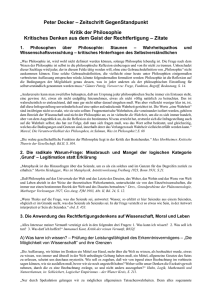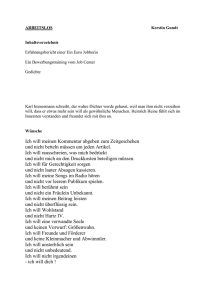Gottes-Anruf - Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt
Werbung

Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
Startseite
Hochschule
Veröffentlichungen
Virtueller Leseraum
Splett: Gottes-Anruf
Jörg Splett
Gottes-Anruf
Über das Wort von Gott (unseres wie seines)
und das Wort zu Ihm
Inhaltsübersicht
Vorwort
Religion: Bezug zum Heiligen
Gotteserfahrung im Gewissen
Gemeinschaft in Gott
»Wo ist nun dein Gott?«
Antwort des Gerufenen: Dank - Bitte - Lob
VORWORT
In dankbarer Erinnerung an ein intensives Wochenende mit Religionslehrern in Fulda (März 1998)
- und mit Dank für den Wunsch der Teilnehmer nach dieser Dokumentation - werden hier die
Grundgedanken des in vier »Einheiten« Vorgetragenen und ebenso sachgemäß wie persönlich
gemeinsam Durchgesprochenen als Arbeitsunterlage auch »Schwarz auf Weiß« vorgelegt.
Hinzugefügt wurde als drittes Kapitel ein Denk-Vorschlag zum Thema Gemeinschaft. Davon war in
den Referaten nur andeutungsweise die Rede. Stärker brachten Diskussionsbeiträge es ein. Es
geht dabei um drei Dimensionen: das Verhältnis von Einzelnem und Gemeinschaft, die
Vermittlung von Gottesliebe und Liebe zum Menschen, schließlich um die Einheit und
Gemeinschaftlichkeit in Gott selbst.
Besonders die dritte Thematik ist lange ungebührlich vernachlässigt worden. Man glaubte vom
ein-persönlichen Gott reden zu können, vergessend, daß 'Person' ein Bezugsbegriff ist. So gerät
man vor die Alternative pan(en)theistischer Verirrung oder des Dreieinigkeits-Bekenntnisses.
Daß Christen, auf den dreieinigen Gott getauft und dies bei jedem Kreuzzeichens bekennend, auf
die Frage, was sie denn da glaubten, nur antworten dürften, das wüßten sie auch nicht, es sei ein
Geheimnis, ging eigentlich zu keiner Zeit an; vollends jetzt nicht mehr, da es wohl - endlich - zum
Gespräch mit den beiden anderen abrahamatischen Religionen kommt.
Eine Weise, der Herausforderung dieses Gesprächs aus dem Wege zu gehen, sehe ich in der
neuen Konjunktur »negativer Theologie« (unter Berufung auf das Bilderverbot, als seien damit
nicht ganz konkret kultische Statuen gemeint). Hier ist an die Wortmeldung H. U. v. Balthasars zu
erinnern, die Bibel kenne keine negative Theologie. (Sie wird im Horizont des Neuplatonismus
nötig, um angesichts eines übermächtigenden Einheitsdenkens und -erkennens die Göttlichkeit
Gottes zu wahren). Nicht von ungefähr, denn zwar kann ich das Eine und ein namenloses
Geheimnis »erschweigen«, nicht aber den Gott und Vater Jesu Christi und sein Heilshandeln an
uns im Geiste (etwas anderes ist das Schweigen im Hören auf einen Anruf, das darum auch
immer wieder Wort wird: von Ihm und zu Ihm).
Was aber das Geheimnis angeht, so sei hier - auch als Lesewink für alles Folgende - nur dies
angemerkt:
Der ursprüngliche Sinn des Wortes ist nicht - wie wohl die meisten denken - Rätsel oder Problem.
Die Vorsilbe 'Ge' steht für Sammlung - so bedeutet 'Gebirge' eine Ansammlung von Bergen,
'Getier' eine solche von Tieren. Die Nachsilbe 'nis' zeigt einen Zustand oder Sachverhalt an, ein
Sein - beispielsweise: 'Wildnis', 'Finsternis'. Die Grundbedeutung von 'Geheimnis' ist demnach:
Gesammelt-Daheim-sein.
Die heutige Bedeutung stammt vermutlich daher, daß die Perspektive der Ausgeschlossenen, der
nicht Aufgenommenen und »Eingeweihten« bestimmend geworden ist. So war etwa »Geheimrat«
jemand, der beim Fürsten und in dessen »Kabinett« daheim, der in Regierungsdinge eingeweiht
war. Für den Außenstehenden trat dann die Unzugänglichkeit der Gemächer, das Nicht-Wissen
des Besprochenen und Beschlossenen in den Vordergrund. Darum meint »Geheimnis« alsbald
nicht mehr, oder kaum noch, das Gewußte und Bewahrte, sondern eher, schließlich nur noch, das
Nicht-Gewußte, Vorenthaltene. - Das muß aber nicht so bleiben, und sollte es vielleicht nicht.
Jedenfalls wäre es gut, dies nicht ganz zu vergessen.
Und ein zweites: Die Heimat umfängt und einbegreift mich; nicht ich vermag sie zu umgreifen.
Könnte ich dies, dann hätte sie eben damit aufgehört, meine Heimat zu sein. Das heißt, daheim ist
jemand nur, wo er vertraut, sich anvertraut, statt aus dem Überblick zu überprüfen. Insofern ist ein
Geheimnis tatsächlich unbegreiflich; aber das heißt keineswegs, es sei unerkennbar.
Erkennen nämlich und Begreifen sind mitnichten dasselbe. Daß man sie häufig nicht
unterscheidet, hängt m. E. mit der Vorreiter-Rolle der exakten Wissenschaften und der Technik
zusammen. Denn hierbei trifft tatsächlich zu, daß einzig der einen Zusammenhang, gar ein
Gesetz, erkennt und versteht, der die Zusammenhänge begreift.
Doch schon bei einem Gedicht ist es anders. Hier gibt es sogar Gebilde, deren Qualität und Größe
uns überzeugt, obwohl wir sie nicht verstehen (so beim späten Celan). Aber nehmen wir »Über
allen Gipfeln ist Ruh...« Dazu (gleichen Sinns bei anderer Wortwahl) K. Kraus: »Kunst ist etwas,
was so klar ist, daß es niemand versteht [= begreift]. Daß über allen Gipfeln Ruh' ist, begreift
[versteht] jeder Deutsche und hat gleichwohl noch keiner erfaßt [= begriffen].« - Bei einem
Geheimnis muß ich ja erkennen, daß mir ein Geheimnis begegnet - statt etwa bloß Unsinn. Sonst
bin ich nicht darin zuhause.
Warum aber sollte ich, was mich birgt und umgreift, als unbegreiflich bezeichnen? Darauf kommt
doch nur jemand, der es irrtümlich zu umgreifen versucht. (Wer z. B. erklärt eine Perle für
ungenießbar - obwohl sie dies fraglos ist? Wer eine Dusche für »unaustrinkbar«?) In diesem Sinn
also will ich vertreten: Geheimnis ist - seinerseits unumgreifbar - jenes Umgreifende, darin
Menschen daheim sind.
Und diese Begriffs-Überlegung finde ich besonders im Blick auf Leben und Person-Würde von
Belang. Person und Person-sein zählen zwar zu den Grund-Geheimnissen unseres Lebens; eben
darum aber, weil wir gleichsam daraus leben, sie uns überall begegnen, all-täglich und
allgegenwärtig, haben wir uns längst schon daran gewöhnt; und das Gewohnte - obwohl vor
Augen - sieht man nicht mehr. So droht hier die Gefahr, das Geheimnis zu banalisieren.
Aus dieser Banalisierung jedoch erwächst die Versuchung, sich dem Gegenüber dadurch
interessant zu machen, daß man sich »geheimnisvoll« gibt. Berühmtestes Beispiel ist
Scheherazade. Sie hat es verstanden, ihren Kalifen tausendundeine Nacht lang zu fesseln. Dabei
ging es - nicht ihr vorzuwerfen - buchstäblich um Leben und Tod. In unserem Alltag mag es
mitunter nicht weniger ernst sein. Dennoch vergesse man nicht: Scheherazade lebt nur im
Märchen.
In Wirklichkeit nämlich ist auf die Dauer kaum etwas lästiger und zugleich langweiliger als ein
sogenannter interessanter Mensch. Denn statt einem Geheimnis begegnet man bei ihm
Problemen, und das ist ganz etwas anderes. Ein Problem quält, solange es nicht gelöst ist, und
wird mit der Stunde der Lösung ähnlich belanglos wie ein ausgefülltes Kreuzworträtsel. Das
Geheimnis aber nährt - so kann man alle Tage Brot essen, nicht aber Torte.
»Für den Liebenden ist man nur wichtig, nicht mehr interessant« (E. Benyoëtz). Und eben dies gilt
vor allem in unserem Gottes-Verhältnis: von uns vor ihm, wie hoffentlich auch von ihm für uns, in
unserem Glauben, Denken und Reden. Auch und gerade vom Geheimnis seiner Dreieinigkeit, in
deren inneres Leben sie uns unbegreiflicherweise hineinrufen wollen.
Ausführlicher siehe: Denken vor Gott. Philosophie als Wahrheits-Liebe, Frankfurt/M. 1996, Kap. 7
(H. U. v. Balthasar: Wahrheit in Herrlichkeit).
RELIGION: BEZUG ZUM HEILIGEN
I. Geschichte
Von ihren Anfängen an hat Philosophie sich auch mit Religion und deren Inhalten befaßt.
Religionsphilosophie aber bildet sich erst seit dem 17. und 18. Jahrhundert in Europa heraus. Bis
dahin war die Philosophie in ihrer Beschäftigung mit der Religion ihrerseits Theo-logie: Lehre von
Gott (den Göttern, dem Göttlichen), ob ablehnend, kritisch oder affirmativ. Im Prozeß der
Aufklärung verschiebt sich die Aufmerksamkeit vom Göttlichen, dem Sein, dem Einen zum
Menschen, der und insofern er sich auf die Gottheit bezieht.
Für Kant sammeln sich die Grundthemen der Philosophie in die eine Frage: »Was ist der
Mensch?« Eine Inversion, die an sich nicht schon dadurch legitimiert ist, daß sie inzwischen
selbstverständlich geworden zu sein scheint. Auch Hegel, wiewohl noch strikt theozentrisch,
erklärt, »daß die Lehre von Gott nur als die Lehre von der Religion zu fassen und vorzutragen«
sei.
Diese Herkunft der Religionsphilosophie aus der Emanzipationsbewegung der Aufklärung hat
Konsequenzen für die neue philosophische Disziplin. Denn im Willen zu »mündiger«
Selbstbegründung aus eigener Vernunft und Vernünftigkeit tritt das Denken in verschärfte
Spannung zu einem Grundmoment von Religion: ihrem Bezug zu Autorität und Überlieferung.
Dies kennzeichnet übrigens auch die sich hieraus entfaltenden, dann sich verselbständigenden
Religionswissenschaften, mit denen die Religionsphilosophie im Austausch steht. (Wobei es
aufschlußreich ist, die Weise, wie Literatur- oder Musikwissenschaftler ihrem Gegenstand
begegnen: insbesondere entschieden wertend und die Hochformen zum Maßstab nehmend, mit
der Einstellung von Religionswissenschaftlern zu Hochgestalten von Religion und zur Frage von
Wahrheit und Rang im Feld des Religiösen überhaupt zu vergleichen.)
Die Faktoren dieser Entwicklung: innerphilosophisch-theologische, wirtschaftlich-gesellschaftliche,
politische, (inter)kulturelle, privat- und wissenschaftsgeschichtliche, sind nicht hier zu erörtern.
Jedenfalls zerbrechen die alten Selbstverständlichkeiten, und damit wird prinzipielle Reflexion =
Religionsphilosophie sowohl möglich wie nötig.
II. Gestalten.
1. Leitende Interessen
Danach läßt sich die Vielfalt dieses Bemühens dreifach gliedern: a) Religionsbestreitung im Dienst
der Freiheit und Selbständigkeit des Menschen; b) Verteidigung der Religion (das heißt zunächst:
des Christentums): Apologetik; c) Erforschung und Untersuchung in theoretisch-wissenschaftlicher
Absicht, anthropologisch, kulturphilosophisch.
a) Die Absage an Religion wird geläufigerweise als »(radikale) Kritik« bezeichnet. Das entspricht
aber nicht dem Wortsinn. Außerdem insinuiert es, Apologetik sei immer und nicht bloß faktisch,
sondern konstitutionell, also von Wesen unkritisch. Es verdeckt, daß tatsächlich der Ursprung
religiöser Kritik in der Religion selbst liegt: bei Propheten, geistlichen Vätern und Lehrern.
Das Nein zur Religion sieht sie als falsches Bewußtsein, untersucht die Ursachen seiner
Entstehung und konzipiert Wege zur Therapie. Als Gründe gelten einmal ungenügende
Naturkenntnis und -beherrschung sowie kulturelle Entfremdung von der natürlichen Sinnlichkeit.
Demgemäß setzt man entweder auf Fortschritt in Naturwissenschaft und Technik oder auf den
Wiedergewinn von Verbundenheit mit der Natur: in sinnlicher Unmittelbarkeit und »natürlichen«
Partner-Beziehungen, anspruchsvoller in der Kunst und im Leben als Kunstwerk. Noch
anspruchsvoller als Kombinationsprogramm: »Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, / Hat auch
Religion; / Wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion.« (Goethe).
Neben die Natur-Perspektive tritt sodann die gesellschaftsbestimmte. Die Ohnmacht der
Unterlegenen, Denk-Angst und bei den Besserwissenden teils Selbstbetrug, teils Mangel an
Zivilcourage, teils wissentlicher Betrug perpetuieren die Fehlvorstellungen. Dann bereiten sowohl
wissenschaftlicher Fortschritt und Aufklärung den Weg zur Humanisierung der Gesellschaft, wie
umgekehrt gesellschaftliche Reformen bzw. Revolutionen die religiösen Vorstellungen überflüssig
machen.
Im Blick auf die zu erwartende oder zu schaffende Zukunft stehen sich unter den
Religionsgegnern zwei Gruppen gegenüber: solche, die größeres Glück und Erfüllung für den
Menschen erhoffen, sei es durch den Wiedergewinn des verlorenen Anfangs (L. Feuerbach), sei
es durch eine ganz neue Mensch- und Übermensch-werdung als Evolutionsziel (F. Nietzsche).
Und solche, die eine desillusionierte, ernüchterte Zukunft vor Augen haben (etwa S. Freud).
Doch sind zum »Ende der Neuzeit«, nach der Moderne, die Entgegensetzungen von Religion und
Natur wie von Religion und Gesellschaft fragwürdig geworden. Nachdem man noch vor zwei
Jahrzehnten das Ende der Religion in der modernen Stadt-Kultur erwartete, stellt sich heute das
zu Ende gehende Jahrhundert geradezu als eines von Religion und Religiosität dar.
(Denkgeschichtlich kann man von einem Siege Schleiermachers über Hegel sprechen.) Dies ist
freilich auch aus religiöser Perspektive nicht bloß positiv zu nehmen, blickt man auf die Breite der
Phänomene von militanten Fundamentalismen bis zu dubiosen Großbetrieben, die aus
juristischen und Steuergründen als »Kirchen« firmieren.
b) Die Verteidiger der Religion antworten in Entfaltung und Verfeinerung einer metaphysischen
Theologia naturalis aufgrund der Vernunftnatur des Menschen. Dabei wird allerdings - zuhöchst im
Deismus und seiner »natürlichen Religion« - die Geschichte vernachlässigt, die (mit Autorität und
Tradition) der Religion wesentlich ist.
Zur objektiv-metaphysischen Begründung (Neuscholastik) treten dann, in Anknüpfung an den
Deutschen Idealismus, transzendental-subjektive Wege (M. Blondel, J. Maréchal, K. Rahner). Sie
wollen Religion als die Ausdrücklichkeit von Grundvollzügen rechtfertigen, die sie als Bedingungen
der Möglichkeit alltäglichen wie wissenschaftlichen Verhaltens (des Urteilens etwa) aufzuweisen
suchen.
Schließlich kommt in unserem Jahrhundert ein existenziell-personalistischer Ansatz dazu, aus der
Krisen- und Umbruchssituation der verheerenden Kriege und ihrer Folgen: im Rückgriff auf S.
Kierkegaard, dialogisch: F. Ebner, M. Buber, F. Rosenzweig, R. Guardini. - Auch diesen beiden
Vorgehensweisen wird Geschichtslosigkeit und Mangel an gesellschaftlichen Perspektiven, an
Gemeinschafts-Bewußtsein vorgeworfen. (Jüngst tritt in Lateinamerika zur Befreiungs-Theologie
auch eine Philosophie der Befreiung; in der ersten Welt zudem - mit verschiedenen Flügeln - ein
feministischer Aufbruch.)
c) Unter Ausklammerung des Für und Wider besteht die dritte Form, im 19. Jahrhundert Geltung
gewinnend, in der empirisch wissenschaftlichen Untersuchung: historisch, soziologisch,
psychologisch, phänomenologisch. Solche Untersuchungen sind als solche und auch in ihren
ersten Auswertungen nicht eigentlich philosophisch im klassischen Verständnis, sondern
religionswissenschaftlich. Doch bedürfen sie eines Religionsbegriffes zur Bestimmung ihres
Forschungsfeldes und seiner Strukturierung. Insofern sie ihn empirisch-induktiv gewinnen wollen,
werden sie ihrerseits Religionsphilosophie - allerdings von nicht geringerer Formalität und
Allgemeinheit als die anderen Formen.
Eine Sonderform ist die analytische Religionsphilosophie. Sie verstand sich als entscheidende
Wende, so daß in ihr alle bisherigen Standpunkte wiederkehren. Nach einer ersten Phase
positivistischer Sinnlosigkeitsthesen arbeitet sie an der methodischen »Klärung« von
Voraussetzungen, Wahrheitsfähigkeit, Rationalität, Begründungs- bzw.
Rechtfertigungsmöglichkeiten religiösen Redens. Sie scheint dabei aber (noch?) jene Frage
auszusparen, die den Religionen selbst von zentraler Wichtigkeit ist: die der Wahrheit ihres
Bekenntnisses, der Wirklichkeit ihres Gegenübers. Müßte so (c) nicht am Ende in (a) oder (b)
münden?
2. Methoden
Darum gliedert man besser nach den Vorgehensweisen. Denn als Disziplin der Philosophie hat
Religionsphilosophie als Erstaufgabe die Entwicklung eines angemessenen Begriffs von Religion,
um von hier aus ihren deskriptiven, komparativen und normativen Dienst für den gelebten, den
wissenschaftlichen wie philosophischen Umgang mit Religion und Religionen zu erfüllen. Hat aber
den die erste Gliederung nicht schon vorausgesetzt? - Auch unter methodischer Rücksicht läßt
sich eine Dreiheit erstellen: apriorisch-deduktiv, empirisch-induktiv, phänomenologisch.
a) Deduktiv geht die Metaphysik vor (was nicht heißen muß: rein apriorisch, im Sinn des Kantisch
verstandenen »ontologischen Gottesbeweises«). Sie bestimmt vom erwiesenen Absoluten, von
dem höchsten Wesen aus die Beziehung des Menschen zu ihm. Ähnlich ein transzendentaler
Einsatz bei den menschlichen Vermögen oder Grundakten, der Religion als Wesens- und
Unbedingtheitsvollzug erschließt. Eine Kulturphilosophie entwirft dasselbe nicht vom EinzelSubjekt, sondern von der Gemeinschaft her. Schließlich wird Religion aus ihrer Funktion - für das
Individuum wie die Gesellschaft - definiert und bewertet. - In all diesen Formen scheint das
spezifisch, »qualitativ« Religiöse als solches nicht berücksichtigt zu werden.
b) Die empirischen Methoden wollen dies leisten. Sie untersuchen »religiös« genannte
Verhaltensweisen: Gebet und Opfer; Unterscheidung und Auszeichnung von Zeiten, Räumen,
Menschen, Dingen und Geräten; die eigene Sprache in Mythos und Kult und besondere
Sprachhandlungen in Kontemplation und Liturgie. Mit der Häufung und Ausweitung des Materials
bis in »Mythen« und »Riten« des Alltags verdünnt sich freilich der Gehalt und dürfte schließlich
nicht allein für normative Zwecke unbrauchbar werden.
c) Die Phänomenologie in der Nachfolge Husserls geht einen dritten Weg. Sie erhebt an konkreten
Vollzügen deren Wesensstruktur und von dort her die Wesensgestalt der ihnen entsprechenden
Zielwirklichkeit, geht also aufdeckend-transzendental vor. Vielleicht darf man davon am ehesten
fruchtbare Ergebnisse erwarten.
III. Probleme
1. Objektivität?
Damit kehrt die inhaltliche Frage wieder. Von woher gilt eine Methode und ein Religionsbegriff als
angemessen? - Einmal sucht man auf dem Boden der Religion selbst ein Verstehen als
Selbstverstehen und aus Einverständnis. Im Gegensatz dazu steht ein außerreligiöses
Verstehensbemühen, wo statt Einverständnis ein Erklärungswille am Werk ist.
Reine Objektivität läßt sich auf keine der beiden Weisen erreichen. Denn der Außenperspektive ist
Religion »eigentlich« etwas anderes, als das religiöse Bewußtsein selbst meint; nämlich z.B.
»Opium«, »Seufzer der Unterdrückten« (K. Marx), Gesellschafts-Stabilisation (E. Durkheim, M.
Weber), Kontingenzbewältigung (H. Lübbe). Eine Innen-Sicht aber schließt den Bestimmenden mit
ein und blickt zudem konkret stets vom Innen einer Religion auf die anderen als von außen.
Bleibt aber reine Objektivität grundsätzlich unmöglich (schon von Begriff und Wortsinn her, da
ohne Subjekt ein Objekt kein Objekt mehr wäre), dann darf sie auch nicht als Ideal-Maß fungieren.
Darum ist der (selbstkritische) Einbezug des jeweils philosophierenden Subjekts in einer
konkreten Religionsphilosophie nicht als subjektiv(istisch) abzuwerten.
Zur Entschärfung des Dilemmas bietet sich die These an, alle Religionen wollten letztlich nur
dasselbe sagen. Doch wenn nach religiös weitgeteilter Überzeugung »alles religiöse Wissen um
Gott ein Wissen auch durch Gott im Sinne der Empfängnis des Wissens selber« ist (M. Scheler),
dann hat man kein Recht, apriori jede solcher Offenbarungen für gleich gültig und gleich
revidierbar, das heißt am Ende, für gleichgültig zu erklären. Wie wären zudem etwa der
Wiedergeburten-Weg einer lebens- und endlichkeits-gequälten Seele ins (von sich und allem Mit)
erlösende Nirwana und die leibhaftige Auferstehung des vom personalen Gott bei seinem Namen
Gerufenen zusammenzudenken?
Wollte man es dennoch versuchen: etwa als »perspektivisch« einander ergänzend, dann wird das
nur möglich, indem man die Thesen als subjektive »Ansichten« versteht statt als Sich-Zeigen
einer absoluten Wirklichkeit, des Heiligen selbst - wenn nicht gar als bloße »Chiffern« (K. Jaspers)
für die beiden gemeinsame Weltflucht. Diese Position aber wäre nicht weniger »dogmatisch« und
»intolerant« als die von ihr abgewiesenen Wahrheitsansprüche der konkurrierenden Religionen.
Die Rede von »dogmatischer Toleranz« bzw. »Intoleranz« entspringt ohnehin einer DimensionenVerwechslung; denn Toleranz kennzeichnet nicht den Bezug zur Wahrheit selbst (sei sie
tatsächlich oder nur vermeintlich erkannt), sondern - im Konflikt der Wahrheitsüberzeugungen - die
Beziehung zum andersdenkenden Menschen. Würde agnostischer Wahrheitsverzicht allgemein,
entfiele sie mit. Bis dahin aber hätte auch der Agnostiker sie dem gegenüber zu üben, der
bekennt, er »wisse, an wen er glaubt« (2 Tim 1, 12), und der darum die eingeschliffene
Entgegensetzung von Wissen und Glauben nicht ohne wichtige Unterscheidungen akzeptiert.
(Beim Substantiv 'Glaube' schon ist die Situation anders als beim Verb.)
Sind also Agnostizismus und Relativismus mitnichten neutral-objektiv, dann gilt das auch von
Versuchen, die unterschiedlichen religiösen Lehren auf »Ansichten« im objektiven Wortsinn: also
auf Aspekte des es-haften Weltbestands oder Weltgrunds zurückzuführen. Es ist in keiner Weise
sachgeboten, sondern entspringt persönlicher Option und Wertung, wenn Autoren die PersonKategorien der Einzigkeit, freier Treue-Zusage und entschiedener Selbst-Festlegung Gottes als
anthropomorph herabstufen gegenüber apersonalen Naturbildern wie Lebensfluß, Energieballung,
Weltmusik oder dem in verschiedenen Wassern je anders gespiegelten einen Mond.
2. Wahrheitsfrage
Die konkrete Antwort auf die Wahrheitsfrage ergeht stets nur innerreligiös, vom Glauben her bzw.
theologisch. Zunächst jedoch ist - so zum Beispiel hinsichtlich polytheistischer Konzeptionen auch Philosophie kritisch zuständig. Religionsphilosophie hat das Wesen von Religion und ihr
»Unwesen« (B. Welte), also die vielfachen Formen von Pseudoreligion und -religiosität zu
unterscheiden. Dieser Begriff gehört - nach Aussparung der philosophisch unklärbaren
Wahrheitsfrage - zur Thematik der Wahrhaftigkeit im Feld des Religiösen. Er meint die
entfremdende Verabsolutierung (»Vergötzung«, Idolatrie) von Begrenzt-Bedingtem (oder auch die
»Totalisierung« des Absoluten, also die Vergötzung Gottes).
Freilich ist kein religiöser Vollzug von Unwesen frei. So muß geklärt werden, ob faktische
Unfreiheiten (bei Individuen, Gruppen, Vollzügen, Strukturen...) innerhalb einer Religion ihr
widersprechen - also von ihr selbst her zu »richten« ( = zu beurteilen wie dann auch zu beheben)
wären - oder ob sie umgekehrt ihr entspringen. Insofern orientiert Religionsphilosophie sich an
dem Hegel-Wort: »Religion ist der Ort, wo ein Volk [ein Mensch, eine Gemeinschaft] sich die
Definition dessen gibt, was es für das Wahre hält.«
So stellt die Grundfrage nach dem Wesen der Religion sich als die bleibende Aufgabe der
Religionsphilosophie heraus, wobei sie - als Philosophie die gemeinsame Sprache von Gläubigen
und Ungläubigen - nach »innen« wie »außen« die religiöse Kern-Wahrheit zu wahren hat.
IV. Begriff der Religion?
1. Der Begriff
Vor der Frage nach dem »Wesen« der Religion: dem, was sie »eigentlich« ist, steht die Aufgabe
der Aus- und Abgrenzung dessen, was auf sein Wesen hin bestimmt werden soll. Zu unspezifisch
ist der Einsatz einerseits bei Letzt-Begründung und Letzt-Bewertung als solcher (P. Tillich:
»ultimate concern«); anderseits bei Dingen, die »den Menschen heilig sind« (Musik, Sport, Urlaub,
Liebe, Vaterland...), gar bloß beim Transzendieren der biologischen Natur durch den
menschlichen Organismus (Th. Luckmann). Zu eingeschränkt erscheint die Bindung an einen
transzendenten personalen Gott. Ungeklärt mehrdeutig zeigt sich selbst das Phänomen Opfer. So
plädiert etwa R. Schaeffler für eine Analyse der Sprache des Gebets. Darin ist transzendierende
Intentionalität wie eine Abhebung vom Profanen enthalten.
Phänomenologische Themenwahl, transzendentale Methodik und sprachanalytische Kriteriologie
wirken so zusammen. Läßt sich eine transzendentale Gotteslehre als hermeneutisches Angebot
an das religiöse Bewußtsein verstehen, dann liefert religiöses Sprechen in Selbstbeteiligung und
Objektivität, in Aussage und Sprachhandlung, in Bekenntnis, Gebet und Erzählung Kriterien des
Religiösen wie seiner Bewertung und erlaubt so die Behandlung der Themen einer
transzendentalen Phänomenologie der Religion.
2. Heils-Suche und Anbetung des Heiligen
Der fast allgemeine Konsens unter Religionswissenschaftlern, -philosophen und Theologen nennt
heute als Grund- und Zielwort von Religion das Heil. Dies schenkt das Göttliche »natürlich« auch und erwartet, daß wir es von ihm erwarten (vgl. Jes 7, 12-15). Wie aber fände man von daher zu
dem Adel jenes Danks, den die große Doxologie der römischen Meßfeier ausspricht: »... wegen
Deiner Herrlichkeit«? Diese ist in der Tat statt despotischen Glanzes gerade sein Gut-Sein, die
Liebe. Doch wird sie unseretwegen (als »Barmherzigkeit«) gepriesen, oder nicht - rein
selbstvergessen - ihretwegen?
Meinte Hegel schon, es sei Sache der Philosophie geworden, Wahrheit(en) zu retten, welche
»manche Art von Theologie« an den Zeitgeist verspiele, dann könnte heute wieder philosophische
Besinnung zur correctio fraterna pastoraler Theologen gefragt sein. Vor und über dem Heil wäre
von jenem Guten zu sprechen, das »anderes ist als retten und gerettet werden« (Platon); vom
Guten, das mehr tut als nur gut (E. Levinas): vom Heiligen. Der Grund- und Zielvollzug von
Religion wäre demnach nicht Überwindung von Endlichkeit, sondern im Selbstüberstieg die
Anbetung des Göttlichen (in der mit Christen und Juden sich muslimische Mystiker finden).
Darin werden in der Zeit (zeitweilig und in »angeldlichem« [2 Kor 1, 22] Vorgriff) schon hier die
Dinge richtig gestellt. Die Welt kommt ins Lot.
Siehe ausführlicher für Begründung und Belege: Die Rede vom Heiligen, Freiburg-München
(1971) 1985; Der Mensch ist Person. Zur christlichen Rechtfertigung des Menschseins,
Frankfurt/M. (1978) 986, Kap. 4 (Religion und Pseudoreligion); Denken vor Gott, Kap. 1 (Über
Religion nachdenken?).
GOTTESERFAHRUNG IM GEWISSEN
Wie ein Leitmotiv zieht sich durch Dostojewskis letzten Roman »Die Brüder Karamasoff« das Wort
Iwans: »vsjo pozvóleno - alles ist erlaubt«, wenn es keinen Gott und kein Leben über den Tod
hinaus gibt. Dies war Dostojewskis eigene Überzeugung, nicht etwa im Blick auf Lohn und Strafe,
sondern auf den Sinn des Lebens überhaupt. Er fragt [den westlichen Ethiker]: »Weshalb ist es
unsittlich, Blut zu vergießen? Wenn ich das Gegenteil behaupte, können Sie mich auf keinerlei Art
widerlegen.«
Jahre später haben Horkheimer/Adorno erneut die »Unmöglichkeit« festgestellt, »aus der Vernunft
ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen.« Und 1970 bekräftigt Horkheimer:
»Rein wissenschaftlich betrachtet, ist der Haß, bei aller sozial-funktionellen Differenz, nicht
schlechter als die Liebe.«
Seine Konsequenz hieraus: »Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht letzten Endes auf
Theologie zurück.« Wie auch er selbst - als Atheist und Moralist, geprägt von Schopenhauer damit umging: das Problem ist unmißverständlich benannt: »die notwendige Beziehung zwischen
theistischer Tradition und Überwindung der Selbstsucht.«
I. Prinzipielle Begründung
Philosophie will erkennen, was ist; und dies aus seinen ersten Gründen. Das Phänomen (= was
sich zeigt), dessen Logos (d. h. Sinn und Grund) nunmehr erhoben werden soll, ist das sittliche
Bewußtsein. Hierbei halte ich die Unterscheidung von Prinzip und Norm einerseits für
fundamental, andererseits für oft nicht genügend bewußt. - Prinzip ist das, wodurch etwas ist
und/oder erkannt wird, im Deutschen: Grund oder Grundsatz. Norm bedeutet wörtlich (norma) das
Winkelmaß; als Handlungs-Regel und -Vorschrift vermittelt sie zwischen der sittlichen Freiheit und
deren Tun.
Grundsätzlich geht es zunächst um die Sittlichkeit selbst: darum, sich überhaupt auf eine sittliche
Betrachtungsweise einzulassen. Prinzipiell soll der Mensch »sich ein Gewissen daraus machen«,
ein Gewissen zu haben und sich ihm gemäß zu verhalten. Wie ist diese Grundforderung zu
verstehen und wie läßt sie sich begründen?
Zu verstehen ist sie als Anruf an Freiheit zur Freiheit, also dazu, wirklich sie selber: Freiheit zu
sein. Anders gesagt: als Appell an ein Selbst zum Selbst-sein oder an Vernunft dazu, ernstlich
vernünftig zu sein. - Auf den auch heute weithin praktizierten Hedonismus einzugehen, hätte sich
damit bereits erübrigt.
Hedonismus (von hedoné = die Lust) besagt das Programm: »Tu, was dir Spaß macht!« Zunächst
schon dürfte einer dies Programm überhaupt nur so lange vertreten, als es ihm Spaß macht, also
gerade nicht prinzipiell. Wie aber sollte und könnte man dann mit ihm diskutieren? Doch
abgesehen davon: wie wollte er selbst - nur unter Spaß- und Lustgesichtspunkten - die
verschiedenen Lüste und Unlüste gewichten? Muß er sich nicht, hat Sokrates gefragt, die Krätze
wünschen, um sich immerfort jucken zu können? Wie schließlich steht es mit dem Lustprinzip bei
menschen-aufbrauchenden Sadisten? - Von Gewissen ist hier keine Rede.
Vielleicht nicht ebenso offenkundig, doch in der Sache ist damit auch der Dezisionismus getroffen,
also (von decído= abmachen, entscheiden) die These, bei der sittlichen Grundwahl handle es sich
um einen puren, irrationalen Beschluß. Am einfachsten kann man das wohl mit H. E.
Hengstenbergs Begriff der »Vorentscheidung« zeigen: Sittlichkeit beginnt damit, daß man für
Sachlichkeit statt Unsachlichkeit optiert. Und nun gilt: Zwar können wir zwischen Sachlich- und
Unsachlichkeit wählen, doch nicht ganz beliebig; vielmehr kann man zur Sachlichkeit sich einzig
sachlicherweise entschließen, und nur unsachlicherweise zur Unsachlichkeit.
Wir hätten also erst Begriffe wie 'vernünftig' oder 'rational' auf »Wissenschaft« zu bornieren, um
mit Popper ausgerechnet das allein Vernünftige, nämlich die Grundentscheidung für Vernunft,
irrational zu nennen. Gewissenhaftigkeit schließt Willkür aus; sie ist vernünftig und darum zu
vernünftiger Rechenschaftsablage gehalten. (Das '-logie' in 'Phänomenologie' verweist auch auf
»logon didónai«, und das heißt »Rechenschaft geben« wie »Grund [und Gründe] benennen«.)
Doch eben vor diesem Anspruch rationaler Begründung warnt man uns heute. Im Blick auf
Scheiterhaufen für Bücher und Menschen durch die Jahrhunderte hin sieht man bei Berufung auf
Wahrheit die Menschlichkeit in Gefahr. Ja, man unterstellt dem Wahrheit-Zeugnis an sich schon
Machtwillen und Herrschaftsdenken.
(So schreibt ein bekannter katholischer Autor, Ordensmann dazu: »Es wird immer Menschen
geben, die auf Grund mangelnder Friedensfähigkeit ihre Gewißheiten für wahr halten - und somit
intolerant agieren.« Dazu meldet sich vorerst die Frage, ob der Verfasser selbst seine
Behauptung, wenn - wie anzunehmen - ihm gewiß, für wahr halte; beziehungsweise, was wir
damit sollen, wenn nicht. Sodann und vor allem möchte ich nicht glauben, z. B. das Urteil:
»Vergewaltigung ist unerlaubt und verwerflich!« halte der Pater höchstens für eine private,
subjektive Gewißheit statt auch für objektiv wahr. Wobei dies Urteil über Taten nicht ohne weiteres
auch schon - wie oft unterstellt - Personen verurteilt.)
Sind damit Lustprinzip und Privatwahl verabschiedet, dann steht für die Erklärung sittlichen
Verhaltens als nächster Kandidat der Utilitarismus zur Begutachtung an (von útile = nützlich).
Gedacht ist hier an wahren Nutzen. (Wir wollen ja Gewissenhaftigkeit verstehen.) Der Nutzen für
möglichst viele, das Wohl für alle. Und dies so, daß man die Einzelnen dabei nicht übergeht;
geschweige denn, daß man sie für ein Ganzes verbrauchte, sei es das Volk, die Partei, eine
Klasse oder die Menschheit, gar Mutter Erde oder der Kosmos.
Der Name »Utilitarismus« werde hierzulande - anders als im Angelsächsischen - oft abwertend
gebraucht. Das will ich nicht tun. Aber hier, wo wir noch nicht nach Normen fragen, sondern erst
nach dem Grundprinzip rechten Handelns, ist zu sagen: Als Grundsatz hebt der Utilitarismus sich
ähnlich auf wie der Hedonismus. Wer das Gemeinwohl von jedem gesucht wissen will, auch um
den Preis privater Verzichte (und ohne die ist es nicht denkbar), doch als Begründung hierfür nur
eben diesen Gemein-Nutzen selbst nennt, der wird dem beanspruchten Einzelnen gegenüber
totalitär. Denn woher ließe sich dann über Recht und Grenzen einer Zumutung an ihn befinden?
Vom Prinzip zu vermeidender Kontraproduktivität her, lautet eine Auskunft. Kontraproduktiv wäre
ein Handeln, das zumindest auf die Dauer und im ganzen mit seinen Ergebnissen verhindern
würde, was es anstrebt: also eine Art von praktischem Selbst-Widerspruch wie etwa Raubbau. Tatsächlich verbietet sich derart selbst-widersprüchliche Praxis - wie jeder Selbstwiderspruch.
Aber macht dessen Vermeidung ein Handeln schon gut?
Kant hat hilfreich zwischen moralischem und bloß legalem Handeln unterschieden. Legal mag
jemand aus Angst, Berechnung, Hochmut und warum noch immer handeln. In gewitztem
Eigennutz würden - so meint er - selbst Teufel etwas derart Prekäres wie Demokratie aufrecht
halten (sie sogar eher als wir, denen Affekte und Kurzsichtigkeit einen Streich spielen würden).
Aber was so funktioniert, sollte dennoch eigentlich nicht sein.
Führe ich damit Moral auf bloße Gesinnung zurück? Keineswegs! Doch ist die Innendimension
hier wesentlich. Es geht nämlich nicht zuerst um äußere Effekte, sondern darum, daß der
Handelnde selber recht und gut sei oder werde. Darum erreicht der Ausschluß kontraproduktiven
Tuns noch gar nicht das Niveau der Sittlichkeit.
Wie aber ließe sich die Ebene bloßer Legalität übersteigen? Es gibt Stimmen - gehört nicht auch
die Dostojewskis dazu? -, die eine Überwindung des Legalitäts-Standpunktes einzig im Glauben
an Gott, vielleicht gar nur im christlichen Glauben für erreichbar halten. - Zunächst wird hierfür
eine Unterscheidung nötig. Eines ist die (»praktische«) Frage, ob der Mensch aus sich selbst,
ohne göttliche Hilfe, menschlich sein könne. Die christliche Theologie erwidert: Nein. Dieser erste
Aspekt der Real-Möglichkeit guten Lebens ist wichtig, vielleicht das wichtigste, doch noch nicht
unser Thema. Wir stellen es bis zur Schlußüberlegung zurück.
Jetzt beschäftigt uns eine zweite (mehr theoretische) Frage: ob ohne Gott sich überhaupt strikter
Gewissensgehorsam verlangen und rechtfertigen lasse. Dies bestreitet der »Theologische
Positivismus«. Konsequent müßte er Atheisten und Agnostiker aus der Gewissens-Verpflichtung
entlassen. Das aber geht nicht an. Und keineswegs (so klang es oft) aus Mißtrauen gegenüber
dem Ungläubigen, sondern gerade aus Respekt vor jedem Menschen. Das wäre selbst Theologen
entgegenzuhalten; fraglos gilt es für den philosophischen Diskurs, der sich der gemeinsamen
Sprache von Gläubigen und Ungläubigen bedient.
Ausgerechnet nun an Kants Philosophie hat Schopenhauer den Vorwurf gerichtet, sie sei
unerlaubt theologisch, nur vom »Mosaischen Dekalog« her begründbar. - Vielleicht spielt derlei
mit, wenn man heute versucht, Kants Moral-Lehre noch entschiedener zu formalisieren und
transzendental-methodisch zuzuschärfen. Dazu dient die sogenannte Retorsion (von retórqueo =
zurückdrehen): es wird gezeigt, daß die Bestreitung des sittlichen Anspruchs seine Anerkennung
voraussetzt. Denn um überhaupt gehört zu werden, muß der Gegner wenigstens vorgeben, er
melde sich aus gebotener Wahrheitsliebe zu Wort.
Die Argumentation ist treffend. Man sollte sie weder steril noch unvornehm schelten oder als
simple »Retourkutsche« abtun. Sie ist auch nicht deswegen schlecht, weil schon seit langem
bekannt. Gegenüber der Prinzipienleugnung bildet sie den notwendigen ersten Schritt. Indes gerät
man vermutlich immer, wo Disput und Argumente nötig werden, unter das eigentlich
angemessene Niveau. Darum steht bei Grundfragen zu Welt, Mensch, Gott über jeder noch so
noblen Diskussion das Gespräch unter philosophierenden Freunden: das Sym-philosopheín.
Für das Retorsionsargument ergibt sich daraus die Frage, ob es außer seiner negativen Leistung,
die Bestreitung der Vernünftigkeit zu treffen, selber positiv das Wesen von Vernunft und Freiheit
treffe. Dafür gilt es nun endlich - nachdem wir verschiedene Deutungen des sittlichen Bewußtseins
angeführt und durchgesprochen haben -, auf es selbst einzugehen. Fassen wir unmittelbar die
Erfahrung ins Auge, die I. Kant als »Faktum der Vernunft« bedacht hat.
II. Selbstverständlichkeit des Guten
D. Henrich hat seinerzeit vier Züge der sittlichen Einsicht benannt, für die er glaubte, auf
Zustimmung rechnen zu können.
Bei dieser Einsicht handle es sich - 1. - nicht um eine bloße Konstatierung, sondern um
ursprüngliche Billigung, wenngleich nicht: Setzung. Wörtlich: »Obwohl das Gute nur in der
Zustimmung sichtbar wird, ist es doch nicht durch diese gut.«
Darum müsse - 2. - das moralische Bewußtsein sehr wohl als Einsicht beschrieben werden statt
nur als Betroffensein - wie etwa in dem fragwürdigen Mitleid Schopenhauers; geht es doch gerade
darum, wie der Mitleidige recht zu handeln habe.
3. sei die Zustimmung eine spontane Leistung des Selbst. Man kann sogar mit Kierkegaard
sagen, erst in diesem sittlichen Ja konstituiere das Selbst sich. Erst und überhaupt im Ernst des
Sittlichen erscheinen Ernst und Würde des Personalen.
Damit aber kommen wir - 4. - aus der Dimension reinen Sollens und Geltens zu jener des Seins.
Im Gewissen begegnet uns ein Du-sollst; doch dies tatsächlich; das sittliche Bewußtsein, soll nicht
bloß: es ist. Ihm kommt Realität zu; und es findet sich in einer Welt, deren Realität eben nicht nur
aus kruden Fakten besteht, sondern ihrerseits sittlich qualifiziert ist. Wörtlich heißt es bei Henrich:
»Die sittliche Einsicht folgt zwar nicht aus einem Gedanken von der Struktur des Seins des
Seienden, ist ohne einen solchen Gedanken aber auch unmöglich.«
Diese vier Punkte: Billigung, Einsicht, Selbsthaftigkeit und Realitätsbezug, möchte ich in eine
Doppel-Aussage verdichten, die das Gemeinte hoffentlich noch klarer herausstellt. Sie betrifft
einmal den Akt gewissenhaften Erfassens, sodann das darin Erfaßte. - Für den Akt des Erfassens
nehme ich einen Vorschlag von R. Lauth, dem Münchener Herausgeber der Fichte-Werke, auf. Er
bezeichnet die Einheit von Einsicht und Antwort, um die es hier geht, mit dem Terminus Sazienz
('sácio' = ergreifen begegnet nur mehr im französischen 'saisir'). Lauth meint damit die aktivpassive, oder vielmehr: die mediale Einheit von Ergreifen und Ergriffenwerden im moralischen
Bewußtsein. Man kann es wohl nicht anders als so kompliziert beschreiben, will man
Fehldeutungen ausschließen; also außer dem Dezisionismus auch den Intuitionismus (von intúeor
= anschauen). Doch der Vollzug ist ganz einfach und ursprünglich: ein Sich-ergreifen-lassen. Im
Gewissen wirkt also nicht Evidenz = rein theoretische Einsicht, erst recht nicht eigene Setzung
und Satzung, sondern das ergriffene Ergreifen eines Geist- und Freiheits-Wesens, das sich hat
ergreifen lassen. - Dies zur ersten Bestimmung: dem Akt des Erfassens. Nun zum zweiten: dem
darin Erfaßten.
Was ergreift das Bewußtsein? - Ihm begegnet, heißt es, das Gute. Was nun ist das? Dies hier
noch nicht als die Frage gestellt, was jeweils gut und recht sei (darum geht es bei den Normen),
sondern: Wovon überhaupt ist die Rede, wenn jemand etwas gut nennt oder wenn er gar (im
Sinne Platons) vom »Guten an sich und als solchem« spricht? - Auch dazu verweise ich auf
Überlegungen Lauths: Die Namen 'Ethik', 'Moral' und 'Sittenlehre' besagen gleichermaßen: Lehre
vom Brauch. Auch wenn man erläuternd hinzufügt: Lehre vom rechten Brauch, wird mit diesen
Bezeichnungen die entscheidende Qualität des Sittlichen nicht ausgedrückt. Dafür erinnert Lauth
an das griechische Wort 'doxa'.
'Doxa' heißt zunächst: Meinung (so ist es Philosophen bis heute geläufig, im Gegensatz zu
'epistéme' = Wissen). Dann aber kennzeichnet es auch die Meinung, in der man bei anderen
steht, also das Ansehen, den Ruhm. Und so wird mit 'doxa' (lateinisch: 'gloria') das biblische
'kabód', die Herrlichkeit Gottes wiedergegeben. Hoheit und Herrlichkeit jedoch sind nun zwei
wesentliche Charaktere der Gewissens-Erfahrung. Lauth schreibt: »... die Hoheit ist sogar ein
ausschließender Wesenszug des sittlich Guten... Die Wissenschaft vom sittlich Guten hieße dann
angemessen: Doxologie.«
Nun ist 'Doxologie' bereits für bestimmte liturgische Texte, für Lobpreisungen in Gebrauch. So
nennt auch Lauth selbst seine Ethik doch »Ethik«. Hat er indes nicht eigentlich recht? - Tatsächlich
kommt erst mit der Hoheit des Doxischen die schlichte Souveränität und das undiskutable
Selbstgerechtfertigtsein jenes Anspruchs zu Wort, der uns im Gewissen begegnet. Hier aber liegt
das Zentrum sittlicher Erfahrung - statt daß es nur darum ginge, richtig zu handeln, geschweige
denn (sei's auch auf Dauer) bloß klüglich.
Die Griechen nannten diese Eigenqualität »kalón = schön«. Sie begnügten sich nicht mit dem
Wort 'agathón = zuträglich, gut', weil sie hierbei zu deutlich den Nutzensaspekt, ein »gut für mich
oder dich oder uns« mitvernahmen. Um den Eigenglanz des Sittlichen herauszustellen, sprachen
sie vom »kalón k'agathón«, dem »Schönen-und-Guten«. - Philosophen wie geistliche Lehrer, von
Platon bis Fichte, von den biblischen Autoren bis H. U. v. Balthasar, haben so immer wieder zum
Bildwort des Lichtes gegriffen, um die innerliche Unbestreitbarkeit des Anspruchs auszudrücken.
Eben dies wollte der Titel über dem jetzigen zweiten Denk-Abschnitt bekunden: die ihm eigene
Selbst-Verständlichkeit des Guten. - Und das hat Kant mit »Faktum der Vernunft« gemeint:
nämlich die Unableitbarkeit des Doxischen und seiner Sazienz von anderswoher, die SelbstUrsprünglichkeit, das Selbst-Recht jener Hoheit, die dem Sittlichen eignet, und der gewaltlosen
Macht, mit der es uns im Gewissen ergreift.
Bekannt ist Kants Ausbruch, mitten in der Analytik seiner praktischen Philosophie: »Pflicht! du
erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir
fassest, sondern Unterwerfung verlangst... ein Gesetz aufstellst, welches... sich selbst wider
Willen Verehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt...« Noch bekannter sein Wort von
der Bewunderung und Ehrfurcht, mit denen zwei Dinge das Gemüt erfüllen, je mehr einer über sie
nachdenkt. »Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.«
Denken und nachdenken muß man freilich, statt sich von modischen Hinweisen blenden zu lassen
wie dem, nicht anders als die Himmelskörper in ihrem nachrechenbaren Wechselbezug sei die
Moral nur ein Ergebnis der Evolution, Produkt der Überlebens-Anpassung. - Wenn es so wäre, wie
stünde es dann (siehe oben: »Retorsion«) mit der Moral eines Menschen, der glaubt, zu dieser
vermeintlichen Einsicht gekommen zu sein? Welche Opfer dürfte man von ihm verlangen?
Und dem zuvor: Inwiefern überhaupt vertritt er sein Urteil als wirkliche Einsicht? Zeigt sich nur
diesmal nicht bloß eine neue Mutation des »kognitiven Apparats«? Ob die These wahr ist, also die
Realität wiedergibt, oder nicht, bliebe allerdings unentscheidbar; denn zur Lebensdienlichkeit
genügt schon irgendeine »Passung« in die Welt, besser: die Umwelt. (Obendrein muß man sehen,
ob die Mutation sich als lebensfördernd herausstellt - statt eher, wie die Mehrzahl, als tödlich.)
Doch das Retorsionsargument genügt, wie gesagt, nicht. Es zeigt die Unumgänglichkeit
moralischen Bewußtseins für den Fortbestand von Kultur-Lebewesen, erst recht für die Entfaltung
von Geist und Freiheit als solchen. Bei der sittlichen Erfahrung aber geht es statt um ein Müssen =
Nicht-anders-Können um ein Sollen = Nicht-anders-Dürfen. Wir können ja anders, wie
allenthalben belegt; doch wir dürfen es nicht: wir dürfen nicht unmenschlich sein. An die Stelle des
Not-wendigen tritt die Sazienz des doxischen Anspruchs.
Diese Erfahrung nun zeigt sich äußerer Begründung weder fähig noch bedürftig. Die Herrlichkeit
des ergreifenden Guten legitimiert sich einfach in ihrem Aufgang. Darum beschränkt ihre Autorität
sich auch nicht auf Theisten noch gar bloß auf Christen. »Gewissen zu haben« definiert den
Menschen als solchen. (Wobei eigens angemerkt sei, daß dies natürlich nicht aktualistisch und
moralisierend gemeint ist - wären ja dann nicht bloß Säuglinge keine Menschen, sondern schon
Schlafende nicht. Die Definition versteht sich grundsätzlich, fachlich gesagt: ontologisch, also im
Sinn eines prinzipiellen Vermögens.) Gewissen zu haben (nicht auch: ihm zu folgen) definiert m.
E. den Menschen unmißverständlicher als das überlieferte »animal rationale«, nicht nur im
Seitenblick auf die künstliche Intelligenz oder die Frage der Tier-Mensch-Unterscheidung. (Seinem
Gewissen folgen würde dann das Menschsein inhaltlich bzw. normativ bestimmen: Menschsein als
Menschlichkeit.)
So steht für die Begründung von gelebter Sittlichkeit und deren Lehre nichts mehr an. Jedenfalls
nicht - vor den konkreten Normenfragen - grundsätzlich. »Why to be moral?« Dazu mag es
genügen, an ein Wort des Aristoteles zu erinnern: Nicht immer, sagt er, seien Vernunftargumente
am Platz, und es gehöre zur philosophischen Bildung, daß man wisse, wo nicht. Wer die Farbe
des Schnees nicht erkenne, bedürfe des Arztes. Und, wörtlich: »Die etwa zweifeln, ob man die
Götter ehren und die Eltern lieben solle oder nicht, haben Züchtigung nötig.« (An anderer Stelle
meint er, weniger harsch, unter Umständen sei schon älter zu werden genug, ob der Schläge des
Lebens.)
III. Theophanie
Ethik begründen - grundsätzlich - können wir weder noch müssen wir es; denn der sittliche
Anspruch begründet sich selbst. Doch sind damit nicht schon alle Fragen erledigt. Statt das
Phänomen begründen zu wollen, könnte man ihm noch besser zu entsprechen versuchen. Und
zwar nicht bloß (praktisch) dem, was es zu tun aufgibt (ohne Zweifel die wichtigste Antwort),
sondern auch (theoretisch) dem, was es zu denken gibt. Nur dieses Zweitwichtigste steht jetzt an.
(Freilich ist auch dies schon ein Tun - und darum zu verantworten.)
Wie und als was also wären Ethik und ihr Kern, das sittliche Bewußtsein, zu verstehen? - Unter
dem Titel Gotteserscheinung formuliere ich die Ausgangsfrage so: Welche Theorie der
Gewissenserfahrung läßt uns diese besser verstehen - ohne sie nur, besserwisserisch, wegzuerklären?
Bei aller beklagten Wissenschaftsfeindschaft haben immer noch »Nichts-anderes-als«-Theorien
Konjunktur: Liebe sei »eigentlich« nur eine hormonale Angelegenheit und Sache frühkindlicher
Frustrationen; Wahrheitswille eigentlich nur Sicherungsbedürfnis, Glaube Ohnmachtsreaktion und
so fort. Dementsprechend wird auch das Gewissen biologisch, psychologisch oder soziologisch
erklärt oder als rationaler Kalkül eines sinnvollen Eigenwohl-Interesses verstanden.
Es leuchtet jedoch ohne Umstände ein, daß keine dieser Theorien den Anspruch eines
Mitmenschen auf unbedingten Respekt vor seinem Gewissensgehorsam rechtfertigen könnte.
Wenn die »Kosten« zu hoch würden, könnte er sich sogar förmlich verbieten.
Nicht, als ob man die genannten Perspektiven übergehen dürfte. Selbstverständlich ist
philosophisch ein Sachverhalt unverkürzt und allseitig zu erfassen. Und zum Gesamtphänomen
des Gewissens gehört außer dem prinzipiellen Anspruch auch dessen Werde-Geschichte:
menschheitlich, gesellschaftlich wie individuell. Doch gehört ebenso dazu, daß einen seine
»Stunde« ruft, sich von solchen Prägungen zu emanzipieren; sich gegen die Normen seiner
Umgebung zu stellen und sich gegen den Druck des Über-Ichs mit den verinnerlichten ElternWünschen zu behaupten. Ist Gewissen doch im Kern statt einer Über-Ich-Funktion ein Ich- und
Selbst-Bestimmen.
Darum gehören die erwähnten Theorien zwar zur Gesamtbeschreibung des Phänomens; doch
nähme man sie als Basis- oder Letzt-Erklärung, hätten sie das Negativ-Ergebnis vorentschieden.
Man würde dem andern in seiner Gewissensnot nicht gerecht. Und zwar darum, weil man der
fordernden Herrlichkeit im eigenen Gewissen nicht mehr ansichtig ist. Man nähme ja dann auch
sich selbst als bloßes Entwicklungs- und Erziehungs-Objekt (oder vielmehr als »Sozialisations«Gegenstand), jedenfalls nicht als ein Selbst und Freiheits-Subjekt.
Fichte beklagte, die Menschen würden sich leichter als ein Stück Lava hinter dem Monde
verstehen denn als ein Ich. Offenbar nimmt man vieles in Kauf, um der Verantwortlichkeit zu
entgehen. Denn sie ist es, die aus der Anerkennung des Ich folgt. Es hat nicht bloß mit sich zu
tun, sondern mit jener Instanz, der es sich verdankt und vor der es im Gewissen sich verantworten
soll. Fichtes jüngerer Kollege Schelling sagt es ausdrücklich: er nennt das Gewissen den
»einzigen offnen Punkt, durch den der Himmel hereinscheint«.
Man könnte zeigen, daß Gewissenhaftigkeit den »Sitz im Leben« und den Kern jedes
Gotteserweises darstellt. (Auch und gerade des sogenannten ontologischen Arguments. Dessen
Ausgangspunkt ist nämlich nicht ein purer Begriff, von dem man dann regelwidrig zur Wirklichkeit
überginge, sondern die Tatsache, der reale Befund, daß in begrenzt-bedingten Menschen die Idee
des Unbedingten und unbedingtes Betroffensein durch dessen Anspruch begegnet.) Auch zur
Hiobs-Frage (die sich hier ja alsbald meldet), steht nochmals Gewissenhaftigkeit an. Sie nämlich
verbietet, das Göttliche - nach dem Vorgang alt- wie neugnostischer Entwürfe - als sakrales GutBöse-Gemisch vorzustellen, statt der Wahrheit die Ehre zu geben. Wäre doch sonst der Mensch
mit seinem Gewissen dem vage-ungeklärten Göttlichen überlegen. - Woher dann der Anspruch,
der ihn als Licht des Heiligen trifft?
Dazu muß man sich der Eigenqualität des sittlichen Bewußtseins öffnen. Um es nochmals auf den
Punkt zu bringen: Zwei Züge sind hier bestimmend: 1. der kategorische Anspruchs-Charakter, das
unbedingte Du-sollst - was nicht auf die (auch dringliche) Erwünschtheit von Werten, also deren
Optativ-Gehalt reduziert werden darf. 2. das lichthafte Selbst-Gerechtfertigtsein des hier prinzipiell
Gebotenen (Liebe, Mitmenschlichkeit...). Es trifft uns eben nicht bloß als äußeres Sollen, auch
nicht nur unumgänglich - dann hieße es tatsächlich besser »Muß« und »Müssen« - , sondern als
das Gute. Das Gute, um das es geht, soll nicht nur irgendwie, sondern unbedingt und schlechthin
sein; und was so ohne Wenn und Aber sein soll, ist nicht irgend etwas, sondern das Gute.
Wie sind nun diese beiden Momente zusammenzudenken? Das gelingt einzig - so die These religionsphilosophisch. Natürlich kann ich die Begründung dafür hier und jetzt nicht mit der
gebotenen Sorgfalt entwickeln. Ein doppelter Hinweis muß uns genügen: 1. kann ein
kategorischer Anspruch nicht bloß allein an Personen ergehen, statt an Unterpersonales; sondern
als unbedingtes Gemeintsein muß er auch seiner Herkunft nach personal sein. Das heißt, er kann
nicht erst vom Hörer als Anspruch vermeint und aufgefaßt werden, er muß dem zuvor schon als
solcher gemeint sein. Aus Fakten, Strukturen, auch aus erfahrenen Werten allein kann, wie
gesagt, niemals ein schlechthin fragloses Du-sollst ergehen; sosehr dergleichen uns berührt und
zu entsprechender Antwort bewegt.
2. ist auf die geforderte Antwort zu blicken. Ich soll nämlich nicht bloß - befehlsgemäß - mich
zwischenmenschlich oder innerweltlich engagieren, sondern ich habe darin zugleich und zuvor
diesem Anruf selbst zu entsprechen, oder richtiger: der Instanz, die mich darin anspricht. Im
Disput soll ich nicht bloß den Gegner achten, wir haben beide »der Wahrheit die Ehre zu geben«.
Der Zeitgenosse wittert hier gleich Fremdbestimmung und blinden Gehorsam. Aber zu Unrecht, ist
das Gebotene doch in sich gut; es wird einsichtigerweise geboten. Gleichwohl begründen nicht
Warum und Weil der Einsicht die fraglose Unbedingtheit des Gebots; denn Begründungen sind
niemals fraglos. - Eben diese Verbindung von Einsichtigkeit und Unbedingtheits-Erfahrung im
doxischen Anspruch wird unverständlich, wenn man nicht von Gott reden will. Entweder muß man
dann den Anspruchs-Charakter bestreiten: im Rationalismus, der höchstens Irrtum kennt, doch
weder ein Du-sollst noch Schuld und Sünde - oder man wird die innere Einsichtigkeit preisgeben
müssen: indem man das gebieterische Moment im Gewissen als Über-Ich deutet und ihm damit
wiederum jede ernstliche Autorität raubt. (Beides zugleich gibt der Dezisionist preis.)
Wird jedoch die Gewissenserfahrung auf den lebendigen heiligen Gott hin verstanden - wie dies
vor allem J. H. Newman ausgearbeitet hat - , dann sieht der Gewissenhafte sich nicht nur von Gott
und seinem Anruf her (»vor dem Herrn«, sagt die Bibel), sondern er richtet sich auch bewußt auf
ihn aus. Und dies nicht bloß zusätzlich, obendrein, sondern grundlegend.
Wer hier Weltflucht, oder doch zumindest Lebensfremdheit, argwöhnen wollte, kann dafür sicher
»fromme« Beispiele nennen; er täuscht sich gleichwohl. Den »barmherzigen Samariter« zum
Beispiel treffen Anblick und Hilferuf des Überfallenen unmittelbar; dazu bedarf's keiner
himmlischen Stimme. E. Levinas spricht vom »nackten«, hilfeflehenden Antlitz, das mich in
Beschlag nimmt, und weigert sich, es als religiöses Symbol, als Weg zu Gott aufzufassen. Er
warnt zu Recht. - Aber dürfte der Helfer, wenn er an Gott glaubt, nicht mit diesem seinem Gott sich
um den Hilflosen kümmern? Und das keineswegs »aufgesetzt« und verstiegen, sondern schlicht
aus gelebter Gott-Verbundenheit heraus.
IV. Normenfragen
Doch kommen wir wieder zur Theorie-Diskussion, und zwar - nach dem prinzipiellen Disput - zur
Erörterung der Normenproblematik.
Erst jetzt - während die gegenwärtige Diskussion, obwohl großen Teils von Theologen geführt,
sich m. E. zu sehr auf das äußere Handeln beschränkt, also darauf, Normen zu finden und zu
begründen, während doch erstlich und bleibend Prinzipienfragen anhängig sind. Dabei wird
vergessen, daß das erste »Objekt« eines Handelnden dieser selbst ist. Ob es mir gelinge, mein
Gegenüber zu übervorteilen, zu belügen, oder nicht: auf jeden Fall habe ich damit ein Stück weit
mich zu einem Betrüger und Lügner gemacht. - M. Blondel: »Das Schlimmste liegt vielleicht nicht
darin, daß wir unsere Taten nicht ändern können, sondern darin, daß unsere Taten uns ändern, so
sehr, daß wir uns selber nicht mehr ändern können.«
Bezüglich nun der Normen-Problematik selber glaube ich auf ein zweites Versäumnis hinweisen
zu sollen: wieder zuerst bei Moraltheologen, doch auch bei Kollegen vom philosophischen Fach.
Ich meine die weithin übliche »Horizontalisierung« der ethischen Diskussion, also die
Ausblendung ihrer Vertikal-Dimension. - Nicht erst fachtheologisch sollte doch gelten: Ist Gott (ja
schon: Ist möglicherweise Gott), dann bestehen für das Geschöpf auch Pflichten ihm gegenüber;
und zwar sowohl für Einzelne als auch für Gruppen und Gemeinschaften. Sollte es wirklich ganz
folgenlos für das menschliche Miteinandersein bleiben, wenn man diese Pflichten verkennt? - Was
nicht etwa göttliche Gekränktheit meint oder, Gott bedürfe unseres Lobes. Es steht nur an, »der
Wahrheit die Ehre zu geben«. Und dann denke man - nach den Worten Blondels - an die
Rückwirkung von Fehlverhalten auf uns selbst.
Im biblischen Kontext wird der Sachverhalt durch die enge Verbindung der beiden Hauptgebote
zum Ausdruck gebracht. »Liebe Gott aus ganzem Herzen, mit all deinen Kräften... und sei dem
Nächsten gut wie dir!« Formalisiert könnte man dies zunächst so lesen wollen: 1. Triff die sittliche
Option! Mach dir - vor allem anderen und unbedingt - ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu
haben und ihm zu folgen! 2. Sei aufgrund dessen strikt unparteilich (B. Schüller), d.h., ziehe nicht
dich vor, bloß weil es du bist! - Das ist wichtig; die Welt sähe anders aus, hielten sich genügend
Menschen daran. Und doch wird es dem Anspruch nicht gerecht.
Das zweite Gebot nämlich spricht nicht bloß das Minimum zu vermeidenden Unrechts an, auch
nicht allein positiv die »goldene Regel«: Was ihr wollt, daß euch die Menschen tun, das tut auch
ihnen! Denn wir sollen - um es ausgerechnet mit dem rigorosen Kant zu sagen - »alle Pflicht
gegen [den Nächsten] gerne ausüben« (wobei die Hervorhebung von ihm stammt). Wir sollen den
Nächsten wie uns wirklich bejahen, ihm nicht nur Gutes tun, sondern gut sein, ihm selbst.
Erst recht geht es im ersten Hauptgebot nicht nur um eigene Gewissenhaftigkeit, Redlichkeit,
Identität, sondern um Antwort. Gewissen ist - hieß es - die Stelle der Sazienz des Heiligen. - Was
uns ergreifen soll, ist eben nicht zuerst die eigene Verfaßtheit: daß wir uns wohl fühlen (gar in
»narzißtischer Homöostase«). Heilig soll uns das Heilige sein: das Doxische.
Es geht die Rede, in allen Bereichen des Geistes sei heute der Gedanke des Unbedingten
unvollziehbar geworden. Sokrates, auf den die Philosophen sich respektvoll und mit Stolz berufen,
hätte zu derlei bemerkt: »Was 'in' oder 'out' sei, weiß ich nicht; auch nicht, wie ernst und
kompetent die Mehrheit, also man, darüber nachgedacht hat. Aber fragen doch zu dieser Stunde
wir uns, du und ich, ob wir persönlich verstehen und vertreten können, was als heutiger Standard
auftritt.«
In diesem Sinn sollte der Einzelne gewissenhaft selbst den Begriff des Heiligen, des Unbedingten
prüfen. Und im gleichen Sinne ist hier von Gott ohne Artikel und Anführungszeichen die Rede.
Nicht, als wechselten wir ins kirchlich-dogmatische Feld; wir bleiben auf dem gemeinsamen
philosophischen Boden. Auf ihm jedoch sollte auch Platz für philosophische Theologie sein; dieser
Name, von Platon eingeführt, ist älter als die theologischen Fakultäten mit ihren Fächern.
Wenn schon anthropologisch, philosophischerseits, Moral und Gewissen nicht verständlich
werden ohne den Gottes-Bezug, dann stellt sich bereits innerethisch ein Problem, das man in
diesem Fach so gut wie nie behandelt. Es ist - über die Nennung der beiden Hauptgebote hinaus die Frage, wie sich nun die Liebe zu Gott und die Menschenliebe zueinander verhalten. Sie sei
auch jetzt nicht be-, nur angesprochen; mit der Zusatzbemerkung, daß weder Gott für den
Menschen noch dieser für das Gottesverhältnis zum Mittel herabgesetzt werden darf. Daß also die
Lösung wohl nur in jenem Mit liegen kann, von dem schon kurz die Rede war: beim Samariter, der
sich mit Gott um den Verletzten bemühte (um sich später vielleicht in Gemeinschaft mit ihm an
den Gott Abrahams zu wenden? Siehe dazu das Folgekapitel).
Jedenfalls wird auch in solch theo-logischer Deutung das Gewissen nicht etwa einfach zu Gottes
Stimme erklärt. Wie nämlich könnte es dann irrige Gewissen geben? Newman präzisiert sich
dahin, vom Echo der Stimme zu sprechen. Und zum Ausdruck »Stimme« überhaupt wäre aus
Heidegger-Lektüre zu ergänzen: »Das Gewissen redet einzig und ständig im Modus des
Schweigens.« - Darum verfängt es so wenig, dagegen anzudisputieren. Die »Stimme« sagt gar
nichts. Schweigend konfrontiert sie mich mit mir selbst. Dies das eine.
Sodann ruft hier das Göttliche erst nur zum »Gewissenhaben« als solchem. Bloß formal ist das
zwar nicht - so wenig, wie etwa Farbe, obzwar formal im Blick auf Rot oder Grün, gegenüber
Geruch und Geschmack nur formal ist. Der Anruf und die Einwilligung, moralisch zu sein, haben
durchaus Gehalt und Gewicht. In klassischer Sprache ist damit die syntéresis (lat.
synterésis/synderésis) angesprochen: das Prinzipien-Gewissen, auch »Seelenfünkchen« genannt.
Damit allein wird Sittlichkeit nicht real; doch ohne es steht man noch nicht auf sittlichem Grund.
Und zugleich sind es gerade die Synteresis, das Grundgewissen, und die ihm entsprechende
Grundgewilltheit zum Guten, welche auf reales Handeln drängen. Wieder mit den alten Begriffen:
die Synteresis konkretisiert sich im Gewissen als consciéntia. Unter dem Licht des GrundAnspruchs ist von Einzel-Normen zu handeln.
Dafür gilt nun erstlich, daß der »Funke« und das Licht in ihm bei allen Fragen ausnahmslos und
unumgänglich maßgebend bleiben. Das Prinzip darf hier nicht etwa bloß als Ausgangspunkt
gelten, den der Alltag dann hinter sich läßt - nach dem Motto: »Im Prinzip ja, doch nicht eben hier;
was theoretisch stimmen mag, taugt nicht für die Praxis.«
Wer aus Angst vor dem »Terror der Wahrheit« sich mit Poppers »piecemeal engineering«
begnügen wollte, ist damit keineswegs schon vor menschenfeindlichen Prozeduren bewahrt. Im
Gegenteil ist es an sich schon menschenundwürdig, jemanden zum Objekt hypothetischer
Praktiken in »Versuch und Irrtum« zu machen. Darüber hinaus kann man technischwissenschaftliche Vorgehensweisen auf ihrer eigenen Ebene nicht wirklich durchgreifend
kritisieren. Sie ließen sich höchstens als unrentabel oder unpraktikabel erweisen. (Was etwa
spräche unter dem Projekt der »Lebensqualität für alle« gegen die schmerzfreie Tötung von
Behinderten, verwirrten Alten, ja jedes ungeborenen Drittkinds?)
Das Gute ist eben nicht bloß ein Mangel an Bösem - so wenig, wie etwa Sinn im Fehlen von
Unsinn besteht oder der Nicht-Widerspruch allein schon Wahrheit verbürgt. Darum dürfen
Normenüberlegungen das Licht der Wahrheit niemals bloß »im Rücken« haben; sie müssen in ihm
geschehen. Und darum stehen sie auch nicht einfach außerhalb der religiösen Dimension. (Man
könnte an den Satz M. Schelers denken, das Opfer sei die Moral der Religion wie die Religion der
Moral - oder an das Goethe-Wort von der dreifachen Ehrfurcht.)
Zugleich aber liegt eben hier auch der Grund, warum konkrete Normen nicht sogleich als göttliche
Gebote propagiert werden sollten. Das liefe rasch auf Fundamentalismus hinaus. Zu appellieren
ist vielmehr an die Selbständigkeit des Menschen, an Mut und Phantasie des sittlich-religiösen
Gehorsams.
Dafür nochmals Schelling: Die Bindung des Ich an das Licht bezeichnet er »der ursprünglichen
Wortbedeutung nach« als Religiosität. »Wir verstehen darunter nicht, was ein krankhaftes Zeitalter
so nennt, müßiges Brüten, andächtelndes Ahnden oder Fühlenwollen des Göttlichen. [So 1809!]
Denn Gott ist in uns die klare Erkenntnis oder das geistige Licht selber... und in wem diese
Erkenntnis ist, den läßt sie wahrlich nicht müßig sein oder feiern.«
Die Vagheit einer bloßen Religiosität verbietet sich gerade aus Gewissensgründen. So das nur zu
durchsichtig wolkige Glaubensbekenntnis Fausts: »Wer darf ihn nennen... Gefühl ist alles; Name
ist Schall und Rauch« (»in ewigem Geheimnis« webend, während der Herr Doktor eine junge Frau
zugrunde richtet). - Bin jedoch im Ernstfall eben ich gefragt (wär's auch nur darum, weil sonst
niemand da ist) - und nennt Levinas uns die einzig richtige Antwort: »me voici - hier bin ich«, dann
erhalte ich gerade daraus meinen Namen. Und der ist statt Schall und Rauch dann »Wort und
Feuer«.
So der Kernsatz in F. Rosenzweigs Stern der Erlösung. Der aber zielt im Namen des Gerufenen
auf den »seines« Gottes: Gottes, insofern er diesen Menschen beruft. (Die Dornbusch-Stimme:
»Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«, wiederholt das Wort »Gott«
nach rabbinischer Lehre, weil der Heilige jedem der Väter sich auf eigene Weise zugewandt hat.)
Stehen wir damit wieder beim Eingangs-Satz Dostojewskis? Unser Feld ist nicht faktische Empirie,
also Befragungs-Ergebnisse zur Verbindung von Frömmigkeit und Kirchlichkeit mit sittlichem
Verhalten. Es bleibt jedoch die Sinn-Frage, die Unabdingbarkeit von Sinn-Bewußtsein für
verantwortliches Verhalten.
Verantwortliches Verhalten: damit werden Prinzipien-Reflexion und Normen-Disput auf Gesinnung
und Haltung hin überstiegen. Das spricht die vermißten Tugenden an. Die werden eher durch
Modell-Geschichten (wie vom Samariter) nahegebracht als durch Begründung. Hält man dem
entgegen, solche »Predigt« stoße oft ins Leere, so läßt sich erwidern, normative Ethik stoße rasch
an ihre Grenzen (vollends, wenn sie sich auf Güterabwägung bei Handlungs-Folgen beschränkt).
Nicht alles kann man theoretisch normativ im voraus klären, gerade in Zeiten des Umbruchs,
neuer Aufgaben und Möglichkeiten wie den unseren. Darum ist die Haltung aufrichtiger
Verantwortlichkeit gefragt - und eine Ethik, die sich nicht nur Normen widmet.
»Liebe und tu, was du willst!« Augustinus hat recht. Allerdings sollte man ihn richtig zitieren. Nicht,
wie häufig: ama et fac quod vis, sondern: »Dílige et quod vis fac!« Amáre besagt: mögen, mit dem
Gegensatz: odísse = hassen; dilígere heißt: hochschätzen anstatt neglégere = verachten. Dilige et
quod vis fac sagt also: Schätze hoch, und was du dann tun willst, das tu!
V. Unglück und Hoffnung
Vor einem Menschenalter hat H. U. v. Balthasar geschrieben, unsere Zeit sei eine tragische
Epoche; denn sie müsse »gleichzeitig beides einsehen: daß auf der Welt zuletzt nichts anderes
sich verlohnt (weil nichts anderes da ist, wofür man sich einsetzen kann) als der Mensch - und
daß der Mensch sich letztlich doch nicht lohnt.« Dies erkläre »den offen oder verdeckt bittern,
zynischen oder süßlich faden oder sanitären... Beigeschmack« der verschiedenen Humanismen.
Erklärt es nicht auch die inzwischen gehäuften menschenfeindlichen Statements von
Naturfreunden und Biophilen? Jeder sei feil; der Mensch das Ungeziefer der Erde, ein Untier...
Woher dieser bohrende Groll, die geradezu wollüstige Selbstabwertung und Herabsetzung des
Menschen? - Dostojewski sieht es als Konsequenz einer gottfernen Humanität. Zunächst empöre
den Philanthropen seine Ohnmacht vor dem Schicksal von Volk und Menschheit. Er fühle sich
»stellvertretend für die ganze Menschheit gekränkt, und... das tötet in ihm seine Liebe zur
Menschheit«, ja kann sie »in Haß verwandeln«.
Die Humanisten, meint er, stehen vor einem Dilemma. Den Menschen, die Menschheit, könne auf
Dauer nur lieben, wer an die Unsterblichkeit der Menschenseele glaubt. Andererseits ist die Liebe
zum Nebenmenschen kaum leichter, da »das Gesicht eines Menschen nicht selten diejenigen,
welche im Lieben noch unerfahren sind, zu lieben hindere.« - Das äußerste wäre dann, der
Enttäuschung über den Schöpfer entsprungen (doch nicht nur daraus), der Haß auf Gott selbst.
Innerlicher als bei Lohn und Strafe und ernster als im Blick auf zu erreichende Vollkommenheit
(wie es Kant sah) gehören die beiden Kantschen Fragen »Was soll ich tun?«, »Was darf ich
hoffen?« zusammen. Damit auch Sittlichkeit und Religion. Besonders eng (und darum besonders
energisch verdrängt) in jenem Punkt, da die Ethik den Menschen vollends im Stich läßt: Sie, die
mir sagt, was ich tun soll, verstummt auf die Frage »Was tun?«, wenn ich - aus freien Stücken nicht getan habe, was ich tun sollte.
Wird so das nach Nietzsche stärkste Motiv zur Leugnung Gottes nicht zugleich der stärkste
Beweggrund für das Verlangen nach ihm? Zunächst kann man Nietzsche ja nicht widersprechen:
»Vor der Moral... muß das Leben beständig und unvermeidlich Unrecht bekommen, weil Leben
etwas essentiell Unmoralisches ist.« Vorher schon hatte Hegel das moralische Bewußtsein als das
unglückliche bezeichnet. - In der Tat: wo jemand soll, da soll er anders werden, als er ist; er ist
demnach nicht so, wie er sein soll. Es war deshalb niemals bloß ein Bonmot, daß ein gutes
Gewissen an sich ein schlechtes sein müsse.
Dies nach beiden Seiten gelesen. Mag einerseits nämlich das »sanfte Ruhekissen« nur ein dickes
Fell sein, so bedenkt andererseits ein waches Gewissen mehr als das getane Böse das
unterlassene Gute. Und auch in dem günstigen Fall, wo angesichts einer Beschuldigung mich
mein Gewissen freispricht, nennt es mich nicht gut. Anders gesagt, eine Ist-Soll-Bilanz entdeckt
den Menschen nicht bloß am gleichsam wertfreien Null-Punkt, sondern im Minus. Und dies
mathematische Bild erweist sich sofort als verbotene Banalisierung. Bei ernstlicher Schuld ist das
Dasein nicht einfach sinn-los geworden, sondern potenziert sinnwidrig.
Dies nun vor Gott. Der Ruf »Adam, wo bist du?« wirkt in der konkreten Situation tatsächlich
vernichtend. - Dennoch erwacht hier eine erstaunliche Gegenbewegung. Der Mensch versteckt
sich nicht bloß - »Staub und Asche«, »Sünder« - vor dem Heiligen; er flieht zu ihm: wider alle
Hoffnung neues Leben hoffend.
Bewußt habe ich nicht dies zum Ausgangspunkt eines Gotteserweises genommen; denn für sich
ergäbe es wohl nur ein Wunschargument. Doch davon schweigen hieße, die Wahrheit des hier
Bedachten verkürzen. - Reue, Umkehr, »Revolution in der Gesinnung«, sollten sie dem
Schuldigen von ihm aus möglich sein, machen die Schuld nicht gut. Kein Bessermachen vermag
das. Könnte man sie also einfach geschehen sein lassen, um sie im Lauf der Zeit zu vergessen?
Hätte man sie gar, wie ein großer Ethiker vorschlug, »in Ehren zu tragen«?
Wie vorher zur der Vertikalen stellt sich jetzt zur Ausblendung von persönlicher Schuld in
akademischen Ethik-Diskursen und psychologischen Heils-Angeboten die Frage nach deren enthumanisierenden Konsequenzen. Gibt es nämlich keine Vergebung - und deren einziger Ort ist die
Religion als Gottes-Bezug - , dann muß man geradezu nach Entschuldigung suchen, also zeigen:
Ich war es nicht, und eigentlich nie. Das aber bringt ein Doppeltes ein: 1. Beschuldigung anderer;
denn irgendwer ist es gewesen; 2. Selbst-Entmündigung; denn war ich's nie, dann bin ich offenbar
gar nicht verantwortlich: nicht zurechnungsfähig.
Müßig die Frage, was von beidem das schlimmere sei; führt doch eines wie das andere zur
Abschaffung wahren Mensch-seins. Wie so oft rettet auch hier uns gewiß immer wieder glückliche
Inkonsequenz. Doch mag das Leben diesen Ausweg bieten, die Philosophie läßt ihn nicht zu. Also
im Ernst wohl doch auch nicht das Leben?
Gelänge es selbst Menschen (nicht bloß Teufeln), sich rein legalistisch zu arrangieren,
grundsätzlich gilt: Ohne Gott sind wir alle entweder (so, wie wir leben) hoffnungslos schuldig oder
seit je schon entschuldigt.
*
Wäre so oder so aber dann nicht tatsächlich »alles erlaubt«?
Ausführlichere Begründung und Belege: Spiel-Ernst. Anstöße christlicher Philosophie,
Frankfurt/M. 1993, Kap. 2 (Warum menschlich sein [sollen]?); Der Mensch ist Person, Kap. 1 und
2 (Mit-Menschlichkeit aus dem Glauben, Gewissen - Ernst der Menschlichkeit); Gotteserfahrung
im Denken. Zur philosophischen Rechtfertigung des Redens von Gott, Freiburg-München (4. Aufl.)
1996 (bes. Kap. 4: Gottesbeweis Mitmenschlichkeit).
GEMEINSCHAFT IN GOTT
I. Bezug und In-sich-Stand
Beziehung ist für das antike Denken die wirklichkeitsärmste Kategorie. Sie gehört zu jenen
Grundbestimmungen, die in der lateinischen Fachsprache accidéntia heißen: 'Zustand,
Zuständlichkeit'. Gemeint ist ein bestimmtes Wie- beziehungsweise So-Sein, das einem
Gegenstand zufallen mag - oder auch wieder fortfallen kann, um einem anderen Zustand dieses
Gegenstandes Platz zu machen.
Unter solchen So-seins-Begriffen ist nun Bezogen-sein offenbar jenes Wie, über das ein Ding am
wenigsten verfügt und das am wenigsten ihm selber zugehört. Soll ein Tisch beispielsweise statt
rot schwarz sein, muß man ihn umstreichen; dem Tisch hingegen, den ich augenblicklich vor mir
habe, muß ich nur den Rücken zukehren, damit er - ohne die geringste Änderung an ihm selbst nunmehr hinter mir steht. Das macht verständlich, warum die antiken Denker der BezugsKategorie einen so geringen Rang zuerkennen.
Nun gibt es nicht bloß derart äußerliche Beziehungen wie das Vor- oder Hinter-jemandem-Stehen.
Spricht man zum Beispiel von Bezugs-Person, dann kommt ein Verhältnis zur Sprache, das für
den Abhängigen von hoher Bedeutung sein kann, vielleicht gar lebens-bedeutsam. Doch muß das
Verhältnis solch ein Gewicht auch für die »Bezugsperson« selber besitzen? Vielleicht ist ihr diese
Situation nicht einmal bewußt. Liegt es nicht jedenfalls an ihr, wie weit sie »die Sache« bzw. den
anderen Menschen »an sich heranläßt«? Sie selbst muß sich nicht durch diesen Bezug
»definieren«.
Wiederum in der Sprache der klassischen Philosophie: Volle Realität und Wirklichkeit:
»Seiendheit« hat das in-sich-stehende Ding, die substántia. Ein solches Etwas nun kann mehr
oder weniger selbständig sein, ja in bestimmtem Sinn sogar mehr oder weniger es selbst. Der
genannte Tisch beispielsweise ist nicht für sich selbst dieser Tisch, sondern nur (Hegel) »an sich«:
»für uns«. Anders schon bei einer Pflanze, erst recht einem Tier. Diese Wesen sind nicht bloß für
andere, sondern auch in gewissem Maß »an und für sich« und durch sich selber sie selbst. Sein
Vollmaß erreicht solcher Selbstand, wo ein Selbst in Bewußtsein und Freiheit über sich bestimmt.
Dann ist es nicht bloß Substanz, sondern Subjekt.
Für einen so gefüllten In-sich-Stand hat sich im Lauf theologischer Diskussionen - um die Trinität
und um ein angemessenes Verständnis der Wahrheit und Wirklichkeit Jesu Christi - das Fachwort
Person herausgebildet. - Da wir jetzt keine dogmatische Theologie treiben wollen, nur dies, daß in
unserer Frage die Theologie der Philosophie eine erhebliche Denkaufgabe gestellt hat. So wurde
die Philosophie dazu gebracht, ihr Begriffs-Besteck zu höchster Feinheit zu schärfen.
Die Herkunft des Worts liegt im Dunkel. (Die antike Etymologie: personare = durchtönen,
vernachlässigt, daß Persona ein langes, personare ein kurzes o hat; im Mittelalter las man ein
»per se una« heraus; und auch der neuere Rückgriff auf das etruskische Phersu ist kaum haltbar).
Die Wort-Bedeutung war ursprünglich »Maske«; daraus: Figur, Charakter - auf der Bühne, in der
Literatur wie im Leben. Sodann bezeichnet Person den individuellen Träger einer
gesellschaftlichen Rolle. Daraus wurde nun der philosophisch-theologische Begriff, geprägt durch
die Definition des Boethius: »naturae rationalis individua substantia - vernunftbestimmtes
Einzelwesen«.
Ausgerechnet für den vorgesehenen Zweck war diese Bestimmung zwar nur schlecht geeignet macht sie doch fast unvermeidlich aus der Lehre von drei göttlichen Personen einen Tritheismus.
Dennoch hat sie sich bis heute als klassisch behauptet. Das aus theologischem Interesse
Erarbeitete etabliert sich in der Folge als eine genuin philosophische Thematik. Person wird zum
Namen für Freiheit, Selbstbewußtsein und Selbstzwecklichkeit; das Wort meint ein Wesen von
Würde, dem - unabhängig von seinem gesellschaftlichen wie charakterlichen Wert und Unwert unbedingte Achtung gebührt.
Kant: »... vernunftlose Wesen [... haben] nur einen relativen Wert, als Mittel, und heißen daher
Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als
Zwecke an sich selbst, d. i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf,
auszeichnet...«
Zeugt es nun schon von Un- und Mißverstehen, wenn man die überkommene Lehre von der
Substanz als »Klötzchen-Denken« verunglimpft, dann verdoppelt die Inkompetenz sich bei
ähnlichen Urteilen über den klassischen Person-Begriff. Nicht bloß ist ein Selbst, das für sich
selbst ein Selbst ist, kein Klotz, sondern Vollzug, als Selbstvollzug; obendrein sagt Vernunft:
prinzipiell uneingeschränkte Aufnahmefähigkeit.
Trotzdem muß man sagen, daß dieser Bezugs-Aspekt hinter dem der Selbständigkeit zurücktrat.
Das Für-andere-sein bleibt durch die Denkgeschichte hin im Schatten des Selbst-Seins,
sozusagen unterbelichtet. Und abgesehen von dieser grundsätzlich »theoretischen« Frage gilt
dies erst recht im Blick auf Leben und Praxis. Hier hat sich in der europäischen Neuzeit ein
liberaler, nein: liberalistischer Individualismus durchgesetzt, der nicht bloß etwa auf Afrikaner als
Verarmung des Menschlichen wirkt.
II. Individualismus - Kollektivismus
Damit gerät das Thema »Person« und bestimmter: »Person in Bezug« in die Spannung zwischen
den Extremen Individualismus und Kollektivismus.
Indem der Einzelne sich als ein Individuum - griechisch: Atom - versteht, sieht er sein Wohl
zumeist im Gegensatz zu dem der anderen; jedenfalls erhält es einen »defensiven Charakter«. Er
glaubt sein Wohl verteidigen zu müssen. Zwar kann er gänzlich ohne andere nicht leben,
Gemeinsamkeit mit anderen zeigt sich darum als unvermeidlich; doch es erscheint nicht als innere
Qualität der Person. Nur eins unter vielen zu sein stellt eine Last, das Dasein der anderen eine
Belästigung dar; Sein und Leben anderer und die Gemeinschaft als solche besagen Schranken.
K. Wojtya: »Die 'anderen' sind für das Individuum nur die Quellen von Beschränkungen, ja sogar
der Pol vielfacher Widerstände. Wenn eine Gemeinschaft entsteht, dann nur zu dem Zweck, um
das Gut des Individuums inmitten dieser 'anderen' zu sichern. Das ist in lapidarer Kürze der Abriß
des individualistischen Standpunkts.«
Wie aber steht es dann mit unserer Hoffnung auf Freiheit und Frieden? Sollten wir das »Recht«
des Stärkeren propagieren, zu gewaltsamer »Befriedung« im Dschungel eines pausenlosen
Kampfes aller gegen alle? Darauf könnte sich nur einlassen, wer wüßte, daß er jeweils der
Stärkere sein wird; dem Schwächeren bleibt dann nur, resignierend »auszusteigen«. - Also muß
man die Grenz-Garantien von Recht und Gesetz akzeptieren: nach dem Prinzip, die Freiheit eines
jeden Einzelnen auf jene Bedingungen zu beschränken (Kant), »unter denen die Willkür des einen
mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt
werden kann«, im Recht als Gesetz »eines durchgängigen wechselseitigen Zwanges«.
Aus einem solchen Verhältnis nur »der Willkür zur Willkür« jedoch kann nicht wahrer Friede
erwachsen, jener, den Augustinus als »Ruhe der Ordnung« gekennzeichnet hat. Einmal aus dem
Grund nicht, weil das Prinzip der Gleichheit aller vor dem Gesetz auf die faktische Ungleichheit
der Menschen trifft. Also wird jede Rechtsordnung Gründe zur Unzufriedenheit bieten, die
Versuchung zur Revolte für jene, welche sich zu kurz gekommen sehen. Sodann insofern, als das
Recht grundsätzlich als ein Zwangsverhältnis besteht. Zum Frieden fände man daraus erst, wenn
die Sphäre des bloßen Rechts in die der Moral »aufgehoben« würde.
Wo die Individuen bloß um des eigenen Überlebens willen in wechselseitige Zwänge einwilligen,
bleibt ihre Aufmerksamkeit ständig durch angstvollen »Grenzschutz« gefesselt. Verstünden sich
aber die Menschen als moralische Wesen, wäre für sie das Recht schlicht darum in Geltung, weil
es »billig und recht« ist. Statt um seine eigenen Rechte zu kämpfen, setzte der Einzelne sich für
das Rechte »an sich« ein. Damit hätte er den Individualismus überstiegen.
Doch ist dieser Überstieg vom Individuum zu erwarten? Und zwar nicht bloß von dem oder jenem,
sondern, wenn schon nicht von allen, dann doch von der Mehrheit? Die Frage stellen heißt, sie
beantwortet haben. Darum droht hier, in einem »Individualismus gegen den Strich«, ein
kollektivistischer Totalitarismus.
»Im Totalitarismus herrscht das Bedürfnis, sich vor dem Individuum zu schützen, vor dem
Individuum, das grundsätzlich in feindlicher Absicht die Gemeinschaft und die Gesellschaft
belauert. Weil vorausgesetzt wird, daß im Individuum nur das Streben nach dem individuellen
Guten steckt..., kann jegliches gemeinsame Gute nur über die Beschränkung des Individuums
entstehen... gemäß der anti-individualistischen Orientierung, in der man leicht die Grundlage des
Individualismus entdecken kann, nur gleichsam von der entgegengesetzten Seite her« (Wojtya).
Da diese Beschränkung gefährdet bleibt, solange sie nur auf äußerem Zwang ruht, sucht man auf
verschiedene Weisen sie in den Mitgliedern zu verinnerlichen. Die Moral reicht dazu nicht aus. Mit dem Wort »Aufhebung«, nämlich des Rechtes in Moral, ist eben nach Kant ein zweiter großer
Staatsdenker zu Wort gekommen: G. W. F. Hegel. Der nun erklärt im Blick auf die Grenzen der
Moralität, auch ihre Stufe sei zu übersteigen. Die moralische Haltung komme selber dazu, - wie es
in seiner mehrdeutigen Sprache heißt - sich aufzuheben: in Sittlichkeit. Den Grund dafür sieht
Hegel darin, daß als Prinzip der Moral das jeweilige Ich gilt, also die Subjektivität: »Diese sich auf
ihre Spitze stellende reine Gewißheit seiner selbst erscheint in den zwei unmittelbar ineinander
übergehenden Formen des Gewissens und des Bösen.«
Mehrdeutig, weil unterschiedlich lesbar. Einmal geht es tatsächlich dem Gewissenhaften nicht um
sich selbst; vielmehr darum, »in der Wahrheit zu sein«, dem Anspruch des Guten zu entsprechen.
Nicht Eigensinn und Eigenwille werden hier verfochten, sondern Autonomie. Und »nomos« =
Gesetz meint immer Allgemeinheit, darum grundsätzliche Ausweisbarkeit. Moralisch zu handeln
bedeutet, verantwortlich handeln, also mit der Bereitschaft, sein Tun »vor dem Richterstuhl der
Vernunft« zu vertreten. Wo wirklich zuletzt nur das eigene Wollen, oder sogar Fühlen, zählte - und
manche denken beim Stichwort »selbstverantwortlich« eben dieses - , da ginge die Berufung auf
das eigene Gewissen tatsächlich in das Böse über.
Aber es gibt auch eine andere Seite. Hier wurde Hegel dahingehend »realisiert«, daß man ihn
gegen »bürgerliche« Ansprüche auf Freiheit und Einmaligkeit der Person gekehrt hat. Darum gab
es im »real existierenden Sozialismus« für Gewissen und Gewissenhaftigkeit so wenig Platz wie in
technizistischen Systemen aus Übersee, etwa im »Futurum Zwei« eines B. F. Skinner, der sein
Glücksreich unverhohlen »jenseits von Freiheit und Würde« ansiedeln wollte.
III. Teilgabe und -nahme: Partizipation
Im Individualismus bleiben Beziehungen beiläufig und äußerlich; denn der Einzelne versteht nur
sich selbst als ein Ganzes, die Gemeinschaft ist ihm ein bloßes Neben- und Gegeneinander
solcher »Monaden«. Umgekehrt gibt es im Kollektivismus nur den einen durchgreifenden GesamtBezug; die Einzelnen können nicht sich beziehen, da sie nur Partikel, Momente oder
Schnittpunkte im Ganzen bilden. Was ließe sich dem gegenüber als angemessene BeziehungsGestalt benennen? Wojtya greift hierfür auf den Begriff der participatio zurück. Das deutsche
»Teilhabe« unterschlägt daran das Geschehens-Moment. Statt um ein Haben (zumal, wenn bloß
als Besitzen verstanden) geht es um Geben und Nehmen: in gegenseitigem Austausch.
Reflektieren wir philosophisch das Gabe-Geschehen als solches: Was heißt es, zu geben? Zunächst gibt der Geber etwas, ein Ding. Ist das Gegebene nun wirklich eine Gabe, ein wahres
Geschenk, dann gibt darin der Gebende zugleich und eigentlich sein Geben. Dies ja macht den
Gegenstand zur Gabe, so wenig man es »objektiv« zu fassen, gar fachlich zu »verifizieren«
vermag. Prägnant dazu der Zweizeiler G. Ungarettis: »Tra un fiore colto e l'altro donato /
l'inesprimibile nulla. - Zwischen einer gepflückten Blume und der geschenkten / das
unausdrückbare Nichts«.
Gibt aber nun jemand derart sein Geben, dann zeigt er darin sich selber als Geber. Die Redensart
»sich so oder anders geben« bekommt hier ihren wörtlichen Ernst: Wer sich als Geber zeigt, tut
nicht bloß so; es bleibt auch nicht dabei, daß er sich als wahrer Geber nur zeigt; vielmehr gibt in
Gabe und Geben der Geber tatsächlich sich selbst. Es geht dabei um die Daseins- und
Lebensweise von Person und Freiheit, bzw. von freien Personen in ihrem Bezug zu einander.
Person-sein wie Freiheit liegen ja nicht einfach vor. Der Mensch hat stets eine bestimmte
Einstellung zu dem oder jenem. Diese erscheint und realisiert sich in konkreten Taten und Worten.
Sie sind nicht die Einstellung selbst - wie die Einstellung nicht der Mensch. Aber gerade und nur
so ist die Einstellung da: in Taten und Worten, die nicht sie selbst sind. Und so nur der Mensch: in
Einstellungen, Haltungen, die nicht er sind.
Schließen wir nun die Glieder der Kette zusammen, ergibt sich: Ein Mensch ist - »in Tat und
Wahrheit« - da in seinen Taten und Worten, welche nicht er sind. In dem, was er gibt und »von
sich gibt«, gibt er - ob ehrlich oder unehrlich - sich selbst. Und anders könnte er sich gar nicht
geben; ja noch schärfer: anders könnte es ihn nicht geben; nicht nur er gäbe nicht, es gäbe ihn
nicht. Es gibt für uns keine andere Weise des Da-seins; unsere Wirklichkeit besteht darin, zu
wirken. Gleichwohl sind Wirken und Wirkung nicht wir. In dieser eigentümlichen Lage drängt sich
förmlich eine Perspektive auf, die man »Zwei-Welten-Denken« genannt hat, oder (F. Nietzsche)
»Hinterweltlerei«. Muß man hier nicht tatsächlich - wie immer wieder der Metaphysik unterstellt von einem Abgrund zwischen Welt und »Hinterwelten« reden? Fast zwangsläufig der Argwohn,
das Gewährte tarne nur den Vorbehalt und unter den Eröffnungen liege der verschlossene Rest.
(Die Weisheit des Märchens sieht in diesem Rest gar Blaubarts verbotene Kammer: im Kern des
Geheimnisses ein geheimes Verbrechen.) Aber muß das Unfaßliche verbrecherisch sein oder
dürften wir es nicht als jenes »Nichts« verstehen, welches die geschenkte Blume von einer
gepflückten unterscheidet? Dann ginge es anstatt um Vorbehalte um den Ernst von Teilgabe als
Anteilgabe an sich selbst, als - ein Grundwort K. Rahners - Selbst-Mitteilung. Mitteilung nicht bloß
als Nachricht, Sach-Information, sondern als ein Geschehen, in dem die freie Person sich selbst
einem anderen mit- und zuteilt: Selbst-Hingabe.
Suchen wir - selbst wenn es »kontrafaktisch« wäre - die »Idee« von Hingabe zu denken! Hier zeigt
sich: Hingabe ist erst einmal das Gegenteil von Sich-Behalten oder Festhalten-an-sich (wie an
einem »Raub« oder »Beutestück« oder »gefundenen Fressen« - Phil 2, 5). Nicht weniger scharf
aber haben wir sie von Selbst-Verlust zu unterscheiden, von einem Sich-Wegwerfen - mit dem
jemand vielleicht die abverlangte Selbstmitteilung rasch und auf einmal »hinter sich bringen«
möchte. - Hingabe stellt keinen Selbstmord der Freiheit zum Sturz in Hörigkeit dar, sondern
besteht in der freien Selbst-Gabe ihrer selbst. In doppeltem »ihrer selbst«: Der Mensch selbst gibt
frei sich selbst. Darum gehört zur Hingabe Entschiedenheit und freie Treue. Die aber fordern,
gerade die Hingabe zu bewahren: das Sich-nicht-Festhalten selbst festzuhalten. Dies geht nur so,
daß die Partner - und zwar gerade im Dienst ihrer personalen Beziehung - Unterscheidung und
Grenzen zwischen sich wahren.
Gerade das Sich-nicht-Festhalten also hält Freiheit, die sich hingibt, fest. Im Bilde: Die Quelle quillt
in die Schale des Brunnens hinein; aber stünde sie gänzlich und restlos in ihr, wäre sie nicht mehr
Quelle, sondern Tümpel-Wasser in einer Zisterne. So bedeutet Person einen ständig quellenden
Ursprung. Unaufhebbar ist sie darum als Ursprung ihres Sich-Gebens von diesem ihrem SichGeben zu unterscheiden; erst recht zu unterscheiden bleibt sie immerfort von ihren Gaben, dem,
was sie jeweils im einzelnen gibt.
Die Spannung von Gabe und Geber ist also unüberwindlich. Dennoch, Person gibt nicht etwa nur
trotzdem, sondern einzig derart sich. Anders nämlich gäbe nicht mehr Freiheit sich - weil es sie
selbst nicht mehr gäbe: der Quell wäre zur Pfütze geworden. - Auf eine Formel gebracht:
Freiheit/Person schenkt die Vorbehaltlosigkeit ihres Sich-Gebens gerade in der Gewähr ihrer
Unfaßlichkeit.
Vorbehaltlos: gegen den »Hinterwelten«-Verdacht, hier werde etwas »anstatt« des eigenen
Herzens gegeben. Bei wahrer Liebe (und die lebt nicht einzig zwischen »Liebesleuten«, sondern
auch etwa zwischen den Generationen; und nicht allein im Privaten, sondern beispielsweise auch
im Lehrer-Schüler-Verhältnis, in gesellschaftlichem, kirchlichem, sozialem Engagement, in
religiösen Gemeinschaften - und nicht bloß Menschen gegenüber...) gibt die Person wirklich sich
selbst.
Als unfaßlich aber gibt die Freiheit sich gerade, indem sie sich gibt. Fassen nämlich können wir
immer nur die gegebene Gabe, nie das Sich-Geben und den Sich-Gebenden selbst. Das Wort
'Gewähr' in der Formel hat demgemäß eine Doppelbedeutung: einmal wird die Unfaßlichkeit
selber gegeben: gewährt; sodann garantiert eben sie die Selbsthingabe; Unfaßlichkeit bietet
Gewähr - soweit es hier im Umfaßbaren überhaupt Gewähr und Garantien gibt. (Im Vorwort klang
an, daß dies Geheimnis der Person gerade nicht trickreiche Geheimnistuerei meint.) Dafür aber ist
es hilfreich, erst die formale Struktur solchen Austauschs, also die Grundgestalt personaler
Wechsel-Hingabe, ins Licht zu heben.
IV. Zweieinigkeit?
Ein Wesensmoment personalen Bezugs ist wohl deutlich geworden: in ihren Mitteilungen teilt
Person sich selber mit. Bei der Liebe - je nach der konkreten Gestalt ihrer angesprochenen Vielfalt
- stellen Zuwendungen (im Plural) die Wirklichkeit dar, in der die Zuwendung (im Singular) sich
auswirkt. Als Muster-Form aus dieser Vielfalt wird uns nun allermeist das erotische Paar vor
Augen gestellt, und mit Recht. Denn so sehr die anderen Bezugs-Gestalten nicht vernachlässigt
werden sollten: hier begegnet - im glückenden Fall - der Bezug in strahlendster Weise als
Erfüllung und Glück. Die Frage ist aber, ob das Verständnis, mit dem man sich traditionell auf dies
Urbild bezieht, unserer Erfahrung wirklich gerecht wird.
Damit meine ich nicht den resignativen Verdacht gegen Zeugen des Glücks, sie machten uns und
sich selber nur etwas vor. Gerade die Selbstquälerei solchen Mißtrauens nämlich rechtfertigt diese
Künder noch einmal, auch wenn die Realität nur zu häufig hinter dem Erhofften, ja Gebotenen
zurückbleibt. Doch eine Strukturfrage stellt sich: im Blick auf die große Wirkungsgeschichte jenes
Mythos, den in Platons Gastmahl Aristophanes erzählt. Ihmzufolge sind wir Menschen allesamt
Hälften, die nach ihrer passenden Ergänzung suchen. Dazu behaupte ich nun: Hätte Aristophanes
recht, wären wir alle ohne Hoffnung auf Rettung im Unheil. Die einzig mögliche Erlösung des
Menschen wäre dann die von ihm - was ja auch Welt- und Religionsweisheit in West wie Ost (und
vor allem im Osten) behauptet. Unglücklich nämlich wäre jeder von uns, solange er er ist, glücklich
erst, wenn er - wie Flüsse im Meer - ins Ganze eingegangen oder »aufgehoben« wäre, also nicht
mehr ist. So gäbe es in Wahrheit überhaupt kein Glück; da zu sein und zu leben würde ein
Unglück bedeuten. Und die Liebe, welche nach Suleikas Wort das Leben ist, wäre das Unglück in
Potenz.
Nun scheint gerade das abendländische Liebesverständnis die Dinge tatsächlich in dieser Weise
zu sehen, nämlich im Doppel-Gestirn des berühmtesten Liebespaares: Isolde und Tristan. Wer an
der Liebe nicht stirbt, der hat nicht wirklich geliebt. Darf also, wer am Leben bleiben will, es in der
Liebe nicht ganz ernst und mit dem ganzen Herzen meinen? An die Stelle des tödlichen Treffens
träte so das Turnier - in immer gleichem ritualisiertem Phasen-Ablauf: vom Ansichtigwerden und
Sich-Näherkommen zu besinnungslosem In-einander-Sturz und schließlichem Erwachen: »nah...
auf getrenntesten Bergen« (Hölderlin).
Leider ist auch die christliche Tradition von dieser Sicht der Leiblichkeit gezeichnet. Tatsächlich
steckt im Wort »Geschlecht« wie im lateinischen »Sexus« der teilende Schlacht-Schnitt. Aber die
Auffassung, die sich in dieser Wortbildung ausdrückt, ist in Wahrheit keineswegs biblischchristlich. Weder die Geschlechtertrennung noch gar die Vielheit der Schöpfung als solche
bedeutet ein Unglück. Sie ist gewollt um der Gemeinsamkeit der Liebe willen. Ein anderes
Liebesverständnis findet sich demgemäß bei einem Theologen des 12. Jahrhunderts. Ihn
vorzustellen ist ein Haupt-Ziel dieses Kapitels: Richard von St.-Victor.
V. Richard von St.-Victor: Trinitarisches Mit-Sein
Der Viktoriner hat seine Liebeslehre in einem Vorschlag entfaltet, das christliche ZentralGeheimnis von Gottes Drei-Einigkeit besser zu denken. Er geht davon aus, daß eine bloße
Wechsel-Liebe zweier keine wahre Einheit kennt, weil die Wesensausrichtung der beiden im
Gegensinn läuft: Er liebt sie; sie liebt ihn. Dies war ja das mörderische Aufeinandertreffen der
Geschlechter bzw. ihr Scharf-aneinander-Vorbei. Zu wirklicher Einheit komme es erst im Mit-Eins
der Liebe: dann nämlich oder dort, wo von den zweien ein dritter gemeinsam und eines Herzens,
also in Eintracht geliebt wird. In der Liebe zu ihm schlägt dann »ihrer beider Neigung in eine
Flamme zusammen«, und jeder kann sein Liebes-Glück, sein Entzücken ob der Herrlichkeit des
Geliebten mit jemandem teilen.
Für die innergöttliche Trinität sieht Richard das so, daß der Vater sich und alles Seinige
vorbehaltlos dem Sohn gibt; dieser empfängt in gleicher Vorbehaltlosigkeit alles, auch das Geben,
so daß er seinerseits (gemeinsam mit dem Vater) gibt. Der Geist aber ist die reine Person des
Empfang(en)s, darin sich das Wir von Vater und Sohn erfüllt und vollendet. Es wäre reizvoll, dies
zu entfalten. Vor allem im Blick auf den Geist als den Dritten (anstatt bloß als Liebe zweier), als
sozusagen die Selbstlosigkeit in Person. Doch sehen wir jetzt von den innergöttlichen
Beziehungen ab und sammeln uns auf die Erwägung nur der formalen Struktur des Mit-Eins und
Mit-Einander als solchen.
Dafür nun wiederum eine Formel. (Für ihre Erläuterung sei erinnert, daß jedes Ich gleichsam ein
»Produkt« aus Du und Ich ist. Erst aus dem Du, von ihm gemeint, entdeckt ein Ich sich selbst als
Ich. In diesem Sinn läßt sich sagen, jedes wache Ich sei die gefügte Einheit aus Du und Ich.) Das
Wir fügt sich - reicher als beim Ich - aus zumindest drei Momenten: zuerst dem Ich-Du-Gegenüber
von zweien, sodann ihrem Wir-Er-Miteinander und schließlich dem Wir-Du-Gegenüber.
Das erste: Ich-Du, ist durch M. Buber geläufig. - Das zweite: Wir-Er, betone ich gegen diesen
Denker des Du; denn für ihn stand dem Lebensvollzug des Ich-Du nur die Mindergestalt eines
unpersönlichen »Ich-Es« gegenüber. Aber wir kennen sehr wohl die liebende Rede von Dritten,
sowohl unter Menschen: etwa zwischen Mutter und Kind vom Vater oder zwischen Eltern vom
Kind, als auch im religiösen Verhältnis. - Den Ziel-Vollzug aber bildet das dritte: Wir-Du. Hier reden
zwei nicht bloß miteinander vom Dritten oder liebevoll über ihn, sondern sie gehen vereint auf ihn
zu, blicken gemeinsam auf ihn.
So die grundsätzliche Formel. Sie müssen wir nun als nächstes dynamisieren. Denn im
Grundsatzkonzept einer solchen Beziehung ist nicht immer derselbe der dritte, der zum
geschlossenen Paar der beiden ersten hinzutreten würde. Damit wäre ja - bei aller gastlichen
Öffnung - doch nur die alte Ich-Du-Gestalt festgeschrieben. Sondern jeder der drei erscheint für
die jeweils anderen als vermittelnder Dritter. Biblisch ließe sich sagen: als der »Freund des
Bräutigams« (Joh 3,29). - Ist so aber jeder der Dritte, dann begeht eben darin auch jeder der drei
zugleich seine eigene »Hochzeit« - um nun zu zweit mit dem Partner den jeweils Dritten zu lieben.
Klingt das nicht völlig verstiegen und jedenfalls eklatant unrealistisch? Immerhin - dies das erste bedeutet es einen scharfen Kontrast zu den üblichen Koalitionen gegen den »ausgeschlossenen
Dritten«. Erklärt es - sodann - nicht vielleicht unser Leiden an »Verhältnissen«, die »nicht so«
sind? - In einem solchen Geschehen wird nämlich keiner zum Mittel, jeder ist Mittler und Quelle
und Ziel. (Und damit verdeutlicht sich nochmals das im vorigen Kapitel angesprochene
Zueinander von Liebe zu Gott und Ja zum Menschen, gegen Programme der Teilung wie
Instrumentalisierung).
Hier herrscht kein bloßes Zu-einander, Auf-einander-Zu bzw. Einander-Entgegen. (Daraus ergäbe
sich niemals ein wahres Mit-EINS!). Ebensowenig waltet hier statt des Gegen-einander ein Aufund Übergehen-in-einander. (Daraus käme es niemals zu einem MIT-Eins!). Wir stehen vielmehr
vor einem lebendigen Austausch und in stetem Wechsel spielenden MIT-SEIN. (Beim Gott des
christlichen Glaubens zudem besitzt dieses Spiel eine derart innige Dichte, daß sein ewiges Wir
nicht nur »eines Sinnes und Herzens«, sondern geradezu eines Seins ist. Darum begegnet es uns
Geschöpfen, gleichsam »nach außen«, als ein einziges Ich.)
VI. Im Spiel
Vielleicht erschließt sich schon hiermit die Feststellung Guardinis: »Wenn es möglich wäre, den
Schritt in den Glauben ganz rein zu vollziehen, dann würde die Antwort auf die Frage, was
Personalität einfachhin sei, lauten: Gottes Dreieinigkeit.«
Warum ist uns dieser Drei-Gedanke so fremd? - Nicht der von Dreiheiten überhaupt. So war es
den christlichen Denkern ein Leichtes, überall in Welt und Leben und in den Traditionen der Völker
Triaden zu finden, die sie als Bilder und Spuren von Gottes Dreieinigkeit deuteten. Aber hierbei
ging es durchwegs um Sach- sowie Struktur-Dreiheiten, nicht um Personen-Bezüge. Bei ihnen ist
uns, wie vorher im Blick auf »Koalitionen« gesagt, eine gleichrangige Drei-Einigkeit fremd.
Ich sehe einen doppelten Grund. Einmal besteht die Grundstruktur des leiblichen Lebens in der
Zwei-Einheit von Gegensatzspannungen. Vor allem in der Polarität der Geschlechter, von
Männlich-Weiblich, Yin und Yang - sowie in der Zweieinheit von deren Zusammenfall. Ebenso
steht es mit der Tätigkeit des Verstandes. Die Tradition hat ihn »teilend und zusammensetzend«
genannt; Hegel faßt das Urteil als Ur-Teilung auf. Der Verstand nimmt das Konkrete in Subjekt und
Prädikat auseinander, um es durch die »Kopula« ist wieder zusammenzufügen.
So haben wir es als Leib- wie als Verstandeswesen stets nur mit Zweiheit beziehungsweise Zweieinheit zu tun. In der Philosophie überdies besteht eine Jahrtausende-Tradition des SubjektObjekt-Denkens. Erst mit den Dialogikern unseres Jahrhunderts trat die Eigen-Gestalt des
Subjekt-Subjekt-Bezugs ins allgemeine Bewußtsein. Kein Wunder darum, daß über Objekt und
Subjekt hinaus ein wahrhaft personales, also trinitarisches Mit-Sein bislang nur in Ansätzen
gedacht wird. Die biblisch-christliche Erschließung der Person(alität) hat eben noch nicht zu einer
Ausbildung der ihr genuin entsprechenden Kategorien geführt.
Was uns bisher zur Verfügung steht, ist der abstrakte Gegensatz von Einheit und Vielheit, Ding
und Struktur - oder auch Stoff und Feld, Masse / Energie - beziehungsweise Substanz und
Beziehung. All das sind Gegensätze oder Gegensatz-Einheiten: Polaritäten, kein personales Mit.
Zu denken hätten wir erst einmal substanziellen oder »subsistenten (in sich stehenden) Bezug«.
Wir dürften also weder bloß Substanzen, In-sich-Stehendes konzipieren, das sich dann (auch)
bezieht - noch anderseits gleichsam eine »Bezugs-Substanz«, also ein Geflecht, ein System, in
dem wir Einzelne gewissermaßen als »Beziehungs-Knoten« nur Momente wären. Das
Unternehmen wird m. E. zeigen, daß solch eine Wirklichkeit nicht als Zwei-Einheit konzipiert
werden kann.
Nun will dies Plädoyer für den Dritten nicht sagen, es gehe darum, zu zweien ein drittes zu zählen.
Daß dies als solches nichts hilft, bedarf keiner Worte. Es ist auf eine Erfüllung hinzudenken, in der
»Eins und Zwei hinter uns liegen« (H. U. v. Balthasar). Darum halte ich auch nicht viel von der
Suche nach »trinitarischen Spuren«, vom Dreiklang bis zur metaphysischen Triade Eins-WahrGut. Oder auch dem Eltern-Kind-Bild, womit man nur die Klein-Familie vergöttlichen würde.
Wichtiger ist mir die Offenheit von Ich und Du ins Göttliche hinein.
Von Ihm her und mit Ihm auf den anderen oder die anderen zugehen - sowie mit diesem und den
anderen zusammen auf den gemeinsamen göttlichen Grund und Abgrund hin: Könnte das nicht
lebenspraktisch einen Ausweg zeigen aus dem bekannten Dilemma menschlicher Beziehungen:
zwischen symbiotischer Einheit, deutlicher: Einsheit, welche eher Tod als Leben bedeutet, und
einer Zweiheit als Gezweitheit, wo man sein Eigen-Leben mit Vereinsamung bezahlt?
Den Person-Begriff verdanken wir theologischen Diskussionen der ausgehenden Antike. Von dort
her hat der Mensch sich als Person zu erfassen gelernt. »Der Personbegriff [aber] drückt von
seinem Ursprung her die Idee des Dialogs aus und Gottes als des dialogischen Wesens« (J.
Ratzinger).
Bei der Beziehung als schwächster Kategorie und Person als der eigentlichen Substanz hat unser
Denkweg begonnen. Nun stehen wir bei dem Satz, den W. Kasper in seiner Gotteslehre wie ein
Resümee kursiv gesetzt hat: »Weder antike Substanz noch neuzeitliches Subjekt ist das Letzte,
sondern die Relation als Urkategorie des Wirklichen.« Weder Substanz noch Subjekt, sondern der
Bezug als solcher selbst: Person als Lebens-Bezug. Der Einzelne ist weder Ganzes noch Teil, er
steht in Beziehung. Und die Beziehung von Mensch und Mensch besagt ihrerseits weder
Ergänzung (von Hälften) noch Verdoppelung selbstgenügsamer Ganzer. Die Menschen sind
miteinander im Spiel. Und dieses Spiel ist nie - natürlich nicht - nur das Ihre.
Ausführlicher für Beleg und Begründung: Freiheits-Erfahrung. Vergegenwärtigungen christlicher
Anthropo-theologie, Frankfurt/M. 1986, bes. Teil IV (Trinitarischer Sinnraum); Leben als Mit-Sein.
Vom trinitarisch Menschlichen, Frankfurt/M. 1990, bes. Kap. 4 und 5 (Antwort: Mit-Sein,
Dreieinigkeits-Offenbarung); Lernziel Menschlichkeit. Philosophische Grundperspektiven,
Frankfurt/M. ²1981, Kap. 3 (Prüfstein Diskretion).
»WO IST NUN DEIN GOTT?«
Das bisher Skizzierte will dem Selbst- und Weltverständnis dienen, also dem urmenschlichen
Bemühen um »Sinn«: seinem Sich-Einrichten bei sich und seinesgleichen wie in der Welt
überhaupt. Doch ist das Scheitern solcher Versuche inzwischen nicht offenkundig? Die schärfste
Herausforderung an das Heimat-Verlangen des Menschen bildet die Un-heimlichkeit von Schmerz
und Leid. Immer neu faszinierend, zu welchen Antworten darauf in »Mythos und Logos« er findet.
Eine der großartigsten ist jene, die diesen Konflikt von Ordnung und zerstörender Unordnung
seinerseits als ein Ordnungs-Geschehen versteht, quasi naturgesetzlich-kausal im KarmaGedanken, personal-ethisch im Verständnis des Leids als Strafe für Schuld.
Damit gelingt es dem Menschen noch einmal, die Welt sich heimisch zu machen - doch um den
Preis, daß der Leidende seinerseits gleichsam als Sündenbock aus der gemeinsamen Heimat
verjagt wird. - Bei dieser (un-)menschlichen Lösung kann es darum nicht bleiben. Nicht jeder
Leidende hat - wie Platon schreibt - sein Los selber gewählt; und ebenso ist den Propheten
Ezechiel wie Jeremias zu widersprechen: Nicht jeder, der stumpfe Zähne bekommt, hat selbst
saure Trauben gegessen. Sieg und Niederlage bedeuten kein Gottesurteil, nicht die
Weltgeschichte schon das Weltgericht. In Babylon wie in Israel findet der verleumdete Leidende
seinen Anwalt.
Damit aber steht wieder alles in Frage, jedenfalls vor dem Hintergrund eines Glaubens an Gott als
Schöpfer und Gesetzgeber der Welt.
I. Dualistisch / monistische Konzeptionen
Die Frage stellen andere dem Gläubigen und er selbst sich. Er fragt sich und seinen Gott. Und er
hält Gott die Frage der anderen an ihn vor. So der Beter des 42. Psalms: »Tränen mein Brot bei
Tag und bei Nacht; denn man sagt zu mir den ganzen Tag: Wo ist nun dein Gott?« - Eine Antwort
läßt sich nicht hören. Wie aber sich selbst verstehen angesichts ihres Fehlens?
Auch dieser Herausforderung begegnet der Mensch; der Disput geht bis heute; jüngst unter
Theologen wie Philosophen mit neuer Intensität aufgebrochen. Statt eines Referats der
Anwortversuche seien die Voraussetzungen und Grundentscheidungen erwogen, auf denen sie
aufruhn.
In ihrer Mehrheit nämlich treffen die verschiedenen Lösungsvorschläge sich darin, daß sie keine
Schöpfung aus Allmacht und Freiheit anerkennen. Entweder liegt sie von vornherein außerhalb
ihres Horizonts oder sie verwerfen dergleichen ausdrücklich (zum Teil gerade aufgrund der
Erfahrung des Leids und des Bösen). Das gilt für die mythische Dimension wie für die
philosophische, in der sich jetzt unser Nachdenken hält.
1. Einmal wird hier Gott dadurch »entlastet«, daß man ihm personale oder auch sachhafte GegenWirklichkeiten konfrontiert. Die Welt, wie sie ist, erscheint dann nicht einfach als sein »Produkt«,
sondern als das Ergebnis einer Auseinandersetzung, die unvermeidlich ihre Spuren hinterläßt.
So erklärt Platon, zwar habe Gott in seiner neidlosen Güte gewollt, »daß nach Möglichkeit alles
gut und nichts schlecht sei«; doch setze die Materie dem Ordnungswillen Grenzen. »Für das Gute
darf man keinen anderen Urheber, für das Schlechte hingegen muß man irgendwelche Ursachen
suchen, aber nicht Gott.« (Darum auch sein engagierter Protest gegen Epos und Drama, wonach
Zeus gute und böse Lose verteilt und »Gott die Menschen schuldig werden läßt, wenn er ihr Haus
verderben will«.) Die physischen Übel zählen dabei strenggenommen nicht; all dies nämlich, »was
ein Übel zu sein scheint«, wird dem Menschen »zum Guten ausschlagen im Leben oder Tod«,
wenn er ernstlich gerecht werden will.
Hinsichtlich dieses Wollens oder Nicht-Wollens aber, bei dem wir uns oft auf ein Nicht-(Wollen)Können berufen, gilt das zitierte Wort der Lachesis an die Seelen: »Euer Los wird nicht nur durch
den Dämon bestimmt, sondern ihr seid es, die sich den Dämon erwählen... Die Schuld liegt beim
Wählenden; Gott ist schuldlos.«
Ob der ungeklärte Dualismus seiner Verteidigung Gottes in Platons letztem Werk tatsächlich zur
Annahme einer zweiten, bösen Weltseele geführt hat oder ob diese zoroastrische Position bloß als
aufzuhebende Hypothese gemeint war, jedenfalls melden sich hier Konsequenzen, die später
Gnosis und Manichäismus ausdrücklich ziehen.
2. Neben solchen Konzepten dualen Kampfes, mit Widermächten oder zumindest mit dem
widerständigen Material, stehen Entwürfe all-einigen Werdens, eines Ausströmens Gottes oder
des Sich-Durchringens zu sich selbst, die die Welt statt als Werk als Leib oder Schicksal des
Göttlichen deuten.
Als Beispiel wieder ein Philosoph griechischer Sprache: Plotin. Sein Wort für die Welt-Entstehung
ist Apórrhoia, Emanation, und sein Lieblingsbild hierfür das ins Dunkel ausströmende Licht.
Während (gemäß der antiken Physik) die Lichtquelle dabei keine Veränderung und keinerlei
Substanzverlust erleidet, nimmt ihre Ausstrahlung doch mit der Entfernung ab, nicht aufgrund
eines Widerstandes, sondern mit innerer Notwendigkeit. Der äußerste Licht- oder Feuersaum nun,
gleichsam das Enden selber des Lichtes, ist die Materie. Und als dieses existierende Nichts heißt
sie ausdrücklich »das wahrhaft Böse«, während Plotin ihr zugleich dieselbe Notwendigkeit
zuerkennt wie dem Guten, da dies sich mit Notwendigkeit ergießt.
Darum ist auch die Welt insgesamt nicht vom Übel, im Gegenteil ist sie als schönste der
möglichen Welten die herrliche Offenbarung des göttlichen Einen. Hinsichtlich der Mängel erfährt
man, es handle sich um einzelnes, das bei Gesamtbetrachtung seinen Platz und Sinn zeige - wie
die Schatten im Bild oder die minderen Rollen im Drama. Prinzipiell heißt es schließlich: »Aus
Entgegengesetztem besteht mit Notwendigkeit dieses All.«
Solchem Monismus der Emanation wäre jener der Evolution an die Seite zu stellen, der besonders
die deutsche Philosophie prägt, von Jakob Böhme zu unseren großen Idealisten und weiter
sodann bis zu den heute herrschenden Biologismen. Th. Haecker hat gerade dagegen immer von
neuem gestritten, gegen die »urdeutsche Häresie, daß Gott erst wird und nicht Ist.«
Damit dürfte die Grundstrategie dieser Lösungsversuche vorgeführt sein. Schuld, das moralische
Übel, wird hier auf natürliche Mängel, also das physische Übel, zurückgeführt. Und dieses
physische Übel wird entweder als naturhafte Gegenmacht aufgefaßt oder als unvermeidliche
Mangelerscheinung der Welt verstanden, wenn man es nicht sogar positiv legitimiert: als
notwendiges Kontrastmoment in der gesamt-kosmischen Harmonie.
Anders gesagt: Der Widerspruch des Bösen wird fälschlich unter die Gegensätze des Lebens
gerechnet; als bedürfte - bildlich gesprochen - Musik zur Abhebung ihrer und zur Einstimmung auf
sie erst einer Lärm-Orgie. Was sie statt dessen wirklich braucht, ist Stille. (Logisch gefaßt: ein
Böses, das sein sollte, wäre gut, also nicht-böse; denn eben dies bedeutet 'gut': zu wünschen,
wünschenswert oder gesollt bzw. sein sollend.)
II. Schöpfung aus nichts
Ob also dualistisch, wie Platon und entschiedener die persische Lehre von Ahura Mazda und
Ahriman, oder monistisch, wie Plotin und moderne evolutive Natur-Konzeptionen: Ein solcher AusWeg ist jüdisch-christlichem: biblischem Denken nicht möglich - obwohl immer wieder auch
Theologen ihn einschlagen wollen. Denn gegenüber dualistischen Konzeptionen bezeugt das
Glaubensbekenntnis Gott als den alleinig souveränen Schöpfer, gegenüber monistischen WerdeEntwürfen besteht der Gläubige auf der göttlichen Freiheit des Schöpfers bzw. einer radikalen
Nicht-Notwendigkeit der Welt.
1. Das sei jetzt verdeutlicht (Gottes Dasein selbst vorausgesetzt; heißt doch die Frage: Wie den
Glauben an Gott mit der Erfahrung des Übels verbinden? Den Atheisten schmerzt das Leid nicht
weniger als den Gläubigen; aber ein »Theodizeeproblem« stellt sich ihm nicht. Die Dinge sind halt,
wie sie sind).
Gott also, der göttliche Schöpfer, und seine Welt, wie sie ist. - Am Anfang steht Israels Bekenntnis
der absoluten Souveränität Jahwes und der Nichtigkeit aller anderen Götter und Mächte, gegen
die Gott »sein Volk« aus dem »Nichts« der ägyptischen Situation heraus erst zum Volk gemacht
hat. Dieses Bekenntnis gewinnt in den »Schöpfungsberichten« der Genesis kosmische
Dimensionen.
In der Begegnung mit dem griechischen Denken wird die ursprünglich geschichts-theologische
Aussage mit ihren kosmologischen Implikationen schließlich metaphysisch ausgelegt. Doch ist
dies Unternehmen der Bibel weniger fremd, als man oft unterstellt; die Weisheitsliteratur geht
»unter dem Einfluß der altorientalischen und besonders ägyptischen Lehrdichtung« ihrerseits
schon diesen Weg (W. Kern).
2. Was bedeutet nun »Schaffen« (im Hebräischen bará, ein Gott vorbehaltenes Wort)? Von allem
anderen Verursachen und »Machen« hebt der Begriff »Erschaffen« das einzigartige Erwirken
Gottes in doppelter Weise ab. Negativ als creatio ex nihilo - Schöpfung aus nichts. - Das weist
ebenso die äußere Abhängigkeit eines Baumeisters oder Künstlers von seinem Material ab wie
die innere Bedingtheit einer Weltseele durch den Urstoff oder eigene Werde-Notwendigkeiten.
(Über Anfänglichkeit oder Anfangslosigkeit der Materie wird damit nichts gesagt, nur, daß die
Schöpfung der Welt - seit »Ewigkeit« oder in einem von »innen« erreichbaren zeitlichen Anfang keinen einschränkenden Bedingungen unterliegt.)
Positiv wird der Begriff als creatio entis qua entis bestimmt - Schöpfung des Seienden als solchen:
in seinem Sein einfachhin. Das meint: nach seiner Wirklichkeit wie auch schon seiner Möglichkeit,
und schließt jegliche »Konkurrenz« mit anderen Urhebern aus. Der Schöpfer ist nicht das erste
Glied einer Ursachen-Kette, sondern der wesenhaft einzige Grund der Welt und alles Weltlichen in
seinen Wirkzusammenhängen.
Hier liegt wohl das größte Ärgernis des Schöpfungsgedankens. Denn werden damit Welt und
Mensch nicht ganz zum »Machwerk« abgewertet? - Dagegen erklärt man, Gott brauche den
Menschen. Dies sei der beste Weg, sich gegen die falsche Vorstellung einer unterdrückenden
Allmacht zu sichern. Doch Unersetzlichkeit garantiert weder Achtung von Würde noch Wahrung
von Freiheit. Das belegt die Erfahrung, von alters - bedurften Griechen und Römer nicht ihrer
Sklaven? - bis heute. Und weiteres Nachdenken zeigt, daß die Funktions- Sicht als solche
überhaupt kein Auge für die Eigenwirklichkeit von Freiheit und Person besitzt.
Anerkennung von Person ist unbedingte Anerkennung. Sie kann nicht durch nützliche Qualitäten
bedingt sein. Andererseits ist zu völligem Absehen von allem Nutzen nur Allmacht imstande.
Einzig sie kann völlig »zwanglos« (im Doppelsinn des Wortes) andere Wesen entstehen und
bestehen lassen. - Das hat Guardini einmal in einem anschaulichen Denkaufstieg verdeutlicht:
Das Werkzeug hebt den Stein; Licht weckt und leitet den Keimling; zur Brunftzeit bringt die Ricke
den Bock in Bewegung... je tiefer die Einwirkung reicht, desto tätiger wird das Bewegte selbst.
Und so geht es weiter, nun unter Menschen: Überredung gewinnt, geglücktes Überzeugen
schenkt Einsicht... Liebe gibt ins streng Eigene frei, in einer Weise, daß der Befreite sagen kann:
»Ich verdanke Dir alles; aber so, daß ich durch Dich erst überhaupt ich selbst geworden bin.«
Im Maß, wie hier Intensität und »Tiefenwirkung« der Einwirkung wachsen, nimmt ihre
»Behutsamkeit« zu, ihr Anruf an Eigensein und -wirken des Betroffenen, zuletzt dessen Freiheit
nicht bloß respektierend, sondern sie eigentlich weckend. Darum ist in solcher Perspektive
Allmacht strikt als Erwirken(können) von Freiheit zu denken - statt als das Vermögen, alles
Mögliche »machen« zu können.
Wenn Freiheit nicht ganz aus sich ist, dann kann sie allein von Allmacht her beginnen; jeder
»mindere« Ursprung höbe sie auf. - Gerade die Würde von Person und Freiheit fordern also deren
»Gott-Unmittelbarkeit«.
Hier liegt der personal-anthropologische Ort des zunächst geschichts-theologisch eingeführten
Schöpfungsbegriffs. - Person kann einerseits nicht leugnen, daß sie sich einem Anfang verdankt;
sie besteht andererseits aber darauf, daß »Geist und Sein... durch kein Seiendes gemacht oder
gezeugt oder in der Weitergabe einer Bewegung verursacht werden können. Dies ist der Sinn
auch des sogenannten thomistischen 'Creatianismus' in bezug auf die Geist-Seele« (M. Müller).
Er behauptet nicht, der Mensch stamme »teils vom Himmel«, teils von der Erde, als heillos
»kentaurischer« Zwitter. Sein Gezeugt-, Geborenwerden ist vielmehr eben die Weise seiner
Erschaffung. Weder Dualismus noch Monismus treffen die Wahrheit. Beide verfehlen die
eigentümliche »Mehrdimensionalität« von Welt und Mensch; daß nämlich wir selber leben,
erkennen und wollen (nicht gelebt werden), und doch aus uns selber weder Leben noch Erkennen
oder Wollen auch nur einen Augenblick lang garantieren können.
3. Solch radikal umfassendes Gründen ist nun nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich wesenhaft
undistanzierbarer. Was nicht bloß Anfang, sondern Grund ist, bringt man niemals hinter sich:
creatio besagt zugleich: creatio continua, Schöpfung ist schöpferisches Erhalten. Und diese
Erhaltung »entfremdet« oder entmündigt so wenig wie nach dem eben Bedachten das Erschaffen
überhaupt. Im Gegenteil wieder; nicht von ungefähr hat etwa Augustinus sich Gottes Allgegenwart
an jener der Wahrheit deutlich gemacht. »Sie gehört nicht dir noch mir noch einem Dritten,
sondern ist allen wunderbar wie ein zugleich geheimes und allgemeines Licht gegenwärtig.«
Als Möglichkeit von Leben und Erkennen aber schenkt die Wahrheit sich so, daß sie zugleich den
unbedingten Anspruch auf Anerkennung erhebt. Diese Erfahrung wurde ins Bild des
allüberspannenden Himmels und der allessehenden Sonne gefaßt. Nietzsche wie Sartre (und
vorher schon Ijob) protestieren gegen diesen unablässigen Blick eines schamlosen Überwachers.
Doch wäre gemäßer der Blick als Liebe zu erkennen, die »An-sehen« schenkt, - und Gott als der
»Nicht-andere« (Nikolaus von Kues: weder so ein anderer, wie wir es für einander sind, noch auch
ein anderer zu dieser Andersheit, sondern non-aliud, Nicht-anderes - während wir Ihm gegenüber
andere sind). Doch wird auch so die unvergleichliche Unterscheidung noch dinghaft-konkret
formuliert; immer noch klingt es nach abgrenzbaren Raum-Bereichen.
Daß es hier gleichwohl nicht um Begriffskonstruktionen zu tun ist; daß solches Reden
Realitätsgehalt hat, belegt die Lebens- und Eigenerfahrung, auf die ich mich hier ständig beziehe,
nämlich die Erfahrung der (Selbst-)Begegnung von Freiheit: Freiheit zeigt und gibt sich in
konkreten Taten und Worten, die nicht sie selbst sind; doch eben so gibt sie, wenn sie diese
ehrlich gibt, sich selbst - und könnte sich auf keine andere Weise geben, hat es im dritten Kapitel
geheißen.
So sind dualistische wie monistische Konzepte zwar verständlich, ja fast unvermeidlich; gleichwohl
verfehlen sie jenes eigenartige »In-Über« (E. Przywara), in dem Wort und Freiheit, Gestalt und
Person, schließlich Welt und Weltgrund zueinander stehen.
Auch mit dieser Korrektur allerdings bleibt alles Reden hier mehr schlecht als recht. Denn das
Gott-Welt-Verhältnis in seinem In-Über muß zugleich als dialogisches gesehen werden; die Welt
ist ja nicht einfach Gottes Leib und Gestalt, er nicht ihre Seele. Gleichwohl ist er jener, »in dem wir
leben, uns bewegen und sind«; Augustinus nennt ihn »Leben unseres Lebens«. Darum hat
zunächst die Rede von »symbolischer Identität« zwischen Schöpfer und Schöpfung ihr Recht. Die
traditionellen Stichworte dafür lauten: Ur- und Abbildlichkeit, Erscheinung: »Das Unsichtbare an
Ihm wird ja als Begreifbares seit Weltschöpfung an den Werken erblickt, nämlich Seine ewige
Kraft und Göttlichkeit« (Röm 1, 20).
III. Schöpfung als Offenbarung
Was aber sagt das für unser Thema? Die Welt offenbare die »Handschrift« des Schöpfers, sagte
man früher. Hier wird also der Vergleich zum Künstler gezogen, der in seinem Werk sich
ausdrückt. Doch auch bei diesem Vergleich gilt es die Grenzen zu sehen.
1. Gott steht nicht mit seinem Werk in gemeinsamer Leiblichkeits-Dimension. Weder besitzt er
selbst »charakteristische« Eigenheiten noch »prägt« ihn der Umgang mit seinem Stoff. Sein
Objekt ist restlos sein Pro-jekt; denn durch wessen Wort restlos alles ent-steht, dem kann nichts
als Gegen-stand entgegenstehen. Insofern muß man offenbar sagen, alles sei, so wie es ist,
Gestalt und Ausdruck seines absoluten Willens und damit seiner selbst. Gott sei so, wie diese
mitunter unerträgliche Welt.
Gott aber, der sich »unwiderstehlich« in seinem Werk ausdrückt, kann ihm nur darum derart
immanent sein, weil er radikal transzendent ist. Indem jede Vorgegebenheit wegfällt, fällt auch die
gemeinsame Dimension von Werker und Werk weg, aufgrund derer man hier wie sonst von
Spuren, Handschrift und dergleichen reden könnte. Wenn Gott gestalt- und bildlos ist, kann es
kein Abbild seiner geben - und demzufolge auch keinen »objektiven« Maßstab für die
»Ähnlichkeit« solcher Bilder.
Das folgt aus der Transzendenz Gottes; es folgt aber auch, nun in die Gegenrichtung geblickt, aus
der unaufhebbaren Endlichkeit des Geschöpfs. Deren rechtes Verständnis verlangt eine doppelte
Korrektur an G. W. Leibniz' berühmtem Beitrag zu unserer Frage.
Erst einmal hat er dem malum physicum und morale der Tradition das malum metaphysicum
beigesellt, mit dem er die wesenhafte Unvollkommenheit = Endlichkeit des Geschöpflichen
ansprechen wollte. Malum = Übel bedeutet eine »Beraubung«, einen Mangel, der nicht sein sollte
(klassisches Beispiel: Blindheit eines Menschen oder Haustiers - im Unterschied zum NichtSehen-Können eines Steins). Die Begrenztheit des Endlichen aber - nicht erst in seinem
faktischen Dasein, sondern bereits als bestimmte »Idee« im göttlichen Geiste - ist keine derartige
Beraubung, kein Unglück, sondern eine positive Möglichkeit.
Sodann vertritt Leibniz, nicht ohne Zusammenhang mit dem ersten Gedanken, die bekannte
These von der »besten aller möglichen Welten«. Demgegenüber verweise ich nur auf das
Argument, daß eine schlechthin unüberbietbare Welt sich ebensowenig denken läßt wie eine
absolut größte Zahl. Anselms Bestimmung »id quo maius cogitári nequit - das, worüber hinaus
nicht Größeres gedacht werden kann,« definiert vielmehr gerade Gott. Daraus ergibt sich, daß
man das Theodizeeproblem nicht auf diesem Weg zu entschärfen vermag. Der Anwalt Gottes
muß dem Kläger einräumen, daß diese Welt durchaus viel besser eingerichtet sein könnte, statt
sich auf Allmachts-Grenzen herauszureden.
2. Das ist - unabhängig von Leibniz - ein heute wieder nicht selten gesuchter Ausweg, in
Aufnahme etwa der Lurianischen Konzeption vom »Zimzum«, dem Rückzug, der
Selbstentmächtigung Gottes (so besonders H. Jonas). - Dazu drei Fragen:
Die erste richtet der Philosoph an den Gottes-Begriff, der einer solchen Konzeption zugrundeliegt.
Darauf erhält er mitunter die Antwort, hier gehe es gar nicht um unser Begreifen, sondern anstatt
um den »Gott der Philosophen« um den lebendigen Gott des Glaubens. Aber das genügt ihm
nicht. Ich insistiere: Wenn Theologen sich der philosophischen Kritik verweigern, müssen sie sich
fragen lassen, wie anders sie beglaubigen, daß sie von Gott sprechen statt von einem mythischen
Götzen; wie anders sie ihren Gott von einem Dämon zu unterscheiden gedenken. (Dämonische
Passagen finden sich ja durchaus in der Schrift.) Es ist also nötig, zu unterscheiden - und dies zu
begründen. Mit einem »trockenen Versichern« (Hegel) ist es dort nicht getan, wo Verehrung,
Hingabe, ja Anbetung geboten werden.
Und zweitens: Wo in der Bibel wäre von Gottes Ohnmacht die Rede? Nicht im Alten Bund, etwa
beim Fall des Reiches, so daß man sich jetzt an die Götter Babylons halten müßte. Und nicht im
Neuen Bund, etwa am Ölberg (Mt 26, 53). Eben deshalb hier der Schrei »Warum?« (Mt 27, 46)
und »Wie lange noch?« (Offb 6, 10 [Lk 18, 7]), der also Gott an-klagt, statt daß man bei sich selbst
oder untereinander Gottes Irrtum und Schwäche dem »Fürsten der Welt« gegenüber beklagte.
Zum dritten: Worauf gründen diese Lehrer eigentlich die gute Botschaft der Hoffnung, in deren
Dienst und Rechenschaft sie gestellt sind? »Seid immer bereit zur Verteidigung vor jedem, der von
euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch« (1 Petr. 3, 15).
Eine Auskunft, die mir begegnet: »Der 'sympathische' Gott, wie er in Jesus Christus offenbar wird,
ist die endgültige Antwort auf die Theodizeefrage... Wenn Gott selbst leidet, ist das Leiden kein
Einwand mehr gegen Gott.« Doch nochmals rückgefragt, mit einem Wort K. Rahners: »Um einmal primitiv gesagt - aus meinem Dreck und Schlamassel und meiner Verzweiflung
herauszukommen, nützt es mir doch nichts, wenn es Gott - um es einmal grob zu sagen genauso dreckig geht.«
Schließlich (Punkt vier nach den drei Fragen): Angenommen sogar, Gott hätte wirklich sich selbst
durch sein Schaffen entmachtet, so wäre mitnichten gewonnen, worum es den Verfechtern seiner
Ohnmacht geht, nämlich Gottes Entlastung. Hätte eben diese Ohnmacht doch niemand anderer
zu vertreten als Er. Oder wollte man so weit gehen (es gibt diese Stimmen), ihm nicht einmal das
zuzumuten (weil man ihm nichts zutraut)?
Damit ständen wir dann in der Tat bei dem, was O. Marquard »Atheismus ad maiorem Dei
gloriam« nennt - Atheismus zur größeren Ehre Gottes. Er meint damit, das Denken kehre sich ab
von der »Blasphemie«, diese Welt habe Gott zu ihrem Schöpfer; und so vollende sich die
Theodizee durch den »Freispruch Gottes wegen der erwiesensten jeder möglichen Unschuld,
nämlich der Unschuld wegen Nichtexistenz.«
Hier zeigt sich also die Theologen-Variante jenes »Witzes«, um den Nietzsche Stendhal zu
beneiden gestand: »Die einzige Entschuldigung Gottes ist die, daß es ihn nicht gibt.«
2. Demgegenüber führt nun gerade die Einsicht in die Unmöglichkeit der »besten Welt« zu einem
neuen Gedanken. Gegen das, was ist, im Namen eines Besseren, das sein kann/könnte, zu
protestieren bleibt immer möglich, weil das Denken jede Wirklichkeit auf Möglichkeiten
transzendiert und weil die Welt nie ihre Möglichkeiten einholt. Ja, es bleibt mit guten Gründen
möglich; denn bei jeder noch so guten Schöpfung wäre das Verwirklichte begrenzt, das NichtVerwirklichte indessen grenzenlos. So ergibt »unterm Strich« der Vergleich stets ein Minus.
Das muß man sich bewußt machen, um zu verstehen, warum die Weltweisheit in Ost und West
die Überzeugung vertritt, das beste sei, nicht geboren zu werden; die »Einsicht« - Buddha spricht
von edler Wahrheit - , daß das Leben Leid sei. Dem widerspricht - ohne jede Romantik - der
gewöhnliche Mensch, der lieber lebt als tot ist, und die Bibel-Botschaft der Schöpfung, wonach
Dasein Gewollt-sein und darum gut ist.
Eben daß ist, was ist, obwohl nichts sein müßte, also das im Doppelsinn des Wortes kontingente
Da- und Gegeben-Sein von allem, stellt die erfragte »Abbildlichkeit« des Irdischen dar. Dies ist es,
was am Welt-Werk erscheint. Kontingent ist es, weil es nicht sein müßte, kontingent ist es im
positiven Sinn als gleichwohl eingetroffen, geglückt.
Was am Geschöpf erscheint, ist dessen völlig ungenötigtes Gegebensein und so das freie Geben
des Schöpfers - der darin sich als frei-gebig gibt. Es geht eben nicht schlicht um Fakten und Daten
(»Seiendes«), sondern um etwas »an« ihnen: um Sinn und Bedeutung. Darum aber müssen wir
das Paulus-Wort vom »Einsehen« des Unsichtbaren richtig lesen.
Auch für Gott und sein Erscheinen gilt das Paradox der Physiognomie, wonach R. Kassner erklärt
hat, »daß der Mensch nur so sei, wie er aussehe, weil er nicht so aussieht, wie er ist.« Gott also
ist nur so, wie er, das heißt, wie seine Schöpfung aussieht, weil er/sie nicht so aussieht, wie er ist.
Das ist der Grund, warum ihn nur die »Augen des Glaubens« erblicken.
IV. Offenbarung im Glauben
1. Wie anders kann das sichtbare Unsichtbare erblickt werden als durch Entscheidung dafür, im
Gewilltsein dazu? Erscheinung als Erscheinen gibt es nur für Freiheit - und insofern ist es stets
auch Erscheinung von Freiheit: Freiheit erscheint, indem ein Geschehen als Erscheinung
aufgefaßt und angenommen wird. - Geist, Freiheit, Wahrheit, Glück, Wohlwollen, Aufrichtigkeit alle »Gegebenheiten« solcher Art, sind keine Dinge, keine »Seienden«, sondern Seinsweisen,
Sinn von Daten. Darum werden sie nicht eigentlich be- und ergriffen, sondern sie ergreifen
ihrerseits. Man wird ihrer gewahr in einem Sich-Auftun der Besinnung auf Erfahrenes wie der
Offenheit für weitere Erfahrungen, das Religion - und jedes ernste Sprechen - Glaube nennt. Und
der steht nicht neben anderen Zugangsweisen; es geht nur so.
Das ist nicht theologisch-dogmatisch, sondern philosophisch gemeint: Glaube als
anthropologisches Faktum. Ich definiere ihn als umfassende Gesamtdeutung vorliegender Daten.
In eine solche geht stets auch die eigene Entscheidung ein. Gesamtdeutungen sind niemals
erzwingbar, im Gegenteil, man kann sogar - im positiven Fall - auch philosophisch schon von
»Gnade« sprechen: Wer Wohlwollen, Zuwendung, Freude erfährt, dankt darum doppelt, einmal
dafür, daß ihm solches begegnet, sodann daß ihm gegeben wird, es anzunehmen, statt es in
Mißtrauen (»Kleinglauben«) von sich zu weisen.
Hier ist die mittelalterliche Entgegensetzung von Glaube und Schau ebenso »aufzuheben« wie die
z.T. sich davon herleitende neuzeitliche Entgegensetzung von Glauben und Wissen. Freiheit zeigt
sich nur Freiheit; Absolutes kann darum nur derart als Absolutes erscheinen, daß es sich in
Kontingenz zeigt, und dies wiederum in doppelter Hinsicht.
Einmal ist die Freiheit, der es erscheint, kontingent (als notwendiger Ausfluß wäre sie selbst keine
Freiheit); sodann muß das Absolute in kontingenter Weise erscheinen, um sich selbst als absolut
(= frei) zu bezeugen. Eine bloße Denk- oder Seinsgesetzlichkeit wäre zwingend, doch nicht
wirklich absolut. Sie nötigte den Menschen letztlich als factum brutum: »dumme« Tatsächlichkeit,
wie beispielsweise die Schwerkraft; aber sie könnte ihn nicht als souveräner Anspruch betreffen.
Wenn die Tradition den »Wort-Charakter« der Schöpfung vertritt, dann ist zu ergänzen, daß ein
Wort stets gemeint wird. So gibt nicht eigentlich die Welt Gott zu erkennen (gar, »ob er will oder
nicht«); in ihr zu erkennen gibt vielmehr Er sich.
Ist Wort jedoch gemeintes Wort, dann erfüllt es sich erst dadurch, daß es gehört wird. Zu Gottes
Schöpfer-Wort gehört der geschöpfliche »Hörer des Wortes«. Erst in seinem Hören findet das
Wort Gottes seine Wirklichkeit (wobei selbstverständlich, wie eben bedacht, dies Hören seinerseits
von Gott erwirkt ist).
Und der letzte Satz gilt wieder auf zwei Ebenen: einmal bezüglich jeden Schöpfungs-Wortes, also
aller Geschöpfe (biblisches Bild dafür ist die offizielle Benennung der Tiere durch Adam). Man
könnte sagen: erst durch unser »Abzeichnen« erhalten Gottes Werkstücke ihr Siegel.
Dann aber gilt dies auch für den Hörer und »Abnehmer« selbst. Sofern in ihm erst das Wort
Gottes vollends Wort wird, ist er selber in wesentlich höherem Sinn Gottes Wort - Wort nicht bloß
als Wortzeichen, sondern Wort als existierender Begriff = existentes Begreifen, oder besser weniger idealistisch - als lebendige Antwort. Hölderlin sagt: Gespräch.
2. Antwort aber und Gespräch müssen hier im gefülltesten Sinn verstanden werden. Es geht nicht
bloß um Worte, sondern um eine Weise, zu sein und zu leben. Wenn »meine menschliche Person
nichts ist als die Weise, wie ich von Gott gerufen bin, und wie ich auf seinen Ruf antworten soll«
(R. Guardini), dann ist der Mensch zwar auch in seinen religiösen Theorien, doch vor allem in
gewissen-hafter Menschlichkeit die Offenbarung Gottes.
Das aber spitzt unser Fragen nochmals zu. Als was offenbart denn die Menschengeschichte den
Welt-Grund? Besteht ihre Menschlichkeit nicht gerade in ihrer Unmenschlichkeit? Kardinal
Newman: »Wenn ich in einen Spiegel blickte und darin mein Gesicht nicht sähe, so hätte ich
ungefähr dasselbe Gefühl, das mich jetzt überkommt, wenn ich die lebendige, geschäftige Welt
betrachte und das Spiegelbild ihres Schöpfers nicht in ihr finde...«
Newman betont, er spreche hier nur für sich selbst; eine objektive Würdigung der Beweisgründe
aus Welt und Geschichte liege ihm fern. Und ich folge ihm darin. Tatsächlich ist hier nichts
entschieden. Wer erklärt, daß nach Auschwitz nicht mehr von Gott die Rede sein dürfe, muß sich
fragen lassen, wie er zu den Betern in Auschwitz stehe. Doch schuldet der Kritiker nicht nur ihnen
Respekt. (Hierzu - nach der früheren Theologen-Schelte - die Warnung, über Auschwitz das Leid
anderer gering zu achten. »Singulär« ist - vielleicht - [bis jetzt] die Effizienz jener bürokratisierten
Tötungstechnik; aber hat das Böse selber seinen Sitz nicht im Herzen? Ist nicht schon, wer haßt,
ein Menschenmörder (1 Joh 3, 15)? Und wäre nicht ein jeder Einzelne - umgebracht oder gerettet
- [Yad-wa-Shem] »eine Welt«?)
Entsprechend »redete« für Newman das Schweigen. Aufgrund nämlich jener »Stimme, die so
deutlich in meinem Gewissen und in meinem Herzen spricht«. Behalten wir daraus für unsere
philosophische Überlegung, daß die Absolutheit Gottes nur und eben in der Kontingenz
menschlicher Freiheit aufgeht. Daß wir sodann diese Freiheit nicht nur im Blick auf die Dinge und
ihre Einschätzung haben, sondern darin vor allem Gott selbst gegenüber und in der Deutung
seines Sich-Zeigens. - Gottes Göttlichkeit erscheint zwar auch in der Natur, doch grundlegend und
eigentlich in unserer Welt- und Selbst-Interpretation. - Gottes Göttlichkeit wird im Zeugnis des
Menschen offenbar.
V. Treue, die hofft
1. Damit aber tieft die Rätselhaftigkeit des Daseins, von der unser Überlegen ausging, sich ins
Unergründliche. Wie ahnungslos sind jene Thesen der Religionskritik, die Religion und vor allem
das Wort der biblisch-christlichen Offenbarung als Wunschtraum und Palliativ zu entlarven
behaupten!
Ohne die Glaubensbotschaft in sich bedenken zu wollen, können wir schon philosophisch sagen,
daß sie die Probleme des Menschen nicht auflöst, sondern im Gegenteil zuspitzt. »In gewissem
Sinn wird das Problem des Schmerzes durch das Christentum eher geschaffen als gelöst; denn
der Schmerz wäre kein Problem, hätten wir nicht, vergraben in unsere tagtägliche Erfahrung mit
dieser schmerzerfüllten Welt, dennoch die, wie wir glauben, gültige Versicherung empfangen, die
letzte Wirklichkeit sei voller Gerechtigkeit und Liebe« (C. S. Lewis).
Das eindrucksvollste Bild dafür ist der am Ölberg um sein Leben Flehende, der nicht erhört wird,
oder vielmehr: so erhört, daß ihm die Kraft zur Annahme der Nicht-Erhörung geschenkt wird (bei
Lukas durch einen stärkenden Engel).
Angesichts dessen scheint selbst in philosophischer »Außen«-Perspektive die Rede von einem
Rätsel kaum noch passend. Ein Rätsel will gelöst werden; hier aber geht es darum, etwas zu
leben; ja, offenbar sogar darum, aus ihm zu leben. Bildhaft ließe sich sagen, in der zu meisternden
»horizontalen« Spannung zwischen Lebensraum und Fremde treffe hier den Menschen »von
oben« ein »blendendes« Licht. Bietet sich hierfür ein besseres Wort an als »Geheimnis«? Was
hier verlangt wird, scheint weniger Scharfsinn und Kombinationsvermögen zu sein als Vertrauen
und Treue. Darum ist Glaube nicht, wie oft zu hören, eine Hypothese, sondern durchzutragende
Entscheidung (wie Freundschaft und Ehe).
Im Anruf dazu aber wird die wahre »Absolutheit« Gottes sichtbar: seine Heiligkeit und Herrlichkeit,
und dies zugleich mit der erfüllten »Kontingenz« des Geschöpfs: der gläubigen Hingabe freien
Gehorsams.
2. Und unsere Fragen? In einem Grundbuch des Abendlands Trost der Philosophie hat sie vor
seiner Hinrichtung Boethius 523/24 auf den Punkt gebracht. Mit einer Doppel-Frage: »Wenn es
Gott gibt, woher Übel und Böses? - Wenn es Gott nicht gibt, woher das Gute?«
Auf die erste Frage lautet die Antwort zuletzt, soviel an Vorletztem vorgebracht werden kann: Ich
weiß es nicht. Es ist an der Philosophie, Antwort-Programme, die mehr sagen wollen, ihrer
Haltlosigkeit zu überführen. Und das gilt für positive wie für negative Angebote. Den Stachel des
Schmerzes zieht keine Theorie aus dem Fleisch. Das Theodizeeproblem ist in der Tat unlösbar.
Eben darum aber sollte man sich auch den Lösungsversuch durch Leugnung Gottes versagen. Er
unterbietet das Frageniveau - und nimmt übrigens Ijob zu allem anderen noch seine Würde: sein
Protest wird Irrtum, sein Appell an den Heiligen anthropomorph, seine Hoffnung kindliche Illusion.
Aber Boethius hat eine zweite Frage gestellt: Wenn es Gott nicht gibt, woher das Gute? Und
darauf heißt die Antwort nicht: Ich weiß nicht. Sehr wohl nämlich wissen wir: Wenn kein Gott ist,
dann gibt es - letztlich - kein Gutes. Nicht in der Zukunft, für die Zu-kurz-Gekommenen,
Erniedrigten, Beleidigten; erst recht nicht für die Henker - oder auch tatenlosen Genießer. Von
dorther jedoch auch nicht ernstlich im Heute. Glück wäre dann nur aufgrund von Wegsehen,
»Vergessen« denkbar. Wird dies aber der Erfahrung und unserer Dankbarkeitspflicht gerecht? Ist
uns wirklich kein Gutes begegnet? Allem anderen voraus in der - durchaus belastenden und
demütigenden - Gewissenserfahrung. Wie zu Newman hinübergesprochen kommt bei Levinas
Gott als der Heilige ins Denken: als jene Macht, die uns »zur Güte drängt (was mehr besagt als
alle Güter, womit man uns überhäufen könnte)«.
Das ist nicht der unerlaubte Versuch, die Frage nach dem, was wir hoffen dürfen, mit einer
Auskunft auf die, was wir tun sollen, zu beantworten. Wir bleiben durchaus in der Theorie. Danach
aber ist die Doppelfrage des Boethius auch doppelt zu beantworten: Ich weiß nicht - ich weiß. Ich
weiß nicht, warum (die Zulassung von) Leid und Bosheit. Ich weiß, daß im Ernst es ohne Gott kein
Gutes gibt. Ich weiß zugleich (will sagen: ich habe erfahren und erfahre), daß es das Gute gibt
(daß es sich mir gibt und vor allem, daß es sich mir aufgibt). Darin aber gibt sich der Gute: Gott.
Diese Erfahrung erzwingt nichts. Doch sie erlaubt in Redlichkeit die Entscheidung für einen
Glauben, der die Antwort auf die erste Frage von Gott selbst erwartet. (Und nur von Ihm - mit
weniger nicht zufrieden.) Daß der Glaube(nde) daran - auch gegen »fromme« Denkverbote festhält, sehe ich aus seiner Würde und der Würde dessen, dem er wissend glaubt, geboten.
3. Darum ist übrigens auch die Unterscheidung von Wollen und Zulassen nicht so leicht abzutun,
wie man mitunter liest. Wer Böses tut, ist böse; wer es zuläßt, wäre dies erst, wenn er sich nicht
rechtfertigen könnte. Wie Gott dies könne, angesichts der Schrecklichkeiten in Welt und
Geschichte, weiß der Glaubende nicht. Ich mache mich obendrein anheischig, jeden konkreten
Erklärungsversuch des Zynismus zu überführen.
So das Kontrast- oder Ganzheitsargument, von dem zu Anfang, bei Plotin, die Rede war. Ein
anderes stellt darauf ab: daß endliche Freiheit, die um der Liebe willen sein soll, die Möglichkeit
von Schuld beinhaltet. Dies mag so sein (ist es sicher?); sicher ist jedenfalls, daß Möglichkeit - vor
allem eine solche Un- (= Wider-)Möglichkeit nicht ihre Realisierung verlangt, im Gegenteil.
Ein äußerstes Argument ist die Frage K. Rahners, ob in der Praxis unseres Lebens die Annahme
des Geheimnisses Gottes nicht allein in der schweigenden Annahme der Unerklärlichkeit und
Unbeantwortkeit des Leides geschehe. Würden wir sonst nicht nur eine Gottes-Idee, nicht Gott
selber bejahen? Eine ernsthafte Gewissens-Frage. Und sie sprengt das Religionsverständnis, mit
dem wir begonnen haben; denn statt um ein Sich-Einheimaten in der Welt geht es nun darum,
aufzubrechen, sich zu verlassen: auf das göttliche Geheimnis. Gleichwohl läßt die Frage schon
bzgl. des Schmerzes offen, warum er so weh tut. Und erklärtermaßen spricht sie nicht von der
Schuld.
Zur Schuld aber jetzt nur dies: So schlimm wie religiös anscheinend naheliegend ist jene
»Zuversicht«, für die S. Freud Heinrich Heine zitiert: »Bien sûr, qu'il me pardonnera; c'est son
métier.« - Objektiv nicht weniger blasphemisch wird die Rede von der felix culpa, sobald sie nicht
mehr aus reiner Dankbarkeit spricht, sondern vergleichend sagen soll, Sünde sei besser als
Unschuld - als ob Bewahrung weniger wäre als Rettung.
Das entschiedene »Keineswegs«, mit dem Paulus dem Vorschlag begegnet: »Bleiben wir bei der
Sünde, damit die Gnade sich häufe!« (Röm 6, 1f), hat doch nicht bloß Zukunftsbedeutung,
sondern gilt schlechterdings, also auch im Rückblick. Wer das nicht akzeptiert (im Gefolge Hegels,
für den das Nicht-sein-sollen des Bösen nur bedeutet, daß es »aufgehoben« werden solle), der
hätte konsequent zu vertreten: Besser Auschwitz samt Verzeihung als keines.
Nochmals also: Nicht bloß die Antwort, schon deren Möglichkeit kennen wir nicht. Aber der
Glaubende muß auch das Wie einer möglichen Antwort nicht wissen und kann dennoch
verantwortet hoffen. Denn nicht erst das Wie einer Zukunft, welche »alles neu« und heil macht, ist
uns unerschwinglich, schon das Wie der »ersten« Schöpfung kennt keiner (nicht zuletzt der
Schöpfung seiner selbst: daß aus der Verschmelzung zweier Gameten ein Wesen von Würde
hervorging).
W. Dirks berichtet als private Äußerung R. Guardinis aus den letzten Jahren, er werde nach dem
Tode, über sein Leben befragt, auch seinerseits Fragen stellen. Doch konnte schon früher jeder
bei ihm lesen, das Endgericht sei die Antwort und Selbstrechtfertigung Gottes.
Daß diese Antwort keine Hegelsche Gesamtgeschichtsschau bieten muß, versteht sich. Werden
nicht überhaupt Lebensfragen weniger beantwortet als gelöst? Statt auf Auskünfte also (oder
»ästhetische« Lösungen: in der Musik, in Bild und Mythos) wartet Hoffnung auf das alles
umwandelnde Wort von Gottes Selbstzusage.
Ijob erhält es im An-Blick Gottes und findet darin Frieden: »... jetzt aber hat dich mein Auge
gesehen.« Ähnlich erhofft bei Saint-Exupéry der Herr der Wüsten-Citadelle ein »Angesicht, das
genugtut und stillt«.
Für weitere Entfaltung und Belege siehe: Gotteserfahrung im Denken, bes. Kap. 3 u 9
(Anthropozentrik [die Sinnfrage] - Die Frage Ijobs); Liebe zum Wort. Gedanken vor Symbolen,
Frankfurt/M. 1985, Kap. 9 (Der Schmerz und die Freude. Bedacht mit C. S. Lewis); Spiel-Ernst,
bes. Kap. 1, 3 u. 4 (Sich einlassen auf das Spiel? - Leben im Todes-Licht - Schwachheit als Gnade
und Wohltat des Schmerzes); Denken vor Gott, Kap. 10 (Sprachlos vor Leid und Schuld?).
ANTWORT DES GERUFENEN: DANK - BITTE - LOB
Spricht man wirklich von Gott und seinem Wort zu uns, wenn man vergißt, daß er zuhört? Ist (oder
wird) man sich aber dessen bewußt, dann gibt es letztlich nur eine Antwort auf diese Situation:
unser Wort zu ihm.
Dabei sei mit Gebet nicht schon und nur das ausdrückliche private oder gemeinsame »Sprechen
zu Gott« gemeint, sondern zunächst ein Grundvollzug: jener prinzipielle und umgreifende Aspekt
an der Wirklichkeit von Person, der dann - und zwar nicht beliebig, sondern wesentlich - sich in
einer bestimmten, eben der religiösen, Dimension thematisiert und hier konkret wird im
ausdrücklichen Gebet. Der Mensch als Wesen des Wortes (Zôon lógon échon) ist ursprünglich
Wesen von Antwort.
I. Dank der Selbstannahme
Diese Antwort ist allererst Dank. Andacht, hat Hegel erinnert, kommt von Denken. Ebenso hängt,
wie mehrfach Martin Heidegger betont hat, mit Denken Dank und Dankbarkeit zusammen. In der
Tat sollte es keiner Worte bedürfen, damit klar sei: ein Wesen, das sich und sein Leben nicht
selber ermöglicht, das sich einem Ursprung verdankt, hat im Bedenken seiner Existenz nicht nur
einfach sich und sein Dasein, sondern gerade auch dieses Verdanken seiner wissentlich und
willentlich zu vollziehen, das heißt aber: zu danken.
Wer sich und den andern nicht schafft, der kann sich und den andern und alles nur annehmen.
Annahme aber ist der Grundvollzug von Dank. Anders gesagt, es geht um die Grundannahme von
»Kontingenz«: um die Erkenntnis und Anerkenntnis der Unselbstverständlichkeit dessen, was ist.
»Contíngit« heißt (wie bereits angesprochen): es trifft sich, trifft ein, es glückt, und sagt damit ein
Doppeltes: 1. was sich da ereignet, muß(te) nicht sein, 2. »glücklicherweise« ist es gleichwohl (sei
dieses »Glück« nun fortuna secunda oder adversa, also dem Betroffenen günstig oder zuwider).
An beidem nun setzen, und nicht erst heute, Einwände ein. Zum ersten braucht man nicht viel zu
sagen. In der Selbsterfahrung von Freiheit, in der Erfahrung des unbedingten Anspruchs an sie
und in der Erfahrung, rechtens für sich unbedingte Achtung verlangen zu dürfen, erfährt Person
unmittelbar, daß sie nicht bloßer Naturnotwendigkeit oder (was zuletzt auf dasselbe herauskäme)
purem Zufall entspringt. Sie muß nicht sein, sie soll und darf es.
Zum zweiten kann man - wie bedacht - nicht viel sagen, zur Frage von Übel und Schuld; dazu,
daß keineswegs alles, was uns begegnet, beglückenderweise so ist, wie es ist. Immerhin, wenn
man dem Glaubenden vorhält, Glück sei, wenn nicht gar Zynismus, mindestens
Gedankenlosigkeit, so muß ihm die Antwort erlaubt sein, daß Widersinn erfahrenen Sinn nicht
ungültig macht, und außerdem die Gegenfrage, wieviel Mangel an Gedenken umgekehrt in der
Behauptung wirke, alles liege völlig im argen.
Mehr als nur ein argumentum ad hominem: Wer, der vertritt, er wisse nicht, wofür danken, könnte
das überhaupt artikulieren, wenn ihm nicht jenes Ausmaß unselbstverständlicher Liebe geschenkt
worden wäre, ohne das er längst - am Syndrom des »Hospitalismus« - zugrundegegangen wäre?
Und will er erwidern, er spreche gerade für jene, die sich eben deshalb selbst nicht äußern
können, dann wird - allen weiteren Erörterungen zuvor - sein mitmenschliches Engagement nur
dadurch glaubhaft, daß es sich mit dem Dank an jene verbindet, ja aus ihm sich speist, denen er
sein Sich-engagieren-Können und -Wollen verdankt. Und dieser Dank bleibt nur ein solcher (ohne
schließlich doch bio-psychologisch wegerklärt werden zu müssen), wenn er sich zugleich als Dank
an Den erkennt, dem sie verdanken, daß jemand ihnen etwas verdankt.
Im übrigen ließe sich zeigen, daß tätige Hilfe, jegliche Form von aktiver Veränderung bestehender
Verhältnisse, wenn sie nicht verkappte Verzweiflung, und das heißt zuletzt: zerstörerisch sein soll,
Hoffnung voraussetzt. Hoffnung aber lebt aus der Überzeugung (und dankt noch einmal dafür, daß
ihr diese geschenkt ist), es gebe trotz aller Sinnwidrigkeiten eine Garantie, und das besagt
notwendig: einen Garanten, endgültigen Sinns.
Anderseits ist niemand anderer als eben dieser Garant zugleich die letzt-zuständige Instanz für
Anfragen hinsichtlich dessen, »wofür man« - nach einer tiefsinnigen Redewendung - »sich nur
bedanken kann«: Adressat auch der Klage, An-klage, des Protestes. Ich sehe dies nicht
einfachhin als Widerspruch zum Dank, sondern als eine eigene (»kontrastive«) Modalität seiner.
Die Gemeinsamkeit besteht darin, daß hier wie dort die »Zuständigkeit«, die Autorität des
Angesprochenen anerkannt wird - und seine »Ansprechbarkeit«. Ijob beklagt sich über Gott - bei
ihm.
Die Christen haben sich dies - wohl infolge des Ostergeschehens - verboten und so verlernt und
vergessen. Zu ihrem Schaden, wie man heute neu entdeckt. Wenn man nämlich Schmerz und
Zorn nicht wahrhaben darf, wenn - »Was Gott tut, das ist wohlgetan« - das klagende Warum? (das
doch auch unser Herr gefragt hat) und das Hadern untersagt sind, dann wird man sein Herz
verhärten und verliert an Mitempfinden, man gerät in Groll und Ressentiment gegen Gott, was den
Einzelnen selbst wie das Verhältnis der Seinen untereinander vergiftet. Umgekehrt belegt der
Psalter, daß gerade Klage und Protest zu einer Innigkeit mit Gott führen wie wenig sonst. So
wandelt die Klage sich schließlich auch wörtlich in Dank.
Dank ist, anders gesagt, das Wort des Glaubens endlicher Freiheit. Glaube meint uns hier,
philosophisch genommen, eine Gesamtdeutung sich bietender Fakten, die - als Gesamtauslegung
- sich aus den Fakten allein nicht als einzig mögliche ausweisen kann, in die also Entscheidung
mit eingeht. Wort und Tat eines andern als Zeichen ehrlichen Wohlwollens zu akzeptieren (es ihm
»abzunehmen«): ihm also zu glauben, daß er sagt, was er meint, und in Wahrheit so ist
(zumindest sein will), wie er sich gibt, stellt jene Annahme dar, die wir eben als den Grundvollzug
von Dank benannt haben. Die Ausdrücklichkeit dieses Vollzugs ist das Dankwort.
Wenn Sinn nur so erfahren werden kann, daß man ihn glaubt (vom Widersinn gilt das übrigens
gleichfalls), dann erfüllt sich solche Sinn-Annahme im Dank.
II. Hoffnung erbittet
Protest wie »tätiges Verändern« anderseits zielen eigentlich nicht mehr so sehr auf die Frage des
Danks; sie blicken voraus. Ihnen geht es um neue, bessere Zukunft. Direkt ist damit in den
heutigen Diskussionen das Gebet gemäß seinem etymologischen Grundsinn gemeint: als Bitte.
Beten als Bitte, erklärt man uns, sei infantil. Sein Muster: das Kind, das auf dem Weg von der
Schule nach Hause die roten Striche im Schulheft wegbeten will. Das Bittgebet denke sowohl von
Gott wie vom Menschen zu niedrig.
Das erste Schlagwort hierzu lautet »Manipulation«. Als Antwort darauf sei jetzt nur ein Text Hegels
zitiert: »Man hat, z. B. auch in der Kantschen Philosophie, das Beten so ansehen wollen als sei es
Zauberei [dies war damals das Wort], weil der Mensch nicht durch natürliche Vermittlung, sondern
vom Geist aus etwas dadurch bewirken will. Aber der Unterschied ist, daß im Gebete der Mensch
sich an einen absoluten Willen wendet, für den doch der Einzelne Gegenstand der Fürsorge ist,
der das Erbetene gewähren kann oder nicht, der überhaupt dabei vom Nutzen des Guten
bestimmt ist.« - Mit einem Wort: Gebet zur Allmacht ist das völlige Gegenteil jeder Magie.
Wir haben hier nicht von Fehlformen und Selbstmißverständnissen, die bekannt - und offenbar
unausrottbar - sind, zu handeln, nicht vom stets auch gegebenen »Unwesen«, sondern vom
Wesen des Betens. Dazu aber sei hier als These vertreten: Wie der Dank das Wort des Glaubens
als der Selbst- und Welt-Annahme endlicher Freiheit ist, so bedeutet die Bitte das Wort der
Hoffnung als Grundvollzug angewiesener Freiheit. Ist Dank der Vollzug gewährter Herkunft, so
Bitte die Weise, wie Endlichkeit fundamental ihre Zukünftigkeit vollzieht.
Am Anfang der neuzeitlichen Philosophie hat Descartes das Gemeinte in aller zu wünschenden
Deutlichkeit formuliert: »Man kann die gesamte Lebenszeit in unzählig viele Teile teilen, deren
jeder von den übrigen in keiner Weise abhängt. Dann folgt also daraus, daß ich kurz zuvor
existiert habe, keineswegs, daß ich jetzt existieren muß, es sei denn, daß irgendeine Ursache
mich für diesen Augenblick gewissermaßen von neuem schafft, das heißt, mich erhält.«
Anders - personaler: der Anspruch, der sich und mich mir gibt, verlangt seine Annahme.
Angerufene Freiheit, die sich als Gabe erhält, erhält sich darin zugleich als Aufgabe ihrer, und dies
so, daß eben dies Annehmen ihrer selbst, die Erfüllung der ihr gegebenen Aufgabe noch einmal
ihr gegeben werden muß. Dies bedacht, zeigt sich, daß Bitte nicht etwas ist, das gänzlich anders
und neu neben dem Dank steht. Dank ist vielmehr nur dann wirklich Dank, das heißt Anerkenntnis
vollen Sich-Verdankens, wenn er sich ins Bitten vollendet.
Das meint: abkünftige Freiheit verdankt nicht nur Herkunft und Gegenwart ihrem Ursprung,
sondern auch ihre Zukunft. Sie kann darum nicht den Dank für das bisher Gewährte »hinter sich
bringen«, um dann sozusagen allein, aus eigener Kraft ihr Leben fortzusetzen. Auch für mein
Morgen habe ich zu danken - und kann das schon heute sagen.
Andererseits bin ich nicht sicher, dieses Morgen zu erleben. Darum erhält mein heutiges Dankwort
die Sprachgestalt des Konditionalen: »Ich danke Dir mein Morgen, wenn ich es erhalte.« -
Schließlich ist es dem Menschen - rechtens - nicht gleichgültig, ob er das Morgen (und wie er es)
erleben wird. Leben heißt hoffen. Darum spricht das bloße Bedingungsgefüge noch nicht voll aus,
was er meint.
Unser Grundwort bezüglich der Zukunft hat also in einem drei Momente zu artikulieren: das
Bekenntnis der eigenen Machtlosigkeit (die das Morgen nicht machen, nur annehmen kann), das
Bekenntnis zur Freiheit jener Macht, der wir dies Morgen verdanken, wenn sie es gewährt (ohne
daß sie dies müßte), und das Bekenntnis unseres Wunsches nach Zukunft, unserer Hoffnung
darauf. Soll und will nun der Mensch diese Dreieinheit nicht bloß in theoretischem Reden-über,
sondern in personaler Anrede zur Sprache bringen, dann kann er dies allein in der Sprachform der
Bitte.
Deshalb bittet der Dankbare: nicht weil er meint, Gott müßte zu weiteren Gaben erst von ihm
genötigt werden, sondern um im Gegenteil die Freiheit seiner Gabe zu bekennen, die allein in
solchem Bekenntnis als das entgegengenommen wird, was sie ist: als freies Geschenk. - Hierher
gehören jene Texte der christlichen Glaubensurkunde - bei allen Mahnungen zum Bittgebet - ,
wonach Gott seinerseits sich dem Menschen anbietet, ja ihm - in seinem Sohn - schon alles
gewährt hat.
So reich und vielfältig wie auch das Leben des Menschen sind seine Erwartungen an die Zukunft.
Er erhofft Großes und Geringes, engagiert sich in übergreifenden Lebensentwürfen, steht unter
Weltängsten, freut sich auf ein gutes Gespräch unter Freunden heut abend... Worauf stützt er sich
nun mit seiner Hoffnung? Nur auf sein eigenes Können, auf die Gesetze des Weltlaufs, sein Glück
- oder zuletzt auf die Treuezusage eines persönlichen Gottes? Anders gesagt, wird unsere
Hoffnung durch die Grenzen unserer eigenen Leistungsfähigkeit begrenzt (so daß jenseits dessen
nur ein resignierendes »Schön wär's [gewesen]« oder utopische Wunschträume blieben) oder
reicht Hoffnung begründet darüber hinaus - als dialogische Hoffnung?
Diese Frage stellt sich nicht zuletzt bezüglich unserer Solidarität mit den Toten. Müßte sie sich mit
der Erinnerung an sie begnügen und damit, »ihr Werk fortzusetzen«? Wäre so etwas aber - in
seinen nur zu bescheidenen Maßen - wirklich deren eigene Zukunft?
Statt zu entfalten, was diese Alternative für Liebe und Menschlichkeit überhaupt impliziert, möchte
ich über diesen Anstoß hinaus auf ein zweites Tabu der Gegenwart zu sprechen kommen, die
Schuld.
Schuld, die kein Bessermachen gutmachen kann, ist allein durch Vergebung aus Gnade zu tilgen.
Und der Schuldige weiß das. So wie »Vorsatz« ohne »Reue« keiner wäre (sondern bestenfalls scheiternde - »Flucht nach vorne«), so wäre Reue nicht sie selbst (sondern »Gewissensbiß«,
»Selbstkritik» oder Verzweiflung), bäte sie nicht um Verzeihung.
Zunächst richtet sich diese Bitte gewiß an den Menschen, den man verletzt hat. Aber sie reicht
zugleich, wie vorher der Dank, über ihn hinaus. Denn einmal hat man nicht nur ihn verletzt,
sondern darin auch jene Wirklichkeit, die J. G. Fichte in Jena die »moralische Weltordnung« und
die Bibel den »Himmel« genannt hat (vgl Lk 15, 21: »Vater ich habe mich gegen den Himmel
verfehlt und vor dir«). Sodann: sollte der andere völlig auf mein Vergeben angewiesen sein angesichts dessen, daß Vergebenkönnen auch in dem Sinn eine »göttliche Möglichkeit« des
Menschen darstellt, daß wir ihrer nur eingeschränkt Herr sind, so daß wir entweder vergessen
(und nicht mehr vergeben müssen) oder zwar vergeben, aber nicht vergessen können (vielleicht
gar nicht vergessen dürfen)? Schließlich: Welche Zukunft hat man, wenn das Opfer tot ist? Jedenfalls hier reicht es keineswegs zu, das Bittgebet nur als den (sich noch theistisch
mißverstehenden) Versuch zu deuten, meditativ mit dem Weltlauf in Einklang zu kommen.
Verzichtet der Schuldige darauf, sich seine Schuld wegzuerklären, wehrt er sich dagegen, sie sich
wegerklären zu lassen (eine Operation, in deren Konsequenz die Wegerklärung seiner Freiheit,
also seiner Menschlichkeit, läge), dann stellt sich zuletzt die Alternative: bleibendes,
unaufhebbares Unheil oder Hoffnung auf unausdenkbare Neuschöpfung durch göttliche
Vergebung. Und es meldet sich zugleich die Frage, ob angesichts dieser Alternative der Mensch
überhaupt dazu fähig sei, sich schuldig zu bekennen, es sei denn aus der Kraft der Hoffnung auf
solche Vergebung aufgrund der Gnadenzusage seines Gottes.
In der Tat spricht alles dafür, daß der Mensch nicht bloß sein Schuldbekenntnis einzig als
Bestandteil einer Bitte um Vergebung aussprechen kann, sondern daß er darüber hinaus dieses
bloß als Antwort auf ein Urteil sprechen kann, das seinerseits nicht einfach sagt: »Du bist
schuldig«, sondern: »Ich biete dir Vergebung an (denn du bist schuldig und deshalb ihrer
bedürftig) - darum rufe ich: Kehr um!«
So hängt offenbar alles an dem möglichen Zuspruch, auf den die Vergebungsbitte Antwort sein
darf. Wenn die göttliche Macht nicht ansprechbar wäre (im doppelten Wortsinn) und wenn sie
ihrerseits nicht an- und zusprechen könnte, wenn ihre Wirklichkeit unterhalb des DuhaftPersonalen läge, wäre Verzeihung nicht möglich.
Die Grundentscheidung in dieser Frage entspricht der eben angesprochenen Wahl. Dort ging es
darum, entweder meine konkrete Schuld vom möglichen bzw. nicht möglichen Schuldigwerden
und -seinkönnen des Menschen her zu denken (also wegzudenken) oder Freiheit und
Schuldmöglichkeit des Menschen von meiner konkreten wirklichen Schuld her zu begreifen. Jetzt
geht es darum, entweder die Möglichkeit (bzw. Unmöglichkeit), den möglichen Sinn (bzw. Unsinn)
des Gebets von einem anderswoher konstruierten Begriff des Heiligen aus, vom Göttlichen, GanzAnderen oder wie immer her zu denken oder vom gelebten, vollzogenen Gottesbezug her, vom
Gebet zu Gott, das Reden von und über Gott zu erwägen. Über einen Gott, von dem der Aquinate
sagt, er wolle uns im Bittgebet die Wüde des Mit-Wirkenden verleihen.
»Mein Gott«, sagt der Beter; dieses Grundwort spricht Ijob, es wird vom gekreuzigten Jesus
überliefert, es wurde in den Qualen nicht nur etwa des Dreißigjährigen Krieges gesprochen, und
wir wissen, daß es auch in den nazistischen Vernichtungslagern nicht erstickt werden konnte. Damit ist jetzt weder ein »Gottesbeweis« (siehe Kap. 2) noch eine »Theodizee« (Kap. 4)
beabsichtigt, Wohl aber dies:
Erstens wird Respekt für den Beter gefordert, gegen die Unterstellung, er habe entweder den
Ernst des Lebens nicht begriffen oder nichts Schweres erlebt oder er habe ein so »dickes Fell«,
daß ihn nichts anfechte, oder er rette sich infantil in ein Märchenland von zauberhafter
Wunscherfüllung. - Das ernsthafte Zeugnis empfangenen Sinns verdient nicht geringere Achtung
und Würdigung als Zeugnisse des Sinnentzugs.
Zweitens sei in aller Schärfe die Alternative herausgestellt, die sich hier auftut, ohne
verschleiernde Mittelpositionen, die nicht anders als vorläufig sein können. Wenn der Mensch, will
er die Wahrheit über sich nicht niederhalten, sich schuldig bekennen muß, dann bleibt ihm letztlich
nur die Verzweiflung einer Hoffnungslosigkeit ohne Gott oder Hoffnung auf jenen, der sagen kann:
»Ich mache alles neu.«
Und darf man - im Gegenzug zur Verdächtigung der Religion auf die Unmenschlichkeit ihrer
Hoffnung - nicht auch einmal fragen, wie man solche Verzweiflung menschlich zu leben
vermöchte: im Weiterleben mit der eigenen Schuld, mit der Schuld anderer und zuletzt mit dem
Leid und Tod der andern, besonders der schuldlosen Kinder?
Man mag der Frage erwidern, eben dieses Übermenschliche sei von uns gefordert, und Religion
sei gerade die Flucht vor solcher Überforderung. Aber unsere Frage meinte »menschlich« nicht
als Gegenwort zu »übermenschlich«, sondern durchaus zu »unmenschlich«. Denn fraglich ist
gerade, ob ein solches Leben wirklich übermenschlich und nicht eher unmenschlich werden
müßte, verstünde der Mensch sich nicht auf »glückliche Inkonsequenzen«. Denn unmenschlich
würde es eigentlich gleichermaßen, wenn er sich noch Freuden gönnte (»guten« oder schlechten
Gewissens), wie wenn er sich rastlos, hoffnungslos für die Verbesserung der Welt verbrauchte.
Doch damit genug zu den dunklen Fragen um Tod und Schuld! - Ob hier oder wie in Salomos
Gebet um Weisheit, stets jedenfalls ist die Bitte des Geschöpfs, Wort seiner Hoffnung, Lob des
Herrn, aus dessen freier Zuwendung es sich und sein Handeln-können empfängt. - Wieweit also
wäre in der modischen Abwehr des Bittgebets auch der geheime Wille zur Verweigerung des
Lobes unserer Kreatürlichkeit wirksam? (Und - psychologisch gewendet - wieweit in der Angst
unserer »Mündigen« vor dem Kindsein pubertäre Selbstinflation?) Anders gesagt: Inwieweit wird
in der Warnung vor der »Indienstnahme« Gottes eine Herr-lichkeit abgewehrt, die selber sich als
dienstbar offenbart hat? Sie »dient« tatsächlich als tragender (Ab-)Grund unser und unserer Welt.
Indem der Dank gerufener Freiheit sich in der Bitte vollendet, bezeugt er die Absolutheit, die
Göttlichkeit des erfahrenen Anrufs, den man nie hinter sich bringt, der vielmehr stets neu auf mich
zu-kommt und immer neu mir - mich und sich und alles andere gibt.
III. Fest entzückter Liebe
Bleibt dies der »Andacht« und »Aufmerksamkeit« bewußt, dann darf man schließlich - in
gebotener Behutsamkeit - auch von der höchsten Möglichkeit menschlicher Antwort sprechen:
dem reinen Lob.
Behutsamkeit ist hier darum vonnöten, weil zunächst gilt, daß der Lobende sich mit seinem Lob
auf eine Stufe mit dem Gelobten stellt - wenn nicht gar höher. Und zwar entschiedener als etwa in
der Kritik; denn der Kritiker muß nicht in jedem Fall beanspruchen, das Ganze adäquat zu
überschauen; er ist im Recht, wenn ihm ein Fehler auffällt - jedenfalls dann, wenn es klar ist, daß
man ihn nicht als mögliches »Kontrastmoment« vermitteln kann und darf. Doch anders jener, der
lobt.
Noch wichtiger aber als dieser »objektive« Aspekt dürfte der subjektiv-innere sein. Im wahren Lob
nämlich sieht der Lobende von sich ganz ab. Gehört es nicht zur Kreatürlichkeit unseres Lobes
und damit zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit des Lobs des Geschöpfes, daß es nicht versucht oder
behauptet, von sich abzusehen? »Von sich«, das heißt hier ja, von seinem Sich-geschenkt-Sein
und -Werden, also von seinem Angewiesensein auf den göttlichen Herrn. - Schon zwischen
Menschen wäre den Geber zu loben statt ihm zu danken wohl eher beleidigend arrogant.
Oder doch nicht mit Notwendigkeit? »Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer
Pracht«, schreibt Goethe ein wenig resignativ. Aber kann Schönheit nicht wirklich zu, wie Kant
sagt, »interesselosem Wohlgefallen« befreien? Und so auch die Anmut des geliebten Menschen?
Mörike beginnt eins der schönsten Liebesgedichte unserer Sprache mit der Zeile: »Wenn ich von
deinem Anschaun tief gestillt.« (Damit klingt übrigens, wie bei 'Andacht' und 'Aufmerksamkeit', das
Thema 'Meditation' zumindest an. Es sollte hier darum im Hintergrund bleiben, weil die
gegenwärtige Situation wohl eher verlangt, auf der Dialogik des Betens, auch und gerade von
'Andacht', 'Aufmerksamkeit' und 'Gesamtorientierung', zu bestehen.)
Gewiß kann nur der völlig selbstlos sein, der sich völlig besitzt. Aber gerade wenn, wie Dank und
Bitte bezeugen, Gott als Geber göttlich selbstlos gibt, dann gibt er nicht sozusagen nur leihweise
oder unter Vorbehalt eines Rests, er gibt gänzlich. Und indem nun gerufene Freiheit dankbar ihre
Herkunft, bittend ihre Zukunft Augenblick für Augenblick wirklich erhält, indem sie aus der
Freigebigkeit sie berufender Freiheit zu sich selber freigegeben wird, wird sie zugleich auch von
sich und der Sorge um sich selbst befreit.
Dank und Bitte können sich ihr dann in dem vollenden, wofür sie immer neu dankt und worum sie
immer neu bittet: im Wagnis selbstvergessenen Lobs. Vollendet sich der Dank im Fest, dann ist
die Mitte des Festes der Lobpreis.
Die Diskretion bleibt darin gewahrt, daß immer wieder gedankt wird dafür und gebeten darum, den
Herrn loben zu dürfen. Dann aber ist dieses Lob der höchste Adel des Menschen; man könnte
sagen: es sei seine (das heißt, die ihm zugedachte) Göttlichkeit.
Nicht mehr Herkunft und Zukunft: stehendes Jetzt - nicht als Flucht aus der Zeit, sondern als ihre
Sammlung. Nicht mehr Sorge und Zweck, nicht Warum noch Wozu: reiner Sinn. Anders gesagt:
im Lobpreis ist Liebe ganz zu dem geworden, was sie ist.
Eben dies aber, nochmals, gerade nicht als endlich doch erreichtes Selbstgenügen (Autarkie), als
monologische Identität des zu sich gekommenen Selbst, sondern als Göttlichkeit des Geschöpfs,
geschenkte Göttlichkeit, als Vollgestalt einer Freiheit, die nun endlich ganz hat Antwort werden
dürfen. (Darum auch nicht isoliert atomistische, sowenig wie kollektiv anonyme, sondern
gemeinsame Antwort.) Und so, daß auch diese Vollendung - der biblische Name dafür ist »Heil« nicht mehr im Blick steht, sondern die Freude darüber, daß der Anruf nunmehr die ihm
entsprechende Antwort erfährt.
Herkunft
Glaube
(Protest)
Dank
(Confessio)
Zukunft
Hoffnung
(Protest)
Bitte
Gegenwart
Liebe
Lobpreis
Sind uns Augustinus zufolge Vergangenheit und Zukunft nur als je gegenwärtige zugänglich, so
haben wir demgemäß nun das Nacheinander zu dynamisieren und die Felder gleichsam
ineinanderzuschachteln. Glaube und Hoffnung zeigen sich dann als glaubende und hoffende
Liebe; Dank und Bitte werden, den Rückbezug »aufhebend«, zum Lobpreis des auf Gott
bezogenen Geschöpfs.
IV. Schlußfrage: Aggression oder Faszination?
Haben wir uns damit nicht zu weit mitnehmen lassen? Ist das nicht völlig utopisch? Immerhin kann
das Gesagte wohl »fragmentarisch«, »angeldlich« durchaus erfahren werden - allerdings nur im
Vollzug jener »Sazienz«, die im 2. Kapitel bedacht worden ist.
Sie ist, im zuvor bestimmten Sinne, Glaubenspraxis, also Sache von Entscheidung. Reflexion
kann diese Entscheidung nur reflektieren, nicht setzen; sie kann sie darum nicht voll theoretisch
legitimieren. Doch kann sie immerhin die Entscheidungs-Situation, also die möglichen
Alternativen, offen legen. Es wäre illegitim und unphilosophisch, gäbe sie vor, daß sie wenigstens
hierbei »rein theoretisch«, »rein objektiv« sei. Dies nicht nur deshalb, weil sie in solcher
Grundsätzlichkeit nicht neutral bleiben kann, sondern weil sie es als wesentlich praktische
Philosophie nicht sein darf.
Keiner ist hier neutral. Wie also denkt und versteht der Mensch sich selbst? Als Homo faber im
weitesten Sinn, der einzig durch seine Arbeit sich und seine Welt erst herstellt, mit »Prometheus
als dem vornehmsten Heiligen im philosophischen Kalender«? Dann wären die Grundkategorien
Kampf und Arbeit: Aggressivität. Wie weit entspricht dies wirklich der Selbsterfahrung von
Freiheit? Und wie weit ermöglicht es Hoffnung, die sich rechtfertigen läßt?
Der entgegengesetzte philosophische Heilige wäre wohl Sokrates, im Gehorsam gegenüber dem
»Daimonion«. Statt Arbeit und Kampf, die nicht fehlen, aber als so nicht sein sollend behauptet
werden, heißen dann die Grundbestimmungen: Verdanken und Liebe.
»In einer Zeit, die mehr denn je vom Sichbehaupten des Menschen bestimmt wird und seinem
Sichdurchsetzen, ist es schwer, eine Philosophie verständlich zu machen, die vornehmlich solche
Wahrheit bedenkt, die den Menschen angeht, gerade indem sie sich ihm entzieht, eine
Philosophie, die sich nicht scheut zu sagen, daß das Sein Liebe ist. Angesichts einer zunehmend
in Verzweiflung umschlagenden Unfähigkeit zur Liebe aber ist solche Philosophie vielleicht doch
nicht so unzeitgemäß« (U. Hommes).
Liebe aber erfüllt sich jenseits ihrer Arbeiten und Tätigkeiten in dem Fest von Dank und Bitte und
zuletzt im Lobpreis des Heiligen.
Liebe, schreibt Antoine de Saint-Exupéry in seinem nachgelassenen Hauptwerk, ist »vor allem
Übung des Gebets, und das Gebet ist Übung des Schweigens«. (Auch das Schweigen sei so, wie
vorher 'Kontemplation', zumindest angesprochen.) Eindeutig wird dieses Schweigen, indem das
Gebet sich als Anbetung in es aufhebt.
Und dies ist nun seinerseits die herrlichste Möglichkeit und Wirklichkeit eben des Menschen und
seiner Liebe. Oder gibt es Herrlicheres als die Lebensdichte und Präsenz, den »Überfluß« ganz
wachen, selbstvergessenen Entzückens? Es macht in der Tat nicht das Elend, sondern die Größe
des Menschen aus, »daß nicht die Menschheit das Ziel der Menschwerdung ist«. Als
Hoffnungsziel dieses leidvollen Werdens erscheint so der befreite, von sich freie Mensch: in
Gottes Licht das Licht erblickend (Ps 36, 10), wird er selber »Licht vom Licht«.
Lob als Anbetung ist der Dank des Menschen an den, der ihn zum Menschsein rief, doch nicht
mehr ob seines Gerufenseins, sondern einfach, weil die Göttlichkeit dieses Rufs ist, was sie ist:
»Wir danken dir ob deiner Herrlichkeit.«
Für Begründung und Belege: Lernziel Menschlichkeit, Kap. 6 (Wort zur Antwort: Gebet); Liebe
zum Wort, Kap. 2 (Fest der Sprache: Gründung im Kult); Spiel-Ernst, Kap. 5 (Festliches
Sprachspiel: Gott-Bekenntnis).
© PTH Sankt Georgen 2016 - Letzte Aktualisierung dieser Seite: 4. Oktober 2001