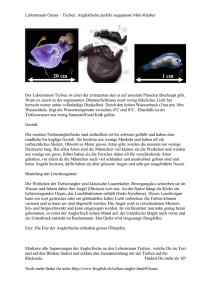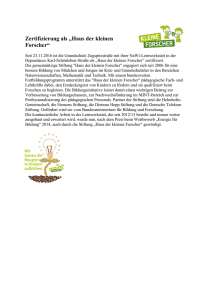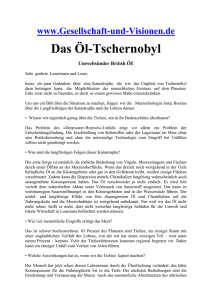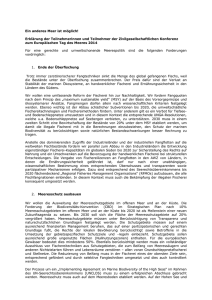Müll in 3000 Metern Tiefe
Werbung
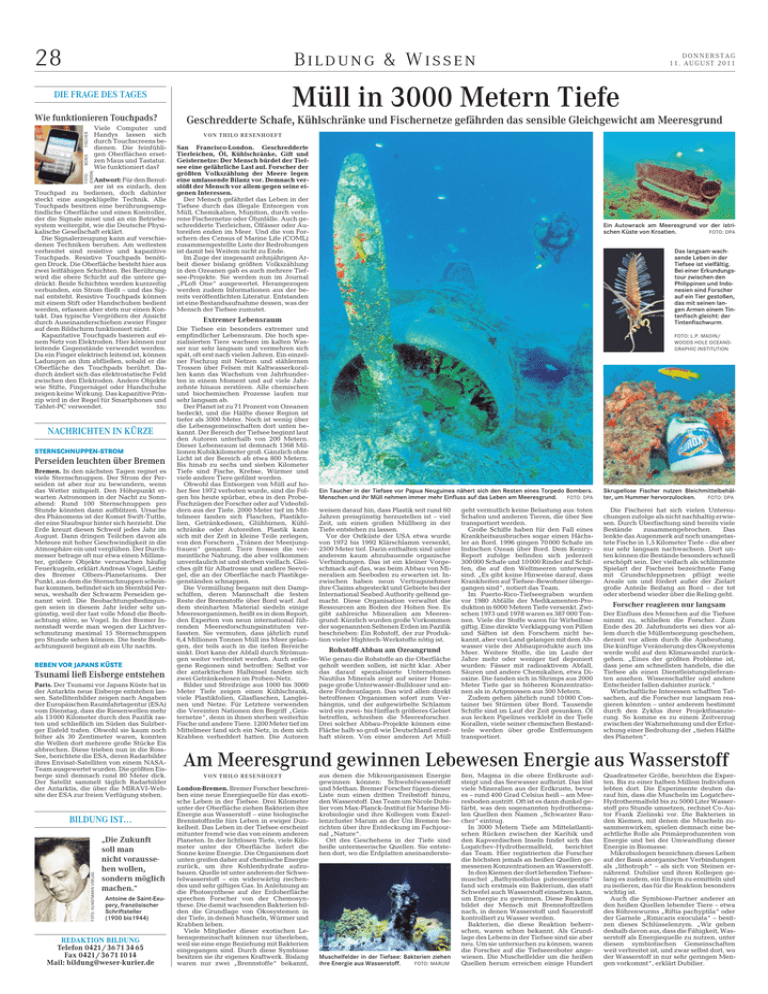
28 DONNERSTAG 11. AUGUST 2011 Bildung & Wissen Müll in 3000 Metern Tiefe DIE FRAGE DES TAGES Wie funktionieren Touchpads? FOTO: (EMSN) BORIS FISCHER Viele Computer und Handys lassen sich durch Touchscreens bedienen. Die feinfühligen Oberflächen ersetzen Maus und Tastatur. Wie funktioniert das? Antwort: Für den Benutzer ist es einfach, den Touchpad zu bedienen, doch dahinter steckt eine ausgeklügelte Technik. Alle Touchpads besitzen eine berührungsempfindliche Oberfläche und einen Kontroller, der die Signale misst und an ein Betriebssystem weitergibt, wie die Deutsche Physikalische Gesellschaft erklärt. Die Signalerzeugung kann auf verschiedenen Techniken beruhen. Am weitesten verbreitet sind resistive und kapazitive Touchpads. Resistive Touchpads benötigen Druck. Die Oberfläche besteht hier aus zwei leitfähigen Schichten. Bei Berührung wird die obere Schicht auf die untere gedrückt: Beide Schichten werden kurzzeitig verbunden, ein Strom fließt – und das Signal entsteht. Resistive Touchpads können mit einem Stift oder Handschuhen bedient werden, erfassen aber stets nur einen Kontakt. Das typische Vergrößern der Ansicht durch Auseinanderschieben zweier Finger auf dem Bildschirm funktioniert nicht. Kapazitative Touchpads basieren auf einem Netz von Elektroden. Hier können nur leitende Gegenstände verwendet werden. Da ein Finger elektrisch leitend ist, können Ladungen an ihm abfließen, sobald er die Oberfläche des Touchpads berührt. Dadurch ändert sich das elektrostatische Feld zwischen den Elektroden. Andere Objekte wie Stifte, Fingernägel oder Handschuhe zeigen keine Wirkung. Das kapazitive Prinzip wird in der Regel für Smartphones und SSU Tablet-PC verwendet. NACHRICHTEN IN KÜRZE STERNSCHNUPPEN-STROM Perseiden leuchten über Bremen Bremen. In den nächsten Tagen regnet es viele Sternschnuppen. Der Strom der Perseiden ist aber nur zu bewundern, wenn das Wetter mitspielt. Den Höhepunkt erwarten Astronomen in der Nacht zu Sonnabend: Rund 100 Sternschnuppen pro Stunde könnten dann aufblitzen. Ursache des Phänomens ist der Komet Swift-Tuttle, der eine Staubspur hinter sich herzieht. Die Erde kreuzt diesen Schweif jedes Jahr im August. Dann dringen Teilchen davon als Meteore mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre ein und verglühen. Der Durchmesser betrage oft nur etwa einen Millimeter, größere Objekte verursachen häufig Feuerkugeln, erklärt Andreas Vogel, Leiter des Bremer Olbers-Planetariums. Der Punkt, aus dem die Sternschnuppen scheinbar kommen, befindet sich im Sternbild Perseus, weshalb der Schwarm Perseiden genannt wird. Die Beobachtungsbedingungen seien in diesem Jahr leider sehr ungünstig, weil der fast volle Mond die Beobachtung störe, so Vogel. In der Bremer Innenstadt werde man wegen der Lichtverschmutzung maximal 15 Sternschnuppen pro Stunde sehen können. Die beste Beobachtungszeit beginnt ab ein Uhr nachts. BEBEN VOR JAPANS KÜSTE Tsunami ließ Eisberge entstehen Paris. Der Tsunami vor Japans Küste hat in der Antarktis neue Eisberge entstehen lassen. Satellitenbilder zeigen nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) vom Dienstag, dass die Riesenwellen mehr als 13 000 Kilometer durch den Pazifik rasten und schließlich im Süden das Sulzberger Eisfeld trafen. Obwohl sie kaum noch höher als 30 Zentimeter waren, konnten die Wellen dort mehrere große Stücke Eis abbrechen. Diese trieben nun in die RossSee, berichtete die ESA, deren Radarbilder ihres Envisat-Satelliten von einem NASATeam ausgewertet wurden. Die größten Eisberge sind demnach rund 80 Meter dick. Der Satellit sammelt täglich Radarbilder der Antarktis, die über die MIRAVI-Website der ESA zur freien Verfügung stehen. FOTO: KUNSTMANN VERLAG BILDUNG IST... „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“ Antoine de Saint-Exupery, französischer Schriftsteller (1900 bis1944) REDAKTION BILDUNG Telefon 0421 / 36 71 34 65 Fax 0421 / 36 71 10 14 Mail: [email protected] Geschredderte Schafe, Kühlschränke und Fischernetze gefährden das sensible Gleichgewicht am Meeresgrund VON THILO RESENHOEFT San Francisco·London. Geschredderte Tierleichen, Öl, Kühlschränke, Gift und Geisternetze: Der Mensch bürdet der Tiefsee eine gefährliche Last auf. Forscher der größten Volkszählung der Meere legen eine umfassende Bilanz vor. Demnach verstößt der Mensch vor allem gegen seine eigenen Interessen. Der Mensch gefährdet das Leben in der Tiefsee durch das illegale Entsorgen von Müll, Chemikalien, Munition, durch verlorene Fischernetze oder Ölunfälle. Auch geschredderte Tierleichen, Ölfässer oder Autoreifen enden im Meer. Und die von Forschern des Census of Marine Life (COML) zusammengestellte Liste der Bedrohungen ist damit bei Weitem nicht zu Ende. Im Zuge der insgesamt zehnjährigen Arbeit dieser bislang größten Volkszählung in den Ozeanen gab es auch mehrere Tiefsee-Projekte. Sie werden nun im Journal „PLoS One“ ausgewertet. Herangezogen werden zudem Informationen aus der bereits veröffentlichten Literatur. Entstanden ist eine Bestandsaufnahme dessen, was der Mensch der Tiefsee zumutet. Ein Autowrack am Meeresgrund vor der istriFOTO: DPA schen Küste von Kroatien. Das langsam wachsende Leben in der Tiefsee ist vielfältig. Bei einer Erkundungstour zwischen den Philippinen und Indonesien sind Forscher auf ein Tier gestoßen, das mit seinen langen Armen einem Tintenfisch gleicht: der Tintenfischwurm. Extremer Lebensraum Die Tiefsee ein besonders extremer und empfindlicher Lebensraum. Die hoch spezialisierten Tiere wachsen im kalten Wasser nur sehr langsam und vermehren sich spät, oft erst nach vielen Jahren. Ein einzelner Fischzug mit Netzen und stählernen Trossen über Felsen mit Kaltwasserkorallen kann das Wachstum von Jahrhunderten in einem Moment und auf viele Jahrzehnte hinaus zerstören. Alle chemischen und biochemischen Prozesse laufen nur sehr langsam ab. Der Planet ist zu 71 Prozent von Ozeanen bedeckt, und die Hälfte dieser Region ist tiefer als 3000 Meter. Noch ist wenig über die Lebensgemeinschaften dort unten bekannt. Der Bereich der Tiefsee beginnt laut den Autoren unterhalb von 200 Metern. Dieser Lebensraum ist demnach 1368 Millionen Kubikkilometer groß. Gänzlich ohne Licht ist der Bereich ab etwa 800 Metern. Bis hinab zu sechs und sieben Kilometer Tiefe sind Fische, Krebse, Würmer und viele andere Tiere gefilmt worden. Obwohl das Entsorgen von Müll auf hoher See 1972 verboten wurde, sind die Folgen bis heute spürbar, etwa in den ProbeFischzügen der Forscher oder auf Videobildern aus der Tiefe. 2000 Meter tief im Mittelmeer fanden sich Flaschen, Plastikfolien, Getränkedosen, Glühbirnen, Kühlschränke oder Autoreifen. Plastik kann sich mit der Zeit in kleine Teile zerlegen, von den Forschern „Tränen der Meerjungfrauen“ genannt. Tiere fressen die vermeintliche Nahrung, die aber vollkommen unverdaulich ist und sterben vielfach. Gleiches gilt für Albatrosse und andere Seevögel, die an der Oberfläche nach Plastikgegenständen schnappen. Die Vermüllung begann mit den Dampschiffen, deren Mannschaft die festen Reste der Brennstoffe über Bord warf. Auf dem steinharten Material siedeln einige Meeresorganismen, heißt es in dem Report, den Experten von neun international führenden Meeresforschungsinstituten verfassten. Sie vermuten, dass jährlich rund 6,4 Millionen Tonnen Müll ins Meer gelangen, der teils auch in die tiefen Bereiche sinkt. Dort kann der Abfall durch Strömungen weiter verbreitet werden. Auch entlegene Regionen sind betroffen: Selbst vor der antarktischen Halbinsel fanden sich zwei Getränkedosen im Proben-Netz. Bilder und Streifzüge aus 1000 bis 3000 Meter Tiefe zeigen einen Kühlschrank, viele Plastikfolien, Glasflaschen, Langleinen und Netze. Für Letztere verwenden die Vereinten Nationen den Begriff „Geisternetze“, denn in ihnen sterben weiterhin Fische und andere Tiere. 1200 Meter tief im Mittelmeer fand sich ein Netz, in dem sich Krabben verheddert hatten. Die Autoren FOTO: L.P. MADIN/ WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION Ein Taucher in der Tiefsee vor Papua Neuguinea nähert sich den Resten eines Torpedo Bombers. Menschen und ihr Müll nehmen immer mehr Einfluss auf das Leben am Meeresgrund. FOTO: DPA Skrupellose Fischer nutzen BleichmittelbehälFOTO: DPA ter, um Hummer hervorzulocken. geht vermutlich keine Belastung aus: toten Schafen und anderen Tieren, die über See transportiert werden. Große Schiffe haben für den Fall eines Krankheitsausbruches sogar einen Hächsler an Bord. 1996 gingen 70 000 Schafe im Indischen Ozean über Bord. Dem KeniryReport zufolge befinden sich jederzeit 300 000 Schafe und 10 000 Rinder auf Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass Krankheiten auf Tiefsee-Bewohner übergegangen sind“, notiert das Team. Im Puerto-Rico-Tiefseegraben wurden vor 1980 Abfälle der Medikamenten-Produktion in 6000 Metern Tiefe versenkt. Zwischen 1973 und 1978 waren es 387 000 Tonnen. Viele der Stoffe waren für Wirbellose giftig. Eine direkte Verklappung von Pillen und Säften ist den Forschern nicht bekannt, aber von Land gelangen mit dem Abwasser viele der Abbauprodukte auch ins Meer. Weitere Stoffe, die im Laufe der Jahre mehr oder weniger tief deponiert wurden: Fässer mit radioaktivem Abfall, Säuren und andere Chemikalien, etwa Dioxine. Die fanden sich in Shrimps aus 2000 Meter Tiefe gar in höheren Konzentrationen als in Artgenossen aus 500 Metern. Zudem gehen jährlich rund 10 000 Container bei Stürmen über Bord. Tausende Schiffe sind im Lauf der Zeit gesunken. Öl aus lecken Pipelines verklebt in der Tiefe Korallen, viele seiner chemischen Bestandteile werden über große Entfernungen transportiert. Die Fischerei hat sich vielen Untersuchungen zufolge als nicht nachhaltig erwiesen. Durch Überfischung sind bereits viele Bestände zusammengebrochen. Das lenkte das Augenmerk auf noch unangetastete Fische in 1,5 Kilometer Tiefe – die aber nur sehr langsam nachwachsen. Dort unten können die Bestände besonders schnell erschöpft sein. Der vielfach als schlimmste Spielart der Fischerei bezeichnete Fang mit Grundschleppnetzen pflügt weite Areale um und fördert außer der Zielart große Anteile Beifang an Bord – der tot oder sterbend wieder über die Reling geht. weisen darauf hin, dass Plastik seit rund 60 Jahren preisgünstig herzustellen ist – viel Zeit, um einen großen Müllberg in der Tiefe entstehen zu lassen. Vor der Ostküste der USA etwa wurde von 1972 bis 1992 Klärschlamm versenkt, 2500 Meter tief. Darin enthalten sind unter anderem kaum abzubauende organische Verbindungen. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was beim Abbau von Mineralien am Seeboden zu erwarten ist. Inzwischen haben neun Vertragsnehmer ihre Claims abgesteckt und Gebiete bei der International Seabed Authority geltend gemacht. Diese Organisation verwaltet die Ressourcen am Boden der Hohen See. Es gibt zahlreiche Mineralien am Meeresgrund: Kürzlich wurden große Vorkommen der sogenannten Seltenen Erden im Pazifik beschrieben: Ein Rohstoff, der zur Produktion vieler Hightech-Werkstoffe nötig ist. Rohstoff-Abbau am Ozeangrund Wie genau die Rohstoffe an die Oberfläche geholt werden sollen, ist nicht klar. Aber das darauf spezialisierte Unternehmen Nautilus Minerals zeigt auf seiner Homepage große Unterwasser-Bulldozer und andere Förderanlagen. Das wird allen direkt betroffenen Organismen sofort zum Verhängnis, und der aufgewirbelte Schlamm wird ein zwei- bis fünffach größeres Gebiet betreffen, schreiben die Meeresforscher. Drei solcher Abbau-Projekte können eine Fläche halb so groß wie Deutschland ernsthaft stören. Von einer anderen Art Müll Forscher reagieren nur langsam Der Einfluss des Menschen auf die Tiefsee nimmt zu, schließen die Forscher. Zum Ende des 20. Jahrhunderts sei dies vor allem durch die Müllentsorgung geschehen, derzeit vor allem durch die Ausbeutung. Die künftige Veränderung des Ökosystems werde wohl auf den Klimawandel zurückgehen. „Eines der größten Probleme ist, dass jene am schnellsten handeln, die die Tiefsee als einen Dienstleistungslieferanten ansehen. Wissenschaftler und andere Entscheider fallen dahinter zurück.“ Wirtschaftliche Interessen schafften Tatsachen, auf die Forscher nur langsam reagieren könnten – unter anderem bestimmt durch den Zyklus ihrer Projektfinanzierung. So komme es zu einem Zeitverzug zwischen der Wahrnehmung und der Erforschung einer Bedrohung der „tiefen Hälfte des Planeten“. Am Meeresgrund gewinnen Lebewesen Energie aus Wasserstoff VON THILO RESENHOEFT London·Bremen. Bremer Forscher beschreiben eine neue Energiequelle für das exotische Leben in der Tiefsee. Drei Kilometer unter der Oberfläche ziehen Bakterien ihre Energie aus Wasserstoff – eine biologische Brennstoffzelle fürs Leben in ewiger Dunkelheit. Das Leben in der Tiefsee erscheint mitunter fremd wie das von einem anderen Planeten. In der lichtlosen Tiefe, viele Kilometer unter der Oberfläche liefert die Sonne keine Energie. Die Organismen dort unten greifen daher auf chemische Energie zurück, um ihre Kohlenhydrate aufzubauen. Quelle ist unter anderem der Schwefelwasserstoff – ein widerwärtig riechendes und sehr giftiges Gas. In Anlehnung an die Photosynthese auf der Erdoberfläche sprechen Forscher von der Chemosynthese. Die damit wachsenden Bakterien bilden die Grundlage von Ökosystemen in der Tiefe, in denen Muscheln, Würmer und Krabben leben. Viele Mitglieder dieser exotischen Lebensgemeinschaft können nur überleben, weil sie eine enge Beziehung mit Bakterien eingegangen sind. Durch diese Symbiose besitzen sie ihr eigenes Kraftwerk. Bislang waren nur zwei „Brennstoffe“ bekannt, aus denen die Mikroorganismen Energie gewinnen können: Schwefelwasserstoff und Methan. Bremer Forscher fügen dieser Liste nun einen dritten Treibstoff hinzu, den Wasserstoff. Das Team um Nicole Dubilier vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie und ihre Kollegen vom Exzellenzcluster Marum an der Uni Bremen berichten über ihre Entdeckung im Fachjournal „Nature“. Ort des Geschehens in der Tiefe sind heiße untermeerische Quellen. Sie entstehen dort, wo die Erdplatten aneinandersto- Muschelfelder in der Tiefsee: Bakterien ziehen FOTO: MARUM ihre Energie aus Wasserstoff. ßen, Magma in die obere Erdkruste aufsteigt und das Seewasser aufheizt. Das löst viele Mineralien aus der Erdkruste, bevor es – rund 400 Grad Celsius heiß – am Meeresboden austritt. Oft ist es dann dunkel gefärbt, was den sogenannten hydrothermalen Quellen den Namen „Schwarzer Raucher“ eintrug. In 3000 Metern Tiefe am Mittelatlantischen Rücken zwischen der Karibik und den Kapverdischen Inseln findet sich das Logatchev-Hydrothermalfeld, berichtet das Team. Hier registrierten die Forscher die höchsten jemals an heißen Quellen gemessenen Konzentrationen an Wasserstoff. In den Kiemen der dort lebenden Tiefseemuschel „Bathymodiolus puteoserpentis“ fand sich erstmals ein Bakterium, das statt Schwefel auch Wasserstoff einsetzen kann, um Energie zu gewinnen. Diese Reaktion bildet der Mensch mit Brennstoffzellen nach, in denen Wasserstoff und Sauerstoff kontrolliert zu Wasser werden. Bakterien, die diese Reaktion beherrschen, waren schon bekannt. Als Grundlage des Lebens in der Tiefsee sind sie aber neu. Um sie untersuchen zu können, waren die Forscher auf die Tiefseeroboter angewiesen. Die Muschelfelder um die heißen Quellen herum erreichen einige Hundert Quadratmeter Größe, berichten die Experten. Bis zu einer halben Million Individuen lebten dort. Die Experimente deuten darauf hin, dass die Muscheln im LogatchevHydrothermalfeld bis zu 5000 Liter Wasserstoff pro Stunde umsetzen, rechnet Co-Autor Frank Zielinski vor. Die Bakterien in den Kiemen, mit denen die Muscheln zusammenwirken, spielen demnach eine beachtliche Rolle als Primärproduzenten von Energie und bei der Umwandlung dieser Energie in Biomasse. Mikrobiologen bezeichnen dieses Leben auf der Basis anorganischer Verbindungen als „lithotroph“ – als sich von Steinen ernährend. Dubilier und ihren Kollegen gelang es zudem, ein Enzym zu ermitteln und zu isolieren, das für die Reaktion besonders wichtig ist. Auch die Symbiose-Partner anderer an den heißen Quellen lebender Tiere – etwa des Röhrenwurms „Riftia pachyptila“ oder der Garnele „Rimicaris exoculata“ – besitzen dieses Schlüsselenzym. „Wir gehen deshalb davon aus, dass die Fähigkeit, Wasserstoff als Energiequelle zu nutzen, unter diesen symbiotischen Gemeinschaften weit verbreitet ist, und zwar selbst dort, wo der Wasserstoff in nur sehr geringen Mengen vorkommt“, erklärt Dubilier.