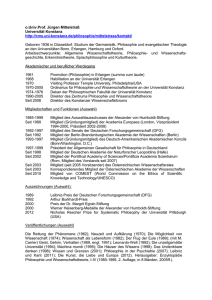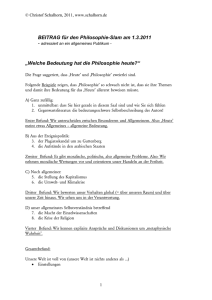Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation 2. Der Einsatz der
Werbung

Ingo Zechner Kultur und Kolonisation II Entwurf für ein Forschungsprojekt zur Kulturphilosophie Der Einsatz der Philosophie und das Problem der „Kultur“ Der Einsatz der Philosophie wird immer ein zweifacher sein: der Moment und der Ort, an dem sie einsetzt und was sie dabei aufs Spiel setzt. Allerorts ist von “Kultur” die Rede; warum also nicht auch in der Philosophie? Oder muß man nicht umgekehrt fragen: Warum soll nun auch in der Philosophie von etwas die Rede sein, worüber man ohnedies überall spricht? Gibt es eine spezifische Differenz oder wenigstens einen signifikanten Unterschied, durch den sich ein philosophisches Sprechen von jedem anderen unterscheidet? Oder gibt es eine unspezifische Differenz und einen asignifikanten Unterschied, der umso weniger vernachlässigt werden darf, als er leicht übergangen wird: Wenn zwar nicht das Bedeutungslose, wohl aber das Unbedeutende die Aufmerksamkeit erregen müßte, um ein Sprechen zu einem philosophischen zu machen? Wo und vor allem wie muß das Sprechen dann einsetzen? Und wie wird es der Gefahr begegnen, das Unbedeutende, das jedem anderen Sprechen entgangen ist, unter der Hand in das Bedeutsamste zu verwandeln – so daß man dann von ihm sprechen kann, als hätte man es bloß übersehen? Was dabei auf dem Spiel steht, wird weniger die “Kultur” als die Philosophie selbst sein: Falls sich herausstellen sollte, daß die Philosophie zur “Kultur” nichts oder nichts anderes zu sagen hat, als andernorts schon gesagt werden konnte (oder gesagt hätte werden können), wird die “Kultur” davon nicht wesentlich betroffen sein; wohl aber die Philosophie — denn was bleibt ihr dann noch zu sagen? Es könnte nun eingewandt werden, daß die Philosophie nicht zu allem etwas zu sagen haben muß, um sich nicht aufs Spiel zu setzen. Und tatsächlich gehört es zur Tradition, zunächst einmal die Frage zu stellen, ob etwas Bestimmtes denn überhaupt Gegenstand der Philosophie sein könne (etwa Hegels Frage am Anfang seiner Ästhetik, ob denn die Kunst überhaupt ein würdiger Gegenstand einer philosophischen Betrachtung sein könne). Was aber, wenn es nicht darauf ankommt, worüber man spricht, sondern wie man über etwas spricht? Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 2 Das drohende doppelte nichts des Nichtssagenden (nichts oder nichts anderes zu sagen zu haben) ist das Dilemma der Philosophie. In ihm gibt es zwei Gesten, die ein philosophisches Sprechen vermeiden muß: Zum einen die Feststellung, daß es “die Kultur” gar nicht gibt und daß niemand recht weiß, was damit gemeint ist, wenn von “Kultur” die Rede ist (selbst wenn dieser Eindruck nicht ganz von der Hand zu weisen ist). Das wäre die erste klassische Geste: “Man beweist, daß etwas nicht sein kann, anstatt zu zeigen, daß es ist und warum es ist”. Zum anderen die Behauptung, daß nur die Philosophie sagen kann, was “Kultur” überhaupt ist. Die zweite klassische Geste: Man beweist, daß etwas zwar bekannt, nicht aber erkannt ist und verspricht, nun endlich die Wahrheit über sein Wesen zu sagen, anstatt zu zeigen, was von ihm bekannt ist und warum das noch nicht genügt. Wenn das genannte Dilemma die Bedingungen markiert, unter denen die Philosophie aufs Spiel gesetzt wird, dann sind es die beiden Gesten, mit denen ihr Einsatz am sichersten verspielt werden kann. Wo aber und wie soll ein philosophisches Denken dann einsetzen? Die Frage zielt auf einen Beginn, auf eine Bewegung des Anfangens hin. Und sie führt zu einer dritten Geste zurück, die am schwersten zu vermeiden sein wird, weil sie als grundlegende Geste den anderen beiden stets vorausgegangen sein wird — und weil gerade sie die Geste ist, mit der sich die Philosophie – seit Descartes – von allen anderen Disziplinen zu unterscheiden trachtet, indem sie sich zugleich ihres Einsatzes (im doppelten Sinn) zu versichern versucht: Es ist die Geste des verschobenen, aufgeschobenen und versetzten Einsatzes, die alles zurückweist, bis die Philosophie ihren eigenen Anfang gefunden hat. Sie eröffnet einen endlosen “Discours de la Méthode”, der über der Suche nach dem rechten Weg (hodos) die Bewegungen vergißt, die er selbst im ungangbaren Gelände noch machen könnte; gegen die Wendigkeit seiner selbst und die Wendbarkeit der Dinge setzt er die meditative Einkehr bei sich. Dabei unterschlägt dieser Diskurs, daß er die Verschiebung nur macht, um den letztlich gefundenen Weg als den richtigen ausweisen zu können; und daß er die Suche selbst nachträglich zum Weg rechnen wird, um vorgeben zu können, schon in ihr weiter gekommen zu sein als jeder andere. Denn wer in diesem Diskurs die Frage nach der Methode stellt, wer den Einsatz der Philosophie mit der Methodenfrage verschiebt, will wohl kaum mit einer jener Gestalten verwechselt werden, die als Zerrbilder des Philosophen die Philosophie seit jeher begleiten: mit dem Sophisten, dem Skeptiker usw. Dagegen gehen wir davon aus, daß die Philosophie ihren Einsatz schon gemacht hat, wenn sie sich auf der Suche nach ihrem Anfang befindet: Sie hat ihren Beginn Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 3 schon hinter sich (diese Ungleichzeitigkeit ist irreduzibel); und sie steht selbst schon am Spiel: Aber das Wort “rien ne va plus” ist lange noch nicht gesprochen. Wenn hier von einer Positivität des Problematischen die Rede ist, soll darin auch ein Moment des Zwanges zu spüren sein. Um den absolut freien Anfang der Philosophie wird es dann nicht mehr gehen. “Es gibt etwas in der Welt, das zum Denken nötigt”, sagt Gilles Deleuze: “Dieses Etwas ist Gegenstand einer fundamentalen Begegnung”.1 Das heißt, daß wir auf das Problematische gestoßen sind. Man darf die Nötigung aber nicht mit einer Notwendigkeit gleichsetzen: Der Einsatz ist zwar nicht absolut frei. Die Begegnung wird vielleicht sogar zufällig sein. Aber es bleibt doch die Möglichkeit, sich dem Zwang zu entziehen. Der Einsatz der Philosophie liegt demnach jenseits oder diesseits der Alternative von Freiheit und Notwendigkeit. Auf das gestoßen zu sein, was man “Kultur” genannt hat, ist für die Philosophie eine Begegnung mit dem Problematischen der Kultur: Nicht nur im Sinne des Fraglichen als dem Ungewissen, mehr noch in dem des Bedenklichen. So ist “Kultur” zum Beispiel stets mit dem “Menschen” verknüpft. Es gibt keine Kultur, die nicht irgendwo und irgendwann auf das Unmenschliche gestoßen wäre, das ihr meist in menschlicher Gestalt entgegen getreten ist. Noch weniger gibt es eine Kultur, die sich bloß von anderen Kulturen unterscheidet, ohne zugleich jede Kultur vom Unkultivierten zu scheiden. Darin bleiben Kultur und Kolonisation jenseits ihrer gemeinsamen Wortgeschichte untrennbar miteinander verknüpft. Die Kolonie ist ein anderes Wort für das Problematische der Kultur. Positivität kann hier nur noch heißen, daß etwas gegeben ist; denn was hier gegeben ist, ist im unzweideutigen Sinn problematisch: Etwa im Namen der Kultur die fehlende Humanität einund die Gewalt anzuklagen, zugleich aber jene Gewalt zu vergessen und womöglich zu rechtfertigen, mit der das Inhumane zugunsten des Humanen getilgt wird. Die Rede vom Problematischen der Kultur besagt jedoch noch nicht, daß es ein philosophisches Problem der Kultur geben muß, es heißt nicht einmal, daß es ein Problem der Kultur geben muß – daß die “Kultur” von vornherein ein Problem sein muß. Es gibt zwar etwas Problematisches an der Kultur, ein Problem der Kultur ist aber nicht einfach gegeben; es kann nur gestellt werden. Man wird der Philosophie immer wieder vorwerfen können, aus allem ein Problem zu machen. Wir wollen diesem populären Vorwurf entgegen kommen und sagen, daß die Philosophie vielleicht nichts ist, wenn sie nicht die Tätigkeit ist, Probleme zu stellen. Allerdings muß hinzugefügt werden, daß es immer verschiedene Arten gegeben haben wird, Probleme zu stellen und daß nicht jede eine philosophische ist. Philosophie ist – genauer 1 Gilles Deleuze. Differenz und Wiederholung, aus dem Französischen übersetzt von Joseph Vogl, München: Fink 1992, S. 182. Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 4 gesagt – eine Art und Weise, Probleme anders zu stellen – oder noch genauer – nicht einfach nur andere Probleme, sondern anders Probleme zu stellen. Vor jeder Festlegung auf eine bestimmte Art ist damit vor allem eines gemeint: Philosophie versucht, ein Problem als solches zu stellen (ihr Gegenstand bleibt ihr genauso problematisch wie sie selbst). Es kommt nicht auf die Lösungen an, eher schon auf die möglichen Lösungen. Vielmehr geht es aber darum, in einer gegebenen Situation das Problematische an ihr zu benennen, um sie selbst als Lösung eines Problems zu begreifen, das erst formuliert werden muß. Dazu muß sich das philosophische Denken aber zuerst von der Geschichte der Philosophie losreißen, in der das Problem und die Frage meist als momentane und vorübergehende Unwissenheit gegolten haben, die vom Wissen beseitigt wird. Ein gut gestelltes Problem verschwindet jedoch in seinen Lösungen nicht. Die Philosophie unterscheidet sich von anderen Disziplinen (etwa von den Künsten) dadurch, Probleme in Form einer Frage zu stellen. Sie verbalisiert jedes Problem. Es ist derselbe Unterschied, den sie mit einigen anderen Disziplinen hingegen teilt (etwa mit einzelnen Wissenschaften). Er markiert die Grenze, an die eine mögliche interdisziplinäre Zusammenarbeit von Seiten der Philosophie immer stoßen wird. Er erinnert jedoch zugleich auch an den Ausschluß von allem, was jenseits der Grenze liegt und vielleicht niemals Sache der Philosophie gewesen sein wird. Die Philosophie wird diese Erinnerung zulassen müssen, weil das Ausgeschlossene sie nicht nur von außen heimsucht, sondern Bedingung ihrer Möglichkeit ist. Sie unterscheidet sich von anderen Disziplinen aber auch in der Intensität, mit der sie Probleme als Fragen stellt: Ein Exzeß des Fragens bewahrt sie davor, nur eine Disziplin unter oder neben anderen zu sein. Längst wäre es lächerlich, den Platz einer Königsdisziplin beanspruchen zu wollen. Aber gleich welchen Status die Philosophie in den Institutionen einnehmen mag: In einer bestimmten Intensität des Fragens hat sie die Grenzen jeder Interdisziplinarität immer schon überschritten. Im interdisziplinären Dialog oder Polylog wäre eine undisziplinierte Philosophie in der Lage, die Rolle des Proteus zu spielen, der die anderen Disziplinen durchquert: Gute Philosophie (vielleicht gibt es keine andere) war immer schon transdisziplinär. Wenn man die Philosophie als ein Stellen von Problemen begreift, ist der technische Aspekt dieser Definition ohnedies kaum zu übersehen. Trotzdem sollte er eigens hervorgehoben werden: Das philosophische Denken wird auf eine Technik des Eingreifens nicht verzichten können; also auf die Verwendung eines Dispositivs von möglichen Einstellungen, in denen bewährte Handlungen (genau lokalisierte und koordinierte Eingriffe) verschiedene Umstellungen vornehmen. Doch bleibt das Ziel dieser Eingriffe so weit offen, daß es die Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 5 Technik als Technik desavouiert. Die Philosophie wird daher mehr eine Kunst, denn eine Technik des Stellens von Problemen sein (und selbst das griechische Wort techne bietet dafür kein Äquivalent). In einem gewissen Sinn wird der Philosophie ihr Einsatz im Feld der Kultur von dieser selbst abgenommen: Weil es kaum zu umgehen ist, daß sie – als eines ihrer Produkte – schon zur Kultur (sei es zu einer bestimmten “Kultur” oder zur “Kultur” schlechthin) gezählt wird, während sie noch ihren spezifischen Zugang zu finden versucht. Statt sich im Feld der Kultur einen Ort zuweisen zu lassen oder im Gegenteil einen eigenen Ort in ihm zu wählen, kommt es jedoch darauf an, es als ein Feld offenzulegen: als ein “bestelltes” Feld, das die Philosophie nicht besetzt, sondern durchquert. Die bereits vertraute Rede von einem “Feld der Kultur” könnte für den Einsatz der Philosophie ein Glücksfall sein. Von den Sozialwissenschaften aus hat sich der Begriff des Feldes neuerdings für mancherlei Art einer regionalen Abgrenzung behaupten können. Bourdieu etwa spricht von einem sozialen Feld. Der Begriff des Feldes wurde jedoch zunächst in der Physik des 19. Jahrhunderts entwickelt. Maxwell war wohl der erste, der ihn systematisch verwendet hat: In seiner Theorie des elektromagnetischen Feldes wird der Raum zu einem Kraftfeld; als solches ist er weder ein leerer Raum, noch ein endgültig geordneter Raum, in dem jedes Ding einen für es bestimmten Platz hätte, sondern ein Raum, in dem Kräfte auf- und gegeneinander wirken – ausgehend von Körpern und abgewandelt von anderen Körpern. Entscheidend daran ist der Versuch – gegen einen gewissen cartesianischen Zug in der Philosophie – die Körper nicht länger zu isolieren und statt vom partikulären einzelnen Ding von einem Komplex auszugehen, der von Kraftverhältnissen bestimmt wird. Die Gestalttheorie eines Wolfgang Köhler etwa hat den Begriff des Feldes in die Wahrnehmungspsychologie versetzt. Und aus ihr haben ihn Husserl, Merleau-Ponty und andere übernommen, so daß er seither in der Phänomenologie sogar zu den Grundbegriffen zählt. Die Philosophie wird das Potential des Feldbegriffs nutzen können. Aber sie wird die metaphorischen Implikationen der Rede von einem “Feld der Kultur” ernst nehmen müssen: nicht nur, um die Vielfalt ihrer Sinnschichten erschließen zu können; mehr noch, um zu verhindern, daß die Metaphern jedem Gedanken gleichsam im Nacken sitzen. Die Verbindung von Kultur und Feld ist in metaphorischer Hinsicht redundant: Kultur hat immer mit der Kerbung eines “Bodens” zu tun. Das lateinische Wort cultura nennt zunächst die Bestellung eines Feldes im wörtlichen Sinn: die “Pflege des Bodens”; cultura als Kurzform von agricultura. Cultivare, kultivieren, heißt zuallererst “urbar machen” und dann “bebauen” und Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 6 “bauen”. Die Bestellung eines Feldes wird eine Topologie errichtet haben, in der die Dinge einen bestimmten Ort behaupten. Zur Orientierung wird gelegentlich eine Topographie des Feldes angelegt worden sein – um so eher, als das Feld unüberschaubar wird (und es kann sein, daß die Topologie erst durch die Topographie kenntlich wird). Eine solche Topographie wird zunächst eine Verortung des ganzen Feldes neben anderen versucht haben und dann ein Verzeichnis der Elemente des Feldes und ihrer Orte unternommen haben. Wo mit dem Wort cultura die “Pflege des Körpers” und “die Pflege des Geistes” genannt ist, wendet die Kultivierung sich ausgehend vom Menschen auf den Menschen zurück: Körper und Geist werden im übertragenen Sinne zum “Feld”. Das Wort colere, das als gemeinsame Wurzel die Kolonie mit der Kultur verbindet, heißt soviel wie “bewohnen” und “bebauen”, dann erst “pflegen” und “ehren”. Colunus nennt man den “Ansiedler”, den “Bebauer” oder einfach den “Bauer”. Diesem Archetypus des seßhaften Menschen wurde in der Philosophie mit der drohenden Anarchie (Kant) oder Geschichtslosigkeit (Hegel) immer wieder der Nomade vor Augen geführt, der kein Feld bestellt und die bestellten Felder verwüstet (Deleuze und Guattari). Per definitionem ist er kulturlos und unkultiviert — was auch immer das schlechte Gewissen der Kultivierten heute darüber denken mag. Was ihm einst als Mangel ausgelegt wurde, macht den Nomaden zur Schlüsselfigur einer Utopologie der Kultur. Wenn als ursprünglicher Sinn des Wortes colere “sich gewöhnlich irgendwo aufhalten” erschlossen wurde – womit neben dem Wohnen die Gewohnheit genannt ist – verdeckt dieser Sinn die Bedeutung, die man in der ebenfalls erschlossenen idg. Wurzel der Wortgruppe um Kultur entdeckt zu haben glaubt: “(sich) herumbewegen”, “(sich) drehen”. Muß erst der Nomade auftauchen, um in der Kultur daran zu erinnern, welche Bewegungen sie vergessen hat? Das Projekt einer Utopologie der Kultur soll als Kartographie angelegt werden: nicht weil das Ziel des Projekts eine Karte wäre, sondern weil jede strategische Operation in einem komplexen Gebiet Karten verwendet. In der Kartographie ist das Studium vorliegender Karten mit dem Zeichnen von neuen gepaart. Wenn die Topologie der kulturellen Felder vermessen werden soll, müssen die Felder zugleich durchmessen werden. Und das Vermessen hat hier wenig mit einem quantitativen Verfahren und noch weniger mit einem äußeren Maßstab zu tun. Quantitativ ist es nur, wo es um die Einschätzung der Kräfteverhältnisse geht. Anders als in einer topologischen Karte werden in einer u-topologischen die Topoi im zweifachen Sinne des Wortes verzeichnet sein: als “Orte” des Feldes und zugleich als “Gemeinplätze” – Gewohnheiten, die es beherrschen. Eine U-Topologie wird versuchen, das Feld als “bestelltes” zu zeichnen und zugleich als offenes Feld freizulegen (vielleicht werden die Karten eher den phantastischen Weltkarten Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 7 ähneln). Sie wird das Offene des Feldes aufzuspüren versuchen, schon allein, um für die Philosophie einen Fluchtweg aus ihm zu finden. Ein solcher Fluchtweg wird kein bloßer Ausweg sein, über den sich die Philosophie – gleichsam durch die Hintertüre – unbeschadet aus einem Bereich zu retten versucht, den sie besser vielleicht niemals betreten hätte: Die Philosophie wird sich nicht in die Flucht schlagen lassen, aber sie wird versuchen, die Dinge mit sich zu reißen, die Elemente des Feldes zur Flucht zu bewegen – ohne sogleich einen neuen Ort für sie bereitzuhalten. Vergessen wir nicht, was Deleuze und Guattari, die Denker der Fluchtwege, am Ende ihres gemeinsamen Denkweges zur Utopie zu sagen haben – obwohl dieses Wort in der öffentlichen Meinung nur noch einen verstümmelten Sinn bewahrt hat: “Die Utopie ist nicht zu trennen von der unendlichen Bewegung: Etymologisch bezeichnet sie die absolute Deterritorialisierung, stets aber an jenem kritischen Punkt, an dem diese sich mit dem vorhandenen relativen Milieu, vor allem aber mit den darin unterdrückten Kräften verbindet.” Freilich birgt die Utopie immer “die Gefahr einer Restauration der Transzendenz, zuweilen die ihrer arroganten Affirmation”. Aber das Wort Utopie bezeichnet immer auch “diese Verbindung der Philosophie oder des Begriffs mit dem vorhandenen Milieu: politische Philosophie”.2 Das ist die Chance einer Utopologie. Das vorrangige Forschungsziel des Projekts wird es sein, ein Problem der Kultur überhaupt erst zu stellen. Deshalb kann in einer Skizze für das Projekt ein solches Problem noch nicht formuliert werden — andernfalls wäre die Forschung ja schon an ihr Ende gelangt. Wohl aber kann das Problematische am Feld der Kultur schon jetzt grob umrissen werden: 1. Die Grenzen des Feldes sind völlig unscharf gezogen. Es scheint, daß diese Unschärfe jedoch kein Mangel, sondern die konstitutive Bedingung dafür ist, daß von “Kultur” überhaupt gesprochen werden kann. Mit anderen Worten und auf den gegenwärtigen erfolgreichen Trend des Kulturbegriffs (cultural studies usw.) bezogen: Seine fehlende Bestimmtheit ist die Voraussetzung seines extensiven Gebrauchs. Einmal ist das Feld gleichsam nur ein “Beet”, dann wieder ein “Landstrich”, ein “Land” oder ein “Länderverbund”. Der Begriff der Kultur oszilliert zwischen der äußersten Partikularität und der äußersten Totalität (von der “Subkultur” zur “Menschheitskultur”, um ein Beispiel zu nennen). Die Grenzen seiner Regionalität (im Sinne der Phänomenologie oder einer regionalen Ontologie) tendieren dazu, mit dem Horizont aller Regionen zusammenzufallen. Und es ist nicht zu vergessen, was jede Region mit einer Regierung und einem Reich verbindet. 2 Vgl. Gilles Deleuze / Félix Guattari. Was ist Philosophie?, aus dem Französischen übersetzt von Bernd Schwibs und Joseph Vogl, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, S. 115 f. Ingo Zechner: Kultur und Kolonisation II 8 2. Unter dem Titel “Kultur” muß zudem nicht nur ein “bestelltes” Feld verstanden werden (welchen Umfang auch immer es haben mag). Er kann auch die Bestellung des Feldes benennen und genauer die Ordnung, nach der diese Bestellung geschieht: In einem gewissen Sinn nennt das Wort Kultur dann nicht nur ein Feld, sondern zugleich auch den “Boden”, auf dem jede Bestellung stattfindet – so weit er sie trägt. Die Philosophie stößt hier auf den ausweglosen Gedanken, daß sie womöglich derselben Ordnung gehorcht, selbst wenn sie das Feld durchquert. Für die Philosophie läßt sich an dieser Stelle ein erstes Problem schon formulieren: Wie kann sie ein solches Feld durchqueren, ohne in ihm ansässig zu werden oder in ihm zu versanden. Es genügt auch nicht, bloß Spuren in ihm zu hinterlassen; nicht einmal, seine Elemente neu zu gruppieren. Wie kann die Philosophie aber ein Feld durchqueren, so daß man es ihm ansieht — ohne das Feld zu verwüsten? Ingo Zechner (Überarbeitete Fassung) Wien, 27. und 28. Juni 1998