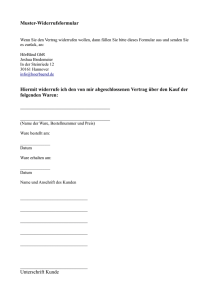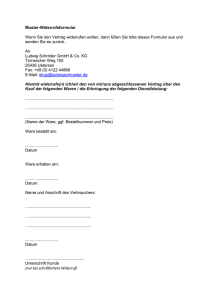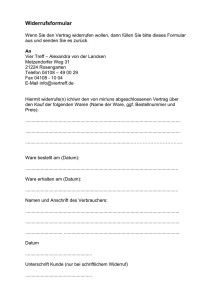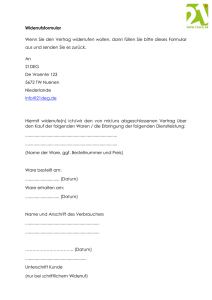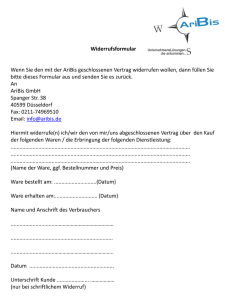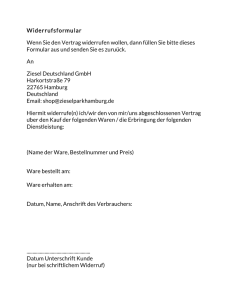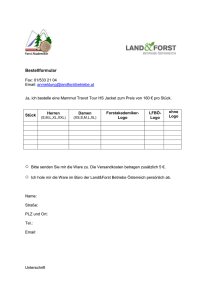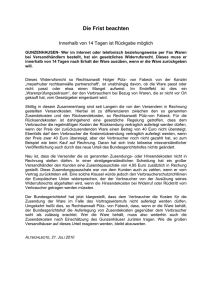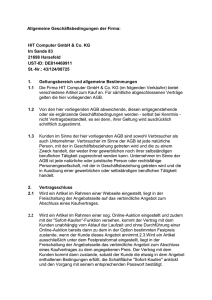Die Werbekultur des Abschieds - Zentralverband der deutschen
Werbung

ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN WERBEWIRTSCHAFT ZAW E.V. Die Werbekultur des Abschieds Bestattungsgewerbe und kommerzielle Kommunikation I. ALDIsierung der Bestattungskultur……………………………...…….....2 II. Wandel in Rahmenbedingungen für Werbung…………….…………....3 III. Provokation: Riskante Propaganda-Strategie…………..……………....5 IV. Vier Orientierungspunkte für die Werbung………………………….…...8 Dokumente Auszug aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG)…….….11 Grundregeln zur kommerziellen Kommunikation des Deutschen Werberats………………………………………………...…18 POSTADRESSE: 10873 BERLIN HAUSANSCHRIFT: AM WEIDENDAMM 1A · 10117 BERLIN TELEFON 0 30-59 00 99-7 00 · TELEFAX 0 30-59 00 99-7 22 E-MAIL: [email protected] · INTERNET: WWW.ZAW.DE BÜRO BRÜSSEL: C/O PRM LTD 10, RUE BERCKMANS · 1060 BRÜSSEL TELEFON +32-2-534 90 36 · TELEFAX +32-2-534 98 82 Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 2 Bestatter verdienen Geld am Tod anderer Menschen. Na und? Ärzte an Krankheiten, Feuerwehrleute an Unglücken und Rechtsanwälte mitunter sogar an Mördern. Warum aber liegt heute das Bestattungsgewerbe im Schatten gesellschaftlicher Akzeptanz? Dafür gibt es vielfältige Gründe, über die nachzusinnen lohnt. Kippt das Mikro-Ansehen der Branche nicht aber ohnehin vollends ins Groteske, wenn der gemütliche Fernsehabend von einem TV-Spot der Bestattungsunternehmer unterbrochen wird? - so erstmals geschehen im Jahr 2008. Wer lässt sich schon gern an die Endlichkeit seines individuellen biologischen Daseins erinnern. Der Werbefilm der Dienstleister in Sachen 'letzte Schritte' hat - im Vergleich mit dem auf dem Bildschirm zum Beispiel gezeigten fiktiven Mord und Totschlag eines Krimiseine reale Bedeutung: 'Dein Leben endet mit deinem Tod. Sorge dafür vor.' Wie mögen sich da ein 70-Jähriger oder 17-Jähriger fühlen? Oder handelt es sich bei dem Werbeeinblendung gar nicht um einen vielzitierten "Tabubruch profitgieriger Bestattungsunternehmen"? Signalisieren nicht vielmehr die Zeitzeichen einen kulturellen Wandel, zu dem Werbung selbst für Dienstleistungen im Rahmen des Abschieds von einem Menschen passt? I. ALDIsierung der Bestattungskultur Werbung ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Sie muss es zwangsläufig aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen sein. Nur wenn ein Unternehmen seine MarktKommunikation den aktuellen Verhältnissen geschmeidig anpasst, wird Werbung eine Investition in die Zukunft des eigenen Geschäfts: Menschen wollen heute angesprochen werden und nicht mit den Bildern aus zurückliegenden Entwicklungsphasen einer Gesellschaft. Der Blick in TV-Spots, in Anzeigen oder auf Plakate demonstriert diesen erzwungenen Opportunismus werblicher Ansprache: Frauen nicht mehr nur als Hausfrau, sondern in der Arbeitswelt oder in der Freizeit; Kinder, die früher gar nichts zu bestimmen hatten, nun als Kunden; Umweltschutz als werblich eingeflochtenes Thema - und politisch 'Korrektes': Der Sarotti Mohr heißt jetzt "Sarotti-Magier der Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 3 Sinne", die Mohrenköpfe "Schokoküsse". Und parallel zum demographischen Wandel immer mehr Ältere in den Sujets der Werbung. Komplexer ist die Lage für die Bestattungskultur in Deutschland: Der Tod hat ein schlechtes Image und Bestattungsunternehmer Akzeptanzprobleme. Das war nicht immer so. Begräbnisse wurden innerhalb der Familie oder der dörflichen Gemeinschaft organisiert. Entsprechend unbefangen die Zeitungsanzeige eines Dortmunder Beerdigungsinstituts im Jahr 1909: "Bau- und Möbeltischlerei. Anfertigung und großes Lager von Holz- und Metallsärgen. Sargversand auch nach auswärts. Leichen-Wäsche in großer Auswahl. Aufbahrung kostenlos". Dann aber kippte in den fünfziger Jahren der Trend. Traumatische Erfahrungen für die gesamte Gesellschaft durch die beiden Weltkriege veränderten den Umgang mit dem Tod. Bestattungsunternehmen zogen sich werblich in Branchenbücher und MiniAnzeigen in der lokalen Presse zurück. "Bedenke, dass du sterblich bist" verschwand aus der Öffentlichkeit, Tod als Tabuthema. Die kulturellen Rahmenbedingungen für Werbung von Bestattungsdienstleister änderten, verschlechterten sich. Dazu trug erheblich die endgültige Streichung des Sterbegelds der Krankenkassen vor fünf Jahren bei. Noch in den neunziger Jahren zahlte die Kasse ein Sterbegeld von bis zu 4.000 Mark. Seit dem Wegfall sparen die Hinterbliebenen oft beim Sarg. Dramatisch gestiegen sind auch die Kosten für die Gräber - seit 2005 um 300 Euro pro Stätte. Die Folge: Es entwickelt sich eine Entsorgungsmentalität beim Aufwand für die Beisetzung. Sie öffnete den Discount - Sargherstellern den Markt. Billigimporte aus Osteuropa verderben die Würde. Auf manchen Schaufenstern sieht man heute gepinselt "Särge zu Discount-Preisen". Die ALDIsierung der Bestattungskultur scheint im vollen Gange. II. Wandel in Rahmenbedingungen für Werbung Aber es gibt auch eine andere Tendenz - jene der neuen Sichtbarkeit des Todes. Menschen lassen sich beim Sterben zusehen. Dokumentarfilme werden via TV und Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 4 Internet darüber verbreitet (Jade Goody, britischer "Big Brother"-Star mit Gebärmutterhalskrebs, starb, wie sie lebte: in Begleitung der Medien), es werden Bücher geschrieben ("Mein Wille geschehe - Sterben in Zeiten der Freitodhilfe", Svenja Floßpöhler), Patientenverfügungen werden freimütig öffentlich diskutiert und die Ächtungskultur des nahenden Todes sogar auf dem Theaterboden durchbrochen (der krebskranke Regisseur Christoph Schlingensief inszenierte sein Stück "Mea Culpa" am Wiener Burgtheater als multimediale Sterbeinstallation). Und das Internet. Dort entwickeln sich individuelle Trauerportale des Gedenkens an Verstorbene. Gleichzeitig wandelt sich die Bestattungskultur. Der historische Vorlauf: Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bekam der sich erstmals formierende Berufsstand der Bestatter politische Konkurrenz: Sozialistisch und sozialdemokratisch orientierte Arbeiter sahen in der preiswerteren Feuerbestattung auch die Möglichkeit, ihrer politische Haltung Ausdruck zu geben. Heute variiert sich die Einäscherung zur Anonymisierung: Nicht mehr Gottesacker, sondern Bestattung auf See, in der Luft (per Ballon), sogar im Weltraum, nicht mehr Grabstein, sondern menschliche Asche in eine Urne aus gepressten Maismehl zur letzten Ruhe in eine Baumwurzel eingebettet, oder verabschiedet in Urnen-Gemeinschaftsgrabanlagen, sogenannte "Grüne Wiesen". Den Wandel haben auch die Todesanzeigen erreicht. Gedichte, Aphorismen, Zitate aus der Literatur, Blumen, Bäume und Schwarz-Weiß-Fotos verdrängen allmählich christliche Trauersymbole. Die Gefühlswelt der Angehörigen rückt in den Vordergrund und nicht die Heilserwartung im Jenseits. Die Kirchen sehen diesen Trend zu anonymen und individualisierten Formen von Bestattungen und Trauerkultur mit Sorge, sind sie doch ein weiteres Zeichen der "Entchristlichung", der Säkularisierung der Gesellschaft - und damit des kulturellen Machtverlustes der Konfessionen. Für die Markt-Kommunikation aber bedeutet der Wandel in der Bestattungskultur geradezu die betriebswirtschaftliche Pflicht, die eigene Werbung kritisch zu fokussieren. Ergeben sich neue Marktchancen angesichts der Entmystifizierung von Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 5 Trauer und Bestattung? Warum nicht auch Tabu-Brüche und Provokationen in der Werbung der Bestatter? III. Provokation: Riskante Propaganda-Strategie Jährlich sterben in Deutschland 850.000 Menschen. Das sind ebenso viele Trauerfälle, gekoppelt mit Problemen, bei denen Bestattungsunternehmen helfen wollen und sollen: Sie machen den Staat in einem besonders psychologisch intimen Bereich bis auf die rechtliche Rahmenordnung entbehrlich. Zur aufgeklärten Gesellschaft gehört aber auch die Bringschuld der privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, dass sie auf ihre Leistungen sachgerecht aufmerksam machen. Das gilt mehr denn je auch für Unternehmen der Bestattungskultur. Werbung hat dort nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine soziale Komponente: Werben für Vorsorge. Aber auf welche Weise? Es herrscht immer noch babylonische Sprachverwirrung über verschiedene Methoden der MarktKommunikation. Liegt die Lösung der Kommunikationsprobleme also im emotionalen DauerWerbefeuer? Also: Ran an den Tabu-Bruch? Die Magie, die früher dem Tabu gegeben war, ist in offenen Gesellschaften verschwunden und hat einem lässigen Wortgebrauch Platz gemacht. Der Begriff Tabu meint entweder ein einfaches Verbot oder die Weigerung, über bestimmte Dinge zu sprechen, nachzudenken oder zu diskutieren. Schwächer geworden ist auch die ordnende Funktion dieser Vokabel. Wir sprechen heute von 'political correctness'. Man macht eben keine Witze über Juden. Die "Negerküsse" mussten weichen. Auch mit patriotischen Gefühlen geht man hierzulande in der Öffentlichkeit immer noch verhalten um – trotz der an die Oberfläche geschwappten Lockerungsübungen während der Fußballweltmeisterschaft. Aufmerksamkeit zu erringen, ist heute werbefachliche Schwerstarbeit. Die Konkurrenz ist gewaltig. Politiker, Kirchen, Gewerkschaften, gesellschaftliche Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 6 Institutionen und natürlich auch Unternehmen - sie alle sind Konkurrenten um das Interesse der Menschen. Vor allem aus Kreisen von Kulturpessimisten und Gegnern der Marktwirtschaft kommt der Vorwurf, die kommerzielle Kommunikation sei der Tabu-Brecher schlechthin. Der Werbung sei auch gar nichts mehr heilig, um Profit zu machen. Ist das wirklich so? Ist öffentliche Aufmerksamkeit für Zahnbürsten und Autos, Küchenkrepp und Waschmaschinen, Lebensversicherung und Bestattung überhaupt noch produzierbar - angesichts der Omnipotenz von gesellschaftlichen Mitteilungsbedürfnissen auf der Bühne der Öffentlichkeit? Auf jeden Fall kursiert in der Wirtschaft die Sorge von der Empfängnisverhütung in Sachen Werbebotschaften. Einige Unternehmen meinen, sie müssten dem Konsumenten emotional die Sporen geben, damit der sich überhaupt noch bewegt. Das Ganze nennt sich dann ’Prinzip Provokation’. Provozieren ist eine fabelhafte Sache. Man kann auf diese Weise seine Ehe beenden, Kriege anzetteln, aber auch soziale Betroffenheit auslösen oder Diskussionen mit dem Ziel anregen, schlechte Dinge zum Besseren zu wenden. Die Bandbreite von Provokation reicht von Waffe bis Werkzeug - gleichgültig ob im öffentlichen Leben oder privaten Bereich, in der Diktatur oder in der Demokratie. Da wirbt ein Bestattungsunternehmen in den USA mit dem Text: "Warum leben, wenn Sie schon für 10 Dollar beerdigt werden können?" Zarte Seelen klassifizieren solche Werbetexte als "Tabu-Bruch"; robustere Gemüter werden das allenfalls als "makaber" bewerten. Provozieren heißt hervorrufen, herausfordern, aufreizen. Gefühlsaufwallungen sollen Verhalten beeinflussen und bestenfalls steuern. Beispiel der Tierschutzverein ’Noah’. In einer Anzeige sieht man den Rücken eines gefesselten Soldaten. Hinter ihm ist der Arm eines weiteren Soldaten zu sehen, der seine Pistole auf den Rücken des Gefangenen drückt. Schlagzeile neben dem Foto: "Wie man sich kurz vor seiner Ermordung fühlt. Fragen Sie mal ihr Schnitzel." Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 7 Lohnen sich überhaupt solche Schläge mit dem Werbehammer, wie man sie sich auch für Bestattungen erdenken kann? Wo sind die Grenzen – wo verabschiedet sich die betriebswirtschaftlich effiziente Provokation und mutiert zur platten Propaganda? Denn die hat mit ’werben’, also mit be-werben wenig zu tun. Propaganda statt Werbung fördert in der Wirtschaft den strategischen Ansatz: Hauptsache, die Katze fängt die Mäuse. Schamloser Realismus, der ohne Rücksicht auf moralische Hemmungen das vor seinen Karren spannt, was den eigenen Zielen nutzt? Dann würde Werbung zur visuellen Droge, die den Bürger als Konsumenten letztlich verachtet. Werbende Firmen würden zu integrierten Asozialen, die zwar lauthals ihr negatives Image in der Öffentlichkeit beweinten, aber ansonsten die letzten, nur sogenannten "kreativen Ressourcen“ rücksichtslos ausbeuteten. Warum dann als Nächstes in der Werbung nicht auch Vergewaltigung von Frauen, den sexuellen Missbrauch von Kindern und TV-Spots mit Einblick in den Prozess der Feuerbestattung? Unter der entschuldigenden Vokabel "Selbstironie" ließe sich doch auch das fabelhaft der Öffentlichkeit verkaufen. Völlig unstreitig ist, dass auch mit Hilfe provokativer Elemente in der Werbung beim Publikum hohe Aufmerksamkeit zu erzielen ist. Aber die Gefahr des betriebswirtschaftlichen Kurzschlusses ist groß: Werbliche Grenzüberschreitungen teilen häufig die Kundschaft in Befürworter und Gegner auf. Das aber kann allein aus ökonomischer Sicht kaum Funktion von Investitionen in Werbung sein: Ich will meine gesamte Zielgruppe für mich gewinnen und nicht nur die Hälfte. Der Bumerang liegt also immer daneben. Regeln brechen kann Firmenimage brechen. Aufsehen ist noch kein Ansehen. Extreme Ideen können zwar zur Unterhaltung der Bevölkerung beitragen - aber auch schlechte Aufmerksamkeitswerte produzieren und Konsumenten von Unternehmen fernhalten. Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 8 Nun hört man immer wieder, dass Provokationen in der Werbung einen exzellenten zusätzlichen Effekt hätten: Die Medien würden sich massenweise in ihrem redaktionellen Teil mit solchen Aktionen befassen. Keine Frage: In manchen Fällen gelingt die Instrumentalisierung von Presse und Funkmedien auch. Der Grund ist simpel: Solche Werbeattacken haben häufig einen gewissen Unterhaltungswert. Der wird von Medien gerne aufgegriffen. Nach dem Medienrauschen messen dann ganz Schlaue die Größen der erschienenen Artikel aus oder die Länge der Beiträge in den Funkmedien, errechnen auf dieser Grundlage die ’gesparten’ Streukosten für Werbung. Wer den entstandenen Imageverlust dagegen aufrechnet, wird rasch im Grübeln enden. Solche Kalkulation mit der Medienresonanz ist riskant. Warum? In einer Anzeige ist der Auftraggeber Herr des Verfahrens - also der Inhalte. Im redaktionellen Teil kommt es auf die Sicht des Redakteurs an. Die Erfahrung zeigt: Letztlich bleibt bei öffentlich strittigen Werbekampagnen immer etwas Negatives an einer Firma und ihrem Leistungsangebot hängen. IV. Vier Orientierungspunkte für die Werbung Das bedeutet keineswegs: Werbung des Bestattungsgewerbes darf nicht aufmerksamkeitsstark sein. Im Gegenteil, das muss sie sein - um ihrer betriebswirtschaftlichen Effizienz und Effektivität willen, aber als erste Stufe eines Kommunikationsprozesses, an den sich die zweite anschließt: Sympathie für das Angebot und Impulse von Vertrauen. Oder anders: auffallen um anzukommen. Dabei spielt die viel in diesem Zusammenhang zitierte 'Pietät' nicht die Rolle eines Damoklesschwertes, sondern in der Werbeplanungsphase die Funktion einer Richtschnur. Das lateinische Wort Pietät bedeutet in unserem Sprachgebrauch heute Respekt und Erfurcht. Da passt jede Menge aufmerksamkeitsstarke Werbung hinein - aber zum Beispiel eben nicht Verschleierungstaktik über die Gesamtkosten einer Beerdigung - eine höchst fragwürdige Strategie, die ohnehin nach dem Gesetz Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 9 gegen unlauteren Wettbewerbs (UWG) als irreführend verboten sein kann und mit dem Inhalt von 'Pietät' so gar nichts zu tun hat. Die Kernkompetenz neben den kommerziell angebotenen Leistungen von Bestattern ist 'Empathie'. Das in seinem Ursprung griechische Wort kann zutreffen mit 'Einfühlungsvermögen' übersetzt werden. Wer darüber verfügt, wird auch kaum Probleme mit seiner Markt-Kommunikation bekommen: Die Alarmglocken schrillen bei Gratwanderungen und beim Verhindern werbliche Grenzüberschreitungen. Und er wird auch zwischen schwarzen englischen Humor oder amerikanischen Schenkelklopfern im Vergleich zur Empfindungsbreite der Deutschen zu differenzieren wissen - sich also im Ausland keine unpassenden Muster suchen. Wie kann Werbung für Unternehmen der Bestattungskultur bodensicher bleiben? Vier Orientierungspunkte: ■ Werben, werben, werben - mit Empathie, mit Pietät - im Bewusstsein, zwei Seiten zu dienen: den Trauernden und dem Verstorbenen, sowie parallel der Existenz des eigenen Unternehmens mit seinen sozialen Verpflichtungen, ökonomischen Zielen und den damit verbundenen positiven Effekten für die Allgemeinheit. ■ Werbung muss aus moralischen und ökonomischen zumutbar bleiben: - rechtlich einwandfrei (insbesondere nicht "irreführend" und in keiner Weise "belästigend") - und sie muss den Normen der freiwilligen Selbstkontrolle des von den 43 ZAWVerbänden getragen Deutschen Werberats entsprechen (Grundregeln zur kommerziellen Kommunikation…"Vertrauen nicht missbrauchen…keine Angst erzeugen…Leid nicht instrumentalisieren…"). ■ Schockwerbung (gescheitertes Muster Benotton) und Provokationen helfen den Unterhaltungsmedien, selten aber Firmen. Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 10 ■ Unternehmen des Bestattungsgewerbes sind Teil der Wirtschaft und kulturell verpflichtet: Indem sie über den Tod hinausdenken, fördern sie den Blick auf das Leben. Es geht bei der Markt-Kommunikation der Bestattungsgewerbes um mehr - um die Werbekultur des Abschieds. 'Laut, bunt, frech' passt besser zu Marmelade. Es muss ja nicht Hölderlin sein. Wunderbares Zitat aus einer Traueranzeige: "Oft schau ich aufs Meer hinaus und überdenke mein Leben, sein Steigen und Fallen. Und es lautet mir wir ein Saitenspiel, in dem der Meister in verborgener Ordnung die Töne durcheinander wirft." Kontakt Volker Nickel Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) Deutscher Werberat Telefon: (030) 59 00 99 – 715, E-Mail: [email protected] Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 11 Auszug Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) "Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2413) geändert worden ist" Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 29.7.2009 I 2413 § 1 Zweck des Gesetzes Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. § 2 Definitionen (1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 1. „geschäftliche Handlung“ jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; als Waren gelten auch Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte und Verpflichtungen; 2. "Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern und Verbrauchern alle Personen, die als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig sind; 3. "Mitbewerber" jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht; 4. "Nachricht" jede Information, die zwischen einer endlichen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst ausgetauscht oder weitergeleitet wird; dies schließt nicht Informationen ein, die als Teil eines Rundfunkdienstes über ein elektronisches Kommunikationsnetz an die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, soweit die Informationen nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden können; 5. "Verhaltenskodex" Vereinbarungen oder Vorschriften über das Verhalten von Unternehmern, zu welchem diese sich in Bezug auf Wirtschaftszweige oder einzelne geschäftliche Handlungen verpflichtet haben, ohne dass sich solche Verpflichtungen aus Gesetzes- oder Verwaltungsvorschriften ergeben; Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 12 6. "Unternehmer" jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag einer solchen Person handelt; 7. "fachliche Sorgfalt" der Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise angenommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Marktgepflogenheiten einhält. (2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. § 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen (1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen. (2) Geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sind jedenfalls dann unzulässig, wenn sie nicht der für den Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, die Fähigkeit des Verbrauchers, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Dabei ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Auf die Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds einer auf Grund von geistigen oder körperlichen Gebrechen, Alter oder Leichtgläubigkeit besonders schutzbedürftigen und eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern ist abzustellen, wenn für den Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche Handlung nur diese Gruppe betrifft. (3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig. § 5 Irreführende geschäftliche Handlungen (1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält: 1. die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 13 2. den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; 3. die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; 4. Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; 5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; 6. die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder 7. Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen. (2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. (3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen. (4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat. § 5a Irreführung durch Unterlassen (1) Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irreführend ist, sind insbesondere deren Bedeutung für die geschäftliche Entscheidung nach der Verkehrsauffassung sowie die Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung der Entscheidung zu berücksichtigen. (2) Unlauter handelt, wer die Entscheidungsfähigkeit von Verbrauchern im Sinne des § 3 Abs. 2 dadurch beeinflusst, dass er eine Information vorenthält, die im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller Umstände einschließlich der Beschränkungen des Kommunikationsmittels wesentlich ist. Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 14 (3) Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen kann, gelten folgende Informationen als wesentlich im Sinne des Absatzes 2, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben: 1. alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung in dem dieser und dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Umfang; 2. die Identität und Anschrift des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und Anschrift des Unternehmers, für den er handelt; 3. der Endpreis oder in Fällen, in denen ein solcher Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder in Fällen, in denen diese Kosten nicht im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können; 4. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, soweit sie von Erfordernissen der fachlichen Sorgfalt abweichen, und 5. das Bestehen eines Rechts zum Rücktritt oder Widerruf. (4) Als wesentlich im Sinne des Absatzes 2 gelten auch Informationen, die dem Verbraucher auf Grund gemeinschaftsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten werden dürfen. § 16 Strafbare Werbung (1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbraucher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer Abnehmer erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Anhang (zu § 3 Abs. 3) Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Abs. 3 sind Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 15 1. die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören; 2. die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung; 3. die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt; 4. die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche Handlung oder eine Ware oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden, oder die unwahre Angabe, den Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung werde entsprochen; 5. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Abs. 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (Lockangebote). Ist die Bevorratung kürzer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuweisen; 6. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Abs. 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung abzusetzen, eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder Dienstleistung vorführt oder sich weigert zu zeigen, was er beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder die beworbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen; 7. die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden; 8. Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ursprünglich verwendete Sprache nicht Amtssprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass diese Leistungen in einer anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht werden; 9. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung sei verkehrsfähig; 10. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar; Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 16 11. der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung); 12. unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt; 13. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen; 14. die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, das den Eindruck vermittelt, allein oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System könne eine Vergütung erlangt werden (Schneeball- oder Pyramidensystem); 15. die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäftsräume verlegen; 16. die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen; 17. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt, oder wenn jedenfalls die Möglichkeit, einen Preis oder sonstigen Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines Geldbetrags oder der Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird; 18. die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbildungen heilen; 19. eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen Bedingungen als den allgemeinen Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch zu nehmen; 20. das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht gestellten Preise noch ein angemessenes Äquivalent vergeben werden; 21. das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 17 Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für die Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind; 22. die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt; 23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbraucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewerbes oder Berufs tätig; 24. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein Kundendienst verfügbar; 25. das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen Vertragsabschluss verlassen; 26. bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nichtbeachtung einer Aufforderung des Besuchten, diese zu verlassen oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sein denn, der Besuch ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt; 27. Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus einem Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass von ihm bei der Geltendmachung seines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder dass Schreiben zur Geltendmachung eines solchen Anspruchs systematisch nicht beantwortet werden; 28. die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen; 29. die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder Dienstleistungen oder eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen, sofern es sich nicht um eine nach den Vorschriften über Vertragsabschlüsse im Fernabsatz zulässige Ersatzlieferung handelt, und 30. die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht abnehme. Werbung des Bestattungsgewerbes Seite 18 Deutscher Werberat Grundregeln zur kommerziellen Kommunikation Oktober 2007 Die Arbeit des Deutschen Werberats als einem Organ der freiwilligen Selbstkontrolle wahrt und stärkt das Vertrauen der Verbraucher in kommerzielle Kommunikation. Die in der Werbewirtschaft tätigen Unternehmen dokumentieren damit auch gegenüber Gesellschaft und Politik, dass sie ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Werbung in Deutschland unterliegt gesetzlichen und darüber hinaus von der Wirtschaft freiwillig festgelegten Grenzen. Angesichts der Vielzahl bestehender und sich neu ergebender Möglichkeiten der werbenden Ansprache sowie vielfältiger und sich ständig verändernder Lebenssachverhalte kann Verstößen gegen diese Grundregeln nicht in jedem Fall mit speziellen Verhaltenskodizes für jeden konkreten Sachverhalt begegnet werden. Kommerzielle Kommunikation hat die allgemein anerkannten Grundwerte der Gesellschaft und die dort vorherrschenden Vorstellungen von Anstand und Moral zu beachten. Sie muss stets von Fairness im Wettbewerb und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft getragen sein. Insbesondere darf Werbung • das Vertrauen der Verbraucher nicht missbrauchen und mangelnde Erfahrung oder fehlendes Wissen nicht ausnutzen • Kindern und Jugendlichen weder körperlichen noch seelischen Schaden zufügen • keine Form der Diskriminierung anregen oder stillschweigend dulden, die auf Rasse, Abstammung, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung oder sexuelle Orientierung bzw. die Reduzierung auf ein sexuelles Objekt abzielt • keine Form gewalttätigen, aggressiven oder unsozialen Verhaltens anregen oder stillschweigend dulden • keine Angst erzeugen oder Unglück und Leid instrumentalisieren • keine die Sicherheit der Verbraucher gefährdenden Verhaltensweisen anregen oder stillschweigend dulden. Bei der Beurteilung einer Werbemaßnahme berücksichtigt der Deutsche Werberat das Leitbild des durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers, der den von der Werbung angesprochenen Verkehrskreisen angehört die Tonalität und Themenvielfalt in den redaktionellen Teilen der Medien als Ausdruck gesellschaftlicher Realität den Charakter des die Werbung verbreitenden Mediums die Situation, in der der Verbraucher mit der Werbung konfrontiert wird.