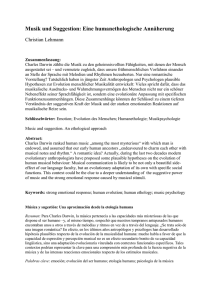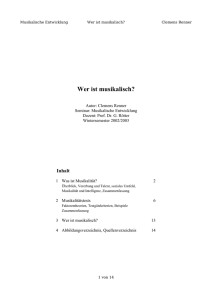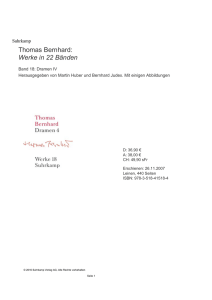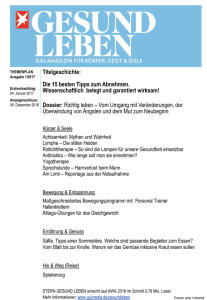Der Musikalische Kompetenzerwerb des jüngeren Kindes (4
Werbung
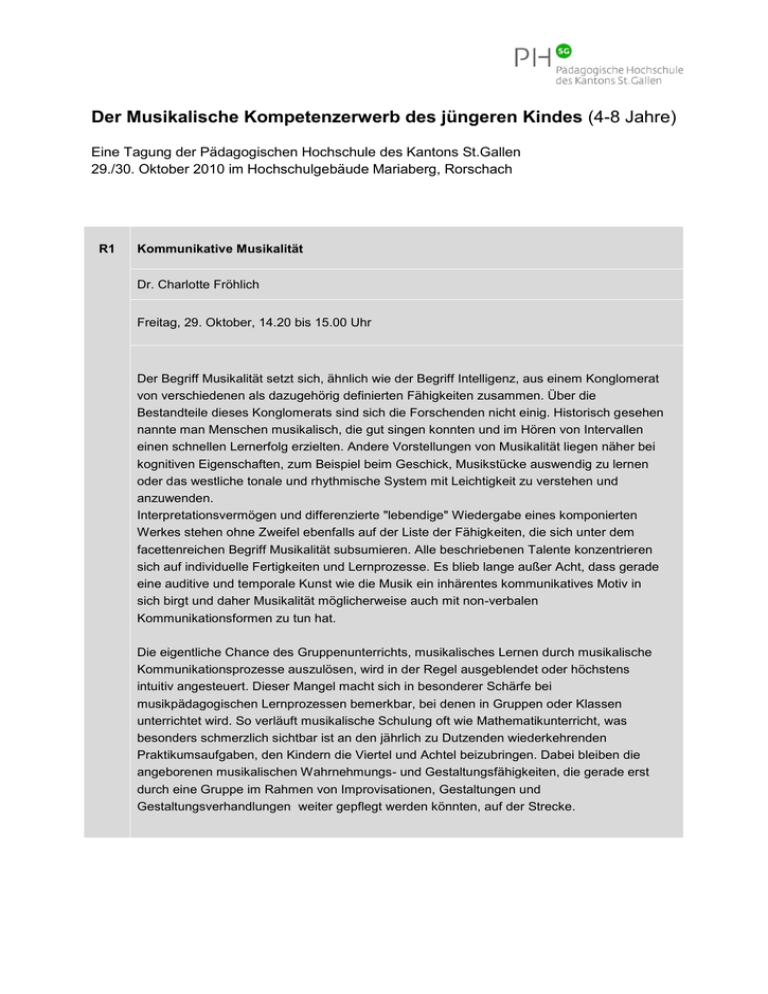
Der Musikalische Kompetenzerwerb des jüngeren Kindes (4-8 Jahre) Eine Tagung der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen 29./30. Oktober 2010 im Hochschulgebäude Mariaberg, Rorschach R1 Kommunikative Musikalität Dr. Charlotte Fröhlich Freitag, 29. Oktober, 14.20 bis 15.00 Uhr Der Begriff Musikalität setzt sich, ähnlich wie der Begriff Intelligenz, aus einem Konglomerat von verschiedenen als dazugehörig definierten Fähigkeiten zusammen. Über die Bestandteile dieses Konglomerats sind sich die Forschenden nicht einig. Historisch gesehen nannte man Menschen musikalisch, die gut singen konnten und im Hören von Intervallen einen schnellen Lernerfolg erzielten. Andere Vorstellungen von Musikalität liegen näher bei kognitiven Eigenschaften, zum Beispiel beim Geschick, Musikstücke auswendig zu lernen oder das westliche tonale und rhythmische System mit Leichtigkeit zu verstehen und anzuwenden. Interpretationsvermögen und differenzierte "lebendige" Wiedergabe eines komponierten Werkes stehen ohne Zweifel ebenfalls auf der Liste der Fähigkeiten, die sich unter dem facettenreichen Begriff Musikalität subsumieren. Alle beschriebenen Talente konzentrieren sich auf individuelle Fertigkeiten und Lernprozesse. Es blieb lange außer Acht, dass gerade eine auditive und temporale Kunst wie die Musik ein inhärentes kommunikatives Motiv in sich birgt und daher Musikalität möglicherweise auch mit non-verbalen Kommunikationsformen zu tun hat. Die eigentliche Chance des Gruppenunterrichts, musikalisches Lernen durch musikalische Kommunikationsprozesse auszulösen, wird in der Regel ausgeblendet oder höchstens intuitiv angesteuert. Dieser Mangel macht sich in besonderer Schärfe bei musikpädagogischen Lernprozessen bemerkbar, bei denen in Gruppen oder Klassen unterrichtet wird. So verläuft musikalische Schulung oft wie Mathematikunterricht, was besonders schmerzlich sichtbar ist an den jährlich zu Dutzenden wiederkehrenden Praktikumsaufgaben, den Kindern die Viertel und Achtel beizubringen. Dabei bleiben die angeborenen musikalischen Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeiten, die gerade erst durch eine Gruppe im Rahmen von Improvisationen, Gestaltungen und Gestaltungsverhandlungen weiter gepflegt werden könnten, auf der Strecke. Referat Kommunikative Musikalität Kommunikative Musikalität – eine herausfordernde Wortkombination. Wir sollten uns als erstes fragen: können Begriffe wie Musikalität und Kommunikation miteinander in Verbindung gebracht werden? Müssen sie es vielleicht sogar? Sollte man sie getrennt betrachten oder kann man sie überhaupt voneinander trennen? Was eigentlich hat es mit der immer wiederkehrenden Behauptung auf sich, Musik sei eine "universelle Sprache"? Was ist Musikalität? Musikalität ist ein nicht genau definierter Begriff und wird von verschiedenen Berufsgruppen unterschiedlich gebraucht. So versuchen empirisch-wissenschaftlich orientierte Leute Musikalität als das zu sehen, was die sogenannten Musikalitätstests messen. Dazu gehören beispielsweise die Unterscheidungsfähigkeit für Tonhöhe, die Leistungen des Ton- und Rhythmusgedächtnisses oder die Fähigkeit, Akkorde zu analysieren bzw. zu bestimmen. Diese messbaren Größen scheinen aber das Wesen der Musik nicht einfangen zu können. Leute, die eher in sozialen und pädagogischen Berufen tätig sind, neigen dazu, diejenigen Menschen und Kinder für musikalisch zu halten, die schlicht Freude an Musik empfinden. In diesem Zusammenhang ist es nicht so wichtig, ob man Freude belegen, messen oder genau nach weisen kann – was bedingt möglich wäre, zum Beispiel durch Befragungen oder differenzierte Beobachtungen von Mimik und Gestik. Es gilt der wohlgemeinte Grundsatz: "Hauptsache, es macht Spaß". Doch gerade darin besteht die Gefahr, dass man in der Praxis nachlässig und oberflächlich wird. Es wird noch eine weitere Auslegung des Begriffs diskutiert: Als Musikalität könnte die Fähigkeit bezeichnet werden, in Klangereignissen und in Klangverläufen einen Sinn zu erleben. Dieses Konzept von Musikalität ist eher einer hermeneutisch-wissenschaftlichen Methode verpflichtet. Es ist ausgesprochen kunst-nah. Die soeben geschilderten drei Begriffskonzepte haben eines gemeinsam: sie gehen vom einzelnen Individuum aus und suchen dessen "Musikalität" zu definieren. Doch vereinen sich seit ca. 15 Jahren Strömungen aus der Anthropologie, der Entwicklungspsychologie und der Hirnforschung zu einem neuen Verständnis von Musikalität. Sie sehen Musikalität als ein Kommunikationssystem, ohne das die Spezies Homo Sapiens gar nicht hätte überleben können. Man nimmt außerdem an, dass dieses Kommunikationssystem die Wurzel aller menschlichen Interaktionen ist. Noch bevor nämlich Sprache als Bedeutungsträger zwischen Menschen wirksam werden kann, übertragen Menschen ihre Stimmungen und Bedürfnisse durch klanglich- (meist natürlich stimmlich-) gestische Zeichen. (TREVARTHEN; 01 – 13). Die Grundfrage hat sich nun verschoben: es wird nicht mehr gefragt: Warum macht DER MENSCH Musik? … sondern: Warum machen DIE MENSCHEN Musik MITEINANDER. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist Musikalität eine spezifische Kommunikationsform, die etwas mit Beziehungs- und Gruppenbildung, mit Gemeinschaftlichkeit zu tun hat. – Sehen wir allerdings unsere westliche Musik an, so entdecken wir dabei, dass sie als hoch differenzierte Kunstform weit über diese Eigenschaften hinaus geht. Wir erkennen, dass Rollen wie die des Solisten, der Dirigentin und des Musikkritikers, wie die der Komponistin und des Korrepetitors Zeichen dafür sind, dass wir es mit einer musikalischen Hochkultur zu tun haben. Es ist leicht einzusehen, dass die anthropologische Vorstellung von Musikalität, von kommunikativer Musikalität uns Klassenlehrpersonen und MusikpädagogInnen die vielfältigsten Perspektiven für unser Arbeitsfeld aufzeigen kann; Perspektiven, die zwar künstlerischer Art sind, die aber weit in die Menschenbildung hineinreichen. Es sind auch Perspektiven, die eine lebenslängliche Motivationsgrundlage für Zeitkünste, das sind Künste, die mit der Zeit erscheinen und vergehen, schaffen können. Mit dem Bezug zur Hochkultur wird man behutsam umgehen müssen; wenn wir einem Kind zu früh nur den Weg in die Hochkultur weisen, so unterlassen wir es, ihm die Vielfältigkeit zwischenmenschlich-musikalischer Erfahrungen nahezubringen. Wir entziehen ihm den musikalischen Nährboden. – Wenn wir aber andererseits NUR die Gemeinschaftsbildung mit Musikunterricht meinen, so vermeiden wir es, Kindern die geistig- seelischen Differenzierungen und Dimensionen unserer abendländischen Musik aufzuzeigen. Wir werden Gefahr laufen, in die Sackgasse namens "Hauptsache-es-hat-Spaß-gemacht" zu gelangen. Spaß darf sein, doch es gibt eine Steigerung von Spaß und die heißt zum Mindesten für den Musikunterricht: Kunst- und Kulturbezug. Vitalitätsaffekte und Attunement Neue Begriffe aus der Säuglingsforschung helfen, die Wirkungsweise von kommunikativer Musikalität besser zu begreifen. Insbesondere handelt es sich um zwei Begriffe, die der Säuglingsforscher Daniel STERN entwickeln musste, um spezifische Eigenschaften im menschlichen und zwischenmenschlichen Gefühlsleben in Worte zu fassen. Er beschreibt mit der Wortschöpfung "Vitalitätsaffekte" eine "Art des Erlebens" (STERN, 83) die nicht in statische Begriffe zu fassen ist wie Freude, Liebe, Trauer, Angst usw. Im Prinzip entdeckte er, dass man nicht nur für Gefühle, sondern auch für die Gefühlsbewegungen einen Begriff finden muss. Seelische Bewegungen lassen sich nur mit dynamischen Begriffen beschreiben. Diese müssen nicht zwingend in Verbindung mit den sogenannten kategorialen Affekten (Freude, usw.) auftreten. "Wir kennen eine (...) Art des Erlebens, die unmittelbar aus der Begegnung mit Menschen hervorgehen kann. Diese schwerbestimmbaren Qualitäten lassen sich besser mit dynamischen, kinetischen Begriffen charakterisieren, Begriffen wie "aufwallend", "flüchtig", "anschwellend", "abklingend", "berstend", usw. Erlebnisqualitäten dieser Art sind für Säuglinge mit Sicherheit spürbar und täglich, ja in jedem Augenblick von großer Bedeutung." (STERN, 83) Diese "Erlebnisqualitäten" nennt Daniel STERN Vitalitätsaffekte. Sie können in Verbindung mit den kategorialen Affekten (Freude, Liebe, Trauer, Angst, …) auftreten, doch dies ist nicht zwingend. Nicht nur Freude, auch ein Tatendrang kann flüchtig, abklingend, zunehmend oder berstend sein. Wir alle kennen einen "berstenden" Übermut, ein "flüchtiges" Erinnern, ein "zunehmendes Erstaunen", eine "abebbende" Neugierde oder einen uns "wuchtig überrollenden" Schrecken. Musikerinnen und Musiker werden schnell entdecken, dass nahezu alle Begriffe, die STERN in seinen Texten zur Thematik Vitalitätsaffekte verwendet, in der Musik als Vortrags- oder Interpretationsangaben vorkommen. Machen wir die Probe aufs Exempel und vergleichen einige Worte aus Daniel STERNS Kapitel über die Vitalitätsaffekte (STERN; 83ff) mit den Vortragsbezeichnungen im dtv-Atlas Musik (S. 70-82): anschwellend, aufwallend, verblassend flüchtig, explosionsartig, abklingend, wuchtig hereinbrechend sich hinziehend leises Zucken dahin eilend munter plätschernd, mühelos crescendo diminuendo volando, volubile oder svelto sforzato subito decrescendo, diluendo con brio, impetuoso, marziale calando vielleicht: mormorando presto gioioso, allegramente leggero, lievo In der Regel imitieren Erwachsene intuitiv die Vitalitätsaffekte von Säuglingen. Ein munteres Armschütteln des Kindes wird mit Winken beantwortet, ein glucksendes Lächeln wird mit Lächeln und ein paar Worten in ähnlicher oder gleicher Tonhöhe beantwortet; Sowieso werden Lautäußerungen von sehr kleinen Kindern oft in der gleichen Lautstärke und Tonhöhe echoartig gespiegelt (vgl. TREVARTHEN, 01 - 13). In diesen Handlungen vermutet man einen evolutionären Sinn. Solche Nachahmungen können einen ersten auditiven und/oder visuellen Kontakt zwischen Kind und Bezugspersonen herstellen und der Vorbereitung des intersubjektiven Erlebens dienen. Knapp zehn Monate nach der Geburt wird die imitationsähnliche Kommunikation um weitere Dimensionen ergänzt. Affektabstimmung nennt STERN diese neue Kontaktebene: Die Bezugsperson ahmt noch immer nach und bestärkt das kleine Kind, wechselt dabei aber oft den Wahrnehmungsmodus. So begleitet sie etwa ein freudiges Hüpfen eines kleinen Kindes mit hüpfender Melodik in ihrer Sprache oder unterstützt eine Spielbewegung mit perkussiven Silben (STERN, 200, TREVARTHEN, 01 - 13). "Sobald der Säugling aber etwa neun Monate alt ist, sieht man, dass die Mutter ihr imitationsähnliches Verhalten um eine neue Dimension erweitert, (...) die wir als Affektabstimmung bezeichnen wollen." (STERN, 200) "Ein neun Monate alter Junge haut auf ein weiches Spielzeug los, zuerst ein bisschen wütend, allmählich aber mit Vergnügen, voller Spaß und Übermut. Er entwickelt einen stetigen Rhythmus. Die Mutter fällt in diesen Rhythmus ein und sagt: "kaaaaa- bam, kaaaaa- bam", so dass bam auf den Schlag fällt und das kaa die vorbereitende Aufwärtsbewegung und das erwartungsvolle Innehalten des Arms vor dem Schlag begleitet." (STERN, 200f) Die musikalisch-kinetischen Qualitäten sind im Prozess der Affektabstimmung komplexer als bei der Imitation der Vitalitätsaffekte. Trotzdem verstehen Kinder diese Kommunikationsform, ja, sie fordern sie sogar oft ein. Manche Kinder reagieren mit Verhaltensauffälligkeiten, wenn sie zu wenig davon erleben. Das alles deutet darauf hin, dass Kinder die Fähigkeit, musikalisch (d. h. in diesem Zusammenhang klanglich, zeitlich und kinetisch) verlaufende Kommunikationsprozesse zu verstehen, mit auf die Welt bringen oder in ihren ersten Lebenstagen ausbilden. – Halten wir fest: schon sehr kleine Kinder haben ein hoch entwickeltes Wahrnehmungssensorium für die unterschiedlichsten dynamischen Verläufe und für zeitliche Übereinstimmungen mit einer mitspielenden, kommunizierenden Person – kleine Kinder sind in diesem Sinne hochmusikalisch. Derzeit verfügt die Anthropologie über viele Belege, dass die Spezies Mensch nur dank ihrem Zusammenrotten in Gruppen überleben konnte. Solche Gruppen müssen zur Verfestigung ihrer Zugehörigkeit auch Gesänge benutzt haben; es ist anzunehmen, dass die heutigen Gesänge von Fussballfans uns vor Augen führen, wie dies vor Urzeiten funktioniert hat. Gruppen, die durch solche Gesänge verbunden sind, vermeiden Gewalttätigkeiten untereinander. Kompetenzerhalt statt Kompetenzerwerb Als Klassenlehrpersonen und MusikpädagogInnen müssen wir folglich verstehen, dass Kinder nicht unbedingt musikalische Kompetenzen zu erwerben haben, sondern dass wir gefordert sind, vorhandene Kompetenzen zu entwickeln, zu verfeinern und letztlich kognitiv zugänglich zu machen. Begründen lässt sich dies von zwei Seiten: qualitativ hochstehende musikpädagogische Erfahrungen verfeinern das Kind einerseits in seinen sozialen und andererseits in seinen künstlerischen Fähigkeiten. Musikalisches Erleben, das heisst Erleben in klanglicher, zeitlicher und kinetischer Dimension, bedeutet ja auch zwangsläufig zweierlei: nämlich sowohl eine vertiefte Hinwendung zu einer Kunst als auch ein Differenzieren von Ausdrucksfähigkeiten und Kommunikationsweisen. Anerkennen wir also, dass ein Kind neben Rhythmen und Tönen eine Reihe von andern musikalischen Charakteristika wahrnehmen kann. Es ist fähig, musikalische Elemente wie Dauer, Zeitgleichheit, Klangfarbe und dynamische Veränderung sehr differenziert einzuordnen. Diese Erkenntnis verändert unser Unterrichtskonzept: Isolierte Unterrichtseinheiten zu "lang-kurz", zu Dynamik oder Klangfarben müssten sehr kritisch hinterfragt werden, denn sie bieten einem Kind kaum Nahrung für seine natürliche Neugierde auf alles was klingt und sich bewegt. Allerhöchstens können Kinder dabei neue Begriffe aus der Welt der Musik lernen. Ein der Nachhaltigkeit verpflichteter Musikunterricht macht die Vermittlung solche Begriffe nicht zum Unterrichtsthema. Musikalische Begriffe sollten in Improvisations- und Gestaltungsprozessen hingegen immer wieder einfließen, nämlich wenn man Lieder, Stücke und Tänze erlernt, begleitet oder gemeinsam ausschmückt. Musiklernen, basierend auf modernen anthropologischen Erkenntnissen, bedeutet vitale Gegenwartserfahrung und akustischer, choreografischer, auch mimischer Austausch mit andern anwesenden Menschen, von frühester Kindheit an. Das heißt aber auch, dass die dynamischen Verläufe (schneller, langsamer, lauter, leiser, hinziehend, berstend, plötzlich…) im Musikunterricht zentraler und lebensnaher sind als der einzelne Ton, der einzelne Takt, der einzelne getanzte Wechselschritt oder der einzelne Notenwert (vgl. SWANWICK 44). Musiklernen bedeutet ferner nicht nur (aber auch) in den Keyboard-Unterricht zu gehen; gerade dies aber ist leider oft eine unreflektierte Grundannahme in Forschungen, welche die Wirkung von Musik belegen oder widerlegen wollen. Eine anthropologisch fundierte Sichtweise auf Musik hat darum auch Konsequenzen für Forschungsfragen. Wir werden als Klassenlehrpersonen und MusikpädagogInnen in Zukunft sehr genau auf den Musikbegriff schauen müssen, der in medizinischen und psychologischen Forschungen verwendet wird. Es gibt Untersuchungen, da wird geprüft, ob ein Kind zu einer Verhaltensänderung kommt, wenn es ein halbes Jahr Keyboardunterricht hatte. Dass dies nicht unbedingt der Fall ist, ist uns praktizierenden MusikpädagogInnen und Lehrpersonen klar. Wenn jedoch auf dieser Basis vorschnell gesagt wird, es gäbe keinen Lerntransfer aus der Musik heraus in das Sozialverhalten, dann ist das, egal wie empirisch und wie breit die entsprechende Forschung angelegt war, ungenau oder sogar schludrig. In zukünftigen Forschungen muss klar sein, ob man unter "Musik" Einzelunterricht an einem klanglich reduzierten Instrument (Keyboard) meint oder ob man qualitativ anspruchsvollen, an musikalischen Erfahrungen reichhaltigen Gruppenunterricht als Ausgangspunkt für eine gültige Aussage zur Wirksamkeit der Musik nimmt. – Grundsätzlich ist zurzeit anzunehmen, dass Musik nicht unbedingt einen Transfer in weit entfernte Gebiete wie Mathematik verursacht. Die Hirnforschung neigt aber heute zur These, dass ein vielfältiges "Plastizitätstraining" in emotional positiver Umgebung eine Vielzahl von Möglichkeiten für andere Lernprozesse bietet, an Grunderfahrungen anzudocken und intensiver einzuwirken. Nicht auszuschliessen sind immerhin sogenannte "nahe" Transfereffekte, die freilich relativ banal sind. Sie können sicherlich keine Argumentationsbasis für mehr Musikunterricht darstellen, sie können auch nicht dazu dienen, Qualitätsmerkmale für einen guten Musikunterricht zu erstellen: So ist beispielsweise nachgewiesen worden, dass Kinder, die Klavier lernten, auch eine bessere Feinmotorik beim Bedienen einer Schreibtastatur aufweisen. Ja, und? Kompetenzerhalt für das einzelne Kind, für die Gruppe Werden wir praktischer: Was heißt Kompetenzerhalt in unserem musikpädagogischen Alltag? Bereits erwähnt habe ich die dringend nötigen und glücklicherweise oft mit hoher Motivation verbundenen Differenzierungsangebote im Unterricht, wie beispielsweise durch folgende Aufforderungen: … "versucht einmal, noch langsamer lauter zu werden" … "habt Ihr genau darauf geachtet, wann man den Nachhall des Klangstabes nicht mehr hört?" …"lasst uns gemeinsam eine Sonne aufgehen lassen, deren Strahlen (gemeint sind die Arme) ganz genau im gleichen Moment aufgehen! …"habt ihr gehört, wie schön der letzte Akkord bei unserem Kanon klang? Lasst es uns noch einmal probieren" …"lasst uns beim letzten Akkord langsam leiser werden, als würde sich das Lied davonschleichen" …"Steinespiele sind zwar schön, aber lasst uns diesmal ein Steinespiel machen, wo nur die Finger oder gar nur die Zehen zappeln!" …"schön, dass Ihr alle wieder auf Euren Stühlen sitzt, doch das nächste mal gehen alle mit acht Schritten an ihren Platz, die einen müssen vielleicht größere, die andern vielleicht kleinere Schritte nehmen." Die soeben aufgezählten Differenzierungsangebote können jedes Kind individuell in seiner Entwicklung unterstützen. Doch der Anspruch auf Kompetenzerhalt kann auch eine spezielle Dimension für eine ganze Gruppe bilden. Musikalische Gruppenkompetenzen verfeinern sich durch den gemeinsamen Austausch über eine improvisierte Klanggestaltung, durch eine besondere Art, eine Kanon zu singen, eine Choreographie. Kinder haben viele Ideen, wie man etwas originell verändern kann oder ausbauen kann. Diese Ideen treten dann besonders häufig auf, wenn die Lehrperson durch ihr modellhaftes Vorleben klar macht, um was es geht. Fragen wie: "Wer hat eine Idee" lassen eine Gruppe eher verstummen. Beginnt aber die Lehrperson erst einmal, zu erzählen, wie sie einen Kanon fand, was man an einem Zwischenspiel noch verändern könnte, oder zeigt sie eine Bewegungsgestaltung, um eine müde Schlange darzustellen, so sind bald auch die kindlichen Ideen auf dem Tisch (oder im Raum). Nun gilt es, Gruppenverhalten zu entwickeln und zu erfahren: Welche Idee probiert man aus? Welche Ideen verbindet man? Welche Ideen gefallen einzelnen Kindern nicht und wie geht man damit um? Welche Ideen sollten noch verfeinert oder ausgebaut werden. – Die Lehrperson wird in diesem Moment zur Moderatorin und zur Gesprächsführerin. In den vergangenen Jahren war oft von "aussermusikalischen Zielen" im Fach Musik die Rede. Diese Sichtweise scheint mir grundlegend überholt: Musik (und Bewegung) als die künstlerische Ausprägung menschlicher Kommunikation sind per se Kunstformen, die soziales Verhalten fordern und fördern. Nur wer Musik als eine Anreihung von Noten, Notenwerten, Pausenwerten und als ein System von Tonleitern sieht, kann diese Tatsache ausblenden und von "aussermusikalischen Zielen" sprechen. Kompetenzerhalt und Unterrichtsplanung In vielen Schulfächern kann ein klar strukturiertes Unterrichtsangebot dadurch entstehen, dass man Aufträge formuliert, welche die Kinder auf ihre eigenen Weisen lösen sollen. Für das Fach Musik ist das bedenklich. Ein Auftrag ist eine Art Problemstellung und die Auftragsausführung setzt kognitive Prozesse voraus. Sehen wir Musik als eine differenzierbare und in die Künste leitende Kommunikationsform, so kann der Unterricht nicht mit einer Problemstellung beginnen; denn eine solche Hinführung geschieht verbal, nicht musikalisch. Es ist, als würden wir französisch sprechend den Englischunterricht einleiten. Zudem ist musikalische Kommunikation in ihren Anfängen kein "Problem" sondern vitaler Austausch. Eine Musikstunde, die das Potenzial zum Gelingen in sich trägt, beginnt flüssig, prozedural, als eine bewegte oder klingende Szene. In dieser bewegten Szene spielen Lehrperson und Kinder kommunikativ, mit Klängen, Bewegung, dynamischen Veränderungen miteinander, wobei die Lehrperson so lange Imitationsmodell bleibt, bis die Kinder die Regeln eines Spiels kennen und ihre eigenen Ideen spontan einbringen. Ideen, die aus dem Imitationslernen entspringen, sind in aller Regel zuerst unbewusst, entziehen sich also der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Kindern nach ihren Ideen zu "fragen", ist nicht ergiebig, im Gegenteil, es kann blockieren und die primäre Motivation zur Musik schmälern. Die wache Lehrperson ist hier unersetzbar, die sofort merkt, wenn in einer Imitationsphase ein scheinbarer Fehler oder eine Abweichung passiert, welche als gute neue Idee gedeutet, gewürdigt und wiederholt werden kann. Kompetenzerhalt im Lehrplan Der Lehrplan des Kantons St. Gallen enthält einige innovative Ideen, nämlich den Fokus auf die die Verbindung von Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz sowie die explizite Erwähnung einer notwendigen Zusammenarbeit mit den Musikschulen. Auch wird der Einbezug des aktuellen Musiklebens und den Umgang mit Musikinstrumenten im normalen schulischen Alltag gefordert, das heißt, Musikunterricht wird definitiv weiter gesehen als früher, als das Fach noch Singen hieß. Bei der kommenden gesamtschweizerischen Lehrplanrevision müssen trotzdem einige Kompetenzen der Kinder ernster genommen werden. Der hohe Stellenwert dynamischer Verläufe ist nicht nur im St. Galler Lehrplan kaum berücksichtigt. Es ist auch nicht ersichtlich, warum Kinder in der Unterstufe nur "im Bereich der Pentatonik und der ganzen Durtonleiter" singen sollten und Lieder in Moll in die Mittelstufe gehören sollten. Ebensowenig ist es kindgerecht, in der Unterstufe die großen Notenwerte, die ganzen und halben Noten, die Viertel- und Achtelnoten (und den entsprechenden Pausenwerte) zu verwenden. Niemand wird stichhaltig begründen können, warum Sechszehntel sowie punktierte Rhythmen eine Angelegenheit der Mittelstufe, schließlich Triolen eine Angelegenheit der Oberstufe sein sollte. Beim rhythmischen Lernen geht es darum, durch verschiedenartige Echospiele die kindliche Kompetenz für Dauern und Zeitlängen, welche gerade sehr früh zum Spracherwerb vorhanden und wach ist, auch in der Musik zu nutzen. Sprechen und Spielen von komplexen Rhythmen können bereits in der Unterstufe gepflegt und Abb. 1 Komplexer Rhythmus mit binären und verfeinert werden, allmählich kann dazu das ternären Strukturen Notenbild gezeigt werden. Auf diese Weise lernen Kinder das rhythmische Lesen und im Verlauf von drei bis vier Jahren auch das Schreiben ähnlich wie bei einem Leseunterricht nach der Ganzheitsmethode, in kommunikativen Echospielen. Einen Rhythmus mit ternären und binären Unterteilungen (vgl. Abb. 1) kann ein Kindergartenkind nachsprechen und mit etwas Übung auf kleinem Schlagwerk nachspielen, jedoch noch lange nicht vom Blatt lesen. Das Blattlesen andererseits kann auch nicht dadurch schneller erreicht werden, dass Kinder nur Viertel, Achtel und Halbe lernen. Man muss die Notenwerte immer wieder in komplexer Kombination gehört und gespielt haben. Das Lesen sollte allmählich immer genauer behandelt werden, so dass Mittelstufenkinder rhythmische Einheiten nach einmaligem Hören lesen können und Oberstufenschülerinnen und –schüler rhythmische Einheiten ohne vorheriges Hören lesen können. Zu erwähnen wäre noch, dass schon kleinen Kindern natürlich auch ganze ternäre Einheiten präsentiert werden müssten, dass also auch Echospiele mit 12/8 Takten oder zwei aufeinanderfolgenden 6/8 Takten immer wieder vorkommen sollten. Das schließt auch den fließenden Wechsel von zwei 6/8 Takten zu einem 4/4 Takt ein. Abb. 2 Ternäre Strukturen (dreiteilige Rhythmen oder Takte): hier zwei 6/8 Takte Die Anzeichen mehren sich, dass musikalisch überstrukturierter Unterricht nicht nachhaltig sein kann. Praktikumsaufträge, wie den Kindern die Viertel und Achtel beizubringen und dies in überprüfbare Lehrziele zu verpacken sind so gesehen weder künstlerisch noch für Kinder attraktiv und mit Sicherheit nicht nachhaltig. Musik musikalisch unterrichten – Musik musikalisch bewerten: Prozesse statt Notenwerte – Ausdruck und Miteinander statt Vorsingen und Schreibübungen! Die hier zur Diskussion gebrachten Vorschläge sind nicht neu. Schon vor gut 10 Jahren erschien in England eine Schrift des damals führenden Musikers, Forschers und Musikpädagogen Keith SWANWICK unter dem Titel: "Teaching Music Musically". Er benennt drei grundlegende Prinzipien auf denen Musikunterricht, der seinem Namen Rechnung trägt, basieren muss: Care for music as discourse – 1 Musik (und Bewegung) zu einer Mitteilung und einem Erfahrungswert machen Care for the musical discourse of students – 1 Sich über Musik (und Bewegung) austauschen Fluency first and last – Flüssige Verläufe als oberstes Prinzip, nämlich zum Unterrichtsbeginn und zum 1 Unterrichtsende: die kleinste musikalische (und tänzerische) Einheit ist daher die Phrase oder die Geste, nicht der einzelne Ton, Notenwert oder Takt (oder 1 Armschwung) . (SWANWICK 43ff) Um Musik musikalisch und somit nachhaltig zu vermitteln, sollen junge Menschen auch über musikalische Qualitätskriterien verfügen. Was ist vielfältig, was ist eintönig, was ist originell und was ist schon dutzendfach kopiert …? Solche Kriterien sollten greifbar werden und schließlich in der Oberstufe auch diskutierfähig werden. Es bleibt offen, ob dem Musikunterricht zurzeit ein guter Dienst getan wird, wenn man wieder Noten (gemeint sind jetzt Schulnoten) einführen will wie in andern Fächern. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Selbst wenn wohlmeinende Pädagogen oder Politiker unserem Fach auf diesem Weg zu mehr Gewicht zu verhelfen meinen – vermutlich wird der Musik hier eher ein Bärendienst erwiesen. Doch dürfen wir nicht die Augen schließen: Derzeit sind Lehrkräfte in den Primarschulen daran, sich zu überlegen, wie sie Kinder in Musik bewerten können. Also gilt es hier besonders sorgsam, besonders "musikalisch" zu denken. SWANWICK schlug ein Wertschätzungs- und Bewertungssystem vor, bei dem es vor allem um die Breite des Ausdrucks und um den Differenzierungsgrad von freien musikalischen Äußerungen geht. Wir 1 Ergänzungen in runden Klammern von Ch. F. können es benutzen, um von der freien kindlichen Klangneugierde zu sehr differenzierten Interpretationsformen einen direkten Bogen zu schlagen. Wenn es denn für ein so persönlichkeitsbezogenes und künstlerisches Fach wirklich nicht zu umgehen sein sollte, scheint es angemessen, auch für den neuen schweizerischen Lehrplan ein Bewertungssystem anzudenken, das solchen Dimensionen gerecht wird. Eingebettet in zeitgemäße Bewertungskriterien muss das Wissen sein, dass Kinder bei den entsprechenden Handlungen tatsächlich schon in der Lage sind, ihre Leistungen zu steuern und zu verbessern. Dies ist beispielsweise beim "richtig singen" nicht der Fall; daher kann eine Bewertung in "Vorsingen" für etliche Kinder (die vielleicht später PolitikerInnen oder SchulleiterInnen werden) einem musikalischen Todesurteil gleichkommen. Selbstverständlich muss vor einer Bewertung, wie sie in dem folgenden Vorschlag gezeigt wird, ein Trimester oder ein Semester lang ein Unterricht stattfinden, welcher die Kinder in diesen Dingen förderte und sensibilisierte. Erste Unterrichtsvorschläge und Ergänzungen zu diesem Bewertungssystem können auf der Website: www.imElement.net eingesehen werden. Die Kurzform von wünschenswerten, kommunikationsbezogenen musikalischen Fertigkeiten könnte so aussehen: und bewertbaren Level 1 (Unterstufe Klasse 1): erkennt und exploriert Klangereignisse, spielt z. B. frei mit Tempi, Lautstärken, Klangfarben und Unterschieden in Ton und Klangfarbe Level 2 (Unterstufe Klasse 2): kann verschiedene Klang und Stimmfarben unterscheiden, z. B. Instrumententypen, einstimmige od. mehrstimmige Klänge, auch Klangfarben. Level 3 (Unterstufe Klasse 3): Tauscht sich in Ausdrucksformen aus, oder kann in Worten ausdrücken, was die Musik sagen will … (vgl. SWANWICK, 81) Schlussbetrachtung Musikalische Prozesse sind Kommunikationsprozesse und gerade darum ist das Fach Musik, wenn es musikalisch behandelt wird, eines der beziehungsreichsten und der beziehungsnährendsten Fächer im schulischen Unterricht. Ein gemeinsames Erlebnis im klanglichen oder tänzerischen Fluss, gemeinsam entdeckte Ausdrucksqualitäten und gemeinsames Spiel mit dynamischen Klangfiguren sind früheste Gewaltprävention, aber genauso auch frühe Hinführung zu den musikalischen Ausdrucksformen verschiedener Kulturen. Solche Prozesse verlaufen allerdings nicht stufenweise "aufbauend" im methodisch-didaktischen Sinne. Sie verlaufen ähnlich wie Entwicklungsprozesse, sind individuell oder gruppenindividuell, können unterschiedliche Akzentuierungen, unterschiedliche Bezüge und unterschiedliche Entwicklungstempi haben. Eine Lehrperson wird oft erkennen, dass sie bei der einen Kindergruppe eine ausgesprochen improvisationsfreudige Meute vor sich hat, bei der andern eine Singgruppe, die Herzen erweichen kann und wieder bei einer andern eine Tanzgruppe mit Freude an rhythmischperkussiven Gestaltungen. Darauf gilt es einzugehen, auch im Sinne eines kommunikativen Geschehens. Was spricht denn dagegen, dass eine Lehrerin mit diesen Gruppen unterschiedliche Wege geht? Ein transparenter, in sich gut vernetzter Unterricht garantiert eines sicher: Dass alle kommunikativen Wege zur Musik führen können. Literatur: Dartsch, Michael; Meyer, Claudia; Stiller, Barbara (2010): Musizieren in der Schule. Modelle und Perspektiven der Elementaren Musikpädagogik. Regensburg: ConBrio Dtv-Atlas Musik. Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance. (200521). München, Kassel: DTV / Bärenreiter (S. 70-82) Fröhlich, Charlotte (2010): Intrinsische Motivation und Unterrichtsplanung. In: Dartsch, Michael; Meyer, Claudia, Stiller, Barbara (2010): Musizieren in der Schule. Modelle und Perspektiven der Elementaren Musikpädagogik. Regensburg: ConBrio (S. 41 –62) Stern, Daniel N. (19933): Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta. Swanwick, Keith (20012): Teaching music musically. Transferred to digital printing. London: Routledge. Trevarthen, Colwyn and Malloch Stephen (Hrsg.) (2009): Communicative musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford: Oxford University Press.