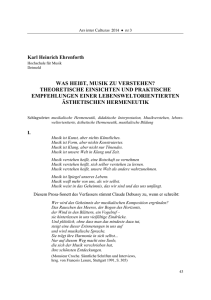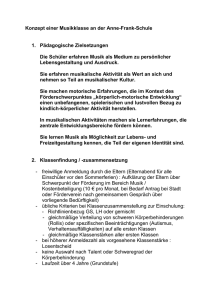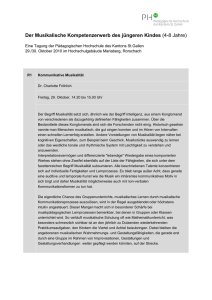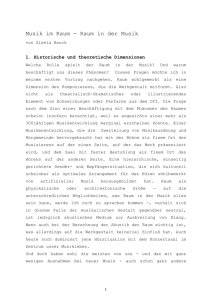Musik und Suggestion: Eine humanethologische Annäherung
Werbung
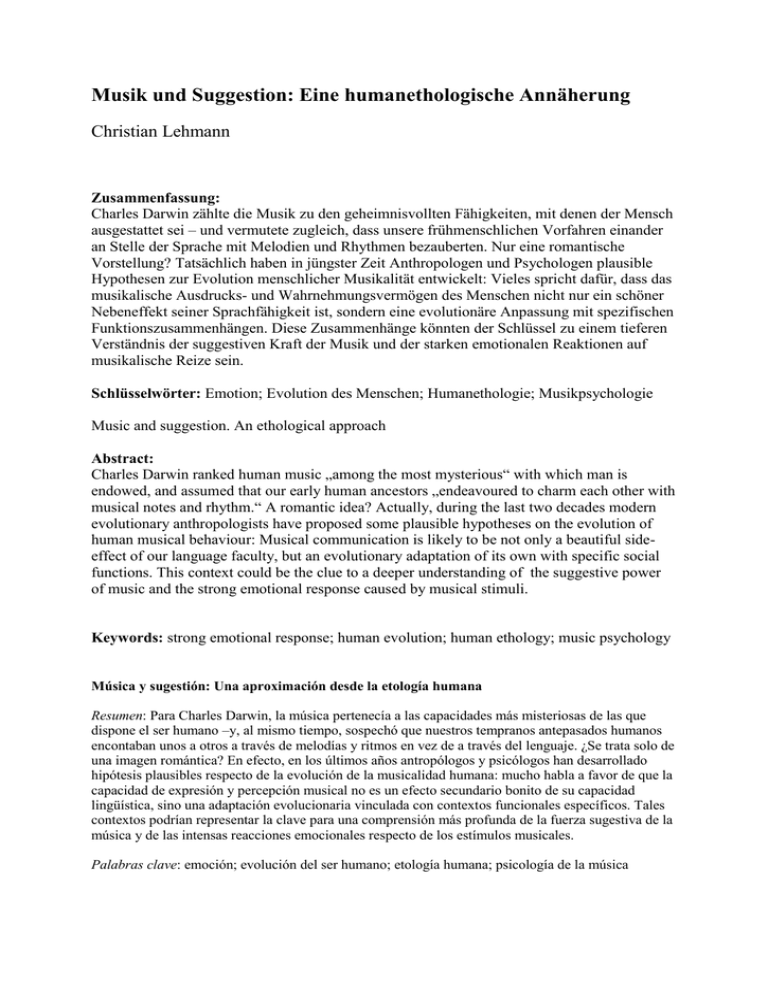
Musik und Suggestion: Eine humanethologische Annäherung Christian Lehmann Zusammenfassung: Charles Darwin zählte die Musik zu den geheimnisvollten Fähigkeiten, mit denen der Mensch ausgestattet sei – und vermutete zugleich, dass unsere frühmenschlichen Vorfahren einander an Stelle der Sprache mit Melodien und Rhythmen bezauberten. Nur eine romantische Vorstellung? Tatsächlich haben in jüngster Zeit Anthropologen und Psychologen plausible Hypothesen zur Evolution menschlicher Musikalität entwickelt: Vieles spricht dafür, dass das musikalische Ausdrucks- und Wahrnehmungsvermögen des Menschen nicht nur ein schöner Nebeneffekt seiner Sprachfähigkeit ist, sondern eine evolutionäre Anpassung mit spezifischen Funktionszusammenhängen. Diese Zusammenhänge könnten der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis der suggestiven Kraft der Musik und der starken emotionalen Reaktionen auf musikalische Reize sein. Schlüsselwörter: Emotion; Evolution des Menschen; Humanethologie; Musikpsychologie Music and suggestion. An ethological approach Abstract: Charles Darwin ranked human music „among the most mysterious“ with which man is endowed, and assumed that our early human ancestors „endeavoured to charm each other with musical notes and rhythm.“ A romantic idea? Actually, during the last two decades modern evolutionary anthropologists have proposed some plausible hypotheses on the evolution of human musical behaviour: Musical communication is likely to be not only a beautiful sideeffect of our language faculty, but an evolutionary adaptation of its own with specific social functions. This context could be the clue to a deeper understanding of the suggestive power of music and the strong emotional response caused by musical stimuli. Keywords: strong emotional response; human evolution; human ethology; music psychology Música y sugestión: Una aproximación desde la etología humana Resumen: Para Charles Darwin, la música pertenecía a las capacidades más misteriosas de las que dispone el ser humano –y, al mismo tiempo, sospechó que nuestros tempranos antepasados humanos encontaban unos a otros a través de melodías y ritmos en vez de a través del lenguaje. ¿Se trata solo de una imagen romántica? En efecto, en los últimos años antropólogos y psicólogos han desarrollado hipótesis plausibles respecto de la evolución de la musicalidad humana: mucho habla a favor de que la capacidad de expresión y percepción musical no es un efecto secundario bonito de su capacidad lingüística, sino una adaptación evolucionaria vinculada con contextos funcionales específicos. Tales contextos podrían representar la clave para una comprensión más profunda de la fuerza sugestiva de la música y de las intensas reacciones emocionales respecto de los estímulos musicales. Palabras clave: emoción; evolución del ser humano; etología humana; psicología de la música Die „Macht der Musik“ ist ein Topos, der in der Vorstellung der Menschen aller Zeiten einen festen Platz hat. Davon zeugt die griechische Mythologie mit dem Motiv des Orpheus und der Geschichte von den Sirenen, die den Odysseus und seine Männer mit ihrem Gesang hypnotisieren. Motivisch nah verwandt ist die deutsche Ballade von der schönen Loreley, die mit ihrem Singen die Rheinschiffer um den nautischen Verstand bringt. Auch die Volkssage vom Rattenfänger von Hameln oder der märchenhafte Stoff der Zauberflöte spiegeln die Vorstellung von der bald bezaubernden, bald verhängnisvollen Macht der Töne wider. In der antiken Welt berichtet Platon von der Wirkung musikalischer Modi auf den Charakter, warnt vor bestimmten Tonarten und lobt andere als besonders geeignet für den Krieger.1 Ähnliche Vorstellungen sind aus orientalischen Kulturen bekannt. Der romantische Dichter Novalis wiederum spricht von dem „Lied“, das „in allen Dingen“ schläft, „und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.“2 Bereits im Vokabular der Sprache spiegelt sich die Assoziation des Zaubers mit dem Gesang: die Worte incantare oder enchanter leiten das Verzaubern vom Singen ab. Die Geschichten von den Sirenen und der Loreley scheint also nicht von ungefähr zu kommen. Im Folgenden möchte ich der Frage nach der Natur dieses „Zaubers“ aus einer naturwissenschaftlichen, genauer gesagt, evolutions- und verhaltensbiologischen Perspektive nachgehen. Was könnte phylogenetisch hinter unserer Vorstellung von der Macht der Töne stecken? – Wie kommt es, dass unser Gehirn so empfänglich ist für diese Art akustischer Reize, die doch, wie es scheint, weit über die zum Leben notwendige Verständigung hinausgehen? Charles Darwin zählte die Musik zu den geheimnisvollsten Fähigkeiten, mit denen der Mensch begabt sei, da sie in allen Kulturen vorhanden, ihr Vorteil für das Überleben und die Fortpflanzung jedoch nicht offenkundig sei. “As neither the enjoyment nor the capacity of producing musical notes are faculties of the least direct use to man in reference to his ordinary habits of life, they must be ranked among the most mysterious with which he is endowed“ schrieb der Naturforscher 1871. Darwin schlägt jedoch selbst eine Erklärung des Phänomens Musik aus der Stammesgeschichte vor: „It appears probable that the progenitors of man, either the males or females or both sexes, endeavoured to charm each other with musical notes and rhythm.“ Darwins Wortwahl „to charm each other“ deutet wiederum auf die Beobachtung und Erfahrung einer suggestiven Wirkung hin. In den letzten Jahren ist die Frage nach der biologischen Dimension der menschlichen Musikalität und des musikalischen Verhaltens in den wissenschaftlichen Diskurs zurückgekehrt. Verschiedene Disziplinen haben dazu beigetragen. Die neuropsychologische Forschung konnte mit modernen bildgebenden Verfahren z.B. zeigen, dass unser Gehirn auf eine unerwartete musikalische Wendung – also etwa auf einen nach unserer musikalischen Erfahrung falschen Ton oder Akkord – ganz ähnlich reagiert wie auf ein unsinniges Wort am Ende eines Satzes. Ein Musikstück kann ebenso wie ein Begriff unsere Wahrnehmung bahnen, ein semantisches „Priming“ bewirken.3 1 Platon, Politeia v. Eichendorff 1838. 3 Koelsch et al. 2004 2 Neurophysiologische Studien zeigen, dass es keine genaue lokale Abgrenzung zwischen „Sprachzentren“ und „Musikzentren“ im Gehirn gibt – der Cortex zeichnet sich durch große Plastizität aus. Andererseits ist seit langem bekannt, dass Sprachfähigkeit und musikalische Kompetenz unabhängig voneinander gestört sein können. Menschen, die etwa nach einem Schlaganfall an einer Broca-Aphasie leiden, können meist noch singen. Die Steuerung des Singens, auch mit Worten, ist also anders lokalisiert als die Sprech-Koordination. Dies kann man sich therapeutisch zunutze machen und die Sprache über das Singen wiedergewinnen, indem andere Areale die Aufgaben des Broca-Zentrums nach und nach übernehmen. Dies ist erst vor kurzem durch die Arbeitsgruppe von Gottfried Schlaug in Harvard neurowissenschaftlich bestätigt worden.4 Umgekehrt können musikalische Fähigkeiten unabhängig von der Sprachfähigkeit gestört sein. Schätzungsweise etwa 3% der westlichen Bevölkerung sind von einer genetisch bedingten sogenannten Amusie betroffen. Diese Menschen können Melodien weder nachsingen noch erkennen, da ihnen das relative Gehör, also der Sinn für Tonhöhenunterschiede fehlt. Ihr Sprachvermögen ist jedoch nicht beeinträchtigt.5 Unsere Musikalität ist also offenbar mehr als nur ein Nebeneffekt der Sprachfähigkeit, und sie erfordert eine spezifische biologische Ausstattung. Daher stellt sich für Evolutionsbiologen die Frage: Warum, aufgrund welcher „Lebensnotwendigkeiten“ könnte sich dieses zweite, doch sehr komplexe akustische Kommunikationssystem in unserer Stammesgeschichte herausgebildet haben? Verschiedene Hypothesen über spezifische adaptive Funktionen menschlicher Musikalität sind vorgelegt worden, die deren Ursprung vor allem in der Mutter-Kind-Interaktion, in der Gruppenbindung und in der Partnerwahl sehen. Sie kontrastieren mit Steven Pinkers berüchtigtem Diktum, Musik sei für die menschliche Natur lediglich „auditory cheesecake“, ein vergnügliches Nebenprodukt der Sprachfähigkeit ohne essentielle Bedeutung.6 Doch sowohl die kulturübergreifende Existenz musikalischer Formen als auch die psychophysischen Wirkungen musikalischer Reize und unsere Empfänglichkeit für Musik bereits in frühester Kindheit sind Indizien für starke phylogenetische Wurzeln der menschlichen Musikalität. Drei Ansätze in diesem Zusammenhang möchte ich im Folgenden vorstellen – und wir werden sehen, dass sie alle im weiteren Sinne mit „Suggestion“ zu tun haben. Sexuelle Selektion: Das akustische Pfauenrad Der US-amerikanische Psychologe Geoffrey Miller griff vor einigen Jahren Darwins Hypothese auf, die die stammesgeschichtliche Entstehung menschlichen Musik in Analogie zum Vogelgesang erklärt: mit dem Prozess der sexuellen Selektion durch Partnerwahl.7 Miller argumentiert: Kunst und Kreativität gehen, vereinfacht gesagt, auf das Balzverhalten zurück. Wer künstlerische und musikalische Fähigkeiten zeigt, wirkt dadurch attraktiv auf das andere Geschlecht. Diese Fähigkeiten erhöhen also die Fortpflanzungschancen: Musikalische Männer haben (bzw. hatten in der Frühgeschichte des Menschen) mehr Nachkommen als unmusikalische, und so setzen sich die entsprechenden erblichen Merkmale in der Spezies durch. Die attraktive Wirkung der Musikalität könnte nach Millers Modell mit unterschiedlichen Mechanismen erklärt werden: 4 Schlaug et al. 2008 Peretz et al. 2002 6 Pinker 1996 7 Miller 2000 5 a) als Fitness-Indikator: Musikalität und Darbietung beweisen nicht nur Intelligenz, Kreativität und Einfühlungsvermögen, sondern erfordern auch eine Reihe von physischen Qualitäten und motorischen Fähigkeiten. Die musikalische Ausdrucksfähigkeit lässt also auf gute Vaterqualitäten schließen und ist ein Anzeichen für gute Gene, die den potentiellen Nachkommen Überlebens- und Fortpflanzungsvorteile verschaffen. b) als ästhetisches Display: Musikalische Reize könnten auf einen fruchtbaren Boden bestimmter sensorischer Präferenzen – etwa für ein metrisches Tempo oder für Klangeigenschaften – fallen, die sich in einem anderen adaptiven Zusammenhang entwickelt haben. Denkbar ist auch, dass die musikalische Ausdrucksfähigkeit des Menschen sozusagen als extreme Merkmalsausprägung, die weit über das für die Verständigung nötige Maß hinausgeht, gleichsam als evolutionärer Selbstläufer entstanden ist. Evolutionsbiologen sprechen hier vom Runaway-Prozess8: Am Anfang steht eine Partnerwahl-Präferenz für ein bestimmtes Merkmal mit Seltenheitswert; durch positive Rückkopplung prägt sich das Merkmal immer stärker aus, auch wenn es unnütz oder sogar eher hinderlich geworden ist. Prominentestes Beispiel im Tierreich sind die überlangen Schwanzfedern mancher Paradiesvogel-Arten. Ebenso setzt also, so Millers Ansatz, der Homo musicus spezifisch evolvierte Verhaltenssignale ein, um die potentielle Partnerin von seinen Qualitäten zu überzeugen – bzw.ihr diese zu suggerieren. Dabei reicht die Bandbreite der möglichen evolutionspsychologischen Begründung, warum man Klavier spielen können müsste, um Glück bei den Frauen zu haben, vom „glaubwürdigen Signal“, das eine verlässliche Information über die Qualitäten des Senders mitteilt, bis zum „schönen Schein“, der die Sinne betört, aber nicht zwangsläufig auf innere Werte schließen lässt. Millers Theorie von der Entstehung menschlicher Musikalität durch sexuelle Selektion weist eine entscheidende Schwäche auf. Ein sexuell selektiertes Merkmal ist immer geschlechtsspezifisch. Entsprechend dem Grundsatz der female choice, der Damenwahl, müssten Männer also deutlich musikalischer sein als Frauen. Das trifft offenkundig nicht zu. Daher kann dieses Erklärungsmodell das Phänomen der menschlichen Musikalität nur teilweise begründen. Musikalisches Verhalten hat höchstwahrscheinlich mehrere unterschiedliche evolutionäre Wurzeln – die jedoch sämtlich einen zentralen Aspekt gemeinsam haben: den der emotionalen Bindung. Infant directed speech Erwachsene, insbesondere Mütter, die mit Babys sprechen, fallen dabei in einen charakteristischen Sprachmodus. Allein am Tonfall könnte ein Zuhörer, der die Sprecherin und ihr Gegenüber nicht sieht, sofort erkennen, ob sie mit einem Erwachsenen oder mit einem Baby spricht: Die Sprachmelodie ist übersteigert, bewegt sich also viel stärker auf und ab als die „normale“ Alltagssprache, und die mittlere Stimmlage ist deutlich erhöht. Dieser typische Singsang wird als „Ammensprache“, Motherese oder infant-directed speech bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Universalie des menschlichen Verhaltens: Die Motherese ist in allen Kulturkreisen der Erde zu beobachten, unabhängig vom Tonfall der Landessprache. Die Verhaltensforschung weiß heute, dass diese Sprechweise nicht etwa eine alberne Angewohnheit der Erwachsenen ist, sondern eine Anpassung an die Wahrnehmung des Kindes – und für das sichere Attachment und die psychische Entwicklung von erheblicher Bedeutung. 8 Fisher 1930 Die amerikanische Anthropologin Dean Falk vermutet in der Motherese eine evolutionäre Verhaltensanpassung aus der Frühgeschichte unserer Gattung. Falks Erklärungsmodell ist als Putting-the-baby-down-Hypothese9 bekannt geworden. Die Neugeborenen unserer Urahnen klammerten sich an das Fell der Mutter. Im Laufe der Hominisation wurde dies jedoch immer schwieriger – weil der „nackte Affe“ (wie der britische Verhaltensbiologe Desmond Morris unsere Art charmant bezeichnet hat) kaum noch Fell trägt, dafür aber ein immer größeres Gehirn bekommen hat. Der zunehmende Schädelumfang machte eine immer frühere Geburt notwendig. Daher sind menschliche Neugeborene im Vergleich zu Affenbabys hilflose Frühchen, die sich nicht selbst festhalten können. Die Menschenmutter muss ihr Baby halten, wenn sie es am Körper trägt. Das kann sie aber nicht pausenlos tun, denn der einfallsreiche Homo erectus verfolgt neue Strategien der Nahrungssuche und beherrscht das Feuer. Die Mutter legt das Baby also zeitweise ab. Was geschieht? Der Körperkontakt wird unterbrochen, das Kind schreit, es kommt zu einer Stress-Situation für Mutter und Baby. Das „Kontinuum“ (wie es Jean Liedloff10 bezeichnet hat) der sicheren Bildung muss auf andere Weise aufrechterhalten werden: durch die Stimme. Sie überbrückt die zeitlichen Lücken des Kontinuums und suggeriert dem Kind auch über eine gewisse räumliche Distanz hinweg Nähe und Sicherheit. Auch heutige Babys reagieren auf die vertraute Stimme der Mutter – und sie sprechen erstaunlicherweise stärker auf Gesang und auf die Prosodie der Motherese an als auf den Tonfall der Alltagssprache. Mutter und Kind teilen einen "prälinguistischen" Code, in dem musikalische Elemente wie Tonhöhe, Sprachmelodie, Rhythmus und Klangfarbe bedeutungstragend sind. Lange vor dem Spracherwerb versteht das Baby den emotionalen Gehalt der prosodischen Elemente, die die Mutter – mehr oder weniger unbewusst – übertreibt und so ihrem Kind Beruhigung, Geborgenheit, Trost oder Bestätigung vermittelt. Nicht nur das: Klinische Studien haben gezeigt, dass frühgeborene Babys, denen regelmäßig vorgesungen wird, schneller an Gewicht zunehmen. Nach Ansicht einiger Wissenschaftler wie z.B. Ellen Dissanayake und Mechthild Papousek liegt in der Mutter-Kind-Interaktion der Ursprung unserer Musikalität und unserer emotionalen Beziehung zur Musik. Eine musikalisch ausgeformte Weiterentwicklung der Ammensprache ist übrigens das Wiegenlied, eine Gattung, die in allen Teilen der Welt bekannt ist und auch in der Kunstmusik immer wieder verarbeitet worden ist, von der Kammermusik bis in die Oper und dieSymphonik. Der Gestus des Wiegenliedes ist ein Archetyp musikalischen Ausdrucks, den wir intuitiv als Signal von Nähe und Geborgenheit verstehen. Musikbeispiel: Arie der Zerlina „Batti batti, bel Masetto“ aus der Oper Don Giovanni von W. A. Mozart http://www.youtube.com/watch?v=9AE6aO1VrTo Erläuterung zum Musikbeispiel: Mozarts Zerlina beschwichtigt ihren eifersüchtigen Bräutigam Masetto mit einer Arie, deren melodische und rhythmische Gestalt an ein Wiegenlied erinnert. Diese musikalische Umsetzung entspricht der ethologischen Theorie der Übertragung des Brutpflegeverhaltens auf die Zuwendung zum Partner. Doch auch hier – wie im Fall der sexuellen Werbung – ist die Botschaft der Musik nur in geringem Maße referentiell, d.h.: Tonfolgen, Klangfarben und Rhythmen teilen nicht – wie die Worte der Sprache – pragmatisch eine konkrete außermusikalische Information mit, sondern sie haben eine affektive Bedeutung. Sie rufen Assoziationen hervor, die mit ihrem ursprünglichen funktionalen Verhaltenskontext zu tun haben, aber auch stark vom persönlichen Erfahrungshintergrund abhängen. 9 Falk 2004 Liedloff 1980 10 Gänsehaut In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Studien eine starker emotionale und physische Reaktion auf Musik untersucht: Das Phänomen der Gänsehaut, des Schauers, der einem bei bestimmten Musikstücken über den Rücken läuft. Der Psychologe Jaak Panksepp nennt als Gänsehaut-Auslöser insbesondere Lieder, die von unerwiderter Liebe und Sehnsucht handeln, aber auch Musik, in der sich patriotischer Stolz und das Gedenken an gefallene Krieger ausdrückt11. Studien zeigen, dass nicht jeder Mensch bei der gleichen Musik eine Gänsehaut bekommt; dennoch gibt es musikalische Reize, die besonders häufig den gewissen Schauer verursachen. Traurige Stücke rufen öfter eine Gänsehaut hervor als fröhliche, und die Reaktion tritt eher bei einem Musikstück ein, zu dem man bereits eine Beziehung hat, als bei einem Stück, das man zum ersten Mal hört. Eine Forschergruppe um Eckart Altenmüller an der Musikhochschule Hannover führte eine Versuchsreihe unter Laborbedingungen durch. Jeder der 38 Versuchspersonen hörte die gleichen Musikstücke. Nur 21 Probanden bekamen überhaupt bei irgendeinem der Stücke eine Gänsehaut. Unter diesen 21 gab es Musiker und Nichtmusiker, ebenso unter den 17 Personen, denen gar kein Schauer über den Rücken lief.12 Die Reaktion hat also wenig mit musikalischer Erfahrung zu tun. Ihre Ausprägung hängt vielmehr von Persönlichkeitseigenschaften ab, wie psychologische Tests ergaben. „Sensation seeking“-Persönlichkeiten sind keine Gänsehaut-Typen. Der Gänsehaut-Typ empfindet bereits subtile Reize intensiv. Doch wie kommt es überhaupt zu dieser Hautreaktion? An den Wurzeln unserer Körperhaare setzen winzige Muskeln an, der Haarbalgmuskeln. Wenn sich diese Muskeln kontrahieren, richten sich die Haare auf und erzeugen kleine Höcker auf der Hautoberfläche. Als Reaktion auf Kälte ist dieser Mechanismus ein leicht erklärbares Überbleibsel aus der Zeit unserer Vorfahren, die noch ein dichtes Fell trugen. Wenn es sich sträubt, isoliert es die Haut besser gegen Wärmeverlust. Hier vermuten Panksepp und Bernatzky auch den evolutionären Hintergrund der durch akustische Reize hervorgerufenen Gänsehaut. Sie meinen, dass z. B. der hohe Ton einer Geige oder einer Flöte phylogenetisch verwurzelte Emotionen auslöst, weil er akustisch den „Trennungsrufen“ junger Tiere ähnelt, die den Sichtkontakt mit der Mutter verloren haben. Einsamkeit und Verlorenheit empfinden wir ähnlich wie Kälte, und unsere Säugetiernatur sträubt dann das Fell, damit uns wärmer wird.13 Gegen diese Hypothese spricht wohl, dass wir diejenigen musikalischen Reize, die eine Gänsehaut verursachen, als angenehm empfinden. Auch die Gehirnaktivität während der Musikschauer wurde mit bildgebenden Verfahren sichtbar gemacht. Dabei zeigt sich ein Muster, das typisch ist für Euphorie und andere angenehme Gefühle. Ich vermute daher einen etwas anders gelagerten phylogenetischen Hintergrund des Schauers, den Menschen bei bestimmten musikalischen Reizen erleben. Die Wärmeregulierung ist nicht der einzige biologische Grund des Haaresträubens. Es gibt eine weitere Funktion, ein Signal nach außen: Wenn Tiere sich verteidigen oder angriffslustig drohen, dann machen sie sich größer. Dieser Effekt kann optisch erreicht werden, indem das Tier sein Fell sträubt und so die Silhouette seines Körpers vergrößert: Ein Bluff, wenn man so will. Die Redewendung „Mir stellen sich die Nackenhaare auf“ verrät: Auch bei uns Menschen sträubt sich noch der Rest des Fells, wenn wir angriffslustig oder verteidigungsbereit sind. Irenäus Eibl-Eibesfeldt weist in diesem 11 Panksepp & Bernatzky 2002 Grewe et al. 2007 13 Panksepp & Bernatzky 2002 12 Zusammenhang auf den „Schauer der Ergriffenheit“ hin, den Menschen erleben, wenn ihre kollektive Verteidigungsbereitschaft bei feierlichen Gruppenereignissen angesprochen wird, zum Beispiel beim Singen eines bestimmten Liedes, mit dem sich das Kollektiv identifiziert.14 Freilich würden wir die meisten typischen „Gänsehaut-Stellen“ in Musikstücken, die wir kennen, nicht auf Anhieb mit Kampflust oder kollektiver Verteidigungsbereitschaft in Verbindung bringen. Doch wenn wir die musikalischen Momente unter die Lupe nehmen, die bei Probanden diesen Schauer hervorrufen, dann fällt etwas Interessantes auf: Es sind oft starke dynamische und besetzungsmäßige Veränderungen: ein anschwellendes Crescendo, ein plötzlicher Choreinsatz oder der Kontrast zwischen einem einzelnen Soloinstrument und dem Tuttiklang des Orchesters. Das heißt: Die Musik stellt eine Spannung zwischen dem Individuum und der Gruppe dar. Der Einzelgänger wird mit der Gruppe konfrontiert oder schützend von ihr aufgenommen – oder von ihr verlassen: Die Komposition führt uns also das Bild – man könnte auch sagen, die Illusion – einer existentiellen Situation vor Ohren, auf die wir unbewusst reagieren. Eine berühmten „Gänsehaut-Stelle“, bei der dieser Zusammenhang auf der Hand liegt, ist ein kurzer Einwurf des Chores in der Matthäus-Passion von J.S.Bach. Pontius Pilatus stellt das Volk (das der Chor darstellt) vor die Wahl, entweder Barrabas oder Jesus freizulassen. Da schreit der Chor in einem dissonanten, markerschütternden Akkord nur: „Barrabam!“, konfrontiert also den Hörer mit geballter Aggression. Es ist nicht abwegig zu vermuten, dass der tiefgläubige Protestant Bach die Hörer der Passion hier emotional in Verteidigungsbereitschaft bringen wollte – und das ist ihm gelungen. Musikbeispiel: http://www.youtube.com/watch?v=Q0sr-qmH-To Doch auch eine viel abstraktere, nonverbale Botschaft kann Erschütterung hervorrufen. Musikbeispiel: W.A. Mozart, Klavierkonzert Nr. 23 A-dur KV 488, 2. Satz http://www.youtube.com/watch?v=vne1E6VH23s Erläuterung zum Musikbeispiel: Nach seiner melancholischen Einleitung wird das Soloinstrument Klavier (das Individuum) vom akustisch sehr weit aufgefächerten Orchesterklang (einer großen Gemeinschaft) aufgenommen. Der Orchestereinsatz gilt als typische „Gänsehaut-Stelle“. Zum Ende noch einige grundsätzliche Überlegungen, die uns dann zu einer abschließenden Szene führen werden, die ebenfalls unter dem Motto „Musik und Suggestion“ betrachtet werden kann. Knopf im Ohr Vielleicht ist es aufgefallen, dass ich in den vorangegangenen Betrachtungen etwas forsch zwei Ebenen vermischt habe: Einmal die musikalische Mitteilung von Mensch zu Mensch in einem spezifischen Verhaltenszusammenhang, z.B. die Mutter, die zu ihrem Kind singt. Die musikalische Form ist hier ein besonderer, ein ritualisierter Modus des Sagens, der eine bestimmte kommunikative Funktion erfüllt. Die zweite Ebene ist die der Musik als „Kunst“, die keinen Zweck außerhalb ihrer selbst verfolgt: ein Produkt, das hergestellt wird, damit man es anhört. L’art pour l’art. Die Musikwissenschaftler sprechen auch von „autonomer“ im Gegensatz zu „funktionaler“ Musik. 14 Eibl-Eibesfeldt 1986 Trotz dieses grundsätzlichen Unterschieds müssen wir uns im Klaren sein: Jedes musikalische Produkt eines menschlichen Geistes besteht aus Material, aus Ausdrucksbausteinen, die auf funktionale Verhaltenszusammenhänge zurückgehen, die den Menschen in seiner Stammesgeschichte zum Homo musicus geformt haben. Das heißt: Eine Klaviersonate, eine Symphonie, eine Filmmusik bilden nicht nur durch Tonmalerei außermusikalische Sujets ab; sie „zitieren“ auch immer wieder Grundformen des musikalischen Ausdrucks – Zuwendung, Selbstpräsentation, Gruppensynchronisation – und diese Elemente sprechen unsere angeborenen Wahrnehmungsmuster an. Das heißt aber: Wir reagieren auf eine Situation, in der wir uns nicht wirklich befinden, sondern die mittelbar dargestellt und abgebildet wird. Wir stehen nicht inmitten einer Volksmenge, die gerade skandiert, dass der Barrabas freigelassen werden soll; als Hörer einer Matthäus-Passion-CD empfinden wir aber in diesem Moment so und bekommen vielleicht sogar eine Gänsehaut. Das ist die typische Situation des Menschen, der Kunst rezipiert: der ein Bild betrachtet oder einen Roman liest. Musik bildet jedoch Situationen meist nicht eindeutig ab; sie simuliert auf einer symbolischen, unbewussten Ebene. Sehr konkret wird diese emotionale Illusion jedoch dann, wenn ein Hörer die starken Reize einer lauten, rhythmischen, perkussiven Musik empfängt. Sein Körper und seine Psyche reagieren so darauf, als wäre er am Geschehen beteiligt, als wäre er selbst ein Teil der Gruppe, die diese Musik macht: In einer „archaischen“ Umwelt (in der unser Wahrnehmungssystem geformt wurde!) kann ein Mensch eine solche Reizintensität nur dann erleben, wenn dicht um ihn herum getrommelt und laut gesungen wird und er selbst möglicherweise auch trommelt oder laut singt. – Unser moderner Hörer sitzt aber ruhig in einer S-Bahn, er interagiert nicht mit einer Gruppe, er ist im Gegenteil durch Ohrstöpsel abgeschottet von seiner realen Umgebung. Durch die Musik, die aus allernächster Nähe an sein Ohr dringt, taucht er emotional in ein scheinbares Gemeinschaftserleben ein – in Wirklichkeit schafft er gerade durch sein Verhalten Einsamkeit. Möglicherweise ist das Massenphänomen „Knopf im Ohr“ vor diesem Hintergrund besser zu verstehen. Je unmittelbarer die Beschallung und je stärker der Puls der Perkussion, desto tiefer taucht der einsame Hörer in ein virtuelles Gruppen-Synchronisations-Erleben ein. Von der Loreley zum iPod: Wenn unsere Musikalität eine spezifische evolutionäre Verhaltensanpassung ist – und dafür spricht einiges – dann ist es auch wahrscheinlich, dass die ursprünglichen Funktionszusammenhänge des musikalischen Verhaltens und der musikalischen „Sprache“ in unserem musikalischen Erleben mehr oder weniger bewusst auch heute präsent sind und unterschwellig verstanden werden. Aus der Perspektive einer evolutionären Musikpsychologie ist es daher kein Mysterium, dass Töne, Rhythmen und Klangfarben eine suggestive Wirkung auf unsere Stimmung und unser Verhalten ausüben und dass der Topos des „Zaubers der Musik“ tief in unserer Vorstellungswelt verankert ist. Ein weiterführender Gedanke im Hinblick auf die therapeutische Praxis: Es wäre zu überlegen, inwieweit die anthropologischen Funktions- und Verhaltenszusammenhänge musikalischer Ausdrucks- und Mitteilungsformen auch für die musiktherapeutische Praxis noch differenzierter nutzbar gemacht werden können. Musik ist nicht gleich Musik. Verschiedene Grundkategorien des musikalischen Ausdrucks repräsentieren sehr unterschiedliche, teils auch geschlechtsspezifische Verhaltenssituationen: Geborgenheit, Beruhigung, Bewegungsanreiz, kollektive Kampfbereitschaft, Selbstdarstellung, Kommunikation mit dem Transzendenten. Alle diese Situationen und Affekte können musikalisch angesprochen oder auch „suggeriert“ werden. Literatur Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Die Biologie des menschlichen Verhaltens. München 1986. v. Eichendorff, Joseph: Wünschelrute, erstmals erschienen in Deutscher Musenalmanach 1838. Falk, Dean: The „putting the baby down“ hypothesis: Bipedalism, babbling, and baby slings. Behavioral and Brain Sciences 27 (2004), S. 526-534. Fisher, Ronald A.: The genetical theory of natural selection. Oxford 1930. Grewe, Oliver et al.: Listening to music as a re-creative process: physiological, psychological and psychoacoustical correlates of chills and strong emotions. Music Perception 23 (2007), S. 297-314. Koelsch, Stefan et al.: Music, language and meaning: brain signatures of semantic processing. Nature Neuroscience, Vol. 7 (2004), No. 3. Liedloff, Jean: Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. München 1980. Miller, Geoffrey: Evolution of Human Music through Sexual Selection. In: Wallin, Merker und Brown (Hrsg.): The Origins of Music. Cambridge MA 2000, S. 329-360. Panksepp, Jaak & Bernatzky, Günther: Emotional sounds and the brain. Behavioural Processes 60 (2002), S. 133-155. Peretz, Isabelle et al.: Congenital amusia. A group study of adults afflicted with a musicspecific disorder. Brain 125 (2002), S. 238-251. Pinker, Steven: Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet. München 1996. Platon: Politeia. Werke IV. Hrsg. von Gunther Eigler. Darmstadt 1971. Schlaug, Gottfried et al.: From Singing to Speaking. Why Singing May Lead to Recovery of Expressive Language Function in Patients with Broca's Aphasia. Music Perception 25 (2008), S. 315–323.