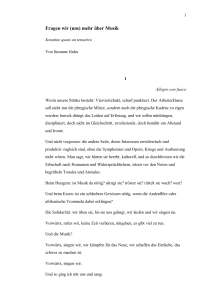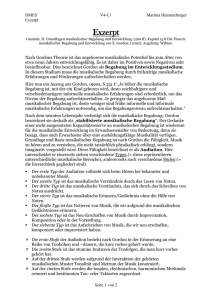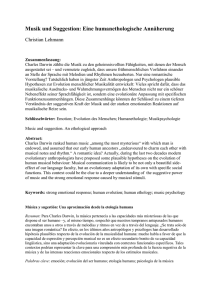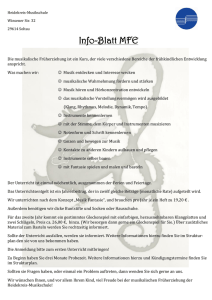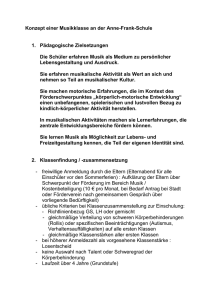Auf dem Weg zu einer neuen Theorie der musikalischen
Werbung
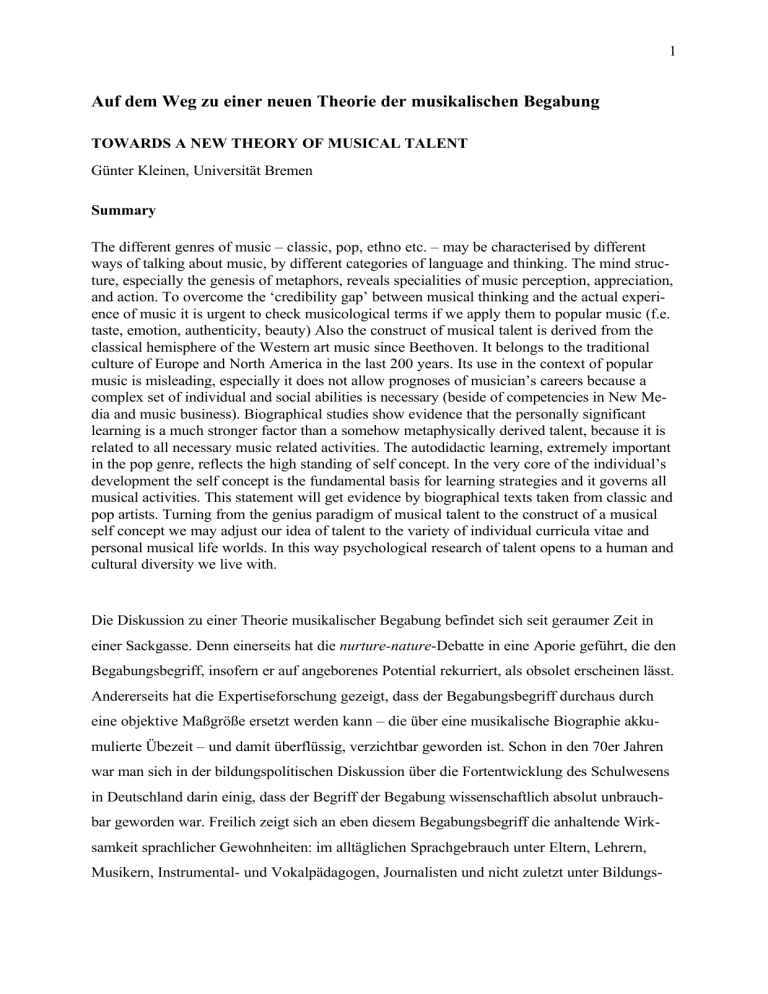
1 Auf dem Weg zu einer neuen Theorie der musikalischen Begabung TOWARDS A NEW THEORY OF MUSICAL TALENT Günter Kleinen, Universität Bremen Summary The different genres of music – classic, pop, ethno etc. – may be characterised by different ways of talking about music, by different categories of language and thinking. The mind structure, especially the genesis of metaphors, reveals specialities of music perception, appreciation, and action. To overcome the ‘credibility gap’ between musical thinking and the actual experience of music it is urgent to check musicological terms if we apply them to popular music (f.e. taste, emotion, authenticity, beauty) Also the construct of musical talent is derived from the classical hemisphere of the Western art music since Beethoven. It belongs to the traditional culture of Europe and North America in the last 200 years. Its use in the context of popular music is misleading, especially it does not allow prognoses of musician’s careers because a complex set of individual and social abilities is necessary (beside of competencies in New Media and music business). Biographical studies show evidence that the personally significant learning is a much stronger factor than a somehow metaphysically derived talent, because it is related to all necessary music related activities. The autodidactic learning, extremely important in the pop genre, reflects the high standing of self concept. In the very core of the individual’s development the self concept is the fundamental basis for learning strategies and it governs all musical activities. This statement will get evidence by biographical texts taken from classic and pop artists. Turning from the genius paradigm of musical talent to the construct of a musical self concept we may adjust our idea of talent to the variety of individual curricula vitae and personal musical life worlds. In this way psychological research of talent opens to a human and cultural diversity we live with. Die Diskussion zu einer Theorie musikalischer Begabung befindet sich seit geraumer Zeit in einer Sackgasse. Denn einerseits hat die nurture-nature-Debatte in eine Aporie geführt, die den Begabungsbegriff, insofern er auf angeborenes Potential rekurriert, als obsolet erscheinen lässt. Andererseits hat die Expertiseforschung gezeigt, dass der Begabungsbegriff durchaus durch eine objektive Maßgröße ersetzt werden kann – die über eine musikalische Biographie akkumulierte Übezeit – und damit überflüssig, verzichtbar geworden ist. Schon in den 70er Jahren war man sich in der bildungspolitischen Diskussion über die Fortentwicklung des Schulwesens in Deutschland darin einig, dass der Begriff der Begabung wissenschaftlich absolut unbrauchbar geworden war. Freilich zeigt sich an eben diesem Begabungsbegriff die anhaltende Wirksamkeit sprachlicher Gewohnheiten: im alltäglichen Sprachgebrauch unter Eltern, Lehrern, Musikern, Instrumental- und Vokalpädagogen, Journalisten und nicht zuletzt unter Bildungs- 2 politikern scheint der Begriff unverzichtbar. Sowohl in der engeren musikwissenschaftlichen Diskussion als auch in der allgemeinen Öffentlichkeit erweist sich seine Überlebensfähigkeit. Offenbar benötigen wir also weiterhin ein Konzept der Musikbegabung, um uns über musikalisches Verhalten, Entwicklung und Persönlichkeit, aber auch über pädagogische Maßnahmen und ihre positiven wie negativen Wirkungen verständigen zu können. Gleich zu Beginn dieser Erörterungen soll hier die Stoßrichtung benannt werden: um aus der soeben skizzierten Sackgasse herauszukommen, scheint eine radikale Wende notwendig zu sein. Die Ausrichtung an einer einheitlichen, allgemein akzeptierten Musikkultur, die – wie noch zu zeigen ist - den älteren Konzepten implizit ist, hat sich eindeutig überlebt, weil wir mit einer großen Vielfalt nebeneinander existierender Teilkulturen zurechtkommen müssen. Ja mehr noch: von Teilkulturen zu sprechen, war in der Kulturdebatte der 70er und 80er Jahre angebracht, mittlerweile ist dieses soziologische Konzept aber durch die kulturanthropologischen Begriffe des Lebensstils und der persönlichen Lebenswelt ersetzt worden. Bei dem Vorhaben, die Theorie der musikalischen Begabung auf eine Gegenwart fortzuschreiben, in der die künstlerischen Ausdrucksformen, das musikalisch-ästhetische Vokabular, Stile, Gebrauchsformen, Funktionen und Wirkungen der Musik usw. in völlig veränderter Form in Erscheinung treten, ist es unumgänglich geworden, das Konzept musikalischer Begabung fortan in den individuellen Selbstkonzepten zu verankern. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Sprache, mit der wir uns über Musik verständigen. Der Popularmusikforscher Simon Frith (1998) betont, dass das Reden über Musik unmittelbar zum Ausführungsritus der Musik gehört und somit maßgeblich zu ihrem Verständnis beiträgt. Auch auf einer experimentellen Basis konnte die Leistung der Sprache für die musikalische Wahrnehmung nachgewiesen werden. Danach korrespondiert die linguistische Struktur musikbezogener Metaphern mit den Wahrnehmungsprozessen (Kleinen 1998, 1999). Hierbei wird auf die Metaphern im Sinne der neueren Linguistik Bezug genommen (Lakoff 1987). Metaphern sind danach die zentralen Werkzeuge der Sprache, in denen sowohl die alle kognitiven Erfahrung begründenden körperlichen Erfahrungen (the body in the mind, vgl. Johnson 1987) als auch die Gefühle, allgemeine Vorstellungsschemata und schließlich das abstrakte Denken ihren Platz haben. Aber von welcher Musik reden wir denn? Dies ist eine wichtige Frage, denn über einen relativ langen Zeitraum, sagen wir: in den letzten 200 Jahren etwa, entwickelte sich in strikter inhaltlicher Kongruenz zum klassisch-romantischen Repertoire der europäischen Kunstmusik (kurz: 3 zum Kanon) ein Repertoire an sprachlichen Begriffen, Denkfiguren, Konzepten (jenseits der nur einem engeren Kreis von Insidern geläufigen Fachtermini), mit denen wir uns über die Musik verständigen und auch unsere musikwissenschaftlichen Diskurse führen. Wechseln wir jedoch das selbstverständliche, im historischen Verlauf kaum mehr hinterfragte Repertoire, das im 19. Jahrhundert die kulturelle Identität der europäischen Bürgertums ausmachte, und akzeptieren, dass in der Gegenwart andere Repertoires gesellschaftlich auf gleichem Level oder höher bewertet werden, so fragt sich, ob der eingebürgerte, an der musikalischen Klassik geschulte Corpus von sprachlichen Ausdrücken und daran gekoppelten Denkfiguren weiterhin brauchbar ist oder nicht notwendigerweise ersetzt werden muss. Katherine Bergeron und Philip. V. Bohlman (1992) haben die unhinterfragte Kanonbildung der klassischen europäischen Kunstmusik in den vergangenen 150 Jahren als einen Akt der kulturellen Disziplinierung kritisiert und den Versuch unternommen, die Figuren auf den Marmorsockeln – in ihrer Mitte Beethoven, flankiert von Bach, Mozart, Haydn, Schubert und Brahms – mit Blick auf die künstlerische Pluralität der Gegenwart, aber auch auf die weltweite Vielfalt der Kulturen zu relativieren. Mittlerweile hat die große Majorität der heute lebenden Menschen andere, neue, eigene Musikstile und Repertoires in ihre kulturelle Lebensmitte gestellt. Auch in der Popmusik findet eine Kanonisierung statt, die nunmehr freilich von der Musikindustrie betrieben wird - mit Blick auf Publikumsgruppen und um eine virtuelle Kommunikation in diesen Gruppen zu stimulieren (Frith 1997). Offenbar trägt die musikwissenschaftliche Diskussion dem längst nicht Rechung. Entwirft man ein neues musikwissenschaftliches Instrumentarium für das neue Jahrtausend, so ist es vielleicht erlaubt, die sich abzeichnenden Tendenzen überdeutlich zu machen, um die Tragweite der Veränderungen abschätzen zu können. Offenkundig ist, dass die Wirklichkeit der Musik heute durch Globalisierung wie verstärkten Regionalbezug, durch Pluralität wie immer radikalere Individualisierung gekennzeichnet ist, durch Mediatisierung wie durch die Forderung nach Unmittelbarkeit usw., also durch widersprüchliche, gegenläufige Tendenzen geprägt ist. Der musikalische Kanon der Klassik hat längst seine, zumindest in der westlichen Welt selbstverständliche Geltung eingebüßt und ist geschmolzen zu einem interessanten, nicht allzu großen Marktsegment. Die Stilrichtungen der populären Musik beherrschen den Konsum auf allen auditiven und audiovisuellen Medien und damit die überwiegende Anzahl der modernen Lebenswelten. Die Globalisierung hat weltweit dazu geführt, dass immer mehr Menschen ethnische Musik in ihrer Vielfalt zur Kenntnis erhalten, dass ethnische Musik weltweit verbreitet und je nach kulturellen Zusammenhängen positiv rezipiert und in veränderte Lebenszusammenhänge beispielsweise in anderen als den Ursprungsländern einbezogen wird. 4 Aus dem einen, im Grunde genommen einmaligen Kanon der Musik, der in der westlichen Welt des gehobenen Bildungsbürgertums unbestrittene Geltung besessen hat, ist eine komplexe Situation geworden, in der mehrere, prinzipiell beliebig viele Kanons, bezogen auf soziale und kulturelle Gruppierungen, existieren und eine eigene, prinzipiell gleichrangige Wirksamkeit entfalten. Das angewachsene Selbstbewusstsein der ehemaligen Entwicklungsländer, der Länder der zweiten und dritten Welt hat zu ersten Veränderungen der Musikwissenschaft geführt: in zahlreichen dieser Länder gibt es eine landeseigene, auf die eigenen Ethnien und Traditionen bezogene Musikwissenschaft, die die historisch überholte Untergliederung der Musikwissenschaft in Historie (der europäischen Kunstmusik selbstverständlich), Ethnologie (für die vermeintlich ‚primitiven’ Kulturen und für die außereuropäischen ‚Hochkulturen’) und die Systematik (vorgeblich mit den allgemeinen Grundlagen, also mit nicht historischen und nicht ethnologischen Sachverhalten befasst) aufgegeben hat. Ein Beispiel hierfür habe ich in der VR China kennengelernt. Dort befasst man sich mit der eigenen Musik nurmehr unter der Bezeichnung ‚chinesische Musikwissenschaft’, die übrigens als primären Gliederungsaspekt die ethnische Herkunft vor der Historie benutzt. Dass die Musikwissenschaft ihr Vokabular, ihre wissenschaftliche Konzepte und Denkfiguren einer kritischen Revision unterziehen muss, ergibt sich schon allein aus dem vielfach geäußerten Vorwurf des Eurozentrismus. Aber auch innerhalb der westlichen Länder sind Revision und Neukonzeption überfällig. Darauf hat unlängst Nicholas Cook (1998) mit seinem Diktum des ‘credibility gap’ hingewiesen. Die an den kulturellen Erfahrungen der Beethoven-Zeit und am heute immer noch wirksamen Beethoven-Kult geschulte Denk- und Ausdrucksweise über Musik verstrickt sich angesichts der modernen Lebenswelten in immer tiefere Widersprüche. Ihre Inadäquanz ist offenkundig. Sie bezieht sich auf das Musikverstehen wie auf den musikwissenschaftlichen Diskurs. Verlagern wir unsere Aufmerksamkeit von der Klassik auf die Stilrichtungen der populären Musik, von der Avantgarde auf ethnische Musik usw., so spüren wir, wenn wir denn diese Sensibilität zulassen, immer wieder eine ausgesprochene Diskrepanz zwischen unserem sprachlichen und begrifflichen Instrumentarium und der betreffenden Musik selbst. Was Authentizität, Schönheit, Wahrheit, aber auch gefühlsmäßiger Ausdruck, Struktur, Kreativität usw. bedeuten, variiert mit der jeweiligen Musik. Ich möchte das an zwei Begriffen nachweisen und zugleich Vorschläge für die Überwindung des ‘credibility gaps’ machen. Es handelt sich um den musikalischen Geschmack, eine zentralen Kategorie der Kultursoziologie, und um die musikalische Begabung, die in die Zuständigkeit der Musikpsychologie fällt. 5 Geschmack ist eine historische Kategorie, die sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat und in der Vokabel vom guten Geschmack als zentralem Konzept der Musikerziehung in den vergangenen hundert Jahren wirksam war. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sind die Auflösungserscheinungen unübersehbar geworden. Die Geschmackskategorie ist obsolet geworden, weil ihr jegliche soziale und kulturelle Verbindlichkeit abhanden gekommen sind. Die Ursachen hierfür liegen in den erdbebenartigen Veränderungen, die mit dem vielfältigen Wandel der Lebensbedingungen, der sozialen Verhaltensweisen, des öffentlichen Schulwesens, mit der Wirksamkeit der modernen Medien usw. zumindest teilweise erklärt werden können. Sie liegen aber zugleich in neuen Orientierungen der Ästhetik und der musikalischen Moderne. Längst gilt nicht mehr die Avantgarde, für die noch Theodor W. Adorno das Postulat der gesellschaftlichen Wahrheit aufstellte, als alleiniger Vertreter der Moderne, und die Avantgarde selbst ist eben vielgestaltig, widersprüchlich, richtungslos geworden (der sprichwörtliche kopflose Tausendfüßler!); vielmehr ist es notwendig geworden, die aktuellen Richtungen der populären Musik im Sinne der Moderne zu akzeptieren. Es gibt gute Gründe, der populären Musik in einer großen Zahl von Erscheinungsformen die kulturelle Signifikanz der Gegenwart zuzusprechen. Innerhalb des Genres der populären Musik könnte man sogar diverse Kanons konstatieren, deren maßgebliche Produktionen oder Werke sich jenseits ihres ökonomischen Werts charakterisieren lassen als das, was in der Gegenwart (sagen wir der letzten beiden Jahrzehnte) „verbindlich sich zuträgt“ (mit diesem Wort sprach Adorno über die musikalische Moderne der Schönberg-Schule). Denn sie können für die unmittelbare Erfahrung kollektiver Identitäten stehen. Die Konsequenzen für Begriff und Konzept des musikalischen Geschmacks liegen auf der Hand. Diese historische Kategorie, deren Beginn um die Wende zum 18. Jahrhundert liegt (vgl. Kneif 1971, 121-150), ist mit dem auslaufenden 2. Jahrtausend an ihr Ende gekommen. In der Kultursoziologie wird der ‚gute Geschmack’ denn auch einer Fundamentalkritik unterzogen und aufgegeben. Pierre Bourdieu (1982) geißelt den ‘Ekel vor dem Leichten’, der die etablierte Ästhetik wie schon die traditionelle Musikwissenschaft kennzeichnet. Statt dessen entwickelt er ein neues begriffliches Instrumentarium, das dieser Situation Rechnung trägt. Da ist nicht mehr von Sub- oder Teilkulturen die Rede, sondern bezeichnenderweise von Lebensstilen. Der soziale Raum ist gleichbedeutend mit dem Raum der Lebensstile. Der jeweilige Lebensstil relativiert den Geschmack als Wahrnehmungs- und Bewertungsschema, das die entsprechende soziale Gruppe kennzeichnet, und als eine unter vielen gesellschaftlichen Praktiken im Sinne von Unterscheidungszeichen (ebd., S. 278 ff.). 6 Die Lebenspraxis folgt alltagsästhetischen Schemata, die eine „kollektive Kodierung des Erlebens“ bedeuten (Schulze 1992, 128), wie sie in den verschiedenen sozialen Milieus vorgenommen werden. Mit einem alltagsästhetischen Schema ist ein ästhetisches Programm gemeint, „das die unendliche Menge der Möglichkeiten, die Welt zum Gegenstand des Erlebens zu machen, auf eine übersichtliche Zahl von Routinen reduziert“ (ebd.). Danach wird auch die Musik vom Individuum wie von gesellschaftlichen Gruppen primär als expressiver Gegenstand des Erlebens definiert. Auf der persönlichen Ebene funktionieren drei Schemata: Hochkultur-, Trivial- und Spannungsschema. Gerhard Schulze kristallisiert auf der gesellschaftlichen Ebene fünf charakteristische Milieus heraus: Niveau, Harmonie, Integration, Selbstverwirklichung, Unterhaltung. Man kann sich leicht ausmalen, welche in welcher ästhetischen Funktion die Musik jeweils herangezogen wird. Das andere Beispiel ist die musikalische Begabung. Auch dieser Begriff gehört in den Diskussionszusammenhang des ‘credibility gaps’. Denn jeder Begabungsbegriff ist nur erklärbar vor dem je speziellen ästhetischen und kulturellen Hintergrund. Der Gang in die Historie führt diesbezüglich zu aufschlussreichen Erkenntnissen (siehe den Beitrag von Heiner Gembris in diesem Band). Zweifellos steht die historischen Entstehungssituation des Begabungskonzepts zum Ende des 19. Jahrhunderts in totalem Kontrast zur psychologischen Wirklichkeit der Musik heute. Die Studie „Wer ist musikalisch?“ von Theodor Billroth aus dem Jahr 1895 eröffnet den wissenschaftlichen Diskurs zu diesem Thema. Freilich wurde die Studie posthum von Eduard Hanslick herausgegeben. Das verweist auf die enge Zugehörigkeit des Autors zum Freundeskreis um Johannes Brahms, Joseph Joachim und eben Eduard Hanslick, der ja 1854 (und nachfolgend in zahlreichen Auflagen) die in jeder Beziehung maßgebliche ästhetische Streitschrift vom musikalisch Schönen veröffentlicht hat. Die Ästhetik des bürgerlichen Konzerts wird hier auf mustergültige Art ausformuliert. Nicholas Cook (1998) hat die Ästhetik und kulturelle Praxis als Beethoven-Kult kritisch auf den Punkt gebracht. Die große Tradition des autonomen Kunstwerks von Bach und den Barockmeistern ausgehend über das klassische Dreigestirn Mozart, Haydn und Beethoven, über Schubert, Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Brahms, Bruckner und Mahler bis hin zu den Klassikern der Moderne Schönberg, Strawinsky, Bartók, Schostakovitsch usw. und auslaufend in der aktuellen Szene der musikalischen Avantgarde, die dieses Erbe trotz aller Negation aufgreift und weiterführt. 7 Billroths Begabungskonzept ist nur vor dem höchst präsenten Hintergrund des Konzertlebens und speziell der Ästhetik des autonomen Musikwerks seiner Zeit zu verstehen. Zwar löst er die Musikalität von der Auffassung konkreter Musikwerke, jedoch schimmert aus allen Definitionen das Erfordernis durch, dass ein musikalischer Mensch in der Lage sein müsse, die musikalische Kunst richtig aufzufassen, zu behalten und am musikalisch strukturellen Geschehen Vergnügen zu empfinden. „Eine kurze, scharf rhythmische und sehr deutlich gegliederte Melodie, die ohne gleichzeitig empfundene Harmonie nicht denkbar ist, zu behalten, sie immer wieder zu erkennen und auch summend oder pfeifend richtig zu reproduzieren, gelingt Vielen. – Dies ist der erste Grad des Verständnisses von Musik, der musikalischen Bildung. Wer das nicht vermag, der ist unmusikalisch“ (Billroth 1895, 232). Hinzu komme ein Verständnis des inneren Zusammenhangs der Teile zum Ganzen, die Erkenntnis der Form (S. 240). Interessant nun ist, dass Billroth in seiner Skizze als Voraussetzung für die musikalische Begabung eine Reihe von grundlegenden Fähigkeiten benennt, wie sie in zur Grundlage fast sämtlicher empirischer Tests seit Carl E. Seashore (1919) gemacht worden sind. Erinnert sei an die Tests von Herbert Wing, Arnold Bentley, Edwin Gordon u.a. Diese Tests basieren auf elementaren sensorischen Unterscheidungen sowie Behaltens- und Strukturierungsleistungen, zuweilen ergänzt um Aufgaben zur ästhetischen Bewertung. Diese Aufgaben und Urteile machen alle einen Sinn nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie die Voraussetzungen für eigene musikalische Tätigkeiten bis hin zum Niveau der professionellen Musikausübung erfassen sollen. Geza Révész (1946) bringt das auf die Formel, „dass das Musikalisch-Ästhetische, das Musikalisch-Schöne, worauf es bei der Musikalität gerade ankommt, sich auf die autonome Tiefenwirkung der Musik bezieht, auf den Genuss, der durch den spezifisch-geistigen Inhalt und die musikalisch Form der Kunstwerke verursacht wird“ (ebd., 163). Die Nähe zu Hanslicks Autonomieästhetik ist hier offenkundig. Noch einmal Révész: „Unter Musikalität im allgemein sind das Bedürfnis und die Fähigkeiten zu verstehen die autonomen Wirkungen der Musik zu erleben und die musikalischen Äußerungen auf ihren ästhetischen Wert (Gehalt hin zu beurteilen“ (ebd., 163). So treffend wie Révész hat kaum ein Forscher formuliert, wie Begabung unter dem Paradigma der klassisch europäischen Kunstmusiktradition zu beschreiben ist: „Der musikalische Mensch besitzt ein tiefes Verständnis für die musikalischen Formen und für den Aufbau des musikalischen Satzes; es hat einen fein aufgebildeten Sinn für den Stil und für die strenge Ordnung des musikalischen Ideenganges. Er ist befähigt, den Intentionen des Komponisten zu folgen, sogar gelegentlich voranzueilen. Zum musikalischen Menschen gehört es auch, dass er sich in Stimmungen der Musik hineinversetzt und zu ihr eine Beziehung gewinnt, de auf die ganzer seelische Beschaf- 8 fenheit einwirkt. Er erlebt das Kunstwerk so innig und so tief, dass er sich einem Schaffenden ähnlich fühlt. Dieser ‚schöpferische’ Akt ist dem musikalischen Menschen sowohl beim bloßen ästhetischen Aufnehmen wie beim Interpretieren musikalischer Werke eigen. Der Besitz dieser Qualitäten äußert sich in den Vermögen, Werke der Tonkunst hinsichtlich ihrer Musikalischen Bedeutung zu beurteilen und zu würdigen. Die Musikalität diese angeborene, aber entwicklungsbedürftige und auch entwicklungsfähige Eigenschaft, strahlt auf den ganzen Menschen aus und bildet demnach einen charakteristischen Zug der ganzen Persönlichkeit“ (164 f.). Im Kontext von Jazz, Rock und Popmusik wird eine Revision dieses Ansatzes dringlich, weil deren Ästhetik aber auch die künstlerische Praxis schon allein aus zeitlichen Gründen in eine völlig andersartige Kultur gehören. Entsprechend wandelt sich auch das methodologische Instrumentarium, denn insbesondere der biographische Kontext ist zu berücksichtigen. In einer Studie unter jugendlichen Mitgliedern von Popbands (vgl. Hemming & Kleinen 2000) wurde von den Befragten geäußert, dass Begabung nicht so wichtig zu nehmen sei, beteiligen könne sich eigentlich jeder, und über das autodidaktische Lernen, von Freunden, auch von Instrumentallehrern, mit Hilfe von Noten oder auch über die technischen Medien könne man sich die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten entweder selbst beibringen oder beibringen lassen. Ob dies nun zutrifft oder nicht, auf jeden Fall wird offenkundig, dass der Stellenwert musikalischer Begabung in diesem stilistischen Spektrum längst nicht so hoch bewertet wird wie in der Klassiksphäre. In einer anderen Studie (Grimmer 1991) erweist sich der Begabungsbegriff generell als verzichtbar. In Gesprächen mit Studierenden der Musikpädagogik zeigt sich nämlich, dass dieser Begriff keinen nennenswerten Erklärungswert für den Verlauf der musikalischen Entwicklung besitzt. Nur was aus der subjektiven Sicht als bedeutsam erlebt wird, schlägt sich nachweislich in den musikalische Biographien nieder. Daher zieht die Autorin den Terminus des signifikanten Lernens heran, der in der Arbeit des Analytikers und Therapeuten Carl C. Rogers (1994) entstanden ist. Dieses signifikante Lernen hat auch für das autodidaktische Lernen einen hohen Stellenwert. Bei diesem Lernmodus verliert das zielorientierte Üben unter Anleitung einer erfahrenen Pädagogin (eine Grundvoraussetzung der musikalischen Expertise) an Bedeutung zugunsten des selbstgesteuerten Lernens. Das autodidaktische Lernen, das im Popgenre allenthalben sehr hoch bewertet wird, stellt eine entscheidende Kraft für die Motivation dar und ist an vielen Stellen im Gruppenprozess zu beobachten. Das autodidaktische Lernen leistet einen entschei- 9 denden Beitrag zur Entwicklung der individuellen Selbstkonzepte, indem es die Musik, bestimmte Stile, aber auch musikbezogene Aktivitäten in der Persönlichkeit verankert. Offenkundig ist dieser Ankereffekt von großer Bedeutung für das gesamte Musiklernen sowohl in den konkreten Situationen als auch perspektivisch im Hinblick auf die Musikerkarrieren. Man blickt nicht auf Autoritäten, sondern entscheidet selbst. Und wenn es denn Autoritäten geben muss, so wählt man sie selbst aus und erklärt sie zu solchen. Das autodidaktische Lernen gehört zu den Aktivitäten des menschlichen Organismus, auf den wir durch den Konstruktivismus wieder aufmerksam gemacht worden sind. Er ist eine Erscheinungsform einer je individuellen, aktiven Aneignung der Welt nach selbst gefundenen Strategien. Insofern steht des autodidaktische Lernen in Opposition zur Vorstellung von göttlicher Eingebung, genetischer Vorbestimmung oder schlichtweg ererbtem Talent, das ungeachtet aller Aufklärung durch Wissenschaft dem Konzept musikalischer Begabung anhaftet. Das selbstgesteuerte und als persönlich bedeutsam erlebte Lernen lenkt den Blick immer deutlicher auf das musikalische Selbstkonzept und dessen Auswirkungen für den musikalischen Entwicklungsverlauf, gleich ob es sich um bloß musikinteressierte Laien oder professionelle Musiker(innen) handelt. Das Selbstkonzept ist der Inbegriff aller auf das Ich einer Person bezogenen Kognitionen. Eng verbunden damit ist das Selbstwertgefühl. Im Selbstkonzept ist zwischen Selbst- und Fremdattributionen zu unterscheiden: sowohl die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten als auch, was andere einem zutrauen, gehört zum Selbstkonzept. Und umgekehrt konstruiert jedes Individuum die Auffassung seiner Person nicht nur aus sich selbst, sondern zugleich aus der Resonanz, die es in seiner Umwelt findet. Zwischen den Erwartungen beispielsweise der Eltern und dem Eigensinn eines Kindes kann es, und wenn auch nur zeitweilig, zu gravierenden Spannungen kommen. Aber das gehört eben zur Entwicklung von der Kindheit zum Erwachsenenalter. In einer inhaltsanalytischen Auswertung der Biographien ausgewählter Jazz und Popmusiker (Kleinen 2000, Manuskript) ergaben sich die folgenden Aussagekategorien: Selbstattributionen Fremdattributionen was ich mir selber zutraue, was ich wichtig welche Erwartungen andere (Eltern, Pädago- finde, meine eigenen Ziele gen) an mich stellen wozu ich mich entschließe, was ich ablehne meine Wirkung bei Zuhörern, wie ich als Mu- 10 siker beim Publikum ankomme welche Stärken, welche Schwächen ich habe wie andere mich einschätzen, Erfolge in der Ausbildung und bei Wettbewerben wie lange ich musikalisch schon tätig bin Resonanz bei Freunden und anderen Musikern was mich zum Musiker (zur Musikerin) macht welche Bedeutung Vorbilder haben wie ich Musik erfahre und was mir persönlich Bedeutung der Musik für die Menschen in die Musik bedeutet meiner Umgebung Diese Kategorien korrespondieren mit den Persönlichkeits- und Umweltfaktoren, die Joseph S. Renzulli (1986) in die Darstellung seiner Begabungskonzeption einbezieht. Renzullis Faktoren erweitern das Spektrum der Selbst- und Fremdattributionen zum Teil erheblich. Sie lauten: Persönlichkeitsfaktoren: Umweltfaktoren: Selbstwahrnehmung sozioökonomischer Status Mut Persönlichkeit der Eltern Charakter Erziehung durch die Eltern Intuition Anregungen von Interessen in der Kindheit Charme und Charisma Position in der Familie Leistungsbereitschaft Schulbildung Ich-Stärke Erreichbarkeit von Rollenmodellen Energie Gesundheit Sinn für Schicksalhaftigkeit Zufallsfaktoren wie Erbschaft, Tod, Lage der Wohnung, Scheidung etc. persönliche Attraktivität Zeitgeist 11 Was das musikalische Selbstkonzept bedeuten kann und inwiefern in seinem Kontext das musikalische Talent neue Konturen gewinnt, soll beispielhaft an Äußerungen einiger weniger Musiker erklärt werden (aus den Genres Klassik und Pop). Der Pianist David Helfgott fasst die Bedeutung, die die Musik für ihn persönlich hat, in einigen Sätzen zusammen: „Ich kam auf die Welt, um zu spielen. – Wenn du dich am Abend ans Klavier setzt, dann ist das das einzige Ding, das zählt. – Ich habe stets für meinen Vater gespielt. Zweifellos wollte ich ihn beeindrucken. Ich wollte meinem Vater gefallen. Das war mein ganzes Wesen, meine Quintessenz.“ Und sein Klavierlehrer ergänzt: „Was David am meisten wünscht, ist in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Er möchte vor den Leuten sitzen. Er möchte kommunizieren.“ (aus: Helfgott 1997) Wenn jemand zum Musizieren auf die Welt kommt, so ist das längst nicht alles. Da müssen schon Leute sein, die zuhören, sich faszinieren lassen, musikalische Leistung, Charme und Charisma bewundern... Der Geiger Gidon Kremer problematisiert den Einfluss von Selbst- und Fremdbestimmung für seine Karriere. „Man behauptet in der Familie, ich hätte schon im Alter von vier Jahren zu Stöckchen gegriffen und versucht, das Geigenspiel zu imitieren. Vielleicht wollte ich damit nur die Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf mich lenken... Vielleicht wollte ich mir mit der Stöckchengeige ein Mehr an Zuneigung erspielen. Sie, die Erwachsenen, hatten ja immer zu tun und nie Zeit. Aber dass sie mein Geigenspiel mit großem Wohlwollen betrachtet haben, da bin ich sicher. Es kann auch das vorprogrammierte Geiger-Ich sein, das nach seinem Werkzeug zu suchen begann, mit dem es sich beliebt machen konnte, um mich den Erwachsenen und ihrer Welt näher zu bringen... Ob es elterliche Bestimmung war oder meine Begabung, die die Geige zu meinem Instrument werden ließ, kann ich nicht beantworten.“ (Kremer 1993, 21) Das musikalische Selbstkonzept des Sängers und Rockmusikers Bob Dylan (ursprünglich: Bob Zimmermann) entsteht aus einer Mischung von persönlichen Nöten und den Chancen, die die Musik ihm zu ihrer Bewältigung bietet: „Mit Hilfe der Musik kann ich meiner Einsamkeit und Verzweiflung, der zermürbenden Atmosphäre und dem Elend entfliehen.“ – „Ich hocke bis tief in die Nacht vor dem Radio und lausche der Musik.“ – „Mit meiner Musik schaffe ich eine eigene Identität.“ – „In meiner Musik kann ich persönliche Eigenart und Nonkonformität finden, wie sie in meinem Ort strengstens verboten sind.“ – „Das einzige, was mich brennend interessiert, ist die Musik.“ – „Ich bin besessen von der Musik.“ – „Ich verspüre die Notwendigkeit, ein Rockstar zu werden, wenn ich mich nicht selbst aufgeben und innerlich zugrunde gehen soll.“ – „Voll innerer Unrast habe ich die Sehnsucht, dem Alltag zu entfliehen.“ – „Ich 12 möchte den Traum von einem abwechslungsreichen Leben verwirklichen.“ – „Ich strebe nach Anerkennung.“ – „Manche Leute meinen, ich belüge mich selbst, ich träume.“ (nach Gross 1978) Einen wesentlich stärkeren Bezug zur Außenwelt nimmt der Rockmusiker Joe Cocker: „Als Jugendlicher habe ich mein ganzes Taschengeld für Platten ausgegeben.“ – „Mit Freunden habe ich eine Band gegründet.“ – „Ich habe einen Anspruch auf Berühmtheit.“ – „Ich will auch da oben auf der Bühne dabei sein. Ich weiß, dass ich großartig bin.“ – „Ich habe einen Hang zur Selbstdarstellung und möchte unter Freunden beliebt sein.“ (nach Bean 1991) Derlei autobiographische Äußerungen geben nur einen kleinen, vielleicht sogar willkürlichen Ausschnitt aus der Komplexität und Differenzierung eines jeden Selbstkonzepts wieder. Sie rühren von den Musikern selbst her, die sich in diesem Fall als „naive Handlungstheoretiker“ betätigen, indem sie sich Gedanken über ihre musikalische Existenz machen. Nimmt man das musikalische Selbstkonzept jeweils als die ausschlaggebende Motivation für die individuelle musikalische Entwicklung, so zeigt ein Vergleich der vier ausgewählten Statements, dass jede Verallgemeinerung ins Leere greift und fehl am Platz ist. Jeder der genannten Musiker hat unstrittig seine musikalische Begabung; aber es ist offenkundig, dass diese Personen an keinem gemeinsamen Maßstab zu messen sind. Was aber ist ein Selbstkonzept? Sigrun-Heide Filipp (1979) stellt die Selbstkonzept-Forschung in den Kontext der Verstehenden Psychologie und einer „Psychologie des reflektierenden Subjekts“ mit zwei Prämissen: „Menschen sind in der Lage sich selbst zum Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zu machen und zwischen ihren Erfahrungen und ihrer Person einen sinndeutenden (Rück)Bezug herzustellen. Menschen verfügen über kognitive Repräsentationen ihrer eigenen Person (‚interne Selbstmodelle‘) und gewährleisten dadurch im raum-zeitlichen Beziehungsgefüge das Erlebnis personaler Existenz und Kontinuität“ (ebd., S. 129). Jeder Mensch weiß um seine personale Existenz und Kontinuität. In den naiven Handlungstheorien, die jeder sich zurechtlegt, gibt es ein Wissen über die eigene Person, das die Fähigkeiten und Begrenzungen einschließt. Als internes Selbstmodell wird „die geordnete Menge aller im Gedächtnis gespeicherten selbstbezogenen Informationen“ (ebd., 142) umschrieben. Wenn man Menschen als naive Handlungstheoretiker begreift, dann hat das interne Selbstmodell die Funktion, ihre Handlungsweisen anzuleiten. Selbst wenn die selbstbezogenen Kognitionen in den Gedanken, die eine Person über sich selbst anstellt, nicht 13 manifest sind, sind Selbstschemata für das Verhalten relevant und bedeutsam. „Kognitive Strukturen und Schemata [führen] jeweils immer auch im Sinne von ‚Hintergrundschemata‘ zu generalisierten Orientierungsreaktionen und –handlungen, ohne dass sich die Person dessen bewusst zu sein braucht“ (ebd., 146). Umso stärker können die Auswirkungen im affektiven und motivationalen Bereich sein. „Nicht umsonst wird in der Selbstkonzept-Forschung sehr häufig eine ... „Gleichsetzung von ‚Selbstkonzept‘ und ‚Selbstwertgefühl‘ oder ein globale Dichotomisierung von ‚positiven‘ vs. ‚negativen‘ Selbstkonzepten vorgenommen. Ihre Bedeutung für menschliches Erleben und Handeln erhalten selbstbezogene Kognitionen unter diesem Aspekt als wesentliche Quelle von Emotionen und als Determinante affektiver Reaktionen“ (ebd., 147). Darüber hinaus besitzen selbstbezogene Kognitionen „für das Individuum instrumentellen Wert, indem sie zur Planung, Vorhersage, Erklärung und Kontrolle von Ereignissen und Handlungen in der jeweiligen Situation erlebnismäßig beitragen“ (ebd., 148). Bezieht man musikalische Begabung und Talent nicht länger auf eine bestimmte Ausprägung musikalischer Kultur, sondern auf die individuellen Konzepte, so wird die nurture-natureDebatte entschärft. Die musikalischen Fähigkeiten, Fertigkeiten, praktischen und theoretischen Kompetenzen verlieren den falschen Mythos des von Gott inspirierten Genies, sie werden in die sensomotorische, emotionale und kognitive Ausstattung einer Persönlichkeit integriert und unterliegen denselben Entwicklungsperspektiven wie jede andere Handlungsweise auch. Der Bezug auf das Selbstkonzept bedeutet für die Begabungsdiskussion einen klaren Paradigmenwechsel. Er ermöglicht es, die musikalische Begabung grundlegend neu zu orientieren: weg von der Kopplung an die Musik der traditionellen Konzertsäle, sprich: die europäischwestliche Kunstmusiktradition (siehe „Beethovenkult“) hin zu individuellen, in persönlichen Lebenswelten angesiedelten Konzepten. Das wäre ein vielgestaltiges Konstrukt musikalischer Begabung, offen für die kulturelle Vielfalt, cultural diversity oder auch „Weltmusik“, mit der wir heute leben und mit der sich auch zu leben lohnt. Literatur Bean, J. P. (1991). Joe Cocker. Wien: Hannibal. Bergeron, Katherine & Bohlman, Philip V. (Eds.) (1992). Disciplining Music. Musicology and its Canons. Chicago and London: University of Chicago Press. Billroth, Theodor (1895). Wer ist musikalisch? Nachgelassene Schrift, hrsg. von Eduard Hanslick. - Berlin: Paetel. Bourdieu, Pierre (1982). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 14 Cook, Nicholas (1998). Music. A very short introduction. Oxford: University Press. Filip, Sigrun-Heide (Hrsg.) (1979). Selbstkonzept-Forschung. Stuttgart: Klett. Frith, Simon (1997). Zur Ästhetik der Populären Musik. In deutscher Übersetzung veröffentlicht unter http://www2.hu-berlin.de/fpm/texte/frith.htm Frith, Simon (1998). Performing Rites: Evaluating Popular Music - Oxford [etc.] : Oxford Univ. Press. Grimmer, Frauke (1991). Wege und Umwege zur Musik. Klavierausbildung und Lebensgeschichte. Kassel: Bärenreiter. Gross, Michael (1980). Bob Dylan. Der Messias der Rockgeneration. München: Heyne. Helfgott, Gillian (1997). David Helfgott. Die Biographie. München: Heyne, 2. Aufl. Hemming, Jan & Kleinen, Günter (2000). Aus dem Forschungs-Projekt BACKDOOR: Tagebuchstudie unter Schülerbands, in: Musikpsychologie, Band 15, Göttingen: Hogrefe (im Druck) Johnson, Mark (1987). The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, And Reason. Chicago and London: Chicago University Press. Kleinen, Günter (1999). Die Leistung der Sprache für ein Verständnis musikalischer Wahrnehmungsprozesse. Musikpsychologie, Band 14, Göttingen: Hogrefe, 52-68. Kleinen, Günter (2000). Das autodidaktische Lernen von Jazz- und Popmusikern im Licht biographischer Äußerungen. Unveröffentlichtes Manuskript Bremen. Kneif, Tibor (1971): Musiksoziologie. Köln: Gerig. Darin: Traktat über den musikalischen Geschmack (S. 121-150). Kremer, Gidon (1993). Kindheitssplitter. München: Piper. Lakoff, George (1987). Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University Press. Renzulli, Joseph S. (1986). The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity. In: Conceptions of giftedness, ed. by Robert J. Sternberg & Janet E. Davidson, Cambridge: Cambridge University Press, 53-92. Rogers, Carl R. (1994). Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten. Stuttgart (Klett). Schulze, Gerhard (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main: Campus.