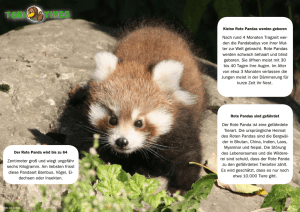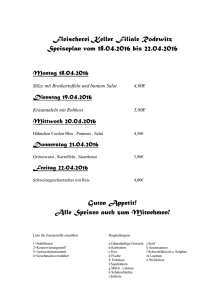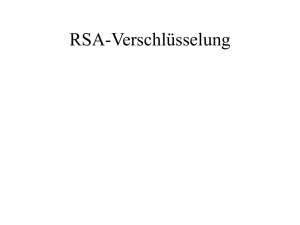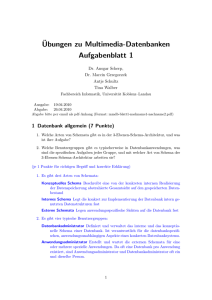Aus Lupinen lässt sich ein Kuchen backen Die Melodie als Text Ein
Werbung

Stuttgarter Zeitung Nr. 83 WISSENSCHAFT TECHNIK UMWELT Donnerstag, 9. April 2009 19 Die Melodie als Text Wie der Kopf Musik verarbeitet Hat die Musik etwas mit der Sprache zu tun? Einige Hirnforscher meinen, Anhaltspunkte dafür gefunden zu haben. Sie glauben, dass Melodien vom Gehirn ähnlich verarbeitet werden wie Texte – als seien sie die Sprache der Gefühle. Von Ima Trempler Fu Long, der Pandajunge im Wiener Zoo, ist seit seiner Geburt im August 2007 (Bild rechts) unter Aufsicht von Biologen. Sie wollen seinen Tagesrhythmus entschlüsseln. Fotos dpa, AP Ein kranker Panda kann seinen Tag nicht organisieren Bei Stress und Leiden gerät die „innere Uhr“ der Bären aus dem Takt – Biologen erforschen, wie sich das vermeiden lässt Weltweit leben nur noch wenige Pandas, in Europa sind es sechs. Einer davon, der knapp zweijährige Fu Long, ist im Wiener Zoo zu Hause. Um die Lebensbedingungen der Pandas langfristig zu verbessern, erforscht die Zoologin Martina Pertl die „innere Uhr“ des jungen Tieres. Von Antje Schmid, Wien Fu Long, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „glücklicher Drache“, sitzt im Tiergarten Schönbrunn mit seiner Mutter im Pandabärengehege und kaut genüsslich an einem ordentlichen Stück seiner Lieblingsnahrung, dem Bambus. Ob das über die Grenzen der Alpenrepublik bekannte Pandababy hier sein Leben verbringen darf, ist noch nicht klar. Denn Fu Long gehört China, weil seine beiden Eltern eine Leihgabe der Volksrepublik sind: die Mutter Yang Yang und der Vater Long Hui, der im Gehege nebenan sitzt und ebenfalls am Bambus kaut. Im August, wenn Fu Long zwei wird und damit das Erwachsenenalter der Pandabären erreicht, entscheidet sich, ob er zurück nach China geht oder noch weiter in Schönbrunn verweilt. Fu Long ist nicht nur deswegen populär, weil er seit 20 Jahren das erste Pandababy ist, das in einem europäischen Zoo das Licht der Welt erblickt hat. Auch die noch junge Wissenschaft der Chronobiologie (chronos bedeutet auf Griechisch Zeit), in der die Rhyth- FUNDSTÜCKE Der Duft der Feinde Wenn mehrere Millionen Individuen zusammenleben, geht das nicht ohne Kontrolle. Bei Menschen funktioniert das mit Ausweisen, bei Ameisen mit Düften. Fehlt Tieren der entsprechende „Stallgeruch“, werden sie als Feinde angesehen. Ein Forscherteam, zu dem auch der Konstanzer Wissenschaftler Giovanni Galizia gehört, haben jetzt den Duft von Rossameisen in seine Bestandteile zerlegt. Interessantes Ergebnis: die Feinderkennung hängt von einer ganz bestimmten Duftkomponente ab. War diese vorhanden, reagierten die Ameisen aggressiv, griffen also den vermeintlichen Feind an. Fehlte sie, passierte nichts – die beschnüffelte Ameise war also offenbar ein Freund. Umgekehrt reagierte die „Fremdameise“, welcher die betreffende Duftkomponente fehlte, auf die kontrollierende Ameise aggressiv – weil diese ja den zusätzlichen Feindduftbestandteil am Körper trug. („Proceedings of the Royal Society“) Einer der kleinsten Frösche der Welt: NoFoto dpa blella pygmaea aus Peru Ein Winzling aus dem Regenwald Bisher hatte man ihn nur quaken hören, jetzt haben ihn deutsche und amerikanische Forscher als leibhaftigen Frosch gefunden: Noblella pygmaea. Mit gerade einmal 11,4 Millimeter Körperlänge gehört dieser im Südosten Perus entdeckte Minifrosch zu den kleinsten Wirbeltieren der Welt. Seine Heimat sind die Nebelwälder, Buschlandschaften und Weideländer zwischen 3000 und 3200 Meter Höhe. Wasser brauchen die Fröschchen nicht: Die Weibchen legen ihre beiden Eier ins feuchte Laub oder unter Moose und schützen sie dann vor Insekten. Der Nachwuchs schlüpft nicht wie bei Fröschen üblich als Kaulquappe aus dem Ei, sondern gleich als landlebendes Fröschchen. („Copeia“) Zz men im Leben von Menschen und Tieren erforscht werden, widmet sich ihm seit seiner Geburt. „Unser Ziel ist es herauszufinden, wie lange es dauert, bis ein Pandabär eine innere Uhr ausbildet“, erklärt die Zoologin Martina Pertl, die darüber gerade ihre Dissertation an der Universität Wien schreibt. Das Leben ist ein Zusammenspiel von unzähligen Rhythmen, die sowohl das Verhalten als auch die Physiologie aller Lebewesen bestimmen, erläutert die Zoologin. Viele Verhaltensweisen würden nicht von außen gesteuert, etwa durch den Tag-Nacht-Rhythmus, sondern von innen heraus, aus einer inneren Uhr. Sie ermögliche es Lebewesen, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Suche nach dem Tagesrhythmus Zwei Jahre lang zeichnet Martina Pertl mit einer fest installierten Videokamera jede Bewegung des jungen Pandas auf, 24 Stunden am Tag. Besonderes Augenmerk gilt dabei seinem Fress- und Schlafverhalten ebenso wie der Kontakt zu seiner Mutter. Pertl wertet diese Daten dann mittels eines Chronoethogramms aus, das Aufschluss darüber geben soll, zu welchem Zeitpunkt Fu Long beginnt, einen festen Lebensrhythmus auszubilden. In einem Chronoethogramm (zusammengesetzt aus den Worten chronos und ethos, was so viel bedeutet wie Charakter und Verhalten) werden verschiedene Verhaltensweisen – wie etwa schlafen, trinken, essen – mit unterschiedlichen Farben dargestellt. „Anhand des daraus erstellten Diagramms lässt sich später erkennen, ob diese Verhaltensmuster in einem bestimmten Rhythmus auftreten“, erläutert Pertl die aufwendige Forschungsarbeit. Ziel sei es, herauszufinden, ob Pandabären von Geburt an einem festen Rhythmus folgen oder nicht. Außerdem untersucht die 25-jährige Wissenschaftlerin, die in enger Kooperation mit dem Berliner Institut für Zoo- und Wildtierforschung arbeitet, welche Einflüsse – beispielsweise das Verhalten der Mutter oder das eines Tierpflegers – den jungen Panda beeinflussen. Im August 2007, kurz nach der Geburt, haben die Aufzeichnungen begonnen. Die Datenflut ist bei der Auswertungsmethode nur langsam zu bewältigen: Martina Pertl hat bisher gerade mal den ersten Lebensmonat von Fu Long analysiert. Das bisherige Ergebnis des Chronoethogramms: „Es ist noch kein Rhythmus erkennbar“, sagt Pertl. „Vielmehr handelt es sich um eine chaotische Phase, die nach der Geburt von Tieren und auch Menschen ganz normal ist.“ Mit Unterstützung der Erkenntnisse aus der Chronobiologie will man im Wiener Zoo auf lange Sicht die Pflege- und Haltungsbedingungen von Tieren verbessern. „Die Disziplin ist eine zuverlässige Methode, um Rückschlüsse auf das Wohlbefinden der Tiere zu ziehen“, sagt Pertl. „Einem Panda sieht man es nicht unbedingt an, ob er Stress hat oder krank ist. Wenn wir mehr über ihre inneren Rhythmen wissen, können wir leichter sehen, ob diese durcheinandergekommen sind.“ Geraten aber zum Beispiel Schlaf- und Wachrhythmus oder das Fressverhalten durcheinander, kann man davon ausgehen, dass die Tiere gestresst sind, und entsprechend schnell Gegenmaßnahmen ergreifen. Darf Fu Long im Zoo bleiben? In Europa leben zurzeit sechs Pandabären in Zoos. Einer in Berlin, zwei in Madrid und drei in Wien. Im August dieses Jahres werden die chinesischen Behörden darüber entscheiden, ob der Zooliebling Fu Long zurück nach China geht. Der zwischen Österreich und China geschlossene Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren beinhaltet nicht nur den Aufenthalt der Pandas in Wien, sondern auch die Aus- und Weiterbildung chinesischer Zoologen in Österreich. In China liegt das größte Pandaschutzgebiet der Welt, das Wolong-Naturreservat. Laut dem Tiergarten Schönbrunn leben hier noch 150 Große Pandas in freier Natur. Insgesamt 21 chinesische Pandabären sind zu Forschungs- und Zuchtzwecken in ausländischen Zoos. Angespannt wirkt Fu Long an diesem Vorfrühlingstag wahrlich nicht. Stresssymptome seien nicht erkennbar, versichert Martina Pertl. Der „glückliche Drache“ verschlingt lieber noch ein Stück Bambus und zeigt sich ansonsten ungerührt – sollen die Touristenmassen an Ostern nur kommen. Aus Lupinen lässt sich ein Kuchen backen Die prächtige Pflanze enthält so viel Eiweiß wie Soja – die Erträge sind aber noch nicht hoch genug Die blau-violette Lupine führt dem Ackerboden Nährstoffe zu und bietet dem Menschen hochwertiges Eiweiß. Doch bis jetzt lässt sich die Pflanze in Deutschland kaum in großem Stil anbauen. Biologen wollen eine bessere Variante züchten. Von Roland Knauer Knallblau mit einem deutlichen Stich ins Violette strahlt so mancher Straßenrand in Chile und Argentinien. Die dort so üppig wachsenden Lupinen könnten in Zukunft helfen, den Eiweißbedarf der Europäer zu decken. Denn diese Pflanze liefert für die Ernährung des Menschen ähnlich hochwertige Proteine wie Soja oder Geflügel. Das Eiweiß der Lupine könnte demnach in Eiscreme, Backwaren oder Nudeln das Sojaeiweiß ersetzen, das dort bis jetzt den Geschmack verstärkt. Tatsächlich gibt es bereits ein Lupineneis, dessen Geschmacksverstärker allerdings aus einer europäischen Lupine stammt. Da die Bauern mit den Erträgen dieser Zuchtform nicht zufrieden sind, versuchen Peter Wehling und Karin Sonntag vom Institut für Züchtungsforschung des Julius-Kühn-Instituts (JKI) in Groß Lüsewitz in der Nähe von Rostock die europäische Sorte jetzt mit Hilfe der Südamerikaner zu verbessern. Von ihren Fortschritten berichten sie in der Fachzeitschrift „Plant Cell, Tissue and Organ Culture“. Die europäische Lupine zu verbessern erfordert in der Praxis modernste Techniken der Züchtungsforschung, weil sie sich nicht auf natürlichem Weg mit den südamerikanischen kreuzen lässt. Die europäische Sorte wurde in den 1930er Jahren aus der Art Lupinus angustifolius gezüchtet, die am Mittelmeer zu Hause ist. Wie alle anderen Wildformen wehrt sich auch Lupinus angustifolius mit Alkaloiden gegen das Gefressenwerden. Die Lupinen an den Straßenrändern sind also sehr giftig. Gelegentlich wächst jedoch eine Pflanze mit einer zufälligen Mutation in ihrem Erbgut heran, die fast keine Alkaloide produziert und daher auch nicht mehr bitter schmeckt. Diese „Süßlupinen“ wurden in den 1930er Jahren weitergezüchtet – und bald darauf gab es die ersten Felder mit den blauvioletten Blüten. Diese Pflanzen haben einige Vorteile. So gehören Lupinen zu den Leguminosen, die mit Hilfe von Bakterien den Stickstoff aus der Luft in einen Nährstoff umwandeln, der nicht nur von der Lupine verwendet werden kann, sondern auch von anderen Pflanzen: Wird auf einem leuchtenden Feld von Lupinen anschließend Getreide angebaut, kann der Bauer sich den Stickstoffkunstdünger sparen, der bei steigenden Energiepreisen ebenfalls teurer wird. Das ausgedehnte Wurzelwerk der Lupine geht bis in 150 Zentimeter Tiefe und holt so Wasser und Nährstoffe herauf, an die andere Pflanzen nicht herankommen. Deshalb kommen Lupinen mit Trockenperioden besser zurecht und holen auch noch Phosphate in die oberen Bodenschichten, die dort von nachfolgend angebauten Pflanzen genutzt werden können. Zudem enthalten Lupinen fast zur Hälfte Eiweiße, von denen angenommen wird, dass sie den Cholesterinspiegel im Blut verbessern können. Bei so vielen positiven Eigenschaften gibt es meist eine Kehrseite der Medaille. So wächst die Süßlupine nur auf Böden mit einem Säurewert unter 6,8 – gute Ackerböden haben in Deutschland aber meist höhere Säurewerte. Daher bleiben die Erträge niedrig, und die Bauern verdienen wenig mit der Lupine. Ein paar Biobauern pflanzen sie als Zwischenfrucht an und verfüttern die hochwertigen Eiweiße anschließend an ihr Vieh. 2008 wurde die Süßlupine daher nur auf 20 000 Hektar Fläche in Deutschland angebaut. Das sind gerade einmal 0,1 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Sorten mit besseren Erträgen lassen sich aus den bisher verwendeten Süßlupinen kaum gewinnen, weil diese aus wenigen Ursprungspflanzen gezüchtet worden sind und daher fast dasselbe Erbgut besitzen. Neue Sor- ten aber lassen sich am besten züchten, wenn das Erbgut möglichst variabel ist und sich so die besten Eigenschaften auslesen lassen. Zudem besteht die Schwierigkeit, dass die Süßlupine so weit von den südamerikanischen Arten entfernt ist, dass eine Kreuzung auf natürlichem Weg nicht mehr möglich ist. In solchen Fällen kann eine Protoplastenfusion helfen, bei der die Forscher das Erbgut der beiden Arten im Labor mischen. Sie kommen dabei ohne die Methoden der Gentechnik aus: Die JKI-Forscher Peter Wehling und Karin Sonntag bauen mit speziellen Enzymen die Zellwand von Lupinus-angustifolius-Süßlupinen und von der südamerikanischen Lupinus subcarnosus ab. Ohne die schützende Wand verlieren die Zellen zwar ihre Form, schwimmen aber ansonsten intakt in einer Nährlösung. Ein kurzer Stromstoß von einigen Millisekunden Dauer und einer Spannung von etwa tausend Volt reiht die Zellen dann wie Perlen auf einer Kette aneinander. Bei diesem engen Kontakt verschmelzen einige wenige Nachbarn miteinander – nicht nur Zellen der gleichen Art, sondern auch Zellen unterschiedlicher Arten. Aus solchen artübergreifenden Fusionszellen müssen die Züchter dann nur noch einen Spross ziehen. Das klappt bei Kartoffelzellen gut. „Lupinen sind allerdings sehr widerspenstig“, sagt Wehling. Immerhin: aus einigen Hundert Fusionszellen schafften die JKI-Forscher es, drei Sprosse zu ziehen. Diese Sprosse enthalten zwar von den wilden südamerikanischen Vorfahren noch Alkaloide, aber sie besitzen auch deren variantenreiches Erbgut. Und sie sollten sich mit den etablierten Süßlupinen kreuzen lassen. Aus solchen Pflanzen eine Lupinensorte ohne Alkaloide, aber mit höheren Erträgen und besserem Wachstum auf den Böden mit höheren Säurewerten zu züchten ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit. „Vorher aber müssen wir noch ein Problem lösen“, sagt Wehling: Bisher konnten sie die erhaltenen Sprosse noch nicht dazu bewegen, auch Wurzeln zu bilden. Peter Wehling ist aber zuversichtlich, auch diese Die Kerne einiger LuHürde auf dem Weg zur pinen sind genießbar. Lupinennudel und dem LuFoto blick-winkel pinenkuchen zu meistern. Für den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, sagte eine Melodie mehr als tausend Worte: „Das, was mir die Musik ausspricht, die ich liebe, sind mir nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte“, schrieb er an einen Cousin seiner Frau. Diese These ist nicht so abwegig, wie man meinen könnte. Neurowissenschaftler haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von Gemeinsamkeiten von Sprache und Musik entdeckt. Lange Zeit nahmen Wissenschaftler an, dass Sprache und Musik in unterschiedlichen Gehirnregionen verarbeitet würden: die Sprache in der linken Gehirnhälfte, die Musik in der rechten. Doch das ist möglicherweise falsch, wie Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig glauben. Sie haben untersucht, wie Akkorde und Melodien im Gehirn der Probanden verarbeitet werden. Die aufgedeckten Muster glichen denen, die auch bei sprachlichen Fehlern festgestellt werden: Verstöße gegen die Grammatik wurden ebenso wie Abweichungen von einer Melodie sowohl im klassischen Sprachzentrum, dem sogenannten Broca-Areal in der linken Hemisphäre, als auch von Bereichen in der rechten Gehirnhälfte registriert. In einem weiteren Experiment wiesen die Forscher nach, dass Musik dem Hörer sogar Informationen zu vermitteln scheint. So verarbeitet das Ge- F. Mendelssohn Barhirn das Wort „Keller“ tholdy (1809–1847) schneller, wenn dem Probanden zuvor eine musikalische Passage mit tiefen Tönen vorgespielt worden ist. Die dunkle Melodie ruft im Hörer offenbar Assoziationen nach düsteren Orten hervor. Stefan Koelsch, der an der Untersuchung beteiligt war, schließt daraus, dass das Gehirn nicht wirklich zwischen Musik und Sprache unterscheide: „Für das Gehirn ist Musik oft Sprache beziehungsweise Sprache Musik.“ Diese Ansicht stößt innerhalb der Wissenschaft auf Kritik. Eckart Altenmüller vom Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover glaubt nicht an eine Hirnregion, die bei allen Menschen für die Musikverarbeitung zuständig ist. „Da unsere musikalischen Hörbiografien einmalig und die Emotionen beim Musikhören flüchtig und veränderbar sind, ist ein statisches Konzept der Musikverarbeitung an einem Ort im Gehirn nicht angebracht“, sagt er. Altenmüller ist dennoch davon überzeugt, dass Musik als „Sprache der Gefühle“ der verbalen Kommunikation vorausging und daher in aller Welt verstanden wird. Ein Beleg dafür entdeckten vor kurzem Forscher des Leipziger Instituts: Die Mitglieder vom Stamm der Mafa in Kamerun erkennen den emotionalen Ausdruck von Freude, Angst oder Trauer in Klavierstücken, obwohl die Forscher die Ersten waren, die ihnen westliche Musik vorspielten. Die Frage, wie das Gehirn Sprache und Musik verarbeitet, ist auch für die Medizin von Interesse. Patienten, deren Broca-Areal geschädigt ist, leiden oft unter schweren Sprachstörungen. Trotzdem können sie Liedtexte singen, die offenbar in anderen Bereichen des Gehirns verarbeitet werden. Durch die sogenannte Melodische Intonationstherapie, bei der die Patienten kurze Sätze oder Wörter singen oder bestimmte Rhythmen klopfen, werden diese Bereiche stimuliert. Mediziner der Universität Harvard haben bei einzelnen Patienten in 75 Sitzungen deutliche Verbesserungen erreicht. FÜR SIE GESPIELT Das Naturquiz für das Osternest Welche Eigenschaften hat die gelbe Iris, um die Ankunft von Insekten zu erleichtern? Welche Taktiken setzen Termiten ein, um ihre Kolonie gegen Feinde zu verteidigen? Und wozu dient der lange Schwanz des Fuchses? Die vier achtjährigen Spieler haben keine Ahnung, raten aber begeistert mit. Jeder hat eine Handvoll Karten vor sich und sammelt möglichst viele Symbole einer Farbe. Die Regeln sind einfach, ähnlich dem gängigen Quartett. Daher können sich die Kinder beim neuen Kosmos-Spiel auf die Fragen konzentrieren, die so spannend sind, dass sich sogar sehr Lesefaule anstrengen, den Text zu entziffern. Die Antworten sind oft überraschend und auch für Erwachsene interessant. Kleine Erklärstücke, die man auch nach der Hektik eines Spieles lesen kann, geben zusätzliche Informationen zu den teilweise unglaublichen Fakten aus der Tierund Pflanzenwelt. Dieses Spiel ist eine schöne Alternative zu den vielen Wissensbüchern, die es für Kinder gibt. Wer noch schnell ein kleines Geschenk für das Osternest braucht, kommt damit bei naturbegeisterten Kindern sicherlich gut an. vz WWF Naturquiz, Kosmos. Für 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, 5,99 Euro.