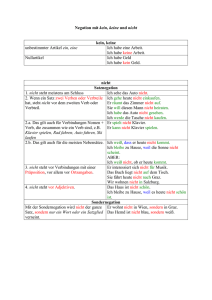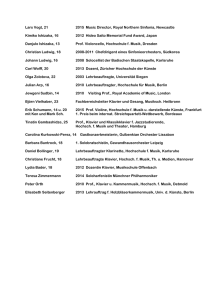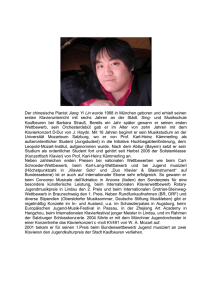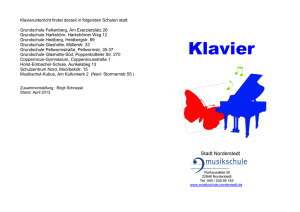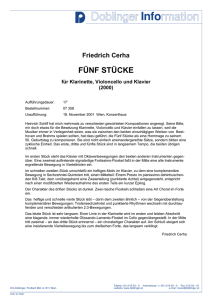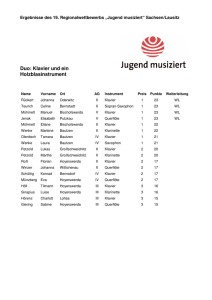zwölftes Kapitel - Klang
Werbung

- 295 - Zwölftes Kapitel - Klang (1.8.2015) In der Musik ist viel die Rede von Klangfarben. Wir sagen z.B., die Pianistin bzw. der Pianist verfüge über einen farbenreichen Klang. Mit dem Begriff Klangfarbe zu operieren, ist für die Vorstellung sinnvoll, dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es am Klavier keine Klangfarben gibt. Das Klavier hat nur eine Klangfarbe, eben die des Instruments Klavier. Durch seine Klangfarbe unterscheidet sich der Flügel von anderen Instrumenten so eindeutig, wie sich etwa eine Oboe durch die nur ihr eigene Klangfarbe von anderen Instrumenten unterscheiden lässt. Das Klavier besitzt keine Farben, es hat Schattierungen. Es ist die bekannte Gegenüberstellung von Farb-Photo = Orchester und Schwarz-Weiß-Photo = Klavier. Die Nuancen-Vielfalt der Grautöne zwischen Weiß und Schwarz ist unendlich groß, keinesfalls geringer als die einer wirklichen Farb-Palette. Schwarz-Weiß-Photos, gerade Portraits, sind oft suggestiver, eindringlicher als Farb-Bilder. Aufschlussreich sind Werke, die der Komponist selbst sowohl als Klavier- als auch als Orchester-Version vorgelegt hat, z.B. Ravels Valses nobles & sentimentales. Die Nuancen, wie sie etwa den Händen einer Klangkünstlerin wie Martha Argerich entströmen, stehen denen eines auch sehr guten Orchesters in nichts nach. Es sind die kleinen, unspektakulären Feinheiten, auf die es ankommt: unmerkliche rhythmische Rückungen, plötzliches Abtauchen eines Akkordes innerhalb einer Akkordreihung usw. Auch für einen sehr guten Dirigenten ist es schwierig, solche Finessen in den großen und deshalb immer ein wenig trägen Komplex eines aus 80 Personen bestehenden Orchesters hineinzutragen; solche Feinheiten entwachsen hauptsächlich dem Impetus des Einzelnen, denn: Raffinement ist immer nur die Eigenschaft eines Individuums, nie die eines Kollektivs. Natürlich hat auch der Rhythmus Einfluss darauf, wie wir einen Klang aufnehmen. Ein Walzer etwa klingt schwebender, luftiger, wenn die Zwei des Taktes an die Eins herangezogen wird und so der Drei mehr Gewicht und Breite zuwächst. Dennoch ist es für diese Untersuchung unumgänglich, die beiden Elemente Klang und Rhythmus zu trennen. Den Rhythmus beiseite lassend, kann man festhalten: Lautstärkenunterschiede sind das einzige Gestaltungsmittel, das uns am Flügel zur Verfügung steht. Tatsächlich hat kein Instrument ein auch nur annähernd so großes dynamisches Spektrum wie der Flügel, vor allem nach unten. Jeder Streicher- oder Bläserton wird brüchig, wo am Flügel ein pp noch leuchtet. Die Orgel mit einem noch größeren Spektrum (aber nicht nach unten!) nehme ich aus, weil auf ihr unterschiedliche Lautstärken nicht mit dem Anschlag der Hand sondern mechanisch entstehen. Künstlerisches Klavierspiel ist die Kunst der Lautstärkendosierung, insbesondere die Kunst, die Lautstärken der verschiedenen Stimmen bzw. Klangebenen in einer - 296 - Weise zueinander in Beziehung zu setzen, dass für den Hörer der Klangeindruck von Vielschichtigkeit entsteht. Die menschliche Stimme kann einem Ton verschiedene Merkmale verleihen. Sie kann ihn bei gleicher Lautstärke weich, schrill, nasal, gequetscht, gestoßen, verhaucht, fokussiert usw. hervorbringen. Am Flügel aber ist ein einzelner, isolierter Ton ohne Aussagekraft, Attribute wie weich, hart, singend, geklopft usw. erlangt ein Ton erst durch den Vergleich mit anderen Tönen zugesprochen. Die Lautstärke eines Tones wiederum hängt ausschließlich davon ab, mit welcher Geschwindigkeit der Hammer auf die Saiten auftrifft. In diesem Zusammenhang weise ich auf ein schon an anderer Stelle erwähntes Buch hin, Josef Dichlers "Der Weg zum künstlerischem Klavierspiel" aus dem Jahr 1948. Ich empfehle es nicht zuletzt deshalb, weil es mit wolkigen Vorstellungen über den Anschlag aufräumt. Ich zitiere eine Passage aus dem ersten Abschnitt des zweiten Kapitels: "... Auf welche Weise der Hammer auf seine Endgeschwindigkeit beschleunigt wurde, ob gleichförmig oder ungleichförmig, ob durch Schlagen oder Drücken oder Streicheln der Taste, ist für den Toncharakter bedeutungslos, alle Anschlagsarten und Methoden haben nur den Zweck, eine möglichste feine Nuancierung der Endgeschwindigkeit (Aufschlagsgeschwindigkeit) des Hammers zu ermöglichen und damit eine möglichst differenzierte Dosierung der Lautstärke. Es ist daher für die Tonqualität völlig gleichgültig, ob die Endgeschwindigkeit des Hammers von z.B. 70 cm pro Sekunde dadurch erreicht wurde, daß man die Taste mit einer Nadelspitze schlug oder mit einem weichen Gegenstand drückte, denn das einzige Merkmal der Geschwindigkeit ist ihre Größe. Es ist nicht möglich, den Hammer mit 70 cm pro Sekunde dunkel zu beschleunigen und ein anderes Mal auf 70 cm pro Sekunde hell. Es gibt keine spitzige, schöne, häßliche oder weiche Geschwindigkeit, sondern nur eine solche von 70 cm pro Sekunde oder mehr oder weniger. Wir ersehen daraus, daß die Begriffe 'heller Ton - dunkler Ton', 'dünnes Piano volles Piano' einer realen Grundlage entbehren und nur psychologische Bedeutung besitzen. Dies zum Unterschied von allen Streich-und Blasinstrumenten, bei denen der Toncharakter in jedem Moment der Tonerzeugung beeinflußt werden kann." Die Konklusion aus dem Gesagten nimmt Prof. Dr. Dichler gleichsam vorweg. Noch vor den soeben zitierten Sätzen sagt er: "... der gleiche Ton hat, wenn er verschieden stark angeschlagen wurde, eine verschiedene Farbe, eine Einflußnahme des Spielers ist aber nur auf dem Umwege über die Lautstärke und in Verbindung mit dieser zu erzielen. Es ist daher nicht möglich, ein und denselben Ton gleich stark und doch verschieden in der Qualität zu spielen. Diese Tatsache ist von außerordentlicher Bedeutung, da daraus hervorgeht, daß alles, was wir unter Anschlagskultur, Anschlagskunst, Tongebung u.s.w. verstehen, einzig und allein von differenzierter Lautstärke abhängig ist, vom Stärkeverhältnis der Töne untereinander - in horizontaler und vertikaler Hinsicht." - 297 - In einer Fußnote merkt Dr. Dichler noch an: "Unwesentliche Verschiedenheiten des Toncharakters können sich bei gleicher Lautstärke durch gewisse Nebengeräusche ergeben (z.B. Fingerklopfen), sie sind jedoch - vor allem bei größerer Entfernung des Hörers vom Instrument - von geringer Bedeutung." Verschiedene Stimmen eines Klaviersatzes unterscheiden sich nicht durch verschiedene Klangfarben sondern nur durch ihre unterschiedliche Lautstärke. Deshalb müssen, um einen Höreindruck von Vielschichtigkeit zu erhalten, die Lautstärkenunterschiede fast immer sehr groß sein, insbesondere dann, wenn die Stimmen nahe beieinander liegen und sich in ihren Tonumfängen manchmal überschneiden (Bach-Fugen). Am günstigsten für ein durchsichtiges Klangbild ist, wenn es gelingt, den Stimmen, besonders benachbarten, eigene Lautstärken-Korridore zuzuweisen, die sich zwar bisweilen überschneiden aber nie decken. Auch unter einer laut gespielten Sopranstimme ist ein darunter liegender Alt gut zu verfolgen, wenn er in einem konsequenten piano stets eine Stufe unter der Lautstärke der darüber liegenden Stimme bleibt und so vermeidet, dass seine Individualität durch zu häufige Ausschläge in Richtung der Dynamik des Soprans verloren geht. Unter der getroffenen Vereinbarung, rhythmische (und spieltechnische) Mängel beiseite zu lassen, können wir festhalten: Wenn ein Klaviervortrag langweilt, dann liegt das immer daran, dass die Lautstärkenunterschiede zwischen den Stimmen / Klangebenen zu gering sind. Um aber einen Klaviervortrag spannend und lebendig zu halten, gibt es, neben der Lautstärkenmischung, eine weitere wichtige Voraussetzung: Die Lautstärkenverhältnisse müssen sich ständig ändern. Professionelle Klavierspieler verfügen alle über eine mehr oder weniger ästhetische Klangmischung; sie heben die Oberstimme hervor, können die Mittelstimmen zurücktreten oder kurz auftauchen lassen, die Bässe sind gut dosiert usw. Der sehr häufige und elementare Mangel besteht darin, dass sich an der gewählten kultivierten Mischung zu wenig ändert, weil sich dynamische Veränderungen immer auf alle Stimmen gleichzeitig erstrecken. Es ist die Art Klavierspiel, dem man, in etwas ironischer Färbung, das Attribut "Bewährte Meisterschaft" zusprechen würde, und das deshalb ermüdet, weil man immer schon vorher genau weiß, was kommt. Diese sehr häufige Beobachtung lässt sich in einem Vergleich zusammenfassen: Das Spiel vieler Pianisten wäre dann dem einem Orchesters vergleichbar, in dem alle Instrumente immer gleichzeitig crescendo bzw. decrescendo machen. Der Satz verwendet den Irrealis "wäre ... vergleichbar", denn kein gutes Orchester macht die Dynamik immer synchron mit allen Instrumenten. Wenige Sätze habe ich im Unterricht gegenüber meinen Studenten häufiger gebraucht als diesen: Wenn ein Orchester forte spielt, heißt das nicht, dass alle Instrumente gleichermaßen forte spielen. Das sind die Feststellungen. Aber es ist schwer, daraus konkrete Tipps abzuleiten, zumal auf dem Papier. Vor über 15 Jahren, als ich an diesem Buch noch mit der Hand schrieb (mit kopierten - 298 - und eingeklebten Notenbeispielen), habe ich den Versuch gemacht, am Grandioso aus Liszts h-moll-Sonate (Bsp.291) die angemessene dynamische Gestaltung genau zu beschreiben: wie eine gewaltige Klangwirkung zu erzielen sei, ohne dabei je den strahlenden Gesang zu überdecken; welche Bässe mächtig, welche zurückhaltend zu nehmen sind, und, vor allem, wie die Mittelstimmen-Akkorde zu gestalten wären: wann sie rückzunehmen sind, wann sie wachsen und drängen müssen ... Bsp.291 Takt 109 Nach über 10 handgeschriebenen Seiten habe ich den untauglichen Versuch aufgegeben. Die unendlich vielen Möglichkeiten der Lautstärkenmischung zwischen den Stimmen entziehen sich der Beschreibung. Dennoch können allgemeine Hinweise hilfreich sein. Bereits im sechsten Kapitel war die Rede davon gewesen, wann ein laut gespielter Bass einen Melodieton stützt und wann er ihn erdrückt. Dies hängt davon ab, welche Funktion dem Bass hat. Ist der Bass-Ton auch Grundton der Harmonie, dann kann er einem Melodieton, wenn dieser Teil der Harmonie ist, zu mehr Strahlkraft verhelfen. So kann (und soll) die Bass-Oktave C in Takt 109 von Bsp.291 selbstverständlich mit größter Wucht genommen werden, das Sopran-G wird dadurch nicht erschlagen, weil die Töne G stark schwingende Obertöne des Basis-Tons C sind, natürlich aber muss zusätzlich, unterstützend, auch der fünfte Finger rechts auf dem G Außerordentliches an stechender Kraft leisten. Bei Sextakkorden verhält es sich anders. Die im Bass liegende Terz kann mit ihrern Obertönen die Entfaltung des Melodie-Tons stören. Dazu sehen Sie nachstehend das erklärende Notenbild aus dem 6. Kapitel noch einmal abgebildet: - 299 - Die stark mitschwingenden Obertöne H (3.Oberton) und Gis (5.Oberton) der im Bass liegenden Terz E vertragen sich nicht mit den übrigen Akkord-Tönen. Deshalb: Sext-Akkord-Bässe (meist) diskret anschlagen. Heikel ist die Klangmischung auch bei ausdrucksstarken Vorhalten, die deutlich hervortreten müssen, von dick aufgetragenen Bässen aber oft daran gehindert werden. In solchen nicht seltenen Fällen lautet das Gebot: Gerade damit eine Sopranstimme in großem forte aufscheinen kann, müssen sich die umgebenden Stimmen zurückhalten. Instruktiv in dieser Hinsicht ist die folgende Passage aus Brahms' Intermezzo op.118 Nr.6 (Bsp.292). Die dynamische Gestaltung, die Stellen wie dieser angemessen ist, heißt "Vorweggenommenes Plateau". Der dramatische Höhepunkt fällt auf den Takt 61, dennoch ist die größte Kraftentfaltung auf den Takt davor zu verlegen, wo die letzte Bass-Oktave Es und der letzte Akkord rechts in beiden Händen mit größtmöglicher Wucht angeschlagen werden. Am Kulminationspunkt selbst, in Takt 61, aber hat der mit dem Ges sich reibende Sopran-Ton F absoluten Vorrang; diesen Vorhalt darf man, ohne Übersteigerung, einen verzweifelten Schrei nennen, auf ihn ist alle Energie, die ganze Entwicklung ausgerichtet. Ein dick gespielter Bass ließe den Schrei in Klangmasse versinken, deshalb darf die Bass-Oktave As in Takt 61 allenfalls mf gespielt werden. "fff " Bsp.292 Takt 61 in beiden Händen ff(f)! hier nur rechts stechendes ff, die As-Oktave links allenfalls mf Der Hörer muss es keineswegs als Energieeinbruch empfinden, wenn der Kulminationspunkt eines Werks nicht mit dem Moment der höchsten Gesamtlautstärke zusammentrifft. Ein Plateau zu erklimmen, erfordert mehr Energie, als es zu halten. Ist das Plateau erreicht, dauert seine Wirkung noch an, ohne dass es nötig wäre, ständig nachzuheizen. Über das Klavier hinaus, orchestral gedacht, kommt es häufig vor, dass eine kleinere Gruppe von Instrumenten die große Energie aufrecht erhalten und weitertragen muss, die zuvor von dem gesamten Orchester aufgebaut wurde. - 300 - Exemplarisch trifft dies zu auf Brahms' Ballade op.10 Nr.1 (Bsp.293), wo, nach einem langen Aufbau, ein gewaltiges Orchester-Tutti den dramatischen Höhepunkt in Takt 44 (incl. Auftakt) erreicht; dieser wird lange, bis zum dimin. in Takt 53, gehalten, ab Takt 49 (sempre ff) aber nur noch von den Streichern und einer Pauke. Das heißt: Mit dem Auftakt zu Takt 49 muss sich die linke Hand zurückhalten und dem Gesang der Streicher den Vortritt lassen. Das Thema ist ab T.49 weiterhin sehr mächtig, aber milder, verbindlicher, melodischer, nicht mehr heroisch gestoßen wie im Orchester-Tutti der Takte 44, 45 usw. Ein über die ganze lange Strecke gleichermaßen lärmendes Bass-Register würde das Ohr ermüden, würde Eindringlichkeit in Bombast verkehren. Bsp.293 Takt 44 Takt 49 Pauke ab hier nur noch ff der Streicher, deshalb die Bässe zurücknehmen. Bei der Gestaltung der Lautstärkenverhältnisse hat man immer die Tatsache zu vergewärtigen, dass Resonanz und Tragfähigkeit eines Klavier-Tones in erster Linie von seiner Höhe abhängen, und das beileibe nicht nur dann, wenn zwei entfernte Töne, ein tiefer und ein hoher, mit derselben Hammergeschwindigkeit angeschlagen werden. Auch ein mit langsamer Hammergeschwindigkeit (= pp) in tiefer Lage angeschlagener Ton trägt viel länger als der in hoher Lage scharf herausgestochene. Machen Sie dazu bitte noch einmal, hier links, das schon an anderer Stelle erwähnte kleine Experiment (bei getretenem Pedal ausführen!): Der tiefe und nur sehr leise angeschlagene Bass-Ton ist beinahe 30 Sekunden vernehmbar, von dem scharf im ff angestochenen Diskant-Ton ist nach kaum mehr als fünf Sekunden nichts mehr zu hören. Im Unterschied zu fast allen anderen Instrumenten diminuiert jeder Klavierton sofort nach dem Anschlag, ohne dass wir irgendetwas dagegen machen können. Gerade die sehr espressiven hohen Töne verklingen am schnellsten. Darüber brauchen wir nicht - 301 - allzu traurig zu sein; denn das Erstaunliche ist, dass der Hörer bei einem zwingenden künstlerischen Vortrag das diminuendo nicht wahrnimmt, mehr noch: Der Hörer empfindet auch Töne als fortlebend, die tatsächlich schon erloschen sind. Das hat damit zu tun, wie unser Gehirn Sinneseindrücke aufnimmt. Wir nehmen sie nicht nur so auf, wie sie real, z.B. in Phonstärke messbar, auf uns einwirken (Perzeption), wir nehmen sie vielmehr so wahr, wie wir sie wahrnehmen wollen. Wir formen die Sinneseindrücke nach unserem Willen und unseren Erwartungen (Apperzeption). Nachdem festgestellt wurde, dass die Nachhaltigkeit von Klavier-Tönen hauptsächlich von ihrer Höhe abhängt, müssen Hinweise zur Klangmischung, die immer nur allgemein sein können, dieser Tatsache Rechnung tragen. Die grundsätzliche Richtlinie lautet: Je tiefer die Lage, desto größer müssen die Lautstärkenunterschiede ausfallen. Ob wir eine Gesamtlautstärke als groß oder klein empfinden, hängt fast ausschließlich von den tiefen Lagen ab. Laute Töne in tiefer Lage breiten sich aus, laute Töne in hoher Lage verklingen rasch. Je mehr wir auf der Tastatur nach oben kommen, desto geringer wird die Notwendigkeit zu großen Lautstärkenunterschieden, der rechte fünfte Finger im hohen Diskant darf / muss, vereinfacht gesagt, immer "f " spielen. Eine zu dünne Oberstimme ist z.B. typisch für fast alle Laienklavierspieler. Es kommt darauf an, Veränderungen in der Lautstärke, cresc. und decresc., nicht mit allen Stimmen gleichzeitig zu machen. Der häufigste Fehler ist, dass die Bässe zu früh an einem crescendo beteiligt werden. So baut sich rasch eine große Gesamtlautstärke auf, und das Ohr ist schon vor dem eigentlichen Kulminationspunkt von einem zu hohen durchschnittlichen Pegel ermüdet. Genauso ist es, umgekehrt, notwendig, bei einem decresc. zuerst mit den tiefen Stimmen zurückzuweichen, den Sopran aber noch lange hell (= laut) zu lassen. Geht der Sopran gleichzeitig mit den übrigen Stimmen zurück, ruft dies meist den Eindruck eines Einbruchs an Intensität hervor. In einem Spezialfall von Bässen jedoch, nämlich Orgelpunkt-Bässen, kann man eine allgemeingültige Regel aufstellen, weil sie auf alle Orgelpunkt-Passagen zutrifft: Beziehe Orgelpunkt-Bässe erst spät in die dynamische Entwicklung ein. Eindrucksvoll zeigt sich dies gegen Ende von Chopins cis-moll-Scherzo (Bsp.294). Ab Takt 526 (nicht abgebildet) verharrt die Musik zunächst in einer inaktiven Haltung nachdenklichen Verweilens, als wüsste sie noch nicht, wohin sie weiter gehen soll. Das weiß sie ab Takt 540; dann erhebt sich das vorher stets unterbrochene Choralthema zu ungeheurer Weite und Größe und strebt in einem mächtigen Sog auf die turbulente Schluss-Stretta zu. Dem Poeten böten diese Takte zahllose Bilder zu schwärmerischer Beschreibung: Einer neuen Hoffnung, dem Licht, einer freundlichen Vision, der aufgehenden Sonne entgegengehen usw. - 302 - In einem Auswahlverfahren für die Studienstiftung des Deutschen Volkes stellte sich im Dezember 2010 ein ambitionierter junger Klavierstudent mit diesem cis-mollScherzo vor, konnte es dann nicht fassen, nicht unter die in Frage kommenden Kandidaten aufgenommen worden zu sein. Von Takt 540 an hatte er sofort laut mit dem Orgelpunkt-Gis losgelegt, dessen von Beginn an aufdringliches Dröhnen es unmöglich machte, von der großen CrescendoEntwicklung auch nur etwas zu ahnen. Für den Studenten war dieser erhabene Gesang nur so etwas wie eine Zwischenstation zum Nachladen, bis er endlich, beim grimmigen Cis-moll-con fuoco angekommen, wieder in seinem Element war. Bsp.294 Takt 540 Bsp.294: Ab Takt 540 den Orgelpunkt Gis erst spät in die crescendo-Entwicklung einbeziehen. Damit sich die Gesamtlautstärke nicht zu rasch aufbläht, sind deshalb zunächst viele Flatterpedal-Bewegungen nötig, Auf der langen Strecke bis zum ff ein bis zweimal leicht zurückgehen, um neu aufzubauen. Das waren Betrachtungen zur vertikalen Dosierung der Lautstärken; erst in der Horizontalen aber, also bei Melodien und Themen, zeigt sich der fundamentale Unterschied zwischen dem Flügel und allen anderen Instrumenten. Spielt eine Klarinette im Verbund mit anderen Instrumenten ein Thema, so kann sie dieses Thema mehr oder weniger bei jeder Wiederholung immer in der gleichen Art - 303 - und Weise mit den natürlichen Hebungen und Senkungen der musikalischen Sprache wiedergeben. Am Flügel dagegen ist die dynamische Gestaltung einer Melodie, eines Themas extrem unterschiedlich, je nachdem ob das Thema exponiert solistisch oder im Verbund mit anderen wichtigen Stimmen auftritt. Eine große Rolle spielt auch die Lage, in der das Thema auftritt, und in welcher Dichtigkeit es von anderen Stimmen umhüllt ist. Beispiel 295, eine Passage aus Ferruccio Busonis genialer Klavieradaption der Bach'schen Chaconne für Violine allein, zeigt, dass es am Klavier oft unumgänglich ist, die Lautstärke von Stimmen unvermittelt, ja bisweilen ruckartig zu ändern. Die hohen Stimmen, die in Takt 197 auf dem Sopran-Fis mit explosiver Kraft erneut einsetzen, markieren den Beginn der triumphalen Schluss-Apotheose in Dur. Um dieses Fis so durchzulassen, dass es alles andere überstrahlt, muss sich die darunter liegende Bass-Oktave D, obwohl Grundton, plötzlich zurückziehen, darf auf keinen Fall das forte der Oktav-Linie davor weiterführen. In den folgenden Takten hat der fünfte Finger rechts weiterhin ein Äußerstes an stechender Kraft zu leisten. Die Notation im unteren System weckt automatisch den Gedanken an die über die Orgelpedale eilenden Füße. Bsp.295 " fff " Das D weglassen, um das Fis stärker abzuheben! Takt 196 f f mp zu Bsp.298: Das in Takt 197 einsetzende Sopran-Fis bedarf als Initial-Ton einer großen Dur-Schluss-Apotheose höchster Leuchtkraft, die alles andere überstrahlt. Deshalb muss sich bei seinem Einsatz die darunter liegende D-Oktave zurücknehmen. Bei den großen, langgezogenen Themen J.S Bachs sind die Intervalle selbst schon der Ausdruck, aufzeigende Hervorhebungen sind unangebracht, ja lächerlich. Deshalb klingen diese Themen auf der Orgel so schön, weil die Orgel keine dynamischen Hervorhebungen kennt, und lange Töne auf der Orgel ruhig stehen bleiben. Betrachten wir das erste Thema aus Bachs Tripel-Fuge fis-moll, Wohltemperiertes - 304 - Klavier, Teil II (Bsp.296). Ausdrucksvolle Hervorhebungen der größeren Intervalle, der Sexte in Takt 1, der Quarte in Takt 2, wären wie unnatürlich aufgesetztes Pathos; später aber im Verbund mit den anderen Stimmen müssen die Intervallspitzen oft sehr hervorgehoben werden, um im Fortgang den Hörer immer wieder - kurz - an das Vorhandensein auch dieses Themas zu erinnern. Diese punktartigen Hervorhebungen sind, notwendigerweise, im Verlauf der Fuge manchmal so stark, dass das Thema, träte es mit diesen Hervorhebungen solistisch auf, wie eine Verzerrung aus herausplatzenden Spitzentönen wirkte. Bsp.296 (Bezeichnungen Sostenuto, non forte, Legatobogen und Staccati von Ferruccio Busoni) Extreme dynamische Ausschläge nach oben und unten in einem Verband von Stimmen führen von selbst zu der alten Frage, inwieweit der Mensch mehrere Stimmen gleichzeitig verfolgen kann, also ob er polyphon hören kann. Die Frage rechtfertigt es, von einem "Selbstversuch" zu berichten, der, mit teils langen Pausen dazwischen, zehn Jahre gedauert hat, von 1982 (Beginn der Arbeit) bis zur ersten Aufführung des Werks im Jahre 1992. Wenigstens an einem exemplarischen Fall, der Fuge dis- bzw. es- moll aus dem Wohltemperierten Klavier, Teil I. (Bsp.297), hatte ich herausfinden wollen, ob sich die Beschränktheit des Ohres, was das gleichzeitige vollkommene Verfolgen mehrerer Stimmen betrifft, überwinden ließe. Bsp.297 Zunächst habe ich das Werk auf drei Systeme umgeschrieben, als Partitur für Oboe (Sopran), Klarinette (Alt) und Fagott (Unterstimme). Dann ließ ich die Fuge von drei - 305 - Bläser-Studenten des damaligen Münchner Richard-Strauss-Konservatoriums auf drei verschiedene Arten auf Band spielen derart, dass jeweils nur zwei der drei Instrumente, z.B. Oboe und Klarinette, die Fuge aufgenommen haben, ein Instrument in den linken, eins in den rechten Stereo-Kanal. Die beiden Mikrophone standen dabei etliche Meter voneinander entfernt, so dass sich eine deutliche Trennung der Stimmen ergab. Anmerkung: Beispiel 297 ist wie das vorherige der Busoni-Ausgabe entnommen. Nach dem Urtext hat Bach die Fuge in dis-moll geschrieben, Busoni hat sie, in Angleichung an das von Bach in es-moll geschriebene Präludium, in es-moll setzen lassen. Die Busoni-Ausgabe ist mir wegen des Ideenreichtums dieses großen Künstlers (wunderbar: "Andante pensieroso"!) oft lieber als ein Urtext. Der Urtext ist auch aus einer kommentierten Ausgabe jederzeit mit Leichtigkeit herauszulesen: Man braucht sich nur die Angaben zu Tempo und Dynamik und die Legatobögen wegzudenken. Dynamische Hinweise von Bach selbst gibt es im gesamten Wohltemp. Klavier nur an einer Stelle in Teil II, nämlich forte in der ersten und piano in der zweiten Zeile des Präludiums gis-moll. Nach und nach lernte ich, jede der drei Stimmen auswendig zu solfeggieren (mit den Solfeggio-Silben von dis-moll) und dabei gleichzeitig die beiden anderen Stimmen über Kopfhörer zu hören. Anmerkung: Der große Nutzen des Solfeggierens für die Gehörschulung besteht darin, dass die Solfeggio-Silben beim Singen von selbst die gesungenen Intervalle bewusst werden lassen, mehr noch: Mit den Solfeggio-Silben hat man beim Singen stets auch die entsprechende Tastenabfolge auf der Klaviatur vor dem geistigen Auge, wobei es keine Rolle spielt, dass man immer Do singt, egal ob es sich um ein C, ein Ces, ein Cis oder um ein C mit Doppelkreuz handelt. Das Solfeggieren führt das geistige Auge stets zu der richtigen Taste. Professor Markus Ulbrich, mein ehemaliger Kollege für Gehörbildung an der Musikhochschule Freiburg, sagte, es liege - die Behauptung kann ich nicht nachprüfen - allein an dem an französischen Schulen obligatorischen solfège-Unterricht, dass unter französischen Kindern der Prozentsatz von Absoluthörern signifikant höher sei als unter deutschen Kindern. Zusätzlich habe ich in allen drei Kombinationen geübt, nur zwei der drei Stimmen, eine in jeder Hand, auswendig zu spielen und die fehlende Stimme singend (mit den Solmisation-Silben als Text) zu ergänzen. Dabei fällt jede Hilfe durch motorische Prägung weg, da in einer dreistimmigen Fuge normalerweise immer eine Hand zwei Stimmen zu bedienen hat. Deshalb ist diese Art der Übung sehr anstrengend, und man schafft in einer Übungseinheit nur eine sehr begrenzte Anzahl von Takten. Der Grund für die Anstrengung war der unbedingte Wunsch, in einem Einklang von Körper und Hören eine vollkommene Polyphonie zu erreichen. Das Werk sollte, fern jeder motorischen Prägung, zu einem Teil meiner selbst werden. Das ambitionierte Experiment hat nicht dazu geführt, dass ich alle Stimmen gleichzeitig hätte verfolgen können. Neben einer sehr großen Sicherheit der Memorisierung sind als Erfolg anzuführen eine entmechanisierte Durchdringung und ungewöhnliche Klarheit, die sicherstellen, dass es in der Fuge keinen ungehört gespielten Ton mehr gibt. Anmerkung: "Ungehört gespielt" bedarf einer Erläuterung. Ungehört gespielt meint, dass die spielende Person angeschlagene Töne nicht wirklich hört, sondern, von Aufgaben an anderer Stelle beansprucht, nur die entsprechenden Tasten herunterdrückt. Dies ist stets unüberhörbar, etwa bei - 306 Begleitstimmen, Begleitakkorden, denen man sofort anhört, ob sie prononciert dargestellt oder nur im Nebenbei mitgenommen werden; es sind die Stellen, an denen gleichsam nur die Finger spielen, nicht die Person selbst. Anhand der dis (bzw. es) - moll-Fuge soll ein Gedankenexperiment den großen Unterschied in der dynamischen Gestaltung zwischen dem Klavier und anderen Instrumenten aufzeigen: Würde, metronomisch gleich, jede der drei Bläserstimmen einzeln aufgenommen, so schön wie möglich mit den natürlichen Hebungen und Senkungen der musikalischen Sprache, und legte man anschließend die Stimmen, Oboe, Klarinette und Fagott, in einem tontechnischen Mischverfahren übereinander, dann ergäbe das Abhören der drei zuvor einzeln aufgenommenen Stimmen ein schönes Klangergebnis. Das gilt auch für Instrumente, die sich in ihrer Färbung nicht so stark voneinander unterscheiden wie Blasinstrumente. Bekanntlich gibt es sehr schöne Fassungen des wohltemperierten Klaviers für Violine, Viola und Violoncello; sogar Mozart hat Fugen J.S.Bachs für Streichtrio eingerichtet. Nähme man am Klavier jede der drei Stimmen einzeln auf, jede ästhetisch vollendet mit diskreten crescendi und decrescendi ausgeführt, so ergäbe die zusammengemischte Aufnahme die langweiligste Interpretation, die sich denken lässt. Soll im Schwarz-Weiß-Film eines Klaviervortrags ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten entstehen, muss ich ständig bestimmte Töne oder kurze Tonfolgen überproportional aufleuchten bzw. überproportional zurücktreten lassen. Nur so lässt sich die Illusion von Polyphonie hervorrufen; denn wir können, selbstverständlich, nicht alle Stimmen gleichzeitig verfolgen. Wenn wir glauben polyphon zu hören, ist es in Wirklichkeit so, dass die Aufmerksamkeit ständig zwischen den hervorstechenden Merkmalen der einzelnen Stimmen hin und her springt. Robert Jourdain ("Das Wohltemperierte Gehirn") sagt dazu: "Die Stimmen werden nicht so wahrgenommen, dass sie sich später wieder einzeln nachvollziehen ließen ... Der Zuhörer hört vor allem Beginn und Ende ihrer Einsätze und die Gipfel und Täler dazwischen. Das Gehirn analysiert so die Beziehungen zwischen den Stimmen mit einem parallelen Strom von Vorannahmen, der diejenigen Stellen ergänzt, auf die man nicht ausdrücklich geachtet hat." Die Stimmen in Bachs dis- bzw. es-moll-Fuge einzeln aufzunehmen und dann zusammengemischt abzuhören, ist ein gedankliches Experiment, es real durchzuführen, wäre für mich zu aufwendig gewesen. Ein anderes, ein reales Experiment, heute in einem Tonstudio leicht durchführbar, ist noch aufschlussreicher. Prof. Dr. Josef Dichler berichtet schon 1948 von Versuchen mit Schallplatten, die gegen den Uhrzeigersinn liefen, die Plattennadel bewegte sich folglich von der Plattenmitte zum Plattenrand hin: Nimmt man (langsame) Tonfolgen beliebiger Instrumente auf, so werden diese, wenn man die Aufnahme rückwärts abspielt, ohne weiteres als die gespielten Instrumente - 307 - wiedererkannt, eine Oboe als Oboe, eine Geige als Geige usw. Rückwärts abgespielte Tonfolgen eines Klaviers dagegen ergeben einen extremen Verfremdungseffekt. "Das Klavier wird gewöhnlich gar nicht erkannt, vielmehr glaubt man ein seltsames Harmonium zu hören, dessen Töne aus dem Nichts kommen und mit einem sfz abreißen." (Josef Dichler) Aber ich wollte mich selbst vergewissern. Herr Jürgen Rummel, der Tonmeister der Würzburger Musikhochschule, hat deshalb im September 2015 liebenswürdigerweise mit ein paar Versuchen im Tonstudio die obigen Aussagen vollauf bestätigt (wobei er mir überdies mit einem Tonbeispiel zeigte, dass der starke Verfremdungseffekt bei rückwärts abgehörten Tonfolgen auch bei der Harfe eintritt). Der Klavierton hat eine äußerst kurze Einschwingungszeit, erreicht seinen Scheitelwert (Amplitude) beinahe sofort, genauer: 0,01 bis 0,03 Sekunden nach dem Anschlag, jeder Klavierton, auch einer im piano, setzt deshalb mit einem sf ein und jeder Ton diminuiert unbeeinflussbar nach dem Anschlag. Anmerkung: Herr Rummel wies mich auf ein Buch hin: "Akustik und musikalische Aufführungspraxis" von Jürgen Meyer, das Buch sei "die Bibel für Tonmeister". Zum Einschwingungsvorgang schreibt Herr Meyer: "Ein Resonanzsystem kann nicht plötzlich auf eine Anregung reagieren, sondern die Schwingungen müssen sich erst bis zur endgültigen Stärke aufschaukeln." Nimmt man den sehr hohen Geräuschanteil hinzu, der mit dem Klavieranschlag verbunden ist, dann sind das für eine melodische Gestaltung denkbar schlechte Voraussetzungen. Würde eine am Klavier als cantabel und süß empfundene Melodie in akustisch messbar gleicher Weise von einem Melodieinstrument, Geige etc., nachgespielt, ergäbe dies eine verstörende Groteske. Mit Kunstgriffen kann man etwas nachhelfen: So kann eine wachsende und vorwärts drängende Begleitung die Illusion stützen, dass der darüber liegende Melodieton ebenfalls wächst. Dies aber erklärt keineswegs, warum die genannten Schwächen des Klaviertons vom Hörer kaum registriert werden, in Gegenteil: Bekanntlich kann das Klavier cantabel, schön, ergreifend klingen, es ist das beliebteste Instrument, die größten Komponisten haben für das Klavier mit ihre besten und bewegendsten Werke geschrieben, im Vergleich zur Fülle der für das Klavier geschriebenen Literatur erscheint das Repertoire jedes anderen Instruments geradezu winzig, und es ist im Grunde das einzige Instrument, dem man als einem nur ganz allein sich präsentierenden Instrument einen ganzen Konzertabend lang ohne nachlassende Spannung zuhören kann. Schon etwas weiter oben war die Rede vom Unterschied zwischen Perzeption und Apperzeption. Perzeption ist, was auf unsere Sinne einwirkt, Apperzeption ist die Interpretation dieser Eindrücke im Gehirn. Zahllos sind die psychologischen Versuche, optische und akustische, die diesen Unterschied belegen. Die Sinne lassen sich leicht täuschen, deuten Eindrücke in eine gewünschte Richtung oder gemäß bestehender Vorstellungen. Vor allem hat das Gehirn die Fähigkeit bzw. das Bedürfnis, nicht Vorhandenes zu ergänzen. Erst vor ein paar Tagen las ich in einem Kriminal- - 308 - roman von Josh Bazell: "Bei schwachem Licht können wir keine Farben sehen. Unser Verstand stellt sie sich vor und malt sie hinzu." Hauptgrund für die schöne Illusion, die ein Klaviervortrag in uns entstehen lassen kann, sind die Harmonien. Ihr ständiger Wechsel zwischen Spannung und Entspannung ruft fortlaufend Vorstellungen darüber hervor, wie es weiter geht, weckt Erwartungen eines Ziels, z.B. einer Auflösung, und von diesen Erwartungen werden auch Melodietöne mitgenommen, selbst wenn sie tatsächlich schon unhörbar geworden sind. "Wir hören nicht das, was klingt, sondern das, was wir uns unter dem Gehörten vorstellen.", sagte der bekannte Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler Hermann Keller. Hinzu kommt: Obwohl die Lautstärke nach dem Anschlag gleich abnimmt, ist die Tragfähigkeit selbst hoher Töne so hinreichend, dass wir sie nicht als sofort diminuierend erleben, der Klavierton wirkt nicht, wie der des Cembalos, nur als Punkt, sondern entfaltet, eben wegen seiner Tragfähigkeit, die nötige Breite, um sich als lange fortklingend im Gehirn zu verankern. Voraussetzung für die Illusion, die ein guter Klaviervortrag erzeugt, ist, dass die Empfindung des Interpreten diese Illusion trägt, das heißt, dass er selbst einen angeschlagenen Ton suggestiv so weiterhört, als ob dieser gleich stark bliebe, ja wüchse. Hier knüpft die Diskussion an die Einleitung an: Weil der Ton nach dem Anschlag nicht mehr beeinflussbar ist, interessieren sich viele Pianisten nur für den Moment des Anschlags, nicht für den sich danach ausbreitenden Klang. Mit dem Anschlag gilt die Aufgabe als erledigt. Daraus leitet sich die schlechthin größte Gefahr her, die es beim Klavierspiel gibt: einen Ton nach dem Anschlag zu vergessen, innerlich fallen zu lassen. Der Anschlag aber ist der Moment, in dem das Leben des Tones beginnt. Ob ein Ton vergessen oder durchgehört wurde, verrät - fast immer- der Anschlusston. Gegen das "Vergessen" eines (langen) Tones, der in einer Pause endet, gibt es eine Hilfestellung: Man muss festlegen, dass der Ton zu einen genau bestimmten Moment endet. Das ist mehr als das übliche Aushalten bzw. Auszählen eines Notenwertes, es bedeutet, den Ton aktiv auf sein Ende auftreffen, ihn auf die Pause gleichsam aufprallen zu lassen. Aus der Opernwelt ist das vertraut, wenn der Sänger einen lauten Ton sehr lange hält, ohne in der Lautstärke nachzulassen, um ihn dann dramatisch abzureißen ("... all' alba vi - ince - e - e - e -.e - r o - o - o - ò "). Lautet die Aufgabe, den Ton zu einem präzisen Moment zu beenden ("abzureißen"), kann ich ihm meine Aufmerksamkeit nicht entziehen, ohne andernfalls die Aufgabe zu verfehlen. Natürlich geht das leichter, wenn der Ton manuell festgehalten werden kann; das ist bekanntlich keineswegs immer der Fall, aber auch dann muss im Interpreten dieselbe quasi körperliche (nicht nur akustische) Empfindung des Festhaltens regsam sein. Für viele Pianisten ist Klavierspielen in erster Linie nur Aktion. Eben diesen Ein- - 309 - druck gilt es zu vermeiden, denn Tatsache ist: Das Publikum lauscht Ihrem Spiel nur, wenn Sie selbst imstande sind, einem Ton bzw. einem Klang, z.B. einer sauberen Auflösung, nachzulauschen. Klang und Komponisten Der Klang ist, natürlich, interpretenabhängig, aber nicht bei jedem Komponisten in gleichem Maße. Der Klang hängt auch vom Komponisten selbst ab. Jeder hat seine bevorzugten Komponisten, was letztlich immer auf eine persönliche Rangliste hinausläuft. Eine interessante Möglichkeit besteht darin, Komponisten danach einzuteilen, inwieweit ihre Musik schon aus den Noten selbst spricht, oder ob sie gleichsam erst hinter den Noten (und jenseits der Grenzen des Instruments) zu finden ist. Bei dieser sehr sinnvollen Einteilung treten, ganz von selbst, die Größten unter den Großen hervor: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, vielleicht noch Brahms, und lassen gleichzeitig den großen Abstand zu den anderen deutlich werden. Gemeint ist: Bei Mozart und Beethoven ergibt die genaue Ausführung des Textes noch lange keine Musik, eine Beethoven-Sonate kann selbst bei perfektester Exekution, wie Jürgen Uhde sagte, "stumm bleiben". Wer dagegen ein Werk von Scarlatti, Mendelssohn, Prokofieff, Bartok, Rachmaninoff usw. genau nach dem Notentext und seinen Anweisungen ausführt, hat damit wenigstens einen Teil der Musik schon erreicht. Dies gilt auch für Debussy und, etwas weniger, für Ravel. Claudio Arrau, heißt es, wurde einmal gefragt, ob ihm, Arrau, zu Ohren gekommen sei, wie wunderbar der Pianist X Debussy interpretiert habe, woraufhin Arrau geantwortet haben soll: "Haben Sie jemals einen Pianisten schlecht Debussy spielen hören!?" Damit ist ausgedrückt: Die Klänge Debussys sind für sich schon, wie sie geschrieben sind, so mundgerecht, süffig, ohne Rauheit, leicht verdaulich, dass damit auch ein durchschnittlicher Pianist, spielt er nur kultiviert und textgenau, angenehme Klänge hervorruft. Nicht umsonst haben Generationen von Barmusikern Debussys Klänge geplündert, nicht unbedingt zum Vorteil des Originals. Debussy wäre notfalls als Hintergrundmusik im Restaurant hinnehmbar, Beethoven nicht. Chopin - Liszt Eine im Vergleich zu Schubert oder Beethoven größere Unabhängigkeit von den klanglichen Fähigkeiten des Interpreten gilt auch für einen großen Komponisten, für Chopin. Chopins Klangvorstellung bewegt sich nur im Rahmen des Instruments Klavier. Chopin wollte Vollkommenheit, Vollkommenheit aber gibt es nur innerhalb definierter Grenzen, niemand kann auf allen Gebieten vollkommen sein. Deshalb denkt - 310 - Chopin gar nicht daran, die Grenzen des Klavierhorizonts zu überschreiten. "Seine Musik erwächst aus dem natürlichen Grunde des Klaviers" (Luis Kentner). Chopins Musik ist die mustergültigste Klaviermusik, die sich denken lässt, sie ist ganz auf den Klavierklang ausgelegt, auf andere Instrumente oder auf ein Orchester übertragen, verliert Chopins ornamentale Melodik ihren Zauber. Bemühen wir noch einmal den erwähnten guten, aber nicht übermäßig begabten, tüchtigen Pianisten: Er bringt die Oberstimme gut hervor, beherrscht mehr als nur einfache Grundlagen klanglicher Mischung, dosiert die Bässe gut gegenüber den übrigen Begleittönen, kann eine Mittelstimme nach Bedarf kurz hervor- und wieder zurücktreten lassen ... Bei so einem Pianisten klingen die Werke Chopins nicht ergreifend, aber erträglich, wenn nicht, wenigstens für den Laien, sogar angenehm, deshalb, weil Chopins ganz dem Klavierklang verhaftete Klangvorstellung dem Pianisten entgegenkommt, dessen Klangvorstellung ebenfalls nicht über das Klavier hinausgeht. Liszts Musik klingt unter den Händen des genannten tüchtigen Pianisten unerträglich. Für die Gestaltung seiner Werke sind die Anforderungen an den Interpreten, was die Fähigkeit zu klanglicher Schichtung und Mischung betrifft, ungleich höher, zum einen wegen des meist opulenteren Satzes, vor allem aber, weil Liszt nie das Klavier direkt meint. Liszt transzendiert den Klavierklang, das Klavier ist ihm nur - um Alfred Brendels Worte zu wiederholen - "das Objekt der Verwandlung, sei es in ein Orchester, sei es in die Elemente oder die Sphären." Luis Kentner bringt den Unterschied zwischen den beiden Genies auf den Punkt: "Chopin verlangte vom Klavier nur das, von dem er wusste, dass es möglich war, und er erreichte es immer. Auch Liszt wusste, was das Klavier konnte, aber er verwarf von vorneherein den Gedanken, dass es etwas gäbe, was das Klavier nicht könnte. Liszt verlangte alles, einschließlich des scheinbar Unmöglichen, und er erreichte es fast immer. Wenn Chopin noch, realistisch, im Sinne des Instruments komponierte, dann beugte Liszt, der Idealist, der Utopist, das Klavier seinem Willen." Das Instrument seinem Willen beugen! Eben darin besteht Liszts Gemeinsamkeit mit Beethoven ("Was schert mich seine elende Geige, wenn mich der Geist überkommt!?"). Anders als bei Chopin besteht bei Liszt die Kunst gerade darin, das Klavier vergessen zu machen. 1841 schreibt Heinrich Heine, nachdem er Liszt in Paris gehört hatte: "...bei Liszt denkt man nicht mehr an überwundene Schwierigkeiten, das Klavier verschwindet und es offenbart sich die Musik." Das heißt: Für Liszts Werke bedarf es eines Interpreten, dessen Klangvorstellung, wie die Liszts, weit über das Instrument Klavier hinausweist, also eines Interpreten bzw. einer Interpretin, die mit viel Phantasie ausgestattet sind. Phantasie aber ist, genauso wie Ausdruckswille und Temperament, eine musikalische Primärtugend, somit eine angeborene Gabe. Lassen Sie sich von esoterisch oder ideologisch umnebelten Pädagogen - "Jeder ist begabt!", "In jedem Menschen - 311 - schlummert der göttliche Funke!" - nichts anderes einreden. Zu sagen: Franz Liszt war nicht eigentlich ein Klavierkomponist, mag als Aussage über den größten aller Pianisten zunächst verstörend klingen. Und dennoch ist es so. Es genügt, die Noten anzusehen: Bei Chopin blicken wir immer auf einen meist luziden, typischen Klaviersatz. Betrachten wir Liszts Klavierwerke, dann sieht das beim ihm häufig gar nicht nach einer Klavierkomposition aus, sondern lässt eher an eine Orchesterreduktion denken, und das oft gerade bei vielen seiner größten Werke, etwa dem großartigen Valleé d’Obermann. Am Flügel erweisen sich gerade die Bewegungsformen als Prüfstein künstlerischer Güte, die nicht eigentlich typische Klavierfiguren sind. Ein solcher Prüfstein ist die großartige Etüde Chasse neige (Bsp.298). Allein die Hände des Interpreten entscheiden, ob es nach Klavier klingt oder elektrisierendes Flirren spürbar wird. Bsp.298 zu Bsp.298: Für die Tremoli darf nur der halbe Tastenweg genutzt werden, daher sind sie ganz in der Taste, vom Auslösepunkt aus zu spielen; die Tasten sollten möglichst nie bis ganz nach oben zur Ausgangslage zurückkommen. Die Rede ist von Liszts Vorliebe für das Tremolo (tremare - zittern). Das Tremolo ist der Orchestersprache entlehnt, ist untypisch für den Klaviersatz. Mit bebenden, extrem schnellen Wiederholungen eines Tones oder Intervalls, meist ausgeführt von den Streichern, zeigen Tremoli eine dramatische Verdichtung an. Dabei müssen wir den zuvor ausgeklammerten Rhythmus wieder mit einbeziehen, denn seine Lebendigkeit bezieht ein Tremolo sowohl aus einem ständigen Oszillieren - 312 - der Lautstärke, als auch durch den ständigen Wechsel zwischen rhythmischer Verdichtung und Lockerung. Lebendigkeit bedeutet immer, dass sich ständig alles ändert. Ein Tremolo, das nur mechanische Bewegung auf der Tastatur ist, sich zudringlich als Hin-und Her-Bewegen von Klaviertönen ins Ohr setzt, ein solches Tremolo ist nur Belästigung. Richtig gestaltet aber kann ein Tremolo sehr viel ausdrücken: Dämonie, Verklärung, Bedrohung, Geistererscheinung, Vision, Naturgewalt usw. Die leidenschaftliche Frömmigkeit der zweiten Franziskus-Legende kann zutiefst ergreifen oder sie entartet zu Bombast, der Schluss der "Les jeux d`eaux à la villa d`Este" ist Vision und Verklärung oder wirkt wie alberne Schlittenglöckchen. Der Grat ist schmal. Der Pianist, der zuvorderst die pianistische Wirkung sucht, nicht hinter die Noten schauen kann, beschädigt Chopins Werke, die Liszts richtet er zugrunde. Franz Liszt hat als Komponist nicht den Rang eines Mozart, Schubert oder Beethoven, mit diesen gemeinsam aber ist ihm die extreme Interpretenabhängigkeit. Über Liszt selbst täusche man sich nicht. Außer in einigen, eigens für den virtuosen Effekt geschriebenen Stücken (Grand Galop Chromatique) ging es ihm eher selten darum, Klaviereffekte hervorzubringen, also zu zeigen, was das Klavier leisten kann und der Pianist auf ihm. Immer steht die Technik im Dienste einer poetischen Idee. Emanuel v. Geibel berichtet über die vier Konzerte, die Liszt 1843 im Münchner Odeon gab - im ersten Konzert war König Ludwig I. mit seinem ganzen Hofstaat anwesend - : "Er ist durch und durch Poet, und die poetische Auffassung, nicht die technische Fertigkeit ist es, was die Menge unbewußt bezaubert." Chopins Gefäß der Genialität ist voll, Liszts Gefäß ist nicht ganz gefüllt und es finden sich darin auch unbedeutende Redseligkeiten, aber es ist - ohne Zweifel - ein viel größeres Gefäß. Lehrbarkeit - Erlernbarkeit Lebendigkeit, hieß es, verlange ständige Änderung. Ein Tremolo, das fesselt, nicht nur nach Klavier schmeckt, wechselt stetig seine Lautstärke, meist unauffällig, kaum merklich, manchmal jäh und eruptiv; soll die Musik geisterhaft einhüllen, muss das Tremolo ganz tief in den Tasten verbleiben, darf bei keiner Bewegung mehr als den halben Tastenweg zurücklegen. Solche entmechanisierten pp-Tremoli sind, zumal in tiefer Lage, eine schwierige künstlerische (und technische) Herausforderung. In Liszts Nuages gris (1881) sind die Oktav-Tremoli im Bass naturhaft dunkles Raunen, wer hörbar geschüttelte Oktaven produziert, hat das Stück schon verschenkt. Und rhythmisch bedarf ein Tremolo ständiger Wechsel zwischen Verdichtung und Auseinanderziehen. Nur: Wie und wann und wo und in welchem Maße diese Änderungen zu erfolgen - 313 - haben, entzieht sich der Beschreibung genauso, wie es keine präzisen Hinweise darüber geben kann, wann, wo, wie stark welche Töne in einem Geflecht mehrerer Stimmen hervortreten oder abtauchen müssen, damit lebendige Szenen aus Licht und Schatten entstehen. Die vorangegangenen Kapitel enthielten detaillierte Hinweise zur Ausführungen der angeführten Beispiele. Einige der Beispiele gerade in den ersten fünf, schon vor Jahren geschriebenen Kapiteln sind mit Kommentaren überfrachtet (was ich heute bedauere), dennoch kann, wer sich die Zeit nimmt und auf diese Kommentare eingeht, aus ihnen einen konkreten interpretatorischen Nutzen ziehen. Deshalb befinde ich mich in einer gewissen Verlegenheit, weil dieses Kapitel über den Klang - mit all seinen Auswirkungen: Spannung, Atmosphäre, Faszination, Lebendigkeit - mangels Beschreibbarkeit eher nur allgemeine Hinweise geben konnte. Ich darf auf das neunte Kapitel verweisen. Im Zusammenhang mit forte-pianoWirkungen und der Verklingdauer von Akkorden sind dort in etlichen Beispielen die nötigen Lautstärkenmischungen so konkret beschrieben, wie dies eben auf Papier möglich ist. Konkreten Nutzen (und eine große Ersparnis an Worten) dagegen bringt ein Lehrer, der seinen Schülern am Flügel auch etwas zeigen kann, gute Lautstärkenmischungen (= schöne Klänge) wirklich hörbar werden lässt. Ein guter Lehrer redet nicht nur, er setzt sich hin, wenigstens manchmal, und macht vor, wie es geht, wie es klingen soll. Aber auch mit einem Lehrer, der gut am Flügel demonstriert, bleiben grundsätzliche Zweifel, was die Vermittelbarkeit musikalischer Primärtugenden betrifft, zu denen Klangsinn und, generell, ein Gespür für all das gehören, was über das nur Sehr-gutKlavierhafte hinausgeht und nicht direkt aus den Noten selbst zu uns spricht. Phantasie, Ausdruckswille, Temperament sind zudem eng an das Körperempfinden gekoppelt. Ein Gradmesser für Begabung ist auch, inwieweit jemand die Musik nicht nur als akustisches Ereignis wahrnimmt sondern mit dem ganzen Körper: Musikalische und körperliche Spannung - eine Binsenweisheit! - sind eins, Tremolo oder Triller sind nicht nur schnelles Hin-und her-Bewegen von Tönen sondern Äußerungen inneren Vibrierens, genauso wie ein sforzato ein Ruck durch den Körper ist und nicht nur ein akustisches Signal. Anmerkung: Man darf dabei nicht den sehr häufigen Fehler begehen und von musikalischen Gaben auf Charaktereigenschaften schließen. Der extrovertierte, temperamentvolle Mensch ist nicht unbedingt der, der auch temperamentvoll spielt, und der Ruhige, in sich Gekehrte kann auf der Bühne in leidenschaftlichem Ausdruck explodieren. Völlig willkürlich sind beliebte Verknüpfungen wie: Wer so wunderbare Musik macht (schreibt), muss auch ein edler, guter Mensch sein. Man fällt immer auf die Nase, will man der Natur menschliche Wertvorstellungen aufdrücken. Nichts ist ihr gleichgültiger. Musikalische Sekundärtugenden machen den tüchtigen Musiker aus. Es sind: Fleiß, Konzentration, Geschick im Blattspiel, Gespür für Maß und Proportion, Ensemble- - 314 - Fähigkeit, sicheres Bestimmen von Intervallen, Geschmack, Stilsicherheit. Diese Sekundärtugenden sind hoch zu achten, aber man hat es mit ihnen leichter, sie sind trainierbar, so auch das Gehör (Intervalle, Hören von Harmoniefunktionen), wenngleich der Aufwand dafür sehr davon abhängt, in welchem Alter mit dem Training begonnen wird. Realtiv leicht zu vermitteln sind Eigenschaften wie Geschmack und Stilsicherheit. Auch einem nicht sonderlich begabten Schüler lässt sich beibringen, eine Haydn-Sonate kultiviert und richtig nach den gängigen Stil-Regeln vorzutragen. Aber ob die Musik auch unter Strom steht, ob die Noten wirklich klingen, darüber entscheiden Primärtugenden, also Temperament und Phantasie. Dass solche Primärtugenden angeboren sind, wird nach wie vor von vielen bestritten. Sehr beliebt unter Pädagogen und Kinderpsychologen ist das schöne Bild von der Pflanze, deren Gedeihen ja davon abhänge, in welchen Boden sie gesetzt wird. Nur: Die Pflanze ist stationär, kann den karstigen Boden nicht verlassen. In den 70-er-Jahren, der Zeit der Studentenbewegung, war in der Geisteswelt und unter den Intellektuellen der Glaube an angeborene Gaben - man kann es nicht anders nennen: verboten. Alles musste von Umwelt und Erziehung herrühren. Der unantastbare Glaubenssatz hieß: Der Mensch ist nicht begabt, er wird begabt. Der Grund, warum es keine angeborenen Talente geben durfte, liegt auf der Hand: Die Gesellschaft, die Menschen können nur umerzogen werden, wenn die Eigenschaften erworben, nicht aber, wenn sie von der Natur eingepflanzt sind. Diese Haltung hat, auf unerträgliche Weise, inquisitorisch und reglementierend auch Einfluss auf Wissenschaft und Forschung genommen. Es ist die alte Geschichte: Den Visionen von Ideologen und Priesterinnen, wie der Mensch sein sollte, hat sich die Natur zu beugen. Die Engstirnigkeit der 68-er-Generation, meiner Generation, lebt weiter, unter anderem in einer Pädagogik, die natürliche Schwächen und Unterschiede zu medizinischen Diagnosen umdeutet und nicht begreifen will, dass es keine guten Schüler geben kann ohne schlechte. Für die Musik jedenfalls gilt: Man braucht keine jahrzehntelange Erfahrung als Hochschullehrer, wenige Jahre genügen, um zu erkennen, wie entschieden die Natur ihre Stempel setzt, unabhängig von Herkunft und Erziehung. (Sa, 10.10.2015)