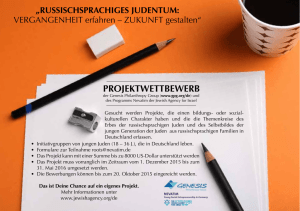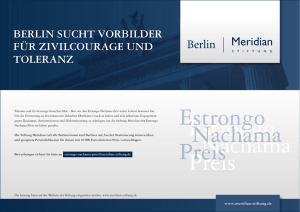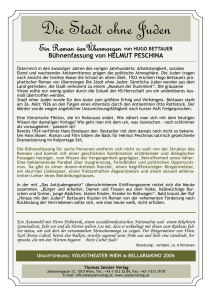Es gibt auf dieser Welt keine endgültige Sicherheit
Werbung

12 | B E R L I N E R G E S P R Ä C H E LEBENSHILFE-ZEITUNG 1/2015 In unserer LHZ-Serie „Berliner Gespräche“ führen ReporterTandems, ein Mensch mit, einer ohne Behinderung, gemeinsame Interviews. Die Interview-Partner kommen aus der Politik, der Wirtschaft, aus der Kultur oder dem Sport. Für diese Kooperation hat die LHZ Schauspieler aus dem integrativen Theater Thikwa in Dieses Mal sprachen wir mit Andreas Nachama. Er leitet ein großes Museum in Berlin. Dort werden die schrecklichen Taten der Nazis gezeigt. Berlin gewonnen. Dazu gehören Peter Pankow (von links), Nico Altmann, Katharina Maasberg, Torsten Holzapfel, Anne-Sophie Mosch, Robert Janning und Martina Nitz. Wir bereiten die Gespräche immer in der Gruppe vor. Zunächst holen wir Informationen aus dem Internet, dann überlegen wir uns die Fragen. „Es gibt auf dieser Welt keine endgültige Sicherheit“ Herr Nachama, Sie sind ein vielbeschäftigter Mensch. Als Jude dürfen Sie am Sabbat – also von Freitagabend bis Samstagabend – nicht arbeiten. Halten Sie sich daran? Ja, schon. Ich arbeite zwar am Sabbat als Rabbiner, aber das ist heilige Arbeit und damit erlaubt. Ich mache eben nichts von der Arbeit, die ich unter der Woche für die Topographie erledige. Juden sollen ja nur koschere Speisen und Getränke zu sich nehmen? Was bedeutet „koscher“ eigentlich? Koscher bedeutet wörtlich „rein“. Die Bibel nennt uns Tiere, die nicht koscher sind, zum Beispiel Schweine oder Fische ohne Schuppen und Flossen wie der Aal. Diese Tiere essen wir Juden grundsätzlich nicht. Für anderes Fleisch gibt es ein Verfahren, das Rabbiner bereits vor mehr als 2000 Jahren anwandten. Das ist eine Art Fleischbeschau, wie wir es heute von den Gesundheitsämtern kennen. Für mich ist daher Rindfleisch aus dem Supermarkt völlig okay. Das esse ich. Ich versuche aber, meinen Fleischkonsum auf etwa einmal pro Woche zu beschränken. Viele Juden sind sogar Vegetarier. Könnten Sie uns Ihr Lieblingsgericht verraten? Spaghetti oder andere Nudeln mit vegetarischen Soßen, sehr gerne auch mit Lachs. Foto: Peer Brocke Der gebürtige Berliner Andreas Nachama (Jahrgang 1951) ist Rabbiner, Historiker und Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Mit über einer Million Besuchern Sie sind Rabbiner. Was genau macht ht ein Rabbiner? Das ist die jüdische Ausgabe eines Pfarrers. Er betreut und leitet eine Gemeinde und predigt im Gottesdienst. Wie ein evangelischer Pfarrer darf ein Rabbiner heiraten und muss nicht wie die katholischen Kirchenmänner im Zölibat leben. Sprechen Sie hebräisch und jiddisch? Jiddisch verstehe ich, aber ich spreche es nicht. Hebräisch ist die Gottesdienstsprache – die kann ich schon ganz gut. Wie haben Sie das geteilte Berlin empfunden und dann den Mauerfall 1989 erlebt? Ich bin ja Westberliner. Jede Reise über die Transitstrecke nach Westdeutschland war ein kleines Abenteuer: die Kontrollen unterwegs, das lange Warten an der Grenze ... Hätte mich jemand ein Jahr vor dem Mauerfall gefragt, ob ich die Wiedervereinigung noch erleben werde, so hätte ich das ganz klar verneint. Es war wie ein Wunder – die Mauer fiel ohne Krieg und Tote. Das gibt mir Hoffnung, dass sich diese konfliktreiche Welt doch noch zum Frieden hin entwickelt. Immer wieder morden Menschen wegen ihrer Religion – von den Kreuzzügen bis zum Islamischen allein im Jahr 2013 gehört das Dokumentationszentrum zu den meist besuchten Erinnerungsorten in Berlin. Dort befanden sich während der Nazi-Zeit die Zentralen der Gestapo, der SS und des Reichssicherheitshauptamts. Torsten Holzapfel (links) vom Theater Thikwa unterhielt sich mit Andreas Nachama über seine Erfahrungen. Staat. Auch Israel findet keinen Frieden mit Palästina. Was muss geschehen, damit dort die Mauern in den Köpfen verschwinden? Damit sich die Situation radikal verändert? Das weiß ich leider auch nicht. Da bin ich fast so mutlos wie damals vor dem Mauerfall. Wir können nur hoffen, dass jemand den Hebel umlegt und die Spirale der Gewalt unterbricht. Jemand wie der Friedensnobelpreisträger Muhammad Anwar as-Sadat, der frühere ägyptische Staatspräsident, der 1979 mit Israel einen Friedensvertrag schloss. Machen Ihnen die Terroranschläge von Paris Angst? Auch Juden gehören ja zu den Opfern. Ich selbst habe keine Angst. Es gibt auf dieser Welt keine endgültige Sicherheit, für niemanden. Menschliches Leben liegt in der Hand Gottes. Reden Sie viel mit anderen Kirchen, mit Andersgläubigen? Es gibt Beziehungen zwischen der evangelischen Kirchengemeinde in Dahlem und meiner Synagoge. Alle 14 Tage haben wir einen Arbeitskreis und lesen gemeinsam die Bibel. Es ist schon interessant, wie unterschiedlich Christen und Juden ein und denselben Text verstehen. Zu Muslimen besteht weniger Kontakt. Früher waren wir in Zehlendorf, dort gibt es keine muslimische Gemeinde. Jetzt sind wir in Charlottenburg, da sind die Voraussetzungen für eine Kontaktaufnahme besser. In der Stiftung Topographie des Terrors beschäftigen Sie sich mit den schrecklichen Verbrechen der Nazis. War auch Ihre Familie betroffen? Mein Vater war in Auschwitz und hat überlebt. Meine Mutter wurde in Berlin versteckt – von der nichtjüdischen Frau des jüdischen Kaufhausbesitzers Wertheim. Nach dem Krieg war sie so eine Art Nenntante für mich und berichtete manchmal von gemeinsamen Erlebnissen mit meiner Mutter. Meine Eltern jedoch haben nie viel aus dieser Zeit erzählt. Wurden Sie selbst schon von Neonazis angegangen? Nein. Unser Theater heißt Thikwa. Das ist hebräisch und bedeutet Hoffnung. Wir arbeiten immer wieder mit israelischen Künstlern zusammen, auch zur Eröffnung des Jüdischen Museums in Berlin sind wir aufgetreten. Fühlen sich Juden heute in Berlin und Deutschland willkommen? Ja, sie fühlen sich willkommen. Das kann ich für mich und meine Gemeinde sagen. Es gab auch eine Abstimmung mit den Füßen: Ende der 1980er-Jahre kamen sehr viele Juden aus Russland nach Deutschland, und etwa 10 000 Israelis sind heute in Berlin gemeldet. Im Stück „Schillers Schreibtisch“ beschäftigen wir uns mit schwierigen Themen wie der „Euthanasie“. Sie selbst haben sich mit der Lebenshilfe und anderen für eine neue Gedenkstätte eingesetzt, die in der Berliner Tiergartenstraße an die behinderten Opfer der Nazi-Zeit erinnert. Sind wir Menschen mit Behinderung heute ausreichend geschützt vor „Euthanasie“? Ich gehe davon aus, dass in Deutschland „Euthanasie“ nicht mehr möglich ist. Doch schon für Europa wäre ich mir da nicht mehr sicher. Es droht dort Gefahr, wo – wie bei der aktiven Sterbehilfe – die Tötung auf Wunsch erlaubt ist. Das menschliche Leben muss aber tabu sein, ich bin deshalb auch gegen die Todesstrafe. Man darf niemanden töten, aber man soll seine Schmerzen durch Me- dikamente lindern können. Nur in diesem Fall darf man in Kauf nehmen, dass solche Medikamente das Leben verkürzen. Haben Sie darüber hinaus regelmäßig Kontakt mit behinderten Menschen? In der Topographie sind wir gerade mit den Verbänden der gehörlosen und sehbehinderten Menschen im Austausch. Wir wollen unsere Ausstellung inklusiver machen, zum Beispiel durch Videos in Gebärdensprache und mit einem Hörspiel für blinde Menschen. Wir bieten auch Führungen in leichter Sprache an – für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder solche, die nicht so gut Deutsch verstehen. Haben Sie noch Zeit für ein Hobby, gehen Sie zum Beispiel gerne ins Theater? Ich gehe öfter ins Konzert als ins Theater, manchmal auch in die Oper. Ich mag klassische Musik. Ich singe sehr gerne alte Berliner Lieder. Könnten Sie sich als Ur-Berliner vorstellen, dass wir einmal zusammen ein Lied singen? Da muss ich leider passen. Abgesehen vom Gottesdienst ist Singen nicht meine Welt.