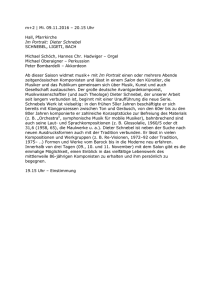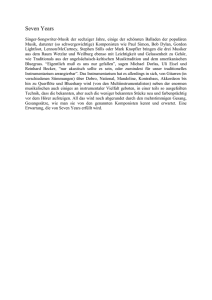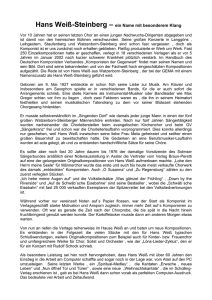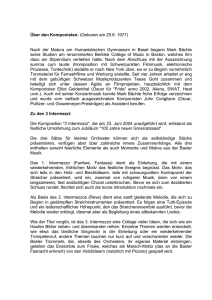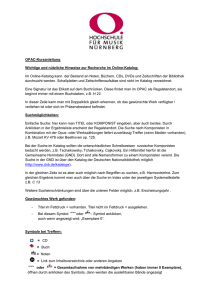«Gilt es doch, sich ein Wissen von sehr vielen
Werbung

16. Einspielung Über die «Gilt es doch, sich ein Wissen von sehr vielen Dingen anzueignen, ohne dass die bloße Wortgewandtheit leer und lächerlich erscheint, der Rede selbst nicht nur durch die Auswahl der Worte, sondern auch durch ihre Fügung die rechte Form zu geben und alle Regungen des Herzens, die die Natur den Menschen gab, genau zu untersuchen; denn alle Wirkung und Methode der Redekunst hat sich in der Besänftigung oder Erregung der Zuhörer zu erweisen. Dazu gehört noch ein gewisser Charme und Witz, Bildung, die eines freien Mannes würdig ist, sowie Schlagfertigkeit und Kürze bei Erwiderungen und Attacken, mit der sich feine Anmut und Eleganz verbindet.» Marcus Tullius Cicero, De oratore/Über den Redner, hrsg. von Harald Merklin, Reclam Stuttgart 1976, S. 51 Angemessen— Neue Musik im Spiegel Natürlich kann man eine Xenakis-Aufführung mit dem gleichen Sprachsound wie eine Beethoven-Sinfonie beschreiben, ja sogar mit den gleichen Worten. Auf einer gewissen abstrakten Ebene der Darstellung könnte man das auch als Spiel betreiben: Was habe ich gerade dargestellt? Ein Rockkonzert, einen Auftritt der musikFabrik oder des Ensemble Modern oder doch einen »typischen« Philharmonie-Besuch? Genau das ist aber nicht gewünscht – zunächst einmal von den Künstlern selbst, präziser: den der Avantgarde zugerechneten, sich selbst zurechnenden. Denn die Neue Musik definiert sich – zum einen durch ihre Geschichte, ihre Kämpfe um Anerkennung, zum anderen, und das ist wesentlicher als die historische Haltung, über ihren Materialbegriff – in Abgrenzung zur Tradition. Zwar hat sich etwa Pierre Boulez als Dirigent und Programmmacher verstärkt um die Tradition bemüht, aber eben unter radikal gegenwärtigem Blickwinkel: Die Neue Musik ist der Schlüssel zur Musikgeschichte, nicht umgekehrt. Man kann also die gleiche Sprache verwenden und würde eben dadurch den ikonoklastischen oder auch ent-ideologisierenden Anspruch der Neuen Musik betrügen. Sprachlich, genauer: über die Mittel der journalistischen Rezeption, würde man Neue Musik wieder eingemeinden, den fundamentalen Unterschied, der sie von der Tradition und mehr noch: von der Pop-Kultur und der sie hervorbringenden Kulturindustrie trennt, einebnen. Zwei radikale Folgerungen 1. Man sollte kann man daraus ableiten: Neue Musik nur nach ihren eigenen Maßstäben beurteilen. Das setzt auf der Seite der Schreibenden einen gewisssen Standard an technischen Begriffen voraus und eine Kenntnis der Geschichte (dieser Techniken). Stil, Gestus, Dringlichkeit der Sprache – sie wären zweitrangig, verschwänden hinter der möglichst korrekten Beschreibung und Einordnung und blieben dem abschließenden Urteil – der Kür – vorbehalten. 2. Man muss eine Sprache finden, die der Radikalität der Neuen Musik entspricht. Eine Sprache, die die musikspezifische Radikalität in ihr eigenes Idiom übersetzt. Technische Kenntnisse, historische —heit von Felix Klopotek der Sprache Korrektheit – sie wären zweitrangig, verschwänden hinter der Souveränität der Urteils. Beispiele für den zweiten Schluss gibt es, und es sind nicht selten Komponisten, die dazu in der Lage sind. Man denke an Dieter Schnebel, der als Schriftsteller und Journalist mindestens ebenso großartig wie als Komponist ist (und der natürlich über den höchsten Standard musikalischer Begriffe verfügt, sein Wissen aber nie überlegen ausspielt, sondern immer nur so viel einsetzt, dass der Leser nicht überrumpelt wird). Man denke aber auch an die Poeme John Cages, die folgerichtig Ernst Jandl ins Deutsche übertragen hat. In der Praxis findet man diese beiden Formen dieses prinzipiell angemessenen Schreibens über Neue Musik kaum in Reinform vor. Häufig gibt es Mischformen zwischen den beiden Formen, das wäre dann der feuilletonistische Plauderton (muss nicht per se schlecht sein), meistens mischt sich aber noch ein weiteres Element hinzu: eines, das jenseits der Musik liegenden Zwängen unterliegt. Diese liegen zum einen im journalistischen Tagesgeschäft (redaktionelles Spar- tendenken, zunehmende Ignoranz gegenüber voraussetzungsvollen Themen etc.), zum anderen im Betrieb der Neuen Musik selbst. Denn selbstverständlich bewegen sich die Protagonisten der Neuen Musik in einem künstlerisch-sozialen Umfeld, ist ihre Musikerexistenz nicht getrennt von Vermittlern (Konzertveranstaltern, Musikologen, Beamten der städtischen Kulturbürokratie, Mäzenen) zu verstehen. Innerhalb dieses Geflechts verselbstständigen sich Idiome, entstehen Empfindlichkeiten, nicht mehr zu hinterfragende Gesten. Das ist alles kein Drama und wohl unvermeidlich, es trifft generell auf alle «Szenen» zu. Problematisch wird es dann, wenn mit der Ausbildung einer Szene, die ja ganz wesentlich zur Stabilität prekärer Künstlerexistenzen beiträgt, eben das, weswegen sie sich in diesem spezifischen Fall überhaupt gebildet hat, nämlich die Radikalität des musikalischen Ausdrucks, verschüttgeht. Oder: Zunehmend hermetisch verkapselt geriert und sich ganz auf die eigene Szene beschränkt, die in der Lage ist, die musikalische Sprache für sich zu dechiffrieren. 16. Einspielung Solche Selbstbezüglichkeiten oder meinetwegen InzestPhänomene sind nicht auf die Szene der Neuen Musik beschränkt, sondern dürften in allen musikalischen Subkulturen vorkommen. Die meisten Szenen sind aber größer, sodass es auf der Seite der Rezipienten für Quereinsteiger leichter ist, sich zu profilieren. Aber – und das ist interessanter: sie sind nicht dermaßen kanonisiert. Der Kanon der Neuen Musik ist immer noch auf einen überschaubaren Kreis herausragender Komponisten beschränkt. Diese Komponisten haben zudem an ihrer eigenen Kanonisierung maßgeblich mitgearbeitet, was aus ihrer Sicht legitim ist. Heute gilt die Epoche, in der die Neue Musik sich konsequent dem Sozialen und Politischen öffnete und somit auch die Rolle des Komponistenübervaters in Frage stellte, bloß noch als Episode. In den 1960er Jahren entwickelte sich aus der Dekonstruktion des Serialismus und der konsequenten Weiterführung der Cage’schen Indeterminismus-Ästhetik eine Bewegung, die auf die konkrete Selbstaufhebung des Komponisten hinauslief. Eine Bewegung, die sich an andere Kunstformen koppelte – Fluxus, Straßenund Improvisationstheater, Beatpoesie, Free Jazz – und die vor allem politisch aufgeladen war. Pierre Boulez wollte die Opernhäuser in die Luft jagen, Dieter Schnebel konzipierte Musik resp. Aufführungspraktiken für Nicht-Musiker, das Londoner Scratch Orchestra verstand sich als eine komponierende und musizierende Volkskommune, selbst Karlheinz Stockhausen dachte Ende der 1960er Jahre ernsthaft daran, die unter seinem Autorennamen firmierenden, aber de facto improvisierten Konzepte «seines» Ensembles der GEMA als Kollektivkompositionen zu melden. Es ist überhaupt keine Frage, dass in diesen Jahren sich auch das Schreiben über Neue Musik änderte und sich ebenfalls öffnete: John Cage wird ins Deutsche übersetzt, Schnebel legt einen seiner wichtigsten Textbände vor (Denkbare Musik), Heinz-Klaus Metzger avanciert zum wichtigen Kritiker, in der Reihe Hanser erscheinen die Ulrich Dibelius herausgegebenen Bände Herausforderung Schönberg, Verwaltete Musik und Musik auf der Flucht vor sich selbst, Mauricio Kagel oder Konrad Boehmer legen markante, provokante Statements vor. Weitere Beispiele ließen sich leicht finden. Das Schreiben über Neue Musik wird in dem Moment spannend, wo es «um etwas geht», wo die Musik mehr sein will als eine gelungene Aufführung und die maßvolle Weiterentwicklung einer bestimmten Tradition. Dieser Funke springt auf die Re- zipienten über, denen bewusst wird, dass dieser Sprung mit dem herkömmlichen Vokabular nicht mehr einzuholen ist. Das Schreiben änderte sich, weil sich die musikalische Praxis geändert hatte. Wie gesagt, die Epoche gilt heute als Zwischenspiel, und die Vergötterung des genialen Komponisten ist in den Jahrzehnten nach «1968» vielleicht sogar noch angewachsen, das darf man schon restaurativ nennen. Wahrscheinlich würde bereits die Hinterfragung des gängigen Neue-Musik-Kanons dazu führen, dass man als Autor und Journalist nicht mehr auf das immergleiche (ggf. vom Meister auch noch sanktionierte) Vokabular zurückgreifen kann. Andererseits wäre es schlicht absurd, von heute arbeitenden Komponisten zu verlangen, «1968» zu wiederholen, zumal es vor vierzig Jahren böseste Verirrungen gab (erinnert sei an den bizarren Maoismus albanischer Prägung, dem Cornelius Cardew, einst die treibende Kraft hinter dem Scratch Orchestra, schließlich huldigte!). Aber es hilft dem Schreibenden, sich klar zu machen, dass Neue Musik nicht im luftleeren Raum gedacht, geschrieben, gespielt wird; dass auch die Kunst der größten Innovatoren einen Moment in einer bestimmten ästhetisch-gesellschaftlichen Bewegung darstellt; schließlich: dass sich Neue Musik über Tabubrüche und Grenzüberschreitungen konstituiert hat, und dass sich diese konstruktiv-zerstörerische Kraft auch im Schreiben widerspiegeln sollte. Netzwerk Neue Musik Medienpartner Zum Thema «Do it yourself» im Online-Magazin D sounds ab August auf: www.netzwerkneuemusik.de