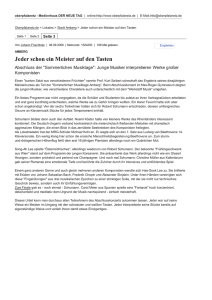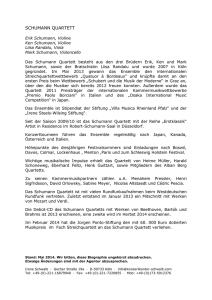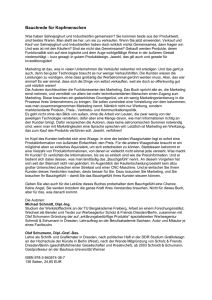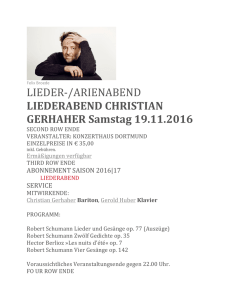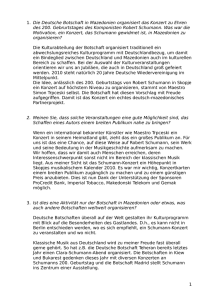114
Werbung

Heinz von Loesch EINE VERKANNTE QUELLE DER FRÜHEN SCHUMANNREZEPTION Die Briefe Robert Emil Bockmühls im Spiegel von Rezeption und Werkanalyse des Cellokonzerts HEINZ VON LOESCH I Dem Umstand, daß Robert Schumann ein gutes Jahr nach Fertigstellung seines Cellokonzerts den Frankfurter Cellisten Robert Emil Bockmühl (1820– 1881) um die Uraufführung des Werkes ersuchte und mit der Fingersatz- und Strichbezeichnung für die anstehende Drucklegung betraute, haben wir ein Konvolut von Briefen seltenen Umfangs zu einer einzigen Komposition zu verdanken. In einem Zeitraum von über zwei Jahren richtete Bockmühl nicht weniger als 26 Briefe1 an Schumann, in denen er sich ausführlich und zum Teil höchst kritisch über das Cellokonzert und die Möglichkeit seiner Aufführung äußert (die sechs Antwortschreiben Schumanns waren bislang nicht aufzufinden). Aus den Briefen Bockmühls zitierte bereits Wolfgang Boetticher in seiner Schumann-Monographie aus dem Jahre 19412, allerdings nur in einer kleinen Auswahl und nicht immer ganz richtig (Bockmühls Handschrift ist schwer lesbar). In ausführlicherer Form waren die Briefe Gegenstand des Referats von Joachim Draheim auf dem Düsseldorfer Schumann-Kongreß im Jahre 1988 über Schumann in Düsseldorf3. 1 Erhalten in der sogenannten Correspondenz, einer Sammlung der an Schumann gerichteten Briefe, heute in der Biblioteka Jagielloøska, Krakau. 2 W. Boetticher, Robert Schumann. Einführung in Persönlichkeit und Werk, Berlin 1941 (= Festschrift zur 130. Wiederkehr des Geburtstages von Robert Schumann). 3 J. Draheim, Das Cellokonzert a-Moll op. 129 von Robert Schumann: neue Quellen und Materialien, in: Schumann in Düsseldorf. Werke – Texte – Interpretationen. Bericht über das 3. Internationale Schumann-Symposion am 15. und 16. Juni 1988 im Rahmen des Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption Draheim stellt Bockmühl als einen widersprüchlichen, wenn nicht launischen Charakter dar, als „geschwätzig“, „unverschämt“ und „anmaßend“ sowie als einen Mann von „konservativem und eher beschränktem Geschmack“4. Und die Briefe erscheinen lediglich als Dokument einer zufälligen und irregeleiteten Rezeption, als Dokument einzig der Verkennung eines musikalischen „Meisterwerks“. Sympathie für Bockmühl zu empfinden, fällt in der Tat schwer, entzog er sich doch in letzter Instanz, welche allein wirkungsgeschichtlich zählt, und unter zum Teil höchst fadenscheinigen Gründen seiner ursprünglichen Uraufführungszusage. Während er somit wesentlich dazu beitrug, einem der bedeutendsten, wenn nicht dem bedeutendsten Cellokonzert seiner Zeit den Zugang zur musikalischen Öffentlichkeit zu versperren, genierte er sich offenbar nicht, sein eigenes Cellokonzert in A-Dur op. 66 öffentlich zu Gehör zu bringen, ein Werk, welches nach dem Notenbild alles andere als eine gelungene Komposition genannt zu werden verdient. Dennoch ist Draheims negative Darstellung des Frankfurter Cellisten und seiner Schumann-Kritik vorschnell. Die Widersprüchlichkeit der Aussagen Bockmühls und sein Zaudern, das Cellokonzert öffentlich vorzutragen, braucht nicht auf einem launischen Charakter zu beruhen, sondern kann durchaus als die höchst verständliche und keinesfalls unsympathische Unsicherheit im Werturteil über ein neues Kunstwerk aufgefaßt werden, dessen ästhetischer und geschichtlicher Stellenwert noch nicht bestimmt war. Und daß ein Cellist angesichts der für den damaligen Stand der Cellotechnik wirklich horrenden Schwierigkeiten vor einer öffentlichen Aufführung immer wieder zurückschreckte, hat nach mehr als einhundert Jahren keine Geringschätzung verdient. Bei dem Vorwurf der Anmaßung und Unverschämtheit aber handelt es sich um moralische und nicht um ästhetische Kategorien. Daß einem Cellisten und Komponisten vom Range Bockmühls eine Kritik an Schumann nicht „zustand“, besagt noch nichts über die Triftigkeit ihres Sachgehalts. Gerade was den Sachgehalt angeht, ist die Kritik jedoch bedeutsam. Einerseits spiegelt sie die Erwartungshaltung und das Urteil einer ganzen Epoche. Ihr wurde von der Schumann-Rezeption fast ausnahmslos entsprochen. Damit aber ist sie nichts weniger als das lediglich private und zufällige Urteil eines einzelnen Cellisten, sondern ein rezeptionsgeschichtliches Dokument von eminenter Bedeutung. Andererseits enthalten die Briefe eine Reihe von Beobachtungen, die noch heute Gültigkeit haben, auch wenn wir einzelne Aspekte der Kritik und zumal ihr Fazit nicht teilen: etwa den Vorschlag, den gesamten Finalsatz durch einen neuen zu ersetzen, oder gar die Konsequenz, das Werk überhaupt nicht aufzuführen. 3. Schumann-Festes, Düsseldorf, hrsg. v. B. R. Appel, Mainz usw. 1993 (= Schumann Forschungen, Bd. 3), S. 249–264. 4 Ebenda, S. 251, 252, 255 und 262. Heinz von Loesch Bockmühls Kritik erscheint insgesamt also keinesfalls als Ausweis mangelnder musikalischer Bildung, lediglich eines „konservativen und eher beschränkten Geschmacks“, und auch nicht als Dokument allein einer irregeleiteten Rezeption, sondern als lehrreiche und differenzierte Kompositionskritik, die mehr als ein bloß historisches Interesse verdient. Sie hat den Vorzug, dem Werk noch gewissermaßen „unvorbelastet“ gegenüberzustehen. Ihr waren Einsichten möglich, die uns heute, aufgewachsen in dem sicheren Bewußtsein vom Schumann-Konzert als einem „Meisterwerk der Musik“ und dem Kairos des romantischen Cellokonzerts, zu entgehen drohen. Wer den Vorwurf der „Unverschämtheit“ oder „Anmaßung“ erhebt, sollte bedenken, daß nur ihr die Kritik zu verdanken ist. Und wer „Geschwätzigkeit“ beklagt, darf nicht vergessen, daß darin eine wesentliche Voraussetzung für die Breite und Differenziertheit der Kritik gelegen hat. Nun gilt es zunächst, die Kritik Bockmühls und seiner Frankfurter Kollegen, die bei verschiedenen Zusammenkünften das Konzert spielten und diskutierten, darzustellen. Im Anschluß soll ihre Geltung sowohl für die ältere Schumann-Rezeption als auch für ein Werturteil aus heutiger Sicht aufgezeigt und gewürdigt werden. II Bockmühls Kritik bezog sich ausschließlich auf den Finalsatz, auf Kadenz und Coda, und richtete sich im wesentlichen auf drei Faktoren. In erster Linie ging es um die Behandlung des Soloinstruments, um Fragen von Spielbarkeit und Virtuosität. Ein Kritikpunkt, der sich in den verschiedensten Varianten durch den gesamten Briefwechsel zieht, ist der Vorwurf, einige Stellen seien „etwas unpracktikabel geschrieben“ und müßten geändert bzw. erleichtert oder transponiert werden (Orthographie und Interpunktion sowie Kürzel oder ähnliches habe ich unverändert von Bockmühl übernommen). Diese Stellen seien zu „unruhig“, verlangten „wilden Fingersatz“ und sprängen „zu sehr auf dem Griffbrett auf und nieder“. So müsse man innerhalb von sechs Takten zwischen den Buchstaben M und N bzw. T und U andauernd „von dem Daumeneinsatz ganz zurück u. wieder hinauf“ springen, „was auf dem Cello kaum im langsamen Tempo sauber & rein aufzuführen“ sei5. Nach Bockmühls 5 Briefe vom 26. Oktober 1851 sowie vom 25. April und 31. Oktober 1852; die Angaben von Buchstaben sind identisch mit der Zählung in der Schumann-Gesamtausgabe bei Breitkopf & Härtel, hrsg. v. C. Schumann, Leipzig 1879–1893. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption Ansicht waren die Schwierigkeiten „außerordentlich“, ja „ungewöhnlich risquant“, und er versicherte: Wenn man das Konzert „rein, technisch vollkommen, mit Ton & Verständniß ausführen will, so ist es ein schwereres Stück Arbeit als alle meine Romberg’sche Servais’sche etc. Musick“6. Beschränkten sich im Detail die beanstandeten Stellen zuerst nur auf den Abschnitt zwischen P und Q7, so erstreckten sie sich in zunehmendem Maße auch auf die Buchstaben O–P8, L–N9 sowie Q–R und T–U10. In scherzhafter Weise versuchte Bockmühl, seinen Änderungsvorschlägen Nachdruck zu verleihen: „Sollten Sie unsere Wünsche nicht erfüllen, so werden Ihnen alle Violoncellisten Nachts im Traum erscheinen & mit ihren Bogen drohen“11. Die Kehrseite des Vorwurfs mangelnder Praktikabilität war der Vorwurf mangelnder Virtuosität, „Undankbarkeit“ und „Effektlosigkeit“. Er klingt in Bockmühls Rüge an, daß die „Schwirigkeiten, seien sie auch noch so bedeutend“, nicht „klingend oder melodieus“ zu bewältigen seien12. Er wird deutlich, wenn Bockmühl an der Passage zwischen O und R bemängelt, daß sie „ganz unpracktisch für Violoncell [sei] und gewiß so effecktlos, daß sie selbst vollkommen ausgeführt nicht durchdringt“13. Der Vorwurf wird aber auch offenbar in dem Wunsch, Schumann möge ruhig „einige kleine Teufelchen loslassen, mit denen wir schon fertig werden wollten“14. Mehrfach bat Bockmühl: „Thun Sie ja ein Übriges für uns arme Violoncellisten u. lassen Sie uns dieß Concert nicht bloß als Composition, sondern auch als ein Solostück 1r Classe bewundern“15. Gönnen Sie „diesem Concerte einige Veränderungen […], da es dann nicht allein das schönstcomponirte sondern auch das Effectvol[lste] wird, was so für Violoncell geschrieben“16. In diesem Sinne ist wohl auch die Bitte zu interpretieren, „die Cadenz zu verlängern“, wie Schumann es selbst bezweckt habe17. 6 Briefe vom 15. November 1852 und vom 3. März 1853. 7 Brief vom 25. Oktober 1851. 8 Brief vom 10. Dezember 1851. 9 Brief vom 25. Dezember 1851. 10 Brief vom 25. April 1852. 11 Brief vom 19. Dezember 1851. 12 Brief vom 31. Oktober 1852. 13 Brief vom 25. April 1852. 14 Brief vom 25. Dezember 1851. 15 Brief vom 26. Oktober 1851. 16 Brief vom 19. Dezember 1851. 17 Brief vom 25. April 1852. Heinz von Loesch Über den engeren Bereich der Behandlung des Soloinstruments, über Fragen von Spielbarkeit und Virtuosität hinaus erstreckte sich die Kritik aber auch auf die übrige kompositorische Faktur des Satzes: auf die Länge, seine formale, harmonische und thematisch-motivische Disposition sowie auf die Satztechnik. 1. Von „mehreren Längen oder vielmehr Wiederholungen des letzten Satzes“ war cum grano salis im Brief vom 19. Dezember 1851 die Rede. 2. Eine Spezifikation dieser Kritik in formaler Hinsicht erfolgte noch im selben Brief: „Was mir nicht recht convenirt ist die Wiederholung des Satzes K–N später, wodurch das Rondo zu sehr die Form eines ersten Allegrosatzes bekommt.“ 3. Wiederum im selben Brief, aber auch schon in dem vom 10. Dezember 1851, kritisierte Bockmühl die Harmonik der Finaldurchführung. Er rügte an der „freie[n] Fantasie von O–Q“, daß sie „fast nur um E dur und a moll & die nächstverwandten Accorde sich dreht“; „dieß macht das Rondo länger als es wirklich ist & trotz der schönen ja wunderschönen Arbeit wird man den großartigen Effect des ersten & den reizenden des 2ten Satzes dadurch vertilgen“. 4. Am 25. Dezember 1851 referierte Bockmühl dann eine ausführliche Kompositionskritik seines Kollegen, des Frankfurter Cellisten und Komponisten Karl Ripfel, die in erster Linie auf Thematik und Motivik zielte: Nun zu dem Rondo – Bis zum 15–16ten Tackt nach dem Buchstaben L findet Ripfel nichts zu ändern, dann aber glaubt er es nöthig das erste Thema ? œ. #œ œ #œ œ œ welches überhaupt weniger interessant einstweilen ganz zu verlassen & in einen breitern Gesang der sich in gesangreichen Figuren zu enden [?] die sich mit ihrer stets interessanten Begleitung bis zum Buchstaben N ausdehnen könnten denn was von oben erwähnten Tackten auf L bis N jetzt steht ist unpracktisch & etwas monoton. – Von N– O folgt das Tutti; aber von O–R verwirft Ripfel Alles. Er glaubt daß von O an ein sehr interessantes Intermezzo über die eigentlich interessantere Figur des Rondos nemlich dieser & œ œ œ œ #œ œ œ eingeschoben werden könnte. – Diese Figur ist sehr launig & macht einen reizenden Eindruck & würde dieselbe sich interessan[t?] mit der Begleitung & recht keck, capricieux und humoris[tisch …?] modulirend verarbeiten lassen – […] Von R an bliebe wieder Alles bis zum Buchstaben T oder einige Tackt[e?] vor demselben wo dann die breitere Gesangstelle nach dem Buchstaben L wieder u. zwar in A dur vorkäme & – bis zum Buchstaben U reichend von wo an nichts mehr zu verändern wäre. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption 5. Am 25. April 1852 machte Bockmühl schließlich noch einen detaillierten Vorschlag zur Änderung der satztechnischen Faktur in der Durchführung: Ferner glaube ich wird es keine Cellisten geben die Ihnen die Stelle von O bis R zu Dank spielen können – Mir ist’s unmöglich & würde ich Sie inständigst bitten, die Cellopartie bis zum brillanten Schluß in den Orchesterstimmen zu vertheilen & dem Violoncell ohne an der Composition etwas zu verändern, dazwischen eine getragene Melodie zu geben vielleicht wenn es sich einigen läßt eine Anspielung auf die früheren. – Dieß wird Ihnen ja da an der Composition nichts verändert wird, sehr leicht sein. III Daß Schumanns Cellokonzert schwer und „unpracktikabel“ sei, war nicht nur die Auffassung Bockmühls und seines Frankfurter Kollegenkreises. Sie wurde von der gesamten frühen Schumann-Kritik geteilt, wovon die überlieferten Dokumente eindringlich Zeugnis geben. Eine große Zahl von Aufführungsrezensionen hebt die ungewöhnlichen Schwierigkeiten des Werkes hervor oder redet von Pannen der Solisten und ähnlichem. So berichten die Signale für die musikalische Welt über die Aufführung des Schumann-Konzerts durch den Cellisten David Popper in Breslau von der „schwere[n] Aufgabe“, an die sich bislang noch kein Cellist „gewagt“ habe18. So spricht die Neue Zeitschrift für Musik angesichts der „noch nicht geschehene[n] Vorführung des Violoncellconcertes von R. Schumann“ im Leipziger Gewandhaus durch Friedrich Grützmacher von „ungewöhnlichen Ansprüche[n] an die Technik“ und von „oft nahe an Unausführbares streifenden Schwierigkeiten“19. Im Zusammenhang mit einer Darbietung Grützmachers in Frankfurt am Main erwähnt die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung die wenig „naturgemäße Behandlung des Instruments“20. Nach einer Aufführung im Leipziger Gewandhaus durch Jules de Swert lobt die Neue Zeitschrift für Musik zwar die „muthige Wahl eines so überaus schwierigen Werkes“, weiß aber auch von „einigen kleinen Unglücksfällen“ zu berichten21. Und nach der Darbietung durch Carl 18 Signale für die musikalische Welt 26, 1868, S. 23. 19 Neue Zeitschrift für Musik 64, 1868, S. 431. 20 Leipziger allgemeine musikalische Zeitung 5, 1870, S. 151. 21 Neue Zeitschrift für Musik 65, 1869, S. 363. Heinz von Loesch Schröder, die unter „kein[em] wünschenswerth glückliche[n] Stern“ gestanden habe, bezeichnet ein Rezensent derselben Zeitschrift das Konzert als „eines der klippenreichsten, es setzt die Intonation wie die Unfehlbarkeit der Technik […] starken Gefahren aus“22. Daß das Schumann-Konzert als schwer und „unpracktikabel“ empfunden wurde, wird darüber hinaus an einem anderen Tatbestand deutlich. Nicht nur die von Bockmühl betreute Erstausgabe, sondern auch verschiedene spätere Ausgaben bieten für die Solostimme zuweilen „erleichterte“ Varianten an. Dazu zählen unter anderem die Takte 14 und 18 im ersten Satz Erleichtert: #œ ^1 ? ˙. #œ III.a #œ cresc. œ bœ œ œ bœ 1 bœ f 7 3 1 bœ o œ œ œ & œ bœ œ ? b œ œ. & b œ œ ? œ J f III. a f 1 II.a >œ1 > ? ˙ œ #œ S ^3 #œ S 1 #œ n œ4 œ4 œ n œ œ œ J #˙ II.a œ œ œ #œ œ 4 o 0 1 œ œ œ # œ & œ #œ œ œ nœ nœ œ. II.a Notenbeispiel 3: Takt 13–20 (Erstausgabe Breitkopf & Härtel) 22 œ œ2 œ n œ4 ˙ Neue Zeitschrift für Musik 73, 1877, S. 81. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption sowie der Anfang des Finales (Erstausgabe) Erleichtert: œ œ œ œ œ 1 4 œ 0 œ œ 1 œ 0 ? œ.2 # œ œ # œ œ & œ œ1 S ^œ œ^ ^œ. œœ œ ^ ?œ o ^ œ ^3 œ. œœ œ œ œ4 œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ J 3 4 1 0 œ 0 œ œ 3 1 4 œ 1 œ œ œ. ? # œ œ # œ 0 1 œ & J œ J S a œ. J S II. ^œ ^ œ ^ œ œ œ ^ œ œœ ^œ ^ œ ^ œ œ œ ^ œ œœ I.a Notenbeispiel 4: Takt 351–358 (Erstausgabe) Daß diese Varianten aber nicht nur eine Konzession an den dilettierenden Laiencellisten – einen potentiellen Notenkäufer – darstellten, was bei Solokonzerten überhaupt weniger verbreitet war, sondern auch von ernstzunehmenden Virtuosen gespielt wurden, geht aus einer im Besitz des Hannoveraner Cellisten Rudolf Metzmacher befindlichen Cellostimme mit den Fingersätzen und Änderungen von Bernhard Coßmann, einem der bedeutendsten Virtuosen des 19. Jahrhunderts, hervor. Selbst diese Fassung, die ganz offensichtlich nicht im Hinblick auf eine Veröffentlichung, sondern für den eigenen Konzertgebrauch konzipiert war, weist solcherart „Erleichterungen“ auf. In den Takten 431 und 433 sowie den analogen Stellen in der Reprise wurden einzelne Töne derart verändert, daß heikle Sprünge in die Daumen- bzw. Übergangslagen nicht mehr vonnöten sind. In der Ausgabe von Julius Klengel finden sich neben den so gekennzeichneten Erleichterungen sogar in der „eigentlichen“ Fassung noch kleine Vereinfachungen, die nicht als solche kenntlich gemacht sind. So wurde in den Takten 352 und 354 zu Beginn des Finales stillschweigend das a durch ein a' ersetzt, was der Bogenhand einen unangenehmen Saitenwechsel über zwei Saiten erspart und der Griffhand ermöglicht, sich bereits auf die bevorstehenden Sprünge einzustellen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die spieltechnischen Errungenschaften des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts einen Teil der Schwierigkeiten zu lösen vermochten. Der Erleichterungen Coßmanns bedarf kein ernstzunehmender Cellist mehr. Und trotzdem wird der Solopart noch Heinz von Loesch immer als schwer, vor allem als heikel empfunden. Selbst heute bereitet seine einwandfreie Realisierung sogar ausgezeichneten Cellisten deutlich hörbare Mühen. Selbst heute ist seine Wiedergabe von verhältnismäßig vielen Pannen und Mißgeschicken begleitet. Die Behauptung, das Konzert sei „uncellistisch“, gilt also nach wie vor, wobei sich drei Aspekte unterscheiden lassen. Uncellistisch ist zum einen das gleichsam freie Schweifen der „kompositorischen Idee“, beispielsweise in der Kantilene des Kopfsatzes. Ist die unersättlich sich verströmende Kantabilität zwar ein ausgesprochen cellistisches Moment, so setzt sich die Bewegung der Melodie über instrumentale Gegebenheiten doch rücksichtslos hinweg. Anstatt durch günstige grifftechnische Voraussetzungen motiviert oder zumindest gestützt zu sein, kommen Melismen, größere Intervalle und Sprünge unvermutet, in schlecht liegenden Konstellationen und zum Teil in den entlegensten Regionen des Griffbretts vor, so in den Takten 19 f., 60–65, 68–72 oder 78–81. Uncellistisch ist neben dem freien Schweifen der „kompositorischen Idee“ die „pianistische“ Faktur zumal des letzten Satzes. Im höchsten Maße pianistisch gedacht ist das zentrale Motiv des Finales (vergleiche Notenbeispiel 1). Während es sich auf dem Klavier ganz ausgezeichnet spielt – man probiere es nur einmal mit dem Fingersatz 1 2 1 2 3 5 –, liegt es auf dem Cello eher unbequem: Es erfordert einen beträchtlichen Aufwand an Saiten- und Lagenwechseln – und das bei einem Motiv, das lediglich den Charakter des Einwurfs tragen soll. Pianistisch gedacht ist überhaupt der ganze Anfang des Finales: Die unerhörten Schwierigkeiten der Cellostimme lassen sich am Klavier bei einer Verteilung auf zwei Spielhände mühelos wiedergeben. Ebenso verhält es sich mit weiten Teilen der Coda: Bei einer Verteilung auf zwei Hände liegen die durch übermäßige Sprünge unterbrochenen Dreiklangsfortschreitungen wirklich glänzend (T. 727–733). 1 œ œ œ ? ### œ œ œ >œ 3 œ œ œ œ œ >œ2 1 œ œ œ œ œ > 1 > o n œ œ œ3 œ nœ œ ### œ 3 1 ? œ œ n œ nœ œ & a 4 œ1 œ œ & œ œ œ 1 >œ4 œ nœ 1 4 1 œ œ #œ I. Notenbeispiel 5: Takt 727–733 (Erstausgabe) In letzter Instanz uncellistisch ist aber auch etwas, was durchaus Kenntnisse über die Möglichkeiten des Cellos voraussetzt. Es scheint, als verriete sich ne Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption ben dem „Komponisten“ und dem „Pianisten“ auch noch der „dilettierende Cellist“, der Schumann ja gleichfalls war, hatte er doch in seiner Jugend eine Zeitlang auch Cellounterricht erhalten. Schumann wußte sehr wohl, daß die hohen Lagen auf dem Cello am besten mit dem Daumen auf dem Flageolett eine Oktav über der leeren Saite zu erreichen sind. Er bediente sich dieses Verfahrens sowohl bei den raschen melismatischen Dreiklangsbrechungen im Hauptthema des Kopfsatzes (T. 14 und 18, vergleiche Notenbeispiel 3) als auch zu Beginn des Finales. Und er wußte, daß die generelle Überwindung großer Distanzen überhaupt am leichtesten unter Zuhilfenahme von Flageoletts möglich ist, da sie eine größere Toleranz gegenüber kleinen intonatorischen Abweichungen besitzen als fest gegriffene Töne. Um einen Flageoletton rein hervorzubringen, muß man die Saite nicht exakt an einer Stelle abgreifen; es genügt, sie innerhalb einer gewissen Bandbreite mit dem Finger zu berühren. Unter Ausnutzung dieser Kenntnisse glaubte Schumann, nun auch auf dem Cello leicht über große Distanzen springen zu können. Zu Beginn des Finales (T. 352 und 354) sollen binnen zweier rascher Zählzeiten zunächst 2 3/4 Oktaven – unter Ausnutzung des Daumens auf dem Flageolett eine Oktav über der leeren A-Saite – und dann ganze drei Oktaven – unter Verwendung auch noch des Flageoletts zwei Oktaven über der leeren Saite – ummessen werden (vergleiche Notenbeispiel 4). Wie irrig der Glaube war, durch den trickreichen Gebrauch von Flageoletts ließe sich wirklich ein elegantes und kapriziöses Springen quer über das gesamte Griffbrett ermöglichen, wird daran deutlich, daß der Anfang des Finales bis heute zu den gefürchtetsten und am häufigsten mißlingenden Stellen der cellistischen Weltliteratur zählt. Daß Bockmühl den Anfang des Finales nie expressis verbis in seiner Kritik nannte, obwohl er noch weit „unpracktikabler“ ist als alle von ihm monierten Stellen, mag zwei Ursachen haben: Einerseits hatte der Cellist sich mit seinem – nach den klanglichen Maßstäben unserer Zeit haarsträubenden – Fingersatz eines guten Teils der technischen Schwierigkeiten entledigt. Andererseits wird er den Satzanfang kompositorisch als so reizvoll empfunden haben – er ist in der Tat so „keck“ und „humoristisch“, so „capricieux“ und so „piquant“, wie Bockmühl sich das ganze Finale wünschte23 –, daß er bereit war, über die ungeheuren Schwierigkeiten hinwegzusehen. Unter den spieltechnischen Voraussetzungen des 19. Jahrhunderts dürfte es übrigens auch da Probleme gegeben haben, wo kaum welche gesehen wurden: im Bereich der Ton- und Klangqualität sowie der Kantabilität. Dies wird an allen „praktischen“ Ausgaben des 19. Jahrhunderts deutlich, bei Bockmühl, Friedrich Grützmacher, Carl Davidoff und Julius Klengel gleichermaßen. Sie lassen vermuten, daß die klangliche Realisation in den ersten beiden Sätzen, 23 Briefe vom 25. Dezember 1851 und 11. Dezember 1852. Heinz von Loesch die fast ausschließlich aus Kantilenen bestehen, nach unseren Maßstäben nicht befriedigend ausgefallen sein dürfte. Der Entfaltung eines großen und wohlklingenden Tones steht sowohl die Praxis langer Bindebögen, die das Tonvolumen ganz erheblich verringern, im Wege, als auch die Anwendung der sogenannten Daumenpositionstechnik, die zur Sicherung der Intonation und zur Steigerung der Geläufigkeit eine ganze Reihe von Kompromissen klanglicher und artikulatorischer Art in Kauf nahm: eine gestreckte und damit unflexible Handhaltung, den Gebrauch zweier „schlecht“ klingender Finger (des Daumens und des kleinen Fingers), hohe Lagen auf tiefen Saiten und Saitenwechsel für wenige Noten, zuweilen nur für einen Ton. IV Auch mit dem Vorwurf mangelnder Virtuosität, dem Vorwurf der Undankbarkeit und Effektlosigkeit, standen Bockmühl und seine Frankfurter Kollegen nicht allein. Auch er wurde bis weit ins 20. Jahrhundert von vielen geteilt. Bereits die erste, allerdings auch einzige, Rezension des Werkes in der Neuen Berliner Musikzeitung, die Schumanns Opus 129 gemeinsam mit dem gleichzeitig erschienenen Cellokonzert von Bernhard Molique besprach, stellte diesen Aspekt heraus: Muss sich nun das Werk als Musikstück gewiss vollgültiger Anerkennung erfreuen, so bleibt es dagegen in seiner Eigenschaft als Concertstück zurück. Die Erfindung der Cantilenen und Passagen [läßt] sehr oft etwas Unbefriedigendes fühlen, so dass der Spieler weder diese noch sich selbst so recht zur Geltung bringen kann, welches doch auch Haupterforderniss eines guten Concertstückes sein muß24. Ähnlicher Ansicht war auch Wilhelm Joseph von Wasielewski, der in seiner Schumann-Biographie bemerkte, … daß der Meister nicht so hinreichend mit der Technik des Violoncells vertraut war, um sachgemäß für dasselbe zu schreiben. So ist es denn erklärlich, wenn die Allegrosätze in diesem Konzertstück nicht zu rechter Geltung gelangen können25. Und selbst Sir Donald Francis Tovey teilte noch diese Ansicht. Er diagnostizierte eine geradezu „abschreckende Schüchternheit“ gegenüber der Ostentation spieltechnischer Virtuosität26. 24 Neue Berliner Musikzeitung vom 17. Januar 1855, S. 17. 25 W. J. von Wasielewski, Robert Schumann. Eine Biographie, 41906, S. 459 f. 26 „Schumann’s shyness is very deterrent“ – D. F. Tovey, Essays in musical analysis, Vol. 3, Concertos, London 1936, S. 187. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption Der Vorwurf mangelnder Virtuosität wurde unterdessen nicht allein im musikalischen Schrifttum erhoben. Er erfolgte implizit auch in den Aufführungsgepflogenheiten. Die Änderungen, die man der authentischen Werkgestalt zuteil werden ließ, erstreckten sich in hohem Maße auf eine Steigerung von Brillanz und Bravour. Dazu gehörte zunächst der Brauch, Schumanns Kadenz durch eine andere, weitaus virtuosere zu ersetzen beziehungsweise neben ihr noch eine zweite einzufügen. Dieser Brauch war bis weit in unser Jahrhundert hinein üblich. Sowohl die ersten Schumann-Interpreten – David Popper, Bernhard Coßmann, Friedrich Grützmacher und Julius Klengel – als auch eine ganze Reihe von Titanen des 20. Jahrhunderts – Pablo Casals, Emanuel Feuermann, Pierre Fournier, André Navarra, Paul Tortelier, Leonard Rose und Maurice Gendron – folgten ihm. Coßmann ersetzte mit der Kadenz zugleich die Coda. Seine Coda ist, um 20 Takte kürzer, tatsächlich sehr viel brillanter als die von Schumann, verzichtet dafür jedoch auf thematische Konsistenz und jeden harmonischen Reichtum: Im wesentlichen wird allein der Tonikadreiklang durch rasche Figurationen in den höchsten Lagen des Cellos umspielt. # #2 Œ & # 4 œ ƒ Sehr lebhaft ( œ = 114 ) # # # 2 œ n # œœœ œ 4 œœœ & ƒ n œœ ? ### 2 œ 4 œ & # # # œ. œ. œœ œ #œ œ œ Œ œ. œ œ œ. #œ œ œ œœ œœ Œ œœ œ n # œœœœ > œœ œœ Œ >œ œ œ Œ œ œ n œœ >œ œ œ Œ œ. œœœ œ œ œ œ. œœ œ œ . œœ œ œ œ œ >j œœ ‰ œœ >œ œ ‰ œ J œ œœ œœ Œ Œ œœ œœœœ œ œœœ œ œœ # # & # ∑ j œœ ‰ œœ Œ j œœ ‰ œœ Œ j œœ ‰ œœ Œ ∑ ? ### ∑ œœ œ ‰ J Œ œœ œ ‰ J Œ œœ œ ‰ J Œ ∑ Heinz von Loesch œ œ œ œ ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ œ & Œ œ ? œ ‰ œ J Œ U ˙ j œœ ‰ œœ Œ U ˙˙ ˙˙ Œ U ˙˙ ˙ # # j & # œœœœ ‰ Œ j œœ ‰ œœ Œ j œœ ‰ œ Œ ? # # # œœ ‰ œ J Œ œœ ‰ œ J Œ œœ ‰ œ J Œ j œ ‰ œ Notenbeispiel 6 Bernhard Coßmann: Coda zum Violoncellkonzert von R. Schumann aus: B. Coßmann: Kadenzen zu den Violoncellkonzerten von Haydn, Schumann und Raff, hrsg. v. C. Fuchs, Schott, Mainz 1912 Takt 722 ff. Zur Steigerung der Virtuosität wurde über Kadenz und Coda hinaus auch in die übrige kompositorische Faktur eingegriffen. So berichtet die Neue Zeitschrift für Musik, daß Jules de Swert den letzten Satz „hier und da mit einigen uns weniger behagenden Fiorituren ausgeputzt“ habe27. Und die im Besitz Metzmachers befindliche Stimme mit den Fingersätzen und Änderungen von Coßmann weist neben eigener Kadenz und Coda noch einige höchst virtuose Varianten auf. So werden im Kopfsatz rhythmische Stauungen durch brillante Triolen- und Sechzehntelgänge ersetzt (T. 77 f., 94 ff., 245 f., 262 ff.). 2 Erstausgabe Variante Coßmann o ? & œ # œ œ œ. œ n œ œ # œ œ œ. #œ nœ nœ œ œ œ & œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ . . Notenbeispiel 7: Takt 77 f. 27 Neue Zeitschrift für Musik 65, 1869, S. 363. & œ ? ^ B œ b˙ S b ˙^ Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption Erstausgabe œ ? œ oœ œ4 œ œœœœœo œ œœœœ ? œœœ œ œœœ œ > ˙ 4 œ œ œ & S II. a œ 2 Variante Coßmann ? 2 1 o 3 o 3 0 o 4 0 2 1 œ œœ œ œœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ & œ œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ S 3 0 Notenbeispiel 8: Takt 94 ff. Und im Finale erscheinen in den letzten acht Takten von Exposition und Reprise Oktavgänge und Sechzehntelkaskaden, die an stupender Bravour die Originalversion Schumanns weit hinter sich lassen (T. 456–464 und T. 660– 668). o o o 3 o œ . #œ . o o œ . o œ œ œ œ œ . . . œ œ ? œ # œ œ œ . œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 Erstausgabe III.a II.a Variante Coßmann ? ? 0 œ œ1 œ œ o 3 0 œ œ 3 œ & œ ? œ œ œ nœ S œ3 œ œ œ œ œ1 œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ > 1 > o œœœ œ œ œ ? œ œ œœ # œ …œ œ œ # œ œ n œ œ œœœ œ a I. 1 3 1 œ3 œ œ œ1 oœ œ œœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ &œ œ Notenbeispiel 9: Takt 456–464 Im Kopfsatz finden sich überdies vereinzelte Oktavtranspositionen (T. 115– 118) sowie einige signifikante Änderungen der Strichbezeichnungen (T. 165– 175 in der „Spielepisode“ vor Wiedereintritt der Reprise), die, um mit Schumann selbst zu sprechen, aus der „poetischen“ Artikulation eine „virtuosische“ machen. Heinz von Loesch Daß Schumanns Cellokonzert nicht eigentlich virtuos sei, war gleichfalls nicht nur die Meinung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts; sie ist ein Topos, dem man auch heute allenthalben begegnet. Von einer schieren Abwesenheit der Virtuosität zu reden, wäre indessen eine unangemessene Verkürzung der Wahrheit. Ungeachtet seines immer wieder zitierten Ausspruchs, er könne „kein Concert schreiben für den Virtuosen“ und müsse „auf etwas Anderes sinnen“, war Schumann, was seine Konzertkompositionen für Klavier und Violine eindeutig belegen, durchaus kein Verächter von Brillanz und Bravour28. Die Virtuosität in Schumanns Cellokonzert ist vielmehr ein zwiespältiges Phänomen. Es ist doch keinesfalls so, als ob nicht zuweilen das Streben nach Virtuosität oder ein Anflug von Brillanz spürbar würde, einer Brillanz, die dann aber nicht recht zum Zuge kommt, die sich nicht zu trauen scheint. So entsteht ein ganz eigentümlicher, seltsam ambivalenter Eindruck, der Eindruck eines „Schon-aber-doch-nicht“, ein Eindruck eben, wie Tovey zutreffend formulierte, von „Schüchternheit“. Daß sich die Virtuosität im Cellokonzert mit dieser seltsamen Zurückhaltung konfrontiert sah – ganz anders als in den Konzertstücken für Klavier und Violine der letzten Jahre –, scheint tatsächlich darauf zu beruhen, „daß der Meister nicht so hinreichend mit der Technik des Violoncells vertraut war“29, um ihm mehr zu entlocken. Am Ende von Exposition und Reprise im ersten Satz sind eindeutig brillante Abschlüsse intendiert. Doch sind die Passagen mit gesteigertem Figurenwerk zu kurz und in ihrer Faktur zu gemäßigt, um wirklich zu „zünden“. Nach einer längeren „Spielepisode“, deren kleinste Notenwerte nicht über Achteltriolen hinausgehen (T. 68–91 bzw. T. 236–259), wird die Bewegung jeweils nur für zwei Takte auf Sechzehntel gesteigert, um bereits im dritten Takt wieder auf Viertel und Halbe reduziert zu werden. Und die anschließende Sechzehntel- und Zweiunddreißigstelkaskade währt wiederum nur einen Takt. Zudem jagt sie nicht etwa in die Höhe wie in der Alternativversion Coßmanns (vergleiche Notenbeispiel 9), sondern stürzt in die Tiefe. Das gleiche gilt für die Kadenz. Nach einigen thematisch gebundenen Melismen (T. 685 ff.) spielt das Solocello im wesentlichen Arpeggien und gebrochene Tripel- und Quadrupelgriffe in den untersten Lagen. Die Bewegung beginnt in Achteltriolen (T. 690). Nach einiger Zeit wird sie auf Sechzehntel gesteigert. Doch anstatt daran eine Weile festzuhalten, die Bewegung noch wei- 28 C. und R. Schumann, Briefwechsel, Bd. 2, hrsg. v. E. Weissweiler, Basel und Frankfurt 1987, S. 367. 29 W. J. von Wasielewski, Robert Schumann. Eine Biographie, a. a. O., S. 459. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption ter zu steigern oder dem Cello andere virtuose Aufgaben zu übertragen, fällt sie nach lediglich vier Takten wieder auf Achteltriolen zurück, und die Coda beginnt. Auch hier ist der Abschnitt mit Figuren- und Passagenwerk oder einer anderen Spielart instrumentaler Virtuosität zu kurz und in seiner Erscheinung zu gemäßigt, um wirklich zu frappieren. Einigermaßen unerklärlich ist auch die Reduktion der rhythmischen Bewegung von Sechzehnteln auf Achteltriolen in den Oktavgängen am Ende von Exposition und Reprise im Finale (T. 456 bzw. 660). Wieviel virtuoser wären die Oktaven, hielten sie ungebrochen am Sechzehntelfluß fest. Bemerkenswerterweise setzen an dieser Stelle nicht nur die Änderungen Coßmanns an; auch im Autograph begegnet hier eine Variante, in der in den Oktavgängen die Sechzehntelbewegung fortgeführt wird. Variante Autograph ? œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ~ Notenbeispiel 10: Takt 456 f. Da, wo Schumann aber in der Tat Virtuosität forderte, im gesamten Finale und in der Coda, schrieb er für das Soloinstrument so ungeschickt, daß das virtuose Element sich nur mit großer Mühe zu behaupten vermag. Die Faktur der Solostimme nötigt zu einem langsameren Zeitmaß, als es für einen brillanten Schlußsatz geboten wäre. Von welch bestechender Bravour das Finale sein kann, zeigt die Wiedergabe von Paul Tortelier, der statt der üblichen œ = 114 œ = 126–138 spielt. (Welches Tempo Schumann gewählt hätte, 108 oder 138, läßt sich aufgrund der vielfachen Überschreibungen im Autograph nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht lediglich, daß das richtige Tempo, wie in den anderen Sätzen auch, Gegenstand längerer Diskussionen bzw. innerer Zweifel war.) Von den beträchtlichen Schwierigkeiten der Prinzipalstimme, die, wie zu Beginn des Finales, ein Scheitern gewissermaßen vorprogrammiert erscheinen lassen, war schon die Rede. Insgesamt zeigt sich, daß auch hier die Kritik Bockmühls und seiner Kollegen nicht ganz unberechtigt war. Und die Eingriffe der Cellisten des 19. und 20. Jahrhunderts setzen da an, wo es sachlich am ehesten geboten und möglich ist: in Kadenz und Coda sowie bei den Abschlüssen von Exposition und Reprise in den beiden Außensätzen. Wenn es auch denkbar ist, daß Schumann den genannten Mängeln hätte Abhilfe schaffen können, so steht doch fest, daß keiner der kompositorischen Eingriffe von seiten der Cellisten eine Verbesserung darstellt: weder in Kadenz und Coda noch in Kopfsatz und Finale. Heinz von Loesch V Die bedeutendste Leistung Bockmühls und Ripfels lag indessen nicht in der Kritik spieltechnischer Faktoren, sondern in der Kompositionskritik im engeren Sinne. So disparat ihre verschiedenen Einwände und alternativen Verbesserungsvorschläge auch scheinen mögen, die Kritik an Länge, harmonischer, formaler und thematisch-motivischer Disposition des Satzes kreist um ein und denselben Sachverhalt: um den Vorwurf der Monotonie. Gegenüber der Harmonik der Finaldurchführung ist er offenkundig, gilt aber auch der formalen und thematisch-motivischen Faktur. Während sich die Kritik Bockmühls an der „Wiederholung des Satzes K–N später“30 lediglich an der Nähe zur Sonatenform störte, zielten die Einwände Ripfels, dessen Alternativvorschlag genau wie bei Schumann am Sonatensatz mit Durchführung und vollständiger Reprise orientiert war, auf thematisch-motivische Gleichförmigkeit. Ripfel beklagt das permanente Festhalten an ein und demselben Motiv in sämtlichen Teilen des Finales, an einem Motiv, das ihm „weniger interessant“ erscheint. Im Gegenzug skizziert er die Umrisse eines Sonatensatzes mit einem kontrastierenden kantablen Thema – einem „breitern Gesang“31 – und einer Durchführung, die nicht auf das Hauptthema des Finales zurückgreift, sondern auf ein Motiv aus dessen Fortsetzung. Die Kritik Bockmühls an der satztechnischen Faktur der Durchführung hingegen besagt, daß er das Prinzipalinstrument nicht nur an der thematisch-motivischen Arbeit des Orchesters beteiligt, das Solocello nicht einfach ins Orchester integriert sehen will, sondern möchte, daß es ihm als eigenständiger Partner gegenübergestellt wird. Auch mit der über den engeren Bereich des Soloinstruments hinausgehenden Kompositionskritik standen Bockmühl und Ripfel nicht allein, selbst wenn Beanstandungen hier weit seltener begegnen. Eine implizite Kritik an den „Längen oder vielmehr Wiederholungen“ und an der Monotonie des Satzes lag in der Praxis der ersten Schumann-Interpreten, das Finale nicht vollständig zu Gehör zu bringen. Laut Mitteilung der Neuen Zeitschrift für Musik spielte Jules de Swert den letzten Satz „erheblich gekürzt“32. Und nach den Eintragungen der im Besitz von Metzmacher befindlichen Cellostimme machte auch Coßmann einen erheblichen Strich, dem nahezu die halbe Durchführung zum Opfer fiel (T. 496–528). 30 Brief vom 19. Dezember 1851. 31 Ebenda. 32 Neue Zeitschrift für Musik 65, 1869, S. 363. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption Eine explizite Kritik an der Satztechnik, an der integrierten Behandlung von Solo und Tutti, findet sich in einer Besprechung der Leipziger allgemeinen musikalischen Zeitung, wo es heißt: Der Componist hat hier offenbar die Idee, das Orchester aus seiner dienenden Stelle heraustreten zu lassen, es nicht dem Soloinstrumente unterzuordnen, ihm auch nicht gegenüber zu stellen, sondern es mit ihm zusammen zu verarbeiten; hieraus entsteht dann ein Orchesterstück mit obligatem Violoncello, eine Mischgattung, mit welcher ich mich vorläufig nicht befreunden kann33. Obwohl Beanstandungen der kompositorischen Faktur nur selten begegnen, ist der Tadel von Bockmühl und Ripfel nicht unberechtigt. Keine besondere Beachtung verdient Bockmühls Kritik an der „Wiederholung des Satzes K–N später, wodurch das Rondo zu sehr die Form eines ersten Allegrosatzes bekommt“. Sie zeigt lediglich eine mehr historisch als ästhetisch begründete Erwartungshaltung, die mit einem Rondo rechnete und keinen zweiten Sonatensatz erlaubte. Wie sehr Bockmühl von einem Rondo ausging, erhellt aus seiner ständigen Verwendung des Rondobegriffs. Zutreffend scheint hingegen der allgemeine Vorwurf von „Längen oder vielmehr Wiederholungen“ zu sein, und zwar in harmonischer wie in thematisch-motivischer Hinsicht. Zwischen den Buchstaben O und Q, genauer zwischen den Takten 480 und ca. 510, also für ganze 30 Takte, kreist die Harmonik ausschließlich um die Haupttonart des Satzes und ihre nächstverwandten Stufen, um nach nur zehn Takten Modulation (T. 519 F-Dur, T. 523 g-Moll) schon wieder in die Haupttonart zurückzukehren: Ein auskomponierter Dominantvorhaltsquartsextakkord führt über einen auskomponierten Dominantseptakkord zum Tonikadreiklang (Eintritt der Reprise). Von einer reichen Harmonik kann in der Durchführung, dem in der Sonatenform dafür prädestinierten Ort, nun wirklich nicht die Rede sein. Und daß der Satz durchwegs an ein und demselben Motiv festhält, ist gleichfalls richtig. Abgesehen von acht Takten in der Überleitung (T. 374– 381) beherrscht es das gesamte Finale, einschließlich des zweiten Themas (T. 414 ff.), zu dem es zunächst in der Begleitung erscheint, um bereits nach 16 Takten das musikalische Geschehen wieder völlig zu dominieren. Von thematisch-motivischem Reichtum kann also ebenso wenig die Rede sein. Eine ausgesprochene architektonische Kraft aber – ein weiteres Mal hat Ripfel recht – läßt sich dem Motiv auch nicht konzedieren. 33 Leipziger allgemeine musikalische Zeitung 5, 1870, S. 151. Heinz von Loesch Ob die Vorschläge Ripfels wirklich eine Verbesserung darstellen, steht nicht fest. Ein „breiter Gesang“ als zweites Thema entspräche doch sehr dem Schematismus des französischen Rondos der Viotti, Rode oder Kreutzer. Und ob das Motiv, das Ripfel als Keimzelle für die Durchführung vorschlägt, in der Tat die „eigentlich interessantere Figur des Rondos“ ist und einen geeigneteren Ausgangspunkt für die Durchführung darstellt, mag gleichfalls bezweifelt werden. Trotz allem setzen seine Vorschläge an den neuralgischen Punkten des Finales an und bieten eine bedenkenswerte Alternative zu der von Schumann realisierten Fassung. Bedenkenswert ist schließlich der Vorschlag, den Bockmühl zur satztechnischen Gestaltung der Finaldurchführung machte. Der Vorwurf, er habe schlicht die strukturelle Funktion der Solostimme verkannt (Draheim), geht ins Leere. Der Cellist wußte sehr wohl, daß es sich um eine Art Durchführung handelt, an der das Solocello lediglich partizipiert. Nicht umsonst redete er von einer „Fantasie über das Rondothema“34. Nicht umsonst war er vorübergehend geneigt, seine Kritik zu revidieren, und zwar nach Einsichtnahme in die Partitur35. Daß er letztendlich an seinen Einwänden festhielt, beruht also nicht darauf, daß er die funktionalen Zusammenhänge nicht erkannt hätte; er hielt daran fest, obwohl er sie durchschaute. Sachlich ist die Kritik aber keinesfalls unbegründet. Für den Wunsch, das Soloinstrument nicht einfach an der thematisch-motivischen Arbeit des Orchesters zu beteiligen, es nicht bloß in einen symphonischen Apparat zu integrieren, gibt es durchaus triftige Argumente. Einerseits besteht zur Teilnahme eines einzelnen Instruments an der thematisch-motivischen Arbeit des Orchesters kein rechter Grund. Um Themenpartikel spielen zu lassen, braucht man keinen Solisten, zumal wenn das gleiche Instrument mehrfach im Ensemble vorhanden ist. Umgekehrt widerspricht die optisch pointierte Position eines Solisten der Idee der durchbrochenen Arbeit, immer nur Teil und Funktion des Ganzen zu sein. Ist es nicht merkwürdig, wenn ein Solist, der an herausgehobener Stelle sitzt und dessen Aktionen eine besondere Aufmerksamkeit erheischen, nur Themenpartikel spielt; wenn er nichts anderes tut als jedes andere Orchestermitglied auch? Andererseits kann das thematisch-motivische Gewebe, soll das Soloinstrument nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar werden, nur dünn gewirkt sein. Und genau dieser Gefahr ist Schumann nicht entgangen: ein Sachverhalt, den 34 35 Brief vom 10. Dezember 1851. Brief vom 30. Dezember 1851. Eine verkannte Quelle der frühen Schumann-Rezeption Bockmühl gleichfalls bemerkte und der ihn zu dem so verwegen anmutenden Vorschlag inspirierte, den Tonsatz, so wie er sei, also all das, was Orchester und Soloinstrument gemeinsam spielen, allein dem Orchester zu überantworten und kurzerhand noch eine Stimme hinzuzukomponieren. Bei dem Versuch, die Hörbarkeit des Solocellos zu gewährleisten, obwohl es in das thematische Gewebe eines gesamten Orchesters integriert wird, war Schumann über das Ziel hinausgeschossen: Er hatte einen Satz verfertigt von einer Kargheit und Dürre, die die Forderung nach Hinzufügung einer weiteren Stimme provozieren mußte.