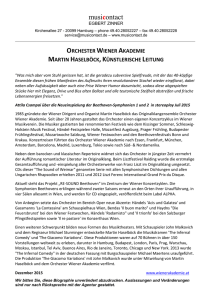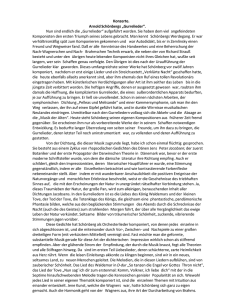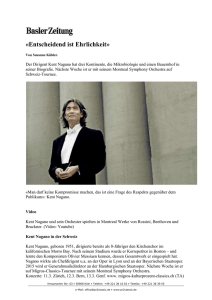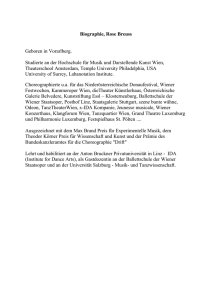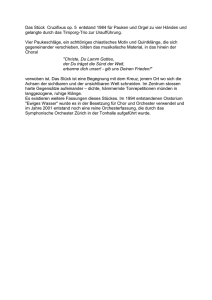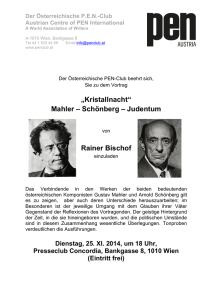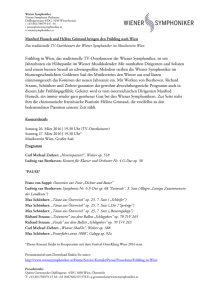Ein legendäres Opus
Werbung

25.06.2013 Ein legendäres Opus Arnold Schönbergs Gurre-Lieder am Wiener Konzerthaus Groß – größer – am größten = Das klagende Lied (Mahler) – Die Sinfonie der Tausend (eigentlich: 8. Sinfonie, Mahler) – Gurre-Lieder (Schönberg). So könnte die passende Formel lauten – zumindest aus besetzungstechnischer Hinsicht -, mit denen sich die Herausforderung der Schönbergschen Komposition, welcher sich vier Chöre und die Wiener Symphoniker unter Kent Nagano am vergangenen Samstag (22. Juni 2013, Anm.) stellten, beschreiben lassen. Das Ergebnis war eine gelungene, wenn auch sicherlich nicht ideale Aufführung im Rahmen des Musikfestes zum einhundertjährigen Jubiläum des Wiener Konzerthauses. Arnold Schönbergs in den Jahren von 1900 bis 1911 entstandene Gurre-Lieder für Soli, Chöre und Orchester, welche genau genommen größtenteils zwischen März 1900 und März 1901 komponiert wurden, sind "legendär"im mehrfachen Sinne. Zum einen ranken sich zahlreiche Legenden, ja Mythen, um ihre Entstehung und zum anderen sind sie ihrem Wesen nach selbst zur Legende geworden. Zu den als "wahr" zu bezeichnenden Legenden um die Gurre-Lieder gehört das Verhältnis Schönbergs zu seiner Schöpfung und deren Platz in dessen Oeuvre. Er sah in ihnen einen Schlüssel seiner Entwicklung, musste aber ebenso wie auch sein Publikum nach der Uraufführung feststellen, dass er zweifellos ein retrospektives Werk vorgestellt hatte. Auf den Erfolg des Februar 1913 – ja, schon wieder ein einhundertjähriges Jubiläum im Wiener Jahresregenten-Kalender – folgt kurz später der Skandel im sogenannten "Watschenkonzert". Ganz und gar ins Reich der Mythen, so die neue Forschunglage auf die Dominik Schwaiger in seinem Programmheftbeitrag hinweist, gehört jener Komplex von Legenden, welche von Alexander Zemlinsky zuerst propagiert worden sind. Schönberg, so scheint es, hat von Anfang an an ein Mamuntwerk gedacht, das Gerücht eines Entwurfes für einen Liederzyklus scheint damit vom Tisch. Eines ist zumindest sicher: die Gurre-Lieder sind ihrem Wesen nach dadurch zur Legende geworden, weil sie nicht nur eine gigantische Besetzung verlangen, sondern auch weil sie gerade durch die höchst experimentelle Sprecherpartie auf die musikalische Dramatik des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts vorausweisen. Jeglicher Beurteilung der musikalischen Ausführung ist es notwendig eine Bemerkung voranzustellen: über ein ähnlich groß dimensioniertes Werk wie die Gurre-Lieder hat Karl Böhm einmal, dass man bei jeder Aufführung vor einer Entscheidung stehe, ob man das Orchester zurückhalten solle oder man es besser voll aufblühen lasse. In beiden Fällen wird es schwierig sein, die Sängerinnen und Sänger zu verstehen.1 Dieses Diktum gilt auch für die Gurre-Lieder. Einzig im Falle einer CD-Aufnahme wird man nicht vor diese Frage gestellt, denn hier lassen sich bekanntlich Sängerinnen und Sänger "hochschrauben" bzw. das Orchester künstlich "dimmen". Das Dirigat und die künstlerische Gestaltung durch Kent Nagano erzwingen eine solche Aussage. Obwohl der Jubel für seine Leistung wohl mit Recht einen Applaussturm entfacht hat, muss gesagt werden, dass die Balance zwischen Solisten, Chören und Orchester, euphemistisch ausgedrückt, unausgeglichen war. Um es auf den Punkt zu bringen: durchweg war das Orchester zu laut, was aber nicht als Fehler Nagano anzurechnen ist. Zum Teil schienen auch die sonst sehr umsichtig musizierenden Wiener Symphoniker beratungsresistent zu sein. Den Glanzpunkt des Abends markiert Mihoko Fujimuras (Mezzosopran) Auftritt als Waldtaube. Sie ist nicht nur die einzige Ausführende des Abends, die gegen die unter ihr tobende – sie stand auf einem erhöhten Podium im linken Zentrum der Bühne – orchestrale Materialschlacht triumphieren konnte, sondern es schien ihr keine Mühe zu machen, richtig: sie hatte sogar scheinbar Freude dabei. Es gelang es souverän ihre gesamten stimmlichen Möglichkeiten auzunutzen. Sowohl in der tiefen Lage als auch bei den gefürchteten Spitzentönen blieb ihr Auftritt eine klangschöne Erscheinung. Ein Melos das den Tod Toves und die Trauer um sie so eindrücklich fühlbar machte, dass man sich zum Weinen angehalten sah. Wenn schon von der Trauer um Tove die Rede ist, so ist diese nicht ganz unberechtigt. Angela Denoke (Sopran) hatte versucht – ihrem zweifelsohne großen schauspielerischen Instinkt folgend – die Rolle des Mädchens, der jungen Frau, zu zelebrieren. Ihr zum Nachteil schien Nagano diese Interpretation nicht mittragen zu wollen, so dass ihre feinsinnige Interpretation vom Orchester oft maßlos "überschrien" worden ist. Interpretatorisch durchzusetzen vermochte sie sich aber auch. Ihr Liebesgeständnis an Waldemar "Nun sag’ ich dir zum ersten Mal"gestaltete sie zum leuchtenden Höhepunkt. Auch Jay Hunter Morris (Tenor), derzeit der Siegfried der Met, hatte an diesem Abend mit der Partie des Waldemar auch seine liebe Not. Wenn ihm auch Momente wie "So tanzen die Engel vor Gottes Thron" rührend und gestalterisch souverän gelangen, so wirkte er auf Dauer angestrengt. Hinzu tritt, aber diese gehört ins Reich der Geschmackssache, dass seine deutsprachige Artikulation zu wünschen übrig ließ. Wie für amerikanische Verhältnisse nicht ganz unüblich, scheint seine Tenor-Stimme "weit hinten im Gaumen zu sitzen", was die Klangschönheit, gerade dieser Partie, doch beeinträchtigten kann. Die beiden Herren Albert Dohmen (Bariton) als Bauer und Kurt Azesberger (Tenor) als Klaus-Narr waren ihren Rollen gemäß ideal besetzt. Dabei gab Dohmen den Bauer aus der linken Proszeniumsloge vielleicht etwas zu grobschlächtig und Azesberger sang zwar die Partie vom Orgelbalkon aus, aus tonaler Perspektivem mit einer zu vernachlässigenden Ausnahme fehlerfrei, allerdings gelang es ihm leider nicht die von Schönberg geforderten, zum Teil buffonesken Singanweisungen, richtig umzusetzen. terz : Gurre-Lieder Seite 2 von 3 An dieser Stelle ist nun eine Lanze für die Chöre zu brechen, wiewohl auch hier Kritik anklingen muss. In Wien sollte, dies gilt nicht nur für das Konzerthaus, bei der Besetzung bestimmter Werke mehr darüber nachgedacht werden, dass wie hier die Wiener Singakademie (Heinz Ferlesch) und Orfeó Català (Josep Villa i Casanas) zwar zwei Chöre mit hohem Anspruch sind und bleiben, aber sie dennoch Laienchöre im besten Sinne des Worten darstellen. Die Gurre-Lieder bringen solche Chöre an ihre absolute Leistungsgrenze, was auch nicht durch den Einsatz von zwei professionellen Chören, dem Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (Josep Villa i Casanas) und den Herren des Chores des Slowakischen Nationaltheaters (Pavol Procházka) wettgemacht werden kann. Dennoch: die Ausführung vermochte letztlich zu überzeugen, wenn auch mit Abstrichen. So gelang der erste Chor der Mannen leider nicht zum erschreckenden Geisterchor – wiederum auch auf Grund des zu lauten Orchesters – und dem zweiten Chor der Mannen fehlte es vor allen Dingen an Strahlkraft der ersten Tenöre, was leider auch am nicht souveränen Falsettieren einiger Sänger lag. Rauschhaft hingegen der Schlusschor als Kampf gegen Naganos Dirigat. Eine Anmerkung noch als ganz persönliches Geschmacksurteil: manchmal hat man als regelmäßiger Konzertbesucher, der selbst auch als Sänger tätig ist, das Gefühl, dass die Choreographie der Sitzpausen für die Chöre dringend überdacht gehört. Warum um Himmelswillen muss sich eine Chormasse, wie bei den Gurre-Lieder, im Sprechermonolog "Des Sommerwindes wilde Jagd" eigentlich setzen? Doch auch die Wiener Symphoniker überzeugten vor allem dann, wenn sie durften. Soghaft gelangen ihnen vor allen Dingen die Zwischenspiele, wie auch "Des Sommerwindes wilde Jagd". Als fragwürdig zeigte sich aber gerade der Anfang dieses Monologes durch einen untypischen Instrumenteneinsatz. Dort, wo Schönberg vier (!) kleine Flöten vorgeschrieben hat, wurden neben der 6. und 8. Flöte (kleine Flöte) Schiffspfeifen verwendet, welche nicht nur naturgemäß unsauber intonieren, sondern auch klangfarblich absolut nicht zu dieser Szene zu passen scheinen. Zuletzt, aber nicht weil das Letzte, ist noch auf die Ausführung der Sprecherpartie durch die Schauspielerin Sunnyi Melles einzugehen. Es wäre dabei unfair ihre Interpretation – leider geschieht dies viel zu häufig -, die Leistungen einer Schauspielerin bzw. eines Schauspielers, welche(r) diese Partie übernimmt, mit denen von "altgedienten" Sängern wie Hans Hotter, Dietrich Fischer-Dieskau oder Ernst Haeflinger zu vergleichen. Eines ist klar: für eine Schauspielerin gehört einiges an Mut dazu sich der Herausforderung des rhythmisch, wie tonhöhenfixierten Sprechens zu stellen! Melles löste diese auf eine gänzlich individuelle, wie beeindruckende Art und Weise, wobei ihre Interpretation darunter litt, dass ihr die Technik einen Strich durch die Rechnung machte. Sie wirkte, da durch Lautsprecher verstärkt – wobei sie diese Hilfe sicher nicht gebraucht hätte, etwas zu laut und übersteuert. Dennoch der i-Punkt des Abends. Jubel im nahezu ausverkauften großen Saal des Konzerthauses für alle Ausführenden einer an und für sich gelungenen Aufführung dieses wahrlich "legendären" Werks. Simon Haasis 1. Vgl. Karl Böhm: „Zur ersten Einspielung der Elektra“, in: Booklet zu DG-Aufnahme der Oper, Hamburg 1961, 7–8, hier: 7. terz : Gurre-Lieder Seite 3 von 3