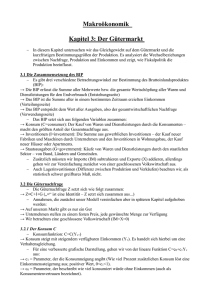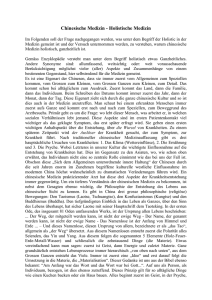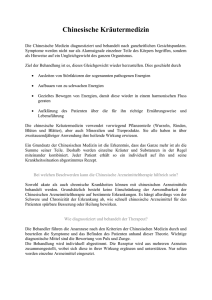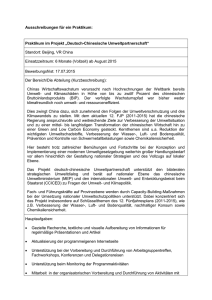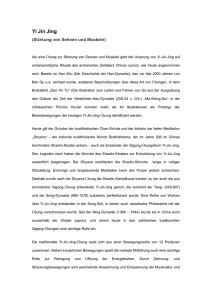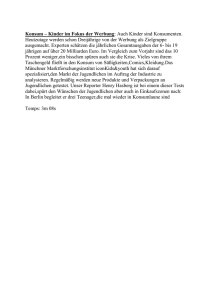China: Die Abkühlung hat nicht nur Nachteile
Werbung

China: Die Abkühlung hat nicht nur Nachteile Düsseldorf, 7. August 2015 Dirk Heilmann Die Zweifel an der chinesischen Wachstumsstory wachsen. Die Indizien für einen Rückgang der Wachstumsrate deutlich unter die von der Regierung angepeilten sieben Prozent nehmen zu. Auch deutsche Unternehmen spüren bereits Umsatzrückgänge im Reich der Mitte. Die Transformation vom rohstofffressenden Industriegiganten zur wissensbasierten Ökonomie mit einem höheren Gewicht von Konsum und Dienstleistungen ist nicht nur eine große Herausforderung für die Regierung in Peking, sondern auch für die ganze Weltwirtschaft. Doch eine Abkühlung in China hat nicht nur Nachteile für Europa und Deutschland. Eine tiefere Analyse chinesischer Wirtschaftsdaten lässt Zweifel an den offiziellen Wachstumsraten von zuletzt knapp sieben Prozent zu. Ein kurzfristiger Rückgang des Wachstumstrends auf rund fünf Prozent und ein mittelfristiger weiterer Rückgang sind durchaus plausibel. Das zeigt sich etwa daran, dass die Stromerzeugung, der Zementverbrauch und die Ölimporte kaum noch steigen oder gar sinken. Auch der Einkaufsmanagerindex, ein wichtiger Frühindikator, zeigt seit Monaten einen Rückgang der Industrieproduktion an. In den vergangenen beiden Quartalen wurde das Wachstum der chinesischen Wirtschaft zu 80 Prozent vom Dienstleistungssektor getragen, auf den nunmehr fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung entfällt. Innerhalb des Dienstleistungssektors trug zuletzt die Finanzbranche entscheidend zum Wachstum bei. Sie ist im ersten Halbjahr 2015 mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 17,4 Prozent expandiert. Doch gerade der Finanzsektor dürfte durch den Einbruch der Börsenkurse in den vergangenen Wochen Schaden nehmen. Um 30 Prozent brach der Index der Börse Schanghai seit Mitte Juni ein. Schlimmer als diese Kurskorrektur selber wirkten die hektischen Eingriffe der chinesischen Führung in den Aktienmarkt, von massiven Stützungskäufen bis zu weit reichenden Handelseinschränkungen. Sie werfen die Liberalisierung der Finanzmärkte ein gutes Stück zurück und wecken Zweifel, ob die KP unter Xi Jinping die Wirtschaft wirklich so gut im Griff hat wie es der Westen glaubt. Die Auswirkungen der Börsenkrise auf die Realwirtschaft dürften sich jedoch in Grenzen halten. Hier ist der Immobiliensektor ein weitaus größeres Problem. Er hat sich enorm aufgebläht und trägt bereits einen Anteil von 15 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Mehr als zwei Drittel davon entfallen auf Wohnimmobilien. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der spanischen Immobilienblase im Jahr 2006 entfielen 12,5 des BIP auf Wohnimmobilien. Nach dem Platzen der Blase brach dieser Anteil auf vier Prozent zusammen. In China hat die Korrektur bereits begonnen und wird nach Einschätzung der Barclays Bank noch mehrere Jahre anhalten. Das sollte den ungewöhnlich hohen Anteil der Investitionen am BIP von derzeit 48 Prozent deutlich reduzieren, sprich normalisieren – es sei denn, die Führung legt, wie es sich jetzt abzeichnet, weitere Infrastruktur-Investitionsprogramme in dreistelliger Milliardenhöhe auf. Ein weiteres großes Problem der chinesischen Wirtschaft ist der zunehmende Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Die Löhne sind seit den 1990er-Jahren kräftig gestiegen, was auch politisch zur Förderung des privaten Konsums gewünscht war. Die Produktivitätszuwächse haben allerdings nicht mit dem raschen Anstieg der Löhne Schritt gehalten. Das verringert die Gewinne der Unternehmen, so dass sie ihre Investitionen in China immer langsamer steigern und sich vermehrt im Ausland engagieren. Gleichzeitig fließt inzwischen per Saldo ausländisches Kapital ab. Dank der unverändert kräftig steigenden Einkommen entwickelt sich der private Konsum hingegen gut. Die Einzelhandelsumsätze steigen zwar nicht mehr mit zweistelligen, aber immerhin noch mit hohen einstelligen Prozentsätzen. Trotz der heftigen Korrektur an der Börse und auf dem Immobilienmarkt müssen die Chinesen ihren Konsum nicht einschränken, denn sie sind im Verhältnis zum BIP nur halb so hoch verschuldet wie die Haushalte in den USA und haben – wegen eines wenig leistungsfähigen Renten- und Gesundheitssystems – eine enorm hohe Sparquote von rund 30 Prozent. In der Gesamtschau zeigt sich dennoch, dass China derzeit nicht nur eine leichte konjunkturelle Abkühlung erlebt, sondern erhebliche strukturelle Probleme hat. Das ist kein Wunder, denn die Transformation von einem aufstrebenden Industriestaat mit investitions- und exportgetriebenem Wachstum zu einer reifen, wissensbasierten Volkswirtschaft mit einem stärkeren Anteil an High-Tech-Industrien und einem zunehmenden privaten Konsum ist eine diffizile Aufgabe. Schon andere Schwellenländer sind daran gescheitert. In der Wirtschaftsforschung ist dieses Problem als „Middle Income Trap“ bekannt, weil es Länder mit einem Pro-Kopf-BIP von rund 10.000 bis 12.000 Dollar trifft. China liegt zurzeit bei 8.000 Dollar. Die zentrale Herausforderung, mit der die chinesische Führung konfrontiert ist, besteht darin zu verhindern, dass die Wachstumsraten in der Transformationsphase zu tief sinken. Es wäre fatal, wenn die „Middle Income Trap“ genau in der Phase zuschnappen würde, in der der demografische Wandel voll zuschlägt. Denn der fällt in China wesentlich brutaler aus als in Europa: Wegen der lange Jahre geltenden Ein-Kind-Politik wird das Angebot an Arbeitskräften schon in wenigen Jahren zu schrumpfen beginnen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was es für Europa und Deutschland bedeuten würde, wenn China auf mittlere Sicht nicht mehr in gewohntem Maße die Rolle als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft spielte. Zumeist werden in diesem Zusammenhang nur die Gefahren für die deutschen Exporte und für den Absatz der deutschen Autohersteller in China diskutiert. Doch diese Betrachtung greift deutlich zu kurz. Denn es gibt eine Reihe von Effekten, die sich verstärken, aber auch zum Teil wechselseitig aufheben. Als negativer Effekt ist bereits sichtbar, dass die Abkühlung in China den Welthandel dämpft. Er wird dieses Jahr nach Prognosen der Welthandelsorganisation WTO nur noch um rund drei Prozent zulegen. Als erstes bekamen die Rohstoffexporteure den gesunkenen Bedarf Chinas zu spüren, unter anderem Australien, Brasilien und eine Reihe afrikanischer Staaten. Inzwischen bemerken aber auch die exportorientierten Unternehmen der reifen Industriestaaten die schrumpfende Nachfrage nach ihren Produkten. Das gilt zum Beispiel für deutsche Autohersteller, die bereits deutlich geringere Wachstumsraten berichten und als Folge des härteren Wettbewerbs Gewinneinbrüche in China befürchten müssen. Sie produzieren ihre Fahrzeuge allerdings vor Ort, so dass sich diese Rückgänge nicht in der deutschen Außenhandelsstatistik niederschlagen. Dafür weisen die Exportstatistiken der Maschinenbauer und Elektrotechniker erste Bremsspuren im China-Geschäft auf. Noch sehen die großen deutschen Exportbranchen keine Trendwende, doch die Abkühlung in China bleibt nicht folgenlos. Zwischen 2010 und 2014 hat China mehr als ein Drittel des globalen Wirtschaftswachstums generiert. Dieser Wachstumsanteil dürfte nach Schätzungen der Citigroup schon bei einem Rückgang der chinesischen Wachstumsrate auf fünf bis sechs Prozent auf ein Viertel zurückgehen. Andere große Schwellenländer wie Indien, Indonesien und die Türkei oder auch die Vielzahl der kleineren Entwicklungs- und Schwellenländer in Asien und Afrika werden diese Lücke nicht füllen können, zumal viele von ihnen selber stark von China abhängen. Doch es ist nicht nur eine Reduktion der Importnachfrage, mit der China den Welthandel beeinflusst. Hinzu kommt, dass dieses Land die Exporte von Produkten verstärkt, die auf dem Heimatmarkt nicht mehr in gleichem Maße benötigt werden. Das gilt insbesondere für Stahl. Die chinesische Baubranche fragt weniger nach, so dass die Hersteller ihre Überkapazitäten zu niedrigen Preisen auf den Weltmarkt drücken. In anderen Branchen verstärkt die Expansionsstrategie in High-Tech-Industrien die Präsenz chinesischer Anbieter auf dem Weltmarkt und reduziert gleichzeitig die Importe dieser Güter. So steigerten zuletzt chinesische SmartphoneHersteller wie Huawei und Xiaomi ihre Weltmarktanteile auf Kosten vor allem asiatischer Konkurrenten. Eindeutig positiv für die etablierten Industriestaaten ist allerdings die dämpfende Wirkung der chinesischen Nachfragerückgänge auf den globalen Rohstoffmärkten. Der HWWI-Index für Industrierohstoffe – von denen 40 Prozent in China verbraucht werden – ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise gefallen. Die Halbierung des Rohölpreises in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres war noch primär auf den Angebotsüberhang durch den Fracking-Boom in den USA und die Weigerung Saudi-Arabiens, die Produktion zu drosseln, zurückzuführen. Doch der neuerliche Preiseinbruch in den vergangenen Wochen nach einer kurzen Zwischenerholung hat mit der Abkühlung in China zu tun. Eine anhaltende Schwäche in China würde den Ölpreis über Jahre niedrig halten, wenn nicht sogar noch ein gutes Stück weiter absacken lassen. Das stützt den Konsum in den westlichen Industriestaaten. Unter dem Strich würde eine anhaltende Abkühlung der chinesischen Wirtschaft Europa und den USA noch am wenigsten schaden. Die Rohstoffexporteure wie Brasilien, Russland, Australien und Saudi-Arabien haben mit dem Verfall der Weltmarktpreise und dem nachlassenden Bedarf Chinas dagegen schwer zu kämpfen. Die asiatischen Nachbarn hängen stark am chinesischen Markt und sehen sich einer härteren Konkurrenz bei Hightech-Produkten gegenüber. In Nordamerika und Europa ist hingegen der konsumstützende Effekt niedriger Ölpreise besonders stark und der Anteil der China-Exporte nicht allzu hoch – in Deutschland betrug er zuletzt 6,5 Prozent. Niedrige Rohstoffpreise in Verbindung mit einem steigenden Angebot preiswerter chinesischer Hightech-Produkte auf dem Weltmarkt dürften die Preisentwicklung in den etablierten Industriestaaten auf mittlere Sicht dämpfen. Das wiederum gibt den Zentralbanken Spielraum, die Leitzinsen noch länger sehr niedrig zu halten und damit die Konjunktur zu stimulieren. Dies könnte die negativen Folgen einer nachlassenden Nachfrage aus China zumindest teilweise kompensieren. Anders ausgedrückt: Die wahrscheinliche Folge eines nachlassenden Wachstums in China ist ein Einkommenstransfer aus rohstoffexportierenden Ländern in die westlichen Industriestaaten bei einem insgesamt schwächeren Wachstum der Weltwirtschaft.