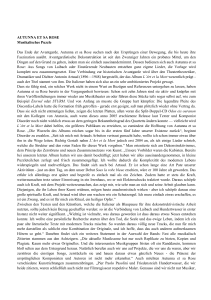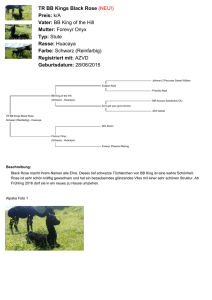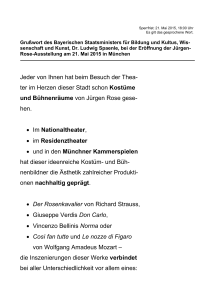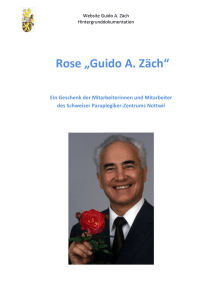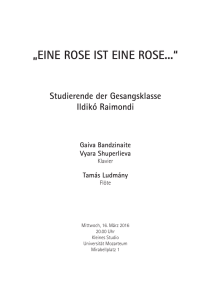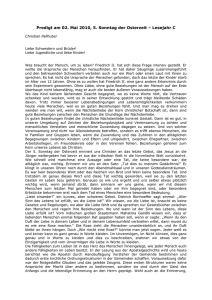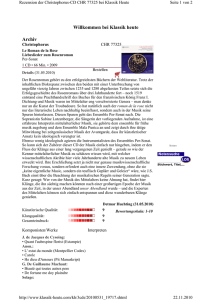Kultur - Jewish Creativity International
Werbung

Kultur Frankfurter Allgemeine Zeitung Samstag, 20. August 2005, Nr. 193 / Seite 59 Alles so analog da draußen Das Künstlerpaar Station Rose arbeitet in Frankfurt – aber eigentlich im vernetzten Elfenbeinturm Absolut restriktiv und total analog war das damals, Ende der achtziger Jahre in der Kunstszene. Erst recht in Wien. Obwohl: Berlin und Hamburg waren auch nicht anders, analog eben. Aber Elisa Rose und Gary Danner, die das so empfanden, waren damals schon auf der Suche nach Verbindungen, nach Schnittstellen zwischen Musik, bildender Kunst und dem, was bald „neue Medien“ heißen sollte, nach den digitalen Welten. Sie gehörten zu den Pionieren des Internets, sie standen mit anderen am Beginn der Club-Bewegung, damals, Anfang der neunziger Jahre, als Techno eine kreative, künstlerische Sache war. Als sie 1987, frisch von der Kunsthochschule kommend, in Wien auf eine Art geschlossene Gesellschaft im Kunstbetrieb trafen, die nicht besonders wild auf Neues war, gründeten sie einen Ort zwischen Pop, bildender Kunst, Theorieforum und neuen Medien, dessen Name heute das Label für ihre gesamte Arbeit ist: Station Rose. Das „öffentliche Labor“, wie die beiden das damalige Projekt bezeichnen, stand am Beginn ihrer Beschäftigung mit audiovisueller Kunst, die heute im allgemeinen, wieder ein wenig stagniere. Nicht viel Neues, dafür spricht alle Welt von der Wiederkehr der Malerei – das erinnert Rose und Danner an die Zeit, in der sie angefangen haben. Schlecht allerdings finden sie diese Phase nicht, die Rose als „Entschleunigung“ bezeichnet. Denn endlich seien nun die technischen Voraussetzungen der Computer und des Internets so, daß man die Virtuosität üben könne – etwa so, wie im Barock Violine oder Cello perfektioniert worden seien. „Das ,Höher, Schneller, Weiter‘ ist im Prinzip erreicht – jetzt kann man arbeiten.“ Seit 1990 leben und arbeiten Station Rose in Frankfurt, damals eine Hochburg der Club- und Techno-Szene. Sie haben damals die ersten Internet-übertragenen Clubbings veranstaltet, mit Beamern Lichtinstallationen in den Raum gestellt. Seit 1991 ist Station Rose online, seit 1999 gibt es ihr „Webcasting“ – live-Netzkunst von zu Hause aus, ein digitales Leben. In stetem Fluß produzieren sie einen Datenstrom aus Bildern und Tönen, der dann „destilliert“ wird, dessen Anfänge und Enden so gesucht werden, wie es die jeweilige Präsentationsform verlangt: Stücke für CDs und DVDs, aber auch Stills, die zu Rauminstallationen oder Drucken auf Stoff oder Plexiglas werden. Eine „Rematerialisierung“ nennt Rose das. Auch ein anderes mittlerweile ziemlich traditionelles Medium nutzen die beiden seit drei Jahren, um ihre im Internet gezeigten komplexen Kompositionen in gewisser Weise „greifbar“ zu machen: das Fernsehen. Im Programm des Hessischen Rundfunks zeigen sie in regelmäßigen Abständen spät in der Nacht „Best of Webcasting“, eine Essenz ihrer Produktion. Ein weiteres Destillat ist nun als DVD „Best of Webcasting“ erschienen, so liegt die virtuelle Netzkunst nun auch in der Hand, drei Levels, 16 Tracks von „Abstract“ bis „Nature is cool“. Vor ihrem Abschluß besuchten sie die „Video“-Klasse der Hochschule – das war damals das, was am allernächsten an audiovisuelle Kunst heranreichte. Zwischen dem, was sie heute tun, und Kunstvideos liegen allerdings Welten. Ebenso wie das, was die beiden produzieren, nichts mit den illustrativen Musikvideos zu tun hat. Der Musikmarkt, so finden die beiden, habe es versäumt, die audiovisuelle Kunst zu etablieren. Heutige VJs dienten lediglich als Dienstleister für die Protagonisten der Musik, zu der sie ihre Bilder zeigten. Station Rose ging früh eigene Wege – mit dem Ergebnis, als Pioniere mit eingeführter Marke einen Platz im Dazwischen zu besetzen: Ihren Kunstbegriff verstand die Clubszene nicht; der Kunstszene sei es bis heute suspekt, daß die beiden etliche Jahre Clubbings veranstalteten hätten, sagen sie. Dennoch sind sie Teil beider Welten, stellen aus, nehmen an den einschlägigen Festivals teil, veranstalten aber auch ihre „Performances“ in Musikclubs, wie demnächst wieder in Frankfurt. Die beiden Linzer, Jahrgang 1959, kennen sich seit Mitte der siebziger Jahre. In Wien haben sie Angewandte Kunst studiert, Rose zuvor Mode bei Karl Lagerfeld; Danner war stets auch Musiker und spielte Gitarre in verschiedenen Bands. Seit den späten achtziger Jahren arbeiten sie so wie heute, zwei Einzelgänger in ihrem „vernetzten Elfenbeinturm“, privat ein Paar mit Kind, im Beruf ein Team. Rose ist für die bildliche Seite der gemeinsamen Produktion zuständig, Danner liefert den Sound. Dabei benutzen sie ausschließlich eigenes Material. Als Einzelkünstler gibt es sie nicht, alles ist Gemeinschaftswerk – entstanden an zwei verbundenen Computern. Natürlich mache sich jeder von ihnen Gedanken über das, was er verwirklichen möchte, so Rose – aber allein, in „Selbstgesprächen“. Während der gemeinsamen Arbeit im Studio herrscht absolutes Sprechverbot: „Worte stören den Kreationsprozeß“, so Danner. Was dann zu hören ist, zitiert manchmal Pop- und Rockgeschichte, ist eingängig, zuweilen etwas melancholisch, spielt mit den bekannten Genres elektronischer Musik und hat doch einen ganz eigenen Klang. Zu sehen sind komplexe Bildkompositionen, die Rose dazu gleichzeitig und völlig gleichberechtigt mit der Musik kreiert. Die Videoaufnahmen erstellt sie selbst, oft ist sie auch Akteurin. Das Material wird bearbeitet, verfremdet, dazu kommen poppige, abstrakte digitale Bilder. Als „neue narrative Form“ bezeichnet Rose die Arbeiten. Schließlich sei es fast unmöglich sei, etwas nicht zu erzählen. In der Tat sind auch die zerrissenen Bilder einer Joggerin (Rose) in „Running Dub“, „Luggage“ oder „Belly Blue“ eine Art von Geschichten. Rose und Danner haben zu gründlich Kunst studiert, um sich darüber Illusionen zu machen. Und sie wissen auch, daß es für sie nicht darum geht, mit ihrer digitalen Kunst eine Art Bilderstürmerdasein zu führen: „Wir sagen ja nicht, daß alles neu ist.“ Aber eben anders: „Als Künstler mußt du immer schneller sein“. EVA-MARIA MAGEL 쐽 Am 12. September ist „Station Rose“ im Frankfurter Club Cooky’s zu hören; im Hessischen Rundfunk ist ihr „Best of Webcasting“ Mittwoch nacht zu erleben, das nächste Mal am 24. August um 02.15 Uhr. Informationen im Internet unter www.stationrose.de Gary Danner und Elisa Rose sind nur im Doppel zu haben – als Station Rose. Foto Claus Setzer Shakespeare mit Hildegard Knef „Timon von Athen“ bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel Die Geschichte des Shakespeareschen „Timon von Athen“ mutet wie ein modernes Gleichnis, aber auch wie eine mittelalterliche Moritat an: Der Athener Timon genießt seinen Reichtum, ist großzügig und verschwenderisch, lädt in sein Haus ein und bewirtet seine Gäste üppig. Er macht teure Geschenke, kann aber nicht zwischen echter und geheuchelter Freundlichkeit unterscheiden. Denn er hält die vielen von ihm Begünstigten alle für seine Freunde. Doch plötzlich befindet sich Timon in finanziellen Nöten, hat seine Mittel offenbar überschätzt, auf die Warnungen der Wohlmeinenden nicht gehört. Als ihm keiner hilft, all seine Hilfeersuchen negativ beantwortet werden, verläßt er die Stadt und zieht in die Wälder: Er wird zum schrecklichen Misanthropen. Dieser erst im 20. Jahrhundert in Deutschland gelegentlich aufgeführten Tragödie – vorher gibt es nur ein paar freie Versionen – hat sich die Gruppe um Norbert Kentrup, der 1983 die Bremer Shakespeare Company und 2001 Shakespeare und Partner gründete, angenom- men: Vera Sturm hat, unter Einbeziehung antiker Quellen wie des Lukian von Samosota, eine neue Übersetzung und Bearbeitung hergestellt und sie als Regisseurin auf die Bühne gebracht. Ihre Fassung gastierte jetzt bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen – mit durchmischtem Ergebnis. Die Sprache des neuen „Timon“ wirkt außerordentlich zeitnah, wozu auch die eingefügten Zitate von Goethe bis Hildegard Knef beitragen. Diese aus Politik und Ökonomie uns vertraute Tonlage macht klar, daß die moralische Frage des Timon durchaus auch eine Frage unserer Gegenwart ist: Auch wir leisten uns noch immer das Mißverständnis, es uns als Verursacher zuzurechnen, wenn Geld uns Gutes bewirkt – dabei ist es doch, ohne Zweifel, eine bloße Eigenschaft des Elementes selbst. Die drei Darsteller zeigen, daß sie nicht nur wandlungsfähig sind, sondern auch Figuren Präsenz verleihen können. Barbara Kratz muß sich zwar auf den Gott Merkur beschränken und dabei stets ihren Helm nach hinten rücken, doch Dagmar Papula als Apemantus, Maler und Alcibiades sowie Norbert Kentrup als Dichter und Timon müssen, was sie überzeugend schaffen, unterschiedliche Figuren vorstellen. Der für Bühnenausstattung und Kostüme verantwortliche Vincent Callara glänzt durch eine ebenso simple wie sinnfällige Konzeption: das weiße Tischtuch des Anfangs wandelt sich zum schwarzen Leichentuch des Schlusses. Der szenische Gehalt des Stückes erweist sich dagegen nicht als groß. An dramatischer Handlung mangelt es auffällig. Es ist, trotz hübscher Einzeleinfälle, ein rhetorischer Zwist, der vor unseren Augen abgespult wird: Welcher Timon ist der richtige, der vor oder der nach der Katastrophe? Der griechische Philosoph Aristoteles definierte die menschliche Tugend durch die Vermeidung der Gegensätze – in diesem Falle: Verschwendung und Geiz. Auf ein deutsches Sprichwort zurückgreifend, hieße das: Muß, wer nicht hören (und sehen) will, wenigstens fühlen? Das gelingt Timon in der InszenieADOLF FINK rung nicht. Junge Musiker mit Zukunft immerhin schon beim Münchner ARDWettbewerb für großes Aufsehen. Auf Initiative des Festivals sollte sich für das Konzert in der akustisch geeigneten, nicht sehr hallreichen Kirche nun eine weitere ARD-Preisträgerin aus Frankreich als Kammermusikpartnerin hinzugesellen. Mit der Flötistin Magali Mosnier und Pierre Colombet an der ersten Violine erklang so Mozarts Flötenquartett D-Dur KV 285 apollinisch-ebenmäßig, mit Leichtigkeit und Eleganz, blitzsauber, mit strahlendem, aber nicht übergewichtigem Flötenpart. Gleiches galt für eine weitere Komposition im Stil der Wiener Klassik, die an den jungen Beethoven denken ließ: Das 1814 entstandene Flötenquartett C-Dur op. 145,1 von dessen Freund und Schüler Ferdinand Ries (1784–1838) stellte für die jungen Virtuosen, nun mit Gabriel Le Magadure-Tonoian an der Violine, technisch keine besondere Herausforderung dar. Gleich- wohl war es keineswegs nachlässig gearbeitet, sondern bis in alle Details fein ausgeformt, wobei das finale „Allegro a l’espagnola“ mit seinen spanisch angehauchten Rhythmen und melodischen Wendungen der originellste Satz der Rarität war. Mit zarten Farben, aber auch voller Leidenschaft, mit viel Gespür für harmonische Verläufe und plötzliche Aufhellungen machte das Quatuor Ebène dann erwartungsgemäß Ravels Streichquartett F-Dur zum Höhepunkt des Abends. Gelungen vor allem, wie nach dem gedämpft, teils auch bewußt fahl, statisch und mit leiser Melancholie gespielten „Très lent“ die dort latente Spannung ihre offene Entladung in den orchestralen Schüben des Finales fand. Für die Zugabe, eine Jazz-Improvisation, trat noch einmal Mosnier hinzu: Vielseitige Musiker mit Musizierlaune und gleich hohem Anspruch hatten sich hier gefunden. Quatuor Ebène mit Mosnier Das junge Quatuor Ebène ist auf dem Weg zur Weltspitze. Wenn Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure-Tonoian (Violinen), Mathieu Herzog (Viola) und Raphael Merlin (Cello) kontinuierlich auf dem hohen Niveau weiterarbeiten, das sie jetzt beim Rheingau Musik Festival in der Kirche Sankt Georg und Katharina in WiesbadenFrauenstein zeigten, dürfte es jedenfalls nur eine Frage der Zeit sein, bis sie internationales Renommee erlangen. Im Vorjahr sorgte das seit 1999 bestehende französische Ensemble, das sich nach dem Ebenholz des Streichergriffbretts benannt hat, GUIDO HOLZE Zeit für Proben und Konzerte: In Michelstadt gastieren noch bis Sonntag 17 junge internationale Musiker. Foto Dieter Rüchel In Leistungslust vereint Junge Musiker bei der ersten Internationalen Sommermusikakademie in Michelstadt Es ist ein gewaltiger Sprung: Auf Johann Sebastian Bachs Französische Suite folgt eine schrille und zeitgenössische Jazz-Improvisation. Das Publikum in der Michelstädter Stadtkirche ist erfreut über diese ungewöhnliche Abfolge und dankt mit viel Applaus. Für die freudestrahlenden Musiker geht es weiter zum gemeinsamen Essen, wo die nächste ungewöhnliche Mixtur wartet. Nicht auf den Tellern – aber über der reich gedeckten Tafel verbreitet sich ein Stimmengewirr aus Hebräisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Verantwortlich für dieses sprachliche Durcheinander sind 17 Studenten aus sechs Nationen. Sie leben seit dem 7. August in Michelstadt, um an der ersten Internationalen Sommermusikakademie dort teilzunehmen. Unter anderem aus Los Angeles, Tel Aviv, St. Petersburg und Warschau haben sich die Musiker auf den Weg in das beschauliche Michelstadt im Odenwald aufgemacht. Doch auch die hiesige Region ist mit zwei Musikern vertreten. Organisiert hat das internationale Treffen der Michelstädter Kirchenmusiker Hans-Joachim Dumeier. Zusammen mit seinem Studienfreund Ofer Ben-Amots und dem Musikprofessor Joseph Dorfmann haben sie die Musiker, die zwischen 16 und 30 Jahre alt sind, eingeladen. „Wir wollten junge, begabte Musiker aus aller Welt zusammenbringen“, erklärt Dumeier. Joseph Dorfmann, der in Tel Aviv an der Universität lehrt, ergänzt: „Der kreative Prozeß bringt Frieden.“ Auch im nächsten Jahr wollen die drei ihre freie Akademie wieder veranstalten. Täglich arbeiten die Nachwuchsmusiker im Einzelunterricht mit den Dozenten zusammen. Zusätzlich zur intensiven Arbeit an Klavier, Orgel oder Klarinette lassen sich einige der Schüler auch in Komposition unterrichten. Einen festen Stunden- plan gibt es nicht und braucht es auch nicht, glaubt Organisator Dumeier. „Hier herrscht Leistungslust“, sagt er über das Engagement der Teilnehmer. Das gehe sogar so weit, daß einer der Studenten die ganze Nacht in der Kirche verbracht habe, um weiter an seinem Werk zu arbeiten. Wichtiger Bestandteil neben der Unterrichtszeit sind die Konzerte. Beinahe täglich haben sich die Musiker bislang in der evangelischen Kirche dem Publikum präsentiert und dabei stets eine Mischung von Moderne und Klassik, aber auch von bekannten Komponisten und eigenen Werken gespielt. Sie stießen beim Publikum, so die Veranstalter, auf regen Zuspruch: Auch die Matineen seien gut besucht gewesen. Sha-Rone Kushnir, Pianist und Komponist aus Los Angeles, ist begeistert vom deutschen Publikum: „Es ist toll, wie sehr die Menschen hier die Kultur und klassische Musik genießen. Das ist in Ame- Kleine Meldungen „Unter der Brücke liegt der Strand“ lautet das Motto eines Abends des Frankfurter Mousonturms, der heute von 21 Uhr an unter der Honsellbrücke stattfindet. Das Duo „Pop and Glow“ hat die Mischung aus LiveAuftritten und DJs zusammengestellt. „Der Elefant, sein Mahout und der Moloch“ heißt ein neuer Dokumentarfilm des Wiesbadener Regisseurs und Produzenten Philipp Selkirk. Die thailändischen Elefanten, deren Population sich Jahr für Jahr verringert, und ihre Besitzer stehen im Mittelpunkt des Films. Er wird vom Verein der Filmfreunde Wiesbaden als Premiere am 24. August um 21.30 Uhr auf dem Gestüt Renz gezeigt; am 9. September ist er im Wiesbadener Kino Caligari zu sehen. rika ganz anders.“ Auch Hans-Joachim Dumeier äußert sich hoch erfreut über die Intensität, mit der die Bürger die Akademie mittrügen. Doch nicht nur wegen des Zuschauerzuspruchs hält er die vielen Konzerte im Programm für wichtig. Das offene Spiel sei für die Künstler eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu üben. Gleichzeitig könnten die Komponisten die Umsetzbarkeit ihrer Stücke erproben, erklärt Dumeier. Jonatan Bensira, der aus Tel Aviv nach Michelstadt gekommen ist, um seine Fähigkeiten am Klavier und im Komponieren zu verbessern, freut sich über diese Möglichkeiten: „Für uns ist das eine große Chance.“ Ergänzt wurden die musikalischen Angebote der Akademie durch wissenschaftliche Vorträge über jüdische Kultur und Musik. „Das ist eine gute Gelegenheit, jüdische Traditionen in Deutschland wieder ans Licht zu bringen“, glaubt Sha-Rone Kushnir. Die 17 Akademieteilnehmer sind aber nicht nur vom zweiwöchigen Programm begeistert, auch für die Gastgeber sind sie voll des Lobes. Hila Tamir aus Tel Aviv fühlt sich in Michelstadt wohl: „Dieser Ort ist gut für unsere Kreativität.“ Allerdings mußten sich einige Musiker erst an die Stadt gewöhnen, wie auch Kushnir selbst. „Als ich ankam, dachte ich, ich sei in einer Filmkulisse gelandet“, erinnert er sich lachend an seine erste Begegnung mit Michelstadt. Am Montag werden er und die anderen Akademieteilnehmer den Odenwald wieder verlassen. Vorher allerdings wollen sie dem Publikum noch ein weiteres Mal die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigen. THOMAS BERTZ 쐽 Die Abschlußkonzerte beginnen am Sonntag um 14 Uhr und um 16 Uhr in der Stadtkirche. Beendet wird die Akademie mit der Aufführung der Eigenkompositionen um 19.30 Uhr.