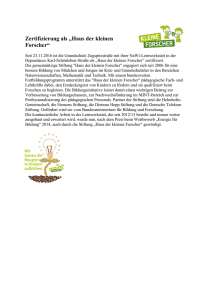Die Mauern des Tumors durchbrechen
Werbung

Natur und Wissenschaft SE IT E N 2 · M I T T WO C H , 1 0 . JU L I 2 0 1 3 · N R . 1 5 7 Diabetesmittel Die aktuelle Debatte um die Sicherheit der neuen Antidiabetika lässt eine andere, mindestens ebenso wichtige Frage in den Hintergrund treten: Wie steht es eigentlich um den therapeutischen Nutzen der Inkretin-basierten Therapien? Als ein wesentlicher Fortschritt der neuen Medikamente gilt, dass sie den Blutzuckerspiegel schonender regulieren als andere Antidiabetika und das Körpergewicht zudem nicht erhöhen, teilweise sogar verringern. Ob sie auch das erhöhte Infarktrisiko der Betroffenen vermindern, liegt noch im Dunkeln. Laut den vorläufigen Ergebnissen einer aktuellen Studie scheint dies eher nicht der Fall zu sein. Zumindest war der darin untersuchte DPP-4-Hemmer Saxagliptin nicht in der Lage, Patienten mit „Alterszucker“ nachhaltiger vor teilweise tödlichen Herz-Kreislauf-Attacken zu schützen als Placebopillen (http://news.bms.com). Die Zukunft wird zeigen, ob die Inkretin-basierten Therapien mehr können als nur die Blutzuckerwerte verschönern. Denn längst nicht alle Arzneien, die aus theoretischen Überlegungen vorteilhaft sein müssten, sind in der Praxis auch nützlich. NICOLA VON LUTTEROTTI eesterne können besser sehen als bisher angenommen. Das haben Meeresbiologen um Anders Garm von der Universität Kopenhagen herausgefunden. Wie schon lange bekannt ist, verfügen die meisten Seesterne über Lichtrezeptoren an der Spitze ihrer Arme. Verglichen mit den Augen etwa von Wirbeltieren und Insekten handelt es sich um primitive Organe. Seesternen traute man daher nur die Fähigkeit zu, zwischen Hell und Dunkel zu unterscheiden, zumal es ihnen an einem gut entwickelten Zentralnervensystem mangelt. Dass man die Tiere damit unterschätzt hat, belegen nun Untersuchungsergebnisse der dänischen Forscher, über die in der vergangenen Woche auf der Jahrestagung der Society for Experimental Biology in Valencia berichtet wurde. Als Versuchsobjekt diente den Biologen der Blaue Seestern (Linckia laevigata), eine in Korallenriffen des tropischen Indopazifiks verbreitete Art. Bei den Experimenten setzte man einzelne Tiere mit oder ohne Augen einen Meter vom Riff entfernt auf dem Sandboden aus. Dort drohte ihnen der Hungertod. Seesterne mit intakten Augen mussten sich aber S Sieh mal an: Auch der Seestern wird unterschätzt Der Fall Strauer düpiert die Branche Gegen den Stammzellforscher und ehemaligen Direktor des Instituts für Kardiologie an der Universität Düsseldorf, Bodo-Eckehard Strauer gibt es neues belastendes Material. Seit Monaten läuft an seiner Universität ein Verfahren wegen Manipulationsvorwürfen. Es geht dabei um Publikationen der Gruppe aus den vergangenen Jahren, in denen gezeigt werden sollte, dass patienteneigene Knochenmarkstammzellen, die den Infarktpatienten über die Blutbahn verabreicht worden waren, die Regeneration des Herzens bewirken. Vor etwas mehr als zehn Jahren waren die Experimente Strauers, ohne dass damals kontrollierte Versuche und Kenntnisse über Nebenwirkungen vorlagen, politisch als Argument gegen die Forschung mit embryonalen Stammzellen verwendet worden. In einer Veröffentlichung in der Fachzeitschrift „International Journal of Cardiology“ (doi:10.1016/j.ijcard.2013.04.152) hat eine Gruppe um Graham Cole vom Imperial College in London jetzt mehr als 200 „Ungereimtheiten“ in den mehr als vier Dutzend Artikeln Strauers aufgelistet. Von widersprüchlichen und unklaren Versuchsdesigns bis zu falschen Statistiken und Patientenzuordnungen ist die Rede. Cole ärgert vor allem, dass kaum einer der zahlreichen Mängel von anderen Wissenschaftlern bemerkt oder jedenfalls erwähnt wurde, obwohl allein die fünf prominentesten Veröffentlichungen Strauers 2665 mal in anderen Fachzeitschriften zitiert wurden. Auch in fünf Metaanalysen wurden Widersprüche der Studiendesigns und Ergebnisse nicht beschrieben. Der Fall wirft ein weiteres Mal ein ungutes Licht auf die Arbeit von Gutachtern. Cole: „Die wissenschaftliche Literatur übernimmt solche Ungereimtheiten offensichtlich immer noch größtenteils unkritisch.“ F.A.Z. Frühjahrsgrippe fördert Frühgeburten Die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt ist bei Schwangeren, die im Mai entbinden, offenbar größer als im Rest des Jahres. Möglicher Grund: Influenzaviren. Weil der Höhepunkt der saisonalen Grippe in eine kritische Phase am Ende der Schwangerschaft fällt, komme es häufiger zu vorzeitigen Geburten, meinen Janet Currie und Hannes Schwandt von der Princeton-Universität in einer Studie, die sie soeben in den „Proceedings“ der amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht haben (doi: 10.1073/pnas. 1307582110). Die beiden Forscher haben die Geburts- und Gesundheitsdaten von mehr als 1,4 Millionen Geschwisterpaaren von 647 000 Müttern in New York, New Jersey und Pennsylvania miteinander verglichen. Die Wissenschaftlerinnen plädieren dafür, mehr Schwangere für die prophylaktische Grippeimpfung zu gewinnen. F.A.Z. Verstimmte Sportler Ein Handbuch zur Depression Das Schwierigste an einer Depression ist es, sie frühzeitig zu erkennen. Gerade bei den vermeintlich Gesündesten in der Gesellschaft. Depression ist ein heimliches Leiden, wie der Aachener Psychiater Frank Schneider in seinem neuen Buch deutlich macht. Er, der das Thema Depression in den vergangenen Jahren zu einem Schwerpunkt der klinischen Psychiatrie gemacht hat, schöpft aus einem gewaltigen Fundus an eigenen Erfahrungen – nicht zuletzt mit vielen prominenten Sportlern, unter denen dieses Leiden allzu oft ausgeklammert wird. In dem Buch gibt es viele Checklisten, Erläuterungen und Fallbeispiele, die klar zeigen: Auch die Leistungswilligsten in der Gesellschaft sind gefährdet und müssen rechtzeitig gegensteuern. F.A.Z. Frank Schneider: „Depression im Sport“, Her- big Verlag, München 2013. 190 S., 19,99 Euro. Foto Dan-Erik Nilsson, Universität Lund Das Auge des Seesterns: An der Spitze jedes Arms sitzen solche tubusförmigen „Komplexaugen“ mit Sinneszellen (rot), die Informationen ans vermeintlich primitive Nervensystem weiterleiten. nicht in dieses Schicksal fügen. Vielmehr bewegten sie sich wieder auf das nährstoffreiche Riff zu. Ihre Artgenossen ohne Augen indessen irrten ziellos umher. Die Augen der Seesterne setzen sich aus zahlreichen lichtempfindlichen Strukturen zusammen. Die Forscher sprechen von einem Komplexauge, das freilich nicht mit dem optisch hoch entwickelten Insektenauge vergleichbar ist. Für Garm belegen die neuen Versuchsergebnisse, dass das Nervensystem von Seesternen mehr leistet als bislang vermutet. Es kann offenbar visuelle Informationen verarbeiten und so den Tieren helfen, sich in ihrer Umgebung zu orientieren. Seesterne sind nicht die einzigen Meeresbewohner, deren Sehvermögen unterschätzt wurde. Das hat Garm zusammen mit anderen Forschern bei früheren Untersuchungen an Würfelquallen der Art Tripedalia cystophora gezeigt. In ihrer frei schwimmenden Form, als Meduse, verfügen diese Tiere über 24 Augen. Einige davon sind darauf spezialisiert, durch die Wasseroberfläche zu sehen. Mit ihrer Hilfe navigieren die Medusen zum Rand von Mangrovenbuchten, ihrem bevorzugten Lebensraum. (R.W.) Die Mauern des Tumors durchbrechen Gentechnik kombiniert mit Immunzelltherapie gilt seit Jahren als erfolgversprechender Ansatz in der Krebsmedizin. Doch es gab Rückschläge. Woran lag es? Vor drei Jahren konnte die Gruppe von Michael Kalos Blutkrebszellen bei drei Patienten mit sogenannten „CAR-Zellen“ ausrotten. Ende vergangenen Jahres machte die kleine Emily Whitehead Schlagzeilen, nachdem sie von einer unheilbaren Akuten Lymphoblastischen Leukämie (ALL) geheilt worden war, ähnliche Erfolge meldete vor kurzem die Gruppe von Renier Brentjens bei fünf an ALL erkrankten Erwachsenen. Wie geht es diesen Patienten heute? Renier Brentjens: Vier der fünf ALL-Patienten konnten aufgrund der CAR-Behandlung eine Knochenmarktransplantation erhalten – die Standardtherapie bei dieser Art von Leukämie. Einer verstarb an Komplikationen, drei sind immer noch in kompletter Remission, das heißt, bei diesen Patienten lassen sich bis jetzt keine Tumorzellen nachweisen, fast zwei Jahre nach der Zellinfusion. Michael Kalos: Inzwischen haben wir bereits 14 Erwachsene behandelt. Bei vier von ihnen bildete sich der Krebs vollständig zurück – was bis heute anhält, für die ersten drei Jahre nach der Therapie, bei sechs nur teilweise, bei vier hatten wir keinen Effekt. Emily geht es prächtig, doch ein anderes Kind, das wir behandelt hatten, verstarb, weil Leukämiezellen erschienen, die das Antigen (Anmerkung: das von den CAR-Zellen erkannte Merkmal) nicht mehr trugen. Die ersten Versuche an Menschen starteten 2006, jedoch ohne Erfolg. Woran lag das? Brentjens: Die Zellen haben sich im Körper nicht vermehrt und waren nach einer Woche verschwunden – sie waren nicht lange genug da, um den Krebs auszurotten. Wir fügten in das Genkon- Michael Kalos: „Weil diese Technik sehr potent ist, kann sie auch sehr gefährlich sein.“ Fotos Andrea Enderlein strukt ein Molekül hinzu, das mittlerweile in allen sogenannten „CARs der zweiten Generation“ enthalten ist und das die Zellen anregt, sich zu vermehren, sobald sie auf ihr Ziel treffen. Den ersten klinischen Erfolg aber erntete damit die Gruppe von Carl June. Kalos: Wir beobachten tatsächlich, dass die Patienten, bei denen die Leukämie komplett verschwindet, diejenigen sind, bei denen die CAR-Zellen sich am meisten vermehrt haben. Doch fragen Sie nicht, warum es bei uns klappte, bei anderen nicht: Lag es an dem Virus, das wir verwenden, um den Rezeptor in die Immunzellen einzuschleusen, lag es an den Kulturbedingungen, die wir einsetzen zur Vermehrung der Zellen vor der Infusion? Das wissen wir nicht. Und darüber hinaus: Warum funktioniert die Therapie bei manchen Patienten, bei anderen nicht? Das versuchen wir gerade in meinem Labor herauszufinden. In den Neunzigern heilten französische Forscher erstmals Kinder von einer lebensbedrohlichen Immundefizienz, der SCID-Krankheit, mittels Gentherapie. Infolge der Behandlung entwickelten einige eine Leukämie. Sind die Techniken mittlerweile sicherer? Brentjens: Wir wissen mittlerweile, dass es gefährlich sein kann, Blutstammzellen mit Retroviren genetisch zu verändern – die Art von Zellen, die die französische Gruppe damals modifizierte. Bei der CAR-Therapie verändert man aber keine Stammzellen, sondern T-Zellen. Es gibt auch verschiedene Arten von Viren, die man verwenden kann. Doch genau aus solchen Gründen werden klinische Studien durchgeführt: um mögliche Nebenwirkungen festzustellen und die Methode besser zu machen. Falsch wäre hier gewesen, die Methode bereits bei Erstanwendung ganz aufzugeben: Weil ein Mensch mit einem der zuerst gebauten Autos verunglückt, hört man nicht auf, Autos herzustellen. Kalos: Mit dem Einsatz von Retroviren und T-Zellen blicken wir mittlerweile auf mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung zurück. Die ersten Behandelten waren HIVPatienten. Aus über vierzig Probanden Christoph Huber: „Es braucht eben nicht nur Geist, sondern auch unter anderem viel Geld.“ wurde kein Fall von Leukämie festgestellt. Auch die unbehandelten HIV-Patienten entwickeln im Prinzip keine Leukämie, obwohl sie das Virus permanent in sich tragen. Bis jetzt wurde die Therapie nur bei bestimmten Formen von Leukämie erfolgreich eingesetzt. Was ist mit anderen Tumorarten? Brentjens: Bei soliden Tumoren haben wir das Problem der Immunosuppres- sion: Tumore schaffen um sich herum eine Umgebung, die den Immunangriff regelrecht lahmlegt. Ich glaube nicht, dass die CAR-Zellen, wie sie im Moment ausgestattet sind, diese Verteidigungslinie allein durchbrechen können. Wir werden etwas anderes hinzufügen müssen, das dies erst ermöglicht – oder den Patienten mit Molekülen vorbehandeln müssen, die das Terrain vor der Behandlung vorbereiten. Cedrik Britten: „Genzelltherapien sind ohnehin stark reglementiert und überwacht.“ Kalos: Eine andere Herausforderung bei soliden Tumoren ist, dass viele der angreifbaren Antigene auch auf anderen Geweben vorkommen. Mit der CAR-Therapie schaffen wir in dem Patienten eine neue Abwehr, die das Zielantigen sehr effizient erkennen kann. Wenn dieses sich auf essentiellen Organen wie dem Herz oder dem Gehirn befindet, wenn auch nur in geringen Mengen, kann das dramatische Folgen haben. Weil diese Technik sehr potent ist, kann sie eben auch sehr gefährlich sein. Die Herauforderung bei anderen Tumorarten wird es also sein, hochspezifische Zielantigene zu identifizieren, auf die man mit der Therapie ohne große Nebenwirkungen abzielen kann. Es scheint, als ob jetzt ein weiterer Durchbruch in der Zelltherapie aus Übersee kommt. Christoph Huber: Die Vorstellung, Innovationen auf diesem Gebiet kämen ausschließlich aus den Vereinigten Staaten, ist falsch. Gerade die CAR-Technologie kommt ursprünglich aus Israel. Es war Zelig Eshar vom Weizmann Institute in Rehovot, der sich Ende der achtziger Jahre das Konzept ausdachte und umsetzte. Die Entdeckung der ersten menschlichen Tumorantigene, auf die solche Techniken, aber auch Krebsimpfungen abzielen, wurde insbesondere von den Forschern um Thierry Boon in Brüssel und Ugur Sahin und Thomas Wölfel in Mainz vorangetrieben. Auch an der Geburt des TCR-Transfers (Anmerkung: eine ähnliche Technologie wie bei der CAR-Therapie) waren Mainzer Forscher um Matthias Theobald zusammen mit der Gruppe von Ton Schumacher in den Niederlanden maßgeblich beteiligt. Innovationen stammen oft aus Europa. Bei der klinischen und der kommerziellen Umsetzung sind uns unsere amerikanischen Kollegen allerdings meist überlegen. Das stimmt schon. Woran liegt das? Huber: Es braucht eben nicht nur Geist, sondern auch unter anderem viel Geld. Als die Europäische Kommission im Jahr 2004 die Förderung der klinischen Umsetzung unseres TCR-Transferprogramms kürzen musste, versuchten wir sie mit einer eigenen Firma zu retten – die wir zwei Jahren später wegen Mangels an Venture-Capital schließen mussten. Ein Großteil der innovativen Produkte in den Lebenswissenschaften stammt eben aus kleinen und mittleren Biotechnologie-Unternehmen, die hauptsächlich von Risiko-Kapital leben. Und dieses Kapital ist ungleich leichter in den Vereinigten Staaten erhältlich. Dort ist die Bereitschaft zum Risiko viel größer. Cedrik Britten: Es ist auch eine Frage der Infrastruktur. Den Schritt in die KliRenier Brentjens: „Die Zellen haben sich im Körper nicht vermehrt und waren nach einer Woche verschwunden.“ nik für aufwendige Zelltherapeutika schaffen vor allem große Zentren, wie die nationalen Gesundheitsbehörden NIH und NCI, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center oder die University of Pennsylvania, die nicht nur einen besseren Anschluss an die Herstellungseinrichtungen, sondern auch an Forschungsgelder haben. In Europa sind die Forschungsstrukturen wesentlich kleiner. Um den Zugriff auf die notwendige Infrastruktur zu gewährleisten und die Chancen auf Finanzierungen zu erhöhen, müssen sich Forscher vernetzen. Das ist eines der Ziele, die CIMT verfolgt: eine Plattform zu bieten für Vernetzungen, um nicht nur die Grundlagenforschung und die klinische Umsetzung vor- Vier Namen, eine Organisation: Was die Immuntherapie antreibt Vor zwei Jahren meldeten amerikanische Forscher die Heilung der ersten Leukämiepatienten mit einem neuen gentherapeutischen Ansatz. Seitdem wurden auch Kinder erfolgreich behandelt. Es gab aber auch in jüngster Zeit Todesfälle. Im Jahr 2010 etwa meldete die Gruppe von Steven Rosenberg am NIH den Fall einer Darmkrebs-Patientin, die kurz nach einer Genzelltherapie-Behandlung an Lungeninsuffizienz gestorben war. Vor kurzem starben zwei Patienten nach einer ähnlichen Therapie, weil die Immunzellen das Gehirn angegriffen hatten. Vier Experten äußerten sich auf dem elften Kongress der Association for Cancer Immunotherapy (CIMT) in Mainz zu Potential und Risiken der hochexperimentellen Therapie: Renier Brentjens und Michael Kalos forschen in den Ver- einigten Staaten, Christoph Huber und Cedrik Britten in Deutschland. Aus den Gruppen von Renier Brentjens am Memorial Sloan Kettering Center in New York und Michael Kalos von der University of Pennsylvania in Philadelphia kommen die ersten klinischen Erfolge mit der sogenannten CAR-Therapie bei der Behandlung von LeukämiePatienten. Bei der CAR-Technologie werden dem Patienten Immunzellen entnommen und diese mit einem gentechnischen Verfahren mit einem sehr potenten Rezeptor (CAR, chimeric antigen receptor) ausgestattet, der ein bestimmtes Merkmal an der Oberfläche von Tumorzellen erkennt. Um das Konstrukt – bestehend aus einem Antikörper und dem inneren Teil eines T-ZellRezeptors – in die Zellen einzubringen, werden meistens degenerierte HIV-ähn- liche Viren verwendet. Die modifizierten Zellen werden dann im Labor vermehrt und dem Patienten wieder injiziert. Christoph Huber gründete Anfang der achtziger Jahre die frühen Stammzelltransplantationszentren in Innsbruck und Mainz. Von 1990 bis 2009 leitete er die Klinik für Hämatologie und Onkologie an der Universität Mainz. Er ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des CIMT-Konsortiums. Cedrik M. Britten ist ebenfalls Mitgründer. Er leitet die Sparte zur klinischen Translation und an der Universität Mainz eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Entwicklung neuer immunologischer Biomarkertests beschäftigt. Zusätzlich ist er bei der Ribological GmbH in Mainz für die industrielle Entwicklung personalisierter Krebsimpfstoffe verantwortlich. (F.A.Z.) anzutreiben, sondern auch den Zugang zu Geldern zu erleichtern. Ist es auch schwieriger, im eher gentechnikfeindlichen Europa mit solchen Technologien voranzukommen? Huber: Der Europäer ist grundsätzlich skeptischer, weniger risikobereit als der Amerikaner. Dies betrifft die breite Öffentlichkeit und die Medien. Wie im Fall der SCID-Kinder werden häufig mehr die Nebenwirkungen erörtert als die Rettung sonst verlorener Patienten. Der Patient allerdings – ob amerikanisch oder europäisch – sieht dies anders. Er ist ein Vorwärtsstürmender, der viel mehr an Innovation glaubt und die persönlichen Risiken geringer einschätzt. ANZEIGE ISBN: 978-3-89843-219-1, Preis: 34,90 €, Update: 24,90 € Aktuelle CD-ROM mit 40.000 Wissenschaftsberichten aus F.A.Z. und Sonntagszeitung der Jahre 1993 bis 2011. Neu: Inklusive Online-Version. Registrieren Sie sich für das Wissenschaftsarchiv Online auf www.faz-wissenschaft.de. Bestellen Sie die CD-ROM inkl. 1 Jahr Online-Nutzung telefonisch (069) 75 91-10 10*, auf www.faz-archiv.de/nuw oder im Buchhandel. * normaler Festnetzanschluss Fortsetzung von der vorigen Seite F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G Britten: Genzelltherapien sind ohnehin stark reglementiert und überwacht. Nicht nur, weil es sich um Gentherapie, sondern im Fall der CAR-Technologie sich um eine potente und dadurch auch teilweise sehr riskante Therapieform handelt. Patienten sind dadurch gestorben. Das hat das Ganze, regulatorisch gesehen, noch eine Stufe aufwendiger gemacht – gleichermaßen für Europa wie auch für die Vereinigten Staaten (Anm: siehe Kasten). Werden in Europa derzeit Patienten mit CAR-Zellen behandelt? Britten: In England werden am University College of London und an der University of Manchester Patienten mit ALL behandelt, das Erasmus University Medical Center in Rotterdam testet CAR-Zellen bei Nieren-Karzinom-Patienten. Die Gruppe von Hinrich Abken in Köln will demnächst eine Studie zur Behandlung von kutanen Lymphomen starten und die Firma UniCell GmbH, eine Ausgründung der Universität Mainz, plant für 2014 eine Studie bei Ovarialkarzinom. Huber: Man muss wissen, dass solche Pilotstudien das Verfahren zuerst an ein oder zwei Duzend Patienten erproben. Erst wenn man die Risiken besser verstehen und bewerten kann, und mögliche Nebenwirkungen im Griff hat, wird die ursprüngliche Kohorte in streng kontrollierten Schritten auf ein paar hundert Patienten weltweit erweitert. Der Entwicklungsprozess einer experimentellen Therapie in der Klinik dauert eben lange. Die Fragen stellte Emmanuelle Vaniet.