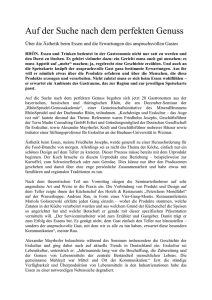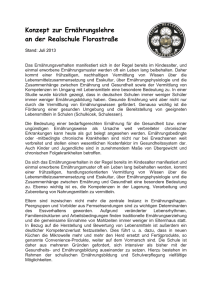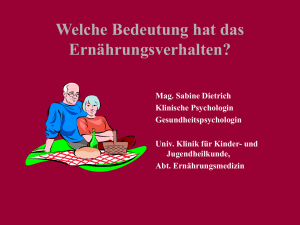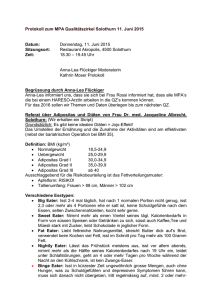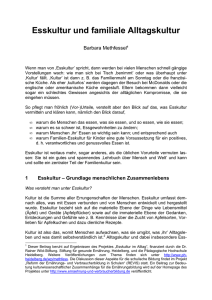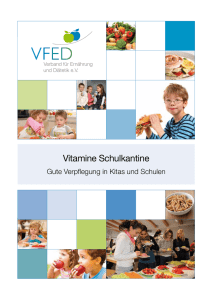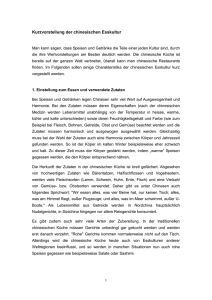4. Regionale Fachkonferenz NRW Bewegt IN FORM Bewegung und
Werbung

4. Regionale Fachkonferenz NRW Bewegt IN FORM Bewegung und Ernährung - aktiv vernetzen! 09. Mai 2012 im Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund "Esskultur vermitteln – eine unterschätzte Bildungsaufgabe?" Prof. Dr. Barbara Methfessel, Hochschule Heidelberg Schönen guten Morgen, mein Damen und Herren, Zunächst möchte ich meinem Vorredner für seinen spannenden Vortrag danken, in dem die Zusammenhänge, die oftmals eher undifferenziert dargestellt werden, doch sehr differenziert betrachtet wurden. Wenn ich jetzt andere Akzente setze, dann will ich ihm nicht widersprechen, sondern den Schwerpunkt auf eine andere Frage legen, nämlich darauf, welche Probleme im Alltag mit der Umsetzung der Vorschläge zu „ausreichender Bewegung“ und „gesunder Ernährung“ verbunden sind und wie sie zu erklären sind. Mir ist wichtig, die Umsetzungsmöglichkeiten von gesundheitsförderlichen Empfehlungen realistisch in den Blick zu nehmen und so auch Zugänge dazu entwickeln zu können, wie sie gefördert werden könnten. Meine Frage ist dabei vor allem, wie man in der Diskussion um Ernährung die Erkenntnisse zur Relevanz der Esskultur nutzen kann, um Essverhalten besser verstehen zu können und geeignetere Zugänge zur Gesundheitsförderung zu finden. Mein Vortrag heute bezieht dabei auch viele Erkenntnisse ein, die ich in unterschiedlichen Projekten – auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen – gewonnen habe1. Warum der Fokus Esskultur? Wenn man über die Entwicklung der Esskultur redet, dann werden schnell die ‚klassischen‘ Vorurteile genannt: „Die Jugendlichen heute haben keine Esskultur mehr, die essen vorrangig Fast Food-Produkte“. „In Familien wird nicht mehr zusammen gegessen.“ etc. Diese Vorstellung von Esskultur ist meistens von einzelnen normativen Vorstellungen geleitet, welche sich darauf beziehen, wie man „essen muss“, z. B. ‚selbst gekocht‘, möglichst am gemeinsam Tisch, mit Messer und Gabel etc. Esskultur hat aber einen viel weiteren Hintergrund, ohne dessen tieferes Verständnis man viele Aspekte der Ernährungsentwicklung weder analytisch, noch lösungsorientiert diskutieren kann. Was sollten Menschen essen? Bevor ich darauf komme, warum der Mensch wie isst, muss ich noch die Frage stellen: Was sollte ‚man‘ denn essen? Seit der Zeit des antiken Griechenland ist man in der Geschichte der zahlreichen Wirrungen darüber, was ‚man essen muss‘, über Jahrhunderte immer wieder auf vier Grundregeln zurück gekommen, an denen man sich heute noch orientieren sollte: 1. Pflanzliche Nahrungsmittel bevorzugen. 2. Die große Vielfalt der Nahrungsmittel nutzen. Einseitige Ernährung vermeiden. 1 Vgl. Hierzu die Informationen und Literaturangaben unter: www.ph‐heidelberg.de/ernaehrungs‐und‐ haushaltswissenschaft/personen/dozentinnen/prof‐dr‐barbara‐methfessel.html 3. Die Nahrungsmittel so gering wie möglich, aber so viel wie notwendig verarbeiten bzw. geringer verarbeitete Nahrungsmittel bevorzugen. Bei dieser dritten Grundregel möchte ich kurz zwei zentrale Begründungen nennen: Zum Einen können so die Nährstoffe, die in den Nahrungsmitteln sind, gut vom Körper genutzt werden, zum Andere kann mit gering verarbeiteten Produkten auch eher verhindert werden, dass kritische Nahrungsanteile bzw. Zusatzstoffe aufgenommen werden. Letzteres bezieht sich nicht nur auf Giftstoffe, sondern auch auf Zusatzstoffe, welche unseren Hunger-Sättigungsmechanismus beeinflussen, wie dies z. B. viele der Geschmacksstoffe können (was auch gezielt von der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird). 4. Die Bevorzugung von Lebensmitteln und Speisen mit einer geringen Energiedichte (d. h. dass wir mit der ‚sättigenden Masse‘ möglichst wenig Kalorien zu uns nehmen). Diese Regel gilt vor allem für Überflussgesellschaften. Wir haben inzwischen eine Ernährung, die auf sehr viele energiedichte Nahrungsmittel zurückgreift. Das heißt, mit wenig Masse bekommen wir sehr viel Energie, sehr viele Kalorien. Wir sind aber gewohnt, dass unser Magen gefüllt sein muss, damit wir das angenehme Gefühl von Sättigung auch erreichen – und das bekommt man natürlich über weniger energieintensive Nahrungsmittel schneller, als wenn man z. B. Schokoladenriegel isst. Diese Grundregeln sind einfach, ihre Umsetzung im Alltag stößt auf viele Hindernisse. Ein zentraler Faktor dafür ist, dass dieses Konzept nicht zu den esskulturellen Strukturen passt, die den heutigen Alltag vieler Menschen bestimmen. Wodurch entwickeln sich diese Strukturen? Wie erlernen Kinder sie? Ernährung (und auch Bewegung) scheinen selbstverständlich zu sein und bedürfen ‚eigentlich‘ keiner Anleitung. Menschen essen im Allgemeinen nicht, um spezielle Nährstoffe zu sich zu nehmen, sondern weil sie Hunger oder Appetit haben – und sie essen, was sie kennen und bevorzugen, und dies auch in eingeübten Strukturen. Warum benötigen Menschen eine Esskultur? Menschen haben meist einen strukturierten Alltag. Sie haben bestimmte Lebensmittel und Speisen, die sie morgens, mittags und abends essen, die sie zwischendurch noch zu sich nehmen oder die sie bevorzugen, wenn sie müde, traurig oder fröhlich sind. Dazu haben sie eingeübte „Programme“, über die sie meist nicht nachdenken. Darüber wird der Alltag strukturiert. Solche Handlungsstrukturen sind nicht angeboren. Anders als Tieren ist Menschen nur das Potenzial, solche Strukturen zu entwickeln, angeboren. Wie sie wann was essen, das wird „angegessen“, es wird über ein kulturelles System erlernt. Damit stellt sich für die Ernährungsbildung auch die Frage: Wie entwickelt sich das kulturelle System weiter und wer bestimmt und/oder beeinflusst dieses? Menschen benötigen eine Esskultur. Sie sind – wissenschaftlich gesprochen – ‚instinktlose Omnivoren‘. Das heißt, theoretisch können sie alles essen, was nicht giftig ist. Und das ist weitaus mehr, als bisher genutzt wird und als das, was auf den jeweiligen Speiseplänen steht. Wir könnten „die halbe Natur abgrasen“. Es gibt viele Gründe, warum dies nicht getan wird. Viele Lebensmittel, die hier in Westeuropa nicht gegessen werden, haben viele wertvolle Inhaltsstoffe, wären günstiger als hier bevorzugte (und werden daher in anderen Kulturen auch verzehrt). Menschen wissen meist nur, dass man etwas isst, aber nicht, was man warum isst. Die Auswahl des ‚ Essbaren‘ aus der Vielfalt dessen, was gegessen werden könnte, ist zu groß, um sie alltäglich treffen zu können. Es wäre nicht ‚alltagstauglich‘, jeden Morgen von Neuem anzufangen und zu fragen: "Welche aus den Millionen von Pflanzen esse ich denn heute?" Deshalb haben Menschen ‚essstrukturelle Systeme‘ entwickelt, die wesentlich dafür sind, das alltägliche Handeln zu prägen und zu strukturieren. Wir benötigen diese Esskultur. Esskultur wird durch das alltägliche Essen tradiert – und verändert. Sie wandelt sich mit den Generationen und den gesellschaftlichen Veränderungen. Um dies klarzustellen: Hier soll nicht vertreten werden, dass „früher alles besser“ war. Viele Rezepte haben wir zu Recht verloren. Es gibt heute weitaus mehr und auch bessere Lebensmittel, als es ‚früher‘ gab. Aber mit jedem Bissen, den wir essen, leisten wir einen Beitrag zur Entwicklung der Esskultur, schreiben wir sie fort. Daraus stellt sich die Frage: Welche Entwicklung nimmt sie? Welche Schritte unternehmen wir, um diese Entwicklung positiv zu beeinflussen? Deshalb beschäftigt sich mein Vortrag mit Esskultur und damit, was aus Präventionsperspektive damit zusammenhängt. Das Erbe der Evolution und die Herausforderungen der Gegenwart In meinem Studium habe ich noch gelernt, „es wird kein Fresser geboren, es wird einer gemacht“. Mein Vorredner hat gerade schon darauf hingewiesen, dass Menschen als Erbe der Evolution die Präferenzen für viel, fette und süße Nahrung mitbekommen haben. Hinzu kommt noch umami (der Geschmack einer Aminosäure und auch von Fleisch). Süß bedeutete ‚nicht giftig‘. Umami signalisiert Eiweiß. Bei bitter, dem Geschmack der Gifte, haben Menschen zunächst eine Aversion. Viel zu essen, bedeutete vor allem in Hungerzeiten zu nehmen, was da ist. ‚Wer weiß schon, was kommt‘? Fettpolster waren aus Evolutionsperspektive eine hervorragende ‚Wertanlage‘, denn sie haben das Überleben der Menschheit gesichert, die unsere Vorfahren waren. Diejenigen Menschen, die genetisch zu Übergewicht und Adipositas neigen und die, wissenschaftlich gesprochen, Energiekonservierungstypen2 sind, haben in Hungerperioden gewährleistet, dass wir hier heute sein können, wie wir sind. Ein Problem ist nur, dass genau diese Eigenschaft das heutige problematische Essverhalten erleichtert – darauf wurde eben schon hingewiesen. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur unser evolutionäres genetisches Erbe mit den Geschmackspräferenzen eine ‚Adipositasfalle‘ ist, oder dass von Bedeutung ist, dass Menschen unterschiedlich schnell und viel Fett einlagern. Zudem gibt es auch sehr unterschiedliche ‚Ess-Typen‘, ob ‚anerzogen‘ oder ‚angeboren‘. Auch die Lebensbedingungen und Lebensstile haben einen großen Einfluss. • Vielfalt: In Westeuropa leben wir vergleichsweise in einem Schlaraffenland. Es stehen so viele und auch so gute Lebensmittel zur Verfügung, wie noch nie vorher in der Geschichte. • Verfügbarkeit: Die Lebensmittel sind breit verfügbar und erleichtern auch das ‚Daueressen‘. Eines unserer pädagogischen Probleme ist, dass sich Kinder heute z. B. häufig selbstständig ‚am Kühlschrank‘ (o. ä.) bedienen dürfen. Dadurch werden die Essrhythmen, die wichtig sind, um esskulturelle Strukturen zu entwickeln, unterbrochen. ‚Snacking‘ und ‚Grazing‘ fördern auch die Sättigung durch weniger empfehlenswerte Speisen, weil dadurch der Verzehr der eher empfehlenswerten Gerichte bei den Mahlzeiten reduziert wird. 2 Zur neuesten Diskussion vgl. Peters (2012) in der Literaturliste. Jugendliche bedienen sich auch alleine aus dem Gefrierschrank. So findet sich plötzlich eine Stunde, bevor gemeinsam gegessen werden soll, eine TK-Pizza im Backofen. Wenn es dann heißt: Die Pizza war doch für Notfälle, dann kann als lakonische Antwort der Jugendlichen kommen: "Es war gerade ein Notfall. Ich hatte Hunger." Die Kontrolle der Zwischenmahlzeiten (u. a. durch Förderung sinnvoller ‚Snacks‘) gewinnt zunehmend an Bedeutung. • Verführung: Wir leben in einer Konsumwelt, in der mit allem Wissen der Wissenschaft Menschen zum Konsum verführt werden, auch zum Konsum von Lebensmitteln. Die beworbenen Lebensmittel sind meist nicht die empfohlenen (Die ‚Werbepyramide‘ der beworbenen Lebensmittel gleicht der auf den Kopf gestellten Pyramide mit den empfohlenen Lebensmitteln.) Die Verführung führt auch zur Veränderung des Verhaltens und der Wertschätzung: Vitaminsäfte (die, wie man inzwischen weiß, auch problematisch sein können) ersetzen Obst und Gemüse, Convenience-Produkte (die man auch in Bioläden bekommt) ersetzen das ‚Hausgemachte‘ und damit verändern sich auch Geschmacksgewohnheiten. Nicht zu verschweigen ist hier auch die ‚Allverfügbarkeit’ von Süßigkeiten (und Zucker, der in zahlreichen Varianten vielen Lebensmitteln zugefügt wird). Verführung wirkt nicht nur über Werbung und verlockende Produkte, sondern auch durch Zusatzstoffe, die den Hunger-Sättigungsmechanismus so beeinflussen, dass man mehr als notwendig essen will. Dieses Angebot trifft auf eine scheinbar gegen gegenläufige Entwicklung: Der Körperkult verlangt ‚schlanke‘ Figuren. Auch dafür bietet der Markt viele (Schein) Lösungen. All dies erschwert den Kampf gegen Adipositas. Der sinnvolle Umgang mit Vielfalt, Verfügbarkeit und Verführung ist nicht einfach. Die zunehmende Selbstbestimmung Jugendlicher ist angesichts eines solchen Angebotes eine Herausforderung für die Entwicklung von gesundheitsförderlichen Essgewohnheiten. Da wir heute in einer demokratischen Gesellschaft leben (und zum Glück haben wir sie), kann man Menschen nicht einfach verordnen, was sie tun oder lassen sollen. Die Entwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen für den Umgang mit dieser Lebenswelt sollte stattdessen über zwei Wege beschritten werden: 1. Jugendliche zu stärken, Verantwortung für sich, aber auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Dazu gehört, Zusammenhänge zu verstehen und zu reflektieren. Es sollten Wege entwickelt werden, wie sie ihr Ziel, einen selbst bestimmten Lebensstil aufzubauen, umsetzen können und so gleichzeitig einen Beitrag für die Esskultur der Zukunft leisten. 2. Die Rahmenbedingungen, d. h. die äußeren Strukturen so zu verändern, dass die gesundheitsförderlichen Essgewohnheiten verstärkt werden. Letzteres wird meist unterschätzt. Wie erwirbt man Essverhalten, wie entwickeln sich Esskulturen? Es gibt eine einfache Regel, die auch die Grundlage für jede Verhaltensänderung ist: Essverhalten erwirbt man durch essen. Beim Essen werden nicht nur Geschmackspräferenzen, sondern auch Werthaltungen geformt, werden Verhaltensund Handlungsmuster angelegt und gefestigt. Esskultur entwickeln ist u. a. das ‚Schaffen‘ von Geschmack. Dabei betrifft Geschmack nicht nur die sensorische, sondern auch die psychische und soziale bzw. sozio-kulturelle Ebene. Kalbs- oder Schweinshaxe mit Kraut gelten als ein Stück deutscher Esskultur. Man findet sie aber in bestimmten Regionen häufiger als in anderen, ebenso bei der älteren häufiger als bei der jüngeren Generation. Sie können also eher unter ‚süddeutsch‘ und ‚traditionell‘ eingeordnet werden. Nichtsdestotrotz wäre ein solches Gericht wahrscheinlich für die meisten in der Bandbreite dessen, was Sie essen würden, wenn sie hungrig sind. Ein Teller mit Wasserkäfern, in Asien eine Spezialität, würden wahrscheinlich eine mehr oder wenige erschrockene Ablehnung hervorrufen. Käferessen ist vollkommen außerhalb unserer Gewohnheiten. Wir hätten große Schwierigkeiten, diese Käfer anzurühren. Wir würden lieber erst einmal denken: „Da lege ich lieber einen Fastentag ein. Den brauche ich sowieso und warte, bis ich was Richtiges zu essen bekomme“. Etwas zu essen, was außerhalb unserer Kultur ist, erfordert das Überschreiten von Grenzen. Erleichtert wird dies, wo man Elemente der eigenen Kultur erkennt. Ein chinesisches Gericht mit Reis, Gemüse und Hühnchen-Fleisch mit ein bisschen Sojasauce gewürzt, zeigt – wenn man es analysiert – ausreichend Parallelen zur ‚heiligen deutschen Dreieinigkeit‘, einem ‚Teller‘ mit einem Kohlenhydratträger (hier Reis), Fleisch und Gemüse , allerdings in der chinesischen Variante gemischt. Man kann sich mit einem solchen Gericht modern und dennoch ausreichend ‚zuhause‘ fühlen. Die Akzeptanz von Lebensmitteln, Gerichten und Essweisen ist also weder vorbestimmt, noch mit der Kindheit abgeschlossen. Sie kann sich auch mit jedem Essen weiter verändern. Neben der Frage danach, was wir essen, ist auch von Bedeutung, wann und wie häufig gegessen wird? Essrhythmen sind wichtig. Häufiges Essen, ‚Grazing’ und ‚Snacking’ kennzeichnen den Wandel in den Essrhythmen. Dies ist nicht günstig zu beurteilen, weil der Körper-Essrhythmus und damit auch der HungerSättigungsrhythmus sich verändern. Es ist durchaus sinnvoll, feste Rhythmen zu haben. Je kleiner die Kinder sind, desto häufiger müssen sie essen und trinken, da kleine Kinder noch nicht ausreichend Nährstoffe und Flüssigkeit speichern können. Während Erwachsene durchaus auch mit drei Mahlzeiten am Tag auskommen können (aber nicht müssen, das hängt vom Ess-Typ ab). Essen und Emotionen oder: Ernährungsbildung beinhaltet die Schaffung positiver Esssituationen Essverhalten entwickelt über die Geschmackserfahrung, aber diese sind nicht einfach vorhersagbar. Sie sind verbunden mit Esssituationen. Nicht alles, was man isst, schmeckt sofort. Positive Situationen führen jedoch dazu, dass zunächst abgelehnter Geschmack (im limbischen System des Gehirns) mit positiven Gefühlen verknüpft wird und dann – mit mehr oder weniger Wiederholungen – als positiv gespeichert wird. Die Werbung nutzt diesen Zusammenhang sehr geschickt und bietet die Gefühle mit dem Produkt an. Bei gemeinsamem Essen mit Menschen, die man nicht mag, speichert unser Hirn Geschmack anders als bei einem Essen mit Menschen, die man mag. Diese Kombination von Gefühlen und Geschmack steuert das Essverhalten stark. Isst man im Urlaub etwas, was man zu Hause nicht gegessen hätte, verändert die Urlaubssituation die Wahrnehmung, und der Geschmack kann positiv gespeichert werden, weil er mit positiven Emotionen verknüpft wird. Esssituationen bieten Erfahrungen. Kuchen essende Kinder auf Familienfesten lernen z. B., dass ein süßer Kuchen in besonderen Situationen, in denen Menschen zusammenkommen und fröhlich sind, etwas sehr Gutes ist (… Kuchen ist gut, … Süßes ist gut…). Familienfeste, an denen Kuchen gegessen wird, sind auch ein Stück der Esskultur. Sie können und sollten ebenso wenig wie der Kuchen zugunsten einer Ernährungsbildung, die den Zuckerverzehr reduzieren helfen soll, gestrichen werden. Sinnvolle Schlussfolgerungen bzw. Fragen sind vielmehr: • In welche Esssituationen reihen sich diese Erfahrungen ein? • Welche anderen Esssituationen werden Kindern und Jugendlichen geboten? Welche Emotionen werden dort mit welchen Geschmäckern verbunden? • Gelingt es, Esserfahrungen auch in sinnvolle Alltagsmuster ‚einzuweben‘ und eine ‚breite‘ Geschmackssozialisation und Handlungskompetenz zu schaffen, in der nicht nur Kuchen, sondern auch Gemüsegerichte u. a. positiv ‚besetzt‘, selbst zubereitet und auch gerne gegessen werden kann. Gesteuert wird die Entwicklung von Essverhalten und Esskultur auch durch soziale Einflüsse und Werte: • Kinder essen– das kennen viele Lehrkräfte aus dem Unterricht – eher, was sie selber zubereitet haben. Das gilt auch, wenn sie vorher gesagt haben: „Das mag ich nicht“. Wenn man in der Nahrungszubereitung im Unterricht vier verschiedene Rezepte zubereiten lässt und einer Gruppe eines davon zugewiesen wird, wovon sie zunächst sagt: "Das will ich nicht. Das mag ich nicht. Ich will lieber das andere Rezept", essen die Jugendlichen dieser Gruppe bevorzugt anschließend das, was sie selbst zubereitet haben, und nicht das, was sie eigentlich zubereiten wollten. In der Auseinandersetzung mit dem Gericht wird eine Beziehung dazu hergestellt, und wenn z. B. die Nahrungszubereitung Spaß gemacht hat, kann sich die Beziehung zu dem Essen auch eher positiv entwickeln. • Sitzt jemand mit am Tisch, dem man imponieren oder vor dem man sich nicht blamieren will, ist man eher bereit, Fremdes zu probieren. Jugendliche lernen so oft Speisen (und Getränke) zu probieren und akzeptieren. Ernährungsbildung ist nicht nur Nahrungszubereitung. Aber die Freude bei der Nahrungszubereitung hat eine wichtige psychische Bedeutung für den Zugang zum ‚Kochen‘ und ‚Essen‘.3 Zur Beeinflussung des (auch eigenen) Ernährungsverhaltens sollten diese Zusammenhänge berücksichtigt werden. Geschmack und Essgewohnheiten ändern sich lebensgeschichtlich Geschmack und Essgewohnheiten entwickeln sich nicht nur in der Kindheit, sondern während des gesamten Lebens. Wir können unseren Geschmack nahezu täglich ändern, je nachdem wie wir bereit sind, uns auseinanderzusetzen. Ein sehr gutes Beispiel ist der Bierkonsum: Der Mensch hat eine Bitteraversion, und Generationen und Generationen von jungen Männern und inzwischen jungen Frauen gewöhnen sich mit aller Macht an den bitteren Geschmack des Bieres, weil das zum Erwachsenwerden gehört und damit oft auch zusätzliche Hoffnungen auf Anerkennung verbunden sind. Esskultur und Essverhalten ändern sich also lebensgeschichtlich. Die meisten kennen verschiedene Stufen des Essverhaltens in ihrem Leben. • Säuglinge reagieren noch auf Hunger und Durst (und den Wunsch nach Nähe). • Kindern wollen ‚groß werden‘. ‚Groß werden‘ bedeutet einerseits: Ich will das essen, was die Großen essen. Wer kleinen Kindern sagt (ohne, dass diese die Absicht bemerken): "Das brauchst Du nicht zu essen. Das ist nur für die 3 Dazu noch eine Anmerkung für alle, die – wie leider viele Rektoren – zum Thema Nahrungszubereitung in der Schule denken: „Das kann meine Frau auch. Die kocht zu Hause auch“: Arbeit in der Schulküche ist harte Arbeit und erfordert viel Kompetenz für den Umgang mit komplexen Situationen. Großen!", kann oft feststellen, dass die Kinder dann gerade das haben möchten. Dann essen sie z. B. sogar rohe Rote Beete, obwohl das nicht dem Kindergeschmack entspricht. Auf der anderen Seite wollen Kinder aber auch von einem bestimmten Alter an eigenständig (und d. h. auch widerspenstig) sein, sie wollen selbstständig werden und unbedingt nicht das tun, was die Eltern tun und was die Eltern wollen. Für solche Auseinandersetzungen (ob in Familien oder KiTas) sollte die Regel gelten, dass der Esstisch kein Kampfplatz für Familien- oder Erziehungsprobleme sein darf. Am Esstisch sollte man mit liebevoller Geduld, Verlockung und Selbstverständlichkeiten, ggf. auch mit Konsequenzen arbeiten. Druck kann dazu führen, dass ein Gericht, dass ein Geschmack mit Aversionen verknüpft wird – und das ist nicht das, was man erreichen möchte. Selbstverständlichkeiten können auch geschaffen werden, wenn eine fröhlich essende und das Essen (ehrlich) lobende Tischgemeinschaft zusammen kommt und ‚mitzieht‘. • Für Jugendliche muss Essen schmecken, satt machen – und auch gut für die Figur sein (ein Thema, das im Weiteren nach angesprochen wird). • Zum Erwachsen werden gehört für viele, beim Essen ‚vernünftiger‘ zu werden. Studierende berichten u. a. regelmäßig, dass sie auch Lebensmittel und Speisen akzeptieren (lernen), die sie zu Hause nicht gegessen haben. Die Zeit der ‚Kämpfe‘ gegen die Eltern ist vorbei. Man überlegt auch mehr, was der Körper benötigt. Mit den Jahren entwickeln viele Menschen neue Interessen und Gewohnheiten und verfeinern den Geschmack und die Fähigkeit zu genießen. Mit den Jahren, so wird gespöttelt, ist Essen „der Sex des Alters“ (d. h., bei Umfragen wird Essen als Genussgeber als wichtiger eingestuft als Sex). Die Genussfähigkeit kann steigen, weil Genuss auch erlernt werden kann. Daher freuen Sie sich ruhig auf das Alter. Genussfähigkeit kann man entwickeln. • Im hohen Alter kommt die Phase, in der das Essen keine Freude mehr bereitet. Das hat die Natur so vorgesehen. Leider führt dies auch zu dem Problem (welches wir aus den Altenheimen kennen), dass der Durst zurückgeht und zu wenig getrunken wird. Für eine erfolgreiche esskulturelle Bildung muss bedacht werden, welches Alter die Zielgruppe hat, wie sie reagiert und welche Wege daher sinnvoll sind. Selbstverständlichkeiten schaffen – auch durch gute Verpflegung in Schule, Kitas und andere Institutionen Selbstverständlichkeiten zu schaffen ist ein ganz zentrales Element der EsskulturBildung. Institutionen wie die Schule und KiTa oder Sportvereine sehen hier ihre Verantwortung oft nicht und/oder unterschätzen die Möglichkeiten. Im Gegenteil, sie fördern leider problematische Ernährungsgewohnheiten, in dem sie z. B. energiedichte, überzuckerte und zu fetthaltige Nahrungsmittel verkaufen. In Schulkantinen oder Pausenkiosken finden sich hoch-kalorische Müsliriegel (welche nichts mit Müsli zu tun haben) oder Schokoriegel und zahlreiche andere wenig empfehlenswerte Produkte. Hier ist eine zentrale Aufgabe, Angebots-Strukturen zu schaffen, über die das Gewünschte zum Selbstverständlichen und langfristig auch zum persönlich Präferierten werden kann. (Und für die daran verdienenden Hausmeister etc. müssen andere Lösungen gefunden werden.) Leider führt die fehlende Entwicklung der Institutionen dazu, dass auch eine gesundheitsförderliche Erziehung der Eltern behindert wird. Individuelle Gewohnheiten zu ändern, ohne die Umweltbedingungen mit zu ändern, ist schwierig. Veränderte Umweltbedingungen führen dagegen schneller zu veränderten individuellen Gewohnheiten. Wer Gesundheit fördern will, muss Strukturen entsprechend gestalten. Was in der Gesundheitsförderung als ‚SettingAnsatz‘ altbekannt ist, ist politisch (zu) wenig umgesetzt. Über die Verpflegung in KiTa und Schule könnten vielen Kindern neue Selbstverständlichkeiten vermittelt werden, die Chance wird bisher zu wenig genutzt. Zu den strukturellen Reformen sollten die Personen, die sie tragen, auch stehen. Wenn Lehrer und Lehrerinnen sich z. B. nicht mit den Kindern an den Tisch setzen, weil ihnen das Essen nicht gut genug ist, ist das nicht unbedingt eine passende Voraussetzung dafür, eine gute Schulesskultur zu schaffen (abgesehen davon, dass sie sich dann für ein besseres Essen einsetzen sollten). Über das Essen werden auch Werte, Normen und Vorstellungen von Gemeinsamkeiten tradiert. In Kitas, Schulen und Vereinen muss man bedenken, dass auch der kleine Pausensnack ein Beitrag zur esskulturellen Entwicklung ist. Da wird immer gesagt: "Das sollen die zu Hause lernen." Nein! Alles ist ein Beitrag der esskulturellen Entwicklung und jede/jeder muss in dem jeweiligen Bereich die Verantwortung übernehmen. Wenn in der Schule nur Croissants, Weißmehlbrötchen (mit einem Alibi-Salatblatt), Kuchen, Müsliriegel, Schokoriegel oder dergleichen verkauft werden, dann bedeutet dies: ‚Das darf man essen. Das ist OK‘. Sportvereine tragen leider auch zu ungewünschten Ernährungsgewohnheiten bei. Im Beitrag meins Vorredners wurde deutlich gemacht, dass Bewegung zentral ist, aber nicht zum schnellen und massiven Energieverbrauch führt. Dazu ein Beispiel über falsch verstandene Wirkungen: In Heidelberg haben wir mit der ‚Ballschule’ ein großes Projekt, durch das Kinder, die adipös sind, durch Sport zu Bewegung ermuntert werden sollen und so auch abnehmen können. Da ich mit Sportlern zusammenarbeite, kann ich häufig beobachten, wie Mütter vor dem Sport den Kindern noch ein süßes Getränk und einen Riegel zum Kauen anbieten, nach dem Motto: „Du braucht ja gleich ganz viel Energie!“ Wenn die Kinder nach dem Sport verschwitzt aus der Halle kommen, erhalten sie noch mal ein süßes Getränk und einen Riegel, weil sie ja so viel verbraucht haben. Eine solche Wirkung von Bewegung wird leider zu häufig verbreitet und verstärkt damit unerwünschtes Verhalten. Essen hat mehrere Dimensionen – sie müssen differenziert und beachtet werden Essen und Bewegung sind sehr stark mit Körperbeziehung und mit sozialen Bindungen verknüpft. Dies ist nicht nur bezogen auf Personen, sondern auch auf Situation sehr unterschiedlich. Sieht man zwei Jugendliche Döner essen, weiß man noch nicht viel über sie. Wir sollten unterscheiden (auch in Diskussionen mit Jugendlichen), in welcher Situation welches Essverhalten angesagt ist. Wir wissen aus Studien, dass Jugendliche nicht so viel Fast Food essen, wie das klassische Vorurteil vorgibt. Fast Food ist ein akzeptiertes Essen, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Das muss noch nicht zu Adipositas führen (männliche Jugendliche im Wachstum haben auch einen hohen Kalorienbedarf). Für sie gibt es trotzdem noch das familiäre Essen. Das ist gar nicht so ‚ausgestorben‘, wie es oft beschrieben wird. Es ist immer noch eine feste Größe, auch wenn sie sich ändert (z. B. von der Mittagsmahlzeit zur Abendmahlzeit).4 4 Zum Essverhalten Jugendlicher und zu Alternativen zur bisherigen Bildungsarbeit vgl. die Studie von Bartsch (2008; s. Literaturliste). In der Schule sollte das Thema ‚Fast Food’ wenig thematisiert werden, zumindest nicht unter der Zielsetzung, Fast Food als ‚schlechtes Essen‘ darzustellen. Die neue ‚pädagogische Variante‘, Fast Food ab und zu mal zu erlauben, ändert nichts daran, dass man den Kern der Bedeutung nicht trifft. Jugendliche werden es weiter essen. Es ist ein Essen, was zu ihrer Freizeit gehört. Wenn man das Thema Fast Food nennt, wissen die Jugendlichen meist gleich, dass jetzt ‚ein erhobener Zeigefinger’ kommt. Da werden die kessen Jungs in der letzten Reihe sagen: „Jetzt wollen Sie uns wieder erzählen, dass wir das nicht essen sollen!“ Und genau das ist es, was uns nicht weiterbringt. Stattdessen ist eine neue Grundorientierung gefordert: Verstehen und reflektieren lernen, was wann bei wem warum im Essalltag welchen Platz hat. Außerdem sollte man in der Schule oder bei anderen Interaktionen mit Jugendlichen eher positive und alltagstaugliche Handlungsalternativen dazu bieten, wie Essen im Alltag schnell, preiswert und lecker organisiert werden kann, ggf. auch, welche (praktikablen!) Alternativen es für die Außer-Haus-Verpflegung gibt etc. Essen und Körperbeziehungen Essen ist verbunden mit Identität, auch mit Geschlechtsidentität. Wir wissen, dass Frauen eher vegetarisch und generell mehr Gemüse essen und dass Männer ‚fleischorientierter‘ sind. Die Reduktion von Fleisch ist eine zentrale Forderung in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), die auf ‚harte‘ kulturelle Grenzen stößt. Fleisch gehört in unserer Kultur zu ‚gutem Essen‘, vor allem für Männer. Das hat viele Ursachen, u. a. wirkt ein uralter Mythos, dass Männlichkeit und Fleisch zusammenhängen. (Sexuelle Identität, Erotik und Essen sind eng verbunden, was hier aber kein Thema ist.) Männlichen Jugendlichen (auch in unserem Studiengang ‚Gesundheitsförderung) denken immer noch, dass sie Fleisch essen müssen, um Eiweiß für die Muskeln zu bekommen. Dass die Deutschen durchschnittlich so viel Eiweiß verzehren, dass dies für eine Phase des aktiven Muskelaufbau-Kraftsport-Trainings reicht, wird schnell ausgeblendet. Vegetarier unter Männern gelten schnell als ‚schwul‘. Eine andere Entwicklung, die kennzeichnend für eine sehr problematische geschlechtsspezifische Beziehung zwischen Essen und Identität ist, besteht im ‚normalverrückten‘ Essverhalten von Frauen. In den Diskussionen zur Gesundheitsförderung ist meist das Übergewicht im Blick. Die Prävention von gesundheitsgefährdender Adipositas ist sicherlich positiv. (Die Beispiele des Vorredners belegten dies.) Die Diskussion darum muss aber kritisch hinterfragt werden. Von Übergewicht spricht man bei einem BMI von 25 bis 30 (mit jedem Jahrzehnt kann ab dem 40. Lebensjahr die Grenze um einen Punkt nach oben geschoben werden). Hat man keine Stoffwechsel- oder Gelenkprobleme, dann muss ein solches Gewicht gar nicht problematisch sein, im Gegenteil, nach einer WHO Studie ist leichtes ‚Über‘gewicht sogar gesundheitsförderlicher (die Versorgung mit allen Nährstoffen ist wahrscheinlicher, bei Krankheiten hat man ‚Reserven‘ etc.). Das ‚Normalgewicht‘ sagt auch nichts über die Qualität der Ernährung aus. Problematisch ist Adipositas, vor allem ab einem BMI von 35 (mit einem BMI von 30 und 35 gibt es viele gesunde Menschen). Die Diskussion über das Gewicht führt dazu, dass Menschen, die kein ‚Normalgewicht‘ haben, ein schlechteres Gewissen bekommen, ihr Essen stark kontrollieren (was nachweislich auch problematisch ist) und ggf. aus Frustration noch mehr essen. Jugendliche (Mädchen und Jungen auf unterschiedliche Weise) entwickeln zunehmend eine verschobene Wahrnehmung von ihrem Körper. Aufrütteln sollten uns hier vor allem die Daten der KIGGS-Studie (vom Robert Koch-Institut) unter den Jugendlichen: • Sieben Prozent der Drei- bis Siebzehnjährigen sind untergewichtig oder stark untergewichtig. • In Deutschland leiden 100.000 Frauen an Magersucht, etwa 15 Prozent von ihnen sterben daran. • Die Zahl der (meist weiblichen) Bulimie-Erkrankten lag bei fast 700.000. • Bei jungen Mädchen nimmt die Gefahr durch Essstörungen derzeit stärker zu als die Gefahr der Adipositas. In der Auseinandersetzung mit Adipositas sind weitere Aspekte zu beachten: Nach der KiGGS-Studie • haben ca. 75 % der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren Normalgewicht, • aber nur 40 % von diesen meinen, genau das richtige Gewicht zu haben, • d. h. 60 % der Normalgewichtigen nehmen sich zu dick wahr. ‚Gewichtshysterie‘ kann falsche Schönheitsideale unterstützen, welche wiederum die Entwicklung von Fehlwahrnehmung begünstigen. Nach den Erfahrungen der letzten 20-30 Jahre fördert dies einen verhängnisvollen Kreislauf von Essproblemen, Diäten und psychischem Leiden, der nicht selten auch zu schwerem Übergewicht bzw. Adipositas führt („Diäten JoJo“). Die Selbstwahrnehmung als ‚zu dick‘ kann weitaus größeren Einfluss auf die Lebensqualität haben als das reale Gewicht. Gravierender als die Folgen des realen Übergewichtes ist damit das Leiden unter dem ‚gefühlten‘ Übergewicht. Wenn sich nur ca. 60 % der adipösen Mädchen und ca. 32 % der adipösen Jungen für ‚viel zu dick‘ halten, kann dies also auch Schutz vor Selbstmissachtung bieten. Es kann aber auch eine Abwehrstrategie gegen die mit Adipositas verbundene Ablehnung des eigenen Körpers handeln. Die medial präsentierten Körperbilder erschweren zu akzeptieren, dass es von Natur aus eine Vielfalt von Körperformen gibt und dass nicht nur eine Körperform schön ist. Der stattfindende Kampf um den mageren (und bei Jungen muskulösen) Körper, die damit verbundenen Essweisen ebenso wie die Wunderdiäten und die diversen Pillen, Getränke und ‚Pulver‘ sind eine reale Bedrohung für die Gesundheit geworden. Problematisch ist auch, dass Figur und Gewicht zunehmend zum ‚Dissen’ (mobben, ausgrenzen) genutzt wird. „Du bist fett!“ist eine selbstverständliche Gemeinheit auf den Schulhöfen geworden, die auch schlanken Mädchen gesagt wird. Magersucht hat zwar viel mit dem Ziel der Autonomie zu tun („Ich kann über meinen Körper selber bestimmen“), ihre Verbreitung ist durch die gesellschaftliche Entwicklung (und ggf. auch durch die öffentliche Diskussion gegen das Übergewicht) gefördert worden. Körperbeziehung und Identität ist bei der Arbeit mit Jugendlichen ein wichtiges Thema der Prävention. Ziel sollte dabei nicht der schlanke Körper sein, sondern ein positives Verhältnis zum eigenen Körper. Essen schafft kulturelle und soziale Identität Menschen erkennen oft erst bei längeren Auslandsaufenthalten, wie wichtig ihr ‚heimisches‘ Essen ist. Auf die Frage: "Was fehlte Ihnen am meisten?" kommt bei Deutschen als Antwort meistens „Deutsches Brot“. Italiener können meist nicht ohne ihre Pasta leben, Asiaten nicht ohne Reis. Das ist nicht bewusst zu steuern, sondern hängt mit den schon erwähnten Verknüpfungen von Geschmack, Emotionen und Identität zusammen. So kann Geschmack das Gefühl von Sicherheit (oder auch Unsicherheit) verstärken. Essen dient im Alltag dem Gefühl von Sicherheit, dies ist nicht zu unterschätzen. Es gibt den alten Spruch: „Wenn ich traurig bin, setze ich mich in meine Bonboniere und ein Gummibärchen hält mir die Hand“. Auf die Frage, wann sie Süßigkeiten essen, antworten Zweidrittel meiner Studierenden, wenn sie unter Stress stehen. Das entspricht auch den Erhebungen des Ernährungspsychologen Pudel. Essen grenzt aus! Nicht (nur), weil bei verschiedenen Menschen ggf. unterschiedliche Geschmacksrichtungen bevorzugt werden, sondern weil jede Kultur klare Normen hat, was ‚man isst‘ oder ‚man nicht isst‘. Wenn diese Normen verletzt werden, kommt es zu Spannungen. Für die deutsche Kultur gehört Schweinfleisch, das z. B. für Muslime und für Juden als ‚schmutzig‘ gilt. Lehrkräfte in der Schule verstehen oft nicht, dass dadurch ein grundsätzlicher Ekel gegenüber Schweinfleisch das Verhalten bestimmen kann, auch bei nicht (mehr) Gläubigen. Es handelt sich nicht um ein ‚Getue‘. Muslime können inzwischen Alkohol trinken, Sex außerhalb der Ehe haben und womöglich gar nicht mehr gläubig sein. Der Ekel über den anderen Geschmack oder schon die Vorstellung bleibt. So ergeht es Deutschen, wenn sie Hunde, Insekten oder auch Pferdefleisch essen sollen. (Man kann provozierend fragen: Warum sollte man keine Hunde essen? In Deutschland gab es bis 1929 noch Hundeschlachtereien.) Auch zwischen den unterschiedlichen sozialen Milieus und den Generationen in Deutschland gibt es eine Abgrenzung über esskulturelle Codes. Dies muss in der alltäglichen Arbeit respektiert werden. Es ist eine Herausforderung der Präventionsarbeit (und des ‚Empowerments‘) die jeweiligen Gruppen selber entwickeln zu lassen, wie sie die Grundregeln beachten möchten. Ein guter Weg kann dabei sein, zusammen zu kochen, denn dadurch kann sich auch ein Essverhalten verändern. Übrigens tun das in bestimmten Situationen sogar Männer ganz gerne. (Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Männer sind eine schwierigere Gruppe als Frauen, was die Ernährungsbildung angeht. So ist es.) Der Mensch ist, was er isst In Präventionskonzepten wird oft übersehen, dass es wenig nutzt, Normen zu setzen, wie: „Das ist gesund. Das ist ungesund. Das darf man essen. Das darf man nicht essen!“ Dies führt zu einer Gegenüberstellung von ‚Lecker‘ und ‚Gesund‘ bzw. Spaß und Gesundheit und dadurch fehlt letztlich auch die Motivation, warum man sich an solchen Normen orientieren sollte. Um Gesundheit durch Ernährung zu fördern, muss man eine positive Beziehung zum eigenen Körper entwickeln. Dazu muss man verstehen, welche Bedeutung Ernährung für den Körper hat. Mein Lieblingsbild dazu ist das Küken, das aus einem Ei schlüpft. Haben Sie je überlegt, dass dieses kleine Wesen, dass aus dem Ei krabbelt, vorher Eiklar und Eidotter war? Dieselben Grundmaterialien sind zu Schnabel, Federchen, Augen, Beinen, Knochen geworden, all dies ist aus dem Eidotter und dem Eiklar (einem genetischen Code folgend) gebildet worden. Dies ist mein Lieblingsbild für Stoffwechsel und es zeigt: Wir sind nur aus dem geschaffen, was wir essen. Der Körper ist kein ‚Durchlaufmodell‘, in dem oben die Nahrung eingefüllt wird, wie Benzin als Energiegeber für den Motor. Hinzu kommen noch ein paar Vitamine, wie beim Motor das Öl. Unser Körper wird jeden Bruchteil der Sekunde umgebaut. Er wird permanent abgebaut. Er wird permanent wieder aufgebaut. Kinder und Jugendliche wachsen, bei ihnen dient Essen auch zum Aufbau einer ‚Grundsubstanz‘, die für die weitere Entwicklung auch eine Bedeutung hat. In allem, was unseren Körper ausmacht, ist wiederzufinden, was vorher zugeführt, d. h. gegessen wurde. Es gibt nichts anderes, aus dem der Körper bestehen kann. Dadurch bestimmt die Qualität unserer Nahrung auch die ‚Qualität‘ unseres Körpers mit. Damit z. B. Knochen nicht porös werden, benötigt man alle Stoffe, aus denen die Knochen aufgebaut werden – und den Druck durch die Bewegung. Beeindruckend ist auch das Beispiel der Darmzotten. Wenn man den Darm mit den Darmzotten auseinander zieht, ergibt das eine Fläche von einem viertel bis einem halben Fußballfeld (die Daten differieren). Alle anderthalb Tage wird die Hälfte dieser Größe im Darm ab- und neu wieder aufgebaut – und zwar bei ‚laufendem Betrieb‘. Das führt auch dazu, dass nach einigen Wochen einer veränderten Ernährung der Körperaufbau auch verändert wird – im Guten wie im weniger Guten. Diese Zusammenhänge werden oft übersehen. Zum Glück wird das Gehirn nicht so schnell umgebaut wie die Haut (Darm gehört zur Haut), der Umbau von Knochen benötigt auch mehr Zeit, aber viele Organe, vor allem die Leber als Entgiftungsorgan, unterliegen einem schnelleren Ab- und Aufbau. Gewicht allein sagt zu wenig Für eine sinnvolle Prävention ist ein differenziertes Verständnis der Bedeutung von Ernährung Voraussetzung, aber leider nicht immer ausreichend vorhanden. Die ‚Kalorien‘, d. h. die Energiezufuhr sind nur ein Teil des Adipositas- und ErnährungsProblems. Wichtiger ist die Qualität dessen, was gegessen wird. Viele Menschen, die schlank sind, sind schlecht ernährt, weil sie auf wichtige Lebensmittel und damit auch auf Nährstoffe verzichten. Leicht ‚übergewichtige‘ Menschen sind nach internationalen Untersuchungen oft gesünder, weil bei ihnen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie alle Nährstoffe, die sie benötigen, auch bekommen. Zwischen einer problematischen Adipositas und dem so genannten Wohlfühlgewicht gibt es eine große Grauzone. Es ist schwer, allgemeine Aussagen dazu zu treffen, wo Gesundheitsprobleme zu erwarten sind. Eine Bewertung der Fettmasse muss z. B. auch zusammen mit der vorhandenen Muskelmasse erfolgen. Mein Vorredner hat deutlich gemacht, dass Fettgewebe und Muskeln eine eigenständige Stoffwechselbedeutung haben. Gleichzeitig wirken sie zusammen, auf der Ebene des Stoffwechsels und der Ebene des Verhaltens: Je größer das Muskelgewebe unter dem Fettgewebe ist, desto größer ist auch das gesundheitliche Potenzial und die Bereitschaft, sich auch zu bewegen. Schlankheit ist daher alleine kein Qualitätsmerkmal. Gesundheit hat mehrere Einflussfaktoren Essen beeinflusst Gesundheit nicht nur über die aufgenommenen Nährstoffe. Es hat auch soziale und psychische Funktionen und kann darüber auch wirksam werden. Essen dient u. a. auch der Spannungsabfuhr. Hunger erhöht den Adrenalinspiegel ebenso wie Stress. Nach der Nahrungsaufnahme sinkt (durch die Ausschüttung von Verdauung und Stoffwechsel steuernden Hormonen) der Adrenalinspiegel, was auch gesundheitsförderlich ist. Essen kann ebenso wie Bewegung Menschen wieder zu einer inneren Balance verhelfen. Essen bei Stress ist daher zunächst einmal ein ‚normales‘ Verhalten und darf nicht generell als ‚schlecht‘ bewertet werden. Mein Standardsatz ist dazu: "Mir ist es lieber, dass jemand, der voller Frust von der Arbeit nach Hause kommt, ein bisschen zu viel isst, als dass er seine Frau und Kinder verhaut!“. Unsere Großmütter haben bei schlechten Noten z. B. immer schon gewusst: „Erst nach dem Essen. Sag das Papa ja nicht vor dem Essen". Die Aggressivität ist vor dem Essen größer. Oscar Wilde sagte dazu: „Nach einem gutem Essen kann man allen verzeihen, sogar der eigenen Verwandtschaft“. Im Zusammenhang mit dem Essverhalten Jugendlicher wurde schon darauf hingewiesen, dass es problematisch ist, nur die Adipositas im Blick zu haben (auch wenn hier die Problematik der Zunahme nicht geleugnet werden soll). Adipositas bei Kindern weist auf Probleme mit der Ernährungsversorgung und/oder dem Essverhalten hin. Dennoch gilt auch im Kampf gegen die Adipositas – selbst wenn dies widersprüchlich klingt –, dass falsche Schlankheitsideale mehr Opfer als Fettringe fordern. Mit Präventionsprogrammen, die bei Kindern Selbstbewusstsein und eine positive Körperbeziehung (auch bei Adipositas) fördern, kann man den Weg zu einem ‚normalen‘ Essverhalten ‚freimachen‘. Verstärkt man die Abneigung gegen das ‚Dicksein‘, gelingt Letzteres nicht. Die sinnvolle pädagogische Orientierung ist nicht Schlankheit, sondern die Freude am eigenen Körper, auch mit genussvollem Essen. Wer seine Freude am eigenen Körper hat, der will auch eher sorgfältig mit ihm umgehen. Wenn, wie erwähnt, 60 % der normalgewichtigen Mädchen in der Pubertät der Meinung sind, dass sie zu dick sind, ist diese Voraussetzung nicht gegeben. Dieser ‚Schlankheitsdruck‘ führt Mädchen (wie Jungen) in ein ‚Diäten-Jojo‘, in dem auch der Hunger-Sättigungsmechanismus gestört wird. Dies geschieht unter anderem, indem durch eine größere, häufige und/oder längerfristige Reduktion der zugeführten Energie der Grundumsatz gesenkt wird. Da über den Grundumsatz der (meist weitaus) größere Anteil der Energie verbraucht wird, ist damit eine Energieüberversorgung und folgend Übergewicht und Adipositas schnell vorprogrammiert. Prävention und Gesundheitsförderung berühren noch weitere Aspekte, die hier nur kurz angerissen werden können, die aber zu beachten sind: • Ernährungs- und Gesundheitsbildung benötigen Verbraucherbildung Ohne Verbraucherbildung kann ein kompetenter Umgang mit den Verlockungen der Konsumgesellschaft nicht erreicht werden. Werbung enthält Verführungen und falsche Versprechungen, die durchschaut werden müssen. Wenn mit ‚natürlicher Energie der Dextrose‘ geworben wird, die nichts anderes ist als billige, aus Mais gewonnene Glukose, oder mit ‚Schokolade für Kinder‘, von der viele Großeltern nicht wissen, dass sie keine ‚bessere‘ Schokolade ist, sollte man diese Botschaften als falsch und irreführend erkennen können. Vitamin- und Eiweißmythen (zum Muskelaufbau) müssen entzaubert und Diäthypes muss widerstanden werden. An Verbraucher und Verbraucherinnen werden hohe Anforderungen gestellt. • Über die Gesundheitsdiskussion darf die Nachhaltigkeit nicht vergessen werden Der Fleischkonsum gerät dabei ebenso in die Diskussion wie der Ressourcenverbrauch durch Transport, Treibhäuser oder Bewässerung. Im Globalen Zusammenhang muss man feststellen, dass die Mast eines Schweines oder gar Rindes die Nahrung eines Menschen aus der sog. ‚Dritten Welt‘ ‚verschlingt‘ – und damit Hunger produziert. Wir vernichten so die Grundlagen unseres Lebens. Hier ist die Aussage zu bedenken, dass wir nur mit ökologischem Wirtschaften überleben, oder gar nicht. • Ernährungsbildung kann auch nicht ohne Wertebildung erfolgreich sein Was wofür eingesetzt wird, ist von Werten abhängig. Bio-Produkte und Gemüse sind vielen zu teuer, die für Katzen- und Hundefutter, für Kosmetik und vieles andere (in Relation) weitaus mehr Geld einsetzen als für ihr eigenes Essen. Der Werbeslogan: „Weil ich es mir wert bin!“ kann auch auf den alltäglichen Umgang mit sich selbst übertragen werden. • Gesundheit ist ein ‚soziales Problem‘ Soziale Unterschiede (auch Armut) haben einen großen Einfluss auf Lebensbedingungen, Lebensstile und Essverhalten. Auch hier sind Veränderungen der Rahmenbedingungen wirksamer als GesundheitsKampagnen. Was ist aus dem allen für Regeln zur Entwicklung von Esskultur und Ernährungsverhalten und -handeln abzuleiten? Ernährungs- und Gesundheitsverhalten sind lebenslänglich im Wandel, also veränderbar. Sie können sich langfristig (bis auf Ausnahmen) auch nur im Lebensprozess ändern, also nur langsam, durch Umgewöhnung und Entwicklung neuer esskultureller Systeme. Keine/keiner sollte versuchen, von heute auf morgen alles zu ändern. Das ist nicht realistisch. Es macht keinen Spaß, denn neue Geschmäcker muss man erst lieben lernen, und ist (daher) auch meist nicht erfolgreich. Wichtig sind kleine Schritte, die möglichst verbunden werden mit der der Schaffung neuer Selbstverständlichkeiten und mit den dazu gehörigen Rahmenbedingungen. Dabei sollten alters- und situationsgerechte Lösungen gesucht werden. Die Lösungen für Ältere sind anders als die für pubertierende Jugendliche. Und für alle Gruppen ist wichtig, dass sie ihre eigenen jeweils akzeptierten Wege finden. Rahmenbedingungen wie Gemeinschaftsverpflegungen in Schule und Kita haben großen Einfluss auf die Entwicklung von Ess- und Bewegungsverhalten. Eine Gesellschaft hat, vor allem in öffentlichen Räumen, die Aufgabe, ihre Kinder vor Körperverletzung zu schützen (und manche Schulangebote grenzen an Körperverletzung). Abgesehen davon gibt es keinen anderen Bereich, in dem man so wirksam und auf längere Sicht auch so preiswert Gesundheit durch Ernährungs- und Bewegungsangebote, d. h. durch Essen und Bewegen fördern kann. Die nächsten Generationen beginnen schon heute, die Esskultur weiter zu entwickeln; was dies bedeutet, kann man auch mit ihnen zusammen thematisieren.5 Esskultur ist ein Teil der Alterskultur und als solche muss sie vermittelt werden. Das ist eine bisher unterschätzte Bildungsaufgabe. Ich danke für Ihr Durchhaltevermögen. Literatur: Bartsch, S. (2008): Jugendesskultur: Bedeutung des Essens für Jugendliche im Kontext Familie und Peergroup, in Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung (Bd. 30), BZgA, Köln. http://www.bzga.de/botmed_60630000.html Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg) (2011). GUT DRAUF – zwischen Wissenschaft und Praxis. Eine bundesweite Jugendaktion der BZgA zur nachhaltigen Gesundheitsförderung. Gesundheitsförderung konkret, Band 15. Bearbeitet von Reinhard Mann, Benita Schulz und Simone Streif. Köln: BZgA http://www.bzga.de/infomaterialien/gesundheitsfoerderung-konkret/ Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) (Hrsg.) (2004). Ernährungsbericht 2004. Bonn: DGE. (S. darin Kap. 1.4, Zeitbudget, Mahlzeitenmuster und Ernährungsstile, S. 72-94) 5 Der Döner ist z. B. kein türkisches Produkt. Döner ist in Deutschland ‚erfunden‘ worden und ist ein Beispiel für die Kombination traditionell türkischer und aktueller deutscher Fast Food‐Kultur. Hauer, T. (Hrsg.) (2005). Das Geheimnis des Geschmacks. Aspekte der Ess- und Lebenskunst. Frankfurt: Anabas. Heindl, I. Kulinaristik und Allgemeinbildung. In: A,Wierlacher & R. Bendix (Hg) KULINARISTIK Forschung – Lehre – Praxis, Band 1, Lit Verlag, Berlin (2008). S. 129–146. Heindl, I.; Methfessel, B. & Schlegel-Matthies, K. (2011). Ernährungssozialisation und -bildung und die Entstehung einer ‚kulinarischen Vernunft‘. In A. Ploeger; G. Hirschfelder & G. Schönberger (Hrsg.), Die Zukunft auf dem Tisch. Analysen, Trends und Perspektiven der Ernährung von morgen (S. 187-201). VS-Verlag, Wiesbaden. Juul, J. (2005). Was gibt‘s heute. Gemeinsam essen macht Familien stark. Beltz, Weinheim Kersting, M. (Hrsg.) (2009). Kinderernährung aktuell. Schwerpunkte für Gesundheitsförderung und Prävention. Sulzbach: Umschau Verlag Kurth, B.M. & Schaffrath-Rosario, A. (2007). Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesgesundheitsbl. Gesundheitsforsch .Gesundheitsschutz 50: 736–743. Kurth, B.M. & Ellert, U. (2008). Gefühltes oder tatsächliches Übergewicht: Worunter leiden Jugendliche mehr? Dtsch Arztebl 105(23): 406–12. http://www.aerzteblatt.de/archiv/60380 Methfessel, B. (Hrsg.) (1999). Essen lehren - Essen lernen. Beiträge zur Diskussion und Praxis der Ernährungsbildung. Baltmannsweiler: Schneider. (3. Auflage 2002) Methfessel, B. (2004). Esskultur und familiale Alltagskultur. Beitrag zum OnlineFamilienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik. www.familienhandbuch.de. https://www.familienhandbuch.de/ernaehrung/sonstiges/esskultur-undfamiliale-alltagskultur Methfessel, B. (2005). Soziokulturelle Grundlagen der Ernährungsbildung. Paderborner Schriften zur Ernährungs- und Verbraucherbildung, herausgegeben von H. Heseker & K. Schlegel-Matthies (Hrsg.), H. 7. Auf der Homepage des Projektes REVIS unter http://www.ernaehrung-undverbraucherbildung.de/wissenschaft_ernaehrung.php als Download verfügbar. Methfessel ,B. (2007). Essen in der Schule: großer Reformbedarf. http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Ernaehrung/s_2426 .html Methfessel, B. (2008). Schulverpflegung im Lebensraum Schule – Verantwortlichkeiten, Chancen und Herausforderungen. Haushalt & Bildung, 85 (1) 10-19. Methfessel, B. & Sammet, T. (2008). Informationen zu Übergewicht und Adipositas In Regierungspräsidium Stuttgart & Landesgesundheitsamt (Hrsg.), GESUND AUFWACHSEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG. Kommunale Netzwerke für Ernährung und Bewegung - Ein Handbuch. (59 – 64), Stuttgart. http://www.familie-plus-sha.de/Handbuch.pdf Methfessel, B. (2009). Der Mensch ist, was er isst – der Mensch isst, was er ist. Perspektiven zur pädagogischen Professionalisierung, Heft 77, Themenheft „Gesundheit – Last oder Lust“. Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule. WS 2009/2010 (S. 13-25). Landau: Verlag Empirische Pädagogik Methfessel, B. & Schlegel-Matthes, K. (2011). Ernährung und Diätetik. In H.-W. Hoefert / C. Klotter (Hrsg.), Gesunde Lebensführung. - kritische Analyse eines populären Konzepts. Bern 127-142): Bern: Huber Methfessel, B. (2011). ‚Gesunde Ernährung‘ als gesundheitspädagogische Aufgabe. In W. Knörzer & R. Rupp (Hrsg.), Gesundheit ist nicht alles? - Was ist sie dann? Gesundheitspädagogische Antworten (S. 78-90). Hohengehren: Schneider. Pope, H. G., Phillips K. A. & Olivardia, R. (2001). Der Adonis Komplex. Schönheitswahn und Körperkult bei Männern. München: dtv. Pudel, V. & Westenhöfer, J. (2003). Ernährungspsychologie. Eine Einführung. Göttingen: Hogrefe. Setzwein, M. (2004). Ernährung - Körper - Geschlecht. Zur sozialen Konstruktion von Geschlecht im kulinarischen Kontext. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Vgl. die in den angegebenen Beiträgen aufgeführte Literatur sowie unter http://www.ph-heidelberg.de/ernaehrungs-undhaushaltswissenschaft/personen/lehrende/prof-dr-barbaramethfessel/publikationen.html