Konzept zum - DIAKO Nordfriesland
Werbung

1 Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in Teilen des Konzeptes nur die neutrale männliche Form genannt. Es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint. Verantwortlich für den Inhalt: Dr. med. Christoph Mai, Chefarzt und Geschäftsführer Dr. phil. Rainer Petersen, Leiter der Fachklinik für Rehabilitation Ralf Tönnies, Therapeutische Leitung Dr. Güde Nickelsen, Oberärztin Dr. rer. nat. Anke Bauer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Stand: 20.02.2017, nächste Revision: 2020 Kontakt und weitere Informationen: DIAKO Nordfriesland gGmbH Fachklinik für Rehabilitation Gammeltoft 8-15, 25821 Breklum, OT Riddorf Telefon: 04671 408 0 Email: [email protected] Internet: www.diako-nf.de Wir sind zertifiziert nach DIN EN 9001:2008 (dies gilt für die Standorte Breklum, Bredstedt, Schleswig (Suchthilfezentrum) und Kiel (Suchthilfezentrum) Neu: Die Fachkliniken Nordfriesland heißen jetzt DIAKO Nordfriesland www.fklnf.de wird zu www.diako-nf.de 2 Therapeutisches Konzept für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit psychosomatischen Erkrankungen der Fachklinik für Rehabilitation - stationäre Rehabilitation DIAKO Nordfriesland gGmbH Inhaltsverzeichnis 1. Wir stellen uns vor ............................................................................................................. 4 2. Die Fachklinik für Rehabilitation......................................................................................... 5 3. Unser Krankheitsmodell .................................................................................................... 5 4. Schwerpunkte.................................................................................................................... 7 5. Theoretischer und wissenschaftlicher Hintergrund der Störungsbilder ............................... 7 5.1 Übersicht der psychosomatischen Störungen .............................................................. 7 5.2 Depressive Störungen (F30-39) ..................................................................................10 5.3 Angststörungen (F40-F41) ..........................................................................................11 5.4 Zwangsstörungen (F42) ..............................................................................................11 5.5 Traumafolgestörungen und Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) ..................12 5.5.1 Exkurs: EMDR als dynamisch-behaviorale Psychotherapiemethode ....................13 5.6 Somatoforme Störungen (F45)....................................................................................14 5.7 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus (F60.31)................15 5.8 Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge Eating) (F50) .....................16 5.9 Psychosomatische Störungen und Pathologisches Glücksspiel (F63.0) ......................17 5.10 Psychosomatische Störungen und der pathologische Gebrauch von Internet und Computer (Medienabhängigkeit) .......................................................................................20 5.11 Psychosomatische Störungen und umweltmedizinische Erkrankungen ....................22 5.12 Zusammenfassende Beschreibung der therapeutischen Verfahren ..........................30 6. Ziele der Rehabilitation .....................................................................................................32 6.2 Therapieziele bei Rehabilitanden mit pathologischem Gebrauch von Glücksspiel, Internet und/oder Computer ..............................................................................................35 6.3 Therapieziele bei Rehabilitanden mit umweltmedizinischen Störungen .......................36 7. Dauer der Therapie ..........................................................................................................40 8. Aufnahme, Diagnostik und Ablauf der Therapie................................................................40 9. Behandlungsteam ............................................................................................................40 10. Ausstattung ....................................................................................................................40 11. Qualitätssicherungsmaßnahmen und Dokumentation.....................................................41 12. Vor- und Nachsorge: Vernetzt behandeln - Therapieerfolg sichern.................................41 13. Referenzen .....................................................................................................................43 3 1. Wir stellen uns vor Die DIAKO Nordfriesland gGmbH ist eine konfessionelle Einrichtung für die Behandlung von Menschen mit Krankheiten, Störungen und Beeinträchtigungen aus den Bereichen der Allgemeinpsychiatrie Abhängigkeitserkrankungen Psychosomatik und Psychotherapie Unser Angebot umfasst Therapie und Behandlung in Fachkliniken, Tageskliniken und Ambulanzen Rehabilitation und Wiedereingliederung Unterbringungsmöglichkeiten in Wohnprojekten, Übergangseinrichtung sowie Betreutem Wohnen Arbeitsprojekte, Tagesstätten und Beschäftigungsmöglichkeiten umfassende Aktivitäten auf dem Gebiet der Beratung, Prävention, Information von Angehörigen sowie Gruppenveranstaltungen runden unser Angebot ab. Unsere innere Vernetzung erlaubt umfassende und individuell abgestimmte Angebote. Unsere Partner sind niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser der Umgebung, Beratungsstellen, soziale und kirchliche Einrichtungen, Nachsorgeeinrichtungen, der öffentliche Gesundheitsdienst, die betriebliche Sozial- und Gesundheitsberatung sowie Vereine und Verbände. Wir sind als mittelständisches Unternehmen mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig als Dienstleister im Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein mit vielfältigem und innovativem Angebot an mehreren Standorten. Wir sind in kirchlicher Trägerschaft. Unsere Gesellschafter sind die Evangelisch-Lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg, der Verein Fachkrankenhaus Nordfriesland e.V., das Zentrum für Mission und Ökumene, der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Nordfriesland und der Verein Brücke e.V. 4 2. Die Fachklinik für Rehabilitation Die Rehabilitationsbehandlung soll die Teilhabe der betroffenen Menschen am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben verbessern und unterstützen. Eine Besonderheit unserer Einrichtung ist die fachübergreifende rehabilitative Behandlung von gemischten Erkrankungsbildern. Neben stationären und ambulanten Angeboten gehört die Adaption in Husum zur Fachklinik für Rehabilitation. Wir bieten die Rehabilitation an von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen psychosomatischen Erkrankungen umweltmedizinischen Erkrankungen mit psychosomatischer Komorbidität pathologischem Glücksspiel oder pathologischem PC-, Internet-, Mediengebrauch mit psychosomatischer Komorbidität Die psychosomatische Rehabilitation ist in modernen, freundlichen Gebäuden in Breklum untergebracht. Für die Patienten stehen Einbettzimmer mit Nasszelle zur Verfügung. Großzügige und helle Zimmer und Therapieräume in freundlichen Farben unterstützen hier den Erfolg der Rehabilitation. Das großzügige Multifunktionsgebäude enthält eine Sporthalle, die medizinische Trainingstherapie mit zahlreichen Fitnessgeräten sowie Räume für Physiotherapie, Entspannungstherapie, Ergotherapie und Musiktherapie. Im Außenbereich gibt es umfangreiche Freizeit- und Grünanlagen sowie Spazierwege. Weiterhin gibt es eine Lehrküche und einen Kiosk mit Cafeteria. Für die rehabilitative Behandlung ist die Kostenzusage eines Sozialleistungsträgers, wie z. B. Renten- oder Krankenversicherung notwendig. Wir nehmen Rehabilitanden überregional auf. Die Fachklinik leistet seit 1986 medizinische Rehabilitation von Menschen mit psychosomatischen Erkrankungen. 3. Unser Krankheitsmodell Psychosomatische Störungen sind ein hochkomplexes multifaktorielles Geschehen im seelischen, körperlichen und sozialen Bereich, das sich auf alle Belange der Lebensgestaltung auswirkt (BAR 2016, AWMF Leitlinien 2010 -2015). Zur Rehabilitation von Menschen mit psychosomatischen Störungen liegt unserem therapeutischen Konzept daher ein bio-psychosoziales Modell der Erkrankungen zugrunde, denn Risikofaktoren für die Entwicklung von psychosomatischen Störungen sind aus den Bereichen der Neurobiologie und Genetik (Bio-), der psychischen Belastung mit Stressoren (Psycho-) und aus der sozialen Entwick5 lung bzw. dem sozialen Umfeld der Betroffenen bekannt (Sozial-) (BAR 2016, Förstl et al 2006, Friboes et al. 2005, Herpertz 2011, Villanueva 2013). Psychosomatische Störungen treten häufig komorbid mit anderen Erkrankungen auf, die ebenfalls in der Therapie berücksichtigt werden müssen, wie bspw. Abhängigkeitserkrankungen oder Traumafolgestörungen (Brieger 2011, Wittchen 2003). Aus diesem Grund ist unser therapeutisches Angebot multimodal und umfasst verhaltensorientierte und psychodynamische Verfahren sowie psychoedukative, sozialtherapeutische, allgemeinmedizinische, internistische und psychiatrische Maßnahmen neben weiteren reha- oder indikationsspezifischen Angeboten. Im Einzelnen umfasst das Angebot Einzel- und Gruppentherapien, Information und Prävention, Rückfallprophylaxe, Sozialarbeit, Arbeitstherapie, Familientherapie, Ergotherapie, Angehörigenarbeit sowie die Vermittlung geeigneter Nachsorge und die Förderung der beruflichen Integration (BAR 2016, AWMF Leitlinien 2010-2015). Beispielhaft seien hier traumaspezifische Behandlungsverfahren wie z.B. EMDR und indikationsbezogene Gruppen bei Essstörungen genannt. Bio-Psycho-Soziales Modell Gesundheitsproblem Gesundheitsstörung oder Krankheit Körperfunktionen und -strukturen Umweltfaktoren Aktivitäten Teilhabe Personenbezogene Faktoren 6 4. Schwerpunkte Die spezifischen medizinischen Indikationen für eine Rehabilitationsmaßnahme sind: Depressive Störungen Angststörungen Traumafolgestörungen Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eating Disorder) Zwangsstörungen Persönlichkeitsstörungen psychosomatische Störungen Wahrnehmungsstörungen umweltmedizinischen Erkrankungen mit psychosomatischer Komorbidität pathologisches Glücksspiel oder pathologischer PC-, Internet-, Mediengebrauch mit psychosomatischer Komorbidität sowie bei psychosomatischer Komorbidität: Substanzgebundene Abhängigkeit 5. Theoretischer und wissenschaftlicher Hintergrund der Störungsbilder 5.1 Übersicht der psychosomatischen Störungen Etwa ein Viertel der Bevölkerung leidet im Laufe des Lebens an einer psychischen Störung unterschiedlichen Schweregrades und unterschiedlicher Dauer. Psychische Störungen gehören damit zu den häufigsten Erkrankungen unserer Zeit. Sie gehören auch zu den Störungen, die die Betroffenen in ihrer Lebensqualität sehr einschränken. Viele Menschen mit chronisch verlaufenden psychischen Erkrankungen benötigen längerfristig eine Therapie je nach den individuellen Erfordernissen. Bei Menschen mit psychosomatischen Primärstörungen entstehen oft Abhängigkeitserkrankungen, welche die Behandlung erschweren. Dies erfordert spezifische Behandlungs- und Therapieangebote. Diese können an der Fachklinik für Rehabilitation aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen und der Abteilung für Psychosomatik im besonderen Maße berücksichtigt werden. Wenn nicht anders angegeben, wurden als Basis für die Ausarbeitung die Leitlinien der entsprechenden Fachgesellschaften verwendet. Die jeweils aktuellen Leitlinien finden Sie unter „Referenzen“ sowie im Internet unter www.leitlinien.net (Störungsspezifische AWMFLeitlinien 2010-2015). 7 Zu vielen Diagnosen gibt es hier auch spezielle Informationen, die leicht verständlich für Patienten und Angehörige aufbereitet sind. Eine Zusammenfassung von Prävalenzen, Komorbidität sowie wissenschaftlich basierte Empfehlungsgrade von therapeutischen Interventionen geben Tabelle 1 und 2 (siehe unten). Anschließend erfolgt eine kurze Beschreibung der Ausprägung und Epidemiologie der Störungsbilder. Tabelle 1: Prävalenzen, Therapiemodule und evidenzbasierte Empfehlungsgrade des Einsatzes bei psychosomatischen Störungsbildern (Evidenzbasierung gilt bei mittelschweren oder schweren Ausprägungen, hier störungsspezifisch)(siehe Referenzen: Störungsspezifische AWMF-Leitlinien 2010-2015). A= Starke Empfehlung / Soll, B= Empfehlung / Sollte, KKP= Klinischer Konsenspunkt = "Gute klinische Praxis", 0= Kann / Empfehlung offen, k.A.: keine Angabe Therapie: Depressive Störungen Angststörungen Zwangsstörungen Essstörungen 12- Monats-Prävalenz in der deutschen Bevölkerung 10,7 % 15,3 % 0,7 % bis 3,8 % 1,5% Prävalenz der Komorbidität mit >=1 weiteren psychischen Störung 60 % 58 bis 93 % 38 bis 76 % 50-75% A A s. KVT B Psychotherapie (PT) Traumafolgestörungen BorderlinePersönl.k. Störung 1,3-3,4%: 1-3% 1- MonatsPrävalenz, altersabhängig! 80-88% 40-70% A A - gilt für siehe KVT traumaspez. Verfahren: v.a. EMDR und KVT Pharmakotherapie (substanzabhängige Empfehlungen: s. Leitlinien) Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) A A A A A 0-B B B - nur in Kom- - nur in Kom- - nur in Kom- bination mit KVT bination mit PT bination mit PT - nur in Kombination mit KVT A B A A - gilt für gilt für: Dialekt. Behav. Ther. (DBT) traumaspez. Verfahren k.A. k.A. Psychodynamische Therapie (PDT) B Psychoedukation B B KKP KKP KKP KKP Einbezug der Angehörigen A KKP KKP KKP KKP KKP B KKP B - gilt für traumaspez. Verfahren 8 Bewegungstherapie KKP KKP k.A. KKP KKP KKP Ergo- /Arbeitstherapie KKP k.A. KKP KKP KKP KKP Musiktherapie KKP k.A. KKP k.A. KKP KKP Bei saisonalen Depressionen zusätzlich: Lichttherapie: A Bei Essstörungen: Spezifische Ansätze Gewichtsnormalisierung, Wiegen, Körpertherapie, Ernährungsberatung u.a.m.: A, jedoch nur in Kombination mit PT Tabelle 2: Evidenzbasierte Empfehlungsgrade für psychosoziale oder adjuvante Therapien bei schweren Ausprägungen psychischer Störungen allgemein (störungsunspezifisch) (siehe Referenzen: AWMF-Leitlinien 2010-2015). A= Starke Empfehlung / Soll, B= Empfehlung / Sollte, KKP= Klinischer Konsenspunkt = "Gute klinische Praxis", 0= Kann / Empfehlung offen, k.A.: keine Angabe Empfehlungsrad Training sozialer Fertigkeiten A KKP Training sozialer Fertigkeiten A Milieutherapie KKP Case Management B Arbeitstherapie B Selbsthilfegruppen B-KKP Soziotherapie, Sozialarbeit Psychoedukation KKP Künstlerische Therapien B KKP Ergotherapie B Sport- und Bewegungstherapie B Psychosoziale oder adjuvante Therapien Therapeutische Beziehung Psychoedukation für Angehörige Technologie gestützte psychosoziale Interventionen (niedrigschwellige Intervention9 Computergestützte KVT (cKVT) (ohne therapeutisches Setting) B Evidenz bei Depressionen cKVT besser als keine Behandlung (Warteliste oder Kontrollgruppe) cKVT mit eMail-Unterstützung besser als ohne Unterstützung. cKVT weniger gut als klassische KVT im therapeutischen Setting Empfehlungsgrad offen 9 5.2 Depressive Störungen (F30-39) Die Hauptsymptome einer depressiven Störung sind: Niedergeschlagene Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit sowie Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Häufige zusätzliche Symptome sind verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Gefühl von Schuld / Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken oder -handlungen, Schlafstörungen und verminderter Appetit. Das somatische Syndrom ist gekennzeichnet durch Interessenverlust, Verlust der Freude an sonst angenehmen Tätigkeiten, mangelnde emotionale Reagibilität auf sonst freudige Ereignisse, frühmorgendliches Erwachen, morgendliches Stimmungstief, psychische und körperliche Hemmung oder Agitiertheit, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Depressive Störungen zählen neben den Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Die 12-Monatsprävalenz der Diagnose liegt bei 11% der Bevölkerung über 18 Jahren. Die Lebenszeitprävalenz liegt bei 16-20% der Bevölkerung. Depressive Störungen weisen eine hohe Rate an Komorbidität auf (ca. 60%) mit z.B. Angststörungen, Zwängen, Posttraumatischen Belastungsstörungen, somatoformen Störungen, Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen sowie Substanzmissbrauch und Abhängigkeitserkrankungen. Frauen erkranken doppelt so häufig wie Männer, die Hälfte der Erkrankten ist bei Beginn unter 31 Jahre alt. Der Gipfel der Prävalenz liegt zwischen einem Alter von 50 bis 60 Jahren. Weitere Risikofaktoren sind Trennung, Scheidung und der Verlust naher Angehöriger sowie körperliche Erkrankungen und Funktionseinschränkungen. Im Bereich somatischer Erkrankungen besteht ein erhöhtes Krankheitsrisiko für arteriosklerotische Herzerkrankungen, vaskuläre Läsionen des Zentralnervensystems, Asthma bronchiale, Heuschnupfen (Allergien), Ulcus pepticum, Diabetes mellitus und Infektionserkrankungen. Belastende Ereignisfolgen in Zeiträumen, in denen keine Erholung von den früheren Belastungen eintreten kann, stellen ein besonderes Risiko dar. Spätere Krankheitsepisoden scheinen dagegen stärker einer eigenen, von äußeren Auslösern relativ unabhängigen Dynamik zu unterliegen. Angehörige ersten Grades von Patienten mit einer depressiven Erkrankung weisen ein Erkrankungsrisiko für affektive Störungen (alle Formen) von 20% gegenüber 7% bei Angehörigen gesunder Kontrollpersonen auf. Wenn zusätzlich zu depressiven Phasen auch manische Episoden vorkommen, so wird dies als bipolare affektive Störung bezeichnet. Das Lebenszeitrisiko hierfür beträgt geschlechtsunabhängig 1 bis 2%. Zu einer depressiven Episode kann es auch im Rahmen eines Burnout-Syndroms kommen (AWMF-Leitlinien 2012 und 2015). 10 5.3 Angststörungen (F40-F41) Angststörungen sind gekennzeichnet durch einen emotionalen Zustand, der charakterisiert ist durch das zentrale Motiv der Vermeidung bzw. Abwehr einer Gefahr und stereotypen psychischen und physischen Begleiterscheinungen wie Unsicherheit, Unruhe, Erregung (evtl. Panik), Bewusstseins-, Denk- oder Wahrnehmungsstörungen, Anstieg von Puls- und Atemfrequenz, verstärkte Darm- und Blasentätigkeit, Übelkeit, Zittern, Schweißausbrüche. Angststörungen sind häufige psychische Erkrankungen mit einer 12-Monatsprävalenz von etwa 15% der Bevölkerung (18-65 Jahre). Zu diesen gehören die spezifischen Phobien, die generalisierte Angststörung, die soziale Phobie, die Agoraphobie und die Panikstörung . Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Angststörungen beginnen häufig im Lebensalter zwischen 20 und 40 Jahren. Risikofaktoren für Angststörungen sind insbesondere Überlastung im Berufs- oder Privatleben und Angststörungen bei Angehörigen. Weiterhin als Risikofaktoren gelten kardiale Diagnostik sowie als hochgradig traumatisierend erlebte (Herz)Todesfälle im engen Familien- oder Freundeskreis. Etwa 58-93% der Betroffenen haben weitere psychische Störungen. Soziale Phobien treten häufig in Komorbidität mit Abhängigkeitserkrankungen auf (AWMF-Leitlinie 2014). 5.4 Zwangsstörungen (F42) Wesentliches Kennzeichen dieser Störung sind wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind Vorstellungen, Ideen und Impulse, die die Patienten immer wieder stereotyp beschäftigen. Zwangsgedanken werden als eigene Gedanken erlebt, auch wenn sie als unwillkürlich und häufig als abstoßend empfunden werden. Die betroffene Person versucht erfolglos, Widerstand zu leisten, Zwangshandlungen oder Zwangsrituale sind ständig wiederholte, stereotype Handlungen. Sie werden als unangenehm empfunden und erfüllen keine nützliche Aufgabe. Betroffene erleben sie oft als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches, schadenbringendes Ereignis. Meist wird dieses Verhalten als sinnlos und ineffektiv erlebt. Menschen mit Zwangshandlungen versuchen immer wieder, dagegen anzugehen. Angstsymptome sind häufig, auch quälende innere Anspannung. Es besteht eine hohe Komorbidität mit depressiven Symptomen (Aus: ICD-10-GM online, Vs. 2017). Zwangsstörungen haben eine Prävalenz von etwa 1-3% in der Bevölkerung. Die Geschlechterverteilung ist annähernd symmetrisch. Der Beginn der Erkrankung liegt bei Frauen häufig zwischen dem 20. und 29. Lebensjahr und bei Männern zwischen dem 6. und 15. Lebensjahr. Bei der Hälfte der Betroffenen beginnt die Erkrankung in der Kindheit. 11 Eine stationäre Therapie ist indiziert bei einer ausgeprägten Zwangssymptomatik, bei besonders ausgeprägten komorbiden Störungen (z.B. Anorexie, Depression, Tic, Hypochondrie), bei mangelnden Ressourcen in der Familie oder besonders ungünstigen psychosozialen Bedingungen bzw. krankheitsbegünstigenden und -aufrechterhaltenden Einflüssen, bei erheblicher Beeinträchtigung von Alltagsaufgaben und nach nicht erfolgreicher ambulanter Therapie (AWMF-Leitlinie 2013). 5.5 Traumafolgestörungen und Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) Traumafolgestörungen sind mögliche Folgereaktionen auf sehr belastende Ereignisse wie z.B. das Erleben von körperlicher und sexualisierter Gewalt, von Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Folter oder das Erleben von schwerwiegenden Unfällen. Die Symptomatik kann unmittelbar oder auch mit (z. T. mehrjähriger) Verzögerung nach dem traumatischen Geschehen auftreten (Hofmann 2014). Häufig führen solche Erfahrungen zu Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) oder anderen psychischen Erkrankungen und sind oft mit einer hohen Rate an Folgeerkrankungen verbunden. Die Häufigkeit von Traumafolgestörungen ist abhängig von der Art des Traumas; Ca. 50% Prävalenz nach Vergewaltigung Ca. 25% Prävalenz nach anderen Gewaltverbrechen Ca. 50% bei Kriegs-, Vertreibungs- und Folteropfern Ca. 10% bei Verkehrsunfallopfern Ca. 10% bei schweren Organerkrankungen (Herzinfarkt, Malignome) Die Lebenszeitprävalenz für PTBS in der Allgemeinbevölkerung mit länderspezifischen Besonderheiten liegt zwischen 1% und 7% (Deutschland 1,5 - 2 %). Die Prävalenz subsyndromaler Störungsbilder ist wesentlich höher. Es besteht eine hohe Chronifizierungsneigung. Bei gleicher Art der Belastung sind Frauen doppelt so häufig von der PTBS betroffen wie Männer. Eine Komorbidität mit einer weiteren psychiatrischen Störung, vor allem mit depressiven Störungen, weisen über 80% aller Patienten mit Traumafolgestörungen auf. Häufig kommen auch Angststörungen, Somatisierungsstörungen, somatoforme Schmerzstörung, dissoziative Störungen, Persönlichkeitsstörungen und Abhängigkeitserkrankungen vor. Die Entwicklung komorbider Störungen ist oft eine Folge einer nicht diagnostizierten und somit auch nicht behandelten PTBS. Die Posttraumatische Belastungsstörung ist gekennzeichnet durch: 12 sich aufdrängende, belastende Gedanken und Erinnerungen (Flashbacks, Alpträume) Übererregungssymptome (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit, Affektintoleranz, Konzentrationsstörungen) Vermeidungsverhalten (Vermeidung mit dem Trauma verbundener Reize) und emotionale Taubheit (allgemeiner Rückzug, Interessenverlust, innere Teilnahmslosigkeit) (AWMF 2011a, Schäfer und Krausz 2006, Bisson et al. 2013, Hofmann 2014, McGuire et al. 2014, Lancester et al. 2016). 5.5.1 Exkurs: EMDR als dynamisch-behaviorale Psychotherapiemethode Im Jahr 1989 erschien die erste Veröffentlichung von Francine Shapiro, in der sie über ihre Methode der „Augenbewegungs-Desensibilisierung“ zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) berichtete. Etwa 1991 nannte sie dieses Verfahren Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), was auf Deutsch etwa mit Desensibilisierung und Neuorientierung durch Augenbewegungen übersetzt werden könnte. Inzwischen hat diese Methode der Traumabehandlung breite Anerkennung gefunden, ist Teil der an den Leitlinien ausgerichteten Therapie und kann als die am besten untersuchte Therapie der PTBS gelten. Francine Shapiro sah ihren Ansatz als einen methodenübergreifenden Zugang an, was der heute in Deutschland vertretenen Sichtweise entspricht (Hofmann 2014). Die psychosomatische Abteilung der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit EMDR bei der Behandlung von Traumafolgestörungen. Die Theorie der EMDR-Methode stützt sich auf das Modell der Adaptiven Informationsverarbeitung (AIP-Modell), das davon ausgeht, dass dysfunktional gespeicherte, pathogene Erinnerungen Auslöser vieler psychischer und psychosomatischer Störungen sein können (Shapiro 2013). Demnach gibt es ein adaptives System der Verarbeitung von Informationen im Gehirn, das z.B. bei der Verarbeitung von Stresserlebnissen oder schmerzhaften Verlusterlebnissen verhindert, dass eine traumatische Stressreaktion eintritt. Dieses System kann aber unter gewissen Umständen überfordert werden, etwa bei belastenden, traumatischen Erlebnissen (z.B. Folter, Unfälle oder Missbrauchserfahrungen). Hier wird die Information nicht verarbeitet, sondern im Nervensystem unverarbeitet festgehalten, d.h. in ihrer ursprünglichen Gestalt, in Bildern, Gedanken, Geräuschen, also als körpernahe Empfindung. Dies implizite Gedächtnis kann als emotionales Gedächtnis bezeichnet werden, das in den entwicklungsgeschichtlich alten Strukturen des Gehirns (Amygdala, Hippokampus) angesiedelt und nicht 13 zeitlich geordnet ist. Es funktioniert weitgehend unabhängig vom expliziten, rationalen oder narrativen Gedächtnis, das im Großhirn (Neokortex) angesiedelt ist. Dies gespeicherte, unverarbeitete Informationspaket führt quasi ein "Eigenleben" und kann von den kleinsten Erinnerungen an das ursprüngliche Trauma reaktiviert werden (Triggerreize). EMDR wirkt vor diesem Hintergrund vor allem dadurch, dass es zunächst die traumatischen Erinnerungen mit all ihren verschiedenen Komponenten – visuell, emotional, kognitiv, physisch – aufruft und das adaptive System der Informationsverarbeitung anregt, das bisher keinen Zugriff auf die Informationen hatte (Servan-Schreiber 2004). EMDR ist ein strukturiertes Verfahren, das in einem acht Phasen umfassenden Behandlungsablauf durchgeführt wird: Anamnese und Behandlungsplanung, Vorbereitung des Patienten, Bewertung des Traumas, Durcharbeitung, Verankerung und Einsetzen eines positiven Gedankens, Körper-Test, Abschluss und Nachbefragung Das Grundprinzip der Methode besteht darin, dass sich eine Person auf eine traumatische Erfahrung und die damit verbundenen Gedanken und Gefühle konzentriert, während gleichzeitig rhythmische Augenbewegungen induziert werden. Es wird also die Aufmerksamkeit des Patienten zugleich auf einen äußeren Reiz (Augenbewegungen) und auf eine identifizierte Quelle emotionaler Störungen (über Bilder und Körperempfindungen) gelenkt (Hofmann 2006). So wird ein rascher Zugang zu allen Assoziationsketten, die mit den in der Behandlung angesprochenen traumatischen Erinnerungen verbunden sind, ermöglicht. In einem so unterstützten Prozess der Informationsverarbeitung kann eine beschleunigte Reprozessierung der maladaptiven, fragmentierten traumatischen Erinnerungen stattfinden. Die Erinnerung verliert ihren intrusiven und emotionsgeladenen Charakter und kann zu einer "normalen" Erinnerung an ein schlimmes Ereignis werden. Damit ist häufig eine Reduktion der Symptomatik verbunden (Hofmann 2006). (weitere Referenzen: Störungsspezifische AWMFLeitlinien 2011, Shapiro 2013, Hofmann 2014). 5.6 Somatoforme Störungen (F45) Somatoforme Störungen sind charakterisiert durch die Beschreibung körperlicher Symptome in Verbindung mit häufigen medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht bzw. nicht ausreichend körperlich begründbar sind. Die körperlichen Beschwerden sind sehr unterschiedlich lokalisiert und werden von Patienten auf alle Organsysteme bezogen. Am häufigsten werden Schmerzsymptome genannt (Rückenschmerzen 30%, Gelenkschmerzen 25%, Kopfschmerzen 19%) sowie gastrointestinale Beschwerden (Blähungen 13%, Magenbeschwerden 11%) und Herzbeschwerden 11%). 14 Multiple somatoforme Symptome treten bei 4-5% der Bevölkerung auf, eine "Somatisierungsstörung" im engeren Sinne bei ca. 1%. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer. Häufige Komorbidität besteht in depressiven Störungen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen. Eine stationäre Behandlung ist insbesondere angezeigt, wenn ein multimodales therapeutisches Vorgehen erforderlich ist, z.B. ein verbales und ein körperorientiertes Verfahren indiziert sind wenn durch eine stationäre Therapie eine hinreichende Motivation für eine indizierte ambulante Psychotherapie erzielt werden kann wenn die Funktionsstörung die Teilnahme an ambulanter Psychotherapie einschränkt oder aufhebt wenn sich nach 6 Monaten ambulanter Psychotherapie keine symptombezogene Besserung erkennen lässt wenn eine erhebliche psychische Komorbidität (z.B. Persönlichkeitsstörung) oder eine die somatoforme Störung komplizierende körperliche Erkrankung vorliegt wenn es zu Krankschreibungen über 3 Monate hinaus gekommen ist oder bei anderen Gefährdungen der Berufs- und Erwerbsfähigkeit (AWMF-Leitlinien 2012). 5.7 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus (F60.31) Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus ist gekennzeichnet durch: ein überdauerndes Muster von emotionaler Instabilität und Impulsivität inkonstante und krisenhafte Beziehungen ausgeprägte Angst vor dem Verlassenwerden impulsive - häufig auch selbstschädigende - Verhaltensweisen instabile und wechselhafte Stimmung multiple und wechselnde psychogene Beschwerden Identitätsunsicherheit Die Stärke der Störung ist von Person zu Person unterschiedlich, ebenso das damit verbundene Leiden und die individuellen Belastungserscheinungen. Unter einer Persönlichkeitsstörung leidet etwa die Hälfte aller wegen psychischer Störungen behandelter Patienten, das sind 5-10% der Bevölkerung. Ca. 3% der Bevölkerung sind von der Emotional instabilen Persönlichkeitsstörung betroffen, dabei sind Frauen etwa dreimal so häufig wie Männer vertreten. 15 Als Risikofaktoren für das Entwickeln einer Emotional instabilen Persönlichkeitsstörung gelten insbesondere "chaotische" Lebenserfahrung in der Primärfamilie, traumatisches Verlassenwerden, Verlust der Hauptbezugsperson, sexuelle Traumatisierung und Gewalterfahrung sowie schwere Erziehungsdefizite. Komorbidität besteht vorwiegend mit affektiven Störungen und Essstörungen, weiterhin Abhängigkeitserkrankungen, Angststörungen, dissoziativen Störungen und posttraumatischen Symptombildern (American Psychiatric Association 2001, DGPPN-Leitlinie 2009, NICE Guidelines 2009, Stiglmayr et al. 2014, Armbrust et al. 2016). 5.8 Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge Eating) (F50) Von der Essstörung Anorexia nervosa spricht man bei Patientinnen oder Patienten mit einem erheblichen Untergewicht (Body-Mass-Index von 17,5 oder weniger), das durch folgende Maßnahmen selbst herbeigeführt wurde: Vermeidung von hochkalorischen Speisen; und/oder selbst induziertes Erbrechen übertriebene körperliche Aktivität Gebrauch von Appetitzüglern, Diuretika und/oder Abführmitteln. Medizinisch-physiologische Begleit- und/oder Folgeerscheinungen sind: Endokrinologische Störungen (u. a. Zyklusstörungen, Schilddrüsenunterfunktion) Störungen im Elektrolythaushalt (v. a. Kalium), Herzrhythmusstörungen Störungen im vegetativen Bereich( Müdigkeit, Schlaf- und Sexualstörungen) Entzündungen der Speiseröhre, Verletzungen durch „Brechhilfen“ Schwellungen der Speicheldrüsen Kariöse Schädigungen der Zähne Gastrointestinale Beschwerden Neurotransmitterstörungen (Noradrendalin, Serotonin) Morphologische Veränderungen des Gehirns Ödeme Hautveränderungen und Haarausfall Psychologisch-psychiatrische sowie soziale Begleit- und Folgeerscheinungen: Unzufriedenheit und übermäßige Beschäftigung mit Gewicht und Figur, Körperschemastörungen Herabgesetztes Selbstwertgefühl Affektive Folgeerscheinungen (Depressivität, emotionale Labilität, Reizbarkeit) 16 Kognitive Folgeerscheinungen (Konzentrationsmangel, Entscheidungsunfähigkeit, ständige gedankliche Beschäftigung mit Essen, Kalorienzählen) Psychophysische Folgeerscheinungen Probleme in der Partnerschaft, Familie, Freundeskreis und Beruf, sozialer Rückzug u. a. m. Es liegt mit 5 bis 20% eine hohe Mortalitätsrate vor. Komorbidität besteht mit depressiven Störungen, Angststörungen, zwanghaft-perfektionistischen Einstellungs- und Verhaltensmustern. Bei der Essstörung Bulimia nervosa steht im Gegensatz zur Anorexia nervosa die andauernde Beschäftigung mit dem Essen und eine unwiderstehliche Gier nach Nahrungsmitteln im Vordergrund. Es kommt zu wiederholtem Auftreten subjektiv nicht kontrollierbarer Heißhungeranfälle (Essattacken), bei denen große Mengen Nahrung in kurzer Zeit konsumiert werden. Die Patientinnen ergreifen extreme Maßnahmen, um dem dick machenden Effekt der aufgenommen Nahrung entgegenzusteuern (z.B. selbst induziertes Erbrechen, Abführmittelmissbrauch, strenges Einhalten einer Diät zwischen den Essanfällen). Dabei besteht eine extreme Furcht, dick zu werden und die Betroffenen setzen sich strenge Gewichtsgrenzen. Die medizinischen, psychologischen sowie sozialen Begleit- und/oder Folgeerscheinungen entsprechen denen der Anorexia nervosa (siehe oben). Komorbidität besteht mit Persönlichkeitsstörungen und Impulskontrollstörungen, seltener mit Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch. Häufig liegt schon eine Anorexie in der Vorgeschichte vor. Eine „Binge-Eating-Störung“ mit unkontrollierbaren Essanfällen geht oft mit Adipositas einher und birgt daher weitere medizinische Risiken: Es kann zu Krankheiten wie Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck kommen, dadurch besteht ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Bei Personen mit unkontrollierbaren Essanfällen sollte zunächst die Essstörung psychotherapeutisch behandelt werden. Bei in der Regel gleichzeitig vorliegenden Gewichtsproblemen wird erst zu einem späteren Zeitpunkt die Teilnahme an einem Gewichtsreduktionsprogramm möglichst unter Einbezug psychologischer Elemente empfohlen (AWMF-Leitlinie 2010). 5.9 Psychosomatische Störungen und Pathologisches Glücksspiel (F63.0) Nach einer repräsentativen Erhebung der BzGA (2016) über das Glücksspielverhalten in Deutschland liegt die 12-Monats-Prävalenz des pathologischen Glücksspiels bei 0,37% und 17 des problematischen Glücksspiels bei 0,42%. Andere Untersuchungen und Schätzungen kommen auf ähnliche Prävalenzwerte des pathologischen Glücksspiels zwischen 0,2 und 0,6%. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Unter Berücksichtigung der Bevölkerung zwischen 28 und 65 Jahren ergeben sich rein rechnerisch ca. 215.000 bis 241.000 Betroffene (BZGA 2016, Mukian 2014). Demgegenüber steht eine Anzahl von etwa 15.800 Patienten, die mit der Diagnose Pathologisches Glücksspiel in Deutschland jährlich ambulant und stationär behandelt werden (Petry et al. 2013). Demnach liegt die Nachfrage nach Therapieplätzen nur bei 2-4% der pathologischen Spieler in Deutschland. Im Alltag charakterisieren nach Petersen (2012) zwei Dinge pathologische Spieler besonders treffend: Zum einen haben sie keine Zeit. Sie spielen immer häufiger und länger, versäumen wegen des Spiels Verabredungen und Verpflichtungen. Und sie haben kein Geld, so dass Kredite aufgenommen werden oder Geld im Freundeskreis geliehen oder anderweitig beschafft wird. Beide zentralen Charakteristika werden in der Behandlung mit besonderem Augenmerk fokussiert und stehen neben der Aufarbeitung der die Suchtentstehung begünstigenden Faktoren im Vordergrund. Studien belegen, dass bestimmte Glücksspielformen ein höheres Gefährdungspotential aufweisen. Die Verfügbarkeit erleichtert und regt zur erstmaligen Spielteilnahme an. Dagegen sind Ereignisfrequenz und Gewinnstruktur konkrete Eigenschaften, die für Verstärkungseffekte und damit die Förderung eines exzessiven Spielverhaltens verantwortlich sind (Mukian 2014). 2010 wurde erstmalig vorgeschlagen in der fünften Ausgabe des Klassifikationssystems „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM) der American Psychiatric Association (APA) den früheren Oberbegriff „Substanzbezogene Störungen“ durch die neue Bezeichnung „Sucht und zugehörige Störungen“ zu ersetzen. Subsummiert werden hier sowohl stoffgebundene als auch nicht-stoffgebundene Störungen. Als erste nicht stoffgebundene Störung wurde das pathologische Glücksspielen aufgenommen. Süchtiges Spielverhalten entwickelt sich vor dem Hintergrund eines multifaktoriellen Geschehens. Ein besonders gefährdeter Personenkreis für die Entwicklung spielsüchtigen Verhaltens lässt sich daher nicht zuverlässig festlegen. Es gibt weder den typischen Spieler noch das charakteristische soziale Umfeld. Dennoch gibt es Bedingungen, die die Entwicklung süchtigen Spielverhaltens begünstigen. Diese betreffen das Geschlecht (90% sind Männer), Persönlichkeitsstruktur und soziales Umfeld, vorhandene psychische Störungen und neurobiologische Parameter (Belohnungssystem) (Petry et al. 2013, Petry 2010). Nach Petry et al. (2013) ist pathologisches Glücksspiel deutlich (> 70%) mit psychischen und psychosomatischen Störungen korreliert. Dabei gehen diese Störungen dem pathologischen 18 Glücksspiel oft voraus. Demnach liegt die Prävalenz von depressiven Störungen bei pathologischen Spielern bei 63%, 37% haben Angststörungen und 44% eine Substanzabhängigkeit (ohne Tabak). Weiterhin weisen ein Viertel der pathologischen Spieler manische Störungen auf (Premper und Schulz 2008). Auch psychotische Störungen, die antisoziale Persönlichkeitsstörung sowie das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS) stellen Risikofaktoren für die Entwicklung der pathologischen Formen des Glücksspiels dar (Potenza et al. 2002). Bei pathologischen Spielern mit psychischer oder psychosomatischer Komorbidität kann nur ein multimodales Therapiekonzept erfolgreich sein, welches alle individuellen Aspekte der Erkrankung einbezieht. Bei Nichtberücksichtigung der Komorbidität, ist die Rückfallgefahr sehr hoch. Neben suchtspezifischen Therapien für pathologisches Glücksspiel müssen daher vor allem psychodynamische, verhaltenstherapeutische, soziotherapeutische und pharmakotherapeutische Verfahren zum Einsatz kommen, welche auf diese Patientengruppe abgestimmt sind (Rasch und Petry 2014). Bei dem Einsatz von Pharmaka müssen zwingend psychische Komorbidität und komorbide substanzgebundene Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Tabelle 5.9.1: Therapie des Pathologischen Spielens nach EBM (evidenzbasierte Medizin) und Effektstärken* (ES) der Therapie (nach Potenza et al. 2002, und Pallesen et al. 2005) Therapie: Multimodales Verfahren Imaginative Verfahren Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) Motivationale Verfahren Selbsthilfegruppe Pharmakotherapie (keine ES) Evidenzklassen: Wirkung auf die spielassoziierten Symptome IIa ES=1,86 - 2,03 Ia ES= 1,07 - 3,88 Ia ES= 1,71- 3,94 IIa ES= 0,45 - 0,80 ES= 0,01 - 0,53 SSRI (Fluvoxamin): IIa (insbesondere bei komorbiden affektiven Störungen) Naltrexon: IIa, Lithium: IIa (insbesondere bei komorb. bipolaren Störungen) Antipsychotika: kein Effekt (IIa) Dopamin-Wiederaufnahmehemmer: IIa (insbesondere bei komorbiden ADHD) *Effektstärken (ES) von 0.2 bis 0.3 werden als schwache, ES von 0.3-0.6 als mittlere und ES >0.6 als starke Effekte der Therapie bezeichnet Ia: Wirksam Ib: Wirksam IIa: Wirksam IIb: Wirksam hortenstudie "Evidenz" aufgrund von Metaanalysen randomisierter, kontrollierter Studien "Evidenz" aufgrund von mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie "Evidenz" aufgrund von mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung "Evidenz" aufgrund von mindestens einer gut angelegten, quasi-experimentellen Studie, retrospektive Ko- 19 III: Wahrscheinlich wirksam "Evidenz" aufgrund gut angelegter, nicht experimenteller, deskriptiver Studien (z.B. Beobachtungsstudien (vorher-nachher), Vergleichsstudien, Korrelationsstudien, Fall-Kontrollstudien) IV: Möglicherweise wirksam "Evidenz" aufgrund von Fall-Serien, Berichte von Expertengruppen, Konsensuskonferenzen V: Möglicherweise wirksam Expertenmeinungen und –aussagen bzw. klinische Erfahrung anerkannter Autoritäten Die Rehabilitationsbehandlung pathologischer Spieler und Medienabhängiger kann grundsätzlich in der Abteilung für Abhängigkeitskranke und in der Abteilung für Psychosomatik geschehen, wobei eine enge Zusammenarbeit stattfindet. Die Entscheidung hierüber trifft primär der Kostenträger nach Gesichtspunkten wie z.B. psychiatrischer Komorbidität oder Suchtverhalten. 5.10 Psychosomatische Störungen und der pathologische Gebrauch von Internet und Computer (Medienabhängigkeit) Der pathologische Gebrauch von Internet und Computerspielen nimmt mit der sich ausweitenden Verbreitung dieser Technologien zu. Allein die Bedeutung sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter, Google Plus oder businessorientiert LinkedIn und XING erleben in den letzten Jahren eine zunehmende Nachfrage. Facebook wird von über 20 Millionen Deutschen und weit mehr als 750 Millionen Menschen weltweit genutzt (Dinse 2012). Die Definition der Internetabhängigkeit ist derzeit nicht einheitlich und es kursieren allein in Fachkreisen mehr als 20 Begriffe für das neue Phänomen gebräuchliche Begriffe sind „Mediensucht“, „Onlinesucht“, „Internet-Sucht“ oder „Internet-Abhängigkeits-Syndrom“ (Willnow et al. 2012). Petry (2010) schlägt zur Abgrenzung der Pathologie die Begrifflichkeiten „Funktionaler Gebrauch“, „Dysfunktionaler Gebrauch“ und „Pathologischer Gebrauch“ vor. In Anlehnung an die zweite große stoffungebundene Suchterkrankung, das Pathologische Glücksspiel, eignet sich der Begriff „Pathologischer PC-Gebrauch“ gut als Arbeitsgrundlage. In einer Studie zur Prävalenz des Pathologischen PC-Gebrauches (hier untersucht: Internet) (Rumpf et al. 2011) wurden auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe 15.024 Personen befragt. Es ergab sich eine geschätzte Prävalenz für das Vorliegen eines Pathologischen PC-Gebrauches von 1,5% (Frauen 1,3%, Männer 1,7%). In der Altersgruppe 14-24 steigt die Prävalenz auf 2,4% an (Frauen 2,5% Männer 2,5%). Bei alleiniger Betrachtung der 14-16jährigen finden sich 4,0% Internetabhängige (Frauen 4,9%, Männer 3,1%). Die auffälligen Mädchen und Frauen (14-24 Jahre) nutzen vorwiegend Soziale Netzwerke im Internet (77,1% der Abhängigen nach LCA) und eher selten Onlinespiele (7,2%). Die jungen Männer nutzen ebenfalls, aber in geringerer Ausprägung, Soziale Netzwerke, und häufiger Onlinespiele (33,6%). Neben den vermutlich Abhängigen lässt sich eine weitere Gruppe mit 20 problematischem Internetgebrauch identifizieren, die insgesamt 4,6% der Befragten betrifft (Frauen 4,4%, Männer 4,9%). Auch hier zeigen sich hohe Raten bei jungen Kohorten und dort in besonderem Maße bei weiblichen Personen (Rumpf et al. 2011, Kuss et al. 2014). Betroffen sind insbesondere Jugendliche und Menschen aus niedrigeren sozialen Statusgruppen, zudem häufiger Männer und Personen ohne festen Lebenspartner und/oder feste Arbeitsstelle. Die betroffenen Personen verbrachten oft > 30 Stunden pro Woche im Internet. Die Ergebnisse der Studien illustrieren das hohe Abhängigkeitspotenzial von PC und Internet. Die Therapie setzt voraus, dass sich die behandelnden Ärzte und Psychologen für die virtuellen Lebenswelten ihrer Rehabilitanden interessieren und diese in die Behandlung mit einbeziehen (Jerusalem und Meixner 2004, Willnow et al. 2012). Die Betroffenen leiden häufiger unter affektiven Störungen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen (s.o.). Die Betroffenen haben weiterhin häufiger soziale Konflikte und soziale Angst sowie weniger soziale Unterstützung und weniger Selbstbewusstsein als Personen ohne pathologischen Mediengebrauch und sie haben hierfür ungünstige Copingstrategien entwickelt (Jerusalem und Meixner 2004, Kuss et al. 2014). Für Patienten mit Medienabhängigkeit sind indikationsspezifische therapeutische Maßnahmen angezeigt. Entsprechend werden medizinische psychodynamische verhaltenstherapeutische sowie suchttherapeutische Maßnahmen bei den Betroffenen eingesetzt. Diese werden durch arbeitstherapeutische sozialtherapeutische familientherapeutische und ergotherapeutische Maßnahmen ergänzt. Hauptziel der Rehabilitationsbehandlung ist die Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben. Störungsspezifische Maßnahmen beziehen sich auf die Erarbeitung eines individuellen Umgangs mit dem Medium PC auf der Grundlage des jeweils vorliegenden Störungsbildes. In der Regel erfolgt diese über die Erstellung eines individuellen Stufenplans, der von der Abstinenz zu Beginn der Behandlung über die Klärung der Alltagsbedingungen und Nutzungserfordernissen des PCs mit Risikoanalyse bis hin zu einem krankheitsgerechten Umgang mit dem Medium und Training in der Therapie reicht. Begleitend wird über die Eigendynamik der 21 Abhängigkeit im Bereich pathologischer PC-Gebrauch und über Hilfsmöglichkeiten, soweit vorhanden, informiert. 5.11 Psychosomatische Störungen und umweltmedizinische Erkrankungen Mit Schadstoffen assoziierte Gesundheitsstörungen beginnen oft schleichend mit Symptomen wie Atemwegsproblemen, Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Schmerzen und Schwindel. Oft treten Reizungen an Augen, Nasen, Rachen oder Haut auf. Wird die Ursache der Symptome nicht erkannt und beendet, sind chronische schwer therapierbare Störungsbilder die Folge (Bartram et al. 2011, Bauer et al., 2008-2010). Zur Klientel der DIAKO Nordfriesland zählen viele Patienten, die eine ausgeprägte chronische Müdigkeit, chronische Schmerzen und/oder ausgeprägte Unverträglichkeiten gegenüber auch niedrigen Konzentrationen vielfältiger Chemikalien entwickelt haben (z.B. Duftstoffe, Zigarettenrauch, Lösemittel). Dieses letztere Krankheitsbild wird auch als MCS ("Multiple Chemical Sensitivity") bezeichnet (Ashford und Miller, 1998). Nach der vom dbu (Dt. Berufsverband der Umweltmediziner) herausgegebenen „Umweltmedizinischen Praxisleitlinie“ (Bartram et al. 2011) ist eine besondere Chemikaliensensitivität (unter anderem) eine mögliche Folge chronischer umweltmedizinischer Erkrankungen und eine „chronische Multisystemerkrankungen, deren Entstehung mit Risikofaktoren aus dem somatischen, psychischen und sozialen Bereich assoziiert ist („bio-psycho-soziales“ Krankheitsmodell)“. Neben einer besonderen Chemikaliensensitivität (Chemical Sensitivity / CS, Multiple Chemical Sensitivity / MCS) sind auch das chronische Erschöpfungssyndrom / CFS sowie chronische Schmerzsyndrome als Folgestörungen chronischer umweltmedizinischer Erkrankungen beschrieben. Die Prävalenz an umweltmedizinischen Erkrankungsbildern insgesamt wird nach den Ergebnissen der internationalen Konferenz „Environment and Health Action Plan 2004-2010“ (EU 2004) auf ca. 5% der EU-Bürger geschätzt. Nach einem großangelegten populationsbezogenen Telefonsurvey von Kreutzer et al. (1999) leiden in den USA 6,3% der Bevölkerung unter umweltmedizinischen Erkrankungen. Besonders empfindlich gegenüber chemischen Expositionen oder Gerüchen reagieren nach einem deutschen Survey von Hausteiner et al. (2005) 0,5% der Bevölkerung. Diese Personen hatten tägliche Symptome aufgrund einer besonderen chemischen Empfindlichkeit oder MCS. Es liegen inzwischen für mehrere Länder Prävalenzraten zu Chemikalien-Intoleranzen (CI) und zur „Multiple Chemical Sensitivity“ (MCS) aus repräsentativen Umfragen vor (Tabelle 5.11.1). Für Deutschland würde dies, bei einer konservativen Annahme von 0,5% der Bevölkerung, 400.000 Betroffene bedeuten. 22 Tabelle 5.11.1: Prävalenzraten von Chemikalien-Intoleranzen (CI) (leichtere Form) sowie multiplen Chemikalien-Intoleranzen (MCS=Multiple Chemical Sensitivity) mit täglich bzw. schweren Symptomen oder einer ärztlichen Diagnose „MCS“ Land MCS Quelle CI (tägliche o. schwere Symptome o. Arztdiagnose) USA 16% 6,3% Kreutzer et al. (1999) USA 11-33% 3,9% Meggs et al. (1996) 9% 0,5% Hausteiner et al. (2005) - 3,8% Hojo et al. (2005) 16% 0,9% 15,6% 3,7% SA Department of Health (2004) Andersson et al. (2008) Deutschland Japan Australien Schweden: Jugendliche Im Bereich des „Schwerpunktes Umweltmedizin“ der DIAKO Nordfriesland im Krankenhausbereich und in der Rehabilitation geht es um die Behandlung von umweltmedizinischen Erkrankungen mit ihren psychischen Folgestörungen oder einer psychischen Komorbidität. Im Bereich der Rehabilitation geht es um die Behandlung der Rehabilitanden, bei denen eine drohende oder bereits manifeste Beeinträchtigung der Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft vorhanden ist. Der Rehabilitand soll (wieder) befähigt werden, eine Erwerbstätigkeit und/oder bestimmte Aktivitäten des täglichen Lebens möglichst in der Art und in dem Ausmaß auszuüben, die für diesen Menschen als „normal“ (für seinen persönlichen Lebenskontext üblich) erachtet werden (BAR 2010). Um diese „Patienten / Rehabilitanden mit chronischen umweltmedizinischen Erkrankungen und Folgestörungen“ geht es in dem folgenden Text. Der Begriff wird der besseren Lesbarkeit halber mit „cUME“ abgekürzt. Die Ursachen für die Entwicklung von cUME werden seit langem sehr kontrovers mit verhärteten Fronten diskutiert (Psychologie versus Toxikologie). Im Gegensatz zu dieser Kontroverse, gibt es mittlerweile deutliche Hinweise darauf, dass gerade das Zusammenwirken von Schadstoffen und körperlichen, sozialen und seelischen „Vulnerabilitätsfaktoren“ bei exponierten Bevölkerungsgruppen als Risikofaktor für die Entstehung und Erhaltung von cUME zu werten ist (Bartram et al. 2011, Bauer et al. 2008-2010). 23 Für folgende - vorwiegend neurotoxisch wirksame (d.h. giftig für Gehirn und Nerven) Schadstoffe/Schadstoffklassen wurde ein besonders hohes Risikopotential für die Entwicklung von cUME nachgewiesen: organische Lösemittel Pestizide (z.B. Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Mottenschutzmittel) Formaldehyd Folgende Gruppen sind aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilität gegenüber Schadstoffen als Risikogruppen anzusehen Kinder Personen mit Vorerkrankungen, insbesondere: o Allergien o Asthma, bronchiale Hyperreaktivität o Hauterkrankungen o Überempfindlichkeiten gegenüber anderen exogenen Noxen (z.B. Medikamenten) bzw. Pseudoallergien o andere Erkrankungen oder Expositionen, die mit chronischer Inflammation einhergehen Frauen sind insgesamt 1,5 bis 2mal häufiger von etlichen der genannten Risikofaktoren betroffen und stellen aus diesem Grund den größeren Teil der Patienten dar (Evidenzgrad: EVG=III). Folgende Gruppen stehen unter einem erhöhten Risiko chronische schwer therapierbare Krankheitsbilder zu entwickeln (EVG= II-III) (Bartram et al. 2011): Personen mit multiplen Allergien oder multiplen Pseudoallergien Personen mit erhöhtem Level an Stressoren Personen mit ängstlicher Persönlichkeitsstruktur oder manifesten Angststörungen 24 Schweregrad, Komorbidität und Therapie der umweltmedizinischen Störungen In allen bekannten Untersuchungen sind umweltmedizinische Patienten im Vergleich mit Bevölkerungsstichproben gesundheitlich-funktionell deutlich beeinträchtigt (vgl. Abbildungen nächste Seite). Die Schwere der Erkrankung kann jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Patienten von niedergelassenen Umweltmedizinern sind im Mittel deutlich weniger beeinträchtigt als die Patienten, die umweltmedizinische Ambulanzen an universitären Zentren und Fachkrankenhäusern aufsuchen (Bartram et al. 2011, Bauer et al. 2010). Die gesundheitsbezogene Lebensqualität umweltmedizinischer Patienten liegt im SF36 im Bereich von Patienten mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen bzw. Herzinsuffizienz/Herzschwäche und in einigen Bereichen sogar darunter (Bartram et al. 2011). Die gesundheitsbezogene Lebensqualität umweltmedizinischer Patienten der DIAKO Nordfriesland ist im NHP (Nottingham Health Profile) insbesondere in den Bereichen „Energie“ und „Schmerzen“ erheblich beeinträchtigt und schlechter als bei stationären Patienten der Psychosomatik oder Diabeteskranken (Bartram et al. 2011, Bauer et al. 2007). Spezifische Symptome (SL-SUM des Neurotox-Fragebogens) treten bei den umweltmedizinischen Patienten der DIAKO Nordfriesland häufiger und schwerer auf als in der Bevölkerung oder bei psychosomatischen Patienten (Bauer et al. 2007). Umweltmedizinische Patienten mit einer komorbiden Diagnose aus dem Abschnitt „F“ des ICD-10 (psychiatrische und psychosomatische Diagnosen) sind in allen Bereichen besonders schwer betroffen (Bartram et al. 2011, Schwarz et al. 2006: vgl. Abbildungen der nächsten Seiten). 25 100 UM (n=129) MCS ( n=81) chron. GI (n=180) Herzinsuffizienz (n=261) Bevölkerung (n=6820) 90 80 70 60 50 40 SF36 30 körp. Funktionsfähigkeit körp. Schmerzen Vitalität soz. Funktionsfähigkeit emotion. Rollenfunktion psych. Wohlbefinden Abbildung 5.11.1: Die gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF36) umweltmedizinischer Patienten (UM) mit und ohne MCS im Vergleich mit kranken Kontrollgruppen und einer Bevölkerungskontrolle (nach: Eis et al., 2002) (niedrige Werte entsprechen geringer gesundheitsbezogene Lebensqualität) Diabetiker (n=1804) 80,0 Psychosomatik (n=17) Gesundheitliche Lebensqualität UM ohne F-Diagnose (n=95) UM mit F-Hauptdiagnose (n=51) 60,0 NHP (0-100) 40,0 20,0 0,0 Energie Schmerzen Emotionalität Schlaf Soziale Isolation Physische Mobilität Abbildung 5.11.2: Die gesundheitsbezogene Lebensqualität (NHP) umweltmedizinischer Patienten (UM) mit und ohne komorbide Diagnose aus dem Abschnitt F des ICD-10 im Vergleich mit kranken Kontrollgruppen (Schwarz et al. 2006) (hohe Werte entsprechen geringer gesundheitsbezogene Lebensqualität) 26 150 142,9 133,4 Spezifische Symptome (SL-SUM) 120 111,7 112,2 UM ohne FDiagnose (n=95) UM mit Angststörungen (n=13) 128 90 SL-SUM 74,0 60 30 18,3 0 gesunde VG (n=47) VG Psychosomatik (n=42) UM mit Anpass.störungen (n=72) UM mit depressiven St.(n=33) UM mit PTSD (n=11) Abbildung 5.11.3: Summenscores (SL-SUM) des Neurotox-Fragebogesn bei umweltmedizinischen Patienten (UM) mit und ohne komorbide Diagnose aus dem Abschnitt F des ICD-10 und bei Vergleichsgruppen (VG) (Schwarz et al. 2006) 3 umweltmedizinische Patienten der RKI-Verbundstudie (n=224) Lösemittelsyndrom 2A (n=29) Lösemittelsyndrom 2B (n=29) 2,5 Kontrollgruppe (n=57) SCL-90-R Score Somatisierungsstörung (n=72) 2 1,5 1 Psychotizismus Paranoides Denken Phobische Angst Aggressivität Ängstlichkeit Depressivität Unsicherheit im Sozialkontakt Somatisierung 0 Zwanghaftigkeit 0,5 Abbildung 5.11.4: SCL-90-Scores bei umweltmedizinischen Patienten im Vergleich mit Patienten mit Somatisierungsstörungen (nach Eis et al. 2002) sowie bei Arbeitern mit Lösemittelsyndrom vom Typ 2a und 2b, sowie einer nicht exponierten gesunden Kontrollgruppe (nach: Karlsson et al. 2000) 27 Die Fachklinik für Rehabilitation legt ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell bei ihren Rehabilitanden zugrunde, welches ein mehrdimensionales therapeutisches Konzept bedingt, in welchem alle Anteile der Gesundheitsstörung angemessen und ganzheitlich berücksichtigt werden. Die Abbildungen auf der nächsten Seite belegen die Wirksamkeit des multidimensionalen Konzepts der Fachklinik im Vergleich mit externen (eindimensionalen) psychotherapeutischen Maßnahmen ohne Einbezug der Umweltmedizin. Tabelle 5.11.2: Therapie der umweltmedizinischen Störungen (UM) Therapie: Evidenzklasse Effektstärke* (1) (12- 24 Monate) Stationärer multidimensionaler umweltmedizinischer Ansatz insgesamt IIIa (1) (2) (5) Expositionsminderungsstrategien IIIa (1) (2) IV (3) IIIa (1) (2) IV (3) IIIa (1) (2) IV (3) Ernährungstherapie Psychoedukation, insbes. Schulung zum Coping/ Umgang mit der Erkrankung/ Krankheitsbewältigung Alle UM: 0,8-0,9 (5) Alle UM: 0,7, MCS: 0,9 UM mit Depressionen: 1,0 UM mit PTBS: 1,2 UM mit Stress: 0,9 Alle UM: 0,9 UM mit NahrungsmittelIntoleranzen: 0,7-1,1 1,6 (2) 0,8 1,1: bei Patienten mit unstimmigem / fixiertem Krankheitsmodell Psychodynamische Therapie IIIa (nur bei psychosomatischer 1,3 Komorbidität) (1) Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) Pharmakotherapie IV (4) eher schadend: IV (3) - Alleinige Psychotherapie Nicht wirksam: IIIa (1) Nicht wirksam: IV (3) - (1) Schwarz et al. (2006): MCS und andere chronische umweltmedizinische Störungen, psychosomatische Komorbidität (2): Bauer et al. (2003): MCS und andere chronische umweltmedizinische Störungen (3) Gibson et al. (2003): MCS (4): AWMF 051/001:. nur somatoforme umweltbezogene Störung (5): Kohlmann et al. (1999) *Effektstärken (ES) von 0.2 bis 0.3 werden als schwache, ES von 0.3-0.6 als mittlere und ES >0.6 als starke Effekte der Therapie bezeichnet Ia: Wirksam "Evidenz" aufgrund von Metaanalysen randomisierter, kontrollierter Studien Ib: Wirksam "Evidenz" aufgrund von mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie IIa: Wirksam "Evidenz" aufgrund von mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung IIb: Wirksam "Evidenz" aufgrund von mindestens einer gut angelegten, quasi-experimentellen Studie, retrospektive Kohortenstudie III: Wahrscheinlich wirksam "Evidenz" aufgrund gut angelegter, nicht experimenteller, deskriptiver Studien (z.B. Beobachtungsstudien (vorher-nachher), Vergleichsstudien, Korrelationsstudien, Fall-Kontrollstudien) IV: Möglicherweise wirksam "Evidenz" aufgrund von Fall-Serien, Berichte von Expertengruppen, Konsensuskonferenzen V: Möglicherweise wirksam Expertenmeinungen und –aussagen bzw. klinische Erfahrung anerkannter Autoritäten 28 60% % Verbesserung im Bereich "Energie" 50% 40% Umweltmedizinische Therapie, keine PT (n=42/40/30/14) 36% 32% 31% 30% Umweltmedizinische Therapie + PT an den FKL (n=25/20/20/15) 20% 15% 10% 9% 9% 8% externe PT ohne Bezug zur Umweltmedizin (n=18/17/13/9) 6% PT= psychotherapeutische Maßnahmen 0% 6 Monate 12 Monate 24 Monate -6% -10% 60% % Verbesserung im Bereich "Emotionale Reaktion auf die Erkrankung" 53% 50% 42% 40% Umweltmedizinische Therapie, keine PT (n=42/40/30/14) 37% 30% Umweltmedizinische Therapie + PT an den FKL (n=25/20/20/15) 26% 20% 14% 10% 8% 8% -5% PT= psychotherapeutische Maßnahmen 0% 0% 6 Monate 12 Monate externe PT ohne Bezug zur Umweltmedizin (n=18/17/13/9) 24 Monate -10% 1,6 1,5 1,4 1,2 Umweltmedizinische Therapie, keine PT (n=42/40/30/14) 1,1 1,0 Umweltmedizinische Therapie + PT an den FKL (n=25/20/20/15) 0,9 Effektstärke (ES) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 externe PT ohne Bezug zur Umweltmedizin (n=18/17/13/9) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 schwacher Effekt: ES=0,2 bis 0,3 mittlerer Effekt: ES=0,4 bis 0,6 deutlicher Effekt: ES > 0,6 0,0 6 Monate 12 Monate 24 Monate 29 5.12 Zusammenfassende Beschreibung der therapeutischen Verfahren Die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen bei psychosomatischen Erkrankungen ist in vielen Studien nachgewiesen worden. Diese sind in wissenschaftlich begründeten Leitlinien der Fachgesellschaften zusammengefasst und in vielen Studien untersucht worden (Störungsspezifische AWMF-Leitlinien 2010-2015). Die psychotherapeutische Behandlung in der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie ist integrativ ausgerichtet. Verhaltenstherapeutische und psychodynamische Therapieformen werden ergänzt durch Methoden wie systemische Familientherapie, dialektischbehaviorale Therapie, Imaginationsverfahren oder Traumakonfrontationsverfahren. Bei der Behandlung von Elternteilen, die in Begleitung ihrer Kinder sind, nutzen wir auch unsere kinder- und jugendtherapeutischen Kompetenzen. Da unabhängig von den eingesetzten Therapiemethoden der Therapieerfolg signifikant durch allgemeine Merkmale beeinflusst wird, wie die Art des therapeutischen Settings, die Qualität der therapeutischen Beziehung und die Einbeziehung wichtiger Bezugspersonen, wird auf die hohe Qualität dieser Merkmale an der Fachklinik für Psychiatrie und Psychosomatik besonders geachtet. Wir gehen davon aus, dass Lernen ein wichtiges Element der Behandlung ist und sowohl Informationsvermittlung und -sammlung sowie das therapeutische Milieu hierauf abgestimmt sein muss. Wichtiges Behandlungsinstrument der psychosomatischen Therapie ist daher auch eine Milieutherapie, in welcher das Leben in der Patientengemeinschaft und die Gestaltung dieser Gemeinschaft ein soziales Lernfeld darstellt. Es kann als Bühne dienen, bewusste und unbewusste Konflikte auszutragen, Bindung und Autonomie neu zu erlernen sowie Unterstützung zu erfahren. Zur Stärkung der Selbsthilfekräfte dient auch eine partielle Selbstverwaltung der Patienten als Element eines selbstorganisierten gemeinschaftlichen Lebens. Wesentliches Element der Behandlung ist die Gruppenpsychotherapie, die sowohl mit den Bezugstherapeutinnen und Bezugstherapeuten wie auch themenspezifisch angeboten wird. Das Erlernen von Lösungskompetenzen sozialer Probleme ist ebenfalls Teil der Psychotherapie. Einzeltherapeutische Gespräche ergänzen das Behandlungsprogramm, deren Umfang und Inhalt indikationsorientiert festgelegt werden. Eine Komplexbehandlung in der Psychosomatik erfordert häufig eine somatomedizinische Intervention. Reduktionistische psychosomatische wie somatische Erklärungsmodelle können gleichermaßen zur Fehlbehandlung führen. Es findet deshalb eine individuelle und bedarfsgerechte Diagnostik statt. Die Fachklinik verfügt über Ärzte und Ärztinnen unterschiedlicher Disziplinen oder wir können weitere Spezialuntersuchungen außerhalb der Klinik veranlassen. Unterstützende pharmakologische Behandlungen setzen wir sorgsam ein. 30 Entspannungsverfahren, Imaginationsverfahren und Musiktherapie unterstützen den Heilungsprozess von Reiz- oder Erschöpfungszuständen und verbessern das Coping. Im Gesundheitstraining werden den Patienten Informationen zu verschiedenen Krankheitsbildern und möglichen Strategien im Umgang mit ihrer Erkrankung vermittelt. Die Sport- und Bewegungstherapie ist unabdingbar in der psychosomatischen Behandlung und kann Depressionen, Angstzustände oder Essstörungen nachhaltig positiv beeinflussen. Bei bestimmten Krankheitsbildern, z.B. bei Adipositas, erfolgen spezifische Bewegungstherapien. Ergo- und Arbeitstherapie wird zur Erhaltung oder Erlangung von Arbeits- oder Freizeitgestaltungskompetenz, zur Erhaltung oder Verbesserung von Funktionsfähigkeiten und zur Verbesserung der Wahrnehmung und Gestaltungskompetenz eingesetzt. Die Ernährungstherapie ist wesentlicher Bestandteil der Behandlung. Rauchende Patienten können an einem Nichtrauchertraining teilnehmen. Um den Behandlungserfolg zu sichern und zu vertiefen, halten wir es für notwendig, dass der Patient schon während des stationären Aufenthaltes eine adäquate Nachsorge sowie Kontakte zu einer Selbsthilfegruppe, Beratungsstelle, einem niedergelassenen Arzt oder Psychotherapeuten oder einer Übergangseinrichtung organisiert. Die Einbeziehung des konkreten Lebensumfeldes des Patienten und die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, Beratungsstellen, Institutionen, Kliniken und Selbsthilfegruppen hat an der Fachklinik für Psychiatrie und Psychosomatik einen hohen Stellenwert. Die DIAKO Nordfriesland verfügen über eine entsprechende Vernetzung (AWMF-Leitlinien 2010-2015). 31 6. Ziele der Rehabilitation Allgemeines Ziel der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ist, die drohenden oder bereits manifesten Beeinträchtigungen der Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft zu beseitigen, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Der Rehabilitand soll (wieder) befähigt werden, eine Erwerbstätigkeit und/oder bestimmte Aktivitäten des täglichen Lebens möglichst in der Art und in dem Ausmaß auszuüben, die für diesen Menschen als „normal“ (für seinen persönlichen Lebenskontext üblich) erachtet werden (BAR 2016, BAR 2010). Die individuellen Therapieziele werden mit dem Rehabilitanden vereinbart und im Rehabilitationsplan festgehalten. In Tabelle 6.1 sind die Therapieziele psychosomatischer Rehabilitanden der DIAKO Nordfriesland aus den Bereichen Körperfunktionen, Körperstrukturen und Aktivität und Teilhabe sowie aufzulösende Barrieren oder zu nutzende Förderfaktoren aus dem Bereich der Kontextfaktoren den Therapiemodulen gegenübergestellt. Tabelle 6.1: Ziele der Rehabilitation und die therapeutischen Maßnahmen bei den psychosomatischen Rehabilitanden der DIAKO Nordfriesland (nach BAR (2010) und GRV (2002)) Rehabilitationsziele: BAR (2010) Allgemeine Rehabilitationsziele Behebung oder Verminderung der Schädigungen (einschließlich psychischer Funktionen) Verminderung des Schweregrads der Beeinträchtigung der Aktivitäten oder Wiederherstellung gestörter Fähigkeiten Kompensation (Ersatzstrategien) Adaption/Krankheitsverarbeitung Rehabilitationsziele bezogen auf Köperfunktionen und Körperstrukturen (einschließlich psychischer Funktionen) 1. psychische Stabilisierung GRV (2002) Therapeutische Maßnahmen A1, A2 B1, B2, B3 A3, A4 B1, B2 D1-D5 A5 Gesamtkonzept A8, A9, A10, A11 C1 Gesamtkonzept GRV (2002) A1 2. Verminderung von negativen Affekten wie Depression und Angst A2 3. Verbesserung der Selbstwahrnehmung A8 4. Verbesserung von Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl A3, A8 Gesamtkonzept Gesamtkonzept Therapeutische Maßnahmen Psychodynamische Verfahren Bewegungstherapie Entspannungsverfahren Psychodynamische Verfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Schulung Bewegungstherapie Ergo- und Arbeitstherapie Psychodynamische Verfahren Bewegungstherapie Ergo- und Arbeitstherapie Indikative Gruppen Psychodynamische Verfahren Bewegungstherapie Ergo- und Arbeitstherapie Milieutherapie 32 5. Korrektur dysfunktionaler Kognitionsmuster 6. Reduzierung von körperlichen Krankheitssymptomen 7. Erkennen möglicher funktionaler Aspekte von Krankheitssymptomen Verbesserung der eigenen Kompetenz im Management von Funktionsstörungen. 8. A3 A2 B1, B2, B3 Rehabilitationsziele bezogen auf Aktivitäten 9. Erweiterung des Verhaltensrepertoires Psychodynamische Verfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychoedukation/Schulung Bewegungstherapie Entspannungsverfahren Somatomedizin A3 Psychodynamische Verfahren A3, A4 Psychodynamische Verfahren Psychoedukation Krisenmanagement GRV (2002) A4 Therapeutische Maßnahmen Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychodynamische Verfahren Lernen in der Gemeinschaft Bewegungstherapie Milieutherapie Ergotherapie Psychodynamische Verfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Paar-und Familientherapie Milieutherapie Bewegungstherapie Ergotherapie 10. Verbesserung des Kommunikationsverhaltens A6 11. Aufbau sozialer Kompetenz A6 Kognitiv-behavioraleVerfahren Ergotherapie Bewegungstherapie Milieutherapie 12. Erwerb von Problemlösefähigkeiten A7 13. Optimierung der Krankheitsbewältigung (Coping) A5 14. Verbesserung der Fähigkeit zur Freizeitgestaltung D4 15. verbesserter Umgang mit Belastungssituationen. C4 D5 Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychodynamische Verfahren Millieutherapie Ergotherapie Milieutherapie Psychodynamische Verfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychoedukation/Schulung Freizeitplanung Ergotherapie Bewegungstherapie Milieutherapie Psychodynamische Verfahren Paar-und Familientherapie Entspannungsverfahren Ergo- und Arbeitstherapie Bewegungstherapie Rehabilitationsziele bezogen auf Teilhabe 16. Erhalt oder Verbesserung der psychischen Unabhängigkeit GRV (2002) D2, D3 17. Erhalt oder Verbesserung der physischen Unabhängigkeit D2, D3 18. Erhalt oder Verbesserung der Mobilität D5 19. Erhalt oder Verbesserung der sozialen Integration/Reintegration D2 Therapeutische Maßnahmen Psychodynamische Verfahren Paar- und Familientherapie Bewegungstherapie Kognitiv-behaviorale Verfahren Bewegungstherapie Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychodynamische Verfahren Paar- und Familientherapie 33 Milieutherapie 20. Erhalt oder Verbesserung im Bereich der Arbeit und Beschäftigung D1 21. Erhalt oder Verbesserung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit D1 Rehabilitationsziele bezogen auf Kontextfaktoren Ergo und Arbeitstherapie Soziotherapie/Sozialberatung Kognitiv-behaviorale Verahren Bewegungstherapie Sozialberatung Ergo und Arbeitstherapie Psychotherapie GRV (2002) 22. Planung und Einleitung von Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben D1 23. Anleitung zur gesundheitsbewussten Ernährung und Motivation zur Lebensstiländerung einschließlich Abbau von Risikoverhalten C2, C3 24. Anleitung zu Stressabbau/Stressbewältigung C4 25. Planung von Veränderungen in der häuslichen Umgebung D2, D3 26. Einleitung von Anpassung an Freizeitaktivitäten. D3, D4 27. Verbesserung des Informationsstandes über die Krankheit C1 28. Umgang mit Notfallsituationen (z.B. bei Panikanfällen) C4 29. Entwicklung von Strategien zum Abbau von Risikoverhalten (z.B. Rauchen, Alkohol, Medikamenten, Stress.) B4, B5 C2, C3 30. Unterweisen in Techniken zur Selbstkontrolle (z.B. Impulskontrollverlust) C2, C3 31. Erlernen von Entspannungstechniken C4 32. bei Essstörungen: Erkennen der Funktionalität der Essstörung mit dem Ziel eines gesunden Essverhaltens und einer gesunden Körperwahrnehmung B4 C3 33. bei Suchtproblemen: Erkennen der Funktionalität des Suchtmittelkonsums mit dem Ziel eines suchtmittelfreien Lebens B4 Therapeutische Maßnahmen Sozialberatung Ergo- und Arbeitstherapie Eingliederungsmanagement Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychodynamische Verfahren Ernährungsberatung Indikative Gruppen Nichtrauchertraining Psychoedukation Entspannungsverfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Paar-und Familientherapie Sozialberatung Ergotherapie Paar- und Familientherapie Ergotherapie Bewegungstherapie Freizeitplanung Psychoedukation/Schulung Somatomedizin Krisenmanagement Entspannungsverfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Schulung/Information Psychoedukation/Schulung Indikative Gruppen Kognitiv-behaviorale Verfahren Kognitiv-behaviorale Verfahren Indikative Gruppen Imaginationsgruppe Entspannungsverfahren Krisenmanagement Entspannungsverfahren: Progressive Muskelentspannung Autogenes Training Imagination Indikative Gruppen Ernährungsberatung Indiv. Bewegungstheraoie Psychoedukation Kognitiv-behaviorale Verfahren Psychodynamische Verfahren Indikative Gruppen Schulung/Information 34 6.2 Therapieziele bei Rehabilitanden mit pathologischem Gebrauch von Glücksspiel, Internet und/oder Computer Die Therapieziele ergeben sich aus den jeweiligen Funktionsbeeinträchtigungen (s.o.) und sind in Tabelle 6.2 den therapeutischen Maßnahmen gegenübergestellt. Die Rehabilitationsziele für die Rehabilitanden mit pathologischem Gebrauch von Glücksspiel, Internet und/oder PC wurden von den Leitlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) für Abhängigkeitserkrankungen abgeleitet (BAR 2006). Ergänzend aufgeführt sind die entsprechenden KTL-konformen Ziele der GRV (2002). Bei psychosomatischer Komorbidität gelten auch die in Tabelle 6.1 genannten Ziele. Tabelle 6.2: Ziele der Rehabilitation und die therapeutischen Maßnahmen bei den psychosomatischen Rehabilitanden der DIAKO Nordfriesland (nach BAR (2006) und GRV (2002)) Behandlungsziele (BAR 2006) 1. 2. 3. Aufbau der Motivation für eine Entwöhnungsbehandlung Krankheitseinsicht und emotionale Akzeptanz der Abhängigkeitserkrankung erreichen Abstinenz erreichen und erhalten, Rückfall vermeiden Ziele (GRV 2002) A 11 Behandlungsmodule A9 C1 Psychotherapie Psychoedukation / Schulung / Information Selbsthilfe Psychotherapie (Rückfallprävention) Psychotherapie (Bezugsgruppentherapie / Einzelgespräche) Psychoedukation / Schulung / Information Sport- und Bewegungstherapie Medizinische Beratung und Behandlung Psychotherapie Medizinische Beratung und Behandlung Sport- und Bewegungstherapie Psychoedukation / Schulung / Information Ernährungstherapie Berufliche Wiedereingliederung (Kognitives Training) Psychotherapie Psychotherapie: Indikative Gruppen zur psychischen Komorbidität Psychoedukation / Schulung / Information Sport- und Bewegungstherapie Ergotherapie Berufliche Stabilisierung Psychotherapie Soziales Kompetenztraining Milieutherapie Beruflichen Wiedereingliederung Ergotherapie Sport- und Bewegungstherapie Psychotherapie Ergotherapie Berufliche Stabilisierung und Wiedereingliederung Milieutherapie Psychotherapie Angehörigenarbeit Soziale Stabilisierung und Wiedereingliederung Nachsorge Psychotherapie: Maßnahmen zur Förderung sozialer Kompetenz Psychotherapie A5 C2 4. Entwöhnungssymptomatik abmildern B 2, 5, 6 5. Behebung oder Ausgleich von körperlichen Störungen A4 B 1-7 6. Behebung oder Ausgleich von seelischen Störungen A 1-4, A 6-10, 12 7. Arbeitsplatz erhalten 8. Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit erreichen D 2, 3 D 1, 3 Grundarbeitsfähigkeit, d.h.: Ausdauer, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Sorgfalt, Flexibilität, Arbeitstempo, Konzentration und Merkfähigkeit verbessern 10. Wiedereingliederung in die Gesellschaft erreichen D 1, 6 11. Soziale Fähigkeiten, d.h.: Zusammenarbeit, Kritikfähigkeit, Umgang mit Autoritäten, Umgang in der Gruppe A6 D2 9. D 2-4 Psychotherapie (Motivationsförderung) 35 12. Selbstbild, d.h.: Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung, Selbstgewissheit und Selbstwirksamkeit verbessern A8 13. beeinträchtigte Fähigkeiten wieder oder kompensatorische Fertigkeiten neu entwickeln bzw. sich fehlende Fähigkeiten aneignen 14. Selbst aktiver werden und wieder mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen D4 15. Soziale Benachteiligungen ausgleichen D 1, 4, 5 16. Umgang mit Stress-Situationen verändern und verbessern A5 C 1, 4 17. Umgang mit Angst-Situationen verändern und verbessern A5 C 1, 4 18. Erhalt selbständiger Lebensführung und Verhinderung von Pflegebedürftigkeit bei Menschen, die nicht mehr ins Berufsleben integriert werden können 19. Nachsorge organisieren (Übergangseinrichtungen, Wohnung, Arbeitsplatz, soziale Kontakte, Anlaufstellen, medizinische Versorgung etc.) D 2-4 A9 B4 C 3, 4 A 13 Milieutherapie Ergotherapie Berufliche Stabilisierung und Wiedereingliederung Sport- und Bewegungstherapie Psychotherapie Soziale Stabilisierung und Wiedereingliederung Milieutherapie Ergotherapie Berufliche Stabilisierung und Wiedereingliederung Sport- und Bewegungstherapie Psychotherapie Ergotherapie Soziale Stabilisierung und Wiedereingliederung Psychotherapie: Motivationsförderung Psychoedukation / Schulung / Information Sport- und Bewegungstherapie Soziale Stabilisierung und Wiedereingliederung Soziale Stabilisierung und Wiedereingliederung Psychotherapie: Maßnahmen zur Förderung sozialer Kompetenz Krisenmanagement Entspannungstherapie Medizinische Beratung und Behandlung Psychoedukation / Schulung / Information Psychotherapie Psychotherapie Krisenmanagement Entspannungstherapie Psychoedukation / Schulung / Information Angehörigenarbeit Soziale Stabilisierung und Wiedereingliederung Nachsorge Nachsorge 6.3 Therapieziele bei Rehabilitanden mit umweltmedizinischen Störungen Die Therapieziele ergeben sich aus den jeweiligen Funktionsbeeinträchtigungen (s.o.) und sind in Tabelle 6.3 den therapeutischen Maßnahmen gegenübergestellt. Die Rehabilitationsziele für die umweltmedizinischen Rehabilitanden wurden von den Leitlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) für allergische (BAR 2013) und für psychosomatische Erkrankungen (BAR 2010) abgeleitet. Spezifische Ausprägungen und Erweiterungen für umweltmedizinischen Rehabilitanden sind kursiv gedruckt. Ergänzend aufgeführt sind die entsprechenden Ziele der GRV (2002). Bei psychosomatischer Komorbidität gelten auch die in Tabelle 6.1 genannten Ziele. Die wichtigsten Ziele der rehabilitativen Behandlung von umweltmedizinischen Rehabilitanden sind wie folgt: 36 Behebung oder Verminderung von körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen Lernen den Einfluss von Umweltfaktoren auf Intoleranzreaktionen und andere Symptome zu erkennen und einzuschätzen Aufbau von Bewältigungskompetenzen und Kompetenzen zur Krankheitsverarbeitung Verminderung des Schweregrads der Beeinträchtigung der Aktivitäten oder Wiederherstellung gestörter Fähigkeiten Erhaltung oder Wiedererlangung der Teilnahme am sozialen und/oder beruflichen Leben Abbau von erkrankungsbedingtem Stress, negativen Gefühlen oder Angst Tabelle 6.3: Therapieziele bei den umweltmedizinischen Rehabilitanden der DIAKO Nordfriesland (adaptiert aus BAR 2010 und BAR 2013 sowie GRV 2002) Rehabilitationsziele: BAR (2010, 2013) Allgemeine Rehabilitationsziele 1. Behebung oder Verminderung der Schädigungen (einschließlich psychischer Funktionen) 2. Verminderung des Schweregrads der Beeinträchtigung der Aktivitäten oder Wiederherstellung gestörter Fähigkeiten 3. Kompensation (Ersatzstrategien) 4. Adaptation/Krankheitsverarbeitung 5. Einfluss von Umweltfaktoren auf Intoleranzreaktionen, Schmerzauslösung, Schmerzverstärkung, Erschöpfung und kognitive Defizite erkennen und erkennen lernen Rehabilitationsziele bezogen auf Körperfunktionen und Körperstrukturen (einschließlich psychischer Funktionen) 6. psychische Stabilisierung 7. Verminderung von negativen Affekten wie Depression und Angst 8. Individuelle Toleranz gegenüber alltäglichen Chemikalien verbessern Individuelle Toleranz gegenüber Nahrungsmitteln verbessern 10. Korrektur dysfunktionaler Kognitionsmuster GRV (2002) A1, A2 B1, B2, B3 A3, A4 B1, B2 D1-D5 A5 Gesamtkonzept A8, A9, A10, A11 C1 Gesamtkonzept Gesamtkonzept Gesamtkonzept Information und Schulung kognitiv-behaviorale Verfahren GRV (2002) A1 A2 9. A3 (Differenziertes Krankheitsmodell erarbeiten bzw. nicht stimmige oder fixierte Krankheitsmodelle verändern) 11. Reduzierung von körperlichen Krankheitssymptomen Therapeutische Maßnahmen A2 B1, B2, B3 Therapeutische Maßnahmen kognitiv-behaviorale Verfahren Bewegungstherapie Ernährungstherapie kognitiv-behaviorale Verfahren Psychopharmako-Therapie Bewegungstherapie Hyposensibilisierung Information und Schulung kognitiv-behaviorale Verfahren Ernährungstherapie Information und Schulung kognitiv-behaviorale Verfahren Information und Schulung Bewegungstherapie Entspannungsverfahren 37 Ernährungstherapie 12. Erkennen möglicher funktionaler Aspekte von Krankheitssymptomen 13. Verbesserung der eigenen Kompetenz im Management von Funktionsstörungen. Rehabilitationsziele bezogen auf Aktivitäten 14. Verbesserung der Beziehungsfähigkeit A3 A3, A4 GRV (2002) A6 15. Erwerb von Problemlösefähigkeiten (Konfliktmanagement) A7 16. Optimierung der Krankheitsbewältigung (Copingstrategien, Erlernen und verbessern, ungünstige Copingstrategien verändern) A5 17. Verbesserung der Fähigkeit zur Freizeitgestaltung D4 18. Verbesserter Umgang mit Belastungssituationen (insbesondere Exposition und/oder Stress) C4 D5 Rehabilitationsziele bezogen auf Teilhabe 19. Erhalt oder Verbesserung der Mobilität (auch unter dem Gesichtspunkt der Exposition) GRV (2002) D5 20. Erhalt oder Verbesserung der sozialen Integration/Reintegration (auch unter dem Gesichtspunkt der Exposition) D2 21. Erhalt oder Verbesserung im Bereich der Arbeit und Beschäftigung (auch unter dem Gesichtspunkt der Exposition) D1 22. Erhalt oder Verbesserung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit D1 Rehabilitationsziele bezogen auf Kontextfaktoren GRV (2002) D1 23. Planung und Einleitung von Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben 24. Anleitung zur gesundheitsbewussten Ernährung und Motivation zur Lebensstiländerung einschließlich Abbau von Risikoverhalten (auch unter dem Gesichtspunkt selbst herbeigeführter Exposition) 25. Anleitung zu Stressabbau/Stressbewältigung C2, C3 C4 Psychodynamische Verfahren kognitiv-behaviorale Verfahren Information und Schulung kognitiv-behaviorale Verfahren Therapeutische Maßnahmen Information und Schulung Psychodynamische Verfahren Paar-und Familientherapie Soziotherapie Information und Schulung kognitiv-behaviorale Verfahren Information und Schulung kognitiv-behaviorale Verfahren Information und Schulung Ergotherapie Information und Schulung Entspannungsverfahren kognitiv-behaviorale Verfahren Therapeutische Maßnahmen Information und Schulung Hyposensibilisierung Bewegungstherapie Information und Schulung Hyposensibilisierung Paar- und Familientherapie Soziotherapie Information und Schulung Hyposensibilisierung Ergo- und Arbeitstherapie Soziotherapie Ergo- und Arbeitstherapie Soziotherapie Therapeutische Maßnahmen Information und Schulung Soziotherapie Arbeitsplatztraining Information und Schulung Ernährungstherapie Indikative Gruppen Nichtrauchertraining Entspannungsverfahren kognitiv-behaviorale Verfahren 38 26. Planung von Veränderungen in der häuslichen Umgebung D2, D3 27. Einleitung von Anpassung an Freizeitaktivitäten D3, D4 28. Verbesserung des Informationsstandes über die Krankheit 29. Umgang mit Notfallsituationen (z.B. bei Panikanfällen) C1 30. Entwicklung von Strategien zum Abbau von Risikoverhalten (z.B. Rauchen, Alkohol, Medikamenten, Stress.) 31. Erlernen von Entspannungstechniken B4, B5 C2, C3 32. bei Essstörungen: Erkennen der Funktionalität der Essstörung mit dem Ziel eines gesunden Essverhaltens und einer gesunden Körperwahrnehmung B4 C3 C4 C4 Information und Schulung Ergotherapie Paar- und Familientherapie Ergotherapie Bewegungstherapie Information und Schulung Krisenmanagement Entspannungsverfahren Information und Schulung Indikative Gruppen kognitiv-behaviorale Verfahren Entspannungsverfahren Indikative Gruppen Ernährungstherapie kognitiv-behaviorale Verfahren psychodynamische Verfahren 39 7. Dauer der Therapie Die Dauer der Therapie richtet sich nach den Schwerpunkten und liegt zwischen 3 Wochen und 8 Wochen. 8. Aufnahme, Diagnostik und Ablauf der Therapie Die Aufnahme erfolgt nach einer Kostenzusage durch den Rehabilitationsträger. Die Therapie gliedert sich in folgende Schritte: 1. Diagnostische Maßnahmen vor Einleitung der Therapie Somatodiagnostik Psychodiagnostik Soziodiagnostik Sonstige Diagnostik (z.B. zu komorbiden Störungen) 2. Erstellung eines Therapieplanes und Definition der Therapieziele 3. Einsatz spezifischer Therapieangebote 4. Überprüfung des Erfolgs der Therapie und falls erforderlich Modifizierung des Therapieplanes oder der therapeutischen Maßnahmen 5. Einleitung von Nachsorgemaßnahmen 9. Behandlungsteam Fachärztinnen, Psychotherapeutinnen, Sozialpädagoginnen, Sozial-, Ergo, Musik - und Bewegungstherapeutinnen sowie Pflegekräfte engagieren sich gemeinsam für die Gesundung der Patienten. Ernährungsfachkräfte ergänzen das Team. 10. Ausstattung Für die Patienten stehen Ein- und Zweibettzimmer mit Nasszelle zur Verfügung. Es bestehen weiterhin Räumlichkeiten für Therapieveranstaltungen, Multifunktionsräume, Aufenthaltsräume und Teeküchen. Es besteht ein separater Wohnbereich für Frauen. Es gibt Patienten-Telefone und Patienten-PCs. Die Ausstattung ist barrierefrei. Breklum und das nahe Bredstedt sind touristisch erschlossene Orte mit historischen Ortskernen nur einige Kilometer von der Nordsee entfernt mit entsprechenden Möglichkeiten für Bewegung und Erholung. 40 In unserem "Raum der Stille" können die Patienten entspannen, nachdenken, meditieren, beten oder einfach nur zur Ruhe kommen. 11. Qualitätssicherungsmaßnahmen und Dokumentation Es erfolgt die regelmäßige Teilnahme an dem Qualitätssicherungsprogramm nach DIN EN ISO 9001:2008. Für jeden Patienten wird eine Dokumentation angelegt, aus der alle therapierelevanten Diagnosen, Befunde sowie die durchgeführten/geplanten Therapieformen entnommen werden können. Die Dokumentation umfasst: sämtliche erhobene anamnestische Daten, klinische Befunde und deren Interpretation die Therapieziele einen individuellen Therapieplan betreffend Art, Häufigkeit und Intensität der Behandlungselemente die Bewertung des Therapieerfolges durch Zwischenuntersuchungen in bestimmten Zeitabständen die Abschlussuntersuchung/-befundung die Angaben zu den Visiten und Teambesprechungen/Fallkonferenzen den Entlassungsbericht. Zusätzlich werden an der DIAKO Nordfriesland Erhebungen zur Patientenzufriedenheit durchgeführt und quartalsweise ausgewertet und diskutiert. Die Klinik verfügt über ein internes Beschwerdemanagement, das von Patienten wie von Mitarbeitenden genutzt werden kann. 12. Vor- und Nachsorge: Vernetzt behandeln - Therapieerfolg sichern Gerade bei komplexen Störungsbildern sind vernetzte Behandlungsangebote notwendig. Bei fast allen Erkrankungen aus den Fachbereichen der DIAKO Nordfriesland gGmbH handelt es sich um komplexe Störungsbilder. Mehrfacherkrankungen und Überschneidungen mit anderen Störungen (Komorbidität) sind eher die Regel als die Ausnahme. So bestehen bei depressiven Störungen häufig gleichzeitig Angststörungen, Zwangsstörungen, Traumafolgestörungen und Abhängigkeitserkrankungen. Das Risiko von Rückschlägen, Krisen und chronischen Verläufen ist bei diesen komplexen Störungsbildern generell hoch. Die Behandlungsplanung hat dem Rechnung zu tragen. Daher kann nur ein multimodales und vernetztes Therapiekonzept unter Einbezug von Nachsorgeangeboten langfristig erfolgreich sein. Dieses muss alle individuellen Aspekte der Erkrankung einbeziehen. Die Behandlung in den Einrichtungen der DIAKO Nordfriesland 41 gGmbH bietet dabei den Vorteil einer guten inneren Vernetzung des erforderlichen therapeutischen Angebotes. So sind - falls individuell erforderlich - Verlegungen in andere Abteilungen, sowie die unkomplizierte Vermittlung von Nachsorge- und Übergangsangeboten möglich. Unsere Partner bei der nachhaltigen Betreuung psychisch kranker und abhängigkeitskranker Menschen sind weiterhin externe Einrichtungen und Kooperationspartner (vgl. Abb. 12.1). Innerhalb der DIAKO Nordfriesland gibt es weiterhin Behandlungsmöglichkeiten in psychiatrischen Tageskliniken und Institutsambulanzen als nachsorgende Maßnahmen oder zur Vermeidung stationärer Aufenthalte Betreutes Wohnen in Wohnheimen und Wohngemeinschaften Eingliederung, stationäre und ambulante Rehabilitation und Adaption Tagesstätten, Arbeitsprojekte und Beschäftigungsmöglichkeiten, bspw. in der Husumer Insel. Abbildung 12.1: Interne und externe Vernetzung der DIAKO Nordfriesland 42 13. Referenzen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. APA - American Psychiatric Association (2001): Borderline personality disorder - Practice Guidelines, Leitlinie zur Behandlung von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/ practice_guidelines/guidelines/bpd-watch.pdf. ARMBRUST M, EHRIG C. (2016): Skills Training for Patients with Borderline Personality Disorder. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 66:283–298. ANDERSSON L, JOHANSSON A, MILLQVIST E, NORDIN S, BENDE M (2008): Prevalence and risk factors for Chemical Sensitivity and sensory hyperreactivity in teenagers. Int J Hyg Environ Health 211:690-697. ASHFORD NA, MILLER CS (1998): Chemical exposures: Low levels and high stakes. 2nd ed. New York: Van Nostrand Reinhold. AWMF 038/017 (2013): S3-Leitlinie: Zwangsstörungen. AWMF-Leitlinien-Register. AWMF 038/019 (2012): S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen. AWMF-LeitlinienRegister. AWMF 038/020 (2012): S3-Leitlinie: Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. AWMF-Leitlinien-Register. AWMF 051/001 (2012): S3-Leitlinie: Nicht-spezifische, funktionelle und somatoforme Körperbeschwerden, Umgang mit Patienten. AWMF-Leitlinien-Register. AWMF 051/010 (2011). S3-Leitlinie: Posttraumatische Belastungsstörung. AWMF-Leitlinien-Register. AWMF 051/026 (2010): S3-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Essstörungen. AWMF-Leitlinien-Register. AWMF 051/028 (2014). S3-Leitlinie: Behandlung von Angststörungen. AWMF-Leitlinien-Register. AWMF nvl-005 (2015): Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depressionen. AWMF-Leitlinien-Register BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) (2016). ICF-Praxisleitfaden 2 für Medizinische Rehabilitationseinrichtungen. BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) (2010). Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe psychisch kranker und behinderter Menschen. BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) (2006). Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) (2013). Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe allergischer Hauterkrankungen. BARTRAM F, BAUER A, V. BAEHR V, et al. (2011): Handlungsorientierte umweltmedizinische Praxisleitlinie - Leitlinienreport. Deutscher Berufsverband der Umweltmediziner e.V. (Hrsg.) Berlin, 2011 (www.dbuonline.de) BAUER A, MAI C, HAUF FO (2010): Follow-Up-Studie zum Einfluss der Erkrankungsdauer auf gesundheitsbezogene und soziale Parameter bei Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Umwelt Medizin Gesellschaft 23:1. BAUER A, SCHWARZ E (2006): Zur Validität von Fragebögen der psychologisch-psychiatrischen Diagnostik bei Personen, die gegenüber neurotoxischen Schadstoffen exponiert sind oder waren. Umwelt Medizin Gesellschaft 19,1: 43-49. BAUER A, SCHWARZ E, HAUF FO, MAI C (2008): Multiple Chemical Sensitivity / MCS: Ein Update. Umwelt Medizin Gesellschaft 21,4: 9-15. BAUER A, SCHWARZ E, MARTENS U, et al. (2003): Untersuchung über die Prädiktoren von Krankheitsentstehung und Langzeitverlauf bei ambulanten und stationären Patienten der Umweltmedizin am Fachkrankenhaus Nordfriesland. Forschungsbericht-Nr. F297 des BMGS, Berlin (www.bmgs.bund.de/cln_040/nn_600122/DE/Publikationen/Forschungsberichte). BRIEGER P (2011): Komorbidität bei bipolar affektiven Störungen. Nervenheilkunde, Heft 5/2011: 309-312. BUSS (Bundesverband für die stationäre Suchtkrankenhilfe) (2011). Erhebung der Problematik exzessiver Mediennutzung bei Patienten in der stationären Sucht-Rehabilitation. Abschlussbericht Februar 2011. BZGA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) (2016). Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland – Ergebnisse des Surveys 2015 und Trends. Forschungsbericht (www.bzga.de). DGPPN - Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (Hrsg.) (2009): S2Leitlinien für Persönlichkeitsstörungen, https://www.dgppn.de/publikationen/leitlinien.html. DINSE S (2012): Welt 2.0. Soziale Netzwerke – Grundlagen, Chancen, Risiken. Soziale Psychiatrie:1. EIS D, BECKEL T, BIRKNER N, et al. (2002): Multizentrische MCS-Studie. Forschungsbericht erstellt durch das Robert-Koch-Institut im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin. EU (2004). Der Europäische Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 2004-2010. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel 9.6.2004 (http://www.apug.de/archiv/pdf/eu-aktionsplan.pdf). FÖRSTL H, HAUTZINGER M, ROTH G (eds.) (2006): Neurobiologie psychischer Störungen. Springer Medizin Verlag Heidelberg: 298ff. FRIBOES RM, ZAUDIG M, NOSPER M (2005): Therapie bei psychischen Störungen. Urban und Fischer München. GBE (Gesundheitsberichterstattung des Bundes) (2013): GBE kompakt 2/2013: Diagnose Depressionen, Unterschiede bei Frauen und Männern (Hrsg. RKI). GIBSON PR, ELMS AN, RUDING LA (2003): Percieved treatment efficacy for conventional and alternative therapies reported by persons with multiple chemical sensitivity. Environ Health Perspect 111:1498-1504. GRV (2002). Therapiezielkatalog Version 3 für die Indikationsbereiche Psychosomatik und Abhängigkeitserkrankungen. Aus: REHA-Qualitätssicherungsprogramm der gesetzlichen Rentenversicherung. Abteilung für Medizinische Psychologie des Uni-Klinikums Hamburg-Eppendorf . 43 34. HAUSTEINER C, BORNSCHEIN S, HANSEN J, ZILKER T, FÖRSTL H. (2005): Self-reported chemical sensitivity in Germany: A population-based survey. Int J Hyg Environ Health 208,4: 271-8. 35. HERPERTZ SC (2011): Beitrag der Neurobiologie zum Verständnis der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Nervenarzt 82:9-15. 36. HOFMANN A (2014): EMDR, Praxishandbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen. 5., vollständig überarbeitete Auflage. 37. HOFMANN A (2006): EMDR - Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome. 3. Auflage. Thieme Stuttgart. 38. HOJO S, Yoshino H, Kumano H et al. (2005): Use of QEESI questionnaire for a screening study in Japan. Toxicol Indust Health 21:113-124. 39. KARLSON B, ÖSTERBERG K, ORBAEK P (2000): Euroquest The validity of a new symptom questionnaire. Neurotoxicology 21:783-790. 40. KOHLMANN T, KUNZE U, EHLERS J, RASPE H (1999): Abschlussbericht zur wissenschaftlichen Begleitung der umweltmedizinischen Ambulanz und Station am Fachkrankenhaus Nordfriesland, Bredstedt. Institut für Sozialmedizin der Medizinischen Universität Lübeck. 41. KTL Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (2015). Ausgabe 2015 (Hrsg. Deutsche Rentenversicherung). 42. KREUTZER R, NEURTA RR, LASHUAY N (1999): Prevalence of people reporting sensitivities to chemicals in a population based survey. Am J Epidemiol 150:1-12. 43. KUSS DJ, GRIFFITHS MD, KARILA L, BILLIEUX J (2014): Internet Addiction: A Systematic Review of Epidemiological Research for the Last Decade. Current Pharmaceutical Design, 2014, 20, 25, online Version (http://irep.ntu.ac.uk/16223/1/3001_Griffiths.pdf) 44. JERUSALEM M, MEIXNER S (2004): Is excessive internet use an unhealthy coping strategy? Amsterdam, Netherlands: 25th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July 8-10, 2004 (www.internetsucht.de/publikationen.html). 45. MEGGS WJ, DUNN KA, BLOCH RM et al. (1996): Prevalence and nature of allergy and chemical sensitivity in a general population. Arch Environ Health, 51: 275-282. 46. MEYER (2016): Glücksspiel - Zahlen und Fakten, Jahrbuch Sucht 2016, Lengerich: Pabst. 47. MUKIAN (2014): Glücksspielsucht - Eine Informationsbroschüre für Betroffene und Angehörige. Suchthilfezentrum Schleswig (www.suchthilfezentrum-sl.de) 48. NICE Guideline (2009): Borderline personality disorder: recognition and management Clinical guideline. nice.org.uk/guidance/cg78. 49. PALLESEN S, MITSEM M, KVALE G, JOHNSON BH, Molde H (2005): Outcome of psychological treatment of pathological gambling: A Review and Meta-Analysis. Addiction 100:1412-1422. 50. PETERSEN R (2012): Behandlung Pathologisches Glücksspiel. Brückenschlag. Zeitschrift für Sozialpsychiatrie – Literatur – Kunst . Paranus Verlag: Neumünster. 51. PETRY J, FÜRCHTENSCHNIEDER-PETRY I, VOGELSANG M, BRÜCK T (2013): Pathologisches Glücksspielen. Suchtmedizinische Reihe Band 6 (Hrsg. DHS, www.dhs.de). 52. PETRY J (2010): Dysfunktionaler und pathologischer PC- und Internet-Gebrauch. Göttingen: Hogrefe. 53. POTENZA MN, FIELLIN DA, HENINGER G et al. (2002): Gambling. An Addictive Behavior with health and primary care implications. J Gen Intern Med 17:721-732. 54. RUMPF HJ, MEYER C, KREUZER A, JOHN U (2011): Prävalenz der Internetabhängigkeit (PINTA). Bericht an das BMG. Universität Lübeck. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (www.drogenbeauftragte.de) 55. RASH C, PETRY NM (2014): Psychological treatments for gambling disorder. Psychology research and behavior management, 7:285-295. 56. SA (SOUTH AUSTRALIAN) DEPARTMENT OF HEALTH (2004): Executive Summary of the Social Development Committee of the Parliament of South Australia: MCS – Multiple Chemical Sensitivity. 57. SCHWARZ E, BAUER A (2006). Therapeutische Optionen bei Patienten mit Multiple Chemical Sensitivity (MCS) und anderen chronischen umweltmedizinischen Erkrankungen. Umwelt Medizin Gesellschaft 2/2006: 111-116. 58. SERVAN-SCHREIBER D (2004): Die neue Medizin der Emotionen. Stress, Angst, Depression: Gesund werden ohne Medikamente. Verlag Antje Kunstmann, München. 59. SHAPIRO F: (2013): EMDR, Grundlagen und Praxis. 2. überarbeitete Auflage. 60. STIGLMAYR C, STECHER-MOHR J, WAGNER T, et al. (2014): Effectiveness of dialectic behavioral therapy in routine outpatient care: the Berlin Borderline. Borderline personality disorder and emotion dysregulation, 1, 1-20, DOI 10.1186/2051-6673-1-20. 61. VILLANUEVA, R (2013): Neurobiology of major depressive disorder. Neural plasticity, Band 2013: 873278. 62. WHO (2005): ICF-International Classification of Diseases. (Hrsg.: Deutsches Institut für medizinische Dokumentation - DIMIDI). 63. WILLNOW H, PETERSEN R, BAUER A (2012): Leben in einer virtuellen Welt: Der Pathologische PCGebrauch. Infodienst Sucht (Ausgabe 2/2012: 12-13). 64. WITTCHEN HU, JACOBI F, HOYER J (2003): Die Epidemiologie psychischer Störungen in Deutschland. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Forschungsvorhaben: Förderkennzeichen: BMBF 01 EB 9405/6 und 01 EB 9901/6. Vortrag 29.09.2003. 44
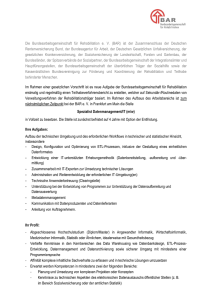
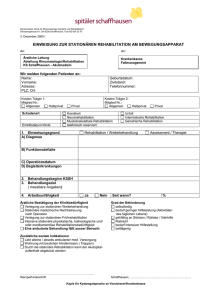
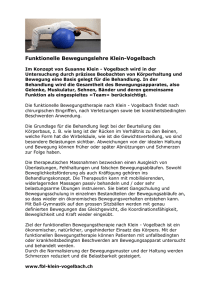

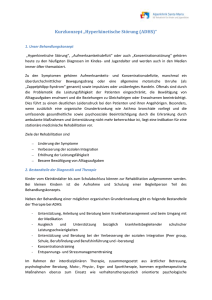
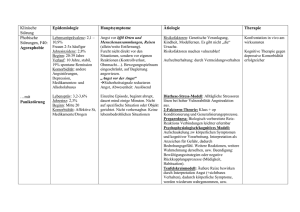
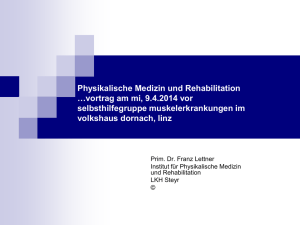

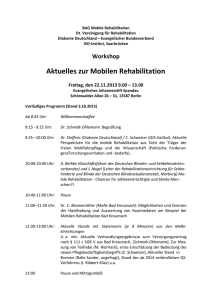


![001_Geologische_Tabelle_Faktoren_3_Endla[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/002317598_1-5316e8c22586a8aa95c7fe9ab279021b-300x300.png)