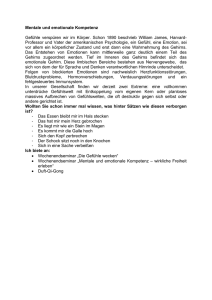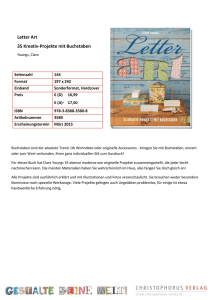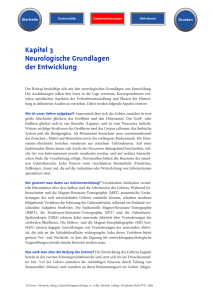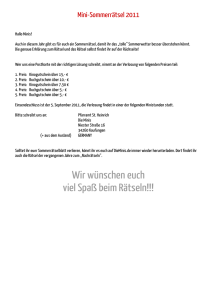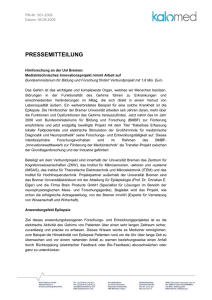Stanislas Dehaene, Lesen. Die größte Erfindung der Menschheit
Werbung

Stanislas Dehaene, Lesen. Die größte Erfindung der Menschheit und was dabei in unseren Köpfen passiert, München 2010 (2009) 08.03.11 (empfohlene Zitierweise: Detlef Zöllner zu Stanislas Dehaene, Lesen. Die größte Erfindung der Menschheit und was dabei in unseren Köpfen passiert, München 2010 (2009), 08.03.2011, in: http://erkenntnisethik.blogspot.de/) 1. Beschreibungssubjekt und Handlungssubjekt in der Gehirnforschung 2. Zur Interdisziplinarität der Gehirnforschung 3. Zur neurophysiologischen Funktionalität des Gehirns: Bewußtsein und Verhalten 4. Zur neurophysiologischen Funktionalität des Gehirns: Konkurrenz versus Wechselseitigkeit 5. Zur neurophysiologischen Funktionalität des Gehirns: Gestaltwahrnehmung 6. Zur neurophysiologischen Funktionalität des Gehirns: Protobuchstaben 7. Zur neurophysiologischen Funktionalität des Gehirns: Schulunterricht Dehaene geht davon aus, daß unsere Buchstaben, um ihre Wahrnehmung zu erleichtern, auf einen „kleinen Fundus minimaler und universeller Buchstabenformen“ zurückgehen (vgl. Dehaene 201, S.218), die er als „Protobuchstaben“ bezeichnet: „Für die Erkennung von Gegenständen spielen diese primitiven Formen die Rolle eines Alphabets, dessen Kombinationen es ermöglichen, jedes beliebige Objekt zu beschreiben. Ich bezeichne diese Formen als ‚Protobuchstaben‘ – sie funktionieren nicht nur wie ein kombinatorisches Alphabet, einige von ihnen ähneln unseren Buchstaben sogar in erstaunlichem Maß!“ (Dehaene 201, S.148) Als „universell“ bezeichnet er sie, weil er sie weltweit in allen Schriftformen wiederfindet, auch in chinesischen und japanischen Schriftzeichen. Letzteres leuchtet mir nicht ohne weiteres ein; es sei denn man setzt einen besonders geübten Blick für die Universalität dieses Formenfundus voraus, der mir abgeht. Chinesische und japanische Schriftzeichen sind jedenfalls für mein europäisches Auge so fremd, daß ich in ihnen kein E, F, L, T, X, Y oder Z wiederfinden kann, es sei denn, ich setze dabei dasselbe Abstraktionsniveau an wie bei den Gegenständen, die Dehaene anführt, um zu zeigen, wie sich das Zusammenlaufen der Konturen bei einem Würfel und bei einer Kaffeetasse mal zu einem F, mal einem T und mal zu einem Y fügt. (Vgl. Dehaene 2010, S.152f.) Jedenfalls ist die These, daß die Erfindung und Entwicklung des Alphabets sich an der (flächigen) Wahrnehmung von Gegenständen der Außenwelt orientiert, plausibel (vgl. Dehaene 2010, S.157), denn es leuchtet ein, daß die schon für die Wahrnehmung von Gegenständen funktionale Aktivität der Neuronen eine entsprechende Aktivität zur Erkennung von Buchstaben unterstützen würde. Weniger plausibel ist allerdings, daß dieses Prinzip offensichtlich nicht bei allen Buchstaben umgesetzt wurde, – daß es vielmehr viele dysfunktionale Gegenbeispiele gibt. Die Flächigkeit des visuellen Systems beinhaltet nämlich eine für das Erkennen und Differenzieren von Buchstaben hinderliche Verallgemeinerungsprozedur: die Symmetriewahrnehmung (vgl. Dehaene 2010, S.320f., 329f., 333), die wir beim Lesenlernen erst mühsam lernen müssen zu unterdrücken, um zu sicheren und geübten Lesern zu werden. Die Symmetriewahrnehmung ermöglicht es uns, in der Außenwelt von links sich in unser Blickfeld hinein bewegende Objekte nicht nur einmalig zu erkennen, sondern auch dann wiederzuerkennen, wenn sie sich von rechts in unser Blickfeld hineinbewegen, also unserem flächigen Sehsystem nun eine ganz andere Seite zuwenden. Haben wir also einmal gelernt, ein Raubtier von links zu erkennen, werden wir es automatisch auch von rechts erkennen, ohne es nochmal extra lernen zu müssen. Das hat nichts mit Rotation zu tun, also mit Räumlichkeit, sondern beinhaltet lediglich eine spezifische Unempfindlichkeit für den Unterschied von rechts und links. Oben und unten unterscheidet dieses visuelle System durchaus, aber eben nicht rechts und links. Nun gibt es aber verschiedene Buchstaben, die zueinander symmetrisch sind, wie z.B. ‚b‘ und ‚d‘ und ‚p‘ und ‚q‘. Für Leseanfänger sind diese Buchstaben identisch, so wie sie auch ein Objekt in der Außenwelt, egal ob von rechts oder von links, als identisch wahrnehmen. „Die Symmetrie ... behindert das Lesen. Sie erschwert das Lernen und verleitet uns dazu, systematisch Buchstaben wie ‚p‘ und ‚q‘ oder ‚b‘ und ‚d‘ zu verwechseln. So zeigt sich erneut, dass das Gehirn nicht wirklich für das Lesen vorgesehen ist und sich so gut wie möglich daran anpasst.“ (Dehaene 2010, S.301f.) Es bedarf also eines langen und mühsamen Lernprozesses, um diese Symmetrie zu „brechen“, wie Dehaene schreibt: „Es (das Sehsystem) lernt, ‚b‘ und ‚d‘ nicht mehr als unterschiedliche Ansichten desselben Objekts zu betrachten. ... Damit entsteht ... eine neuronale Hierarchie, die auf die visuelle Erkennung von Wörtern spezialisiert ist und gespiegelte Bilder nicht länger miteinander verwechselt – im Gegensatz zu den auf Objekte und Gesichter spezialisierten benachbarten Neuronen.“ (Dehaene 2010, S.334) Die Frage, die sich hier stellt, ist, wieso eine kulturelle Evolution der Schrift, in der sie durch „Versuch und Irrtum und fortwährende Selektion über mehrere Generationen hinweg ... zu einem kleinen Fundus minimaler und universeller Buchstabenformen“ gelangte (vgl.Dehaene 2010, S.218), so hartnäckig an ganz offensichtlich zum Lesen dysfunktionalen Buchstaben festhielt, die das Lesenlernen bis hin zur Legasthenie so sehr erschweren? Es ist offensichtlich nicht einfach so, wie Dehaene es immer wieder auf seine These von der begrenzten Plastizität des Gehirns verkürzend darstellt, daß das Lesen sich der neurophysiologischen Funktionalität anpaßt, sondern das Lesenlernen stellt vielmehr ein herausragendes Beispiel für die Art und Weise dar, wie wir die neurophysiologische Funktionalität des Gehirns – bis hin zur ‚Brechung‘ des Symmetrieprinzips! – einem kulturellen Zweck, nämlich dem Lesen anpassen. Dehaene selbst weist immer wieder auf diesen Umstand hin: „Je besser die Lesefähigkeit wird, desto stärker wird die linke Schläfenregion im Hinterhaupt aktiviert – genau an den beim Erwachsenen beobachteten Koordinaten.() Diese Steigerung hängt mehr vom erreichten Leseniveau des Kindes als von seinem Alter ab. Darin spiegelt sich sicher der Leseerwerb und nicht nur eine Reifung des Gehirns.“ (Dehaene 2010, S.235) Daß Dehaene das Lesenlernen trotzdem als Beispiel für die begrenzte Plastizität des Gehirn verwendet, läßt vermuten, daß sein gegen den kulturellen Relativismus gerichtetes Interesse am Nachweis einer invarianten anthropologischen Konstante größer ist (vgl. Dehaene 2010, S.132) als das objektive Gewicht seiner Argumente Nach meiner Lektüre seines Buches scheint mir jedenfalls eher die These gestärkt zu sein, daß es sich bei der Lesefähigkeit um ein auf der Verhaltensebene zu verortendes und dort auch zu verstehendes Phänomen handelt und daß dieses Verhalten die Gehirnfunktionen beeinflußt, – solange jedenfalls, wie nicht pathologische Deformationen diese Gehirnfunktionen für das Lesen dysfunktional werden lassen! Wir haben es also mit einem Beleg dafür zu tun, daß es auch hier, bei der neurophysiologischen Funktionalität des Gehirns, vor allem auf die Art ihrer Verwendung ankommt, nicht anders als bei der ‚Intelligenz‘ oder bei dem kulturellen Potential einer Schriftart (Assmann).