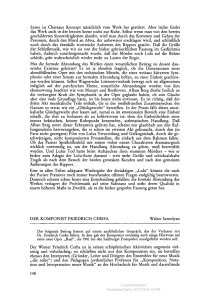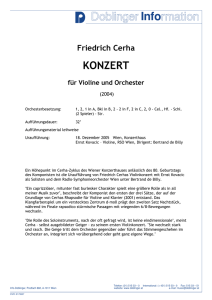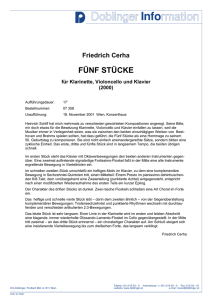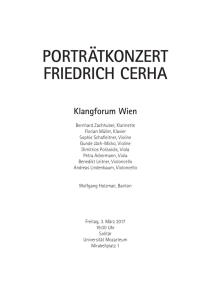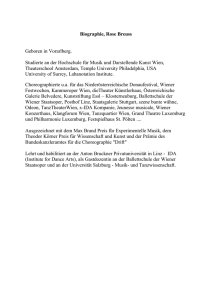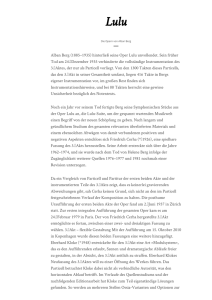Interview mit Friedrich Cerha von Thomas Meyer, Februar 2012 my
Werbung

Interview mit Friedrich Cerha von Thomas Meyer, Februar 2012 my: Herr Cerha, ich möchte gern im Jahr 1958 beginnen: Damals gründeten Sie zusammen mit Ihrem Komponistenkollegen Kurt Schwertsik in Wien das Ensemble die reihe. Welches waren die Beweggründe zu dieser Gründung? Friedrich Cerha: Es gab damals noch keine Ensembles für Neue Musik, und es gab vor allem in Wien, wie übrigens an vielen anderen Orten auch, keine guten Aufführungen von den doch recht anspruchsvollen Werken der Wiener Schule. Unsere Ambition war es, ein Podium zu schaffen, um Werke der Wiener Schule – also Schönberg und Webern vor allem – und daran anschliessend auch der damaligen neuesten Musik – das war hauptsächlich die von Darmstadt her geprägte – in wirklich einwandfreien Aufführungen herauszubringen. my: War das Musikleben in Wien damals reich an Neuer Musik? Es gab wohl einige wichtige Figuren, aber lebte diese Szene auch? Cerha: Heute ist das Bild von dieser Zeit im Allgemeinen recht verfälscht. Da muss ich weiter ausholen. Man hat vielfach so getan, als ob die Darmstädter Schule sozusagen etwas fortgesetzt hätte, was es vor dem Krieg im Konzertleben gab. Das stimmt ja nicht; schon vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Vertreter der Wiener Schule, also Schönberg, Webern, in Wien so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Im Vordergrund standen ganz andere Leute. Nach dem Krieg gab es einen Nachholbedarf – Österreich war ja völlig abgeschnitten während des Krieges –, aber was man meinte, nachholen zu müssen, war das, was man halt so unter dem Begriff Neoklassizismus subsumiert, also Hindemith, der späte Bartók und Strawinsky. Ich bin relativ früh zur österreichischen IGNM [Internationale Gesellschaft für Neue Musik] gestoßen, in der noch eine Reihe von Leuten aus der Umgebung Schönbergs und Weberns wirkten. Natürlich hat mich die Wiener Schule fasziniert, und ich hatte glücklicherweise Gelegenheit, sozusagen aus erster Hand diese Werke kennen zu lernen und zu analysieren. Das war eigentlich der Umkreis, der mich, wenn Sie wollen, erzogen oder herangebildet hat. my: Ich denke da etwa an eine Qualität der Musik Weberns, die ich auch bei Ihnen wiederfinde: Fasslichkeit. Cerha: Weberns Musik hatte einen großen Einfluss auf mich. Sicher durch den SchönbergSchüler Josef Polnauer, einen Juden, der sich sechs Jahre lang verstecken musste und dabei Musik analysierte. Von ihm habe ich viel gelernt, auch bezüglich der Klarheit, mit der ich gestalte. Polnauer, der Vortragsmeister in Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen, saß in allen meinen Proben, wenn ich Werke von Schönberg oder Webern erarbeitet habe. Nicht zu vergessen, dass er sich auch damals schon für Boulez und andere interessiert hat. Dieser Kreis um die IGNM hat uns dann auch sehr geholfen, die Konzertserien mit unserem Ensemble die reihe zu realisieren. Darüber hinaus, materiell und organisatorisch, gab es eine sehr aufgeschlossene musikalische Jugend, die Jeunesse musicale, die uns sozusagen die äußeren Voraussetzungen gegeben hat, diese Dinge zu realisieren. my: Wir sprachen schon über Webern: Man sagt ja heute manchmal, dass die Seriellen seine Musik damals auf fruchtbare Weise missverstanden hätten, indem sie sie auf Einzeltöne reduzierten. Haben Sie in Wien ein anderes Webern-Verständnis mitbekommen? Cerha: Die damals in Darmstadt übliche Webern-Interpretation war immer ein Gegenstand der Auseinandersetzung. Polnauer lehrte mich Webern vor allem formal zu analysieren. Reihenverläufe interessierten ihn nur am Rande; „Töne zählen können Sie alleine“, sagte er. Wenn ich heute Webern mache, weiss ich natürlich, wie er gebaut ist, aber im Grunde genommen interessiert mich das viel weniger als der emotionale Anteil: Irgendwo fühle ich mich als Österreicher oder besser als Ostösterreicher oder, wenn Sie wollen, als Wiener, etwa in den Trakl-Liedern op. 14 zuhause; es ist so etwas wie meine musikalische Heimat. my: Verstehe ich Sie richtig: der Ausdrucksgehalt interessiert Sie eigentlich mehr als die Konstruktion? Cerha: Man sollte und man kann das nicht so auseinandernehmen, aber um ein Beispiel zu geben: In der Darmstädter Zeit sind Webern-Werke immer genau in dem Tempo gemacht worden, das dort in Metronomzahlen steht, meistens noch schneller, während doch Schönberg und auch Webern immer beteuert haben, dass Metronomzahlen grundsätzlich nur Andeutungen für den Charakter der Musik sind. Mittlerweile hat sich das ja alles geändert, und Boulez nimmt ja auch heute zum Teil extrem langsamere Tempi als damals. Sehr wichtig ist ein atmendes Phrasieren. Das habe ich damals an vielen Interpretationen vermisst. my: Diese Diskrepanz, nach der ich frage, betrifft ja nicht nur Webern. Wenn man Ihren Zyklus Spiegel aus den Jahren 1960/61 hört, merkt man, dass Ihre Musik von der Kompositionstechnik und vom Material her völlig auf dem Stand der Zeit war. Darüber hinaus steckt in den Spiegeln aber auch eine enorme Klangsinnlichkeit. Cerha: Ja, aber vor allem kommen die Spiegel aus einem ungeheuren Ausdrucksbedürfnis. Es hat mich befremdet, dass die Kritiker nach den ersten Aufführungen von intellektuellen Experimenten, von Kopfmusik gesprochen haben. my: Dabei klingt diese Musik für mich doch sehr viel expressiver, fast dramatischer als vieles, was ich aus jener Zeit kenne. Cerha: Ich vermeide es ja möglichst, mich selber zu interpretieren, vor allem verbal. Ich muss aber sagen, dass sich da in der Rezeption allgemein viel gewandelt hat. Ich erinnere mich noch an die Uraufführung etwa des vierten Spiegels, nach der allgemein nur das große Experiment, das Avantgardistische oder das Konstruktive gesehen wurde. Das ist mir schon damals sehr einseitig vorgekommen, weil für mich eben auch der emotionale Anteil daran wichtig war. Mittlerweile hat sich das gewandelt: Bei den letzten Aufführungen der Spiegel ist offensichtlich das, was hinter der Tonsprache steht, besser verstanden worden. Hier hat sich einfach in den Hörgewohnheiten oder im Verständnis sehr vieles verändert. Man versteht heute viel mehr den Ausdruck dieser Musik als damals. my: Kann man sagen, dass Sie damals schon in Wien eine gesunde Distanz zu Darmstadt hatten? Cerha: Ja, das kann man sagen. Ich hatte zwar immer sehr guten Kontakt, etwa mit Stockhausen, aber ich erinnere mich noch, dass er mich doch manchmal von der Seite und sehr scheel angesehen hat, wenn ich einige Dinge nicht unterschreiben wollte oder bedenklich fand (lacht). Umgekehrt ist es in den letzten Jahren Mode geworden, sich von Darmstadt zu distanzieren und die Richtung und die Bewegung von damals sozusagen als eine Sackgasse der Geschichte zu betrachten. Das ist völlig unsinnig, denn in der Geschichte gibt es ja keine Sackgassen, das ist ja ein Netzwerk von sehr verschlungenen Wegen: von Wegen, die nie geradlinig gehen, sondern sozusagen immer Umwege machen. Es ist ja auch nicht zu leugnen, dass sehr vieles Andersgeartete, das heute passiert, ohne diese Zeit und ihre Ereignisse nicht möglich wäre. my: In Wien gab es damals ja auch eine sehr radikale literarische Bewegung, die Wiener Aktionisten. Gab es da Berührungspunkte zur Musikszene? Cerha: Diese Bewegung gab es in den 60er Jahren, und es ist, glaube ich, sehr schwer, da eine Parallele herzustellen. Die avantgardistischen Zirkel, die aus der Bildenden Kunst oder auch aus der Literatur kamen und mit denen ich auch in Kontakt und vielfach befreundet war, waren in den 50er Jahren aktiv und wir haben damals von Darmstadt noch so gut wie nichts gewusst. Wir haben in der Musik noch etwas ganz anderes als avantgardistisch gesehen. Im Strohkoffer etwa, dem Lokal des Art Clubs, wurde sehr viel Strawinsky gespielt oder auch Jazz und so gut wie überhaupt keine Musik der Wiener Schule. Diese Kreise um den Art Club und die Wiener Gruppe mit H.C. Artmann, Friedrich Achleitner, Oswald Wiener haben eigentlich erst relativ spät die Anstöße der seriellen Musik rezipiert. Gerhard Rühm war ihnen als Einziger voraus. my: Und interessanterweise haben Sie deren Texte damals auch nicht vertont. Cerha: Die Künstler der Wiener Gruppe waren Freunde, wir trafen uns im Untergrund. Lange aber konnte ich damit musikalisch nichts anfangen. In den 80er Jahren erst entstand dann eine Reihe von Chansons… my: …etwa der Zyklus Eine Art Chansons nach Gedichten von Friedrich Achleitner, Ernst Jandl, Gerhard Rühm, sowie eigenen Texten… Cerha: Das war eine sehr intensive Auseinandersetzung in jener Zeit. my: Was konnte die reihe in all diesen Jahren bewirken? Hat sich etwas verändert? Konnten Sie ein Publikum heran ziehen? Entstand dadurch in Wien eine Szene für Neue Musik? Cerha: Unsere Konzerte waren eigentlich von Anfang an sehr gut besucht, und das Interesse von Seiten der anderen Kunstsparten war immer sehr groß, also seitens der Architektur, der Bildenden Kunst sowie einer Gruppe, die spezifisch in Wien immer musikalisch eine Rolle gespielt hat, nämlich der Ärzte, der Medizin. Unsere Konzerte haben eine breite Aufmerksamkeit gefunden, wenngleich natürlich nicht immer eine positive. Ich erinnere mich noch an unser erstes Cage-Konzert, das einen ungeheuren Skandal verursacht hat, der bis in die illustrierten Zeitschriften, die so bei den Friseuren herumliegen, gedrungen ist; wir haben uns der Fotos wegen, die dort zu finden waren, gar nicht mehr auf die Straße getraut (lacht). Wien hat zwar international den Ruf, sicherlich auf einigen Gebieten und in gewisser Hinsicht mit Berechtigung, eine konservative Stadt zu sein. Aber eigentlich stimmt das schon längst nicht mehr. Seit vielen Jahren nun schon stellt etwa Wien Modern jeweils vier, fünf lebende Komponisten in den Mittelpunkt und macht eine Vielzahl von dreißig, vierzig Konzerten mit Neuer Musik. Dieses Festival hat einen ungeheuren Zulauf, und die Öffentlichkeit nimmt breiten Anteil an diesen Ereignissen, auch sehr viele junge Menschen, auch die Medien. my: Dazwischen aber, bevor Wien Modern gegründet wurde, lag doch, so schien uns von außen, einiges relativ brach, war also Wien wieder etwas im Konservatismus versunken… Oder stimmt diese Sichtweise nicht? Cerha: Das stimmt nicht. Neue Musik war – ab 1959/60 in Ensemble- und ab 1968 auch in Orchesterkonzerten – immer präsent. Es ist aber, glaube ich, sehr wichtig, dass man nicht nur die gegenwärtige Kunst pflegt, sondern auch eine Brücke schlägt vom gängigen Repertoire zur gegenwärtigen Kunst. Und das ist in Wien eine Zeit lang zu wenig geschehen – wie in vielen Städten Europas. Die großen Konzerthäuser spielen allerorten nur die Musik bis Debussy und Strawinsky; daneben gibt es die Veranstalter mit ganz neuer Musik und dazwischen klafft eine Lücke mit der Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dadurch fehlt etwas. Wir in Wien haben daran gearbeitet, und durch – ich sage das heute oft verpönte Wort: Erziehung – ist es uns gelungen, ein aufgeschlossenes Publikum an die Gegenwart heranzuführen. In Wien ist das Publikum weniger konservativ, als es früher war. Es ist ja noch nicht damit getan, wenn man irgendein schwieriges Werk einmal aufführt. Wichtig ist, dass dem ständigen Repertoire immer neue Werke einverleibt werden. Und das kann fürs Publikum nur dadurch geschehen, dass gewisse wichtige Stücke aus dem modernen oder avantgardistischen Bereich eben immer wieder kommen. Ich habe deshalb ein Unternehmen gestartet, den Zyklus „Wege in unsere Zeit“, der über fünf Jahre hinweg einen Querschnitt aus der Musikentwicklung, angefangen etwa mit dem Ersten Weltkrieg bis in die damalige Gegenwart, gebracht hat [1978–1983]. Das hat, denke ich, sehr den Boden bereitet für das, was dann mit Wien Modern in einer erfreulichen Weise zum Durchbruch gekommen ist. Es gibt ja Städte in Europa, wenn Sie an Deutschland denken, etwa Frankfurt oder Köln, die den Flair des Avantgardistischen haben und wo es 150 Leute gibt, denen nichts avantgardistisch genug sein kann, wo aber keine Brücke zum übrigen Publikum geschlagen wird. Und das finde ich bedauerlich, denn jene 150 oder, wenn’s mal gut geht, 300 Leute, die sehr verständnisvoll sind, sind vielleicht doch zu wenig, um zu garantieren, dass sich die Tradition sozusagen fortsetzt. Und darauf kommt es ja an: dass der traditionellen Musikpflege neue Werke einverleibt werden. In Wien gibt es zurzeit eine sehr lebendige Atmosphäre. Anfangs war die reihe das einzige Ensemble. Inzwischen existiert eine Vielzahl von Ensembles für Neue Musik, wobei jedes einen etwas anderen Schwerpunkt hat und auch sein eigenes Publikum. my: Spiegel ist ein zentrales Werk anfangs der 60er Jahren. Dahinter steht, wenn ich das richtig verstehe, eine szenische Konzeption. Cerha: Das visuelle Moment hat in der Struktur dieses Stückes eine wesentliche Rolle gespielt; es gab von Anfang an eine Art Libretto für den Zyklus, das aber bis zum heutigen Tag nicht wirklich realisiert wurde. Die Spiegel sind alle um 1959/60 konzipiert worden, wurden aber zum Teil erst später ausgeführt, weil es ja damals keine Chance einer Aufführung gab. Klangflächenkomposition hat man später das Verfahren genannt; den Begriff habe nicht ich erfunden. In der Musik liegt der Schwerpunkt auf Massenereignissen, in denen das vereinzelte Ereignis, die vereinzelte Linie sozusagen im Gesamtgeschehen aufgeht. Analog ist auch im optisch-theatralischen Bereich das Einzelwesen, das Individuum von untergeordneter Bedeutung. Es ist also ein Netzwerk – so heisst auch die nächste Arbeit für das Musiktheater von mir – von Massenereignissen, die immer wieder zur Evolution des Menschen beziehungsweise der humanen Gesellschaft Bezug nehmen. In dieser Form schließt es ein wenig – freilich in einer völlig anderen Weise oder übersetzt – an die alte Idee des Welttheaters an. my: Das ist ja ein zentrales Thema in Ihrem Œuvre. Ich denke zum Beispiel an Ihre zweite Oper Der Rattenfänger nach dem letzten Stück von Carl Zuckmayer. Cerha: Die Idee, die Bühne als Symbol der Evolution der Spezies, aber auch des Einzelindividuums oder, wenn Sie wollen, von mir selbst zu sehen, zieht sich durch die Arbeiten hindurch, auch vom Stoff her. Die Masse, die Gemeinschaft, die Sozietät steht in den Spiegeln im Vordergrund. Im Netzwerk (1962/79) wechselt die Perspektiven zwischen Masse und typisierten Einzelwesen, die interagieren. Im Baal [nach Bertolt Brecht] ist es dann eigentlich das Verhältnis des Individuums, des Subjekts zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft, das für mich im Mittelpunkt steht. Was kann eine Gemeinschaft vom Einzelnen fordern? Wie kann sich der Einzelne der Gemeinschaft gegenüber verhalten? Was muss er akzeptieren? Wie weit muss er die Wege, die eine Gesellschaft dem Individuum vorzeichnet, gehen und wie weit kann er diese, wenn Sie wollen, Einbahnstrasse, die die Gesellschaft ihm vorschreibt, verneinen? my: Es gibt in Ihrem Werk mehrere Außenseiterfiguren. Cerha: In den Opern etwa, im Baal, im Rattenfänger, der in eine korrupte Stadt kommt und die Kinder in eine andere Welt mitnimmt, ohne sie darüber in einer Illusion zu lassen, dass sie besser sein wird. Und der Riese vom Steinfeld ist allein seiner Statur wegen ein Aussenseiter. Aber auch in meinen Kammermusikwerken finden Sie die Gegenüberstellung von Einzelnem und Kollektiv, etwa im Klarinettenquintett und in den Instrumentalkonzerten… my: Auch in dem Stück Hinrichtung für sieben Vokalstimmen, das kürzlich beim Festival Eclat in Stuttgart uraufgeführt wurde. Cerha: Ein einzelner, dort ist es der Countertenor, gerät in Konflikt mit der Gesellschaft. Das ist ein Grundthema in meinem Schaffen, schon in den 60er Jahren, aber eigentlich immer. my: Es handelt sich in den Spiegeln und im Netzwerk auch um Reflexionen über gesellschaftliche Zustände. Cerha: Ich würde eher sagen: Assoziationen zu gesellschaftlichen Zuständen. Es ist mir erst viele Jahre später klar geworden, dass dahinter auch meine schrecklichen Kriegserlebnisse stehen. Damals war mir das gar nicht bewusst. Ich habe bereits als Siebenjähriger die Gräuel des österreichischen Bürgerkriegs erlebt und danach den halbfaschistischen Ständestaat. Im Krieg bin ich als Soldat zweimal desertiert und kam danach in dieses Wien, das damals wirklich verknöchert und konservativ war. Das hat mich geprägt, ich konnte mich nie als in der Gemeinschaft integriert fühlen; ich erlebte mich immer ihr gegenüber. my: Würden Sie das als politische Musik bezeichnen? Cerha: Nicht als parteipolitisch, aber natürlich ist jedes Kunstwerk, indem es etwas im Hörer bewegt, politisch. Es löst etwas aus. Kunst ist Hilfe. my: Ich denke da auch an Ihr radiophones Stück Und Du… von 1963… Cerha: Das ist mein einziges wirklich politisches Stück, entstanden in der Zeit des Kalten Kriegs und der atomaren Bedrohung. Mit dem Text von Günter Anders … my: „Ob wir das Ende der Zeiten bereits erreicht haben, das steht nicht fest. Fest dagegen steht, dass wir in der Zeit des Endes leben. Und zwar endgültig. In der Zeit des Endes bedeutet, in derjenigen Epoche, in der wir ihr Ende täglich hervorrufen können. Und endgültig bedeutet, dass, was immer uns an Zeit bleibt, Zeit des Endes bleibt, weil es von einer anderen Zeit nicht mehr abgelöst werden kann, sondern allein vom Ende.“ (G.Anders) Cerha: …damit ist eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Es bleibt aktuell und gültig. my: Der Außenseiter Baal ist ein radikaler Mensch, der zum Teil auch seine Umwelt zerstört, weil er seinen eigenen Weg zu gehen versucht. Cerha: Zwischen diesen Fronten der Selbstzerstörung oder der Zerstörung einer größeren Gemeinschaft und der Illusion, sich ein individuelles Paradies zu schaffen, also zwischen diesen Fronten spielt sich die Entwicklung des Baal ab. my: Mir kommt Baal wie ein männliches Gegenstück zur Lulu vor. Sehen Sie da auch eine Parallele? Cerha: Brecht hat ja die Lulu gekannt, und im Baal gibt es einige Szenen, die bewusst auf die Lulu anspielen. Er verwendet – „zitiert“ wäre schon zu viel gesagt – einige Sätze, die sich auf die Lulu beziehen, Wedekindsche Formulierungen auch, und ich habe an solchen Stellen damals ganz bewusst auf Formulierungen Bergs angespielt, was mir vielfach eingetragen hat, ich wäre durch die Arbeit am 3. Akt der Lulu Berg-abhängig geworden, was ja unsinnig ist. my: Gibt es denn für Sie keine Erfahrungen aus der Arbeit an der Lulu, die dann später in Ihrem eigenen weiteren Opernschaffen fruchtbar geworden sind? Cerha: Ich kann das schwer beurteilen, aber ich glaube eigentlich, dass die analytische Arbeit an Werken der Wiener Schule insgesamt für mich etwas ziemlich wichtiges war. Natürlich nimmt man diese Dinge auf; sie sind in einem drinnen und zählen einfach zur Persönlichkeit, sind sozusagen der Seele einverleibt, aber jetzt irgendein spezifisches Nahverhältnis ausgerechnet zur Sprache Bergs in der Lulu herzustellen, ist, glaube ich, doch zu viel. Etwas anderes spielt sicherlich noch eine Rolle: Zur Zeit, als sich der Weg der Klangflächenkomposition sozusagen als ausgeschritten erwiesen hatte, wurde es nicht nur von mir, sondern damals allgemein als eine Möglichkeit, als eine legitime auch vom historischen Standpunkt aus, angesehen, wieder einen Schritt zurück zu gehen, um wieder zu einer anderen Sicht der Zukunft zu kommen, zu einem anderen, wieder neuen gangbaren Weg in die Zukunft zu gelangen. Dieser Schritt zurück bringt natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Dingen, die man kennt, mit sich. Dies ist ein Symptom, das ja die verschiedensten Richtungen der heutigen Musik zeigen. my: Sie sprachen von Klangflächen. Im Baal, so scheint mir, arbeiteten Sie häufig mit ganz flexiblen Klangflächen, über die dann die Sätze auch grossenteils gesprochen werden. Cerha: Die Klangflächenstruktur ist im Baal für bestimmte Bereiche ganz bewusst als Stilmittel eingesetzt, das ist richtig. Ich will das nicht wieder selber interpretieren, aber man könnte sagen, sie steht für all das Irrationale im Baal, für das undurchdringlich Naturhafte, aber auch für das Erträumte, für das, was er für sich realisiert haben möchte, für seine Vorstellung, wie man leben sollte oder wie man leben können sollte, also für alle Wunschvorstellungen, für jenen Kreuzweg, der in ein Paradies führen sollte und niemals dorthin führt. Die Ballade von Evelyn Roe ist ein Bild für das Visionäre in ihm, in dem Melodik eine wesentliche Rolle spielt; es ist also keineswegs so, dass ein Großteil des Baal gesprochen ist. Die deklamatorischen Stellen sind nur eine der Möglichkeiten. Es gibt ja auch die festen Formen, die in den sinfonischen Baal-Gesängen zusammengefasst sind. my: Ein starker Kontrast ergibt sich in den Schlussszenen, aus dem Nebeneinander solcher Klangflächen und einer „trivialen Szenenmusik“. Cerha: Das ist eben der Gegensatz zwischen der visionären Welt des Baal und der Banalität der Realität, die ihn umgibt und gegen die er ja steht. my: Der Baal ist also für Sie, kann man sagen: ein Träumer, der an der Realität zerbricht? Cerha: Träumer würde ich nicht sagen, dazu steht er viel zu vital im Leben. Er ist ein Mensch, der meint, l e b e n zu müssen, der meint, für sich ein Leben nach seiner Vorstellung erwarten zu dürfen und verlangen zu können. Und der auf der Suche nach dem Land, „wo es besser zu leben ist“, scheitert, weil er sich auf diesem Weg isoliert. Das ist es, woran er zugrunde geht. my: Das war wohl auch der Grund, warum Sie zu diesem Stoff gegriffen haben. Cerha: Ich hab den Baal anfangs der 50er-Jahre kennen gelernt, und ich glaube, dieses Jahrzehnt war für viele der Generation, die noch ein wenig durch den Expressionismus durchgegangen sind, eine sehr schwierige Zeit. Man konnte eigentlich die Dinge, die man vorgestellt, die man visionär vor sich gehabt hat, nicht realisieren, weil der äussere Apparat nicht da war. Es war damals für mich kaum möglich, Orchesterwerke zur Aufführung zu bringen. Das war die eine Seite, die einen an den bestehenden Verhältnissen verzweifeln liess. Hinzu kam der Kalte Krieg, die Schwierigkeiten im Zusammenleben nicht nur des Einzelnen mit der Gesellschaft, sondern auch in der Konfrontation der gesellschaftlichen Systeme. Eigentlich war das Verzweifeln in dieser Situation etwas recht naheliegendes. Denken Sie an die vielen Fälle, wo Künstler selbst ihrem Leben ein Ende gesetzt haben, auch einige meiner Freunde. Es war das Gefühl des Isoliert-Seins, der Erkenntnis, die Verhältnisse nicht beeinflussen, ja eigentlich nichts ändern zu können, zugleich aber nicht in einer Welt leben zu können und zu wollen, in der man auf die damals vorgezeichnete Weise leben musste. Das war eine Situation, in der man eigentlich jeden Tag sozusagen mit der Möglichkeit des Selbstmords konfrontiert war, und das spiegelt sich sicherlich auch noch im Baal. my: Somit ist der Baal für Sie fast wie eine Summe vieler Erfahrungen, die sie bis dahin gemacht haben, musikalisch, aber auch existentiell? Cerha: Sicherlich, ja. my: Ich denke da auch an Thomas Bernhard. Cerha: Wir haben uns gut gekannt, vor allem Ende der 50er, Anfang der 60er-Jahre. Ich habe später noch das Requiem für Hollensteiner nach seinem Buch Gehen komponiert, in dem er radikal mit österreichischen Verhältnissen abrechnet. Da mag es, wenn auch nicht in den Kunstmitteln, sicherlich Berührungen geben. my: Das wäre eines Ihrer Stücke, in dem es konkret um österreichische Verhältnisse geht. Cerha: Ja. Dieses Requiem für Hollensteiner handelt vom Verhältnis des hochtalentierten, visionären Einzelmenschen zur österreichischen Staatsbürokratie, wobei es natürlich so ist, dass Sie die Verhältnisse, die hier als österreichisch bezeichnet werden, eigentlich in den meisten Staaten der sogenannten Ersten Welt wiederfinden können. Mit dem Wienerischen, einer sehr spezifischen Form des Österreichischen, habe ich mich in meinen beiden Keintaten aus den 80er Jahren auseinandergesetzt. Meine Beschäftigung mit außereuropäischer Musik hat mir damals bewusst gemacht, dass ich als Komponist die Wiener Volksmusik, die ich seit Kindesbeinen in mir herumtrage, als Komponist bisher völlig ignoriert hatte. Die Sprüche aus dem „Wiener Panoptikum“ und der „Wiener Grottenbahn“ meines Freundes Ernst Kein – der Titel meines Werks leitet sich von seinem Namen ab –, die mir damals zufällig wieder in die Hände fielen, haben mich animiert, wie er den Leuten im lutherischen Sinn zunächst „auf’s Maul zu schauen“ und die banalen bis grotesk- makabren Sprüche in entsprechenden musikalischen Modellen zunächst einmal anzunehmen, um sie dann durch Überdrehung zu pointieren und hinter sie zu leuchten. Dass im letzten Abschnitt der I. Keintate die Elemente immer mehr verfremdet werden, Auflösungstendenzen überhand nehmen und Delirium, Fatalismus und Tod dominieren – uralte Themen in der Volkskunst und in der Kunst aus Wien – macht das Stück in besonderem Mass zum Dokument einer wesentlichen Schicht in der Mentalität dieser Stadt, vielleicht auch des Ost-Österreichischen insgesamt. my: Sie haben sich mit afrikanischer und papuanischer Musik beschäftigt. Was interessiert Sie an diesen außereuropäischen Musiken? Cerha: Nicht das exotische Moment, wie es etwa Debussy an der fernöstlichen Musik fasziniert hat. Und auch nicht – das fällt ja von vorneherein weg – das Herstellen einer nationalen Identität, wie es in den nationalen Schulen des vorigen Jahrhunderts oder nach der Jahrhundertwende bis zu Bartók in den europäischen nationalen Schulen doch stark im Vordergrund stand. Sondern einfach die faszinierende Möglichkeit eines anderen musikalischen Bewusstseins, das nicht so vom geradlinigen Fortschreiten von Bach über die Klassik, Romantik zur Wiener Schule und in die Gegenwart diktiert wurde, das vielmehr noch irgendwo Wurzeln hat, die uns verloren gegangen sind oder eben nie als Möglichkeit musikalischen Denkens bewusst waren. Und es geht in der Arbeit natürlich nicht darum, dass man existierende musikalische Verhältnisse zitiert, sondern dass man Dinge, die man von der Struktur her vorfindet, mit der Fantasie eines Menschen von heute, mit den Erfahrungen, mit der Entwicklung eines Komponisten von heute, weiterspinnt. Das ist ein – zumindest für mich – interessanter und gangbarer Weg ist. my: Das ist sicherlich eine Spannung, in der Sie stecken. Mich würde interessieren, wie weit fühlen Sie sich als ein österreichischer oder ein Wiener Komponist? Cerha: Ich habe lange Zeit Wert darauf gelegt, mich als Weltbürger zu sehen, und habe auch gemeint, dass ich eine entsprechende Musik mache. Es hat eigentlich lange gedauert, bis ich draufgekommen bin, dass das ja nicht stimmt und dass es hier Wurzeln gibt, die ich nicht gesehen habe oder, wenn ich sie gesehen habe, möglicherweise nicht wahrhaben wollte, übrigens wie viele meiner Generation. Es war immer eines meiner Prinzipien, die Dinge, wenn ich merke, dass eine Art von Erscheinungen oder eine bestimmte Tendenz vorhanden ist, unter die Lupe zu nehmen und nicht unkontrolliert zu lassen. Auf diesem Weg bin ich sozusagen auch wieder zu meiner eigenen Vergangenheit gekommen. Ich bin ja – wie die meisten Wiener – ein Kind der Habsburger Monarchie, bin selbst auf den beiden Ufern der March aufgewachsen, auf dem österreichischen und auf dem slowakischen Ufer. Mein Großvater väterlicherseits ist noch in Budapest geboren, und von da geht’s bei meinen Vorfahren nach Siebenbürgen und in die Türkei – in Istanbul gibt es noch eine Moschee mit diesem Namen – und mütterlicherseits weiter nach Mähren, in die Slowakei und nach Galizien. Ein wesentlicher Anstoß zur musikalischen Beschäftigung mit dem östlichen Raum war eine reine Äußerlichkeit: eine Tante, die eine Zeit lang in Serbien, Ungarn, der Slowakei, Polen und Russland gelebt hat, hat mir Lieblingslieder aus ihrer Familie vorgesungen. Das war altes ungarisches, slowakisches Gut. Und da war eine Gesinnung, ein Rubato, ein Ausdruck da und hinter all dem irgendwo ein mir plötzlich ganz verwandter seelischer Bereich, von dem – vielleicht Janáček ausgenommen – in unserer sonstigen Musik nichts mehr vorhanden war. Das hat mich sehr berührt, und damit sind auch persönliche musikalische Erinnerungen aus meiner Kindheit wieder aufgetaucht. Das hat mich dahin gebracht, diesen Dingen intensiver nachzuhängen, sie unter die Lupe zu nehmen und sie sozusagen in meinen Vorstellungsbereich wieder einzugliedern. Und interessanterweise haben sich auch von dort her Beziehungen zu aussereuropäischer Musik ergeben. my: Könnten Sie ein Beispiel nennen, wo Sie dieses alte Liedgut wieder eingebracht haben? Cerha: Eingebracht ist schon zu viel gesagt; ich habe dieses Liedgut ja niemals wirklich zitiert, aber die papuanische Musik, wie die Musik mit den sieben Flöten vom Sepik in Neu-Guinea, spielt zum Beispiel im letzten Drittel meines Phantasiestücks eine Rolle, und sie ist von der slawischen Tradition gar nicht so weit entfernt. Aus der außereuropäischen Musik habe ich auch einiges an Oktav-Teilungen übernommen. Um 1990 sind zwei Streichquartette entstanden. Für das eine, das ich in Marokko geschrieben habe, habe ich einige Anregungen aus der arabischen Musik aufgegriffen. Das andere nimmt afrikanische und papuanische Elemente auf. Und beide arbeiten mit Vierteltonteilungen. Ich bin schon sehr früh in Wien mit der Musik Alois Hábas in Berührung gekommen, habe ihn auch noch gekannt und war zwar immer skeptisch im Hinblick auf die Realisationsschwierigkeiten solcher Konzepte, sah aber dann doch Möglichkeiten, sie so einzusetzen, dass sie auch wirklich bewusst spielbar und hörbar sind. Deshalb habe ich sie in diesen beiden Streichquartetten genutzt, und ich meine, dass sie im Ersten Streichquartett besonders gut realisierbar und wahrnehmbar sind. my: Könnten Sie mir vielleicht noch etwas zum Zweiten Streichquartett sagen. Cerha: Es ist als Auftrag des Streichquartettwettbewerbs von Evian entstanden, wo ich in der Jury und dieses Stück das Pflichtstück war. Es verwendet ebenfalls Vierteltöne und geht einen Schritt weiter in einer Tendenz, die ich nur schwer beschreiben kann und die ich für mich gelegentlich als polygestische Musik bezeichnet habe. Das bedeutet, dass es ist nicht nur ständig polymetrische Bildungen gibt, also Schichten übereinander von verschiedener Metrik, sondern dass der Typus von Bewegung, von musikalischer Bewegung, von musikalischer Gestik in den einzelnen Instrumenten verschieden ist. Das ist durchaus auch, so könnte man sagen, in einem polemischen Sinn gedacht, weil ich an vieler heutiger Musik finde, dass ihre Sprache nicht durch den aktiven Akzent eines Individuums zustande gekommen ist, sondern sich musikalische Sprachen vielfach als ein Derivat darstellen, als das, was übrig geblieben ist, wenn man bestimmte Dinge nicht tut, wenn man sozusagen alle Dinge herauskondensiert, die irgendwelche Konsequenzen haben, denen man aus dem Weg gehen möchte. Was dann übrig bleibt, ist natürlich etwas eher Puristisches, aber vielfach eigentlich etwas Armes. Und ich – das ist eine Art Credo von mir – meine, dass Kunst immer reich sein müsste, natürlich nicht im Sinn von Anhäufung von Material, sondern im Sinne von Vielfalt. Vielfalt macht es, wenn sie nicht völlig willkürlich sein soll, notwendig, dass die vielfältigen Elemente in eine Beziehung zueinander treten, das heisst, dass aus dieser Vielfalt wieder Einheit hergestellt wird. Einheit in der Vielfalt, also durchaus im Sinn des Hegelschen Absoluten. Das ist etwas, was mir zurzeit sehr wichtig scheint. my: Ist das etwas, was sich mit Ihrer Musik entwickelt hat, oder war es im Kern schon von Anfang an vorhanden? Cerha: So etwas kann man selber schwer beurteilen. Wenn ich die heutigen Kommentare zu Stücken, die ich vor 30 Jahren gemacht habe, lese, dann muss ich denken, dass das schon immer in mir drinnen war. my: Eine letzte Frage noch: Sie haben ein Sommerhaus in Maria Langegg… Cerha: Ich habe Ihnen von dieser engen Situation in den 50er Jahren in Österreich erzählt, die mich dazu geführt hat, dass ich den Nationalismus und auch das Wort „Heimat“ von mir gewiesen und mich als Weltbürger gefühlt habe. Damals bin ich als Dirigent rund um die Welt gekommen, war aber mit diesem hektisch-bewegten Leben unzufrieden. Und da bin ich ins Auto gestiegen, losgefahren, habe mich umgeschaut und habe in der Wachau, zwischen Krems und Melk, einen Ort gefunden, ein Haus am Wald. Dort ist auch ein Großteil meines bildnerischen Schaffens entstanden. Die Arbeiten füllen mittlerweile den Dachboden. my: Diese andere künstlerische Tätigkeit ist ja recht wenig bekannt. Sie arbeiten nicht nur kompositorisch, sondern malen auch und schaffen Skulpturen. Cerha: Es ist eine zweite Schiene, obwohl ich das eine gar nicht vom anderen trennen kann. my: In Ihren Langegger Nachtmusiken hört man zum Beispiel das Tuten der Schiffshörner. Cerha: Ja, die Schiffshörner hört man von der Donau her. Aber diese Umgebung weckt noch viel mehr in mir, eine Aufmerksamkeit auf alles, was uns permanent umgibt, visuell und klanglich.