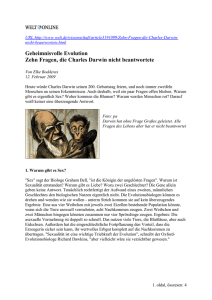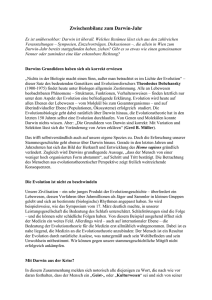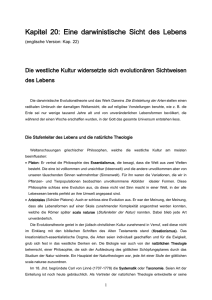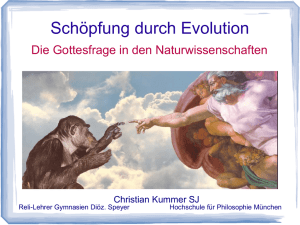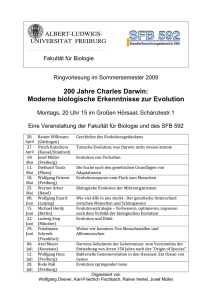Darwin SGZBB
Werbung
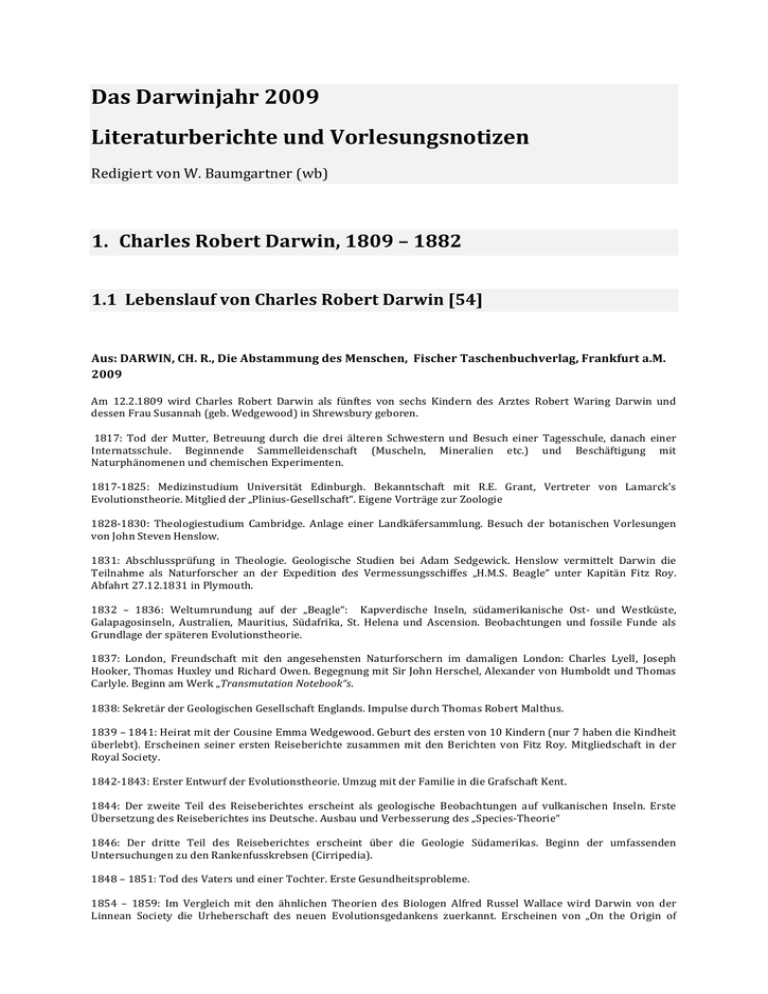
Das Darwinjahr 2009 Literaturberichte und Vorlesungsnotizen Redigiert von W. Baumgartner (wb) 1. Charles Robert Darwin, 1809 – 1882 1.1 Lebenslauf von Charles Robert Darwin [54] Aus: DARWIN, CH. R., Die Abstammung des Menschen, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt a.M. 2009 Am 12.2.1809 wird Charles Robert Darwin als fünftes von sechs Kindern des Arztes Robert Waring Darwin und dessen Frau Susannah (geb. Wedgewood) in Shrewsbury geboren. 1817: Tod der Mutter, Betreuung durch die drei älteren Schwestern und Besuch einer Tagesschule, danach einer Internatsschule. Beginnende Sammelleidenschaft (Muscheln, Mineralien etc.) und Beschäftigung mit Naturphänomenen und chemischen Experimenten. 1817-­‐1825: Medizinstudium Universität Edinburgh. Bekanntschaft mit R.E. Grant, Vertreter von Lamarck’s Evolutionstheorie. Mitglied der „Plinius-­‐Gesellschaft“. Eigene Vorträge zur Zoologie 1828-­‐1830: Theologiestudium Cambridge. Anlage einer Landkäfersammlung. Besuch der botanischen Vorlesungen von John Steven Henslow. 1831: Abschlussprüfung in Theologie. Geologische Studien bei Adam Sedgewick. Henslow vermittelt Darwin die Teilnahme als Naturforscher an der Expedition des Vermessungsschiffes „H.M.S. Beagle“ unter Kapitän Fitz Roy. Abfahrt 27.12.1831 in Plymouth. 1832 – 1836: Weltumrundung auf der „Beagle“: Kapverdische Inseln, südamerikanische Ost-­‐ und Westküste, Galapagosinseln, Australien, Mauritius, Südafrika, St. Helena und Ascension. Beobachtungen und fossile Funde als Grundlage der späteren Evolutionstheorie. 1837: London, Freundschaft mit den angesehensten Naturforschern im damaligen London: Charles Lyell, Joseph Hooker, Thomas Huxley und Richard Owen. Begegnung mit Sir John Herschel, Alexander von Humboldt und Thomas Carlyle. Beginn am Werk „Transmutation Notebook“s. 1838: Sekretär der Geologischen Gesellschaft Englands. Impulse durch Thomas Robert Malthus. 1839 – 1841: Heirat mit der Cousine Emma Wedgewood. Geburt des ersten von 10 Kindern (nur 7 haben die Kindheit überlebt). Erscheinen seiner ersten Reiseberichte zusammen mit den Berichten von Fitz Roy. Mitgliedschaft in der Royal Society. 1842-­‐1843: Erster Entwurf der Evolutionstheorie. Umzug mit der Familie in die Grafschaft Kent. 1844: Der zweite Teil des Reiseberichtes erscheint als geologische Beobachtungen auf vulkanischen Inseln. Erste Übersetzung des Reiseberichtes ins Deutsche. Ausbau und Verbesserung des „Species-­‐Theorie“ 1846: Der dritte Teil des Reiseberichtes erscheint über die Geologie Südamerikas. Beginn der umfassenden Untersuchungen zu den Rankenfusskrebsen (Cirripedia). 1848 – 1851: Tod des Vaters und einer Tochter. Erste Gesundheitsprobleme. 1854 – 1859: Im Vergleich mit den ähnlichen Theorien des Biologen Alfred Russel Wallace wird Darwin von der Linnean Society die Urheberschaft des neuen Evolutionsgedankens zuerkannt. Erscheinen von „On the Origin of Species by Means of Natural Selection: Or, The Preservation of Favoured races in the Struggle for Life“. Schon am Tag der Herausgabe ist die gesamte erste Auflage vergriffen. 1862 – 1881: Veröffentlichung weiterer Arbeiten zu Botanik, Zoologie und zur Abstammung des Menschen („The Descent of Man and Selection in Relation to Sex“ (1871). Auszeichnung durch die Copley-­‐Medaille der Royale Society, Mitgliedschaft in der Académie française. 19.4.1882: Tod und Beisetzung in der Westminster Abbey 1.2 Die Reise eines Naturforschers um die Welt Julia Voss, Insel Taschenbuchverlag, Frankfurt a.M. und Leipzig 2008 [68] Buchbesprechung, Phil. I Anton Cotti Vom 27. Dezember 1831 bis zum 2. Oktober 1836 nimmt der junge Darwin als naturwissenschaftlicher Begleiter an einer Forschungsreise rund um die Welt teil. Der erfahrene Kapitän, Robert Fitzroy, Vizeadmiral, Hydrograph und Meteorologe, ist beauftragt, die Vermessung des südamerikanischen Kontinents abzuschliessen. Der Kontinent gilt als Schatzkammer für Rohstoffe und als riesiger Markt für gewerbliche Produkte. Ziel des Projektes ist es, einen reibungslosen Handel mit Südamerika zu ermöglichen. Inseln und Küstenlinien sind deshalb neu zu kartographieren, bereits existierende Seekarten zu überprüfen und zu ergänzen. Auch chronometrische Messungen rund um die Erde sind erforderlich [57]. Die Regierung stellt das Segelschiff, die Beagle, zur Verfügung. Die Dauer ist mit zwei bis drei Jahren vorgesehen, es werden schliesslich fünf Jahre daraus. Die Route Die Reise führte von Devonport (Plymouth) zu den kanarischen Inseln, an Teneriffa vorbei zu den Kapverdischen Inseln an die Ostküste Brasiliens (Bahia). Anschliessend segelt die Beagle der Küste entlang südwärts zu den Falklandinseln und weiter um Feuerland und Patagonien herum, dem eigentlichen Ziel der Reise, der Westküste entlang nordwärts. Über die Magellanstrasse gelangt die Beagle in den Pazifischen Ozean, entlang der Chilenischen und Peruanischen Küste nach Valparaiso. Auf der Höhe von Lima fährt die Beagle zu den Galapagos-­‐Inseln. Schliesslich erreicht sie Tahiti. Über die Nordinsel Neuseelands gelangt die Expedition nach Sydney in Australien. Die weitere Fahrt führt über die Kokosinseln sowie nach Mauritius, an der Südspitze von Madagaskar vorbei nach Südafrika. Kapitän Robert Fitzroy kehrt jetzt noch einmal nach Brasilien zurück -­‐ er will einzelne Messwerte nochmals überprüfen -­‐, bevor er über die Azoren nach England zurückkehrt (aus Wikipedia). Darwins Motivation Neben dem Auftrag der Vermessung sollte ein Naturforscher die Gesteine, Pflanzen und Tiere der erwähnten Destinationen beobachten, sammeln und klassifizieren. Kultur und Lebensgewohnheiten der Völker sollen studiert werden. Man will genauen Aufschluss über die Natur des südamerikanischen Kontinents. Der Naturforscher wird auf eigene Rechnung zugelassen, somit ohne Besoldung und nicht uniformiert im Dienste ihrer Majestät. Er muss aus dem Landadel stammen und bereit sein, die Schiffskabine mit dem Kapitän zu teilen. Henslow, Professor für Botanik in Cambridge und wichtigste Bezugsperson von Darwin, empfiehlt den jungen Wissenschaftler als Begleiter bzw. Naturforscher für diese Weltreise. Mit grosser Begeisterung war Charles neben dem Theologiestudium in Cambridge den Vorlesungen von Henslow gefolgt. Er hatte dessen private Abendveranstaltungen für Studenten besucht und ihn auf vielen botanischen Exkursionen begleitet. Henslow und Darwin verbindet seit dieser Zeit eine Freundschaft, die das ganze Leben hält; Henslow wird Vorbild und ein wichtiger Helfer Darwins auch in späteren Jahren. Bei Professor Sedgwick studierte Darwin Geologie. Hier lernt er viel Methodisches, vor allem auch, dass man Theorien bilden muss, will man die gemachten Beobachtungen verstehen. Die wichtigste Arbeit während seiner Zeit in Cambridge gilt seiner Käfersammlung. Charles findet schon während dem Studium seltene und unentdeckte Arten. So zeigt sich neben der Liebe zur Natur die Fähigkeit der Konzentration auch auf kleine Gebiete wie etwa die Käfer. Obwohl der Vater aus ihm einen Arzt oder Pfarrer machen will, zeigt Charles mit seinen breiten Interessen schon früh einen unabhängigen Geist, was eine wesentliche Eigenschaft für den späteren Erfolg und seine Karriere sein wird. Nach Beendigung des Theologiestudiums blieb Darwin noch ein Jahr in Cambridge, wo er sein Wissen in Biologie und Geologie vertiefte. Wir können uns die Begeisterung des jungen Absolventen von Cambridge vorstellen, der nach Bedenken des Vaters dank der Fürsprache eines Onkels aus der Familie Wedgwood die Erlaubnis bekommt, die Weltreise anzutreten. Während seines Theologiestudiums hat sich Darwin sehr intensiv mit naturwissenschaftlichen Fragen befasst. Botanik, Zoologie und Geologie, damals junge Wissenschaften, faszinieren Darwin, der sich seit seiner Jugend mit der Natur befasst. Das Studium der Naturphilosophie – auch der Naturtheologie – und die Reiseberichte von Alexander von Humboldt wecken in Darwin ein waches Interesse für ferne Länder und die Erforschung der Natur. Das Theologiestudium, welches er zwar als zehntbester von 178 Kandidaten, aber ohne Begeisterung absolviert, lässt Raum für solche Interessen. Im Übrigen gehören Reiten, Schiessen, Jagen und Fischen zu seinen Leidenschaften. Charles ist ein ausgesprochen kräftiger, sportlich ausdauernder junger Mann von robuster Gesundheit. Die späteren Krankheiten sind vielleicht Spätfolgen der Weltreise. Arbeitsweise und Aufgabe Mit grosser Begeisterung stürzt sich Darwin in die Arbeit. Er nimmt seinen Auftrag sehr ernst. Der ehemalige Student der Medizin und Baccalaureus der Theologie ist nun als Naturforscher unterwegs. Seine Begeisterung überträgt sich auf die Stimmung der Mannschaft. Als Mensch ist Darwin stets freundlich gegen jedermann und immer gut gelaunt. Einzig die Seekrankheit plagt ihn und hindert ihn oft am Arbeiten. Den Beginn der Reise erlebt Darwin als besonders schwierig. Er freut sich auf die vorgesehenen Destinationen, die er von seiner vorbereitenden Lektüre und z.T. von den Reisebeschreibungen Humboldts mit grosser Spannung erwartet. Mehrmals ändert der Kapitän die Route. Die Hauptziele der Reise stimmen nicht in allen Teilen mit den Wünschen von Darwin überein. So segeln sie wegen hohen Seegangs an Madeira vorbei und auch die Insel Teneriffa können sie infolge einer Choleraepidemie – sie müssten eine Quarantäne von zwölf Tagen erdulden – nicht betreten. Darwin verfolgt seine Ziele mit Konsequenz und Energie. Um die Seetiere zu beobachten, befestigt Darwin ein Schleppnetz am Heck des Schiffes. Dieses bringt ihm reiche Beute an Seetieren, die er nach zoologischer Systematik ordnet [66]. Die oft mehrere Wochen dauernden Landgänge erlauben eine intensive Forschung. Mit strengster Konsequenz und unermüdlicher Energie widmet sich Darwin seiner Aufgabe. Er erlebt die Grösse der Natur mit ungeheurer Empfindungsstärke und versucht mit aller Kraft des Geistes, die seine Wahrnehmungen gedanklich zu ordnen und die Beobachtungen begrifflich zu durchdringen. So verliert er sich nicht in Schwärmerei. Darwin hat sich in Geologie, Botanik, Zoologie, als Paläontologe bzw. Fossilienforscher und Ethnologe zu bewähren. Die Menge der Funde und das gesammelte Material sind ungeheuer. Über 1500 in Spiritus konservierte Arten, fast 4000 Felle, Häute, Knochen und anderes mehr. Dazu kommen 15 Feldnotizbücher, 770 Seiten Tagebuch, 368 Seiten zoologische Aufzeichnungen, davon 200 über die wirbellosen Meerestiere und umfangreiche geologische Notizen. Die Beobachtungen über Tiere, Pflanzen, Gestein sind ergänzt durch die nicht minder wesentliche die umfangreiche Korrespondenz, die Darwin während der ganzen Dauer der Reise – und auch im späteren Leben als Privatgelehrter – mit unzähligen Gelehrten führt. Es sind nicht nur die bekannten Professoren-­‐Freunde aus Cambridge, praktisch die ganze wissenschaftliche Welt ist an den Beobachtungen und Entdeckungen dieser Weltreise interessiert und auf dem Korrespondenzwege einbezogen. Wichtige Freunde halten die Gelehrten in der Heimat auf dem Laufenden und sorgen damit für die Verbreitung seiner Forschungsergebnisse und die wissenschaftliche Diskussion der neuen Erkenntnisse. Reisetagebuch Das erfolgreiche Buch seiner Reise lässt sich im Einzelnen nicht wiedergeben. Es ist seit seinem ersten Erscheinen immer wieder aufgelegt worden. Empfehlenswert ist die Ausgabe des Insel Verlags von Julia Voss, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Darwin-­‐Spezialistin. Sie hat die bedeutendsten und schönsten Passagen des umfangreichen Reisetagebuches auf gut 250 Seiten und einem einführenden Kommentar ausgewählt und mit einem Überblick über Leben und Werk des grossen Naturforschers versehen. Die wesentlichen Eindrücke Drei wesentliche Eindrücke der Weltreise seien erwähnt: Zum einen ist es die Begegnung mit der Urbevölkerung, den sog. Wilden wie auch Landschaft und Bewohner Brasiliens und der Südspitze Amerikas. Brasilien erscheint ihm als Land, „wo die Kräfte des Lebens vorherrschend sind“. Diese Völker legen eine Lebensart an den Tag, die einem zivilisierten Engländer aus dem 19. Jahrhundert, der zudem aus dem Landadel stammt, völlig neu und fremd ist. Im Weiteren lösen die Fossilienfunde in Patagonien grosses Erstaunen aus. Sie sind ihm unumstösslicher Beweis, dass die zurzeit angetroffenen Arten wesentliche Veränderungen durchgemacht haben und die paläontologischen Spuren zeigen, dass sie erhebliche Veränderungen erlebten. Darwin erkennt den Artenwandel als Realität. Die Natur ist in ihrer Vielfalt also nicht durch immer wiederkehrende Schöpfungsakte nach Naturkatastrophen aus dem Nichts entstanden. Die Funde der Expeditionen bringen die Anschauung zu den Vermutungen und noch zaghaft geäusserten Thesen, die Darwin während des Studiums in Cambridge aufgenommen hat. Und schliesslich sind es die Beobachtungen auf den Galapagos-­‐Inseln. Die Beobachtungen der Vogelwelt machen klar, welch ungeheuer wesentlichen Anteil die geographische Isolation auf die Entstehung neuer Arten haben kann. In ihrer ganzen Bedeutung werden diese Phänomene erst später erkannt, was schliesslich zur Formulierung der Evolutionstheorie führen wird. Natürlich bringen die mehrwöchigen Landaufenthalte in Argentinien, Uruguay, während denen der Kapitän die Vermessungen durchführte, sowie die Erkundung der Anden und die vielen Aufenthalte auf den Inseln wichtiges Material für die spätere Begründung der Theorien. In seiner Autobiographie bezeichnet Darwin die Reise mit der Beagle als das wichtigste Ereignis seines Lebens. Der Wechsel vom Medizinstudenten und Theologen zum anerkannten und weltweit berühmten Naturforscher ist durch diese Reise begründet. Die intensive Suche nach Spuren, die grosse Menge der Funde, die Auswertung und Beurteilung zu Hause, zusammen mit vielen Wissenschaftlern, macht den Erfolg der Expedition möglich. Aus späterer Sicht kehrte Darwin als erfolgreichster Teilnehmer der Expedition nach England zurück. Die Auswertung seiner Forschungs-­‐und Sammelarbeit hat die Wissenschaft, die Ansichten der Menschen über ihre Herkunft und die Entstehung der Arten wie kaum eine andere Erkenntnis des 19. Jahrhunderts geprägt. Eine ablehnende Haltung bringt Darwin bezüglich der Sklavenhaltung mit, die sich für ihn in jeder Form als abscheulich und falsch erwiesen hat. Im letzten Kapitel seines Reisetagebuchs gibt er seinem Zorn darüber Ausdruck und dankt Gott dafür, dass er nie mehr in einem Sklavenland leben muss. Darwin, dessen Name mit dem Kampf ums Dasein assoziiert wird, erweist sich als grossherzig und mitfühlend sowie von ausgeprägtem Gerechtigkeitsempfinden. Er empört sich über Machtmissbrauch und jede Art der Unterdrückung von Menschen. Faszinierend ist festzustellen, wie Darwin in den Jahren der Weltreise ein Revolutionär der Wissenschaft wurde, wie aus Notizen ein Werk wird, aus flüchtigen und zunächst oft unverständlichen Beobachtungen eine Theorie. So wird aus dem naiven Glauben an einen Gott, der alles in sechs Tagen aus dem Nichts geschaffen habe, ein Zweifel. Im grossen Gedanken vom Wechselspiel der Variation und Selektion, nach dem sich alles Lebendige gebildet haben dürfte, setzt sich eine neue Erkenntnis allmählich durch. In aller Bescheidenheit dankt er am Schluss auch für alle Hilfe, vor allem Alexander von Humboldt, dem er viele Ideen und Eindrücke verdankt. Jedem Naturforscher gibt er als Fazit seiner Erfahrungen den Rat, sich selber in der Welt umzusehen, vor Schwierigkeiten und Gefahren nicht zurückzuschrecken, denn diese seien in der Regel geringer, als man zuvor befürchte. Auch würde einem eine Forschungsreise eine Reihe von Erfahrungen und Qualitäten bieten, die zu Hause nicht zu erwerben seien. Dazu gehören „gutmütige Geduld, Freiheit von Selbstsucht, die Gewohnheit, für sich selbst zu handeln und aus jedem Vorkommen das Beste zu machen.“ 1.3 Kommentare zu Charles Darwins Person Prof. Dr. Conradin Burga, [8] vom Geographischen Institut der Universität Zürich beschreibt in der Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 2009, Charles Darwin als von seiner Herkunft her sehr vermögend. Schon sein Grossvater sei ein reicher Arzt, Erfinder und Dichter gewesen und habe sich bereits mit Evolutionslehre beschäftigt. Auch sein Vater war ein reicher Arzt und Privatbankier. Darwin sei von zahlreichen einflussreichen Persönlichkeiten gefördert worden, u.a. vom „HMS Beagle“-­‐Kapitän Fitz Roy. Er habe eine langjährige freundschaftliche Beziehung mit dem berühmten Geologen Charles Lyell gepflegt und habe von Jena bis Java mit 2000 Personen korrespondiert. Seine Frau (und Cousine) kam aus dem wohlhabenden Haus Wedgewood und das alles habe Darwin die nötigen Freiheitsgrade gegeben, um nach dem Theologiestudium als Privatgelehrter die Natur zu beobachten, wozu er dann noch das nötige Talent zur späteren Weltberühmtheit mitbrachte Prof. Dr. Rolf Rutishauser, [35] vom Institut für Systematische Botanik der Universität Zürich zeigt in einer Publikation der NGZ 2009, dass Darwin auch botanische Entdeckungen machte, für die man ihn am 200. Geburtstag ebenso ehren sollte wie für seine Evolutionstheorie. Ohne Faktorengenetik erbrachte er den experimentellen Nachweis von Inzuchtdepression und Heterosis-­‐Effekt. Mit Experimenten an Graskeimlingen antizipierten Charles Darwin und sein Sohn Francis die Existenz von Phytohormonen. Sie hätten gezeigt, dass Pflanzen in ihren Lebensäusserungen wie z.B. Sinnesleistungen den Tieren nicht unähnlich seien. Darwin sei vor allem als Zoologe bekannt. Er schrieb aber alleine 7 Bücher über Botanik, gibt Rutishauser zu bedenken. Die Themen waren: Orchideen, Kletterpflanzen, Domestizierung von Tieren und Pflanzen, tierfangende Pflanzen, Fremd-­‐ und Selbstbestäubung, Blütenformen und Pflanzen in Bewegung. Er machte noch heute aktuelle Fütterungsexperimente mit dem fleischfressenden Sonnentau (Drosera), die später von seinem Sohn Francis fortgeführt wurden. Prof. Rutishauser wiederholte die Experimente, bei denen der Pflanze Milchtropfen verfüttert wurden, im Jahr 2009. Es konnte bestätigt werden, dass sich die Blätter von Drosera über dem Milchtropfen einrollen, ihn verdauen und sich nach einigen Tagen wieder öffnen. Weiter bestätigte Prof. Rutishauser Darwins Beobachtungen, dass sich einige Pflanzen wie etwa der Wassersalat (Pistia stratiotes) nachts in einer Art Schlaf befinden, wobei sich vor allem die jüngeren die Blätter tagesperiodisch aufrichten, schliessen und wieder öffnen. Prof. Dr. Andrew Hector, [13] Institute of Environmental Siences, Universität Zürich, erwähnt, dass die intellektuelle Verknüpfung von Biodiversität und Ökosystemprozessen erstmals durch Darwin mit seinem „Divergenzprinzip“ vollzogen worden sei. Er habe festgestellt, dass Gemeinschaften von Organismen, die sich aus vielfältigen und stark divergenten Formen entwickelt haben, höhere Produktivitäts-­‐ und Abbauraten aufweisen sollten. Den Beweis fand er in einem Gräsergarten im Süden von England. Prof. Dr. Heinz-­‐Ulrich Reyer und Heide Reyer-­‐Sievers, [34] zitierten zum Schluss der Ringvorlesung aus Briefen von Charles und Emma Darwin. Aus einem Brief an Alfred Russel Wallace: Die meisten Personen würden wohl in ihrer Lage etwas Neid und Eifersucht empfinden. Wie prächtig frei von diesem gemeinen Fehler der Menschheit scheinen Sie zu sein. Sie sprechen aber viel zu bescheiden von sich selbst. Sie würden, wenn Sie freie Zeit gehabt hätten, die Arbeit genauso gut, vielleicht noch besser gemacht haben, als ich sie gemacht habe. Aus einem Brief an Joseph Hooker: Endlich zeigt sich ein Lichtschimmer – Ich glaube, ich habe (welche Vermessenheit) das einfache Verfahren erkannt, mit dem Arten sich verschiedenen Zwecken hervorragend anpassen. Notizen von Charles zum Heiraten: Das ist die Frage: Heiraten – Nicht Heiraten: Heiraten: Kinder, ein beständiger Partner, der sich für einen interessiert, jemand, den man lieben und mit dem man spielen kann. Besser jedenfalls als ein Hund. Ein Heim, und jemand, der sich um das Haus kümmert. Annehmlichkeiten der Musik und weibliches Geplauder. Diese Dinge sind gut für die Gesundheit. Nicht Heiraten: Keine Kinder, niemand der im Alter für einen sorgt. Aber Freiheit zu gehen, wohin man will. Auswahl der Gesellschaft und wenig davon. Unterhaltung mit klugen Männern in Clubs. Kein Zwang, Verwandte zu besuchen und in jeder Kleinigkeit nachgeben zu müssen. Mein Gott, der Gedanke ist unerträglich, sein ganzes Leben wie eine geschlechtslose Biene mit Arbeit, Arbeit und nichts weiter zu verbringen. Nein nein, das geht nicht. Nur Mut. Heirate – heirate – heirate! Emma über Charles: Sein Charakter ist ausserordentlich verträglich. 1.4 Wissenschaftliches und historisches Umfeld 1.4.1 Aus: Charles Darwin, Die Entstehung der Arten. Reclams Universal-­‐
Bibliothek, Berlin, [53] Einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Ansichten von der Entstehung der Arten sowie über seine wichtigsten Kollegen und Freunde aus den Kreisen der Naturforscher gibt Darwin in der Einleitung zu seinem Hauptwerk im Jahr 1859 gleich selbst. Er beginnt mit dem oft zitierten Satz: Bis vor kurzem glaubte die grosse Mehrzahl der Naturforscher, die Arten seien unveränderlich und jede einzelne sei für sich erschaffen worden. Er führt diese alte Ansicht auf Aristoteles zurück, welcher immerhin als Ausnahme Empedokles mit dem Vorschlag des Zufalls bei der Beschaffenheit der Körperteile erwähnt hatte. Als ersten Verfechter einer allmählichen Entwicklung der Arten durch das Mittel der Abänderung und einer Abstammung von anderen Arten beschreibt Darwin seinen Zeitgenossen Lamarck mit einer Publikation von 1801: Das Mittel der Abänderung sucht er zum Teil im Einfluss der Lebensbedingungen, zum Teil in der Kreuzung bereits bestehender Formen und zum Teil im Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe, also der Macht der Gewohnheit. Noch frühere Ansätze zu einem „Wie“ der Merkmalveränderung ortete er 1794/95 bei Goethe in Deutschland, bei Etienne Geoffroy Saint-­‐Hilaire in Frankreich und bei seinem Grossvater Erasmus Darwin in England. 1818 postulierte C.G. Wells in London das Prinzip der natürlichen Selektion („Zuchtwahl“) für die Menschenrassen. 1822 erklärte W. Herbert in Manchester, dass Pflanzenarten nur eine höhere und beständigere Klasse von Varietäten sind. Saint Hilaire sprach dann 1828 öffentlich aus, dass sich die Formen nicht unverändert seit dem Anfang aller Dinge erhalten hätten. Darwin erwähnt dann noch eine grössere Zahl von Naturforschern und Geologen, u.a. Prof. Grant und seinen Freund R.G. Wallace, den Geologen Leopold v. Buch, den Zoologen C.E. von Baer und viele andere, die in der ersten Hälfte des 19. Jh. auf verschiedene Weise Erklärungen gefunden hatten, dass sich Varietäten allmählich in feste Arten oder sog. „bleibende Typen“ verwandeln, die keiner Zwischenkreuzung mehr fähig sind, und dass sie konstante und eigentümliche Merkmale erhalten. Er kritisiert aber, dass zahlreiche Gelehrte einen unwissenschaftlichen „Göttlichen Impuls“ postulierten, der den verschiedenen Lebensformen, oder einer „Urform“ anfangs oder von Zeit zu Zeit vermittelt worden sei. Darwin beschreibt dann, wie er 1837 von seiner 5-­‐jährigen Forschungsreise mit neuen Eindrücken von der Tier-­‐ und Pflanzenwelt Südamerikas zurück gekehrt sei, welche ihm Licht zu werfen schienen auf die Entstehung der Arten, das Geheimnis aller Geheimnisse. Aber erst 1859 habe er im Einvernehmen mit seinen Freunden Wallace und Hooker, welche die selben allgemeinen Schlüsse über die Entstehung der Arten bereits publiziert hatten, und durch die Vermittlung des Geologen Charles Lyell an die Linnean Society in London, seine Skizzen von 1844 zu einem grossen Werk zusammengefasst und veröffentlicht. 1.4.2 Aus: Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen (Originaltitel: The Descent of Man, 1871), [54] Darwin erwähnt den Präsidenten des Nationalinstituts von Genf, Karl Vogts, der im Jahr 1869 erklärte: Niemand, wenigstens in Europa, wagt mehr, die Erschaffung der Arten unabhängig voneinander zu verteidigen. Und im Jahr 1874 schrieb Darwins Kollege Thomas Huxley einen Aufsatz über die „Ähnlichkeiten und Unterschiede im Bau und in der Entwicklung des Gehirns beim Menschen und bei den Affen“. Darin heisst es: Jede Hauptwindung und Hauptfurche eines Schimpansengehirnes ist deutlich auch im menschlichen vorhanden, so dass die für das eine angewandte Terminologie auf das andere übertragen werden kann. 1.4.3 Aus: Vom Milch trinkenden Sonnentau (Drosera spec.) zum schlafenden Wassersalat (Pistia spec.): Charles Darwin als Botaniker. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 2009 Prof. Dr. R. Rutishauser, 2009, [35] Prof. Dr. Rolf Rutishauser, Institut für systematische Botanik der Universität Zürich, zitiert Darwins Vorwort zur sechsten Auflage seines Hauptwerks folgendermassen: Bereits der englische Pflanzenzüchter Patrick Matthew habe in einer Publikation von 1831 dieselbe Ansicht vom Ursprung der Arten entwickelt wie R.G. Wallace und er selbst. Matthew habe aber seine Theorie unglücklicherweise in zerstreuten Sätzen im Anhang zu einem Werk mit anderem Inhalt geschrieben, so dass sie völlig unbeachtet blieb. Er habe aber deutlich die volle Bedeutung des Begriffs der natürlichen Zuchtwahl erkannt. Rutishauser weist dann noch darauf hin, dass Darwin zusätzlich zur natürlichen und künstlichen Selektion die Wichtigkeit der sexuellen Selektion erkannt habe, bei der z.B. die Weibchen entscheiden, welche Männchen ihr Erbgut an die Nachkommen weitergeben. 1.4.4 Aus:, Massenaussterben und Evolution. H. Furrer et al, Paläontologisches Institut und Museum und Zoologisches Museum der Universität Zürich, 2009, [11] Prof. Dr. Hugo Bucher, Direktor des obgenannten Instituts und Museums, liefert weitere Angaben zu den Zeitgenossen Darwins und ihren Theorien: Bekannt ist heute noch Georges Cuvier (1768-­‐1832) als Begründer der vergleichenden Anatomie und Wirbeltierpaläontologie. In seinem Hauptwerk beschrieb er die geologischen Formationen des Pariser Beckens, wovon jede eine unterschiedliche Fauna enthält. Er schloss daraus, dass diese Faunen jeweils durch gigantische Umweltkatastrophen ausgelöscht worden seien und postulierte damit die Theorie des „Katastrophismus“. Er schätzte das Alter der Erde auf mehrere Millionen Jahre. Zwischen den Katastrophenereignissen seien die Arten unverändert geblieben. Diese Theorie wurde unterstützt von William Buckland in England und Louis Agassiz in Neuchâtel. 1860 definierte John Philips die drei grossen geologischen Zeitalter Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum aufgrund der von Cuvier entdeckten biotischen Haupteinbrüche. Im Gegensatz zum „Katastrophismus“ wurde der „Aktualismus“ begründet von Buffon (1707-­‐1788), Lamarck (1744-­‐1829) und Hutton (1726-­‐1797). Er besagt, das Ausmass der Faunenveränderungen und der geologischen Prozesse sei eine Folge der Unermesslichkeit der Zeit. Auch Darwins Freund, der Geologe Charles Lyell (1797-­‐1875) verwarf den Katastrophismus und argumentierte in seinem Hauptwerk „Principles of Geology“, dass sich alle in der Vergangenheit wirkenden Prozesse nicht von den heutigen unterscheiden. Darwin sah in Anlehnung an Lyell in den Aussterbe-­‐Ereignissen Lücken in den stratigraphischen Daten. Die Theorie des „Punktualismus“ von Eldredge und Gould entstand aber erst ab 1970 und postulierte das plötzliche Entstehen neuer Arten. Anhand von hohen Iridium-­‐Konzentrationen in Kreide-­‐Paläogen-­‐
Grenzschichten wurde überdies die Theorie von Asteroiden Einschlägen aufgestellt, womit eine Renaissance des Katastrophismus eingeläutet wurde. 1.4.5 Aus „Darwins langer Arm – Evolutionstheorie heute“, H.-­‐U. Reyer und P. Schmid-­‐
Hempel, 2010, [33] „Mitte 1858 bekam Darwin einen Artikel von Alfred Russel Wallace (1823-­‐1913) zugeschickt, bei dessen Lektüre er mit Schrecken feststellte, dass es sich im Prinzip um eine Kurzfassung seiner eigenen Evolutionstheorie handelte. Wallace war seit vielen Jahren als Naturforscher und Sammler in Südostasien unterwegs, hatte zwar mit Darwin hin und wieder korrespondiert, ihn aber nie getroffen. Und er hat mit Sicherheit die Grundzüge der Evolutionstheorie völlig unabhängig von Darwin entwickelt. Das Umdenken lag also in der Luft; der Nährboden für die Evolutionstheorie war vorhanden“. 1.5 « On the Origin of Species by Means of Natural Selection », Charles Darwin, 1859 Die Entstehung der Arten. Reclams Universal-­‐Bibliothek, Berlin 1963, [52] Buchbesprechung, wb Die Ringvorlesungen haben Darwin’s Hauptwerk nicht resümiert, sondern als bekannt vorausgesetzt. Leider sprechen heute aber viele Leute über Darwin, ohne auch nur eines seiner Werke je gelesen zu haben. Nach Hans Küng [63] haben heute Millionen von Amerikanern und offensichtlich auch Europäern anscheinend weder im Biologieunterricht noch in einem Buch je eine seriöse Darstellung der Evolutionstheorie zu Gesicht bekommen. Ich versuche deshalb nachfolgend „Die Entstehung der Arten“ anhand der deutschen Übersetzung von Reclam zu beschreiben. Ich betone, dass dies ein Versuch ist. Die riesige Vielfalt von Darwins Beobachtungen, Feld-­‐ und Laborversuchen, Argumenten und Schlüssen, die zahllosen Fakten, die aus seiner Korrespondenz mit anderen Forschern der ganzen Welt zu ihm gelangt waren, die Repliken auf kritische Einwände und schliesslich das kohärente Gesamtkonzept der Evolutionslehre selbst, all das in leserfreundlicher Kürze zusammenzufassen, ist letztlich ein aussichtsloses Unterfangen. Das Buch ist in 15 Kapitel gegliedert, welche Darwin’s Beobachtungen der Varietäten unter den Individuen, Arten und Gattungen, die Theorie der Auslese (Selektion) der passendsten Varietäten durch die Umwelt, den Menschen, andere Lebewesen und das andere Geschlecht, die daraus folgende langsame Abänderung und Neuentstehung von domestizierten und natürlichen Phänotypen, die Probleme der Geologie und Fossilienfunde zu seiner Zeit, die Einwände gegen seine Theorie, die geographische Verbreitung und gegenseitige Verwandtschaft der Arten, das angeborene Verhalten und die gemeinsame Abstammung der Lebewesen behandeln. Obwohl Darwins Sprache von einer durchaus modernen nüchternen Logik durchdrungen ist, weist sie zwangsläufig einen Viktorianischen Stil auf, welcher in der deutschen Reclam-­‐Übersetzung übernommen wurde. Um dem Original möglichst treu zu bleiben verwende ich dieselben Ausdrücke in meiner Zusammenfassung. Im ersten Kapitel behandelt Darwin die ABÄNDERUNG IM ZUSTANDE DER DOMESTIKATION und beginnt mit der Beobachtung, dass Individuen von domestizierten Pflanzen-­‐ oder Tierarten bzw. Unterarten stärker variieren als solche von Arten im Naturzustand. Er stellt dies in Zusammenhang damit, dass domestizierte Arten veränderlicheren Lebensverhältnissen, nämlich den Wünschen des Menschen ausgesetzt sind und stellt fest, das domestizierte Arten noch nie aufgehört hätten, sich zu verändern. Offenbar beruhe dies auf der Beschaffenheit der Organismen einerseits und auf der Natur der Lebensverhältnisse anderseits. Die Auswirkungen auf die Nachkommen seien entweder bestimmt, etwa die Dicke der Haut in verändertem Klima, oder unbestimmt als kaum erkennbare kleine Abweichungen. Weiter hat er Veränderungen des Fortpflanzungssystems beobachtet, welches offenbar sehr empfindlich auf kleinste Änderungen der Lebensbedingungen reagiere. So hören viele Tiere in Gefangenschaft auf, sich fortzupflanzen, was aber bei domestizierten Tieren nicht der Fall ist. Die Änderungen von Gewohnheiten, etwa des Klimas oder der Ernährung, bringen vererbliche Wirkungen hervor, stellte er an zahlreichen Beispielen fest. Diese Veränderungen seien oft korrelativ, z.B. dass längere Beine etwa mit einem längeren Kopf korreliert und dass der Organismus als Ganzes vom elterlichen Typus abweichend sei. Darwin betont aber, dass ihm die Gesetze, denen die Vererbung unterliegt, grösstenteils unbekannt seien. Auch dass gewisse Veränderungen oft nur auf ein Geschlecht und oft nur zu bestimmten Zeiten der Embryonalentwicklung übertragen werden, müsse ein wichtiger Punkt zukünftiger Forschung sein. Er stellt aber fest, dass gezüchtete Rassen genauso voneinander abweichen wie Arten und Gattungen im Naturzustand. Es sei denn auch kein Unterschied zwischen einer gezüchteten Rasse und einer naturbelassenen Art ersichtlich. Einen grossen Raum widmet Darwin in diesem Kapitel nun der Frage, ob die domestizierten Pflanzen-­‐ und Tierarten durch Kreuzungen von mehreren wilden Typen abstammen, oder ob sie durch gezielte Zucht wie auch durch unbewusste Domestikation je von einem einzigen Wildtyp herkämen. Anhand von Beobachtungen der Hunderassen und der grossen Anzahl von gezüchteten Haustauben kommt er zum Schluss, dass sich diese grosse Anzahl von Varietäten stets aus je einer einzigen wilden Art heraus entwickelt hätte. Als wichtiges Argument führt er an, dass Abkömmlinge bestimmt verschiedener Tierarten kaum je fortpflanzungsfähig seien, was bei Kreuzungen unter verschiedenen Rassen nicht der Fall sei. Er führt auch zahlreiche Beispiele an, wie einzelne Merkmale nach vielen Generationen als sog. „Rückschlag“ wieder auftauchen können, was bei einem Ursprung aus verschiedenen Arten eher unwahrscheinlich wäre. Im zweiten Kapitel ABÄNDERUNG IM NATURZUSTAND zeigt Darwin anhand einer riesigen Zahl von Beispielen, dass auch die Arten im Naturzustand sich in dauernder Veränderung befinden, dass sie nicht eine statische Konstanz aufweisen, sondern ein dynamisches Kontinuum. Er relativiert gleich anfangs die Begriffe Art, Unterart, Gattung, Varietät, Variation, Monstrosität und individuelle Unterschiede. Schon „Art“ und “Gattung“ haben bei den Naturforschern höchst verschiedene Deutungen, je nach den Kriterien, die gewählt werden. Unter „Varietät“ versteht er Verschiedenheit bei gemeinsamer Abstammung, auch wenn diese selten nachweisbar sei. Als „Monstrosität“ bezeichnet er beachtliche anatomische Abweichungen, die für das Individuum meist schädlich sind. Veränderungen, die direkt auf die äusseren Lebensbedingungen zurückgehen, aber nicht vererblich sind, nennt er „Variation“. „Individuelle Unterschiede“ seien kleine Unterschiede bei Nachkommen derselben Eltern oder Bewohnern einer begrenzten Örtlichkeit. Dass sog. Übergangsformen zwischen Arten und Gattungen kaum je von Arten selbst oder von Varietäten unterschieden werden können, weist er anhand zahlreicher Beobachtungen im Pflanzen-­‐ und Tierreich nach. Oft hänge die Unterscheidung nur davon ab, welche Form von den Forschern zuerst beschrieben worden sei. Die Bezeichnung Art werde so zu einem schwankenden Begriff, hinter dem man sich früher offenbar einen Schöpfungsakt vorgestellt habe. Arten mit grosser geografischer Verbreitung und solche grösserer Gattungen variieren nach Darwins Beobachtungen am meisten. Den Grund sieht er darin, dass sie verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt seien und mit anderen Gruppen organischer Wesen in Wettbewerb treten müssen. Solche weit verbreitete Arten bezeichnet er auch als „herrschende“ Arten. Aber nicht alle grossen Gattungen variieren stark und nicht alle kleinen Gruppen seien unvariabel. Damit will Darwin beweisen, dass auch dort wo viele Arten einer Gattung gebildet wurden, immer noch viele in Bildung begriffen seien. Die grossen Gattungen würden sich daher stets langsam in kleinere auflösen. So würden alle Lebensformen der Erde in Gruppen und Untergruppen geteilt. Das dritte Kapitel trägt den Namen DER KAMPF UMS DASEIN Dieser Begriff ist im 19. / 20. Jahrhundert leider politisch und normativ missdeutet und missbraucht worden. Die Bedeutung, welche Darwin selbst darin sah, muss deshalb genauer betrachtet werden. Darwin erklärt, dass die in Kapitel II erarbeiteten Kenntnisse der Varietäten und Verschiedenheiten in den Arten zu verstehen helfen, wie neue Arten und Gruppen von Arten, also Gattungen entstehen: Der Kampf ums Dasein unter diesen Varietäten sei dafür die Ursache. Die kleinsten Veränderungen, welche für ein Individuum von Vorteil und nützlich sind und sich wieder vererben, erhöhen die Aussicht, am Leben zu bleiben, sich zu vermehren und eine neue Art zu bilden. Dies nennt er „natürliche Zuchtwahl“ und er setzt sie in Beziehung zur „künstlichen Zuchtwahl“ durch den Menschen. Der Ausdruck „Überleben des Tüchtigsten“ (survival oft he fittest) stamme vom zeitgenössischen Philosophen Herbert Spencer. Darwin betont aber wörtlich, dass er den Begriff „Kampf uns Dasein“ in einem weiten metaphorischen Sinne gebrauche, welcher die Abhängigkeit der Wesen voneinander und die Fähigkeit des Individuums, Nachkommen zu hinterlassen, mit einschliesst. Natürlich könne damit etwa der Kampf zweier Raubtiere gegen einander gemeint sein, aber auch der Kampf einer Pflanze am Rande der Wüste mit der Dürre. Oder die Mistel, deren Samen von Vögeln gefressen und so verbreitet werden, „kämpft“ mit anderen fruchttragenden Pflanzen darum, die Vögel dazu zu verleiten, lieber ihre Samen zu fressen und zu verbreiten. Das heisst aber nur, dass diejenigen Varietäten überleben, welche am besten zur Situation der Umwelt und der anderen Lebewesen passen. Der Ausdruck „Kampf ums Dasein“ sei also nicht sehr treffend und werde nur der Bequemlichkeit halber von ihm verwendet. Die Begründung zu diesem Kampf sieht er darin, dass die Geometrie der Fortpflanzung allen Wesen eine sehr schnelle Vermehrung erlauben würde. Dieser werde aber zwangsläufig eingeschränkt durch die Vermehrung anderer Lebewesen und die äusseren Lebensbedingungen sowie die Endlichkeit der Ressourcen. Schon Darwins Lehrer Malthus habe postuliert, dass auch erfolgreiche Arten immer wieder vernichtet würden. Eine Verminderung der zerstörenden Einflüsse müsste dem gegenüber eine unbegrenzte Vermehrung einer Art zur Folge haben. Die Ursachen, die das natürliche Streben einer jeden Art, nach Vermehrung beschränken, seien aber völlig unbekannt. Hingegen würden gesellige Lebewesen auch unter ungünstigen Verhältnissen beisammen leben und damit überleben. Die guten Wirkungen der Kreuzung und die schlechten der Inzucht spielten ebenfalls eine Rolle. Schlussendlich seien aber die Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebewesen in hoch komplexer Art verwickelt, und kleine Änderungen in den äusseren Lebensbedingungen oder die Einführung einer fremden Art in einen Lebensraum könne das Aussterben einzelner Arten und die Verbreitung anderer Arten zur Folge haben. Allmählich würde sich aber ein Gleichgewicht einstellen, so dass die Natur sich während längerer Zeit nicht verändert. Es sei aber unsinnig, Gesetze über die Dauer von Lebensformen aufstellen zu wollen, da die einzelnen Ursachen zur Störung eines Gleichgewichts nicht eruiert werden könnten. Hingegen könne man ableiten, dass der Körperbau jedes Lebewesens in engster, aber oft verborgener Beziehung zu dem anderer Lebewesen stehe, mit welchem es in Konkurrenz um Nahrung oder Wohnung stehe. Zudem sei der Kampf ums Dasein zwischen Individuen und Varietäten der gleichen Art am heftigsten, weil die Unterschiede zwischen ihnen am geringsten seien. Im vierten Kapitel NATÜRLICHE ZUCHTWAHL ODER ÜBERLEBEN DES TÜCHTIGSTEN lässt Darwin nun die bisher erarbeiteten Prinzipien zur kohärenten Evolutionslehre zusammenfliessen. Er beginnt mit der entscheidenden Feststellung, dass das Prinzip der Zuchtwahl so wie in der Hand des Menschen auch in der Natur wirke. Die Varietäten seien ja nicht vom Menschen verursacht. Der Mensch kann sie nur dort, wo sie vorkommen durch Zucht erhalten und häufen. Dasselbe mache auch die Natur durch Erhaltung vorteilhafter Abänderungen im Überleben und Fortpflanzen des Passendsten. Abänderungen, welche nachteilig sind für das Individuum, führen dagegen zum Aussterben. Abänderungen, die weder vorteilhaft noch schädlich sind, unterliegen der natürlichen Zuchtwahl nicht. Auch hier unterstellt Darwin der Natur aber nicht einen bewussten Willen zur Auslese, so wie ihn der Mensch hat. Der Ausdruck „Zuchtwahl“ sei vielmehr eine Umschreibung eines ziellosen Naturgesetzes. Darwin versteht unter dem Wort „Natur“ die vereinigte Wirkung und Leistung vieler Naturgesetze, und unter „Gesetzen“ die nachgewiesene Aufeinanderfolge der Ereignisse. Sowohl bei der künstlichen wie bei der natürlichen Zuchtwahl wächst durch Änderung der Lebensverhältnisse die Neigung zu Variabilität. Für die natürliche Zuchtwahl steht aber unendlich viel mehr Zeit zur Verfügung und sie wirkt nicht nur auf einzelne ausgewählte Merkmale eines Lebewesens, sondern auf den ganzen Organismus. Die Natur kennt aber noch eine weitere Form der Zuchtwahl, welche bestimmt wird vom Kampf darum, vom anderen Geschlecht zur Fortpflanzung ausgewählt zu werden. Dies nennt Darwin die geschlechtliche Zuchtwahl. Das Ergebnis des erfolglosen Mitbewerbers ist eine verminderte oder fehlende Nachkommenschaft. Bei den erfolgreichen Bewerbern entwickeln sich dagegen besonders attraktive Merkmale wie etwa die Mähne des Löwen, die hakenförmige Kinnlade beim Lachs, die Lockgesänge der Vögel und die verschiedenen Farben und Grössen ihres Gefieders. Solche Merkmale können im Lauf der Zeit zwar auch auf das andere Geschlecht vererbt werden, erhalten sich jedoch oft als markante geschlechtliche Unterschiede. Einen wesentlichen Faktor zur Steigerung der Fruchtbarkeit und zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit sieht Darwin in der Kreuzung zwischen Individuen und Varietäten derselben Art. Sowohl eigene Versuche wie die Berichte von Tier-­‐ und Pflanzenzüchtern bestärken ihn in der Annahme, dass sich idealerweise zwei Individuen regelmässig zum Zweck der Fortpflanzung vereinigen sollten, und dass eine enge Inzucht die Fruchtbarkeit und Lebenskraft vermindert. Bei einer Kreuzung verschiedener Arten, sei der Erfolg aber umgekehrt. Weitaus die Mehrzahl der Pflanzen sind allerdings Hermaphroditen, bei denen die Paarung nicht notwendig ist. Trotzdem sei aber die gelegentliche Kreuzung möglich und offenbar unerlässlich. Die Verbreitung der Pollen durch den Wind und durch Insekten ermögliche diese, obwohl in der Blüte Staubfäden und Stempel so nahe beisammenstehen, dass die Selbstbefruchtung als Hauptzweck erscheine. Im Tierreich existieren keine reine Hermaphroditen und keine Geschlechtsorgane, die so eingeschlossen wären, dass sie keinen Kontakt mit anderen Individuen haben könnten. In den Cirripedien sah Darwin lange eine rätselhafte Ausnahme, was aber durch eine zufällige Beobachtung einer Kreuzung entkräftet werden konnte. Darwin beschreibt nun günstige und ungünstige Umstände für die Entstehung neuer Formen. Günstig seien eine lange Zeitdauer, wenn auch nicht unbedingt notwendig, dann eine grosse Zahl von Individuen und ein grosses Verbreitungsgebiet mit zahlreichen anderen Arten und Gattungen. Der sog. Rückschlag, das Wiedererscheinen bereits verlorengegangener Merkmale, wirke dagegen leicht stabilisierend auf die Arterhaltung und damit hemmend für neue Formen. Die Kreuzung wirke zuerst zwar ebenfalls stabilisierend, durch Entstehung einer grösseren Anzahl Individuen schliesslich aber doch wieder fördernd. Grosse Bedeutung misst Darwin der Isolierung bei, also der Trennung von Varietäten durch geografische, klimatische oder physikalische Schranken. Dadurch können Varietäten zu Arten werden, neu variieren und zahlreiche Stellen in der Natur neu besetzen. Anhand zahlreicher Beispiele von Inseln (etwa Galapagos) untermauert er diese Sicht, hält aber fest, dass eine Isolierung für die Entstehung neuer Arten nicht wirklich notwendig sei, sondern dass die Grösse des Verbreitungsgebietes eine wichtigere Rolle spiele. Umgekehrt weist er auf lebendige Fossilien hin, Meeresbewohner, die in kleiner Zahl ein begrenztes Gebiet bewohnen und ohne Konkurrenten seit langer Zeit unverändert geblieben seien. Das Aussterben von Arten lasse sich dadurch erklären, dass in einem mit Arten vollbesetzten Gebiet die begünstigten Formen und Varietäten zunehmen, die minder begünstigten jedoch seltener werden und verschwinden. Davon seien gerade die am nächsten verwandten Formen am meisten betroffen. Eine Neuentdeckung von Darwin war das Prinzip der Divergenz, des Phänomens nämlich, dass die geringen Unterschiede zwischen Varietäten zu grossen Unterschieden zwischen Arten heranwachsen. Dies geschieht einerseits in der künstlichen Zuchtwahl, weil die Züchter die kleinen Unterschiede durch bewusste Auswahl fördern, bis etwa eine gewünschte Nutzpflanze ihren Vorstellungen entspricht. In der natürlichen Zuchtwahl verläuft es dadurch, dass, je mehr die Abkömmlinge einer Art voneinander abweichen, sie desto zahlreichere verschiedene Stellen im Haushalt der Natur einzunehmen und sich damit an Zahl vermehren können. Dies hat Darwin selbst bei Feldversuchen mit Gräsern bewiesen: Ein Feld, das mit mehreren Gräsern verschiedener Gattungen besät wurde, gab einen höheren Gewichtsertrag an Heu, als wenn nur eine Gräserart ausgesät wurde. Auch die Bauern wenden dieses Prinzip als Fruchtfolge an. Dasselbe geschieht beim Einbürgern ausländischer Pflanzen: Es resultiert schlussendlich eine grössere Zahl von Arten insgesamt. Bei Säugetieren zeigt sich das gleiche Prinzip als Differenzierung der Organe zur physiologischen Arbeitsteilung: Je zahlreicher die Säugetierarten sind, umso variationsreicher und vollkommener wird ihre Differenzierung. Die Kombination des Divergenzprinzips mit dem Prinzips des Aussterbens schlecht angepasster Arten und der natürlichen Zuchtwahl führt nun dazu, dass aus stark variierenden Arten grosser Gattungen immer mehr neue Arten mit zunehmenden Unterschieden in den günstigen Merkmalen und mit zunehmender Anpassung an die Umwelt und zunehmender Differenzierung entstehen. Das erklärt die zunehmende Vervollkommnung und Spezialisierung der miteinander konkurrierenden Lebewesen, genauso wie den gleichzeitigen Erhalt von einfachen aber gut angepassten Arten kleiner Gattungen mit wenigen Variationen in besonderen Nischen der Natur. Wären die Arten unabänderlich und separat erschaffen worden, wäre dies alles nicht möglich. Im fünften Kapitel erklärt Darwin, dass seine Unkenntnis der GESETZE DER ABÄNDERUNGEN gross sei, dass sich aber bei allen Vergleichen dieselben Gesetze oder Ursachen zeigten. Als solche kann er nun aufzählen: -­‐
-­‐
veränderte Lebensbedingungen führen zu dauerhaften Veränderungen Gebrauch von Teilen oder Organen führen zu einer Verstärkung und Vergrösserung, Nichtgebrauch zu einer Verkümmerung oder zum Verschwinden von Organen Homologe Teile variieren in gleicher Weise, was als korrelative Veränderung bezeichnet wird Rudimentäre, zwecklose oder unspezialisierte Teile bleiben leichter veränderlich als spezialisierte Artmerkmale sind veränderlicher als Gattungsmerkmale Sekundäre Geschlechtsmerkmale sind stark veränderlich, meist zusammen mit Artunterschieden Ähnliche Einflüsse bringen bei ähnlichen Arten analoge Veränderungen hervor Ausserordentliche Organe können nach langer Zeit langsam einen festen Charakter erhalten. Rückschlag zu Eigentümlichkeiten der Vorfahren kann gelegentlich zu Modifikationen und Mannigfaltigkeit führen -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Darwin meint, eine Ursache für all das müsse es geben, und das könne nur die stete Anhäufung von nützlichen Unterschieden sein, welche alle Modifikationen des Körperbaus in den Beziehungen zu den Lebensgewohnheiten entstehen lasse. Im sechsten Kaptiel zählt Darwin die SCHWIERIGKEITEN DER THEORIE auf, die ihm oft ernste Zweifel verursacht hätten. Er unterscheidet die folgenden vier Probleme: 1.
Wenn die Arten aus unmerklichen Übergängen entstanden sind, sollte man überall Übergangsformen finden. Die Natur müsste ein wirres Durcheinander von Formen sein, anstatt wohlabgegrenzte Arten zu zeigen. 2.
3.
4.
Kann man glauben, dass die natürliche Zuchtwahl nur durch ziellose Modifikationen so wunderbare Organe wie ein Auge oder die speziellen Lebensgewohnheiten und den Körperbau einer Fledermaus hervorbringt. Können auch Instinkte durch natürliche Zuchtwahl erworben und abgeändert werden, so wie die Biene Brutzellen baut, welche die Entdeckungen von Mathematikern vorwegnehmen. Warum sind Arten, die sich kreuzen, unfruchtbar, oder warum erzeugen sie unfruchtbare Nachkommen, während bei Varietäten die Fruchtbarkeit unvermindert bleibt. Er beantwortet diese Fragen folgendermassen: 1.
2.
Die Arten neigen dazu, sich mit kleinen Abänderungen langsam optimal an die Lebensbedingungen anzupassen und erhalten dadurch eine gewisse Stabilität, die auch als „Einheit des Typus“ bezeichnet wird. Sie verbreiten sich erfolgreich in einem abgegrenzten Gebiet. Varietäten die nicht eine deutliche Verbesserung bringen, was selten ist, sterben schnell wieder aus oder werden durch Konkurrenz wieder verdrängt. An anderen Orten können erfolgreiche Varietäten wieder zu einer neuen, umschriebenen Art und Typus evoluieren, wobei aber die Übergangsformen gleich wieder aussterben, weil sie von den jeweils erfolgreicheren Nachkommen wieder verdrängt werden. Die Übergangsformen müssten also generell bedeutend seltener sein als die erfolgreichen Arten. Dazu kommt noch die Lückenhaftigkeit der geologischen Überlieferungen, welche in einem separaten Kapitel abgehandelt wird. Es spricht nichts dagegen, dass durch die Häufung der Wirkungen der natürlichen Zuchtwahl spezielle Formen entstehen können. Darwin zeigt dies anhand der Familie der Eichhörnchen, wo durch die Änderungen in der Umwelt, der Nahrungsquellen und der natürlichen Feinde alle Abstufungen bis zum Flughörnchen entstanden sind. Ebenso zeigt er mit Übergangsformen, wie aus der Schwimmblase der Fische die Lungen der Säugetiere entstehen konnten, wie also dasselbe Organ eine andere Funktion bekam. Auch das menschliche Auge kann aus unendlich vielen Zwischenformen erklärt werden. Anfänglich konnten einzelne lichtempfindliche Zellen nur zwischen hell und dunkel unterscheiden. Aus ihnen entstanden Sehnerven, welche von Pigmentzellen umgeben und von einer durchscheinenden Haut bedeckt waren. Sobald dieser Hautfleck die Form einer Linse annimmt, kann bei adäquater Distanz zum Sehnerv ein Bild entstehen. Bei den Insekten bilden zahlreiche Facetten der Hornhaut wahre Linsen eines zusammengesetzten Auges. Bei Wirbeltieren handelt es sich um ein einfaches Auge, eine pigmentierte Einstülpung der Haut mit einem Sehnerven. Beim Menschen sei noch aus Epidermiszellen die Kristalllinse und aus embryonalen Unterhautgeweben der Glaskörper entstanden. Immerhin werden auch einzelne Beispiele angeführt, wo (noch) keine Ursprungsformen bekannt seien, etwa die elektrischen Organe der Fische, die Leuchtorgane der Insekten oder geschlechtslose Insekten. Generell sieht Darwin aber doch eine Übereinstimmung mit allen damaligen Naturforschern, dass die Natur sehr viele Veränderlichkeiten zeige, aber selten wirkliche Neuerungen. Der Satz „Natura non facit saltum“ drückt dies aus. Hingegen verneint Darwin die Behauptung, die organischen Wesen seien dem Menschen zur Freude erschaffen worden. Er verweist darauf, dass die Blüten ihre Farbe einzig für den Besuch der Insekten erhalten hätten, und dass schon fossile Lebewesen eine grosse Schönheit zeigten, obwohl diese Tiere Jahrmillionen vor dem Erscheinen des Menschen gelebt hätten. Der Begriff der Schönheit gehe offenbar vom Menschen selbst aus ohne Rücksicht auf die wirklichen Eigenschaften der bewunderten Wesen. Er betont an dieser Stelle nochmals, dass die natürliche Zuchtwahl nicht zu einer Vollkommenheit von Arten oder Individuen führe. Vielmehr würde das Gesetz der Existenzbedingungen infolge der Erblichkeit früherer Abänderungen und Anpassungen eine Einheit des Typus hervorbringen. Zu den Fragen 3 und 4 hat Darwin speziell die Kapitel Acht und Neun geschrieben. Im siebten Kapitel EINWÄNDE GEGEN DIE NATÜRLICHE ZUCHTWAHL führt er zuerst noch einige konkrete Argumente anderer Forscher gegen seine Theorie zur Erwiderung an. Viele Biologen und Zoologen seiner Zeit konnten sich nicht vorstellen, dass die hochspezialisierten Organe der Tiere und Pflanzen durch langsame Abänderungen aus anderen Organen anderer oder ähnlicher Arten entstehen konnten. Darwin versucht, diese Möglichkeiten aufzuzeigen, ohne dass er dies natürlich beweisen kann. Er beschliesst seine Erwiderungen mit den folgenden Sätzen: Wer der Meinung ist, dass irgend eine alte Form sich plötzlich durch eine geheimnisvolle Kraft oder Neigung verändert habe, z.B. plötzlich Flügel bekam, der ist fast zu der Annahme gezwungen, dass viele Individuen im Widerspruch zu aller Analogie gleichzeitig variierten; es kann nicht geleugnet werden, dass derartige jähe und grosse Veränderungen des Körperbaus ganz anderer Art sind als jene, denen die meisten Arten offenbar unterlagen. Er wird ferner annehmen müssen, dass viele Organe, die allen anderen Teilen desselben Geschöpfes sowie den umgebenden Bedingungen vortrefflich angepasst sind, plötzlich auftraten, aber er wird für solch ein kompliziertes, und wunderbares Zusammenpassen auch nicht den Schatten einer Erklärung beibringen können. Er wird schliesslich auch zugeben müssen, dass diese grossen und plötzlichen Umformungen keinerlei Spuren am Embryo zurückliessen. All das zusammengenommen heisst aber, wie mich dünkt, in den Bereich des Wunders eintreten und die Wissenschaft verlassen. Im Achten Kapitel INSTINKT zeigt Darwin anhand zahlreicher Beispiele aus den Reichen der Insekten und der Vögel, dass Verhaltensweisen und geistige Fähigkeiten von Lebewesen genauso wie anatomische Merkmale variieren und durch natürliche Zuchtwahl, Anhäufung von Verbesserungen und durch Gebrauch oder Nichtgebrauch langsam Veränderungen und Entwicklungen erfahren haben. Eine Vollkommenheit werde aber wie beim Körperbau nicht erreicht. Zum Ursprung von geistigen Fähigkeiten will er sich aber ebenso wenig äussern wie zum Ursprung des Lebens selbst. Als Instinkt definiert er Handlungen, die Individuen oder Gruppen ohne Erfahrung ausführen und ohne dass sie deren Zweck kennen. Ein klein wenig Urteilskraft oder Verstand sei aber selbst bei niederen Tieren immer im Spiel. Vom Instinkt unterscheidet er Gewohnheiten als Handlungen, die in einem bestimmten Lebensabschnitt oder Körperzustand erworben und dann beibehalten, aber wiederum durch den Verstand modifiziert werden können. Da Gewohnheiten offenbar erblich werden können wie Instinkte, sei ihre Unterscheidung aber oft schwierig. Ein gutes Beispiel dafür sei die Scheu der Tiere vor den Menschen, die in Gegenden, wo der Mensch noch nie hingekommen sei, nicht existiere. Bei domestizierten Tieren, etwa beim Hund, stellte Darwin hingegen fest, dass natürliche Instinkte verlorengingen, jedoch durch die Einwirkung des Menschen, also durch Gewohnheit neue Instinkte erworben und erblich, aber weniger stark fixiert wurden als die natürlichen. Dass die Instinkte durch natürliche Zuchtwahl und Gewohnheit tatsächlich abgeändert werden, zeigt er nun anhand des Kuckucks, der seine Eier in fremde Nester legt, dann der Ameisen, die sich Sklaven halten und schliesslich anhand des Zellbauvermögens der Honigbiene. Der Kuckuck legt die Eier in Abständen von 2-­‐3 Tagen und ist ein frühzeitig aufbrechender Zugvogel. Die Gewohnheit, einzelne Eier in ein fremdes Nest zu legen, kann dem Überleben und der Aufzucht der Jungen dienlich sein. Auf den verschiedenen Kontinenten wird das vom Kuckuck aber verschieden ausgeübt. So legt er in Amerika die Eier in ein selbst gebautes Nest worin Eier und Junge zusammen sind. In Europa und Australien legt er einzelne oder mehrere Eier in ein fremdes Nest mit Eiern derselben Farbe und die Eier sind von verschiedener Grösse. Die geschlüpften Jungtiere werfen in Europa die Pflegegeschwister aus dem Nest, was sie offenbar mit denselben Bewegungen vollbringen, wie sie für das Aufknacken der Eischale nötig sind. Auch bei anderen Vögeln hat Darwin dieses Brutschmarotzertum festgestellt, welches sich auf verschiedenste Weise besonders dann zeigt wenn die Eier in Abständen von einigen Tagen gelegt werden. Eine grosse Anzahl von Abstufungen und Formen hat Darwin auch beim Sklaven-­‐Instinkt der Ameisen festgestellt. Dieses Verhalten müsse damit begonnen haben, dass grössere Ameisen die Puppen kleinerer Ameisen nicht nur als Futter benutzten, sondern sie in ihrem Nest aufzogen und als Arbeitssklaven einsetzten, was dem Gedeihen ihrer Nester offenbar dienlicher war. Die Kooperation dieser Sklaven habe sich bei verschiedenen Ameisenarten äussert verschieden entwickelt in Bezug auf die Arbeiten im Nest selbst, Verteidigung und Bewachung, die Suche nach Futter und Baustoffen, die Pflege der Blattläuse und das Füttern der Herren. Einige Herrenameisen seien sogar richtig abhängig geworden von ihren Sklaven und könnten sich ohne sie nicht mehr ernähren. Beim Umzug eines Nestes können sowohl die Herren als auch die Sklaven bestimmend sein und einander auf ihren Kiefern tragen. Bei der Suche nach lebenden Sklaven wenden sklavenmachende Ameisen jedoch rücksichtslose Gewalt an gegen kleine Ameisen, die sich zu verteidigen suchen. Alle diese graduellen Unterschiede kann sich Darwin nur durch die Wirkung der natürlichen Zuchtwahl erklären. Dasselbe postuliert er auch für den Zellenbauinstinkt der Honigbienen, welcher die Bewunderung des Menschen findet. Mathematiker meinen, dass die Bienen ein schwieriges Problem lösten, um die grösstmögliche Menge Honig bei möglichst geringem Verbrauch von Wachs bergen zu können. Sie konstruieren ihre Waben sogar bei Dunkelheit mit grosser Präzision. Anhand von Vergleichen zwischen den Instinkten verschiedener Insekten weist Darwin nach, dass die Honigbienen ihre Bauweise nicht plötzlich selbst mittels Überlegungen erfunden hatten, sondern dass diese sich in langsamen Abstufungen adaptiv entwickelt haben muss. Die Abstände der einzelnen Bienen und die Geschicklichkeit beim Wabenbau sind durch natürliche Zuchtwahl im Sinne einer unbewussten Optimierung von Aufwand und Nutzen schrittwiese entstanden. Das Sammeln der nötigen Menge von flüssigem Nektar zur Wachsabsonderung sei für die Bienen äusserst anstrengend und der Honigvorrat sei für ihr Überleben im Winter entscheidend. Die Ersparnis an Wachs und Zeit für den Wabenbau muss also im Sinne der natürlichen Zuchtwahl gewirkt haben. Die Wabe der Honigbiene Melipona stelle das mathematische Optimum dar, welches hervorgebracht werden könne. Diese Beispiele zeigen, dass die natürliche Zuchtwahl nicht nur auf Individuen, sondern auch auf Familien oder Populationen und deren Kooperation wirkt. Darwin unterstreicht dies noch mit dem Phänomen der geschlechtslosen und unfruchtbaren Individuen bei Insekten. Sie stellen Beispiele dar von erhöhtem Grad von Organisation und Arbeitsteilung innerhalb einer Gemeinschaft. Gleichzeitige Änderungen des Körperbaus und des Instinkts in Korrelation mit Unfruchtbarkeit gewisser Mitglieder der Gemeinschaft muss sich als vorteilhaft herausgestellt haben. Bei Instinkt und Körperbau dieser sterilen Individuen fand Darwin eine unendliche Vielfalt entsprechend den Lebensbedingungen der Populationen. Im neunten Kapitel BASTARDBILDUNG widmet sich Darwin dem Problem der Kreuzung, sowohl zwischen Arten, was zu „Bastarden“ führt, wie auch zwischen Varietäten, was zu „Blendlingen“ führt. Zu Darwins Zeiten meinten viele Forscher, die Unfruchtbarkeit gekreuzter Arten und ihrer Bastarde diene dem Zweck, eine Verwirrung der organischen Formen zu verhindern. Diesem Zweckdenken setzte Darwin ohne molekularbiologische Kenntnisse die Theorie einer zufälligen Folge von Unterschieden im Fortpflanzungssystem gegenüber. Bei Bastarden fand er nämlich meist leistungsunfähige Zeugungsorgane. Da gekreuzte Arten meist unfruchtbar seien, gekreuzte Varietäten hingegen meist sehr fruchtbar, sah er daraus zwar eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Varietäten und Arten. Diese Feststellung relativiert er aber gleich wieder, nachdem er zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel gefunden hatte, entweder in eigenen Beobachtungen oder in Werken seiner Kollegen. Die Unfruchtbarkeit werde zudem durch Inzucht ebenso verursacht wie durch Kreuzung und sei aus diesem Grunde bei künstlich befruchteten Bastarden weniger ausgeprägt als bei spontaner Befruchtung. Er führt als Beispiel die Blumenzüchter an, welche zahlreiche Kreuzungen von Arten mit grosser Fruchtbarkeit hervorbrächten. Im Tierreich fand er nur wenige gut untersuchte Beispiele, hingegen zahlreiche Belege, dass die Unfruchtbarkeit von gekreuzten Arten durch Zucht und Pflege, also günstige Lebensbedingungen, behoben werden könne. Sowohl im Tier-­‐ wie im Pflanzenreich stuft sich der Fruchtbarkeitsgrad von Kreuzungen, Bastarden und Blendlingen von Null bis zur Vollkommenheit ab. Bastarde von schwer kreuzbaren Arten seien aber meist unfruchtbar. Arten verschiedener Familien brächten überhaupt keine Bastarde hervor, während nah verwandte Arten sich leichter paaren. Aber auch davon gibt es zahlreiche Ausnahmen. Darwin folgert aus alldem, dass diese Eigenheiten der Kreuzungen unmöglich den Zweck haben können, die Vermischung von Arten zu verhindern, sondern rein zufälliger, oder noch unbekannter Natur seien. Dieselben Unregelmässigkeiten fand er parallel dazu auch beim aufeinander Pfropfen verschiedener Pflanzen. Ebenso unvorhersagbar und unterschiedlich sei die Fruchtbarkeit von Tieren in der Gefangenschaft oder in Domestikation. Immerhin glaubt er feststellen zu können, dass geringe Veränderungen in der Lebenswelt der Fruchtbarkeit und der Lebenskraft förderlich seien, während dem grosse Veränderungen eher schädlich seien. Er kommt aber zum Schluss, dass Fruchtbarkeit keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen gekreuzten Varietäten und Arten darstellt, wenn auch die Variabilität späterer Generationen von Blendlingen deutlich höher sei als diejenige von Bastarden. Die Unfruchtbarkeit der ersten Kreuzungen und Bastarde könne aber nicht durch natürliche Zuchtwahl entstanden sein, sondern durch Störungen in der Fortpflanzungsorganisation durch Verschmelzung verschiedener Formen. Dies alles scheint nach seiner Überzeugung der Ansicht nicht zu widersprechen, dass Arten ursprüngliche Varietäten seien. Zehntes Kapitel: DIE LÜCKENHAFTIGKEIT DER GEOLOGISCHEN URKUNDEN Darwin interessierte die Frage, ob mit Fossilienfunden ein Beweis für oder gegen seine Evolutionstheorie erbracht werden könnte. Seine Kritiker hielten ihm entgegen, dass die Fossilienfunde keine Beweise für die Übergänge von Arten zu neuen Arten liefern würden. Die Entstehungsmechanismen von Fossilien in Sedimenten waren Darwin bekannt aus dem Werk seines Kollegen Charles Lyell „The Principles of Geology“. Dieser hatte beschrieben, wie durch Hebung und Senkung der Landmassen und Meeresböden sowie durch abwechselnde Abtragung (Denudation, Erosion, Wind, Regen, Wellenschlag etc.) von Material und dessen Ablagerungen zu Sedimenten die Erdoberfläche in riesigen Zeiträumen verändert und meilendicke, fossilführende Sedimentschichten entstanden waren. Darwin postulierte, dass bei Senkungen des Meeresbodens der Druck der Sedimente steigt und somit viele Fossilien entstehen, dafür aber viele Arten sterben, dass bei dessen Hebung dagegen der Druck abfällt und deswegen weniger Fossilien versteinert werden, dafür viele neue Arten entstehen können. Darwin argumentiert, dass nur relative wenige Lebewesen überhaupt zu versteinerten Fossilien werden können und dass diese Funde aus den oben genannten Gründen sehr lückenhaft seien, auch weil die Zeiträume zwischen den geologischen Formationen, die eben stets wieder durch Erosion abgetragen wurden, viele Millionen Jahre umfassten. Zudem seinen die Zeiträume, in denen Arten sich fest verbreiteten viel grösser gewesen als die Zeiträume der Meeresbodensenkungen. Ferner wies er darauf hin, dass es bei Fossilien noch schwieriger sei, einigermassen konstante Arten von Übergangsformen und Varietäten zu unterscheiden oder gar noch festzustellen, welche Formen aus welchen anderen Arten hervorgegangen seien. Ausgestorbene Formen seien kaum je direkte Zwischenglieder noch lebender Formen. Immerhin sei aber die scheinbar grosse Lücke zwischen Schwein und Kamel durch Fossilien ausgefüllt worden, das fossile Hipparion sei ein Bindeglied zwischen dem heutigen Pferd und älteren Huftieren, mit dem tertiären Zeuglodon sein ein Bindeglied zwischen den Walen und im Wasser lebenden Fleischfressern gefunden worden, und selbst die grosse Kluft zwischen Vöglen und Reptilien sei mit dem Fund des Archaeopteryx unerwartet überbrückt worden. Zu Darwins Zeit waren allerdings nur wenige Gesteinsschichten in Europa und Nordamerika überhaupt untersucht, was nur einem winzigen Teil der Erde entsprach. Aber aus der Natur der organischen Reste in den Formationen Europas und Nordamerikas spekulierte er, dass diese Kontinente in früheren Zeiten als trockene Länderstrecken bestanden haben könnten. Schlussendlich schrieb er, dass in den verschiedenen aufeinanderfolgenden Formationen all die Lebensformen vergraben seien, die uns den irrtümlichen Eindruck vermitteln, sie seien plötzlich erschienen. Die Schwierigkeiten, anhand von Fossilien die Evolutionstheorie zu beweisen, würden mit diesen Erkenntnissen mit der Zeit verschwinden. Auch im zwölften und dreizehnten Kapitel, die beide die GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG der Arten zum Thema haben, versucht Darwin zu zeigen, dass eine unabhängige Schöpfung einzelner Arten an verschiedenen Punkten der Erde und zu verschiedenen Zeiten ausgeschlossen werden kann und dass die vorliegende Verbreitung der Tier-­‐ und Pflanzenarten nur durch Evolution, also durch die gemeinsame Abstammung mit Modifikationen erklärbar ist. Er verweist auf die grossen Unterschiede von Flora und Fauna von Amerika, Europa, Afrika und Australien. Innerhalb der Kontinente seien sich die Arten ähnlicher, weil offenbar die Wanderung leichter sei als von Kontinent zu Kontinent. Auch in den grossen Ozeanen fänden sich drei Meeresfaunen, die sich in parallelen Linien von Norden nach Süden ausdehnten. Die Ähnlichkeit von Lebewesen beruht auf dem Gesetz der Vererbung. Der Grad der Unähnlichkeit wird bestimmt durch die Weite der Wanderungen von einem Gebiet in ein anderes, die geographischen Schranken, die klimatischen Unterschiede, den Grad der Veränderungen und die Zeitpunkte der Abwanderungen. Da Darwin davon ausging, dass alle Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung haben, müssten also Transport und Wanderung über alle Kontinente hinweg möglich gewesen sein. Für Pflanzen und Samen ist die Überwindung grosser Distanzen im und übers Meer ohne weiteres möglich, wie Darwin z. T. auch experimentell beweisen konnte. Auch die Vögel hätten offenbar keimfähige Samen über grosse Ozeane transportiert. Für Landtiere bilden die Meere grössere Hindernisse. Die Inseln vor den Küsten könnten zwar nachweislich von ihnen besiedelt werden. Für die Überwindung grosser Ozeane führt Darwin aber andere Theorien ins Feld. Durch die Hebung und Senkung von Landmassen seien zu verschiedenen geologischen Zeiten Landbrücken entstanden und wieder untergegangen. Einzelne Landmassen könnten auch in früheren Zeiten miteinander verbunden gewesen sein. Sein Zeitgenosse Edward Forbes behauptete, Amerika hätte noch in neuerer Zeit mit Europa und den Atlantischen Inseln zusammengehangen (die Theorie der Plattentektonik von A. Wegener war ihm allerdings noch nicht bekannt). Dies wurde von Darwin aber als unbeweisbar eher verworfen, obwohl er die Idee seiner Theorie als ausserordentlich dienlich und mit seinen Beobachtungen vereinbar hielt. Hingegen richtete er seine Aufmerksamkeit vor allem auf die Klimaschwankungen der Erde und auf die von der Exzentrizität der Erdbahn verursachten Eiszeiten. Er stellte sich vor, dass in Wärmeperioden die nördliche Erdhalbkugel in den arktischen Regionen eisfrei und trocken und damit der Wanderung von Tieren zugänglich gewesen sei. In den Eiszeiten hingegen hätte sich die an die Kälte angepasste Flora und Fauna ebenfalls über eine ganze Halbkugel verbreiten und nach der Wiedererwärmung in den kälteren Höhen der Berge erhalten können. Zu den Eiszeiten auf der Nordhalbkugel sei zudem die Temperatur in der Südhalbkugel höher gewesen und umgekehrt, was die Fauna immer wieder zu ausgedehnten Nord – Süd – Wanderung veranlasst habe. Dieselben Gründe vermutet er auch für die weltweite Verbreitung der Meerestiere. Die genauen Wanderwege liessen sich aber in keinem Fall nachweisen. Ganz besonders hätten sich die Süsswassertiere und Pflanzen über die ganze Erde verbreitet, obwohl Seen und Flüsse eigentlich abgegrenzte geographische Gebilde seien. Wiederum vermutet Darwin, dass frühere Wärmeperioden etwa in der Antarktis die Wanderung von einem Kontinent zum andern ermöglicht hätten. Aber auch innerhalb der Kontinente sei die Süsswasserfauna erstaunlich wanderungsfähig, z.B. weil sie auch eine Zeitlang einer Küste entlang im Salzwasser leben könnte, oder weil der Laich auch ausserhalb des Wassers lange überlebensfähig sei. Die Samen von Süsswasserpflanzen würden oft durch Vögel und Fische über grosse Distanzen transportiert und seien in den Exkrementen dieser Tiere noch immer keimfähig. Generell seien gerade tief organisierte Pflanzen am weitesten verbreitungsfähig. Besondere, nur durch die Evolution erklärbare Gesetze beschreibt Darwin für die Flora und Fauna von ozeanischen Inseln. Alle Inseln zeigten in ihrem Charakter die Beziehungen zu derjenigen Gegend, aus der am leichtesten Einwanderer zuströmen können, sowie deren spätere Modifikationen. Je weiter Inseln von einem Festland entfernt seien, desto zahlreichere endemische Arten fänden sich darauf. Die Landsäugetiere, die solche Meeresdistanzen nicht überwinden können, fehlten aber, soweit sie nicht von Kolonisten eingebracht worden seien. In dieser Beobachtung war er auf den Galapagos Inseln besonders gut bestätigt worden, wobei viele Tiere, wie etwa die Spottdrosseln, auf einzelne Inseln sehr gut angepasst und nicht vermischt waren. Die Galapagos Inseln sind durch breite Meeresarme getrennt, in denen starke Winde und Strömungen herrschten. Wären die Tier-­‐ und Pflanzenarten unabhängig voneinander einzeln erschaffen worden, wären alle diese Tatsachen so nicht möglich. Das vierzehnte Kapitel nennt sich GEGENSEITIGE VERWANDTSCHAFT DER LEBEWESEN, MORPHOLOGIE, EMBRYOLOGIE, RUDIMENTÄRE ORGANE Im Prinzip geht es Darwin in diesem Kapitel darum zu zeigen, wie nach seiner Theorie die weit verzweigten Verwandtschaftslinien der Tier-­‐ und Pflanzenwelt, die gemeinsame Abstammung verwandter Formen, ihre Abänderung durch Variationen und natürliche Zuchtwahl, die Möglichkeit des Aussterbens und die Divergenz der Charaktere auf die Klassifikation der Lebewesen in einem natürlichen, genealogischen System von Varietäten, Arten, Gattung, Familie, Ordnung, und Klasse einen entscheidenden Einfluss haben müssen. Nur unter der Voraussetzung der Abstammung mit Modifikationen würden die Haupttatsachen der Morphologie verständlich, etwa ein gemeinsamer Grundplan innerhalb einer Klasse oder die Homologie der beiden Körperhälften oder der beiden Geschlechter oder die Abnahme der Ähnlichkeiten mit der Zeit. In der natürlichen genealogischen Klassifikation werden die Bedeutung embryonaler Merkmale oder rudimentärer Organe verständlich. Darwin würdigt in diesem Zusammenhang denn auch die Erfindung der Phylogenie, der Abstammungslinien aller organischen Wesen durch Ernst Haeckel, welche sich hauptsächlich auf embryologische Merkmale stützt. Der Wert hingegen, den die Forscher auf konstante und vorherrschende Merkmale legen oder auf den Unterschied zwischen analogen und Anpassungsmerkmalen könne für die Klassifizierung äusserst verschieden sein. Am Beispiel des Walfisches zeigt Darwin, wie die Anpassungsmerkmale der Flossen oder der Lebensweise im Wasser nicht ausreichten, um das Tier zu den Fischen zu zählen, während dem die Fortpflanzungsorgane die Verwandtschaft mit den Säugetieren zeigen. Auch die Sprachen des Menschen, meinte Darwin, könnten mit ihren Dialekten in ein genealogisches System entsprechend einem Stammbaum der Menschen klassifiziert werden. Im letzten fünfzehnten Kapitel ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS wiederholt Darwin nochmals die wichtigsten Argumente, welche seine „Theorie der Abstammung mit Modifikationen durch Anhäufung unzähliger geringer Abänderungen, deren jede dem betreffenden Individuum nützlich war, und durch natürliche Zuchtwahl“ unterstützen und die Einwände der Gegner entkräften. Es sind alle jene Argumente, Beobachtungen und Schlüsse, die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeitet worden waren. Er betont nochmals, dass die Variabilität, die Veränderlichkeit, nie aufhört und bei domestizierten Lebewesen besonders gross ist. Sie sei aber nicht vom Menschen hervorgerufen, sondern durch verwickelte Gesetze, wie korrelatives Wachstum, Gebrauch oder Nichtgebrauch der Teile und Einfluss der umgebenden Bedingungen. Der Mensch wählt lediglich die ihm passenden Variationen aus und häuft sie bei der Zucht an. Dasselbe macht auch die Natur, nur viel langsamer, mittels der natürlichen Zuchtwahl, welche auf dem „Kampf ums Dasein“, einem Wettbewerb der grösseren Zahl der Nachkommen beruhe und von Aussterben und Divergenz der Merkmale begleitet werde. Da die Abänderungen meist nicht in einem embryonalen Alter auftreten, gleichen sich die Embryonen von Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Fischen sehr, während dem sich die erwachsenen Tiere stark unterscheiden. Bei Tieren mit getrennten Geschlechtern finde in der Regel ein Kampf der Männchen um die Weibchen statt, was in der geschlechtlichen Zuchtwahl resultiere. Darwin wiederholt nochmals, dass er keine scharfe Grenze sehe zwischen individuellen Verschiedenheiten und wenig umschriebenen Varietäten, oder zwischen ausgeprägten Varietäten und Unterarten oder Arten. Deshalb sei auch eine Theorie von besonderen Schöpfungsakten einzelner Arten nicht haltbar. Auch die beobachtbare unterschiedliche Konstanz von Gattungsmerkmalen wäre nach einer solchen Theorie nicht möglich. Der Glaube an eine Unveränderlichkeit der Arten sei durch die frühere Vorstellung einer kurzen Erdgeschichte gefördert worden. Die heute errechneten Zeiträume von vielen Millionen Jahren mit unendlich vielen Abänderungen der Lebewesen sei allerdings für den menschlichen Verstand nur schwer nachvollziehbar. Doch der Glaube, dass gewisse elementare Atome je dazu kommandiert worden wären, sich zu einem Lebewesen zusammenzuschliessen, sei noch viel unvernünftiger. Dem gegenüber zwinge ihn aber die Analogie zum Schluss, dass alle Tiere und Pflanzen von einer einzigen Urform abstammten. Dies sei zwar etwas unsicher, doch hätten immerhin alle Lebewesen vieles gemeinsam in ihrem Zellenbau, in ihrer chemischen Zusammensetzung, in Wachstumsgesetzen und Umweltempfindlichkeit. Darwin folgert aus seinem Werk, dass eine grosse Umwälzung der Naturwissenschaft die Folge sein würde. Die Systematik der Klassifizierung werde wesentlich erleichtert werden, obwohl der Begriff „Art“ kaum mehr haltbar sei. Vor allem aber werde man die Lebewesen nicht mehr als etwas Unverständliches und Übersinnliches betrachten, sondern als etwas mit Arbeit, Erfahrung, Geschichte und Verstand Erklärbares. Die Naturwissenschaft werde dadurch wesentlich fesselnder. Besonders das Studium der Ursachen und Gesetze der Variationen werde grossen Raum einnehmen, ebenso wie die Embryologie, welche ein Bild der alten Lebensformen zu entwerfen helfe. Auch die Geologie werde bessere Kenntnisse über die einstigen Klima-­‐ und Niveauveränderungen bringen und damit erlauben, die Verbreitungs-­‐ und Entwicklungsmöglichkeiten früherer Lebewesen zu erklären. Allerdings dürfe man die Erdkruste nicht als gut gefülltes Museum betrachten, höchstens als armselige Sammlung von einzelnen Zufällen. Die Psychologie werde zeigen, dass geistiges Vermögen nur allmählich und stufenweise erlangt werden könne. Licht werde auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte. Es gäbe wohl von einem Schöpfer der Materie eingeprägte Gesetze; doch Entstehen und Vergehen aller früheren und heutigen Erdenbewohner genauso wie Geburt und Tod der Individuen seien eine Folge sekundärer Ursachen. Doch da die natürliche Zuchtwahl immer zum Vorteil der Geschöpfe wirke, so würden die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu weiterer Vervollkommnung gelangen. Darwin schliesst sein Werk mit dem Gedanken, es sei etwas Erhabenes, dass aus einem schlichten Anfang eines Kampfes um Hunger und Tod eine so unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entstehe. 1.6
Kritik von Darwins Zeitgenossen Gemäss Dr. Urs B. Leu, Leiter der Abteilung Alte Drucke an der Zürcher Zentralbibliothek, stiess Darwins Evolutionstheorie bei vielen bekannten Naturforschern seiner Zeit auf Widerstand. Zu diesen gehörten etwa Joachim Barrande, Trilobitenspezialist in Prag, Heinrich R. Göppert, Paläobotaniker in Breslau, Arnold Escher von der Linth und Ulrich Stutz, Geologen in Zürich, sowie die Schweizer Biologen Carl Nägeli und Albert Kölliker und der Schweizer Paläobotaniker Oswald Heer. Im Folgenden soll über die beiden pointierten Kritiker Oswald Heer und Ulrich Stutz anhand von Literatur der NGZ aus den Zürcher Hochschulen berichtet werden. Ferner erwähnte Prof. Dr. Paul Schmid-­‐Hempel in seiner Ringvorlesung „Darwins Erben“ von den Kritikern Sir John Herschel, Astronom (1792-­‐1871), und Adam Sedgwich, Geologe. Sie hielten Darwin hauptsächlich entgegen, seine Theorie stehe konträr zur deistischen Sicht, sie arbeite nicht induktiv sondern deduktiv, Gott werde ersetzt durch die Natur, sie könne die Selektion nicht beweisen, sie sei unmoralisch, Variationen würden sehr schnell eliminiert und die Rückkreuzungen würden die Unterschiede einebnen und eine neue Art sei auch noch nie gezüchtet worden. Die Gegenargumente finden sich im Kapitel 2 in den Vorlesungsnotizen „Darwins Erben“. 1.6.1 LEU, U.B., Oswald Heer (1809-­‐1883): Paläobotaniker und Kritiker Darwins. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009), 154(4/3): 83-­‐95. Literaturbericht, wb Dr. Urs B. Leu beschreibt in dieser Arbeit den Schweizer Naturforscher und Theologen Oswald Heer, welcher die Evolutionstheorie abgelehnt und stattdessen eine eigene „Umprägungstheorie“ entwickelt hatte. Heer war ab 1832 während 51 Jahren Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, wo er (auch gemäss Prof. C. Burga) viele Vorträge hielt und fleissig publizierte. Ähnlich wie Darwin korrespondierte Heer mit Forschern und Universitäten der ganzen Welt, u.a. auch mit Charles Lyell. Er war einer der führenden Palä-­‐ontologen seiner Zeit mit Schwergewicht auf Tertiärpflanzen. Er verfasste auch ein populärwissenschaftliches Buch „Die Urwelt der Schweiz“, welches in mehreren Auflagen und in verschiedenen Sprachen grosse Verbreitung fand (Siehe Kapitel 6). Er beschrieb nach Leu hunderte von neuen Arten und schloss aus der Ähnlichkeit der fossilen Flora Europas und der rezenten Nordamerikas auf die Existenz einer untergegangenen Landmasse, welche die beiden Kontinente einmal verbunden haben musste. Diese bezeichnete er als „Atlantis“. Die moderne Theorie der Plattentektonik war zu Heers Zeiten noch unbekannt. Heer teilte Darwin seine Kritik in zahlreichen Briefen mit und erhielt von ihm dafür ein Handexemplar seines Werkes „On the Origin of the Species“. Darwin nahm die kritischen Punkte zur Kenntnis, ohne aber eine Diskussion darüber zu führen. Aus zahlreichen Beobachtungen im Pflanzenreich mit fossilen Funden aus den Pfahlbauerdörfern und aus dem alten Ägypten folgerte Heer, dass die wildwachsenden Pflanzen über grosse geologische Zeiträume unverändert geblieben seien. Nur die domestizierten Pflanzen seien bis zu einem gewissen Grad umgewandelt worden. Er lehnte damit Darwin‘s Theorie der natürlichen Zuchtwahl ab. Die Entstehung des Lebens selbst führte er auf einen schöpferischen Akt Gottes zurück, was auch Darwin in jungen Jahren noch vertreten hatte. Ebenso lehnte er es als der Vernunft widersprechend ab, dass lediglich durch eine allmähliche Umwandlung der Typen eine Steigerung von einfachsten Pflanzen bis zum Menschen stattgefunden haben könnte. Er erkannte allerdings an, dass die Verwandtschaft zwischen fossilen und rezenten Arten so gross sei, dass entweder durch einen genetischen, langsam wirksamen Zusammenhang, oder aber durch eine kurzfristige, noch unbekannte Einwirkung eine plötzliche Umprägung in eine höhere Art erfolgt sein müsse. Sowohl aus theologischen wie aus Gründen seiner Beobachtungen der Fossilienfunde bekannte er sich dann aber zur Theorie der Umprägung. Als Lösung des Rätsels der Einwirkung postulierte er eine Intervention des Schöpfers und erklärte aber, dass unser Geist diese Frage nicht zu fassen vermöge. Zugleich kritisierte er, dass die nach dem Evolutionskonzept notwendigen Übergangsformen in den Fossilien zu finden sein müssten, was zu seiner Zeit nicht der Fall war (Siehe auch Kapitel „Fossilien“). Darwin hatte dieses Problem in seinem Buch ebenfalls behandelt und U. Leu vermutet, dass er gerade wegen der damaligen Unvollständigkeit der Funde die Diskussion mit Heer vermieden habe. Heer besass selbst eine beachtliche Sammlung von Fossilien, die er auch Charles Lyell bei einem Besuch im Jahr 1856 vorzeigen konnte. Er erging sich in seinen Publikationen öfter auch in Polemik, wenn er etwa der Evolutionslehre, die er selbst „Transmutationslehre“ nannte, entgegen hielt: Es ist die Furcht vor der Zweckmässigkeit der Natur, und noch mehr vor dem dadurch notwendig gewordenen Zwecksetzer, welche manche Naturforscher veranlasst hat, sich an die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl als rettende Planke anzuklammern. Leu führt auch an, dass Heer sogar vielen Naturforschern den unwissenschaftlichen Vorwurf machte, sie wollten einfach Gott aus ihrem Weltbild streichen. Mit völligem Unverständnis reagierte Heer auch auf Darwins Postulat des sog. sekundären Wassergangs der Landwirbeltiere. Auch dazu konnte Darwin noch keine Übergangsformen als Fossilien vorzeigen. Leu schliesst seine Recherchen mit der Erklärung, dass Heer nicht als Vorgänger Darwins bezeichnet werden kann, wie das früher oft behauptet worden sei. Hingegen sieht er in ihm einen Vorläufer des „Punktualismus“, welcher von Eldredge und Gould 1972 formuliert wurde. Dieser sagt, dass lange Zeiten von Stabilität der Arten von kurzen Phasen der Wandlung unterbrochen worden seien. Dabei hätten allopatrisch entstandene Arten andere ähnliche Arten verdrängt. Die Entwicklung sei aber unplanmässig verlaufen, was wiederum im Gegensatz zu Heers Vorstellung eines planenden Schöpfers steht. Einen Bezug zu heutigen Kreationisten stellt Leu aber nicht her. 1.6.2 SULSER, H., Der Zürcher Geologe Ulrich Stutz (1826-­‐1895) und seine kritische Auseinandersetzung mit dem Evolutionskonzept Darwins – ein historisches Dokument zu einer alten Streitfrage. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2008) 153(1/2): 7-­‐13 Literaturbericht, wb Ausgangspunkt zu dieser Publikation von Dr. Heinz Sulser ist ein an der ETH aufgefundener gedruckter Vortrag des Geologen Ulrich Stutz aus dem Jahr 1867. Am damaligen Zürcher Polytechnikum sprach Stutz 8 Jahre nach Erscheinen des „Origin of the Species“ vor einem gemischten Publikum über „religiöse Streitfragen der Zeit“. Als Geologe wusste Stutz, dass die Entwicklung des Planeten Erde bis zur heutigen Gestalt allmählich über einen riesigen Zeitraum abgelaufen war, und dass anfänglich weder Pflanzen noch Tier oder Mensch den Erdball bevölkert hatten. Es war auch aus den Fossilien bekannt, dass die Pflanzen den Tieren zeitlich voraus gegangen waren, dass die ersten Pflanzen Meeresbewohner waren und dass die warmblütigen Tiere nach den niederen Wassertieren und der Mensch als eines der letzten Geschöpfe erschienen waren. Diese Veränderungen der Lebewesen, meinte er, seien nach und nach durch Aussterben und Neuerscheinungen von Arten vorangegangen. Was Stutz jedoch an Darwin’s Theorie nicht akzeptierte, war die Idee der natürlichen Zuchtwahl. Er bestritt, dass in der Natur durch den Zufall der äusseren Bedingungen und der individuellen Varietäten dasselbe Prinzip ablaufe, wie die künstliche Zuchtwahl, also die Herausbildung und Vererbung neuer Formen durch die auswählende Hand des Menschen. Noch vehementer verneinte er, dass auch der Mensch selbst ein Produkt natürlicher Zuchtwahl sein könne. Er führte zum Beweis an, dass Übergänge zwischen den Arten nicht bekannt seien (obwohl 1864 Exemplare des Archaeopteryx gefunden worden waren), und dass die Natur über die Reinhaltung der Arten wachen würde. Er räumte zwar ein, dass eine genaue Definition von Arten unmöglich sei, verneinte aber die reine Nützlichkeit des Überlebens als Triebfeder der Entwicklung zu immer höheren Organismen. Diese müsse seit Beginn der Schöpfung nach einem bestimmten Plan erfolgt sein, welcher nicht im einzelnen Individuum liegen könne, sondern von einem aussermateriellen Wesen gelenkt werden müsse. Jedes Geschöpf sei in Vollkommenheit für seinen Zweck bestimmt. Sulser schreibt Stutz damit eine laientheologische Sinnsuche zu, die konkretisiert wurde durch die Meinung, dass gegenwärtig die Reiche der Pflanzen und Tiere abgeschlossen und unveränderlich dastehen würden, und dass durch das Erscheinen des Menschen eine dauerhafte Stabilität in der Natur erreicht sei. Charakteristisch am Menschen sei aber der Geist, womit das Ziel der Schöpfung erreicht sei. Der Mensch sei also entsprechend der biblischen Mosaischen Geschichte die Krone der Schöpfung und dazu ausersehen, die materiellen Schätze der Erde zu nutzen. Sulser weist natürlich darauf hin, dass man das „Nutzen der materiellen Schätze der Erde“ heute eher als Ausbeutung bezeichnet. Aber er zitiert auch den versöhnlichen, schon beinahe visionären Schlusssatz aus dem Vortrag von Stutz: Dass man mit der Auffassung der Naturordnung und der Heilsordnung eine Weltanschauung erhält, in welche beide sich ungezwungen einfügen, von der aus beide sich gleich gut verstehen und vereinigen lassen. 2. Evolution heute 2.1 Ringvorlesung vom 17.9.09, UNI Zürich: Alles nur Zufall? Darwins Evolutionstheorie in ihrer heutigen Gestalt Prof. Dr. Heinz-­‐Ulrich Reyer Vorlesungsnotizen, wb Prof. Dr. Heinz-­‐Ulrich Reyer (1945) Prof. für Zoologie an der Universität Zürich 2005-­‐2009 Direktor des Zoologischen Instituts Forschung über die Einflüsse von Genetik, Ökologie und Verhalten auf die Struktur und Dynamik von Populationen. Es ist uns heute im Zeitalter der Biodiversität und des Naturschutzes vielleicht nicht mehr bewusst, dass bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts sowohl in Religion wie in Wissenschaft die Idee einer „Konstanz der Arten“ vorherrschte. Seit ihrer Erschaffung oder Entstehung seien die Arten bis heute unverändert geblieben. Man sah nicht zuletzt durch die Fossilfunde aber doch langsam, dass sich Arten im Laufe der Erdgeschichte allmählich verändert hatten, wenn auch nur innerhalb ihrer Linien. Ein Fisch galt demnach immer als Fisch, ein Vogel also ein Vogel und Insekten als Insekten, auch wenn frühere Vögel als anders als heutige Vögel erkannt wurden. An Darwins Theorie waren zwei Elemente anders und neu: Die Entwicklung besteht nicht in parallelen Linien, sondern in Verzweigungen, und die Vielfalt entstand durch Aufspaltung aus einem gemeinsamen Ursprung. Der deutsche Biologe Ernst Haeckel (1834-­‐1919) zeichnete mit dieser Vorstellung 1874 den populären „Baum des Lebens“ mit seinen Verzweigungen und Verästelungen. Die Idee einer gemeinsamen Wurzel mit zunehmender Aufspaltung war Darwin auf den Ozeanischen Inseln gekommen. Auch schon James Cook (1768-­‐1771) und Alexander von Humbolt (1799-­‐1894) hatten Daten darüber über deren ungewöhnliche Fauna und Flora gewonnen. Die Arten auf Inseln sind nicht sehr zahlreich, variieren aber stark und sind endemisch, d.h. sie kommen an anderen Orten nicht vor. Andere Gruppen von Arten fehlen völlig, wie etwa Amphibien und Säugetiere. „Alles nur Zufall“? fragte Reyer. Nein, denn auf die weit vom Festland entfernten Inseln gelangten eben nur wenige Exemplare einzelner Arten, etwa Vögel im Flug, Landtiere auf schwimmenden Zweigen etc. Sie fanden dort kaum Konkurrenz und konnten sich dank Variationen in viele ökologische Nischen ausbreiten. Anderseits interessierte sich Darwin stark für Fossilien und legte eine umfangreiche Sammlung an. Die verschiedenen Pflanzen-­‐ und Tiergruppen treten in unterschiedlich tiefen Gesteinsschichten auf, deren Tiefe auf die Abfolge ihres Erscheinens schliessen lassen. Dank der Ähnlichkeiten ihres Körperbaus konnte Darwin Übergänge belegen. Heute sind diese Belege allerdings wesentlich lückenloser als im 19. Jahrhundert. In einigen Fällen wurden auch ausgestorbene Übergangsglieder, sogenannte „Brückenfossilien“ gefunden. Eines der bekanntesten ist das 1861 gefundene Skelett des Urvogels Achaeopteryx, welcher mit seinen Zähnen und der Schwanzwirbelsäule zu den Reptilien gehörte, mit dem Federkleid und dem Bau des Fusses hingegen schon zu den Vögeln. Auch das ist kein Zufall. Da Erd-­‐ und Gesteinsschichten durch Ablagerungen entstehen, zeigt die Reihenfolge der Schichten das zeitliche Auftreten der darin enthaltenen fossilierten Tiere und Pflanzen. Übergangsformen sind wichtig als Beleg ihrer Transformation. Heute sind auch die Übergänge von den Fischen zu den Amphibien belegt und die Zahl der Brückenfossilien nimmt weiter zu. Hilfreich sind dabei die neuen Bohrtechnologien und die Altersbestimmung von Gesteinen anhand des Zerfalls natürlicher radioaktiver Elemente. Eine weitere Informationsquelle nutzte Darwin mit dem Vergleich der Merkmale des Körperbaus und der Embryonalentwicklung heute lebender Formen. Der Grundbauplan innerhalb einer Gruppe ist nämlich derselbe, auch wenn das Erscheinungsbild von Untereinheiten völlig verschieden ist. Die Anzahl der Wirbel etwa oder der Bau der Gliedmassen, die zum Teil wie bei Schlangen oder Walen nur noch rudimentär sind, sind stets unverändert. Die Untersuchung der Embryonalentwicklung zeigt zudem, dass Organismen, die als Erwachsene völlig verschieden sind, oft sehr ähnliche Frühstadien haben. Menschliche Embryonen ähneln den Embryonen von anderen Säugetieren und von Vögeln oder zeigen Kiemenspalten wie Fische. Alle diese Eigenschaften werden nur verständlich, wenn man Evolution annimmt. Die Forschung nach Darwin hat die Evolutionstheorie weiter bestätigt. Die Zellbiologie konnte mit immer besseren Licht-­‐ und schliesslich Elektronenmikroskopen in immer kleinere Bereich des Lebens vorstossen. Man hat dabei eine überall präsente Grundstruktur gefunden. Weiter hat die Biochemie gezeigt, dass die chemischen Prozesse zur Energiegewinnung, zur Nahrungsverdauung und Herstellung von Substanzen von einfachsten Formen bis zum Menschen weitgehend gleich sind. Dies sind Hinweise, dass alles Leben aus derselben Wurzel stammen muss, und dass die entsprechenden „Erfindungen der Natur“ sehr früh in der Entwicklung von Leben aufgetreten sind. Am meisten haben aber die Genetik und die Entwicklungsbiologie Erkenntnisse geliefert, wie Eigenschaften vererbt werden und wie aus einfachen befruchteten Eizellen unterschiedliche Organismen entstehen. Wichtige Meilensteine der Forschung waren die Mendel’schen Gesetze 1870 und die Entschlüsselung des genetischen Codes ca. 1940. Die Kenntnisse über den Informationsweg von Desoxyribonukleinsäure DNA, nämlich von Genen, zu den 20 Aminosäuren, welche Peptide und Proteine und damit Enzyme bilden, erwiesen sich als universal für die belebte Natur. Da man heute diesen genetischen Code entziffern kann, kann man auch die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen entschlüsseln und ihre Verwandtschaftsbeziehungen nachzeichnen. So wie es aber z.B. bei Schlangen funktionslose Rudimente von Extremitäten gibt, so gibt es auch funktionslose Übrigbleibsel von Genen im Genom. Auch das ist nicht Zufall sondern nur durch evolutionäres Erbe zu verstehen. Über die allerersten Anfänge von Leben tappt man immer noch im Dunkeln, auch wenn die molekularen Vorstellungen über den Stoffwechsel, den genetischen Code und das Vervielfältigen (Replikation) der DNA über theoretische Modelle unter den Bedingungen der frühen Erde spekulieren lassen. Wie es danach aber mit den ersten Lebewesen weiterging, darüber lieferte Darwin überzeugende Argumentationsschritte: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Individuen derselben Art unterscheiden sich in zahlreichen Merkmalen. Prinzip der Variation. Ein Teil dieser Unterschiede ist erblich und wird von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Es werden mehr Nachkommen erzeugt, als die Ressourcen eines Gebietes tragen können. Daraus entsteht Konurrenz. Die Varianten, die für die Konkurrenz um die Ressourcen am geeignetsten sind, werden besser überleben (Selektion). Die Nachkommen tragen dann die geeigneten Merkmale häufiger. Auf längere Sicht werden sich erfolgreiche Merkmale durchsetzen. Im Verlauf der Evolution erfolgt so eine Anpassung (Adaptation) an die spezifische Umwelt. Wenn Umwelten sich an verschiedenen Orten unterscheiden, wird die Ausgangsform sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Es kann damit zu einer endgültigen Aufspaltung kommen, also zu neuen Arten. Darwin hatte diese Argumentationskette als Tier-­‐ und Pflanzenzüchter selbst kennen gelernt und sprach dort von der „künstlichen Selektion“, weil der Mensch als Selektionsprinzip auftrat. Im Gegensatz dazu bezeichnete er es als „natürliche Selektion“, wenn die Selektion durch die Umwelt oder andere Organismen erfolgte. Darwin fehlten aber Belege, da er die Ursache der Variationen und die Mechanismen der Vererbung nicht kannte, da man die natürliche Selektion im Gegensatz zur künstlichen Selektion nicht direkt beobachten konnte, und da es für die Aufspaltung in verschiedene Arten durch Veränderungen noch keine Beweise gab. Die Ursache der Variation ist heute bekannt als Mutationen, also Veränderungen am Erbgut der DNA und zufällige Fehler bei ihrer Verdoppelung einerseits, und an der nach dem Zufallsprinzip erfolgenden Durchmischung der Gene (Rekombination) bei der geschlechtlichen Zellteilung anderseits. Dass Darwin den unterschiedlichen Erfolg von Variationen nicht direkt messen konnte, lag daran, dass es zu adaptiven Veränderungen Hunderte bis Tausende von Generationen braucht. Evolution läuft in Hunderttausenden bis Millionen von Jahren ab. Heute kann man dagegen mit Mikroorganismen arbeiten, die sich sehr schnell vermehren und damit Veränderungen wie etwa Resistenzen auf Antibiotika in relativ kurzer Zeit beobachten lassen. Ein anderes berühmtes Beispiel sind die Beobachtungen an Darwinfinken auf den Galapagos Inseln. Da dort die Klimabedingungen sehr stark wechseln, konnte vom Forscherehepaar R. und P. Grant gezeigt werden, dass sich die Schnabelgrösse der Vögel je nach der witterungsbedingtem Beschaffenheit des Nahrungsangebots in wenigen Generationen verändern und anpassen konnte. Prof. Lukas Keller wird darüber referieren. Man hat allerdings gesehen, dass diese Anpassungen nicht nur über die Mechanismen der Mutationen und der Rekombination erfolgen. Zusätzlich wurden „Schaltergene“ gefunden, welche andere Gene ein-­‐ und ausschalten können und so etwa die Schnabelbildung nach den Umweltbedingungen beeinflussen können. Auch diese Schaltergene findet man in allen Organismen in erstaunlicher Übereinstimmung. Zufällige Veränderungen an bewährten Mechanismen führen also infolge von Selektion zu immer komplexeren Strukturen. Die Zufallskomponente besteht nur in den Mutationen und in der Rekombination der Gene. Was darüber hinausgeht, ist aber das Ergebnis von Selektion und führt zu Anpassung, die heute in vielen Fällen voraussagbar ist. Über die Bedingungen zur Artbildung, die Darwin auch noch nicht belegen konnte, weiss man heute ebenfalls mehr. Damit sich Variationen zu verschiedenen Arten auseinander entwickeln, muss der Genfluss zwischen ihnen unterbunden werden, da sonst Unterschiede immer wieder verwässert werden. Dies kann durch Auswanderung in ein anderes klimatisches Gebiet erfolgen, was dann als allopatrische Artbildung bezeichnet wird. Es kann aber auch in ein und demselben Gebiet zu Artbildung kommen, welche dann als sympatrisch bezeichnet wird. Dafür können wiederum Mutationen verantwortlich sein. Reyer verwies hier auf die Vorlesung von Prof. Dr. Meyer. Ein globales Beispiel der geographischen Barrieren zur Artbildung ist die Verschiebung der Kontinente in den letzten 200 Millionen Jahren. Viele Lebewesen lebten schon auf dem zusammenhängenden Superkontinenten Pangäa und entwickelten sich nach dessen Aufspaltung in verschiedene Richtungen und Formen. Das Evolutionskonzept hilft uns letztlich auch, unser menschliches Verhalten zu verstehen, genauso wie ökonomische Zusammenhänge, medizinische Probleme und sogar philosophische Konzepte. 2.2 Ringvorlesung vom 3.11.09 an der ETH Zürich Darwins Erben Prof. Dr. Paul Schmid-­‐Hempel, ETH Zürich Vorlesungsnotizen, wb Prof. Dr. Paul Schmid-­‐Hempel, 1948 Professor für experimentelle Ökologie an der ETH Zürich, Institut für integrative Biologie. Hauptforschungsgebiet: Koevolution von Wirten und Parasiten. Professor Schmid begann sein Referat mit einer Rekapitulation der Leistungen Darwins, die anlässlich seiner Beerdigung am 19.4.1882 in der Westminster Abbey, London, in Anwesenheit der bedeutendsten Naturwissenschaftler seiner Zeit und der britischen Gesellschaft gewürdigt worden seien: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Das statische Weltbild wandelte sich zu einem dynamischen, aber nicht zu einem kreationistischen Die Veränderung von Arten ist ein biologischer Prozess Evolution verläuft graduell Es findet eine natürliche Selektion von Variationen statt Es gibt eine gemeinsame Abstammung aller Lebensformen auf der Erde Geeignete Formen passen sich an und werden häufiger Ein Teil der individuellen Unterschiede ist erblich Die zur Zeit Darwins vorgebrachten Zweifel und Kritik betrafen vor allem folgende Punkte: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Die Evolutionstheorie stehe konträr zur deistischen Sicht und sei unmoralisch Darwins Methoden seien nicht induktiv, sondern deduktiv Gott werde ersetzt durch die Natur Für die Selektion von Variationen gebe es keine Beweise Die Variationen würden im Gegenteil stets schnell aufgebraucht und eliminiert Rückkreuzungen würden die Unterschiede zwischen Variationen einebnen Es sei noch nie gelungen, eine neue Art zu züchten. Die Evolutionstheorie sei nicht kompatibel mit den Mendel’schen Gesetzen. Bis heute können nach Prof. Schmid etwa folgende Gegenargumente zugunsten der Evolutionstheorie ins Feld geführt werden: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Selektion konnte schon 1899 in einer Schneesturmnacht nachgewiesen werden. Sperlinge fielen in Abhängigkeit ihrer Grösse dem Schneesturm zum Opfer. Die gefundenen toten Vögel waren im Durchschnitt kleiner als die überlebenden Individuen. Der Sturm hat also in Richtung grösserer Individuen selektioniert. Die Archäologie der Viehzucht zeigt, dass Kultur auf die Biochemie der Verdauung selektionierend wirkte. Die Viehzucht und damit die Nutzung von Kuhmilch als Nahrungsquelle ist vor 9000 Jahren in Ägypten entstanden, gelangte vor 7‘-­‐8000 Jahren nach Europa und vor 3000 Jahren nach Ostafrika. Im Menschen ist das Milch abbauende Enzym Lactase in diesen Regionen häufiger verbreitet als anderswo. Vor dem Übergang zur Sesshaftigkeit dürfte es nur in Einzelfällen als Mutation vorgekommen sein. Variationen können prinzipiell durch Selektion verschwinden. Es entstehen aber schneller und immer wieder neue Variationen durch Mutationen, Genduplikationen, Gentransfer oder Rekombination. Erworbene Fähigkeiten werden viel weniger weiter vererbt, als dass neue Eigenschaften selektioniert werden. Nach den Mendelschen Gesetzen werden Merkmale nicht vermischt, sondern als Einheiten (der Gene) weitergegeben. Die Geschichte der Biologie zeigt die zunehmende Bestätigung der Evolutionstheorie: 1910: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Die Chromosomen wurden als Träger der Erbinformation identifiziert Fitnessunterschiede werden als bedeutsam für erkannt Die genetische Varianz wurde belegt ebenso die grosse Anzahl genetischer Variationen in einer Population. Arten werden als Satz verschiedener Populationen bezeichnet. Zwischen 1930 und 1950 kam es zur modernen Synthese von Genetik und Biologie. Mutationen wurden als rein zufällig erkannt und der „Gradualismus“ beschrieb die Evolution deshalb als in kleinen Schritten und stetig graduell verlaufend. Im Gegensatz dazu steht der „Punktualismus“ nach Stephen Jay Gould, welcher eine sprunghafte Artbildung postuliert. Die Paläontologie lieferte immer deutlichere Belege für die Existenz einer natürlichen Selektion. Das Jahr 1950 brachte den Durchbruch für die Molekularbiologie und die Genetiker. 1953 beschrieben James D. Watson und Francis Crick das Doppelhelixmodell der Desoxyribonukleinsäure DNA, der genetische Code wurde entschlüsselt, Gene als Abschnitte der DNA identifiziert und der Begriff des Genoms entstand. Die Selektion wurde damit als für das Individuum massgebend erkannt, während dem die Gruppenselektion als Lieblingskind der Organismiker an Bedeutung verlor. Heute ist zur Genetik die Epigenetik hinzugekommen. Sie beschreibt die Entstehung von Änderungen im Phänotyp, die nicht auf Veränderungen der Gensequenz basieren. Einflüsse von Umweltfaktoren können sich so vererbbar bemerkbar machen. So kann etwa das normale Jgf2-­‐Gen bei der Maus nicht exprimiert werden, falls ein mutantes Allel vorliegt. Dies wird genetische Prägung genannt und wirkt sich verschieden aus, je nachdem ob das geprägte Gen von der Mutter oder vom Vater stammt. Ein anderer neuerer Zweig der genetischen Forschung ist die Entwicklungsbiologie oder Entwicklungsgenetik. Sie beschäftigt sich nicht nur mit der Embryonalentwicklung und Fortpflanzungsgenetik, sondern auch mit Schaltergenen (HOX-­‐Gene), welche durch Ein-­‐ oder Ausschalten von Genen unterschiedliche Formen des gleichen Grundplans erzeugen können. Auch auf diese Weise können Neuheiten in Arten gelangen. Anderseits werden Eigenschaften auch rezykliert, indem Strukturen, die es früher in ausgestorbenen Arten schon gab, wieder verwendet werden können. An der Frage, wie es zur Artbildung kommt, wird immer noch im Detail geforscht. Es herrscht die Ansicht vor, dass irgendeine Form der Trennung innerhalb einer Population eine grosse Rolle spielt. Dies müssen nicht nur geografische Barrieren sein, sondern auch trennende Einflüsse wie etwa die Anwesenheit oder Abwesenheit von Raubtieren. Beim Fisch Gambusia (über 40 Arten) bei den Bahamas wurde z.B. deutlich festgestellt, dass in Abhängigkeit von Räubern verschiedene Formen von Flossen gebildet wurden, bis diese beiden Varietäten schliesslich nicht mehr kreuzbar waren. Bei der Schnecke Euhadra hingegen entscheidet ein einziges Gen, ob ihr Gehäuse nach links oder nach rechts gewunden ist. Die beiden Arten sind nicht kreuzbar. Die von Darwin beschriebene Sexuelle Selektion konnte in ihrer Bedeutung bis heute bestätigt werden. Paarungspräferenzen bilden tatsächlich neue Arten. Weshalb die sexuelle Reproduktion überhaupt so erfolgreich ist, wird bis heute kontrovers diskutiert. Die asexuelle, klonale Fortpflanzung ist rein numerisch erfolgreicher, da in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand eine grössere Zahl von Nachkommen erzeugt wird. Daneben gibt es auch Jungfernzeugung (Parthenogenese) bei Arten mit geschlechtlicher Fortpflanzung. Innerhalb der sexuellen Reproduktion unterscheidet man Isogamie mit gleich grossen weiblichen und männlichen Gameten und Anisogamie. Ihr grosser Vorteil ist nach heutiger Sicht die Rekombination der Gene beim Crossover in der Meiose, der Teilung der Keimzellen. Nach Schmid entstehen dabei zahlreichere Variationen für die Abwehr der asexuellen Parasiten. Trotz aller Bestätigungen von Darwins Theorie lehnt der Referent jede Dogmatik in der Evolutionslehre ab. 2.3 Ringvorlesung vom 15.10.09 an der UNI Zürich Galapagos – Evolution im natürlichen Labor. Darwin und die Folgen der Inzucht. Prof. Dr. Lukas Keller, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Prof. D r. Lukas Keller Studium der Biologie: Universitäten Zürich und Basel Doktorarbeit über Wildtierbiologie 1996, Wisconsin Research Fellow in Princeton Assistenzprofessor in Glasgow 2003 D irektor des Zoologischen Museums der Universität Zürich, Professur für Evolutionsbiologie Prof. Keller begann seine Vorlesung mit dem Datum des 1.7.1858, als in der Linné’schen Gesellschaft in London ein Bericht von Charles Darwin und von Wallace zur Evolution der Arten verlesen wurden. Das Echo sei aber mässig gewesen. Erst 1859 mit der Publikation von Darwins „The Origin of the Species“ wurde die Öffentlichkeit auf die Sensation aufmerksam. Heute ist Evolution das vereinigende Prinzip der modernen Biologie. Im Weiteren schilderte Keller, wie Darwin 1831 als 22-­‐Jähriger zu seiner Weltreise gestartet war. Er sei ein genialer Beobachter und Beschreiber der Flora, der Fauna und der Geologie gewesen. Die Galapaos Inseln spielten für Darwin eine wichtige Rolle bei der Entwicklung seiner Theorie der Entstehung neuer Arten, dem Geheimnis der Geheimnisse, wie er es nannte. Er beschrieb die Inseln bei seiner Landung in San Cristobal zwar als unwirtlich, übel riechend und mit grauem Gebüsch und schwarzer Lava durchsetzt, trocken und dürr. Sein Interesse wurde dann jedoch auf die Spotdrosseln gelenkt, welche auf den verschiedenen Inseln des Archipels in verschiedensten Variationen anzutreffen waren. Dabei habe er sich erstmals mit dem Gedanken befasst, dass Arten nicht stabil seien. Aber auch die Vielfalt und Schönheit aller zahlreichen Tier-­‐ und Pflanzenarten auf den Inseln begeisterten ihn. Prof. Keller schildert, wie auch er fasziniert war von den Tieren und speziell ihrer Zahmheit. Von Genetik wusste Darwin allerdings noch nichts. Zwar hatte der tschechische Mönch Gregor Mendel im Jahr 1870 seine mathematischen Vererbungsgesetze publiziert. Diese Arbeit ging aber verloren und wurde erst im Jahr 1900 wieder entdeckt. Heute können die Gene eines Individuums im Detail beschrieben werden und Evolution kann somit auch im natürlichen Labor, wie eben auf den Galapagos Inseln nachgestellt werden. Keller hat zusammen mit seinem Kollegen H.U. Reyer selbst Feldforschung auf den Inseln betrieben. Für Evolution braucht es die genetischen Variationen bei den Individuen, welche vererbt werden. Die Unterschiede in der Fitness dieser Individuen, nämlich der Fähigkeit sich unter den gegebenen oder neuen Bedingungen fortzupflanzen und zu überleben, führen dann zu neuen Unterarten und Arten. Keller prüfte dieses Prinzip anhand der Darwin Finken mit ihrer variierenden Schnabelgrösse. Darwin hatte diese Finken ebenfalls kennen gelernt aber für verschiedene Vogelarten gehalten und er hatte zahlreiche Exemplare mit nach Hause genommen. Erst ein Ornithologe in London machte ihn darauf aufmerksam, dass es sich dabei um lauter Finken handelte. Galapagos-Finken von Darwin dargestellt mit Schnäbeln in abgestufter Grösse und Gestalt. Bild aus: „Ulrich Stutz und seine
kritische auseinandersetzung mit dem Evolutionskonzept Darwins. Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
(2008), 153(1/2): 7-13
Die wechselnden Umweltbedingungen auf den Galapagos sind Regen und Dürre. Kommt es zu einer längeren Trockenheit, gibt es für die Finken keine kleinen, weichen Samen mehr als Nahrung. Viele gehen deshalb zugrunde. Nur diejenigen Variationen mit etwas grösseren Schnäbeln überleben, weil sie die bei Dürre verbleibenden grossen und harten Samen aufknacken können. Sie pflanzen sich fort und vererben die grösseren Schnäbel. In der Regenperiode jedoch gibt es zahlreiche kleine, weiche Samen, welche auch von den Finken mit kleineren Schnäbeln gefressen werden können. Auch diese Finken pflanzen sich dann wieder fort und vererben die kleinen Schnäbel. So können zahlreiche Unterarten mit verschiedener Schnabelgrösse entstehen. Heute kennt man das Protein, welches die Schnabelgrösse bestimmt und welches in unterschiedlicher Zeitdauer exprimiert wird und damit Variationen verursacht. Darwins Vogelsammlung in London wird heute mit genetischen Methoden untersucht, die es erlauben, den Zeitpunkt der Trennung zweier Arten zu bestimmen Man hat dabei Zeiträume von ca. 250 Jahren errechnet. Artenstehungen in solch kurzen Zeitabschnitten bezeichnet man als Mikroevolution, während man mit Makroevolution die Entwicklungen über Millionen von Jahren definiert. Die evolutiven Vorgänge selbst, nämlich das Oszillieren der Variationen und der Umweltbedingungen, sind dabei dieselben. Die Frage aus dem Auditorium, ob Evolution auch reversibel sein könne, beantwortete Keller mit Ja. Im zweiten Teil des Vortrages berichtete Keller über Darwins Arbeiten zur Kreuz-­‐ und Selbstbefruchtung im Tier-­‐ und Pflanzenreich. Darwin hatte selbst mit Pflanzenzucht experimentiert und hielt in der Folge die Selbstbefruchtung für im Durchschnitt schädlich. Diese Inzuchtdepression zeige sich in verminderter Fortpflanzung und höherer Mortalität. Dies hatte er auch bei seiner eigenen Familie erlebt. Er hatte seine Cousine geheiratet und 10 Kinder mit ihr gezeugt. Von diesen verstarben einige früh und andere waren unfruchtbar. Heute ist bekannt, dass das Immunsystem bei Inzuchttieren geschwächt ist, die sexuellen Merkmale weniger ausgeprägt sind und dass die Alterung früher einsetzt. Die Effekte der Inzucht seien aber im Ganzen sehr variabel und vom Futterangebot abhängig. Je weniger Nahrung zur Verfügung stehe, desto stärker mache sich die Depression bemerkbar. Keller erwähnt dazu auch Inzuchtphänomene, welche im Tessiner Maggiatal bei der Bevölkerung des Dorfes Cavergno beobachtet wurden und Darwins Theorie bestätigten. Viele östliche Völker erlauben übrigens die Cousinenheirat und gleichen die höhere Kindersterblichkeit und Unfruchtbarkeit mit einer höheren Geburtenrate aus. Keller schloss mit dem pointierten Satz, Darwin habe viel von Evolution verstanden und deshalb zehn Kinder gezeugt; er habe aber nichts von Genetik verstanden und deshalb seine Cousine geheiratet. 2.4 Ringvorlesung vom 8.10.09, UNI Zürich Das Geheimnis der Geheimnisse, Wege zur Artenbildung. Prof. Dr. Axel Meyer, Konstanz Vorlesungsnotizen, wb Prof. Dr. Axel Meyer Studium an den Universitäten Marburg und Kiel, wissenschaftliche Tätigkeit in Miami, Harvard und Berkley Promotion an der State University, New York, USA Seit 1997 ord. Professor für Evolutionsbiologie in Konstanz Besondere Interessen: Grundlegende Mechanismen der Evolution, genetische Unterschiede und Entstehung von Diversität, Wissenschafts-­‐ und Forschungspolitik. Axel Meyer gehört zu den 250 meist zitierten Autoren in der Biologie. Prof. Meyer gliederte sein Referat in zwei Teile, wobei er zuerst der Frage nachging, was Darwin über die Entstehung von Arten gesagt hatte und was spätere Evolutionsbiologen, im speziellen Ernst Meier dazu erarbeitet hatten. Im zweiten Teil erläuterte er die Problematik anhand der selber erforschten, enorm schnellen Bildung zahlreicher Arten bei den Buntbarschen in afrikanischen und südamerikanischen Süsswasserseen. Darwin hatte immer wieder betont, dass man nicht wisse, was Arten eigentlich sind, ob sie nur zufällige Varietäten, Unterarten oder Rassen seien, oder gar nur künstliche Konstrukte der menschlichen Taxonomie. Auch heute gibt es nach Meyer etwa 100 verschiedene Arten-­‐Konzepte. Im „Origin of the Species“ habe Darwin die natürliche Selektion als Ursache für die Artentstehung herausgearbeitet, zusammen mit dem Prinzip des Überlebens der passendsten Individuen oder Variationen. Das letztere wurde unmittelbar nach Darwin zum Hauptprinzip der Artenbildung erhoben. Darwin habe aber nach seiner Weltreise lange als Tier-­‐ und Pflanzenzüchter geforscht und diese Ergebnisse in seine Beobachtungen einfliessen lassen. Als Folge davon habe er die künstliche Selektion durch den Menschen, also die Domestikation, der natürlichen Selektion gleich gestellt. Meyer betonte aber, dass die natürliche Selektion keinen Plan und kein Ziel habe, so wie der Züchter dies hat. Sie ist rein vom Zufall abhängig. Sie ist deshalb auch langsamer und produziert keine Perfektion. Sie hinterlässt lediglich Gruppen von Individuen mit möglichst grosser Nachkommenschaft. Auf der Ebene der Gene heisst das etwa: Bei der künstlichen Selektion verursachen wenige Gene sehr grosse Unterschiede in den Phänotypen der Rassen innert weniger hundert Generationen. Anderseits können in der Natur genetische Variationen entstehen, aus denen durch divergente Selektion neue Arten hervorgehen können. Bei dieser Selektion wird der Genfluss durch Barrieren, meist geografische Barrieren, behindert oder unterbrochen, so dass die getrennten Gruppen zu getrennten Arten evoluieren können. Dieses heute als wesentlich erachtete Prinzip habe Darwin nicht mit einbezogen. Meyer ist der Meinung, dass die taxonomischen Ebenen zwar künstlich, dass Arten selbst aber ein wesentliches Phänomen seien. Er favorisiert denn auch das biologische Artenkonzept nach Ernst Meier, welches etwa besagt: „Eine Art ist eine biologische Gruppe, die sich kreuzen kann und von anderen Gruppen auf irgend eine Weise isoliert ist“. Die Artbildung verlaufe langsam, auch ohne natürliche Selektion, aber allopatrisch, also infolge natürlicher Barrieren, welche die Mutationen trennen. Man müsste eigentlich annehmen, dass schon vor der Entstehung der Zygoten genetische Behinderungen gegen die Fortpflanzung mit Artfremden eingebaut werden. Auch dies muss aber relativiert werden, da Kreuzung unter zahlreichen Arten doch häufig möglich ist. Zusammenfassend definierte der Referent die folgenden Möglichkeiten der Selektion und Artbildung: -
Gerichtete Selektion: Auswahl nach bestimmten Kriterien wie z.B. der Grösse führt zur künstlichen Artbildung Stabilisierende Selektion: Die durchschnittlichen Typen (z.B. nach Grösse) gedeihen am besten womit die Art stabil bleibt Divergierende Selektion: Besonders stark abweichende Individuen (z.B. die Grössten oder die Kleinsten) haben in einer Nische einen Selektionsvorteil und bilden neue Arten (von Darwin favorisiert) Sympatrische Artbildung: neue Arten entstehen ohne geografische Barrieren innerhalb einer Population Allopatrische Artbildung: Mutationen werden infolge von Barrieren passiv und einseitig akkumuliert und führen zu neuen Arten (heute am ehesten akzeptiert). Eine besondere Fähigkeit zu schneller Artbildung haben offenbar die Buntbarsche in den Seen von Afrika, Südamerika und Indien. Axel Meyer hatte deshalb intensive Studien mit diesen Tieren betrieben und berichtete nun darüber im zweiten Teil seiner Vorlesung. Die Buntbarsche schilderte er als eine Familie von ca. 3000 Arten, welche als Artenschwärme endemisch in den Seen leben, d.h. bestimmte Arten kommen nur in bestimmten Seen vor. Im Viktoriasee z.B. gibt es gute 500 Arten, welche in den letzten 100'000 Jahren homophylogenetisch, also aus einer einzigen Art entstanden sind. Geografische Barrieren gibt es in solchen Seen eigentlich nicht, aber die verschiedenen Arten sind zwangsläufig sehr stark spezialisiert in Bezug auf Nahrungsquellen und Gestalt und zeigen damit eine grosse Diversität. Man kann dies auch als ökologische Artenbildung bezeichnen. Als besondere Spezialisierung erwähnte der Referent den „Schuppenfresser“, eine Art, welche sich von den Schuppen anderer Fische ernährt. Damit sie von der Seite her an die Schuppen herankommen, ist ihr Kopf zur einen Seite abgedreht, und zwar zu je 50% zur linken oder zur rechten Seite. Dieses Gleichgewicht stellt sich ein, weil die Opfer sich auf die Angriffe von links oder rechts einstellen und damit ein Übergewicht einer der Seiten bekämpfen können. Interessant ist zudem, dass in den verschiedenen Seen Ostafrikas ähnliche Formen unabhängig voneinander aus je einer ursprünglichen Art entstanden sind. Die zahlreichen Färbungen der Buntbarsche werden als Merkmale der sexuellen Selektion gedeutet. Wenn es nicht viele oder keine Fressfeinde hat, kann die Partnerwahl wichtiger werden als etwa die Flucht oder Tarnung. Bei einigen Arten werden die Eier im Mund der Mutter befruchtet. Die Männchen haben sog. Eiflecken, die sie den Weibchen zeigen können und die der Partnerwahl dienen. Je mehr Eiflecken eine Art vorzeigen kann, umso eher wird sie zur Paarung ausgewählt. Durch sexuelle Selektion können bei Buntbarschen neue Arten schneller, nämlich innerhalb von 100 Generationen (=100 Jahren) entstehen. Dies konnte Meyer auch in Kraterseen in Nicaragua feststellen, in denen die Artbildung vollständig isoliert stattgefunden hatte, und zwar durch oekologische und sexuelle Selektion ohne geografische Barrieren. Nachdem Axel Meyer also im ersten Teil Darwin kritisiert und ihm gemäss Ernst Meier die Bedeutung der geografischen Barrieren und das Postulat einer langsamen, seltenen Bildung zu stabilen und eindeutigen Arten entgegen gehalten hatte, zeigte er im zweiten Teil, dass die Datenlage doch nicht so eindeutig sei, dass es Artbildung auch sympatrisch aufgrund divergierender und sexueller Selektion gibt, und dass Arten nur durch minimale genetische Unterschiede divergieren können. Dies treffe zumindest auf Buntbarsche wie auch auf die Darwinfinken zu. Auf molekularbiologischer Basis gäbe die Artbildung der Wissenschaft aber so oder so noch viele Rätsel auf. 2.5 Ringvorlesung vom 20.10.09 an der UNI Zürich Evolution in der Sprache Prof. Dr. Andreas Fischer, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Referent setzte den Anfang seiner Erläuterungen bei Darwin an, welcher nach seiner Weltreise eine erste Skizze vom gemeinsamen Ursprung aller Lebewesen, vom „Baum des Lebens“ gezeichnet hatte. Dieser Ursprung war mit der Zahl 1 markiert. Von hier aus verzweige sich das Leben in seine verschiedenen Erscheinungsformen, wobei sich Ähnlichkeiten und Unterschiede durch den Abstand vom Ursprung und von anderen Formen des Lebens erklären lassen. Der deutsche Biologe Ernst Haeckel (1834-­‐1919) lieferte 1877 eine anschauliche Darstellung dieses Baums, welche zum allgemein bekannten Modell der Evolution organischen Lebens wurde. Etwa gleichzeitig mit Darwins Hauptwerk publizierte der Sprachforscher August Schleicher (1821-­‐1868) aus Jena erstmals einen „Baum der Sprachen“, der die indogermanischen Sprachen von den Kelten im Westen bis zu den Indern im Osten enthielt. Er postulierte die Regelmässigkeit der Lautgesetze: Ein Laut werde in der gleichen Umgebung gleich behandelt. Durch diese beiden Bäume wurde die Ablösung des Denkschemas „Schöpfung“ durch die Idee „Evolution“ graphisch verdeutlicht. Die Sprachenvielfalt, so betonte der Referent, sei allerdings im Gegensatz zu Pflanzen, Tieren und Mensch in der Bibel nicht als etwas Positives, sondern als Strafe Gottes für die Überheblichkeit der Menschen dargestellt worden. Demgegenüber sind Sprachen nach der Evolutionslehre das Resultat eines natürlichen Entwicklungsprozesses, welcher durch Variation und Selektion angetrieben wird. Dies war auch die Auffassung von Darwin, welcher die Entwicklung der Sprachen durchaus als Evolution sah und eine phylogenetische Klassifizierung noch für möglich hielt. Die Idee der indogermanischen Sprachenverwandtschaft ist aber viel älter und geht zurück auf den Engländer Sir William Jones, der 1786 mit dem indischen Sanskrit in Kontakt kam und die grosse Ähnlichkeit dieser ältesten überlieferten Sprache Indiens mit Griechisch und Latein entdeckte. Er fand diese Sprache vollendeter und vielfältiger und in der Grammatik wie in den Wurzeln der Worte so ähnlich dem Latein und Griechisch, dass er den Zufall als Ursache dafür ausschliessen musste. Diese Sprachen mussten nach seiner Meinung von einer gemeinsamen Quelle abstammen, die wohl nicht mehr existierte. Noch heute wird diese Ansicht gestützt und die ausgestorbene Vorform wird als Indogermanisch oder Indoeuropäisch bezeichnet. Als bekanntesten Indogermanisten bezeichnete der Referent den Schweizer Linguisten Ferdinand de Saussure (1857-­‐1913), welcher postulierte, dass Gruppen von Konsonanten die Wurzeln aller Wörter und ein kohärentes System bilden. Wichtig sei dabei aber nicht die Beschaffenheit der Elemente, sondern die Beziehungen zwischen Ihnen. Am deutlichsten sei dies im Hethitischen erkennbar mit dem Konsonanten „H“. Er verglich die Sprachen mit einem Schachspiel: die Regeln des Spiels zeigen die Beziehungen zwischen den Elementen. Die Gestaltung der Schachfiguren kann jedoch so verschieden sein wie die Formen der Worte und Sätze. Trotzdem kann man mit allen Schachfiguren Schach spielen, wenn man die Regeln kennt. De Saussure postulierte auch sprachliche „Missing Links“, die tatsächlich gefunden wurden. Gemeinsamkeiten zwischen dem Baum des Lebens und dem Baum der Sprachen Dem Baum des Lebens und dem Baum der Sprachen sind nach Prof. Fischer drei Grundideen gemeinsam: Erstens die Idee, dass alles auf eine Urform zurückgeht. Zweitens, dass nicht mehr existierende Formen auffindbar oder rekonstruierbar sind und drittens, dass die Entwicklung von der Urform bis zu den heutigen Ausprägungen nach bestimmten Prinzipien verläuft. Anhand des Vergleichs von Gemeinsamkeiten und Unterschieden können Verwandtschaftsbeziehungen methodisch bestimmt und mit Hilfe von überlieferten Beweisstücken Vorformen konstruiert werden. Dies wird auch als „Vergleichende Rekonstruktion“ oder Textkritik bezeichnet. Was in der Biologie Fossilien sind, sind in der Sprachwissenschaft Schriftstücke aus früheren Zeiten. Bei beiden gibt es natürlich Lücken in den Überlieferungen, die durch Plausibilität und Rekonstruktion aufgefüllt werden müssen. Der Referent zeigte dies am Beispiel des Wortes „Gast“, welches in den indogermanischen Sprachfamilien mit ähnlichen Formen belegt ist, woraus die nicht belegte gemeinsame Vorform „gastiz“ konstruiert werden konnte. Unterschiede Die Unterschiede zwischen den beiden Bäumen sind aber wesentlich grösser und zahlreicher als die wenigen Gemeinsamkeiten. Während etwa Fossilien einen Zeithorizont bis zu 3,5 Milliarden Jahren dokumentieren und damit den Baum des Lebens bis zu seiner Wurzel zeigen, reichen Schriftstücke gerade mal bis in eine Zeit vor gut 5000 Jahren zurück. Die Sprache selbst dürfte aber mit Homo sapiens bis gegen 200 000 Jahre alt sein. Rekonstruktionen können vielleicht bis 10 000 Jahre zurückgehen, aber keinesfalls weiter. Man kann den Baum der Sprache deshalb nicht als zusammenhängendes Ganzes verstehen. Da die etwa 6000 Sprachen der Welt von den Linguisten in etwa 30 Sprachfamilien unterteilt werden, liegt die Vorstellung von einem gemeinsamen Stamm vorläufig im Dunkeln. Zwar gibt es bei den Sprachen wie bei Individuen Variationen, sowohl auf der Ebene der Form, der Laute und ihrer Bedeutung. In historischer Zeit habe man die Sprachen zu vereinfachen versucht. Erst durch die äusseren Einflüsse sei das Kasussystem erweitert worden, postulierte August Schleicher. So sei Sanskrit die logischste Sprache, gefolgt von Altgriechisch und Latein. Während Variationen in der Biologie aber zu unterschiedlicher Fitness selektioniert werden, findet sich bei sprachlichen Variationen kein solcher Effekt. Variationen können zwar in den Sprachen über viele Generationen hinweg stabil bleiben, oder zur Entstehung neuer Sprachen beitragen. Gerade aus den Übergängen von Latein zu den „Tochtersprachen“ Italienisch, Spanisch und Französisch sind solche Pprozesse durchaus bekannt. Ein evolutionärer Vorteil kann daraus aber für die Träger dieser Sprachen nicht herausgelesen werden, was auch Darwin einräumte. Sprachen sind Kommunikationsmittel und ihre Merkmale sichern ihnen das Überleben nicht. Vielmehr sind sie abhängig vom Überleben der Menschen, die sie sprechen. So hat es immer wieder durch Eroberungen, Verfolgungen aber auch Auswanderungen ein Aussterben von Sprachen gegeben, was mit ihrer Struktur oder Grammatik nichts zu tun hatte. Ebenso gab es Sprachwandlungen wie etwa im Englischen, die aber keinen Prinzipien von Selektion folgten. Eine Analogie zwischen sprachlicher und biologischer Evolution ist hier nicht erkennbar. Jedes Kind kann zudem eine beliebige Sprache als „Muttersprache“ erlernen, unabhängig von der Sprache seiner Eltern. Sprachliche Einheiten analog den biologischen Arten können zwar definiert werden. Doch die Kriterien zur Beschreibung des Übergangs von Varianten zu einer neuen Sprache sind schwierig und nur willkürlich zu definieren. Die Linguisten verwenden drei Kriterien: Strukturelle Unterschiede, die sich beschreiben lassen, die gegenseitliche Verständlichkeit und das Selbstverständnis bzw. der politische Wille zu einer Sprachgemeinschaft. Die strukturellen Unterschiede zeigen noch am ehesten eine Analogie zu biologischen Arten, die beiden letzteren kaum. Ein gutes Beispiel ist gerade die deutsche Sprache, die heute in drei verschiedenen Ländern gesprochen wird. Die Eigenständigkeit von Sprachen hat keine biologische Entsprechung. Sie braucht die Selbstdefinition und das Bewusstsein einer Gruppe, welche eine gemeinsame Sprache sprechen will. In der Hybridisierung zeigt sich ein weiterer Unterschied zwischen biologischen Arten und Sprachen. Die Vermischbarkeit zwischen Arten ist ausserordentlich gering und die Nachkommen daraus sind weniger lebensfähig oder unfruchtbar. Ein bekanntes Beispiel ist das Maultier als Kreuzung aus Pferd und Esel. Darwin hat ebenfalls weitere Beispiele von Hybriden als evolutionäre Sackgassen beschrieben. Dem gegenüber können sich Sprachen durch gegenseitigen Kontakt genauso wandeln wie durch genetische Entwicklung. Es gibt Entlehnungen und Angleichungen, welche die Sprache in keiner Weise negativ beeinflussen. Sie hängen wesentlich von der Intensität und Dauer des Kontaktes ab, aber nicht von der Verwandtschaft der Sprachen. Im Deutschen gibt es zahlreiche Lehnwörter aus dem Arabischen via dem Türkischen, aus dem Aztekischen via dem Spanischen und sogar aus dem Chinesischen via dem Malaiischen. Wenn Sprachen nahe beisammen in einer Region gesprochen werden und auffallende Ähnlichkeiten zeigen, bezeichnet man dies als Sprachbund. Eine maximale Vermischung über genetische Grenzen hinweg zeigt sich bei den sog. Kreolsprachen. Hybridisierung ist also bei Sprachen eher die Regel als die Ausnahme. Auch das Aussterben von Arten und Sprachen kann nicht miteinander verglichen werden. Biologische Arten sterben meist aus durch abrupte Wechsel in den Umweltbedingungen und der Konkurrenten bzw. Partner. Sprachen sind aber an Menschen gebunden, die sie sprechen und weitergeben. Sie sterben, wenn es keine Menschen mehr gibt, die sie sprechen. Dies kann eintreten, wenn ethnische Gruppen aussterben oder vernichtet werden. Die vor dem Eintreffen der Europäer in Amerika und Australien gesprochenen indigenen Sprachen starben grösstenteils aus, weil die sie sprechenden Völker ausgerottet wurden. Es kommt aber auch zu Sprachwechseln, wenn Gesellschaften freiwillig oder unfreiwillig ihre Sprache aufgeben und eine andere übernehmen. Dies geschah etwa auf den Britischen Inseln, auf denen noch vor Tausend Jahren verschiedene keltische Sprachen gesprochen wurden. Heute leben nur noch drei davon, eine Walisische und zwei Gälische. Auch hier haben aber Verfolgungen und Unterdrückung eine Rolle gespielt. Auch die Kartoffelseuche im 19. Jahrhundert zwang viele Iren zur Auswanderung, womit die Zahl der Sprecher des Gälischen weiter zurückging. 1831 wurde die Volksschule eingeführt, in welcher nur Englisch erlaubt war. Der Sprachwechselwurde damit gewaltsam implementiert. Die Bedeutung der Vielfalt muss in Biologie und Sprachwissenschaft ebenfalls unterschiedlich gesehen werden. In der Biologie ist die Biodiversität bekannt als funktionelle Notwendigkeit für Nahrungsketten und Anpassungen an unterschiedliche klimatische und ökologische Bedingungen. Eine solche Notwendigkeit gibt es für die Sprachen nicht. Theoretisch wäre eine einzige Sprache für die ganze Erdbevölkerung vorstellbar. Sprachen sind aber Ausdruck menschlicher Kultur, ihrer Diversität und Merkmale von Identität. Gemeinschaften, vergewissern sich durch Sprachen ihrer selbst. Gerade die Identität der Deutsch sprechenden Schweizer gegenüber ihren ebenfalls Deutsch, aber ein anderes Deutsch sprechenden Nachbarn ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Darwins Traum einer perfekten Klassifizierung aller Sprachen, auch der untergegangenen, analog der Klassifizierung der biologischen Arten liess sich aber nicht realisieren. 2.6 BENZ, G., Koevolution von Insekten und Pflanzen. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002) 147/3: 77-­‐91 Prof. em. Dr. Georg Benz, Zürich, Literaturbericht von Bernhard Neidhart, dipl. Ing. agr. 1. Begriffserklärung Der Begriff Koevolution basiert auf dem Grundbegriff Evolution, unter dem man in der Biologie den stammesgeschichtlichen Wandel der Organismen von einfachsten zu immer komplexeren Lebensformen versteht. Die Evolution beruht auf zufälligen Mutationen von Genen, Rekombination während der Meiose und Selektion durch Umwelt und geschlechtliche Zuchtwahl jener Individuen, die fähig sind, möglichst viele ihrer Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Dabei ist die Evolution gerichtet, obwohl sie auf ungerichteten Mutationen beruht, von denen sich zudem die m eisten im homozygoten Zustand negativ auswirken. Sie findet innerhalb und zwischen Populationen statt. Als Population bezeichnet man eine Gruppe von Organismen der gleichen Art, die sich zur gleichen Zeit im gleichen Gebiet befinden und sich untereinander bisexuell fortpflanzen. Durch fortwährende Rekombination wird die genetische Vielfalt in einer Population so gross, dass sich kaum jemals zwei genetisch identische Individuen finden lassen. Der Genbestand aller Individuen einer Population ist deren Genpool, in dem jedes einzelne Gen in einer bestimmten Häufigkeit vorkommt, die man Genfrequenz nennt. Qualitative Veränderungen des Genpools werden durch Mutationen, quantitative durch Verschiebungen der Genfrequenzen bewirkt. In nicht allzu grossen Populationen kann es relativ leicht zu Veränderungen der Genfrequenzen kommen. Man spricht dann von genetischer Drift. Eine Filialpopulation kann dann rasch beträchtliche Unterschiede zur Ausgangspopulation aufweisen. Damit verändern sich die Rekombinationsmöglichkeiten und mit ihnen die Individuen (Genotypen und Phänotypen). Die Selektion greift nicht am Erbgut selbst an, sondern am Phänotyp. Mass der Auslese ist die sogenannte Fitness. Anpassungsfähig ist eine Population, die in ihrem Genpool viele Möglichkeiten für morphologische, physiologische und (bei Tieren) verhaltensmässige Änderungen birgt. Veränderung des Genpools ist der Schrittmacher der Evolution. Deren Richtung ergibt sich daraus, dass die Umweltbedingungen eine Zuchtwahl in die Richtung verbesserter Arterhaltung treiben. Populationen können relativ rasch auf Umweltdruck reagieren. Direkt beobachtbar ist Evolution nur bezüglich kleiner Abweichungen innerhalb von Populationen, Arten oder Gattungen, sog. Mikro-­‐ oder intraspezifische Evolution. Dagegen bedarf die Makro-­‐ oder transspezifische Evolution innerhalb höherer Taxa (Familien, Ordnungen, Klassen und Stämme) sehr grosser Zeiträume. Unsere Anschauungen darüber beruhen auf paläontologischen (Fossilien) und geographischen Belegen, aber auch auf dem Vorkommen lebender «Fossile» und rudimentärer Organe sowie nachgewiesenen Homologien (z. B. Blütenorgane als umgewandelte Blätter, Mundwerkzeuge von Insekten als umgewandelte Extremitäten, homologe Makromoleküle usw.). Auch die Entwicklungsgeschichten (Ontogenese) verschiedener Taxa lassen Schlüsse auf deren Evolutionsgeschichte zu. Unter Koevolution verstehen wir nicht einfach Evolution zweier oder mehrerer Arten zu gleicher Zeit, sondern die gegenseitige evolutive Beeinflussung und gegenseitige Anpassung von Arten zu gegenseitigem Nutzen. Erst 1980 wurde Koevolution als «Evolutionsschritt einer Eigenschaft der Individuen einer Population als Antwort auf eine Eigenschaft der Individuen einer zweiten Population, gefolgt von einer evolutiven Antwort der zweiten Population auf die Veränderung in der ersten Population» definiert. Bei solch gekoppelter Evolution durch wechselseitige Auslese hat also immer ein Partner einen Vorsprung, der vom andern nachvollzogen bzw. ausgeglichen werden muss. Koevolution kann dem Betrachter als friedliche oder ästhetische Kooperation zum Nutzen aller imponieren, aber auch als Rüstungswettlauf oder als dauernde gegenseitige Bedrohung. Diese Qualitäten würden nun auch in die Geisteswissenschaften eindringen und hätten insbesondere Einfluss auf die Sozialwissenschaften. 2. Evolution der Insekten und der Blütenpflanzen Weil die Uratmosphäre der Erde noch keinen Sauerstoff enthielt, war die Erdoberfläche intensiver lebensfeindlicher Ultraviolettstrahlung von der Sonne ausgesetzt. Leben war daher nur im schützenden Wasser möglich. Erst nach der Erfindung der Photosynthese durch marine Algen gaben diese genügend UV-­‐absorbierenden Sauerstoff in die Atmosphäre ab, um Leben auch auf dem Festland zu ermöglichen. Die Landnahme von Pflanzen und Tieren vor rund 400 Mio. Jahren führte die Landlebewesen vorerst zu einem Überlebenskampf, der vielfältige Anpassungen verlangte, zugleich aber auch viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten (sog. Nischen) bot und so die Evolution neuer Lebensformen gewaltig stimulierte (adaptive Radiation der Organismen). Die Gefässpflanzen und die Insekten, die beide vor rund 380 Mio. Jahren erschienen, sind Resultate solcher Entwicklungen. Heute bilden die über 300’000 Arten von Gefässpflanzen den Hauptanteil der Biomasse der Erde, und die Insekten mit bis heute über 1,2 Mio. beschriebenen Spezies sind die artenreichste Klasse aller Lebewesen. Landpflanzen und Insekten haben sich nicht nur zur gleichen Zeit entwickelt; sie weisen z.T. auch synchron Entwicklungshöhepunkte auf, was auf gegenseitige Beziehungen hindeutet. So traten die ersten geflügelten Insekten (Eintagsfliegen, Libellen, Schaben u.a.) zur Zeit auf, als die Flora einen grossen Reichtum an baumförmigen Sporenpflanzen entfaltet hatte. Das neu erworbene Flugvermögen führte zur ersten grossen Artenentfaltung der Insekten mit Höhepunkt im Oberkarbon, als die ersten nacktsamigen Blütenpflanzen erschienen (Gymnospermen, Nadelhölzer). Eine zweite Entwicklungswelle der Insekten finden wir im Perm (286-­‐248 Mio. J.), in dem sich die holometabolen Insekten entwickelten, d.h. Insekten mit vollständiger Metamorphose über vier Stadien: aus dem Ei schlüpft eine Larve, die wächst und sich nach einer mehr oder weniger definierten Anzahl Larvenhäutungen zur Puppe häutet, aus der dann die geflügelte Imago (das Adultstadium) schlüpft. Als erste holometabole Ordnung erschienen die Käfer. Gleichzeitig wurde die Vorherrschaft der Farne durch jene der Nadelhölzer gebrochen. Mit Ausnahme der Schmetterlinge waren Ende Perm die Grundformen aller wichtigen Insektenordnungen vorhanden: Urzweiflügler, Urhautflügler usw Eine dritte Entwicklungswelle -­‐ die gewaltigste bezüglich der Entwicklung neuer Arten -­‐ finden wir sowohl bei den Insekten als auch bei den Pflanzen in der Oberkreide, nachdem zu Beginn der Kreidezeit die ersten bedecktsamigen Blütenpflanzen {Angiospermen) erschienen waren, die mehrheitlich von Insekten bestäubt wurden. Dies erlaubte es den in den Tropenwäldern verstreut wachsenden Angiospermen untereinander in genetischem Kontakt zu bleiben. Insektenbestäubung gab es übrigens schon vor der Kreidezeit bei den nacktsamigen Bennettiteen mit z. T. grossen ein-­‐ oder zweigeschlechtigen Blüten. Primitive Schmetterlinge traten als letzte Insektenordnung erst in der Kreidezeit auf. Diese Urschmetterlinge besassen noch keinen Saugrüssel, sondern beissende Mundwerkzeuge zum Kauen von Pollen. Die am besten an die Bestäubung von Blüten angepassten Familien der Zweiflügler (Schwebfliegen und Hummelschweber), der Hautflügler (Bienenartige und Wespen) und der Schmetterlinge (Eulenfalter und Schwärmer) erschienen erst im Tertiär. Über die Frage, warum die wahrscheinlich von den Samenfarnen abstammenden Angiospermen sozusagen «ohne Vorwarnung» zu Beginn der Kreidezeit auftraten und sich dann so rasch entwickelten, dass in der Oberkreide bereits mindestens 60 Familien vorhanden waren, rätselte schon Darwin und rätseln die Botaniker heute noch. Nach einer recht einleuchtenden Hypothese von HESS (1983) erlaubte das Vorhandensein eines Fruchtknotens mit Griffel und Narbe bei den Angiospermen die Entwicklung von Selbstinkompatibilitäts-­‐Mechanismen (Verhinderung von Selbstbefruchtung), was den Angiospermen dank gezielter Pollenübertragung durch Insekten und Fremdbestäubung zu besseren Rekombinationsmöglichkeiten verhalf als die ungezielte Windbestäubung (Anemogamie) den Gymnospermen. Die Angiospermen eigneten sich dadurch besser für eine Anpassung an neue Lebensräume und veränderte Klimabedingungen. Die Vögel, die sich ebenfalls während der Kreidezeit entwickelten, könnten als Samenverbreiter auf grosse Distanz ein weiterer Faktor sein, der es den Angiospermen erlaubte, sich rasch überall dort anzusamen, wo sich Gelegenheiten zur Besiedelung neuer Räume auftaten und so die weniger anpassungsfähigen Gymnospermen ins Hintertreffen zu setzen. Schon diese kurze Übersicht über die Evolution der Landpflanzen und Insekten zeigt, dass zwischen diesen Organismengruppen mehr oder weniger enge Beziehungen bestanden haben müssen und heute noch bestehen, sei es auch nur die, dass sich die sog. phytophagen Insekten von pflanzlichem Material ernähren und viele Insekten eine wichtige Rolle bei der Bestäubung der höheren Blütenpflanzen spielen. 3. Beispiele der Koevolution 3.1 Einfache Herbivorie (Pflanzenfrass) Auf komplexere Herbivorie wie Gallenbildung oder Dreiecksverhältnisse von Pflanzen mit Herbivoren und Ameisen geht der Autor im Artikel nicht ein und verweist auf die entsprechende Literatur. Die sich rasch vermehrenden Herbivorenpopulationen übten einen Druck auf die Pflanzenpopulationen aus, so dass diese Abwehrmassnahmen entwickelten. Bezüglich der Insekten sei hier nur an mechanische Abwehr durch Borsten und Haare auf der Epidermis sowie chemisch/sensorische Abwehr durch eine riesige Zahl toxischer und/oder geruchlich bzw. geschmacklich abstossender Stoffe verwiesen. Die Synthese all dieser Abwehrmittel ist für die Pflanzen aufwendig. Dies trifft besonders für die stickstoffhaltigen Abwehrstoffe zu, da deren Synthese in Konkurrenz mit der Proteinsynthese tritt, wenn Stickstoff ein begrenzender Faktor ist. Dass sich die Pflanzen diese Kosten leisten, spricht für die Wichtigkeit der Abwehr. Die Vorstellung von Koevolution der Pflanzen mit den sie fressenden Insekten, also von positiven Beziehungen zwischen diesen Partnern, die auf gegenseitiger Anpassung beruhen, scheint auf Anhieb grotesk zu sein. Man erwartet vielmehr, dass das herbivore Insekt zu seiner Wirtspflanze eine «egoistische» Beziehung pflegt und dass umgekehrt die negative Beziehung des Opfers zum Fressfeind vorherrscht. Es ist aber nicht nötig, dass koevolutive Partner voneinander uneingeschränkt profitieren; die «gemeinsamen Interessen» können darin liegen, dass beide Partner fit aus dem koevolutiven «Wettrüsten» hervorgehen. Dies verdeutlicht der Autor mit der Bestandesregelung durch Frass, mit der Überkompensation des Wachstums bei Teilfrass oder mit der raschen Regeneration (Verjüngung) bei Kahlfrass. Den Pflanzen dürfte deshalb nicht absolute Vermeidung von Herbivorenfrass, sondern optimal eingeschränkter Frass durch ausgewählte Spezialisten den grössten Selektionsvorteil bieten. Fit aus dem «Herbivoren/Pflanzen-­‐Wettrüsten» hervorgehen heisst, ein Gleichgewicht zwischen Pflanze(n) und Insekt(en) zu erreichen. Dass sich trotz der Abwehrmassnahmen der Pflanzen herbivore Insekten nicht nur erhalten, sondern auch gewaltig vermehren konnten, bedeutet, dass sie sich durch Gegenmassnahmen an die Pflanzenbedingungen anpassten. So erlaubten etwa neue Verhaltensweisen die mechanischen Abwehrmassnahmen zu umgehen. Auch wurden Mechanismen zur Entgiftung der toxischen Stoffe bestimmter Pflanzen entwickelt, entweder durch biochemischen Ab-­‐ oder Umbau und Ausscheidung der Moleküle oder durch Einlagerung der toxischen Stoffe in spezielle Zellkompartimente zum eigenen Schutz vor Rauborganismen. Die Anpassung an bestimmte Wirtspflanzen geht bei Spezialisten so weit, dass Geruchs-­‐ und Geschmacksstoffe, die Herbivoren abstossen sollen, nicht mehr repellent bzw. deterrent wirken, sondern im Gegenteil als positive Stimuli wahrgenommen werden, die als Attraktantien es dem Insekt erlauben, die spezifische Wirtspflanze oder Wirtspflanzengruppe aus Distanz zu finden und dort als Phagostimulantien (Anbeiss-­‐ und Schluckfaktoren) das Fressen bzw. als Ovipositionsstimuli die Eiablage zu stimulieren. Untersuchungen zeigen, dass Spezialisten den Abbau toxischer Pflanzensubstanzen weniger effizient betreiben als Generalisten. Damit erlangen die polyphagen Insekten eine grössere Wahlfreiheit, sozusagen als Kompensation für den geringeren Konkurrenzdruck, dem die mono-­‐ und oligophagen Spezialisten ausgesetzt sind. Offensichtlich sind verschiedenen Überlebensstrategien vorhanden. Dies führt uns zur Frage, wie weit die reziproke Anpassung von Pflanzen und Insekten zwischen einzelnen Pflanzenpopulationen und einzelnen Insektenpopulationen stattfindet, oder ob eher die «diffuse Revolution» (d.h. Koevolution diverser Pflanzenpopulationen mit diversen Insekten-­‐ und anderen Herbivorenpopulationen, eventuell auch Krankheitserregern) von grösserer Bedeutung war. Darüber weiss man noch wenig. Zweifelsohne erhöhte sich durch die zunehmende Insektendiversifizierung der Anpassungsdruck auf die Pflanzen und die Diversifizierung ihrer Abwehrstrategien. Insgesamt ergab sich daraus ein evolutives Wettrüsten zwischen Pflanzen und Insekten. Manche Pflanzen schützen sich gegen Herbivoren nicht zum vornherein durch den Einbau relativ grosser Mengen frasshemmender und/oder giftiger Stoffe bzw. mechanisch durch eine besonders zähe Epidermis oder dichten Haar-­‐ und Borstenbewuchs. Je nach Pflanzenart ist die genetische Anlage für die eine oder andere oder gar für mehrere dieser Abwehr-­‐massnahmen zwar vorhanden, wird aber nur im Mindestausmass realisiert. Erst wenn die Pflanze von Herbivoren angegriffen wird, werden die entsprechenden Gene aktiviert, d.h. die Pflanze verstärkt ihren Schutz. Der Autor hat dies bei seinen Untersuchungen am Lärchen/Lärchenwickler-­‐System schon 1961/62 beobachtet und später als Regelprinzip der zyklischen Massenvermehrungen des Lärchenwicklers bestätigen können (oberhalb von 1400 m.ü.M. sind reine Lärchenwälder nur dank des Lärchenwicklers möglich, ansonsten die übliche Baumartensukzession ablaufen würde). Vergleichende Untersuchungen am Entomologischen Institut der ETHZ veranlassten den Autor, das Prinzip zu verallgemeinern und den heute allgemein verwendeten Begriff Insect Induced Resistance einzuführen. An Nachtschattengewächsen konnte festgestellt werden, dass diese als Reaktion auf künstliche Blattverletzung einen Proteinase-­‐Inhibitor produzieren, und zwar nicht nur im verletzten Blatt, sondern auch in benachbarten Blättern. Die Forscher vermuteten, dass diese Pflanzenreaktion gegen den Kartoffelkäfer gerichtet sei. 3.2 Bestäubung entomogamer Blütenpflanzen Obwohl auch die Bestäubung von bedecktsamigen Blütenpflanzen ursprünglich auf reiner Herbivorie beruhte, ist Koevolution der Beziehungen zwischen entomogamen (insektenbestäubt) Angiospermen (bedecktsamige Blütenpflanzen) und ihren bestäubenden Insekten viel offensichtlicher als bei der einfachen Herbivorie. Bei der entomogamen Blütenbestäubung profitieren eindeutig beide Partner: die Pflanze, weil sie durch das Insekt befruchtet wird, das Insekt, weil es von der Pflanze Nahrung erhält (zuckerhaltigem Nektar, eiweissreichem Pollen, Öle, etc.). Obwohl der Begriff Koevolution erst 1964 geprägt wurde, hatte DARWIN (1862) schon recht klare Vorstellungen von gekoppelter Evolution, denn als er erfuhr, dass in Madagaskar eine Orchidee mit einem anderthalb Fuss langen Nektarsporn existiere, sagte er voraus, dass somit in Madagaskar ein Insekt vorhanden sein müsse, das einen ebenso langen Rüssel habe, also wahrscheinlich e in F alter. D iese V oraussage h at s ich 1 903 m it d er E ntdeckung d es e ntsprechenden Falters erfüllt. Mit seinem langen Rüssel kann dieser Schwärmer den tief versenkten Nektar der Orchidee schöpfen und die Blüte bestäuben. Im gegebenen Fall haben sich die Orchidee und der Schwärmer wechselseitig so stark aneinander angepasst, dass jede der beiden Arten ohne die andere auf die Dauer nicht überleben könnte. Aufgrund des Istzustandes können wir uns gut vorstellen, was Pflanzen und Insekten alles «unternahmen», um die Entomogamie zu entwickeln und zu perfektionieren, u.a.: •
•
•
•
•
•
•
klebrige Pollen führen zu gezielterer, effizienterer Bestäubung als bei Windbestäubung energiespendender Nektar als Ersatz für proteinreichen Pollen ist sparsamer und braucht auch keine speziellen Mundwerkzeuge, was eine grössere Vielfalt von bestäubenden Insekten (Pollinatoren) ermöglicht selektive Düfte, teils zeitlich beschränkt, selektiert die Pollinatoren und reduziert den Aufwand der Pflanze optische Signale gekoppelt mit einem unterschiedlichen Aufbau der Blüte selektieren die Pollinatoren Zwitterblütigkeit erhöht die Erfolgsaussichten der Pollenübertragung indem ursprünglich getrenntgeschlechtige Blüten zur Zwitterblüten vereinigt wurden versteckte Nektarquellen selektiert sehr stark, da adäquate Saugorgane ausgebildet sein müssen zygomorphe Blüten wirken sehr selektiv, da die Blüten-­‐ der Körperform des Pollinators angepasst ist Die aufgezählten Merkmale können in Form einer extremen Koevolution letztlich dazu führen, dass das Überleben zweier Arten davon abhängt, dass beide Arten gleichzeitig am gleichen Ort leben. Im umgekehrten Fall führt es zum Aussterben einer oder beider Partner. Die Anpassung des einen auf den anderen Partner (z.B. langer Rüssel für versteckten Nektar) wird in Wirklichkeit nicht gemacht, sondern sie passiert. Und wenn sie passiert, wird es der Pflanze nur dann zum Vorteil gereichen, wenn sich der eine oder andere potenzielle Bestäuber an die neuen Verhältnisse anpassen kann und zudem der Pflanze sicherere Fremdbestäubung gewährleistet. Gleichzeitig sollte auch das bestäubende Insekt davon profitieren (z.B. weil es eine Ressource mit weniger Konkurrenten teilen muss). Insgesamt sollten Pflanze und Insekt gegenüber dem Rest der Lebensgemeinschaft einen Selektionsvorteil haben. Andernfalls ist es ein misslungener Versuch der Natur unter den gegebenen Umständen. Unter anderen Umständen hätte sich der gleiche Versuch eventuell positiv ausgewirkt. In diesem Sinn ist die natürliche Auslese weder zufällig noch ungerichtet. Der Selektionsdruck schiebt die genetische Zusammensetzung einer Population in eine Richtung, wobei der Grad der Fitness richtungweisend ist. 2.7 SCHALLER, A., Die Abwehr von Fressfeinden: Selbstverteidigung im Pflanzenreich. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002), 147/4:141-­‐150 Dr. Andreas Schaller, ETH Zürich, Institut für Pflanzenwissenschaften, Zürich 2002 Literaturbericht, wb Vor 135 Millionen Jahren traten die ersten bedecktsamigen Blütenpflanzen (Angiospermen) auf. 70 Millionen Jahre später, gegen Ende der Kreidezeit, waren sie bereits vorherrschend und von den 300 000 Pflanzenarten, die heute bekannt sind, machen die Angiospermen 250 000 Arten aus. Mit ihrer Vielfalt boten sie den Insekten eine Unzahl von Nischen und deren Besiedelung beschleunigte die Evolution im Sinne der Koevolution. Da die meisten Blütenpflanzen durch Insekten bestäubt werden, haben sich die unterschiedlichsten Blütenformen in Anpassung an die verschiedenen Formen und Ernährungsweisen der Insekten herausgebildet und umgekehrt. Ähnliche wechselseitige Anpassungen haben sich auch entwickelt zwischen Pflanzen und herbivoren Insekten, also den Fressfeinden der Pflanzen. Der Autor stellt die Möglichkeiten der Pflanzen dar, den Fressfeind abzuwehren und Resistenz gegen ihn zu entwickeln. Gleichzeitig erläutert er, welche biochemischen und molekularen Vorgänge dieser Abwehr zugrunde liegen, und wie sie experimentell untersucht werden können. Schaller arbeitete vor allem mit dem Kartoffelkäfer, welcher wie die meisten herbivoren Insekten oligophag ist, d.h. nur einige ausgewählte Pflanzenarten frisst. Er scheint auf Solanaceen angepasst zu sein, wobei innerhalb dieser Gattung verschiedene Resistenz gegen ihn besteht. Anderseits sind Kartoffelpflanzen resistent gegen die meisten anderen Schädlinge. Die Resistenzmechanismen der Pflanze fallen in drei Kategorien: Mechanisch – chemisch – biologisch. Anderseits können sie ständig ausgeprägt, „konstitutiv“ sein, oder sie können durch den Befall mit dem Schädling ausgelöst werden, was als „induziert“ bezeichnet wird. Induzierte Mechanismen wiederum können sich direkt gegen den Schädling richten, oder sie können indirekt wirken, indem die natürlichen Fressfeinde der Schädlinge von der Pflanze unterstützt werden. Mechanische Resistenzfaktoren sind etwa verholzte Zellwände, Dornen und Stacheln, aber auch feine Haare auf den Blättern (Trichome), in denen oft mechanische und chemische Elemente vereinigt sind. Dies ist etwa im Brennhaar der Brennnessel der Fall. Bei Berührung bricht die Spitze des Haares ab und der verbleibende Schaft wirkt als Injektionskanüle, womit dem Schädling Histamin, Acetylcholin und Ameisensäure eingespritzt wird. Dieser Faktor ist sowohl konstitutiv wie auch induziert, da nach einer Verwundung der Brennnessel die Dichte der Brennhaare auf den Blättern zunimmt. Chemische Resistenzfaktoren beeinflussen die Auswahl der Wirtspflanze, die Eiablage und das Fressverhalten der Insekten. Neben dem Primärstoffwechsel, welcher für die Lebensvorgänge essentiell ist, verfügen die Zellen über einen Sekundärstoffwechsel, welcher für das Zusammenspiel der Zellen und die Interaktionen mit der Umgebung zuständig ist. Er produziert z.B. die Blütefarbstoffe oder die Abwehrgifte einer Pflanze. Man kennt heute gut 100 000 sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Sie können auf Insekten abschreckend wirken durch ihren Geruch und Geschmack, anderseits sind viele davon toxisch. Der Mensch macht sich dies bekanntlich zu Nutze. Dazu gehören etwa Alkaloide wie Nikotin, Morphin, Strychnin oder Chinin. Auch Terpenoide findet man, wie das Menthol der Minze, das Gossipol der Baumwolle oder Digitoxigenin des Fingerhuts. Schliesslich müssen die Phenole genannt werden, wie Tannine oder Cumarin. Allerdings sind diese Substanzen meist nicht nur für das Insekt sondern auch für die Pflanze selbst toxisch. Sie werden deshalb in einer ungiftigen Vorstufe in der Vakuole gelagert. Bei Verletzung der Zelle und der Vakuole kommt diese Vorstufe in Kontakt mit einem Enzym, welches die weiteren Reaktionen zur Bildung der Wirksubstanz einleitet. Biologische Resistenzfaktoren arbeiten unter Einbezug der natürlichen Fressfeinde der Frass-­‐Schädlinge. Der Autor erwähnt zwei bekannte Beispiele. Einmal die Symbiose von Baumakazien und Ameisen in Afrika und Zentralamerika. Die Ameisen leben in hohlen Dornen der Baumakazien. Es sind sehr aggressive Ameisen, welch die herbivoren Insekten, die den Baum befallen, angreifen. Der Baum profitiert also davon und stellt den Ameisen dafür einen zuckerreichen Nektar zur Verfügung. Solche gegenseitige Abhängigkeiten haben sich im Laufe der Evolution unabhängig voneinander mehrfach entwickelt. Bei uns kennt man das zweite Beispiel als Abwehrreaktion von Kohlpflanzen gegen den Kohlweissling. Die Larve des Kohlweisslings ernährt sich nur von Kohl und hat gegen dessen Abwehrsubstanzen Resistenz entwickelt. Die Pflanze ist also auf Hilfe angewiesen und ruft eine Wespe herbei (Cotesia glomerata). Diese Wespe legt als Parasitoid ihre Eier in die Raupe des Kohlweisslings, die dann den Wespenlarven als Wirt dient. Wie ruft nun die Kohlpflanze die Wespen herbei: Sie synthetisiert bei Verletzung sozusagen als Wundreaktion flüchtige Substanzen, Duftstoffe, welche der Wespe die Anwesenheit von herbivoren Larven signalisieren. Wundreaktionen von Pflanzenblättern spielen die Hauptrolle bei der Induzierten Resistenz. Die biochemischen und molekularen Vorgänge dieses Mechanismus erläutert der Autor anhand der Solanaceen, speziell der Tomatenpflanzen. Nach Befall durch Kartoffelkäfer und mechanischer Verwundung synthetisiert die Tomatenpflanze einen Proteinase-­‐Inhibitor (PI). Dieser ist in der Lage, im Verdauungstrakt der Insekten die Verdauungsenzyme Trypsin und Chymotrypsin zu inaktivieren. Damit kommt es im Insekt zu Mangelerscheinungen, womit sich Wachstum und Entwicklung verzögern. Schaller konnte zeigen, dass eine ganze Reihe weiterer Abwehrproteine gebildet werden, die gemeinsam zur induzierten Resistenz beitragen und er hat Modelle entwickelt, wie es in der Pflanze zur Akkumulation dieser Proteine kommt. Durch eine verstärkte Expression und Transkription der Gene für die Abwehrproteine entsteht eine Anhäufung von Messenger-­‐RNAs, welche im Prozess der Translation in Abwehrproteine übersetzt werden. Da diese Prozesse sowohl in verwundeten wie in unverwundeten Blättern ablaufen, wurde ein Botenstoff postuliert, welcher am Ort der Verwundung entsteht und über die ganze Pflanze verteilt wird. Dieser Stoff wurde 1991 gefunden und hört auf den Namen Systemin. Es ist ein Oligopeptid aus 18 Aminosäuren und hat eine hormonähnliche Wirkung. Auch das Gen für Systemin wurde charakterisiert. Es codiert für ein grösseres Vorläuferprotein, das Prosystemin, welches aus 200 Aminosäuren besteht. Experimente zeigten, dass Prosystemin und Systemin bei der Vermittlung der Wundreaktion eine zentrale Rolle spielen und dazu notwendig, aber auch ausreichend sind. Versuche mit transgenen Tomatenpflanzen, bei denen die Expression von Prosystemin im Genom ausgeschaltet wurde, brachten nämlich Pflanzen mit fehlender Resistenz gegen herbivore Insekten hervor. Die Induktion der Abwehrproteine im Zielgewebe der Blätter durch Systemin läuft indessen über mehrere Rezeptoren und Zwischensubstanzen ab. Der Mechanismus ist zwar seit 1992 einigermassen bekannt, lässt aber immer noch viele Fragen offen. Vor allem lasse sich die induzierte Resistenz nicht losgelöst von der Resistenz der herbivoren Insekten gegen die Abwehrproteine betrachten, betont der Autor am Schluss des Artikels. Im Interesse einer umweltverträglichen, nachhaltigen Landwirtschaft ohne Einsatz von Pestiziden müssten noch viele Fragen geklärt werden. 2.8 KLÖTZLI, F., Verbindende Elemente in der Vegetation: Konvergenz – Koevolution – Synevolution. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2005) 150/1-­‐2:33-­‐45 Prof. em. Dr. Frank Klötzli, Zürich, Literaturbericht, wb Evolution im Sinne von Entwicklungsgeschichte der Lebewesen ist ein international bekannter Forschungs-­‐gegenstand auf dem Platz Zürich. Die Arbeiten von Prof. Klötzli beinhalten die seltener diskutierte Synevolution als verbindendes Element der Koevolution im Pflanzenreich. Die Evolution von Einzelorganismen ist immer mit Nachbarorganismen verbunden, die ähnliche Ansprüche an die Umwelt stellen. Synevolution bedeutet das Phänomen, dass unter ähnlichen Bedingungen unter konvergenter Entwicklung ähnliche morphologisch-­‐physiologische pflanzliche Strukturen und Vegetationstypen entstehen. Es ist eine Evolution, die in Pflanzengesellschaften an ähnlichen Standorten in eine ähnliche Richtung verläuft und das ähnliche Bild bestimmt, das innerhalb eines jeden Bioms vorherrscht. Synevolution erlaubt damit eine gewisse Vorausschau bei der Entwicklung gestörter Ökosysteme, indem die Auslenkung gewisser Standortfaktoren zur Veränderung bestimmter Strukturen führt. Konvergenz beschreibt der Autor als Ausbildung einer Pflanze oder einer Pflanzengesellschaft zu ähnlicher Physiognomie bei ähnlichen Standort-­‐ oder Lebensbedingungen und kommt in allen Biomen vor, aber auch in der Zoologie etwa zwischen Placentaliern und Marsupialiern (Beispiel: Wolf – Beutelwolf oder Maulwurf – Beutelmull). Koevolution wird seit 1964 definiert als sich gegenseitig beeinflussende Evolution oder als gegenseitiger Evolutionsdruck in einer engen physiologischen Beziehung unter genetischer Rückkoppelung. Anhand von Beispielen aus den Hochstauden, den Zwergsträuchern sowie den Horst-­‐ und Büschelgräsern, welche miteinander in Biomen in Koevolution leben, zeigt Prof. Klötzli eine globale Synevolution gemeinsamer Strukturmerkmale. Seine Übersicht betrifft die Biome der nördlichen Hemisphäre und zwar des sommergrünen Laubwaldes, des nördlichen Nadelwaldes und der Taiga, der Steppe, der südlichen Tundra und des warmtemperierten bis subtropischen Lorbeerwaldes. Hochstauden als wenig verholzte, hochwüchsige Kräuter haben ihr Schwergewicht im Raum von Taiga, Steppe und am Rande von Tundragebieten sowie in feuchteren Biomen. Ihre Südgrenze liegt in den subtropischen bis warmtemperierten Lebensräumen. In Lorbeerwäldern und tropischen Regenwäldern sind sie durch baumförmige Bananengewächse ersetzt. Je nach Temperatur-­‐ und Feuchtigkeitsbereich finden sich verschiedene Arten, die vom Autor in einer Synthese aufgelistet wurden. Er misst dem Energieaufwand für die Produktion der Pflanze eine grosse Bedeutung bei. Dieser ist für Hochstauden gering, weil Blätter und Stengel weich sind und weil immer genügend Wasser und Nähstoffe zur Verfügung stehen. Wo Hochstauden vorkommen, herrscht eine gute Zufuhrlage, aber eher basischer Boden. Grasartige sind verbreitet in der Steppe, im Laub-­‐ und Nadelwald, in Taiga und im Hartlaubbereich und sehr stark auch in den tropischen Biomen. Grasphasen erscheinen auch bei Störungen in diesen Biomen, etwa durch Feuer, Auflichtung oder Wildverbiss. Der Lichtgenuss ist für Büschelgräser neben einem basischen Boden ein wichtiger Standortanspruch. Die Typisierung erscheint an denselben Übergangsstellen wie bei Hochstauden. Die Gruppe der Zwergsträucher, v.a. der lederblättrigen bis laubwerfenden Ericaceae (Preisel-­‐ Moor-­‐ und Heidelbeere), ist generell in feuchten Gebieten zu finden, wie in Heiden, in der Taiga und noch in Hartlaubwäldern, und gerade dort, wo winterlicher Frost und unverhoffte Temperaturstürze auftreten, sowie generell in sauren Böden. Unter günstigen Bedingungen kann ein Zwergstrauch grösser werden und gehört dann oft schon zur Domäne der immergrünen Baumförmigen, etwa in den Lorbeerwäldern Zentralasiens. Der Energieaufwand ist für den typischen Zwergstrauch sehr hoch, da die Blätter auch bei Frost und Dürre dauerhaft sein und auch in mageren Standorten überleben müssen. Klötzli interessiert sich speziell für die Reaktionen dieser Pflanzengruppen bei Auslenkungen der Standortbedingungen durch Trockenheit, Überflutung, Veränderung der Bodenreaktion, der Nährstoffe, des Lichtfaktors oder durch Wildverbiss. Hochstauden erweisen sich als sehr regenerationsfähig, weil sie nach Welkung noch hohe Reserven im Wurzelstock haben. Nach Verbiss entwickeln sie Seitentriebe, welch das Wild abhalten. Sie reagieren sehr empfindlich auf Frost, haben aber je nach Schneelage die Möglichkeit der Regeneration aus dem Wurzelstock oder aus Seitentrieben. Die Zwergsträucher sind wie erwähnt weniger empfindlich auf Frost und haben zudem die Fähigkeit der Peinomorphose: Bei Düngung werden grössere und weichere Blätter gebildet, bei Trockenheit hingegen harte und kleine. Bei starkem und langem Frost sind dagegen die Ausfälle grösser, da kaum Reserven vorliegen. Auf Verbiss reagieren sie mit dichterem Wuchs, was auch für Gräser gilt. Diese schützen das Meristem bei Kälte durch Überdeckung mit toten Blättern. Sowohl Hochstauden wie Zwergsträucher sind natürlich mit vielen weiteren Pflanzen vergesellschaftet. Trotzdem erlaubt die Synevolution eine gewisse Vorausschau bei Auslenkungen von Standortfaktoren. So ist etwa bekannt, dass in Wiesen durch Nährstoffzufuhr eine Verhochstaudung eintritt. Durch sauren Regen kommt es anderseits zu Veränderungen in der Bodenreaktion und zu Verstrauchung oder Verhagerung der anthropogen veränderten Wälder. Die Auslenkung des Wasserfaktors führt in beiden Richtungen zur Vergrasung. Die Veränderungen der Atmosphäre haben Zustände mit sich gebracht, die es während der gesamten Evolution bisher nicht gegeben hat. Veränderungen durch treibhausaktive Schadgase, chemische Hilfsstoffe, höhere Temperatur sowie die grosse Dünge-­‐ und Schwermetallfracht sollten mit Hilfe der Kenntnisse der Synevolution früh erkannt werden, um rechtzeitig Gegenmassnahmen einleiten zu können. 2.9 BLANCKENHORN, W.U.: Die Evolution der Körpergrösse und des geschlechtlichen Grössendimorphismus. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002) 147/3:99-­‐106 PD Dr. Wolf U. Blanckenhorn, Zoologisches Museum der Universität Zürich, 2002 Literaturbericht, wb Unterschiedliche Grössen von Organismen zeigen sich überall in der Natur, vom kleinsten Mikroorganismus bis zum grössten Wirbeltier, dann auch innerhalb der einzelnen Gattungen und Arten und schliesslich bei getrennt-­‐geschlechtlichen Organismen als männlich-­‐weiblicher Grössendimorphismus. Der Autor zeigt in dieser Arbeit die evolutionsbiologischen Ursachen dieser Grössenunterschiede und die wichtigsten ökologischen und genetischen Einflussfaktoren. Er weist darauf hin, dass die „genetische Drift“ als ein ungerichteter Prozess der zufälligen Mutationen unterschieden werden muss vom gerichteten (aber nicht zielgerichteten, teleologischen) Prozess der Selektion von Merkmalen durch gegebene Faktoren wie selektive Paarung, Fressfeinde oder Umweltbedingungen. Die letztere Evolutionsursache ist dafür verantwortlich, dass Merkmale einer Population von Generation zu Generation systematisch verstärkt oder abgeschwächt werden. Man spricht dann von Anpassung bzw. von einem adaptiven Merkmal. Die natürliche Selektion führt offenbar dazu, dass unterschiedliche Grössen evoluiert werden, womit unterschiedliche ökologische Nische besetzt werden können und die Konkurrenz um die Ressourcen kleiner wird. Die Körpergrösse einer Art als Durchschnittsgrösse eines adulten Individuums ist determiniert bei Säugetieren, Vögeln und Insekten. Andere Organismen hören nicht auf zu wachsen wie z.B. die meisten Pflanzen, Fische, Reptilien, Würmer oder Stachelhäuter. Ihre Wachstumrate wird aber mit dem Alter kleiner. Die Körpergrösse wird von vielen Genen gleichzeitig beeinflusst und hat also eine erbliche und anderseits eine Umwelt-­‐Komponente, wie Ernährung oder Temperatur. Die Erblichkeit schwankt um 30-­‐40% und die Körpergrösse kann sich deshalb bei hohem Selektionsdruck relativ schnell ändern. Der höhere Anteil der Variabilität ist gemäss Blanckenhorn aber umweltbedingt und kann in Bezug auf Ernährung und Temperatur systematisiert werden. Schlechte Ernährung resultiert immer in kümmerlichem, langsamem Wachstum, kleiner Körpergrösse und hoher Sterblichkeit. Die Temperatur kann verschiedene Effekte zeigen. Einerseits ist die „Bergmann-­‐Regel“ (1847) bekannt, wonach gleichwarme Organismen gegen den Pol zu grösser werden. Der Grund sei physiologischer Natur, da das Verhältnis von Körpergrösse und Volumen bei grösseren Tieren günstiger sei zur Erhaltung der Körpertemperatur. Es gibt aber offenbar auch Beispiele bei wechselwarmen Tieren, wo gegen den Pol zu gerade kleinere Individuen angetroffen werden. Man führt diesen Effekt auf die kürzeren Vegetations-­‐ und damit Wachstumsperioden in den kalten Regionen zurück. Die meisten Tierarten bilden zwei Geschlechter aus, wobei die Männchen und Weibchen oft unterschiedlich gross sind (Körpergrössendimorphismus). Bei den Säugetieren sind die Männchen grösser, bei Spinnen hingegen die Weibchen, bei den Vögeln wiederum sind beide Geschlechter etwa gleich gross. Ein Unterschied scheint dann zu resultieren, wenn er zu einem besseren Reproduktionserfolg führt oder mit einem unterschiedlichen evolutionären Gleichgewicht verbunden ist. Grössere Weibchen können mehr und besseren Nachwuchs hervorbringen (Fertilitätsvorteil), grössere Männchen haben gegenüber ihren Konkurrenten einen Paarungsvorteil. Da die Grösse eine erbliche Komponente hat, sollten beide Geschlechter im Lauf der Evolution grösser werden, aber nicht unabhängig voneinander. Ein grösserer Körper hat auch Nachteile. Er braucht eine längere Entwicklungszeit bis zur Reproduktionsfähigkeit, ein schnelleres Wachstum verbraucht mehr Ressourcen und ein grösseres Gewicht macht das Individuum schwerfälliger und auffälliger für Fressfeinde. Es gibt also auch einen negativen Selektionsdruck für grössere Individuen. Daraus resultiert ein Gleichgewicht, in welchem offenbar bei Säugetieren der männliche Paarungsvorteil gegenüber dem weiblichen Fertilitätsvorteil überwiegt. Der Autor hat die verschiedenen Selektionsdrucke im Laborexperiment mit verschiedenen Fliegen verglichen. Die sexuelle Selektion, welche grössere Männchen bevorteilt, war zwar immer stärker als der Fertilitätsvorteil der grösseren Weibchen. Trotzdem sind bei der gelben Dungfliege die Männchen, bei der Schwingfliege hingegen die Weibchen grösser. Beim gegenwärtigen Forschungsstand kann der Autor deshalb erst aussagen, dass die grössere Männchen bevorteilende sexuelle Selektion auffällig stark, aber auch sehr variabel ist und als treibende Kraft des Körpergrössendimorphismus angesehen wird. Er erwähnt dazu auch die „Regel nach Rensch“ (1950), wonach der Grössendimorphismus mit zunehmender Grösse einer Tierart mehr in Richtung grössere Männchen verschoben ist. Die Grösse der Männchen evolviert bei grossen Arten offenbar schneller als diejenige der Weibchen, was aber immer noch eine ungeklärte phylogenetische Rahmenbedingung sei. 2.10 WARD, P. I., Die Ko-­‐Evolution der Geschlechter. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002) 147/3:93-­‐97 Prof. Dr. Paul I. Ward, Zoologisches Museum der Universität Zürich Literaturbericht, wb Die geschlechtliche Fortpflanzung wird traditioneller-­‐weise als kooperativer Akt verstanden und Männchen und Weibchen haben auch klare gemeinsame Interessen dabei. Prof. Ward zeigt in seiner Arbeit aber, dass einige massgebliche Konflikte zwischen den beiden Geschlechtern involviert sind, welche die Physiologie, die Morphologie und die Fortpflanzungsweise beeinflussen. Die Konflikte kommen eigentlich daher, dass ein Weibchen sich nach der Fortpflanzung mit einem Männchen später wieder mit anderen Männchen paaren kann. Die verschiedenen Nachkommen sind für das Weibchen von gleicher Bedeutung für seinen gesamten Fortpflanzungserfolg. Für das Männchen liegt das Interesse aber anders, da nur seine eigenen Nachkommen seine Gene weitergeben. Nach der Theorie der natürlichen Selektion sind Gene, die schon früher erfolgreich waren, im evolutiven Interesse ihrer Träger. Es haben sich in der Folge bei vielen Tierarten gegenläufige Adaptationen entwickelt, welche die Befruchtungs-­‐vorgänge kontrollieren. Das Weibchen kann seine Ressourcen in ihre ersten Nachkommen, in ihr eigenes Überleben oder in eine zweite oder dritte Nachkommenschaft investieren und aufteilen. Das evolutive Interesse des Männchens ist es aber, dass das Weibchen alle Ressourcen in seine eigenen Nachkommen investieren soll. Weitere Befruchtungen mit anderen Vätern sind für das erste Männchen bedeutungslos. Es ist viel mehr daran interessiert, dass sein Nachwuchs grösser und zahlreicher wird, als es vom mütterlichen Interesse her optimal wäre. Dieser Konflikt ist auf der Ebene der Gene als „genomische Prägung“ (Imprinting) verankert: Es gibt Wachstumsgene, die als von Mutter oder Vater geerbte Allele verschieden aktiv bzw. eingeschaltet sind. Die meisten von ihnen sind bei Säugetieren und Taufliegen, aber auch bei Samenpflanzen auf dem X-­‐Chromosom lokalisiert. Sie beeinflussen bestimmte Wachstums-­‐proteine. Es haben sich aber auch Gene evoluiert, die gegen diese unterschiedliche Funktion von mütterlichen und väterlichen Allelen wirken. Diese Gene sind meist auf den Y-­‐Chromosomen lokalisiert. Die X-­‐ und Y-­‐Chromosomen können wiederum ungleichmässig an die nächste Generation weitergegeben werden („Meiotic drive“). Der Autor hat die kurz-­‐ und langfristigen evolutiven Vorgänge der sexuellen Konflikte an der Taufliege Drosophila melanogaster untersucht. Bei der Kopulation werden nicht nur Spermien sondern auch akzessorische Moleküle („Sexpeptide“) auf das Weibchen übertragen. Diese arbeiten im Interesse des Männchens, indem sie im Hirn des Weibchens bewirken, dass dieses mehr Eier legt, im Weiteren weniger mit anderen Männchen kopuliert und eine verkürzte Lebensdauer hat. Die Weibchen ihrerseits können über ihr Nervensystem bestimmen, in welcher Eiablage die Spermien gelagert werden sollen und welche Spermien zur Befruchtung der Eier gelangen. Ward berichtet auch von anderen Forschern, die Experimente machten mit Taufliegen, die nur mit einem Männchen zur Kopulation zugelassen wurden. Nach 47 Generationen hatten die Weibchen eine deutlich längere Lebensdauer, da offenbar der Selektionsdruck für die Männchen weggefallen war und sie adaptiv keine oder weniger akzessorische Peptide ins Weibchen einschleusten. Ward schliesst daraus, dass das Fortpflanzungssystem einer Tierart evolutive Konsequenzen für ihre Physiologie und Verhaltensweise haben kann. Ward arbeitet selbst am meisten mit der gelben Dungfliege. Die Weibchen der Dungfliege legen ihre Eier in frischen Kuhfladen. Die daraus schlüpfenden Larven ernähren sich vom Dung und bauen ihn ab. Die anfliegenden Weibchen werden aber auf dem Dung bereits von Männchen erwartet und zur Kopulation gezwungen, bevor sie ihre Eier ablegen können. Die Weibchen haben aber bereits Spermien anderer Männchen in ihren Spermatheken gelagert und können nun mit ihren akzessorischen Fortpflanzungsdrüsen die Verteilung der Spermien auf die Eier steuern. Sie müssen aber die Kopulation mitmachen, damit sie danach die Eier unter der Aufsicht der Männchen in den Dung ablegen können. Der Befruchtungserfolg der Männchen hängt davon ab, wie ähnlich es dem Weibchen in einem bestimmten Enzym ist. Unter konstanten Umweltbedingungen wählen die Weibchen diejenigen Spermien, die ihnen in diesem Enzym gleichen. Unter variablen Umweltverhältnissen wählen sie darin unähnliche Spermien. Somit kann das Weibchen den Genotyp der Nachkommen an die Umwelt anpassen. Die Männchen können ihrerseits ihren Fortpflanzungserfolg über die Anzahl und Länge ihrer Spermien beeinflussen, welche genetisch bedingt verschieden ist. Interessanterweise, so erwähnt Ward, scheinen die Gene für die Länge der Spermien ebenfalls auf dem Geschlechtschromosom zu liegen. Die Anzahl der Spermien wird durch die Grösse der Hoden bestimmt. Ward konnte experimentell zeigen, dass sich die Hoden der mit mehreren Paarungspartnerinnen (polyandrisch) gezüchteten Männchen im Verhältnis zu „monogam“ gehaltenen Männchen bereits nach zehn Generationen vergrösserten. Er sah auch, dass unter Polyandrie Merkmale evolvieren, die den Männchen bessere Fähigkeiten geben, die Fortpflanzung in ihrem Interesse zu kontrollieren. Auch bei polyandrisch gezüchteten Weibchen zeigte sich über die Generationen eine Vergrösserung ihrer akzessorischen Drüsen, die ihnen eine Auswahl der geeignetsten Spermien ermöglichen. Der Autor sieht auch darin ein Beispiel, wie Physiologie und Verhaltensweisen unter unterschiedlichen Bedingungen evoluieren können. 2.11 SCHMID-­‐HEMPEL, P., Koevolution und die Rote Königin. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002) 147/3:107-­‐114 Prof. Dr. Paul Schmid-­‐Hempel, ETH Zürich, Ecology & Evolution Literaturbericht, wb Der Autor geht in dieser Arbeit drei wichtigen Fragen nach: l. Wie wird die genetische Variation in natürlichen Populationen aufrechterhalten 2. Wie agieren die Genotypen von Wirten und Parasiten miteinander und welche Bedeutung hat dies für die Selektion 3. Welches ist die Ursache für die Evolution und Aufrechterhaltung der sexuellen Fortpflanzung Prof. Schmid-­‐Hempel stellt seinen Ausführungen einen bezeichnenden Satz des Evolutionsbiologen J.B.S. Haldane aus dem Jahr 1949 voran: Eine Maus kann viel leichter einen Gensatz erhalten, welcher sie vor dem Bacillus typhimurium schützt, als einen Satz, der sie fähig macht, einer Katze zu widerstehen. Zuerst beschreibt er aber die Bedeutung der Variationen innerhalb von Populationen. Nach Darwin beruhen evolutive Veränderungen auf der Auswahl von Variationen durch die natürliche Selektion, etwa von Umweltbedingungen. Die ausgelesenen Variationen müssen aber auch erblich sein, damit Veränderungen in weiteren Generationen erhalten und weitergegeben werden können. Auf die Körpergrösse bezogen heisst das, dass grosse Eltern auch grosse Nachkommen haben müssen, damit es durch die Selektion zu einer Verschiebung des Merkmals „Körpergrösse“ kommt. Für die Körpergrösse sind Gene zuständig, welche in einer Population als Allele in verschiedenen Ausprägungen vorkommen. Die Gesamtheit der Allele repräsentiert die genotypische Variation für bestimmte Merkmale. Die evolutive Veränderung der Körpergrösse resultiert also auf einer Verschiebung der Häufigkeit von Allelen. Umwelteinflüsse auf die Körpergrösse, wie die Ernährung, lässt der Autor für diese theoretische Betrachtung weg. Hingegen erwähnt er, dass Veränderungen schneller eintreten, wenn die Zahl der Variationen eines Gens grösser ist. Wenn nun aber die Körpergrösse stetig zunimmt, müssten die Allele für kleine Individuen mit der Zeit abnehmen oder gar verschwinden und das Evolutionsgeschehen würde zum Stillstand kommen. Dies ist in den letzten 4 Milliarden Jahren aber nicht eingetreten, und die Variationen in natürlichen Populationen sind heute erstaunlich hoch. Welche Prozesse sind dafür verantwortlich? Einerseits sind es die spontanen Mutationen in den Genen, welche immer wieder neue Variationen und Allele erzeugen. Die Wirkung dieses Prozesses sei aber schwach, betont der Autor. Nur 1 aus 1 Million Zellteilungen führt zu einer Gamete, welche ein neues Allel trägt. Bei Bakterien und Viren, die in kurzer Zeit grosse Populationen bilden, sei dies wohl von Bedeutung, nicht aber Säugetieren oder Vögeln. Gerade die riesige genetische Variation von Allelen, welche die biochemischen Prozesse in einem Organismus steuern, kann nicht mit spontanen Mutationen erklärt werden. Ein weiterer Mechanismus zur Erhaltung der Variationen besteht in der periodischen Umkehrung von Selektionsbedingungen wie etwa Dürre und Feuchtigkeit oder Wärme und Kälte im Klima. Die Selektionsrichtung wird dadurch immer wieder geändert, so dass beim Beispiel der Körpergrösse abwechslungsweise grosse und kleine Individuen begünstigt werden. Damit gehen weder die Allele für grossen noch für kleinen Wuchs je verloren. Dies funktioniert aber nur bei idealen zeitlichen Bedingungen in der Umkehr der Umweltfaktoren. Die jüngste, von Haldane in seinem Satz mit der Maus propagierte Theorie zur Erhaltung der Variationen stellt Schmid-­‐Hempel nun vor als wechselseitige Selektion durch koevoluierende Parasiten. Als Beispiel kann man die Antibiotikaresistenz von Krankheitserregern anführen. Wenn pathogene Keime resistent werden gegen Antibiotika, sucht die Forschung nach neuen Medikamenten, auf welche die Mikroorganismen wiederum mit neuer Selektion von resistenten Individuen reagieren. Dies trägt zur Erhaltung der Variationen innerhalb der Populationen der Erreger bei. Dasselbe geschieht aber auch im Immunsystem des Wirtes, z.B. des Menschen, indem auf neue Genotypen der Parasiten mit der Selektion von passenden Abwehrzellen geantwortet wird. Die Interaktion von Wirt und Parasit begünstigt also bei beiden die Aufrechterhaltung von genetischen Variationen. Es resultiert dann daraus der sog. „Red-­‐
Queen“-­‐Prozess nach folgender Vorstellung: Ein Parasit kann genetisch auf einen bestimmten Genotyp eines Wirtes passen und ihn infizieren. Wenn dieser Wirtsgenotyp häufig vorkommt, ist dies ein Fitnesserfolg für den Parasiten, während dem die Wirte infolge der Erkrankung aber langsam seltener werden. Wirte mit anderem Genotyp, die seltener sind, sind durch ihre Seltenheit geschützt, erfahren aber dadurch ihrerseits einen Konkurrenzvorteil und werden langsam häufiger, bis ein anderer Parasit einen zu ihm passenden „chemischen Schlüssel“ findet und ihn nun ebenfalls infizieren kann. Da dieser zweite Parasit nun wiederum einen Fitnessvorteil erhält, wird sich der erste Wirtstyp erholen und wieder häufiger werden, womit sich das wechselseitige Spiel als Koevolution zwischen den beiden Wirten und Parasiten endlos widerholen kann. Man spricht dann von einer negativ-­‐frequenzabhängigen Selektion. Obwohl hier durch Mutation keine neuen Typen entstehen, läuft Evolution ab, führt aber nicht zu einem Fortschritt. Wirt-­‐ und Parasitenpopulation drehen sich sozusagen im Kreis und keiner kann den anderen je einholen und eliminieren. Die genetische Variation wird so durch Koevolution aufrechterhalten. Dies hat dem Prozess den Namen gegeben in Adaptation an die Rote Königin in „Alice im Wunderland“, wo die Rote Königin mit Alice im tiefen Wald immer schneller läuft, die Bäume dabei aber stehen bleiben. Der Autor meint nun in Anlehnung an W. D. Hamilton, dass der Red Queen Prozess auch die evolutive Effizienz der geschlechtlichen Fortpflanzung erklären könnte, die eigentlich streng nach Darwin sehr ineffizient ist gegenüber der ungeschlechtlichen Vermehrung. Die asexuelle, klonbildende Reproduktion ist viel seltener, kommt aber bei Einzellern bis hin zu Baumarten oder Eidechsen vor. Bei der sexuellen Fortpflanzung werden pro Nachkommen zwei Eltern benötigt, bei der asexuellen nur einer. Damit weiter eine Mutter eine Tochter haben kann, muss sie im statistischen Durchschnitt zwei Nachkommen grossziehen, nämlich zusätzlich noch einen Sohn. Diesem fällt lediglich die Rolle zu, die Eier der nächsten Generation zu befruchten. Schon nach drei Generationen hat die sich asexuell fortpflanzende Mutter achtmal mehr Töchter hervorgebracht als die sexuelle, die immer noch Söhne mitproduzieren muss. Der Autor bezeichnet dies nach dem Evolutionsbiologen J. Maynard Smith als die zweifachen Kosten der sexuellen Reproduktion. Dazu kommt noch, dass der elterliche Genotyp durch die besondere Zellteilung der geschlechtlichen Keimzellen (Gameten), nämlich die Meiose, auseinander gebrochen wird. Zunächst verdoppelt sich jedes Chromosom, gegenüberliegende Stränge überkreuzen sich und tauschen Gene aus, danach teilt sich die Zelle in vier Tochterzellen, von denen zwei ausgetauschte, „rekombinierte“ Gen-­‐ bzw. Allelanordnungen tragen. Das Prinzip der Erblichkeit wird dabei zwar gewahrt, da ein Nachkomme mit 50% Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Gen von der Mutter oder vom Vater erbt. Aber die Zygote trägt nun eine neuartige Kombination von Allelen, die zu anderen Eigenschaften führt, als sie in den Eltern zu finden waren. Diese „Macht der Rekombination“ ist ausserordentlich gross. Wenn man als Beispiel 1000 Genorte (loci) rechnet mit je zwei möglichen Allelen, so ergeben sich daraus 10301 Kombinationsmöglichkeiten. Da das menschliche Genom mindestens 30‘000 Genorte umfasst, wird es nie genügend Gameten geben, um alle diese Möglichkeiten auszuschöpfen und jedes sexuell entstandene Individuum ist im Gegensatz zum Klon ein genetisches Unikat! Nach Darwin sollten aber erfolgreiche Eltern möglichst ähnliche Nachkommen haben und so die natürlich selektionierten Vorteile weitergeben. Durch die Rekombination in der Meiose wird das erfolgreiche Modell aber nicht kopiert, sondern nach dem Zufallsprinzip zu neuen Kombinationen zusammengewürfelt. Schmid-­‐Hempel stellt also die Frage, wieso trotzdem eine grössere Fitness der sexuellen Reproduktion resultiert und er sucht die Antwort gerade in diesen Kombinationen der Gene. Genkombinationen können einen positiven oder negativen Effekt auf die Fitness haben, was als pos. oder neg. Epistase bezeichnet wird. Dies führt im Laufe einiger Generationen zur Koppelung von Genen an zwei naheliegenden Orten (loci) und zur Selektion von Kombinationen. Wenn Epistase eine Genkombination stärker bevorzugt, als es nach der Häufigkeit dieser Gene alleine zu erwarten wäre, spricht man von einem Koppelungsungleichgewicht. Auf der Suche nach der Ursache von Epistase kommt der Autor wiederum auf die Parasiten. Es sind molekulare Interaktionen zwischen Genen und Genorten der Wirte und der Parasiten bekannt, die vermutlich einem Zahlenschloss-­‐Prinzip unterliegen. Wirte mit seltener Zahlenkombination werden nur schwer von den Parasiten befallen und ihre Häufigkeit wird zunehmen, bis ihr Code von koevoluierenden Parasiten geknackt wird. Es entsteht dasselbe „Red Queen“ Spiel wie oben geschildert, wobei sich aber die Kombinationen von Genen im Lauf der Generationen infolge der Rekombination in der Meiose ändern und damit die Koevolution mit den Parasiten antreiben. Die Parasiten können eine bestimmte Kombination von Genen im Wirt eine Zeitlang bevorteilen (positive Epistase falls die Kombination selten ist) und nach etwa 3 – 5 Generationen wieder benachteilen (negative Epistase falls die Kombination häufig ist). Sie können mit ihrer asexuellen Vermehrung aber nicht so zahlreiche neue molekulare Schlüssel produzieren wie die Wirte ihren Code ändern können. Der vermeintlich absurde Vorgang der sexuellen Fortpflanzung mit der Meiose entpuppt sich so als adaptiv in einer koevolutiven Welt voller Parasiten. Die Konsequenz aus diesen Erkenntnissen ist, dass die Rekombination in der Meiose nicht wie früher angenommen den Vorteil hat, möglichst schnell zahlreiche genetische Variationen zu erzeugen, welche der Art eine schnelle Anpassung ermöglichen und damit dem „Wohl der Art“ dienen würden. Diese Sicht sei heute nicht mehr haltbar, betont der Autor. Hingegen vertritt er die Ansicht, dass Evolution weitgehend durch die Geschehnisse innerhalb von Populationen angetrieben wird, insbesondere durch die Konkurrenz zwischen alternativen Strategien. Er erwähnt schliesslich Untersuchungen an Süsswasserschnecken in Seen von Neuseeland, die oft von Trematoden befallen werden. Die Süsswasserschnecke kann sich sowohl sexuell wie asexuell fortpflanzen. Es hat sich als Bestätigung der Theorie gezeigt, dass in denjenigen Seen oder Seeabschnitten, wo viele Trematoden vorkommen, stets die Süsswasserschnecke mit sexueller Vermehrung überwiegt. Die Umwelt der Organismen wird nicht nur von physikalischen und chemischen Faktoren bestimmt, sondern v.a. von der Präsenz und Wirkung anderer Organismen mit anderen Strategien. Parasiten sind sehr zahlreich und haben eine kurze Generationenzeit, womit sie sich schnell an den Wirt anpassen können. Der Wirt seinerseits hat den Vorteil und Vorsprung der Macht der genetischen Rekombination in der geschlechtlichen Fortpflanzung. 2.12 KÖNIG, B., Natürliche Selektion und die Entstehung und Veränderung von Arten. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009), 154(3/4): 57-­‐61. Prof. Dr. Barbara König Literaturbericht, wb Prof. König fasst in dieser Arbeit zusammen, was von Darwins Theorien und den nachfolgenden Forschungen heute als gesicherte Lehrmeinung vertreten wird. Das Phänomen der biologischen Artenvielfalt steht auch für Laien ausser Zweifel. Man schätzt heute die Anzahl nur schon von Tierarten auf 5 bis 80 Millionen. Dieser grosse Rahmen zeigt die Unvollständigkeit der Bestandesaufnahmen. Das Ziel der Biologie sieht die Autorin aber darin, zu verstehen, wie Merkmale und Verhalten der Lebensformen entstanden sind. Darwin war der erste und bisher einzige, der dazu eine konsistente wissenschaftliche Theorie formulierte, nämlich Evolution durch den Prozess der natürlichen Selektion. Sie besteht im Wesentlichen aus drei Punkten: -­‐
-­‐
-­‐
Variation: Vertreter einer Art unterscheiden sich in bestimmten Merkmalen Erblichkeit: Eltern geben Merkmale an ihre Nachkommen weiter Differenzielle Fortpflanzung: Aufgrund verschiedener erblicher Merkmale hinterlassen einige Eltern mehr Nachkommen als andere. Organismen haben grundsätzlich die Fähigkeit, sich exponentiell zu vermehren. Dies wird aber begrenzt durch Energiereserven und Ressourcen. Es kommt unter den Organismen deshalb zu direkter oder indirekter Konkurrenz um Zugang zu diesen Ressourcen. Organismen, die sich sehr ähnlich sind und identische Ressourcen benutzen, also Individuen derselben Art, konkurrieren am heftigsten. Die innerartliche Konkurrenz ist deshalb ein wichtiger Antriebsmotor für die Evolution des individuellen Verhaltens, der gemeinschaftlichen Interaktionen, der Aufrechterhaltung von Diversität und der Fortpflanzungsfähigkeit. Der Fortpflanzungserfolg, die direkte biologische Fitness besteht im Platzieren von Kopien eigener genetischer Anlagen in der nächsten Generation. Natürliche Selektion sorgt für Unterschiede im Fortpflanzungserfolg: Bei gegebenen Randbedingungen haben verschiedene Allelkombinationen unterschiedlichen Wert. Dadurch wird heute die Evolution und Anpassung von komplexen individuellen Merkmalen an die Umwelt erklärt. Seit den 1960er Jahren wird dieses Prinzip auch auf die Beziehungen unter Individuen angewandt. Die Evolutionsbiologen W. Hamilton und R. Trivers haben eine evolutive Erklärung von altruistischen Verhaltensweisen erarbeitet. Wie bei vielen Insekten kann das Individuum seine indirekte Fitness steigern, indem es den Fortpflanzungserfolg von Verwandten, also von Trägern identischer Gene, unterstützt. Der Biologe M. Smith bezeichnete dies als Verwandtenselektion, welche für das Auftreten von altruistischen und kooperativen Verhaltensweisen von grosser Bedeutung sei. Daraus habe Trivers Grundlagen gelegt für das Verständnis von Verhaltensweisen unter männlichen und weiblichen Individuen, zwischen Eltern und Kindern, unter Geschwistern und in der Beziehung einer Person zu sich selbst. Er hat auch einen Mechanismus vorgeschlagen, wie Kooperation, welche Fitness-­‐
Kosten beinhaltet, auch unter nicht verwandten Individuen durch reziprokes Erwidern kooperativen Verhaltens entstehen kann. Dazu müssen sie aber andere Individuen erkennen und sich an ihre vorgängigen Handlungen erinnern können. Der Prozess der natürlichen Selektion fördert aber nicht nur Eigenschaften, welche die Fortpflanzung betreffen, sondern es kommt auch innerhalb des Individuums zu genetischen Konflikten. Gene können innerhalb eines Organismus in gegensätzliche Richtungen selektiert werden. Man hat „egoistische“ genetische Elemente gefunden, die sich auf Kosten des Gesamtorganismus vermehren. Anderseits werden die anderen Gene des Organismus daraufhin selektiert, die egoistischen Elemente zu unterdrücken. Prof. König schliesst mit der Beschreibung der Anpassungsfähigkeit der Darwinfinken auf den Galapagos, wie sie in der Vorlesung von Prof. Lukas Keller erläutert wird. Es gilt als gesichert, dass wie Darwin heraus fand, die natürliche Selektion sofort innert weniger Generationen wirkt, sobald erbliche Merkmalsunterschiede einen Einfluss auf das Überleben und die Fortpflanzungsfähigkeit haben. Oder auf der genetischen Ebene ausgedrückt heisst es, dass natürliche Selektion wirkt, sobald sich Genotypen in ihrem relativen Beitrag zur Nachkommensproduktion in der nächsten Generation unterscheiden. 2.13 BACHOFEN, R., BRANDL, H., SCHRANZ, F., Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! Ein Feldführer für Mikroorganismen. Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 2006 Prof. Dr. Helmut Brandl, Universität Zürich, Institut für Umweltwissenschaften Literaturbericht, wb Zu den Mikroorganismen zählen Viren und Bakterien, aber auch höhere Organismen wie wenig-­‐zellige Algen, Pilze und Protozoen. Aus dem 140 Seiten starken Neujahrsblatt der NGZ auf das Jahr 2007 soll hier nur über die evolutionsbiologischen Aspekte der Bakterien berichtet werden. Bakterien sind Prokaryoten mit einfachem Zellbau ohne Zellkern und mit wenig inneren Strukturen. Von Auge sind sie als Einzelzellen nicht erkennbar. Erstmals wurden sie von Antony von Leeuwenhoek (1632 – 1723) mittels eines selbst gebauten Mikroskops beobachtet und beschrieben. Anhäufungen von Bakterien hinterlassen aber oft Spuren ihrer Aktivitäten, eine sog. makroskopische Signatur. Sie bilden durch den Stoffwechsel Gase und sind Ursache starker Gerüche, farbiger Niederschläge oder schleimiger Oberflächen. Diese Signaturen erlauben wiederum Rückschlüsse auf bestimmte Mikroorganismengruppen. Louis Pasteur (1822–1895) entwickelte Steriltechniken und züchtete Bakterien in Gefässen, um einzelne Formen zu isolieren. Er widerlegte die Theorie der spontanen Bildung von Leben. Robert Koch (1843-­‐
1910) entdeckte die bakteriellen Erreger verschiedener ansteckender Krankheiten wie Tuberkulose und Milzbrand. Auf ihn geht auch die Kultur von Bakterien auf festen Nährböden in sogenannten Petrischalen zurück. Ohne Bakterien käme das Leben auf der Erde weitgehend zum Stillstand, da sie an allen Kreisläufen der Elemente in der Natur beteiligt sind. In biogeochemischen Zyklen erfolgt die Umwandlung der Elemente aus der Umwelt durch biologische Prozesse. Dabei werden anorganische Verbindungen in die Biomasse von Organismen eingebaut und später wieder freigesetzt. Wesentlich sind dabei die Kreisläufe von Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel. Die Anzahl der Mikroorganismen auf der Erde ist gigantisch. Sie wird auf 5 x 1030 Zellen geschätzt, was einer Kohlenstoffmenge von 5 x 1011 Tonnen entspricht, soviel wie der weltweite Kohlenstoffgehalt aller Pflanzen zusammen. Es gibt kaum Standorte, an denen Mikroorganismen NICHT vorkommen. Artbestimmungen wurden in der Vergangenheit mittels Reinkulturen auf festen Nährböden vorgenommen. Damit konnten Wachstum und Stoffwechsel der Bakterien untersucht und klassifiziert werden. Dazu wurden weitere physiologische Merkmale herangezogen wie optimale Temperatur, Licht, pH oder Nährstoffbedarf. Durch Färbungen können im Lichtmikroskop Unterschiede sichtbar gemacht werden. Bekannt ist vor allem die Gram-­‐Färbung, welche dicke und dünne Zellwände (Gram-­‐pos. / gram-­‐neg.) erkennen lässt. Vor über 200 Jahren begannen die Biologen die Lebewesen hierarchisch in Divisionen, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten zu gliedern. Voraussetzung dazu war die von Linné (1707-­‐
1778) eingeführte binominale Namensgebung. Man setzte die einfach organisierten Organismen an den Anfang der Systeme und die hoch entwickelten, komplizierten an den Schluss, woraus baumähnliche Gebilde nach Darwins Evolutionstheorie als „natürliches“ System und als Stammbaum entstanden. Dieses Prinzip wurde auch für die Bakterien übernommen, wobei Populationen aus Individuen einer Art eine Reinkultur oder ein Isolat darstellten. Die morphologischen und physiologischen Merkmale bildeten die Grundlage für die Beschreibungen von Gattungen und Arten. Die Kreuzungsfähigkeit ist bei der ungeschlechtlichen Vermehrung natürlich kein Kriterium. Auf diese Weise wurden bisher gut 5000 Arten von Bakterien beschrieben und taxonomisch klassifiziert. Heute weiss man aber, dass sich nur ein kleiner Teil aller Bakterien auf Nährlösungen züchten lässt und dass sich mit dieser Methode das wirkliche Ausmass der bakteriellen Vielfalt nicht erfassen lässt. Auch Informationen zur Evolution und zu Verwandtschaftsbeziehungen der Bakterien lassen sich so nicht gewinnen. Erst mit der Technik der Bestimmung der Abfolge von Aminosäuren von Eiweissen und von Nukleinsäuren bei der Erbsubstanz (Sequenzbestimmung) wurde es möglich, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Bakterienarten aufzuzeigen. Haben zwei Arten gemeinsame Vorfahren, so kann etwa für ein bestimmtes Enzym eine hohe Übereinstimmung der Sequenz erwartet werden. Diese muss umso höher sein, je später sich die beiden Arten im Lauf der Evolution voneinander getrennt haben. Ist die Trennung hingegen schon älter, haben Mutationen für eine geringe Übereinstimmung gesorgt. Für einen Vergleich der ganzen Lebewelt ist die Analyse eines möglichst universell verbreiteten und möglichst stabilen Gens geeignet. Viele DNA-­‐Abschnitte variieren allerdings sogar innerhalb derselben Art. Man arbeitet deshalb mit den sehr gut konservierten Untereinheiten der ribosomalen RNA (rRNA), weil die Ribosomen bei allen Lebewesen die gleiche zentrale Rolle bei der Genexpression spielen. Diese Moleküle haben eine Länge von ca. 1500 Einheiten der vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Uracil. Ihre Sequenz ist ein genetischer Barcode des betreffenden Organismus und zeigt den Verwandtschaftsgrad innerhalb der Bakterien. Bis heute wurden etwa 100 000 solcher Sequenzen bestimmt und in Datenbanken archiviert. Der im alten System für die Klassifizierung wichtige Stoffwechsel erwies sich für die Phylogenie in vielen Fällen als untauglich. Die Nutzung der Lichtenergie in der Photosynthese, oder die Verwendung von alternativen Elektronenakzeptoren (Nitrat-­‐ und Sulfatatmung) kommen z.B. in vielen nicht verwandten Gruppen vor. Schliesslich mussten einzelne Gruppen im Stammbaum neu positioniert werden, wie etwa spezialisierte Parasiten oder Symbionten. Die Autoren sind überzeugt, dass heute erst ein kleiner Bruchteil aller Bakterienarten bekannt ist. Ihre Zahl wurde bisher um Grössenordnungen unterschätzt. Es seien erst 0.1-­‐1 % der Bakterien kultiviert und beschrieben worden. Es wurden auch immer wieder neue DNA-­‐Sequenzen gefunden, die noch keiner bekannten Division zugeordnet werden können. Die Fragen nach der Anzahl der Bakterienarten und nach der Definition der Art stellt sich auch mit den neuen Methoden. Es sind zwar von 100000 Organismen DNA-­‐Sequenzen in Datenbanken gespeichert, während nur 5000 in Reinkulturen gezüchtet worden sind. Doch die Frage ist immer noch unbeantwortet, wie gross der Unterschied zu einer bekannten Sequenz sein muss, damit ein gefundener Organismus als neue Art bezeichnet werden kann und nicht in die Variationsbreite einer bestehenden Art fällt. Die Autoren teilen heute die Domäne der Bacteria in 55 Divisionen ein. Beispiele dazu sind etwa die Cyanobakterien, die Proteobakterien oder die Gram-­‐positiven Bakterien. Viele Stämme müssen in einer kurzen Zeitspanne entstanden sein, da sie sich genetisch sehr nahe beieinander verzweigen. Es sind alles Prokaryoten. Die Domäne der Archaea ist mit nur drei Stämmen weniger divers und hat als Besonderheiten die Methanbildung, eine Photosynthese und eine sehr hohe Temperaturtoleranz mit einem Wachstums-­‐
Optimum von gut 120°. Bekannt sind auch die Salzbakterien, die auch Halobakterien heissen, die bei extrem hohen Salzkonzentrationen leben können, was für andere Bakterien unmöglich ist. Auch sie sind Prokaryoten ohne Zellkern. Die Archaea haben sich vor 3 Milliarden Jahren von den Eubakterien abgespalten. Die Domäne der Eubakteria enthält drei Stoffwechseltypen mit Energiegewinnung 1. durch Photosynthese 2.
durch Oxidation anorganischer reduzierter Verbindungen 3.
Oxidation organischer Verbindungen Viele bekannte Bakteriengruppen gehören dazu: Gram-­‐negative und Gram-­‐positive Bakterien, phototrophe Bakterien, chemolithotrophe Bakterien, chemoorganotrophe Bakterien, Bakterien mit anaerober Atmung, Stickstofffixierende Bakterien, Pflanzenpathogene Bakterien, Cyanobakterien oder Blaualgen. Die Domäne der Eukarya sind wie der Name erraten lässt Eukaryoten mit einem Membran umhüllten Zellkern und verschiedenen Organellen mit ihren diversen Funktionen. Ihr Stoffwechsel ist viel weniger vielfältig als derjenige der Prokaryoten. Sie sind entweder Sauerstoff-­‐freisetzend (phototroph) wie die Pflanzen und Algen, oder aerob und heterotroph wie Tiere, Pilze und Protozoen. 2.14 KAESER, E., Der Mensch: das Tier, der Automat. „Koevolution“ von Mensch und Maschine. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002) 147/3: 125-­‐132 Dr. phil. nat. Eduard Kaeser, Bern Literaturbericht, wb Der Autor weist darauf hin, dass sich der Mensch seit der Werkzeugerfindung mit diesem zusammen weiter entwickelt hat. Dabei habe sich im Werkzeug eine Tendenz zur Verselbständigung gezeigt, welche zuerst zum Automaten, dann zur Robotik und schliesslich zur selbst-­‐replikativen Maschine geführt habe, welche sich in einer postbiologischen Phase vom Menschen ablösen könnte. Einerseits habe der Mensch den Wunsch, seine Fähigkeiten hinaus zu verlagern und zu verbessern, anderseits entstehe die Angst, dieses emanzipierte maschinisierte Menschliche könnte sich am Ende gegen ihn selbst richten. Kaeser unterscheidet wie die meisten Autoren eine biologische von einer kulturellen Evolution. Beim Menschen erscheint die biologische Evolution in den grossen Zügen abgeschlossen, während dem sich die kulturelle Evolution in vollem Gange befindet. Die Sprache der Biologen und der Ingenieure gleicht sich einander immer mehr an und es zeigt sich eine Grenzauflösung zwischen Natürlichem und Künstlichem. Aristoteles habe „Natur“ noch als Prinzip der Bewegung, als Werden und Vergehen gesehen. Er unterschied denn auch Gewachsenes, welches einen Plan zur Endgestalt in sich trage, von Gemachtem, welches vom Menschen definiert sei. In der Renaissance habe man Technik und Natur einander bereits näher gebracht und Descartes bezeichnete die Natur schliesslich als eine (göttliche) Maschinenbauerin und unterwarf sie damit einem menschlichen Ingenieurblick. Damit entstand auch die Idee, alle Lebewesen könnten letztlich Automaten sein mit lediglich graduellen Unterschieden. Auch die Seele, welche Descartes noch als von Gott implantiert postulierte, wurde bei Leibnitz schliesslich zum immateriellen Automaten. Der Geist erschien als eine (göttliche) Rechenmaschine. Kant habe dieses Maschinenmodell im Prinzip akzeptiert, habe diesem aber einen Naturzweck beigesellt, welcher nicht mechanisch erklärbar, aber ein Mittel zur moralischen Verbesserung sei. Gerade diesen Naturzweck, oder anders gesagt, das Zweckdenken in der Natur lehnte Darwin dann ab zugunsten eines blinden, automatischen Anpassungsprozesses an sich verändernde Umweltbedingungen, der die optimale Überlebenslösung ziellos findet. Darin sieht Kaeser die entscheidende Aufweichung des Gegensatzes von Natürlichem und Mechanischem, von Mensch und Maschine. Als Konsequenz gehen heute Biologie und Technologie immer neue Allianzen ein und die Maschine wird immer menschenähnlicher, die Menschen immer maschinenähnlicher. Es sei aber ein schiefes Bild, die Maschinen entweder als Bedroher oder als Heilsbringer zu sehen. Man müsse sie als einen Teil unserer selbst betrachten mit dem Zweck, die routinemässigen Aspekte unseres Verhaltens an diese neue künstliche „Spezies“ zu delegieren. Die Koevolution besteht darin, dass dieses Hinausverlagern bei uns Menschen selbst wiederum Spuren hinterlässt. Diese Spuren verfolgt der Autor anhand von vier Technologisierungsschüben: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Vom Werkzeug zur Maschine Von der Maschine zum Automaten Vom Automaten zum Autopoieten Vom Autopoieten zum Animaten Vom Werkzeug zur Maschine: Werkzeuge sind künstliche Weiterentwicklungen der motorischen Fähigkeiten unserer Arme und Hände. Mit der Entwicklung von Maschinen erfolgte sukzessiv eine Loslösung des Werkzeugs oder von Werkzeugkombinationen von der Hand des Menschen. Man macht sich physikalische Gesetze nutzbar wie etwa das Hebelgesetz. Die Handhabung des Werkzeugs weicht der Bedienung der Maschine. Schliesslich kann auch die Steuerfunktion an die Maschine delegiert werden. Von der Maschine zum Automaten Das wesentliche an der automatischen Maschine ist ihre logische Architektur. Wenn sie von selbst tätig werden muss, muss man ihr dieses „von selbst“ irgendwie eingeben. Das Schlüsselwort dazu ist der Algorithmus. Er legt fest, wie ein Vorgang Schritt für Schritt durchzuspielen ist und führt in endlich vielen Schritten garantiert zu einem Endergebnis. Er gibt das „von selbst“ als codierte Instruktionen an ein geistloses Gerät weiter. Der Entwurf solcher Algorithmen ist aber hochkomplex. Der Engländer Alan Turing habe 1930 ein Konzept eines idealen Automaten entworfen, die sog. Turingmaschine. Man kann ihr die notwendigen Daten und Instruktionen als Code von binären Ziffern (1 oder 0) eingeben. Sie „weiss“ dann beim Ablesen, was sie zu schreiben hat, je nachdem ob sie eine Eins oder eine Null vorfindet. Die so geänderte Inputfolge kann man als Resultat einer Aufgabe interpretieren. Was man auch mit „Rechnen“ oder „mechanischem Verfahren“ umschreibt, kann man durch eine manipulierte Abfolge von eins und null simulieren. Der menschliche Verstand wird ersetzt durch den Algorithmus, womit sich die Grenze zwischen Mensch und Maschine weiter aufweicht und sich die Frage stellt, ob auch Lebensprozesse im Grunde algorithmisch sein könnten. Vom Automaten zum Autopoieten (Selbsthervorbringer) Ein weiterer Technisierungsschub wurde durch die Frage eingeleitet, ob Maschinen sich wie Tiere oder Zellen vermehren, also Selbst-­‐Hervorbringer sein könnten. Der Autor erwähnt den Mathematiker John Von Neumann, welcher ein Modell gedanklich erarbeitet hatte, wie Automaten Automaten erzeugen könnten, welche sogar komplexer sind als ihre „Eltern“. Ein solcher Automat kann nach eingegebenen Algorithmen in einem Gerätemagazin nach Rohmaterial und Teilen suchen für den Bau von seinesgleichen. Er verfügt zudem über den Code seines eigenen Bauplanes. Er setzt Module von Computern, Batterien, Motoren, photoelektrische Zellen, Antennen usw. zusammen, fischt alles aus dem Lager, was er braucht und weidet es aus, um sie dann Stück für Stück schrittweise nach seiner Selbstbeschreibung zusammen zu bauen. Schliesslich kodiert er die Kopieranleitung seiner selbst in die Steuereinheit seines Abkömmlings. Das Gedankenexperiment war also möglich. Interessanterweise entdeckten James Watson und Francis Crick 1953, vier Jahre nach der Publikation von Von Neumann, die DNA als biologischen Automatismus der Selbstreproduktion von Organismen. Den Wissenschaftlern war es danach logisch, die Vorgänge in Lebewesen und die Vorgänge in Maschinen unter denselben Gesichtspunkten zu studieren. Vom Autopoieten zum Animaten Wenn nun Maschinen Selbstreproduktion durchführen können, stellt der Autor die Frage, ob sie auch Geist und Bewusstsein entwickeln könnten, ob Geist durch einen geistlosen Algorithmus erzeugt werden könnte und Maschinen damit eine künstliche Intelligenz erhalten könnten. Einerseits können Neuro-­‐
Ingenieure bereits heute neuronal arbeitende Maschinen nach dem Vorbild des Säugetiergehirns bauen und diese Technologie habe auch Zukunft. Anderseits steht die Frage im Raum ob solche Maschinen spirituell sein könnten, ob sie denken, wahrnehmen, empfinden, fühlen und sogar ein „Selbst“ haben könnten. Nach Ansicht des Autors würde hier die Ebene des Ingenieurs verlassen. Obwohl Geist an physikalische, physiologische, also materielle Medien gebunden ist, kann er nicht für sich alleine erklärt werden, sondern nur im Kontext mit einem Subjekt, einem Selbst. Am Beispiel des Rechnens zeigt Kaeser, dass das Gehirn zwar elektrische und chemische Signale verarbeitet, dass es aber nur im Kontext mit seinem Besitzer, dem Selbst, also einer Person „rechnen“ kann. Allerdings wird die Sache schwieriger bei komplex vernetzten Automatensystemen wie etwa einem Schachcomputer. Wir betrachten ihn als einen synthetischen Experten und Gesprächspartner, welcher mit uns in Interaktion tritt. Wir billigen dem Schachcomputer zwar keine künstliche Subjektivität, kein maschinelles „Selbst“ zu, aber wir sind in einen neuartigen Verkehr mit der Maschine getreten. Es werden zudem bereits Roboter mit sozialen Fähigkeiten entworfen. Der Autor erwähnt die Kreatur Kismet, einen humanoiden Roboter mit sozialisierbaren Eigenschaften. Er ist ausgestattet mit Sensorik, Aufmerksamkeit, Emotionen, Motorik für Gesichtsausdrücke, Kopf-­‐ und Augenorientierung sowie stimmliche Äusserungen. Kismet kann sich mitmenschlich verhalten und evoluiert zum Animaten. Es ist ein lernfähiges Maschinenkind, dem menschliches Verhalten nicht einfach einprogrammiert ist, sondern dem es anerzogen werden kann. Seine Ingenieure erwarten, dass sich sein Verhalten durch fürsorgliche Einwirkung von Menschen immer mehr dem Menschen angleicht. Simulation von menschlichem Verhalten erscheint so immer mehr als eine Sache der Technologie. Kismet ist sozusagen das maschinengewordene Wissen über uns selbst. Nun fragt der Autor natürlich, ob sich der Mensch in dem erschöpfe, was sich in eine Maschine packen lässt. Das wäre zwar verführerisch, aber nicht haltbar. Über das „Mehr“ wüssten wir allerdings nichts, aber wir wundern uns, was es sei und wie es dazu kam. Das Wunder der persönlichen Identität besteht darin, dass wir uns wundern und Fragen stellen, die wir nicht beantworten können, deren Antworten wir aber verkörpern. Wir sind Maschinen, die viel zu klug sind, als dass man über sie je völlig im Bilde wäre. 2.15 Informatik und Evolution Dipl. Ing. ETH Martin Fussen, Bern, 2010 Genetische Algorithmen, Die Lehre Darwins in der modernen Informatik Die folgende Kurzvorstellung genetischer Algorithmen (GA) soll zwei Dinge aufzeigen. Zum einen sind GA in der Informatik ein Beispiel dafür, welch weitreichenden Einfluss die Lehren Darwins bis heute haben. Zum Anderen kann das Funktionieren dieser Verfahren als eine Art Beweis oder zumindest als starkes Indiz für die Stichhaltigkeit der Evolutionslehre angesehen werden. Entstehung genetischer Algorithmen Bereits Anfang der sechziger Jahre begannen verschiedene Forschergruppen die Prinzipien der Evolution nachzuahmen, um effiziente Optimierungsalgorithmen zu entwickeln. So haben John H. Holland und David E. Goldberg die Genetischen Algorithmen entwickelt. Ihr Ziel war es, bewusst Prinzipien der Evolution nachzuahmen, um sie im Sinne von Optimierungsregeln einzusetzen. John Holland richtete sein Hauptaugenmerk auf die Frage, auf welche Art und Weise die Natur genetische Informationen speichert und wie die jeweiligen Prozesse auf diesen genetischen Daten operieren. Ihn faszinierte die Tatsache, dass sich das Leben in derart vielfältiger Form allein auf Grund des genetischen Codes und den damit verbundenen evolutionären Prozessen entwickeln konnte. Diese Form der Selbstorganisation und Adaption wollte er nachvollziehen und auf technischem Wege mit Hilfe von Computersimulationen nutzbar machen. Funktionsweise eines einfachen GA3 Die Grundidee genetischer Algorithmen ist, ähnlich der biologischen Evolution, eine Menge (Population) von Lösungskandidaten (Individuen) zufällig zu erzeugen und diejenigen auszuwählen, die einem bestimmten Gütekriterium am besten entsprechen (Auslese). Deren Eigenschaften werden dann leicht verändert (Mutation) und miteinander kombiniert (Rekombination), um eine neue Population von Lösungskandidaten (eine neue Generation) zu erzeugen. Auf diese wird wiederum die Auslese und Rekombination angewandt. Die Einzelnen Schritte werden so lange wiederholt bis eine gewünschte Güte der Lösung erreicht ist. Der typische GA umfasst die folgenden Schritte: 1. Initialisierung: Erzeugen einer ausreichend großen Menge unterschiedlicher „Individuen“ (Lösungskandidaten). Diese bilden die erste Generation. 2. Evaluation: Für jeden Lösungskandidaten der aktuellen Generation wird anhand einer Fitness-­‐-­‐
-­‐Funktion ein Wert bestimmt, der seine Güte angibt. 3. Selektion: Zufällige Auswahl von Lösungskandidaten aus der aktuellen Generation. Dabei werden Lösungskandidaten mit besseren Fitness-­‐-­‐-­‐Funktion mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgewählt. 4. Rekombination: die Daten (Gene) der ausgewählten Individuen werden gemischt und daraus neue Individuen erzeugt. 5. Mutation: Veränderung der neuen Individuen durch vereinzelte zufällige Anpassungen. 6. Aus den neuen entsteht die aktuelle Generation für den nächsten Durchlauf. 7. Wenn ein Abbruchkriterium erfüllt ist, wird der beste gefundene Lösungskandidat als Ergebnis ausgegeben und der Algorithmus beendet. Sonst wird er mit Schritt 2 fortgesetzt. Ein konkretes Beispiel [69]: Das folgende Beispiel soll exemplarisch zeigen wie GA funktionieren. Die Problemstellung in diesem oft zitierten Beispiel zur Veranschaulichung von Optimierungsverfahren ist folgende: • Ein Handelsreisender muss auf seiner Tour eine gewisse Anzahl Städte mit Buchstaben abgekürzt) besuchen. • Jede Stadt muss genau einmal besucht werden (also auch keine doppelten Besuche) • Seine Tour soll in der Stadt enden, in der sie begonnen hat. • Die Distanzen zwischen allen Städten sind bekannt und entsprechen in diesem vereinfachten Beispiel der direkten Luftlinie. • Die Strecke die der Reisende auf seiner Tour zurücklegt soll so kurz wie möglich sein. C
A
A
F
D
A
E
B
Abbildung 1: Tour ADCFEBA
C
A
A
F
D
A
E
B
Abbildung 2: Tour ADBCEFA
Die beiden Abbildungen zeigen zwei gültige Lösungen für die gestellte Aufgabe, wobei die Lösung in Abbildung 1 eine kürzere Reiseroute zeigt. Diese Lösung ist somit besser als die in Abbildung 2 dargestellte. Ziel des GA ist es nun für eine beliebige Zahl von Städten die beste (also kürzeste Lösung zu finden) Das Vorgehen hierzu sieht folgendermassen aus: 1.
Initialisierung: Das Optimierungsverfahren beginnt mit einer gewissen Anzahl zufälliger Lösungen. Beispiel: ABCDEFA, ACEBDFA, BADCFEB, ... 2.
3.
4.
Evaluation: Anhand der Stecken zwischen den einzelnen Städten wird für jede Lösung die Gesammtlänge der Reise ermittelt. Beispiel: ABCDEFA = 1000km, ACEBDFA= 1200km, ... Selektion: Aus den momentanen Lösungen werden gewisse ausgewählt. Die Auswahl geschieht zufällig, wobei die Wahl einer guten Lösung aber wahrscheinlicher ist als die einer schlechten. Rekombination: Aus zwei gewählten Lösungen wird eine neue erzeugt. Dabei werden die Lösungen „zerschnitten“ und neu zusammengefügt. Beispiel: Lösung 1 A B C Lösung 2 A C D B F E A Kombination A C D B E F A D E F A * Es ist zu beachten, dass bei der Rekombination ungültige Reiserouten entstehen können, diese werden entweder ignoriert oder “korrigiert”. Eine genaue Beschreibung dieser Methoden würde aber den Rahmen dieses Beispiels sprengen. 5.
Mutation: Die neu entstandenen Lösungen werden zufällig mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mutiert. In diesem Beispiel werden zwei beliebige Städte vertauscht. Beispiel: Vor Mutation A C D B E F A Nach Mutation A C D F E B A 6.
7.
Die durch Rekombination und Mutation neu entstandenen Lösungen werden zur neuen aktuellen Generation. Das Verfahren wird beendet, wenn sich das Optimum der letzten 3 Durchläufe nicht mehr unterschieden hat. Ein Beispiel mit 30 Städten zeigt folgendes Optimierungsverhalten TSP30 (Performance = 941)
100
90
80
70
60
y
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
x
Abbildung 3: Zufällige Initialisierung
TSP30 (Performance = 652)
100
90
80
70
60
y
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
x
Abbildung 4: Zwischenschritt bei der Optimierung
TSP30 Solution (Performance = 420)
100
90
80
70
y
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
x
Abbildung 5: Gefundenes Minimum
TSP30 - Overview of Performance
1600
1400
Distance
1200
1000
800
600
400
200
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Generations (1000)
Abbildung 6: Optimierungsverhalten
29
31
Best
Worst
Average
Wie man in den Abbildungen 3,4 und 5 sieht verbessert sich die Lösung im Laufe des Optimierungsverfahrens kontinuierlich. Abbildung 6 gibt einen Überblick über das Verhalten des Optimierungsverfahrens. Das hier vorgestellte Schulbeispiel (Travelling Sales Man = TSP) findet in abgewandelter Form zahlreiche Anwendungen beim Finden von idealen Routen für den elektronischen Datenverkehr oder das Layout von Computerplatinen. Einsatzgebiete Im Folgenden sollen mehrere praktische Einsatzgebiete für GA kurz vorgestellt werden. Flugzeugbau Um ein optimales Flügelprofil oder eine optimale Rumpfform zu bekommen, verwendet man heute genetische Algorithmen. Die Lösungen (sprich: die verschiedenen Profile) werden mit Simulationen ausgewertet, so dass keine teuren Modelle gebaut werden müssen. Investment Strategien [65] In zunehmendem Mass werden GA auch in der Finanzwelt eingesetzt. GA dienen dazu in den unzähligen Finanzmarktdaten Muster zu erkennen und aus ihnen Prognosen für die zukünftige Entwicklung von Unternehmen und deren Aktienkursen abzuleiten. Phantombilder In England werden Phantombilder am Computer mit einem genetischen Algorithmus erzeugt. Anhand von ein paar wenigen Daten, zum Beispiel Geschlecht, Haarfarbe, Gesichtsbehaarung und Kopfform, werden ein Satz zufälliger Phantombilder erzeugt. Aus diesen Bildern wählt der Zeuge das, welches dem Täter am ähnlichsten sieht. Aus diesem und den letzten paar Bildern werden neue Bilder erzeugt, aus denen der Zeuge wieder das dem Täter am ähnlichsten wählen soll. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis keine der Vorschläge dem Täter ähnlicher sehen. Dieser Vorgang ist nicht nur schneller und billiger als ein Zeichner die Resultate haben sich in Tests als genauer erwiesen. Routen-­‐ und Zustellplanung Adaptierte Varianten des oben erwähnten Algorithmus zur Lösung des TSP finden ihre Anwendung in Routenplanern und beim Berechnen idealer Auslieferwege von Transportfirmen. Fazit GA waren vor allem in den 80er und frühen 90er Jahren stark „in Mode“. Man hoffte mit ihnen viele bis anhin kaum überwindbare Optimierungsprobleme zu lösen. Aktuell haben GA wieder etwas an Terrain verloren. Andere Verfahren erwiesen sich in vielen Belangen als ebenso tauglich. Trotzdem sind GA bei einigen speziellen Optimierungsproblemen immer noch das Mittel der Wahl. Neben den praktischen Einsatzmöglichkeiten sind GA ein interessantes Modell zur Nachbildung von evolutionären Grundideen. Ihre Funktion verdeutlicht, dass mittels Rekombination, Mutation und Auslese aus zufälligen Startwerten sinnvolle Lösungen gefunden werden können. Wie die biologische Evolution Lebewesen hervorgebracht hat, die ideal an ihren Lebensraum angepasst sind, so bringen GA Lösungen hervor die ein spezifisches Problem optimal lösen. 2.16 Aus: Geschichten vom Ursprung des Lebens, [55] Richard Dawkins, 2009 Literaturbericht, wb Sexuelle vs asexuelle Fortpflanzung Die grossen Evolutionsforscher des 20. Jh. sind immer wieder die Frage nachgegangen, warum in der heutigen höheren Pflanzen-­‐ und Tierwelt die sexuelle Fortpflanzung derart vorherrschend ist. Insbesondere John Maynard Smith, W.D. Hamilton und George C. Williams haben postuliert, dass die Sexualität „doppelte Kosten“ verursache und deshalb eigentlich nicht mit der Darwin’schen Evolutionstheorie vereinbar sei. Es werden dabei ja die Gene eines erfolgreichen Individuums nur zu 50% an die Nachkommen weitergegeben, und die Gene eines anderen Individuums vermischen sich mit ihnen zu 50% im Körper der Nachkommen. Zudem braucht es zwei Eltern für die Produktion von Nachkommen, was nur dann allenfalls von Nutzen sein kann, wenn beide sich an der Aufzucht mit gleichem Aufwand beteiligen. Dies ist aber selten, denn meistens verbrauchen die Männchen ihre Energie für Rivalenkämpfe und drücken sich vor der gemeinsamen Brutpflege. Ungeschlechtliche Fortpflanzung kommt aber doch im Tier-­‐ und Pflanzenreich vor, wenn auch selten. Ein solches Beispiel ist Bdelloidea, eine Klasse der Rädertiere mit 18 Gattungen und 360 Arten. Es sind sehr erfolgreiche winzig kleine Tiere in den Süsswässern, Pfützen und feuchten Moosen der ganzen Welt und haben vor ca. 40 Millionen Jahren von der sexuellen zur asexuellen Fortpflanzung gewechselt. Solche Wechsel gab es auch bei anderen Tiergruppen, führten aber in der Regel zu deren Aussterben. Warum diese Bdelloidea Gattungen erfolgreich weiterlebten ist unbekannt. Der Artbegriff bezieht sich zudem auf die Fähigkeit der Kreuzung, was bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung dahinfällt. Wenn man von 360 Arten der Bdelloidea spricht, meint man Typen, die so viele Unterschiede aufweisen, dass sie nach unserer Vorhersage andere Typen als Partner ablehnen würden, wenn sexuelle Fortpflanzung stattfinden würde. Als Besonderheit haben diese Tiere trotz der Geschlechtslosigkeit einen diploiden Chromosomensatz. Da sie aber keine Meiose mit Rekombination der Gene machen, trafen sich die Gene der Chromosomenpaare seit 40 Millionen Jahren nie mehr und haben sich mit Mutationen sehr weit voneinander weg entwickelt. Die Unterschiede in diesen Genen sind daher ein Mass für den Zeitabschnitt seit dem Wechsel zur asexuellen Vermehrung. Die sexuelle Fortpflanzung mit der Rekombination in der Meiose hat die Nebenwirkung, dass „Ausreisser“ in den Genen durch die Vermischung sozusagen neutralisiert werden. Die Entstehung neuer Varietäten, Unterarten und Arten wird so verlangsamt oder behindert. Es braucht deshalb meist geografische Barrieren, damit neue Arten schnell und erfolgreich entstehen. Die asexuelle Gruppe der Bdelloidea war dem gegenüber offensichtlich im Vorteil und konnte 360 Arten bilden. Anderseits gibt es nur bei der geschlechtlichen Vermehrung einen Genpool, also eine Sammlung von Genen, die allen Individuen einer Art mit unbeschränkten Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung steht und so die Evolution der Individuen möglich macht. Mit jeder Generation gelangen die Gene in eine neue „Mannschaft von Mitspielern“, also von anderen Genen, mit denen sie eine Zeitlang einen Körper teilen. Bei der asexuellen Fortpflanzung ist dies nicht der Fall, denn ohne Rekombination gibt es keinen Genpool, sondern nur Genome, die sich nur langsam durch Mutationen einzelner DNA-­‐Abschnitte verändern. Daneben ist natürlich die sexuelle Fortpflanzung im Rüstungswettlauf mit den Parasiten von Vorteil, weil die Entstehung neuer Variationen schneller geht als bei der asexuellen Vermehrung der einzelligen Parasiten. Damit kann und will Dawkins aber keine Theorie aufstellen für den Nutzen oder die Entstehung der sexuellen Fortpflanzung, denn wenn Bdelloidea schon seit so langer Zeit mit der asexuellen Vermehrung zurecht kommt, müsste noch irgendein unbekannter Aspekt im Spiel sein. 3. Gene, Genome, Genetik 3.1. Molekulare und biochemische Grundlagen der Vererbung, Maturastoff Berichte von Dipl. Ing. ETH Werner Schönenberger und aus dem DUDEN Schnellmerksystem, Biologie, Duden Schulbuchverlag, Berlin, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2010 DNA / RNA Die Träger der Erbinformation sind Nukleinsäuren. Es sind sehr grosse (Makro-­‐) Moleküle, die aus einzelnen Nukleotiden bestehen, welche durch Phosphorsäurediesterbindungen miteinander verbunden sind. Von Bedeutung für das Leben sind die Desoxyribonukleinsäure DNA und die Ribonukleinsäure RNA. Bekanntlich besteht die DNA aus einer Doppelhelix, die bei Eukaryoten in einem abgegrenzten Zellkern anzutreffen ist und sich dort als ein Set von Chromosomen manifestiert. Im Gegensatz dazu findet sich die DNA bei Prokaryoten, also Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen, frei als Plasmide im Zytoplasma. Die DNA ist eine Folge von Nukleotiden, das sind chemische Verbindungen, die aus Zucker, Phosphat und Basen bestehen. Die Nukleotide bilden aneinander gereiht lange Ketten, den DNA-­‐Strang und sind dabei in Bereiche eingeteilt, welche die bekannten Gensequenzen bilden. Als Basen stehen bei der DNA die vier Varianten Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin zur Wahl (im Fall der RNA kommt als Base Uracil an der Stelle von Thymin zum Einsatz). Die einzelnen Nukleotide sind aber nicht nur über das Phosphat zu Ketten aneinander gereiht, sondern können auch mit einem anderen Nukleotid eine Paarbindung ein-­‐
gehen. Dadurch entsteht die spiralartige Doppelhelix, die aus zwei DNA-­‐Strängen besteht. (RNA dagegen liegt meist als Einzelstrang oder gefaltet vor). Wichtig ist dabei, dass nur bestimmte Paarbildungen auftreten können: Adenin (A) bindet zu Thymin (T) und Guanin (G) bindet zu Cytosin (C). Hat nun ein Bereich eines DNA-­‐Strangs die Basenfolge ...-­‐T-­‐G-­‐G-­‐C-­‐G-­‐A-­‐A-­‐... so hat demzufolge der zugehörige paarige Strang die Folge ...-­‐A-­‐C-­‐C-­‐G-­‐C-­‐T-­‐T-­‐... Die Kenntnis dieser Eigenschaft macht man sich in der Molekulardiagnostik zunutze. Eine Dreiergruppe von aufeinanderfolgenden Basen heisst Triplett, oder Codon und ihre Bindungspartnerin ist das Anticodon. DNA-Doppelhelix und ihr Aufbau aus Ribose, Phosphat und Basenpaaren (aus Wikipedia)
Die Replikation läuft in allen Organismen gleich nach dem folgenden, stark vereinfacht dargestellten Schema ab: Der Doppelstrang wird entspiralisiert, öffnet sich und es entsteht eine Replikationsgabel, in welcher ein RNA-­‐Primer die neue DNA schrittweise in kleinen Stücken entgegen der Öffnungsrichtung zu einem Folgestrang verlängert. Am anderen Strang, dem Leitstrang, wird durch das Enzym DNA-­‐Polymerase kontinuierlich ein neuer Strang synthetisiert. Schliesslich werden die beiden neu entstandenen Tochterstränge getrennt. Diese Abläufe werden alle durch Enzyme gesteuert und laufen bei Eukaryoten im Zellkern ab. Genexpression Die Zusammensetzung von Proteinen aus Aminosäuren nach dem von der DNA vorgegebenen Code, läuft ausserhalb des Zellkerns an den Ribosomen ab. Sie bestehen aus Proteinen und mehreren Einheiten sogenannter ribosomaler RNA, auch als „rRNA“ bezeichnet und sind eine Art Proteinmaschinen. Die Aminosäuren werden von speziellen Enzymen hergestellt und schwimmen im Cytoplasma, um von Ribosomen aufgenommen zu werden. Aus dem Zellkern kommt eine transkribierte Kopie der DNA, die „Messenger RNA“, „mRNA“, welche als „Lochstreifen“ dient und in das Ribosom eingelesen wird (Translation). Die zu den Codons dieses Lochstreifens passenden Aminosäuren werden in der von der mRNA vorgegebenen Reihenfolge der Codons zu einer Proteinkette verbunden. Es wird aber nicht die ganze mRNA-­‐Kette eingelesen, sondern sie wird vorher „gespleisst“, d.h. die Teile, welche nicht eingelesen werden sollen (Introns), werden herausgeschnitten und die anderen Teile (Exons) bleiben zur Translation übrig. Richard Dawkins hat in „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ 2009 [55] den Ablauf dieser Zuordnung allgemein verständlich dargestellt: In der Zelle gibt es eine Gruppe kleiner „Transfer-­‐RNA“-­‐Moleküle (tRNA), die jeweils aus etwa 70 Bausteinen bestehen. Jede tRNA verbindet sich gezielt mit einer und nur einer der 20 verschiedenen natürlichen Aminosäuren. Am anderen Ende des tRNA-­‐Moleküls befindet sich ein Anticodon, das heisst eine Gruppe aus drei Bausteinen, die genau komplementär zum Codon, also einer Abfolge von drei Bausteinen in der mRNA sind. Wenn der mRNA-­‐Lochstreifen am Lesekopf des Ribosoms vorüberläuft, bindet sich jedes Codon der mRNA an ein tRNA-­‐Molekül mit dem richtigen Anticodon. Dies führt dazu, dass die Aminosäure, die am anderen Ende der tRNA liegt, in die richtige Position für die „Partnervermittlung“ gebracht wird und sich mit dem wachsenden Ende der neu entstehenden Proteinkette verbinden kann. Ist die Aminosäure dort angeheftet, löst sich die tRNA, um sich ein neues Aminosäuremolekül ihres bevorzugten Typs zu suchen, und der mRNA-­‐Lochstreifen schiebt sich um einen Schritt weiter. Erstaunlicherweise kann ein mRNA-­‐Streifen mehrere Ribosomen gleichzeitig bedienen. Diese Abläufe, also die Kopierung von DNA in mRNA und die mit ihrer Hilfe an den Ribosomen eingelesene Produktion von Proteinen ist eine allgegenwärtige Funktionsweise des uns bekannten zellulären Lebens. Man spricht deshalb von der DNA-­‐RNA-­‐Protein-­‐Welt und von der Ein-­‐Gen-­‐ein-­‐Polypeptid-­‐Hypothese, dass also ein Gen eine Funktionseinheit der DNA ist, die mit ihrer Basensequenz für ein Polypeptid oder Protein codiert, welche aus wenigen oder sehr zahlreichen Aminosäuren bestehen. Strukturgene codieren für die körpereigenen Proteine, welche von Kontrollgenen reguliert werden. Regulation wiederum findet kurzfristig statt zur Anpassung an die reversiblen Veränderungen der Umwelt und ist anderseits die Grundlage der irreversiblen Ausbildung unterschiedlicher Zelltypen (Differenzierung). Damit Evolution auf genetischer Ebene stattfinden kann, müssen sowohl in DNA, RNA und in Proteinen biochemische, molekulare Änderungen, also Variationen entstehen können. Diese nennt man Mutationen Sie entstehen einerseits bei der Replikation der DNA als Fehler beim Einbau der „richtigen“ Basenpaare, oder als Lesefehler bei der Transkription und Translation. Nukleotide können eingefügt, entfernt, oder verdoppelt werden (Punktmutationen). Einige Reparaturmechanismen überwachen allerdings die Replikation, damit die Mutationsrate nicht zu hoch wird. Durch Mutation veränderte Gene heissen Allele. Anderseits sind die Chromosomen, die fadenförmigen DNA-­‐Träger in den Zellkernen, Gegenstand von Veränderungen. Einzelne ihrer Abschnitte können verloren gehen (Deletion), verdoppelt werden (Duplikation), ausgetauscht (Translokation) oder umgekehrt werden (Inversion). Weiter können sie bei der Zellteilung der Körperzellen (Mitose) falsch verteilt werden und auch bei der Zellteilung der Keimzellen (Meiose) kann es zu Fehlfunktionen kommen. Des Weiteren sind Mutagene bekannt, chemische Substanzen und physikalische Faktoren wie radioaktive Strahlung oder UV-­‐Strahlung, welche Baasenpaare und Nukleotide verändern können. Fehler korrigieren oder zulassen, Gottfried Schatz, 2011 Der Biochemiker Prof. em Dr. Gottfried Schatz, Basel, beschrieb in der NZZ vom 17.2.11 auf allgemeinverständliche Weise, wie Kopierfehler korrigiert werden und wie trotzdem Variationen entstehen: Um einen DNA-­‐Doppelstrang zu kopieren, „entdrillt“ ihn die Kopiermaschine der Zelle, fertigt von jedem der beiden Einzelstränge eine spiegelbildliche Kopie an und überwacht den Kopiervorgang gleich dreifach: Zunächst holt sie sich aus dem Zellsaft den entsprechenden chemischen Buchstaben und prüft, ob er der richtige ist. Ist er es nicht, verwirft sie ihn und wiederholt die Suche. Hat sie dann den ausgewählten Buchstaben an die wachsende Kopie angeheftet, prüft sie ihn nochmals – und wenn er sich als falsch erweist, trennt sie ihn wieder ab und beginnt von vorne. Hat sie auf diese Weise mehrere Buchstaben kopiert, vergewissert sie sich ein drittes Mal. Entdeckt sie einen falschen Buchstaben, schneidet sie ihn heraus und ersetzt ihn durch den richtigen. Nach dem ersten Prüfschritt ist immer noch jeder hunderttausendste Buchstaben falsch, nach den beiden weiteren Schritten nur mehr ein Buchstabe unter 100 bis 200 Millionen. Bei 6,4 Milliarden Buchstaben (menschliches Genom) schleichen sich dennoch einige Dutzende von Fehlern ein. Die meisten sind für die Tochterzellen ohne Folgen. Doch einige verändern sie und verwandeln sie in eine biologische Variante. Zellen könnten die Fehlerrate beim Kopieren noch weiter senken. Sie tun dies aber nicht, weil der Kopiervorgang dann zu langsam wäre, zu viel Energie erforderte und zu wenig neue Varianten schüfe. Es gibt darüber hinaus noch schnell veränderliche Anpassungsgene, die sich nicht kopieren lassen, weil sie mehrmals wiederholte Buchstabenfolgen enthalten, welche die Kopiermaschine ins „Stottern“ bringen. Stotternd gefertigte Genkopien sind dann entweder inaktiv, oder falls die Vorlage inaktiv war, reaktiviert. Auf diese Weise können in erstaunlich kurzer Zeit neue Lebewesen entstehen. Auf eine andere Weise entsteht ebenfalls Vielfalt: Viele Gene und Proteine sind in der Zelle in so kleiner Stückzahl vorhanden, dass ihre chemischen Reaktionen nicht mehr den statistischen Gesetzen der Chemie, sondern dem Zufall gehorchen. Anstatt vorhersagbarer Resultate gibt es dann nur noch zufällige Ja-­‐Nein-­‐
Entscheide. Solche Zufallsentscheide können lawinenartig verstärkt werden und die Entwicklung oder das Verhalten eines Lebewesens langfristig prägen. Die winzige Zufallsschwankung hat ein stabiles Ungleichgewicht bewirkt, wird fixiert und führt zu verschiedenen Erscheinungsformen eines Lebewesens, selbst wenn Gene und Umwelt gleich bleiben. Man spricht von einem „molekularen Rauschen“. Um dennoch eine präzise Entwicklung des Lebewesens zu garantieren, setzen Zellen Rauschfilter ein. Gelegentlich wird das Rauschen aber auch durch die Zelle verstärkt, um die Entstehung von Vielfalt zu ermöglichen. Lebewesen und Organismen haben eine Summe von Genen, das Genom. Ein Individuum ist mit der ihm eigenen Zusammensetzung dieses Genoms ein bestimmter Genotyp, welcher nach aussen als Phänotyp in Erscheinung tritt. Als Genpool bezeichnet man dann die Gesamtheit der Gene, welche in einer einzelnen Art vorkommt. Das Genom kann in einfacher Form vorliegen, indem von jedem Chromosom 1 Exemplar vorhanden ist (haploider Chromosomensatz). Es kann aber auch in mehrfacher Form vorliegen, wobei sehr häufig wie beim Menschen der doppelte (diploide) Chromosomensatz realisiert wurde. Evolution kann stattfinden, indem unterschiedliche Genotypen als Phänotypen unterschiedlich erfolgreich in der Fortpflanzung sind und sich so nach Darwins Theorie immer besser an die Umwelt und das Zusammenleben mit anderen Organismen anpassen und an Komplexität zunehmen. Aber auch im Genom selbst können einzelne DNA-­‐Abschnitte oder Nukleotide in ihrer Replikation mehr oder weniger erfolgreich sein, selbst wenn sie zur Fortpflanzung des Organismus nichts beitragen. Zellteilung Das Wesentliche an unserer Vorstellung von Leben ist aber die Grundeinheit der Zelle. Damit Vermehrung und Fortpflanzung und damit wiederum Evolution stattfinden kann, muss sich nicht nur die DNA, sondern eben die ganze Zelle vermehren, also verdoppeln oder replizieren können. Die ungeschlechtliche Zellteilung und diejenige von Körperzellen laufen nach dem Prinzip der Mitose ab. Die geschlechtlichen Keimzellen hingegen teilen sich nach dem Prinzip der Meiose. Während bei der Mitose das Genom einfach verdoppelt und dann auf eine Mutter-­‐ und eine Tochterzelle verteilt wird, kommt es bei der Meiose nach einer ersten Verdoppelung zu einer Überkreuzung der Chromosomen (Cross-­‐Over), wobei einzelne ihrer Abschnitte zwischen ihnen ausgetauscht werden (Rekombination). Danach teilen sie sich wieder und es liegen am Schluss vier Zellen vor, welche je ein neues haploides Genom in vier verschiedenen Zusammensetzungen des ursprünglichen diploiden Ausgangsgenoms enthalten. Je eine mütterliche und väterliche haploide Keimzelle können sich schliesslich wieder zu einer diploiden „befruchteten“ Eizelle (Zygote) vereinigen. Infolge aller dieser Kenntnisse ist die Wissenschaft natürlich auf die Idee gekommen, die Genome der Lebewesen bis auf die Folge der Basenpaare zu analysieren und die Mutationen nicht nur dem Zufall zu überlassen, sondern aktiv korrigierend oder gestaltend einzugreifen. Daraus resultierten die Gebiete der Genomanalysen und Gentechnik [56] Um neue DNA-­‐Moleküle und veränderte (transgene) Organismen herstellen zu können, verwendet man -­‐ Enzyme, welche DNA-­‐Moleküle spalten und verknüpfen (Restriktasen, Ligasen) -­‐ Vektoren, nämlich Viren oder Plasmide, mit deren Hilfe Fremd-­‐DNA ins Genom eines Lebewesens eingeschleust werden können -­‐ Plasmide, kurze, ringförmige Moleküle von Bakterien, die von Zelle zu Zelle übertragen werden können. Plasmide von Bodenbakterien werden etwa in der Pflanzengentechnolgie verwendet. Für Analysen von Genen und Genomen werden vor allem die folgenden Methoden eingesetzt: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Gelelektrophorese: In einem Polyacrylamid-­‐Gel wandern DNA-­‐Moleküle unter einer elektrischen Spannung unterschiedlich schnell zur Anode. Die Fragmente aus den nicht codierenden Bereichen des Genoms ergeben dabei für jedes Individuum ein charakteristisches Bandenmuster, das auch als genetischer Fingerabdruck bezeichnet wird. Hybridisierung: Den durch Gelelektrophorese getrennten Fragmenten werden mit Fluoreszenz-­‐
Farbstoff markierte DNA-­‐Moleküle mit bekannter Sequenz als „Sonden“ zugefügt. Komplementäre Basenpaarungen können danach dargestellt und abgetrennt werden. DNA-­‐Sequenzierung: Heute gängig ist die Kettenabbruchmethode nach Sanger und Coulson. DNA-­‐Einzelstränge werden mit Nukleotiden gespalten, an die sich keine anderen Nukleotide anlagern können. Die entstandenen Fragmente werden durch Gelelektrophorese getrennt und aus dem Bandenmuster kann die Basensequenz abgelesen werden. Polymerase-­‐Kettenreaktion (PCR):. Nach der Aufspaltung des DNA-­‐Doppelstranges durch Hitze können bekannte Nukleotide zugefügt werden, die sich komplementär mit der zu untersuchenden DNA zu neuen Doppelsträngen verbinden. Das Enzym Polymerase vervielfältigt diese in mehreren automatisierten Zyklen. 3.2 SCHATZ, G., Genomforschung, die Würde des Lebens und die wunderbaren Fehler der Evolution. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004) 149/1: 15-­‐22 Prof. Dr. Gottfried Schatz, Präsident des Schweiz. Wissenschafts-­‐ und Technologierates, 2004 Literaturbericht, wb Das menschliche Genom ist im Jahr 2000 grundsätzlich aufgeklärt worden, wenn auch seine chemische Strukturaufklärung mit den heutigen Methoden bis auf Weiteres noch nicht abgeschlossen werden kann. Schatz meint aber, die moderne Biologie habe uns mit der Gentechnologie nicht nur neue Medikamente und Nahrungsmittel beschert, sondern auch präzise Teilantworten geliefert auf die Fragen: „Was ist Leben?“ oder „Worin liegt die Würde eines Lebewesens?“ Der Autor betont, dass der riesige Unterschied an Komplexität zwischen belebter und unbelebter Materie alleine schon die beiden Materieformen qualitativ trennen kann. Lebende Zellen seien die komplexeste Materie, die bisher im Weltall gefunden wurde. Einfache Viren, eigentlich nur wandernde Gene, keine Lebewesen, enthalten etwa 10 Gene auf einem einfachen Ringmolekül und können damit etwa 10 Proteine produzieren. Sie können sich denn auch nur in lebenden Zellen vermehren, in die sie eindringen. Die einfachsten Lebewesen sind primitive Bakterien, die sich zum Überleben an höher entwickelte Zellen anheften müssen. Ein solches ist das Mycoplasma genitalium. Sein Genom besteht aus 500 Genen mit 580‘700 Buchstaben. Die 500 Proteine, die es fabrizieren kann, sind schon fast die unterste Grenze für lebende Materie. Es ist deshalb auf die „Hilfe“ von Wirtszellen angewiesen und alle Zellen einer Population sind völlig identisch und zeigen weder genetische Freiheitsgrade noch Individualität. Eine nächsthöhere Stufe stellen frei lebende Bakterien dar. Sie haben etwa 5000 Gene mit etwa 4 Millionen Buchstaben und können 5000 Proteine herstellen. Einzelne dieser Proteine können nun aber noch durch Abspaltung kurzer Regionen oder durch Anheftung von Zuckern oder Fettsäuren modifiziert werden, womit sich die Zahl der Proteine auf gut 7500 erhöht. Dies reicht knapp für ein unabhängiges Leben, wobei aber alle Zellen einer Population meist ebenfalls identisch sind. Es gibt aber bereits Ausnahmen, die einige Proteine haben, die sie nicht immer brauchen und die sie deshalb mit einem Ja/Nein-­‐Entscheid ein-­‐ oder ausschalten können. Die molekularen Mechanismen dieser Entscheidung sind als erste Anzeichen von Individualität den allerdings wesentlich komplexeren Schaltprozessen in unserem Gehirn nicht unähnlich. Das Genom des Menschen besteht aus gut 30‘000 Genen mit etwa 3 Milliarden Buchstaben (Basenpaaren) und kann etwa 50‘000 – 70‘000 Proteine herstellen. Zwischen den Genen erstrecken sich aber endlos lange DNA-­‐Abschnitte, die keine erkennbare Erbinformation tragen und die 95% des Genoms ausmachen. Jede Zelle ist diploid, enthält also zwei Exemplare dieser Genreihe, eines von der Mutter und eines vom Vater. Die beiden unterscheiden sich durch hunderttausende von kleinen Fehlern, den Mutationen, welche die Menge und Eigenschaft der produzierten Proteine verändern. Deshalb haben wir von vielen Eiweissen zwei Varianten. Des Weiteren können die Gene auf verschiedene Arten abgelesen werden, und die abgelesene Information kann nachträglich verändert werden. Dazu tragen offenbar die langen DNA-­‐Zwischenstücke ohne Erbinformation bei. So kann ein Gen bis zu einem Dutzend verschiedene Proteine fabrizieren, welche wiederum zusätzlich durch Abspaltung oder Anheftung chemischer Gruppen verändert werden können. Es gibt etwa 1000 Proteine, welche andere Proteine durch Anheften von Phosphorsäuregruppen verändern (Siehe auch Imprinting). Die meisten dieser Veränderungen können noch nicht vorhergesagt werden. Man kann also das menschliche Genom zwar lesen, aber den grössten Teil davon noch nicht verstehen. Man weiss noch nicht, wie viele verschiedene Proteine menschliche Zellen theoretisch machen können. Es scheinen mehrere Hunderttausend zu sein. Dazu kommt noch die riesige Zahl der Antikörperproteine. Zellen des Immunsystems kombinieren und verändern Teile des Genoms in fast unendlich vielen Variationen. Die Zellen können das menschliche Genom mit einem grossen Reichtum an Virtuosität lesen. Bakterien lesen ihr Genom, aber Menschen interpretieren das ihrige. Der Reichtum des menschlichen Genoms liegt nicht nur in seiner Grösse, sondern ebenso sehr in der Virtuosität, mit der die Zellen dieses Genom in vielen Variationen lesen können Zusätzlich zum Genom, welches sich im Zellkern befindet, liegt das Genom der Mitochondrien vor, von es in jeder Zelle Tausende gibt und die aus Nahrung und Sauerstoff Energie produzieren denen (Verbrennung). Dieses Genom wird bei Säugetieren nur von der Mutter vererbt. Es hat etwa 16‘000 Buchstaben und liegt in jedem Mitochondrion in 50 Kopien vor, womit pro Zelle viele tausend seiner Genome vorliegen. Es gilt als gesichert, dass Kombinationen und Kooperationen zwischen den Mitochondrien-­‐Genomen und den Kerngenomen möglich sind. Von all den theoretisch möglichen Proteinen produziert jede Zelle aber nur etwa 10‘000 in einem für sie typischen Spektrum. Diese Differenzierung in verschiedene Zelltypen ergibt die verschiedenen Gewebe des Organismus. Hirnzellen produzieren eine riesige Zahl von Proteinen, welche als neurologische Schalter wirken. Wechselwirkungen mit der Umwelt und anderen Menschen scheinen zudem die Anheftung von Phosphorsäuregruppen zu beeinflussen. Das Variationspotenzial dieser Zellen steigt damit ins Unermessliche, so dass jeder Mensch ein unverwechselbares Individuum ist. Der Informationsreichtum des Genoms schenkt jedem Menschen Einmaligkeit und damit das, was wir auch als „Würde“ bezeichnen. Kleine Genome hingegen bieten keine biologische Freiheit und keine Individualität. Es ist aber nicht bloss die Grösse des Genoms, die Anzahl Gene oder Buchstaben oder die Anzahl der gespeicherten Kopien, die Individualität ausmachen. Mäuse und Schimpansen haben gleich viele Gene wie wir. Einige Pflanzen und Amphibien haben wesentlich grössere Genome als der Mensch. Es sind auch keine besonderen „Schlüsselgene“ bekannt, die Homo sapiens von anderen Säugetieren unterscheiden würden. Der Unterschied muss in einem höheren Grad von Komplexität liegen, die aber noch nicht aussagekräftig erforscht ist. Der Autor denkt dabei an die mögliche Entdeckung neuer Gesetze, die nur für hochkomplexe Systeme gelten. Die heutigen Ansätze zur Chaostheorie kämen da vielleicht in Frage. Die Philosophie habe sich ebenfalls schon mit dem Problem beschäftigt, wie die menschliche Individualität, Freiheit und Würde mit der Tatsache vereinbar sei, dass der Mensch letztlich eine biochemische Maschine ist. Nichts ist am Menschen grossartiger als sein Wissen um die eigene Geschichte. Nie zuvor konnten wir so weit in diese zurückblicken wie heute. Was uns die magischen Augen der Genomforschung zeigen, ist Grund zu Stolz und Demut zugleich. Stolz, weil uns der Reichtum unseres Genoms Individualität schenkt und Demut, weil wir aus zwei Lebewesen entstanden sind und trotz unserer Individualität nur Teil eines viel grösseren Ganzen sind. Schatz weist weiter auf die «Schablonen-­‐Information» hin, strukturelle Informationen in den Mitochondrien, die aber nicht in den beiden Genomen als DNA-­‐Stränge vorliegen. Da sich die Mitochondrien nicht wie die Keimzellen geschlechtlich vermehren, dient jedes als Vorlage, als Matrize für die Zusammensetzung eines neuen Mitochondrions mittels der Bausteine im Genom dieses Teilchens. Diese Schabloneninformationen müssen als genetische Informationen ebenfalls weitervererbt werden, damit unser Leben erhalten bleibt. Wie zahlreich sie sind, ist noch unbekannt. Wie es geschichtlich dazu kam, kann der Autor jedoch summarisch schildern: Vor 4 Milliarden Jahren hatte sich die Erde zwar bereits etwas abgekühlt und Meere waren entstanden, aber ihr Wasser war noch recht warm. Die Atmosphäre enthielt noch keinen Sauerstoff und keine schützende Oxidschicht, weswegen die UV-­‐Strahlung sehr stark war. Zusätzlich gab es zahlreiche aktive Vulkane und viele Gewitter. In dieser Umgebung waren in den Meeren zahlreiche organische Substanzen entstanden. Sie reagierten miteinander und bildeten evolutiv immer kompliziertere Stoffe und Moleküle. Aus diesen bildeten sich auf noch unbekannte Weise innert 200 Millionen Jahren die ersten lebenden Zellen und ernährten sich von den übrigen organischen Stoffen in den Meeren. Sauerstoff brauchten sie für ihren Stoffwechsel nicht und es gab ja auch keinen. Nachdem die vorhandenen organischen Nährstoffe in den Meeren aufgebraucht waren, starben die meisten lebenden Zellen wieder aus. In dieser Krise überlebten aber wenige Zellen, welche das Sonnenlicht mittels der Photosynthese als Energiequelle nutzen konnten, nämlich die Cyanobakterien. Sie verbreiteten sich auf der Erde rasant und ihre Spuren sind heute noch als riesige versteinerte Koloniehügel unter dem Namen Stromatolithen erhalten. Bald folgte aber die nächste Krise für das Leben: Als Endprodukt der Photosynthese wurde Sauerstoff freigesetzt, der für lebende Zellen giftig ist. Er reicherte sich in der Atmosphäre immer mehr an und als Folge dieser „Umweltverschmutzung“ starben wiederum gute 99% der Lebewesen aus. Die Überlebenden hatten Schutzmechanismen entwickelt, die auch heute noch, etwa in unseren Lungenbläschen, unsere Zellen vor dem Sauerstoff schützen. Das Leben breitete sich wieder auf dem Erdball aus und der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre stieg auf 20% an. Schliesslich entstanden Zellen, welche die organischen Abfallsubstanzen der abgestorbenen Zellen zusammen mit Sauerstoff verbrennen und daraus Energie gewinnen konnten. Diese „Abfallverwerter“ waren also die ersten „atmenden“ Zellen. Sie waren sehr erfolgreich, da sie auch nachts und ohne Sonnenlicht wachsen konnten. Der Autor fasst nun die Situation vor 2-­‐3 Milliarden Jahren zusammen: Es gab drei Gruppen von Lebewesen in der Form von Bakterien, also mit sehr kleinem Genom, ohne die Fähigkeit der Individualität oder der Bildung mehrzelliger Organismen. 1.
2.
3.
Zellen, die ihre Energie aus dem Sonnenlicht gewannen (phototrophe Bakterien) Zellen, welche die Überreste der ersten Gruppe durch Atmung mit Sauerstoff verbrannte. Die Gruppe der ersten lebenden Zellen, die sich ohne Photosynthese und ohne Atmung von frei gelösten organischen Stoffen ernährte. Sie hatte eine „veraltete“ Energieproduktion und war wenig erfolgreich. Vor 1,5 Milliarden Jahren gelang es aber gerade der dritten Gruppe, ihren Stoffwechsel zu verbessern, indem sie sich atmende Bakterien, also der Gruppe 2, einfing und in ihren Zellen „gefangen“ hielt. Diese produzierten nun für ihre Wirtszelle Energie und erhielten als „Gegenleistung“ eine schützende Umgebung. Sie gewöhnten sich an diese Symbiose und gaben im Lauf der Zeit den grössten Teil ihres Genoms an das Genom der Wirtszelle ab. Sie wurden zu den Mitochondrien, den Verbrennungsmaschinen unserer Körperzellen. Der neue durch Verschmelzung zweier Lebewesen mit zwei Genomen entstandene Zelltyp war erfolgreich und konnte sich zu vielzelligen Pflanzen und Tieren entwickeln. Auch Cyanobakterien wurden so eingefangen und wurden zu Chloroplasten, welche nun für ihre Wirtszellen Energie mittels der Photosynthese aus Sonnenlicht produzierten. Diese Wirtszellen sind die modernen Pflanzenzellen und sie sind also eine Verschmelzung von drei Lebewesen und enthalten sowohl Mitochondrien also auch Chloroplasten. Die Mitochondrien unserer Zellen entstehen immer noch wie ihre Vorfahren durch Teilung. Sie benötigen deshalb immer noch die dazu nötigen Informationen. 3.3 HERGERSBERG, M., Das Human-­‐Genom-­‐Projekt: Die Entschlüsselung des menschlichen Erbmaterials. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1999) 144/3: 13-­‐127 Dr. Martin Hergersberg, Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich, 1999. Literaturbericht, wb Da diese Publikation aus dem Jahr 1999 stammt, kann der Bericht darüber nicht allerneuste Forschungsresultate präsentieren. Interessant in Bezug auf die Evolutionstheorie ist sie vor allem als ein Stück Wissenschaftsgeschichte der jüngsten Vergangenheit, in welcher die Geschwindigkeit der Wissensvermehrung exponentiell zugenommen hat. Der Autor beginnt damit, wie im Jahr 1977 die technische Möglichkeit eröffnet wurde, die genaue Reihenfolge der vier Basen Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin in einem DNA-­‐Fragment zu bestimmen. 1986 hätten verschiedene Arbeitsgruppen die Idee einer Sequenzbestimmung des gesamten menschlichen Genoms erörtert, aber auch sehr hitzig kontrovers diskutiert. Man hielt das Projekt zum Teil für „bizarr“, wenn auch „technisch möglich“, aber nicht Erkenntnis bringend. 1988 wurde das Human Genome Projekt HGP der USA vom Kongress bewilligt. Danach entstanden in weiteren Ländern nationale Genomprojekte, die aus staatlichen und privaten Quellen finanziert wurden. Daneben wurde 1989 die Human Genome Organisation gegründet mit dem Ziel, die Analysen aus den verschiedenen Ländern zu koordinieren. Die 1999 und heute allgemein angewandte Methode der Analyse ist der sequenzspezifische Einbau von strangabbrechenden Nukleotiden (Dideoxynukleotide, nach Sanger). Stark vereinfacht kann die Methode folgendermassen dargestellt werden: Der DNA-­‐Strang wird zuerst durch Hitze in seine zwei Stränge aufgespalten, danach werden einzelne Abschnitte durch radioaktiv markierte Basen und durch vier in verschiedenen Farben fluoreszierende Nukleotide sichtbar gemacht. Diese Vorgänge laufen heute in Automaten ab. Die ursprüngliche manuelle Methode war etwas komplizierter. Nach einer elektrophoretischen Auftrennung dieser an den Enden von DNA-­‐Fragmenten gebundenen Nukleotide können durch einen Laser identifiziert werden. Die Daten gelangen anschliessend in einen Computer zur Darstellung der Sequenz. Mit den 1999 zur Verfügung stehenden Sequenzierungsautomaten konnten pro Tag ca. 500 000 Basenpaare (bp) sequenziert werden. Zur Sequenzierung konnten gentechnologisch vervielfältigte, also klonierte Bruchstücke des Genoms mit je 1000 – 2000 bp gelangen. Da das menschliche Genom etwa 3 Milliarden Basenpaare umfasst, welche auf 23 Chromosomen in doppelter Zahl verteilt sind, muss es zuerst in kleine Fragmente unterteilt und kartiert werden. Diese Fragmente werden wie erwähnt vervielfältigt. Dies wird als shotgun-­‐cloning bezeichnet. Grosse Fragmente werden dabei mehrmals in Form zahlreicher kleiner Fragmente sequenziert, was eine Kontrolle der Genauigkeit erlaubt. Die Kartierung besteht in der Charakterisierung und Vorbereitung der zu sequenzierenden Klone. Im Finishing werden unklare Daten und unzureichende Überlappungen kontrolliert und bei Bedarf nochmals sequenziert. Die Karte eines Genoms bezeichnet die Lage verschiedener Orientierungspunkte (Marker) zu einander. Marker sind Abschnitte mit bereits bekannter Basensequenz und phänotypischer Eigenschaft und heissen Sequence tagged sites (STS). Ihre Anwesenheit in einem Klon kann mit der Polymerasekettenreaktion (PCR) bestimmt werden. Eine spezielle Nomenklatur weist jedem STS-­‐Marker einen eindeutigen Namen zu. Ein D bedeutet einen DNA-­‐Marker und die darauf folgende Zahl bezeichnet das Chromosom, auf dem er lokalisiert ist. S steht für einen singulären Marker und ist gefolgt von einer Laufzahl. So ist DXS984 ein Marker auf dem X-­‐
Chromosom in der Nähe des Gens für den Blutgerinnungsfaktor 9. Je weiter zwei Marker auf einem Chromosom voneinander getrennt liegen, umso wahrscheinlicher werden Rekombinationen zwischen ihnen beobachtet. Man spricht dann vom genetischen Abstand, welcher in centiMorgan (cM) angegeben wird. 1 cM entspricht einer Rekombination in 100 beobachteten Meiosen. Für diese genetische Kartierung sind polymorphe Marker von Bedeutung, also Allele, von denen verschiedene Sequenzvarianten bekannt sind. Mit dem Ausdruck physikalische Kartierung bezeichnet man ihre räumliche Lokalisierung auf dem Chromosom. Eine Serie überlappender Klone wird Contig genannte und entspricht einem längeren chromosomalen Abschnitt. Ein Contig des gesamten Genoms stellt dann die Basis für seine Sequenzierung dar. Je kleiner die verwendeten Klone sind, im Idealfall die DNA-­‐Sequenz, umso höher ist die Auflösung der physikalischen Karte. Zur Klonierung werden einerseits auch bakterielle Vektoren eingesetzt, welche DNA als Inserts aufnehmen können. Anderseits können durch Bestrahlung DNA-­‐Abschnitte aus Zelllinien herausgelöst und vermehrt werden. Sie werden radiation hybirds genannt und ihre Grösse wird durch die Intensität der Strahlung bestimmt. Etwa 40% des menschlichen Genoms bestehen allerdings aus DNA-­‐Sequenzen, die in Kopien zu mehreren Millionen vorliegen und in den meisten Fällen nicht die Information für ein Protein enthalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin Gene mit wichtigen Funktionen verstecken, wird als klein angesehen. Ab 1998 konnte die jährliche Sequenzbestimmung auf etwa 100 Megabasen gesteigert werden. Bis dahin waren 11,7 % des menschlichen Genoms sequenziert und in Datenbanken gespeichert. Weitere 7,1% lagen in einer provisorischen Arbeitsversion vor. 20 000 polymorphe Marker waren bekannt und durch Kopplungsanalysen lokalisiert. Dank der hohen Auflösung der genetischen Karten von unter 1 cM konnten bereits einzelne Krankheitsgene lokalisiert werden. Um das Hauptziel, die Identifikation aller menschlichen Gene zu erreichen, wurden grosse Anstrengungen zur Bestimmung der in Proteine übersetzten Gene der verschiedenen Zelltypen und Entwicklungsstadien unternommen. Dazu konzentrierte man sich auf kleine mRNA-­‐Fragmente von 100-­‐300 bp, sogenannte expressed sequence tags (EST). Im Juli 1999 waren in der grössten Datenbank der USA ca. 2,7 Millionen ESTs und ca. 30 000 Gene gespeichert. Durch den Vergleich von mRNA-­‐Sequenz und ihrer komplementären DNA-­‐Sequenz kann auch die Intron-­‐Exon-­‐Struktur des Genes bestimmt werden, also die Frage, welche Anteile des Gens exprimiert werden. Die angestrebte Präzision beträgt 0,01%, also 1 falsche Base in einer Sequenz von 10 000 bp. Ein weiteres Ziel des HGP ist die Entdeckung und Kartierung phänotypischer und genotypischer Polymorphismen. Dazu wurde schon 1991 das Human Genome Diversity Projekt gegründet. Es sucht systematisch nach Sequenzunterschieden in menschlichen Populationen. Je zwei Menschen unterscheiden sich in etwa 3 Millionen bp der insgesamt 3 Milliarden bp des haploiden Genoms. Die meisten dieser Unterschiede betreffen Polymorphismen einzelner Nukleotide (Single nucleotide polymorphisms, SNPs) in Genen. Diese Varianten haben oft einen Einfluss auf die Funktion der codierten Proteine, wobei die Auswirkungen auf den Phänotyp aber meist nicht bekannt sind. Für die Lokalisierung von Krankheitsgenen wird den SNPs aber eine grosse Bedeutung zugeschrieben, da mit ihrer Hilfe die Analyse biallelischer Polymorphismen automatisiert werden kann und da sie eine geringe Mutationsrate haben. Die Herstellung äusserst genauer Genom-­‐Karten sollte mit dieser Technik in der Zukunft möglich sein. Das HPG war mit der Bereitstellung der riesigen Informationsmengen auch ein Schrittmacher der Bioinformatik. Dank der graphischen Darstellung konnten genetische und physikalische Karten zu einem Human-­‐Genom-­‐Sequenz-­‐Index integriert werden. Viele Programme erlauben bereits die Erkennung von Genen und von Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen genomischen Regionen oder zwischen ganzen Genomen. Im Frühjahr 1998 wurde von einigen Genom-­‐Firmen (Craig Venter, PE-­‐
Biosystems) angekündigt, durch Anwendung der Shotgun-­‐Strategie und mit neuen Sequenzierautomaten das menschliche Genom schneller und billiger zu sequenzieren. Der aufwendige Schritt der physikalischen Kartierung sollte dabei übersprungen werden können. Geplant war, die Sequenz des menschlichen Genoms im Frühjahr 2000 vorzulegen. Ein weiterer Bestandteil des HGP ist die Bestimmung der vollständigen Sequenz der Genome zahlreicher anderer Organismen. Man erhofft sich ein besseres Verständnis der biologischen Funktion unbekannter Gensequenzen durch die Erforschung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Genomen verschiedener Organismen (Phylogenomik). Dazu sind gut bekannte Genome einiger Modellorganismen geeignet. Das Verständnis ihrer Gene ergibt oft Hinweise auf die Rolle verwandter Gene etwa beim Menschen. Zuerst wurden die relativ kleinen Genome von Mikroorganismen bearbeitet. 1999 lagen 26 Genom Sequenzen vollständig im Internet abrufbar und 70 weitere waren in Bearbeitung. Das erste vollständig bekannte Genom eines Eukaryoten war dasjenige der Hefe Saccharomyces cerevisiae, und das grösste bekannte Genom ist dasjenige des Fadenwurms Caenorhabditis elegans. Man blickt bereits voraus auf eine „postgenomische“ Ära, in der die Kenntnis zahlreicher Genome die Grundlage für experimentelle Strategien darstellen wird. Die detaillierte Kenntnis des menschlichen Genoms ist auch eine Voraussetzung für die Bestimmung von Genen, die zur Entstehung von monogenen Krankheiten und Befindlichkeiten beitragen. Diese entstehen durch Mutationen in einem einzigen Gen. Bisher sind 500 Gene identifiziert worden, deren Mutation einer Krankheit zu Grunde liegt. Es muss dabei nachgewiesen werden, dass das Auftreten einer Krankheit in Familien mit der Wirkung eines einzigen Gens vereinbar ist. Der Ort des mutierten Gens im Genom kann mit Hilfe von polymorphen Markern bestimmt werden. In den Datenbanken kann dann nach Genen und ESTs in dieser Region gesucht und mit Sequenzierungen können Mutationen entdeckt werden. Auch Gene, die durch Chromosomenbruch zerstört wurden, können Krankheiten verursachen. Die Identifikation von mutierten oder geschädigten Genen wird durch die Ergebnisse des HGP entscheidend beschleunigt. Weniger erfolgreich sind die beschriebenen Methoden jedoch bei der Bestimmung genetischer Ursachen von komplexen Krankheiten, da diese eine genetische Komponente durch Allele an verschiedenen Genorten haben, und erst unter bestimmten Umwelteinflüssen in Erscheinung treten. Dazu gehören etwa Herzkreislauferkrankungen, Krebserkrankungen oder zahlreiche psychiatrische Erkrankungen. Man spricht von sogenannten Anfälligkeitsallelen, wenn in einem kleinen Bereich des Genoms viele erkrankte Personen eine andere Allelverteilung zeigen als die Kontrollpopulation (Koppelungsungleichgewicht). In diese Forschung ist auch das bereits erwähnte Human Genome Diversitiy Projekt involviert. Es untersucht überdies auch Allele, die vor Krankheiten schützen. Mit Hilfe des HGP können auch Fragen der Tumorbiologie angegangen werden. Es können Gene identifiziert werden, deren mRNA in einem Tumor in veränderter Konzentration vorliegt im Vergleich mit normalem Gewebe. Mit demselben Ansatz kann dann nach Medikamenten gesucht werden, welche die Veränderungen in den Tumorzellen beeinflussen. Die durch das HGP gewonnen Informationen sind zudem wichtig für Diagnostik seltener genetischer Veränderungen. Der Autor erwähnt als Beispiel aus seinem Labor den Fall einer Blutgerinnungsstörung, einer Hämophilie B bei einem 2-­‐jährigen Knaben, welcher zugleich von einer geistigen und motorischen Entwicklungsstörung betroffen war. Die Hämophilie wird durch eine Mutation des Gens auf dem X-­‐
Chromosom für den Blutgerinnungsfaktor F9 verursacht. Da die Männer nur 1 X-­‐Chromosom haben, sind die Träger der Mutation von der Hämophilie betroffenen, während dem die Frauen mit 2 X-­‐Chromosomen die Krankheit zwar an ihre Kinder weitergeben können, selbst aber nicht daran leiden. Die gleichzeitig vorliegende Entwicklungsstörung bei diesem Knaben liess vermuten, dass durch eine grosse Gendeletion (Verkürzung) auf dem X-­‐Chromosom zwei Gene inaktiviert worden waren, die neben einander liegen. Tatsächlich wurde diese Deletion gefunden. Bei zwei Hämophilie-­‐Patienten aus England zeigte sich durch die Untersuchung der STSs und ESTs eine noch grössere Deletion des F9-­‐Gens, aber keine geistige Entwicklungsstörung. Aufgrund dieses Befundes konnte die Entwicklungsstörung nicht der Deletion auf dem X-­‐Chromosom angelastet werden, wohl aber die Hämophilie. Die physikalischen Karten dieses Chromosoms erscheinen daher noch unvollständig und ihre Beziehungen zu den genetischen und cytogenetischen Karten sehr kompliziert. Die betroffenen Gene können deletiert sein, ohne einen eindeutig definierten Phänotyp zur Folge zu haben. Das HGP und die enorme Zunahme der genetischen Informationen führen schliesslich zu vielen psychologischen, sozialen, ethischen und politischen Fragen und Problemen. Es ist bereits eine grosse Besorgnis über eine Entwicklung zum „gläsernen Menschen“ entstanden, dessen „Defekte“ in Form von Anfälligkeitsallelen zu Diskriminierungen am Arbeitsplatz und bei Kranken-­‐ und Lebensversicherungen führen könnten. Die pharmazeutische Industrie hat mit ihren Begehren zur Sammlung und Auswertung genetischer Informationen solche Ängste etwas mit verursacht. Zudem wurde der Krankheitsbegriff in seiner Definition immer undeutlicher, da statistisch jeder Mensch als Träger einer unbekannten Zahl von potentiell krank machenden Allelen betrachtet werden muss. Das HGP investiert deshalb 5% seiner Mittel in die Untersuchung ethischer, sozialer und legaler Fragen (ELSI-­‐Bereich: ethical, legal and social issues). Diese betreffen etwa die folgenden Probleme: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Gerechtigkeit in der Verwendung genetischer Informationen Versicherer, Arbeitgeber, Gerichte, Schulen und andere Institutionen. Wer soll Zugang zu genetischen Informationen haben und sie auf welche Weise nutzen dürfen? Wie kann die Vertraulichkeit genetischer Informationen gewährleistet werden? Mit welchen psychologischen und sozialen Folgen aufgrund genetischer Unterschiede ist zu rechnen? Gibt es Hinweise auf Ausgrenzung? -­‐
-­‐
Sind genetische Tests zuverlässig und werden sie korrekt interpretiert und den Ratsuchenden vermittelt? Sollen genetische Test auch durchgeführt werden, wenn für die untersuchte Krankheit zum Zeitpunkt der Untersuchung keine therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen? Unter diesen Fragen hat sich der Schwerpunkt des HGP etwas verschoben. Man ist davon abgekommen, in der Sequenz des menschlichen Genoms den Gral biologischer Erkenntnis zu sehen. Man erblickt darin eher eine Voraussetzung zur funktionellen Analyse der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den Genen und ihren Produkten sowie zwischen biologischen Voraussetzungen und Umweltbedingungen. Es ist auch eine Sensibilität für die Aspekte von Vererbung und Solidarität entstanden. Das HGP hat so in vielen Bereichen zu einem vertieften Nachdenken geführt. 3.4 BRUNNER, E., Proteom der Fruchtfliege weitgehend erschlossen. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2007) 152(3):97-­‐98 Dr. Erich Brunner, Center for Model Organism Proteoms, Institute of Molecular Biology, Universität Zürich Literaturbericht, wb Der Autor resümiert in diesem Aufsatz die Forschungsresultate seines Teams, welche er in „Nature Biotechnology“ (Vol. 25, No. 5) publizierte. Proteine werden in den Zellen von Genen, also DNA-­‐
Abschnitten exprimiert und sind die zentralen Elemente biologischer Prozesse. Sie definieren Struktur, Stoffwechsel und Wechselwirkungen von Zellen innerhalb eines Organismus. Viele Krankheiten beruhen auf fehlerhafter Regulation von Zellproteinen. Die Summe aller Proteine eines Organismus heisst Proteom und ist heute nach den Analysen der Genome, der Summe aller Gene eines Organismus, prioritärer Gegenstand biologisch-­‐medizinischer Forschung. Bis heute ist es zwar noch nicht möglich, eine komplette Analyse eines Systems, z.B. eines Gewebes, durchzuführen. Dem Autor und seiner Gruppe aus UNI und ETH Zürich ist aber ein wichtiger Schritt in diese Richtung gelungen. Gegenstand der Studie war das Proteom der Taufliege Drosophila melanogaster, welches zu 63 % gemessen und katalogisiert werden konnte. Die aus verschiedenen Entwicklungsstadien und Zellkulturen extrahierten Proteine wurden durch enzymatische Verdauung in Peptide aufgespalten und diese wurden im Massenspektrometer analysiert. Die vom Autor eingesetzte bioinformatorisch-­‐
statistische Analyse der experimentellen Daten unterstützte die Messungen und verhalf zu neuen Experimenten, so dass schliesslich ein einmaliger, mehrere Terabytes umfassender Datensatz erarbeitet werden konnte. Zum ersten Mal konnten dank dieser Methode die auf der Gensequenz der Proteine basierenden Vorhersagen validiert werden. Zudem können die Messergebnisse eingesetzt werden, um bestehende Gen-­‐Modelle zu verbessern und bisher unbekannte Proteine und deren Gen-­‐Modelle zu entdecken. Eine Vielzahl von Proteinen eines Gewebes können nun auch gezielter und schneller erfasst werden. Zur Identifizierung eines Proteins genügt allerdings schon eine spezifische Untereinheit, ein „proteotypisches Peptid“, welches eine einmalige Signatur eines Proteins darstellt. Der vom Autorenteam publizierte Proteomkatalog ermöglicht es nun, diese einzelnen Signaturen für die Proteine der Drosophila zu bestimmen. Mit der neuen Methode wird daher der Aufwand für die Messung von Proteinsignaturen und die Generierung quantitativer Daten über zahlreiche Proteine deutlich geringer werden. Auch die noch fehlenden Proteinsignaturen für andere Organismen können nun per Computer berechnet werden, was für die Grundlagenforschung wie auch für die humane Krankheitsdiagnostik von grossem Nutzen sein wird. 3.5 KUBLI, E., BOPP, D., Sex bei den Insekten. Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 2011. Prof. Dr. Eric Kubli, Dr. Daniel Bopp Institut für molekulare Biologie der Universität Zürich Literaturbericht, wb Eine zentrale Rolle im Leben der geschlechtlichen Organismen nimmt die Reproduktion ein. Die Autoren betonen, dass die Evolution eine riesige Fülle von hochkomplexen Mechanismen hervorgebracht hat, die aber auch Gemeinsamkeiten haben. Auch die Mechanismen, welche das Geschlecht eines Individuums festlegen, sind höchst unterschiedlich, obwohl ein allgemeingültiges Konzept der genetischen Kontrolle dieser Entscheidung ersichtlich ist. Ebenso wurde nach Kubli und Bopp in neuerer Zeit ein „Kampf der Geschlechter“ erkennbar, indem bei der Fliege Drosophila ein „Sex-­‐Peptid“ gefunden wurde, welches generell bei Insekten vom Männchen bei der Begattung zusammen mit den Spermien auf das Weibchen übertragen wird und für dieses nachteilige Folgen hat. Die Komplexität der biologischen Phänomene ist auch auf der molekularen Ebene vorhanden. Die geschlechtliche Fortpflanzung besteht darin, dass die Erbinformation zweier Individuen so zusammen geführt wird, dass ein neuer Organismus daraus entstehen kann. Ein Spermium und eine Eizelle müssen dabei miteinander verschmelzen. Die beiden Zellen müssen miteinander kompatibel sein und sich zur Fusion finden. Dazu werden zwei Geschlechter gebildet, die auf die Produktion einer der beiden Keimzellen (Gameten) spezialisiert sind und sie zusammen bringen. Es gibt aber auch Arten, deren Mitglieder beide Zelltypen herstellen können (funktionelle Zwitter). In einigen Fällen können Zwitter auch sich selbst befruchten, wobei aber kein Austausch von Erbinformation stattfinden kann. Gerade das ist aber ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der geschlechtlichen Fortpflanzung. Die genetische Vielfalt und die schnelle Anpassung an die sich verändernde Umwelt wurden erst dadurch möglich. Teil 1: Geschlechtsbestimmung bei Insekten Die Autoren stellen in dieser Arbeit die Fortpflanzungsmechanismen der Insekten vor, welche in einer riesigen Artenvielfalt gut 80% der bekannten Tierarten ausmachen. Sie gingen der Frage nach, in welchen Aspekten sich Männchen und Weibchen unterscheiden und wie bestimmt wird, ob ein Individuum das eine oder das andere Geschlecht bekommt. Gibt es dafür ein gleichbleibendes Prinzip, oder hat die Natur immer wieder neue Strategien erfunden? Tatsächlich haben die Insekten zahlreiche verschiedene Mechanismen zur Fortpflanzung und Geschlechtsbestimmung. Es gibt sogar Ameisenarten, bei denen man drei Geschlechter vermutet, nämlich ein Weibchen und zwei genetisch unterschiedliche Männchen. Je nachdem, mit welchem Männchen sich die Königin paart, entstehen sterile Arbeiterinnen oder eine fruchtbare Königin. Bei der Hongbiene wiederum entscheiden Sekretzusätze in der Nahrung, ob eine fruchtbare Königin entsteht. Die beiden Geschlechter unterscheiden sich oft nur durch kleinste anatomische Unterschiede, die von aussen nicht erkennbar sind. Bis ins 19. Jh. war man der Meinung, dass Umwelteinflüsse die geschlechtliche Identität eines Individuums festlegen könnten. Erst mit der besseren Mikroskopie an der Wende zum 20. Jh. konnte die Bedeutung der Geschlechtschromosomen (Gonosomen) erkannt werden, indem bei Weibchen zwei X-­‐Chromosmen und bei Männchen ein X-­‐ und ein Y-­‐Chromosom (heterogametisches Geschlecht) gefunden wurde. Bei der Heranreifung der Keimzellen erhalten Eizellen deshalb immer ein X-­‐Chromosom, während Spermien entweder ein X-­‐ oder ein Y-­‐Chromosom abbekommen. Das menschliche Y-­‐Chromosom ist ziemlich verkümmert, denn es enthält weniger als 100 Gene, das X-­‐
Chromosom hingegen etwa 2000. Ursprünglich waren die beiden identisch, da sie vom gleichen Chromosomenpaar abstammen. In den letzten 300 Millionen Jahren ist das Y-­‐Chromosom aber durch Mutationen und Verlust von Genen zusammengeschrumpft. Der Grund dafür könnte das Fehlen der Rekombination sein, die in der Meiose bei X-­‐ und Y-­‐Chromosom nicht stattfindet, nur bei allen anderen Chromosomen, den sog. Autosomen. Die Rekombination ist aber ein Mittel, um Fehler in der Information der DNA auszumerzen. Es wurde deshalb postuliert, dass das Y-­‐Chromosom und damit die Männchen bis in 125 000 Jahren nicht mehr funktionsfähig sein könnten und aussterben würden. Neuste Forschungen haben aber gezeigt, dass das Y-­‐Chromosom über eigene Reparaturmechanismen verfügt, um weitere Verluste von Genfunktionen einzudämmen. Es bestehen also nach Ansicht der Autoren durchaus Hoffnungen für das Überleben von „Adam“. Allerdings gibt es Fälle, bei denen Temperatur-­‐unterschiede, etwa die Bebrütungstemperaturen bei einigen Reptilien-­‐ und Amphibienarten, eine entscheidende Rolle bei der Geschlechtsbestimmung spielen. Auch bei Insekten können hohe Temperaturen Geschlechtsumwandlungen bei Embryonen auslösen. Es gibt temperatursensitive Allele von Genen, deren Aktivität massgeblich ist. Zudem ist das XX-­‐XY-­‐System zwar bei Wirbeltieren sehr verbreitet, bei Insekten hingegen nur eine Variante unter vielen, die nachfolgend beschrieben werden: Das XX-­‐XY-­‐System besteht darin, dass das heterogametische Geschlecht XY männlich ist. Das Geschlecht kann auf zwei Arten bestimmt werden: Entweder enthält das Y-­‐Chromosom einen dominanten Faktor für die Entwicklung zu Männchen, oder die doppelte Anzahl von X-­‐Chromosomen ist ein Signal für die weibliche Entwicklung. Das Y hat dann keinen Einfluss auf die Entscheidung. Ist das heterogametische Geschlecht hingegen weiblich, spricht man von einem ZZ-­‐ZW-­‐System. ZW-­‐
Individuen sind also weiblich. Auch hier kann die Geschlechts-­‐Bestimmung auf beide Arten wie im XX-­‐XY-­‐
System ausgelegt sein. Ein weiteres System weist keinen Unterschied auf im Chromosomensatz der beiden Geschlechter. Man vermutet hier einen einzelnen dominanten Faktor, welcher die geschlechtliche Identität festlegt. Möglicherweise verkümmern solche Chromosomen über längere Zeit. In seltenen Fällen bestimmt die genetische Ausstattung des Muttertieres das Geschlecht der Nachkommen. Es gibt zwei Typen von Weibchen, solche, die nur männliche, und solche die nur weibliche Tiere hervorbringen. Ein anderes Beispiel für die Vielfalt der Systeme ist ein Mechanismus, bei dem die Anzahl der Chromosomensätze über männlich oder weiblich entscheidet. Haploide Individuen (mit nur 1 Chromosomensatz) entstehen aus unbefruchteten Eizellen und sind Männchen. Aus befruchteten Eizellen hingegen entstehen diploide Individuen (doppelter Chromosomensatz), welche dann Weibchen werden. Man schätzt, dass sich etwa 20% aller Tierarten dieses Mechanismus bedienen. Eine Besonderheit bei Insekten ist das Vorkommen von Hermaphroditen oder Gynander, die aber nicht funktionell sind. Diese Tiere sind genetische Mosaike, die aus einem Gemisch von männlichem und weiblichem Gewebe bestehen. Ihre Zellen können die geschlechtsbestimmenden Instruktionen offenbar verschieden voneinander interpretieren. Man spricht von einer zellautonomen Differenzierung. Bei Säugetieren hingegen sind es vor allem die in Keimdrüsen gebildeten geschlechtsspezifischen Hormone, welche durch den Blutkreislauf zu den Körperzellen gelangen und die Instruktionen für männliche oder weibliche Entwicklung übermitteln. Auch Parasiten können das Geschlecht des Wirtes beeinflussen. Zwischen 17 und 70% aller Insektenarten werden z.B. infiziert durch den Parasiten Wolbachia, ein gramnegatives Bakterium. Es nistet sich in die Eizelle von Insekten ein und wird so an die nächsten Generationen weitergegeben. Spermien sind als Vehikel für den Parasiten hingegen zu klein. Für das Überleben von Wolbachia ist es daher von Vorteil, wenn möglichst viele Weibchen vorhanden und infiziert sind. Der Parasit kann tatsächlich in den Prozess der Geschlechtsbestimmung des Wirtes eingreifen und ihn so manipulieren, dass mehrheitlich Weibchen entstehen. Trotz der Verschiedenheit dieser Systeme, die sogar in einzelnen Fällen in ein und derselben Art nebeneinander vorkommen können, wurde eine überall gleiche Grundlage der Signalübermittlung gefunden. Wichtig ist offenbar, dass die Entscheidung früh in der Individualentwicklung erfolgt, und dass alle Zellen des Organismus dieselbe Identität bekommen. Der Entscheidungsweg besteht nach den Resultaten der Autoren aus drei Stufen, aus der 1. Instruktion, 2. der Übertragung 3. der Ausführung Die Instruktion besteht aus einem Primärsignal, welches von einem direkt untergeordneten Gen gelesen und weiter übertragen wird. Dieses Gen funktioniert somit als genetischer Schalter, der entweder aktiviert wird oder inaktiv bleibt. Beide Zustände sind vergleichbar mit den in der binären Computersprache verwendeten Zuständen 1 und 0. Der gewählte Zustand „Ein“ oder „Aus“ wird dann auf weitere untergeordnete Gene übertragen bis er zu den eigentlichen ausführenden Differenzierungsgenen gelangt. Z.B. müssen die Dotterproteingene in weiblichen Fettkörperzellen aktiviert werden, in den männlichen jedoch ausgeschaltet bleiben. Man geht davon aus, dass es zwar verschiedene, diversifizierte Primärsignale gibt, dass diese aber immer dieselben Schaltergene für die Weiterleitung der Geschlechtsbestimmung benutzen. Die Natur scheint also gerne bewährte Mechanismen beizubehalten, auch wenn die Variation der Primärsignale zu verschiedenen Phänotypen führt. Am besten untersucht sind diese Vorgänge bei der Taufliege Drosophila melanogaster, welche schon seit hundert Jahren Gegenstand genetischer Forschungen ist. Bei ihr wird das Geschlecht durch die Anzahl der X-­‐Chromosomen bestimmt, während das Y keine Signalwirkung hat. Das XX-­‐Signal wirkt offenbar bereits 2 Stunden nach der Befruchtung und die etwa 6000 Zellen, die nach 13 Zellteilungen entstanden sind, können dieses Primärsignal unabhängig voneinander lesen und interpretieren. Die Frage, wie die X-­‐
Chromosomen gezählt werden und wie der Unterschied erkannt wird, wurde 1978 durch die Identifikation des Schaltergens Sex-­‐lethal (Sxl) beantwortet. Sein Aktivitätszustand „Ein, weiblich“ oder „Aus, männlich“ bestimmt die weitere Entwicklung wie beschrieben. Sxl spielt zudem die Rolle eines Gedächtnisses, welches gewährleistet, dass die einmal festgelegte Identität auch bei allen Tochterzellen bestehen bleibt. Es braucht aber eine bestimmte Menge der Aktivatoren auf dem X-­‐Chromosom, also der Gene, welche die Transkription von Sxl in Gang bringen, damit dieses Gen eingeschaltet wird. Nur wenn 2 X-­‐Chromosomen vorhanden sind, wenn also zwei Genkopien aller Aktivatoren vorliegen, genügt es, dass das Sxl-­‐Gen eingeschaltet wird. Es produziert dann das Protein SXL, welches mittels mRNA-­‐Spleissung die nicht codierenden mRNA-­‐
Anteile des nächsten untergeordneten Übertragungsgens tra heraus-­‐schneidet, damit die mRNA an den Ribosomen „lesefähig“ macht und somit dessen Produktion seines Proteins TRA in Gang bringt. Dieses Protein wirkt auf dieselbe Weise auf das Ausführungsgen doublesex (dsx), welches darauf das Protein DSX herstellt, welches die Differenzierungsgene für die weibliche Entwicklung aktiviert. (Gene werden klein und kursiv geschrieben, die von ihnen codierten Proteine gross und normal) Ist jedoch nur 1 X-­‐Chromosom vorhanden, reicht die Menge an Aktivatoren nicht aus, um Sxl zu aktivieren. Folgedessen wird auch tra nicht eingeschaltet, was zur Folge hat, dass aus dsx eine männliche Variante hergestellt wird, die nur diejenigen Differenzierungsgene aktiviert, welche die männliche Entwicklung einleiten. Die meisten Differenzierungsgene, von denen bereits einige identifiziert sind, werden offenbar direkt von solchen Proteinvarianten reguliert. Auf diese Weise wird auch das „Liebesleben“ der Drosophila gesteuert. Das Männchen zeigt ein Balzritual und produziert mit seinen Flügeln einen „Liebesgesang“. Dieses Verhalten wird nicht erlernt und besteht geschlechtsspezifisch angeboren nur bei den Männchen. Nur wenn das Übertragungsgen tra ausgeschaltet ist, wird das Balzverhalten während der Entwicklung des Nervensystems festgelegt. Wenn man experimentell dieses Gen im Nervengewebe aktiviert, zeigen diese Männchen kein Interesse an Weibchen und sind steril. Wenn man dasselbe Gen umgekehrt im Nervengewebe des Weibchens ausschaltet, balzen diese wie Männchen. Wie schon erwähnt, ist die Art der Signalübertragung bei verschiedenen Insekten unterschiedlich, arbeitet aber grossenteils mit denselben Systemen von Primärsignal, Übertragung und Ausführung. Interessant sind Rückkoppelungsschlaufen, welche die eingeschaltete Kaskade verstärken und als Gedächtnis in den Tochterzellen dienen. Bei den ZZ-­‐ZW-­‐Systemen führen geschlechtsspezifische Spleissvorgänge zu unterschiedlichen männlichen bzw. weiblichen DSX-­‐Proteinen. Als gemeinsame Basis der Signalübertagung bei allen Insekten hat man das System des Übertragungsgens tra und des Ausführungsgens dsx gefunden. Dieses System scheint evolutiv konserviert zu sein. Sowohl die Primärsignale am Anfang der Kaskade wie auch die Differenzierungsgene unterhalb von dsx haben sich aber evolutiv divergiert. Viele sind vermutlich verloren gegangen, andere sind neu hinzu gekommen. Doch das Herzstück des Kontrollweges blieb unverändert. Möglicherweise erlaubt diese Plastizität des Systems die Anpassung an die sich stets verändernde Umwelt. Auch andere, über Signale regulierte Prozesse in der Biologie, wie etwa Wachstum und Organbildung, zeigen einen ähnlichen Aufbau. Teil 2: Das Sex-­‐Peptid von Drosophila Melanogaster Damit Eier nicht von artfremden Spermien befruchtet und damit inaktiviert werden, gibt es auf verschiedenen Ebenen Barrieren. Das können artspezifische Pheromone sein, Duftstoffe, die artgleiche Männchen über weite Distanzen anlocken, das spezifische Werbeverhalten, anatomische Besonderheiten der Geschlechtsorgane oder physiologische Sperren. Der Liebesgesang des Drosophila Männchens wird etwa durch das Gen period festgelegt, welches experimentell auf andere Arten übertragen werden kann, wobei von diesen dann derselbe Gesang gesungen wird. Beim Weibchen zeigen sich typische Begattungsreaktionen. Unbefruchtete, virginelle Weibchen legen wenige Eier und willigen rasch in eine Begattung ein. Nach der Begattung verändert sich dieses Verhalten drastisch, was biologisch sinnvoll erscheint: Die Bereitschaft zur Begattung ist stark reduziert und die Eilegerate nimmt massiv zu. Dies dauert etwa eine Woche. Danach tritt der „virginelle“ Zustand wieder ein. Das Weibchen ist dann wiederum zur Begattung bereit (Rezeptivität). Die Frage stellte sich, wodurch diese Begattungsreaktionen ausgelöst und gesteuert werden. Bei Drosophila wurde ein dafür verantwortliches, spezielles Pheromon, das sogenannte Sex-­‐Peptid SP gefunden, welches in den akkzessorischen Drüsen des Männchens gebildet und an den Spermien angeheftet bei der Begattung auf das Weibchen übertragen wird. Aber schon vor der Begattung wird die Auswahl des Partners mittels Pheromonen, flüchtige Duftstoffe, als „Priming“ gesteuert. Bei Drosophila gibt es also eine biochemisch untermauerte „Liebe auf den ersten Blick“. Sie kann heute mit gentechnischen Eingriffen bei Insekten experimentell verändert werden. Auffallend attraktive Weibchen werden allerdings durch aggressive Werbeversuche von Männchen an der Fortpflanzung gehindert, sie werden unsanft zur Begattung gezwungen und erleiden dadurch körperliche Schäden. Das von den Männchen übertragene Sex-­‐Peptid SP ist zwar ein Sexualpheromon, ist aber kein flüchtiger Duftstoff, sondern ein „Kontakt“-­‐Sexualpheromon. Es gibt noch weitere solcher Peptide, wie das DUP99B, welche die Begattungsreaktion auslösen können, doch das Sex-­‐Peptid ist offenbar bei weitem das Wichtigste. Die dadurch ausgelöste Verhaltensänderung ist Fitness-­‐steigernd: Während vor der Begattung die Aufmerksamkeit des Weibchens dem Partner gilt, konzentriert es sich danach auf die Produktion von Nachwuchs. Diese Reaktionen gibt es natürlich auch bei Wirbeltieren, aber mit anderen molekularen Mechanismen. Sie sind damit ein Beispiel der evolutiven Konvergenz, wie sie schon von Darwin postuliert wurde. Das mit den Spermien übertragene und in die weibliche Hämolymphe („Blut“ der Insekten) gelangende Sex-­‐Peptid SP hat aber erwiesenermassen noch zahlreiche weitere Wirkungen beim Weibchen, die nicht alle in ihrem Interesse liegen und damit auch einen „Kampf der Geschlechter“ dokumentieren. Man kann sie etwa folgendermassen auflisten: - SP löst die Verminderung der Rezeptivität des Weibchens aus. Dies liegt im Interesse des Männchens, welches möchte, dass nur seine Spermien zur Befruchtung gelangen. Je mehr SP an den Spermienschwänzen angeheftet ist, desto länger dauert die Reduktion der Rezeptivität. Es haben sich deshalb sehr lange Spermienschwänze evolviert. - SP erhöht beim Weibchen die antimikrobielle Peptidsynthese, d.h. es verbessert das Immunsystem des Weibchens. Dies ist einerseits sinnvoll, da mit der Begattung nicht nur Spermien, sondern zwangsläufig auch Mikroorganismen auf das Weibchen übertragen werden, welche die Produktion von befruchteten Eiern verhindern können. Anderseits verbraucht das Immunsystem sehr viel Energie, was zu den „Kosten“ beitragen könnte, die ein Weibchen für die Begattung bezahlen muss. Zudem lösen schon die Spermien selbst als „Fremdproteine“ eine gewisse Immunantwort aus. Eine Parallele findet sich beim Menschen: Prostituierte, die zahlreiche verschiedene „Kundenspermien“ aufnehmen, erfahren oft eine Immunantwort, welche zu Sterilität führt. - SP steigert die Nahrungsaufnahme des Weibchens. Unmittelbar nach der Begattung werden aus den Oocyten (Vorstufen der Eier) befruchtete Eier gelegt, deren Gesamtgewicht etwa dem des Weibchens selbst entspricht. Zudem müssen neue Oocyten angelegt werden. Begattete Weibchen fressen etwa 2-­‐3-­‐mal mehr als vor der Begattung. Mit transgenen Tieren konnte gezeigt werden, dass der „Heisshunger“ der Weibchen nicht durch die Befruchtung der Eier, sondern tatsächlich durch SP ausgelöst wird. Nicht nur die Menge der Nahrung, sondern auch ihre Zusammensetzung wird beeinflusst: Statt Kohlehydrate fressen begattete Weibchen vor allem Proteine. - SP verändert den Tag-­‐Nacht-­‐Rhythmus und die Ruhephasen (Siesta) des Weibchens. Befruchtete Weibchen gönnen sich keine Pausen, sondern suchen auch bei grösster Mittagshitze nach Nahrung und nach geeigneten Eierablegeplätzen. Weibchen, die von transgenen Männchen ohne SP begattet werden, zeigen dieses Verhalten nicht. SP wirkt also als „Siesta-­‐Blocker“. - SP verkürzt die Lebensdauer des Weibchens zusätzlich zu der Belastung durch die Eierproduktion. Dies liegt im biologischen Interesse des Männchens, welches „möchte“, dass nur seine Gene weitergegeben werden. Das Weibchen möchte dies aber auch und wehrt sich gegen SP mit Proteinen, welche SP in der Hämolymphe abbauen. Zwischen SP und diesen Proteinen wurden evolutive Interaktionen gefunden. Zudem kopulieren die Weibchen ca. 6 mal mit verschiedenen Männchen, um das Risiko einer nicht erfolgreichen Befruchtung zu mindern. Das Weibchen hat weiter die Möglichkeit, die ihm genehmen Spermien noch in seinem Genitaltrakt auszusondern und zur Befruchtung zulassen oder nicht. SP ist ein Paradebeispiel für einen „extended phenotype“: Das Gen wird im Männchen exprimiert, der Phänotyp entwickelt sich aber beim Weibchen. Unter dem Strich scheint es einen Gewinn für das Männchen zu bringen. Dies könnte sich nach Ansicht der Autoren aber durch die Evolution auch wieder ändern. Doch bei Drosophila erhöht SP den reproduktiven Erfolg des Männchens, welches nach dem Prinzip „fire and forget“ lebt: Nach der Begattung frisst und kopuliert es anderswo weiter, SP erledigt den Job beim ersten Weibchen alleine und verpasst ihm einen chemischen Keuschheitsgürtel. Dieser molekularbiologische Geschlechterkampf findet sich vor allem bei solitär lebenden Insektenarten. Bei sozial lebenden Arten wie Ameisen oder Bienen hingegen kopulieren die Weibchen häufig nur einmal und die Pärchen zeigen eine lebenslange Treue. Zum Teil wird bei ihnen die Lebenserwartung der Weibchen durch die Begattung sogar erhöht. Die molekularen Mechanismen, die dazu führen, werden zur Zeit noch erforscht. Die Entdeckung von SP und seinen Wirkungen eröffnet aber noch einen weiteren Horizont bei der Schädlingsbekämpfung. Heute werden aus Umweltschutzgründen nicht mehr so oft Giftstoffe gegen schädliche Insekten eingesetzt. Effizienter ist die Methode, sterile Männchen in grosser Zahl in gefährdeten Gebieten freizusetzen. Dadurch entstehen zahlreiche sterile Nachkommen und die Populationen werden nachhaltig verringert oder ganz eliminiert. Die Sterilität der Männchen wird mit ionisierenden Strahlen erreicht, was den Nachteil hat, dass Mutationen entstehen, welche bei unvollständiger Sterilität an Nachkommen und in die Natur weitergegeben werden könnten. Man arbeitet deshalb an der Idee einer genetischen Geschlechtsumkehrung. Man könnte einem Schädling ein Gen einpflanzen, welches durch bestimmte Temperaturen oder Futter aktiviert wird und das tra-­‐Gen ausschaltet. Dadurch würden sich genetische Weibchen in sterile Männchen umwandeln. Bei Drosophila konnte diese Möglichkeit realisiert werden, bei anderen Insekten muss das Fortpflanzungssystem aber noch weiter untersucht werden. Modellorganismen wie Drosophila melanogaster eignen sich generell als „Speerspitze“ der Forschung indem sie Ideen liefern, ersetzen aber keinesfalls das Studium anderer Arten. Dazu muss bedacht werden, dass wir als Homo sapiens nicht abseits stehen. Etwa die Hälfte der Gene teilen wir mit Drosophila und die Anzahl der Gene ist bei uns nur geringfügig höher. Wir sind sowohl Mitglieder, Zuschauer und Akteure der Natur. 3.6 VON MERING, C., Auf der Spur des unsichtbaren Lebens in unserer Umwelt. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2007) 152 (1/2): 52 Prof. Dr. Christian von Mering, Institut für Molekularbiologie, Universität Zürich, Literaturbericht, wb Bakterien machen schätzungsweise mehr als einen Drittel der Biomasse unseres Planeten aus und sind damit erfolgreicher als jede andere Lebensform. Sie beeinflussen globale Nährstoffkreisläufe, das Klima und unsere Gesundheit. Über die verborgenen Bakterien in der Umwelt weiss man trotz jahrzehntelanger Forschung allerdings wenig, im Gegensatz zu den Krankheitserregern. Sie lassen sich nämlich nicht auf Nährlösungen kultivieren. Vom Autor wurde nun zusammen mit Forschern aus den USA und der BRD ein neues Verfahren zur Analyse von Genomsequenzen entwickelt, welches erstmals einen analytischen Blick in die Erbsubstanz dieser verborgenen Mikroorganismen erlaubt. Die Methode der sog. „Metagenomik“ sequenziert die Genome von Mikroben aus Umweltproben, also ohne sie zuvor im Labor zu züchten. Das Verfahren erlaubt es, nicht nur einzelne Organismen, sondern ganze Ökosysteme zu sequenzieren. Aus der Masse der Genomdaten können nun diejenigen Gene herausgefiltert werden, die Rückschlüsse auf die Identität der Bakterien geben. Die Umweltbakterien können nun erstmals in Verwandtschaftsbeziehungen zu bereits bekannten Bakterien gesetzt und in den „Baum des Lebens“ eingeordnet werden. Viele dieser Bakterien sind allerdings nur entfernt verwandt mit bekannten Arten und sind spezifisch an ihre Umwelt angepasst, was dem bisherigen Bild der „Generalisten“ widerspricht. Offenbar legen sich viele Mikroben auf eine bestimmte Nische fest und verbleiben dort für viele Millionen Jahre. Das Forscherteam stellte sich daher auch die Frage, ob die Evolution in allen Teilen der Umwelt gleich schnell vorangeht. Man kann diese Geschwindigkeit an der Häufigkeit der Mutationen, d.h. der Sequenzveränderungen in bereits bekannten Genen abschätzen. Es zeigte sich, dass Organismen im Meerwasser deutlich schneller variieren und evolvieren als im Erdboden. Die Sequenzierroboter in den Labors werden gemäss von Mering noch lange für die Forschung gebraucht, bis man mehr Mikroben im Labor züchten könne. 3.7 BENZ, G., Buchbesprechung: Primate Phylogeny from a Human Perspective. K. Bauer und A. Schreiber, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, 1996. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1997) 142/2:54 Prof. Dr. Georg Benz, 2002 Literaturbericht, wb Prof. Dr. Georg Benz fasst dieses Buch zusammen, da es mit einer eigentlich schon etwas veralteten immunologischen Technik zur Lösung phylogenetischer Probleme und Fragen gute Resultate liefert. Es geht um die CDA-­‐Methode, die „Comparative Determinant Analysis“, mit welcher die Autoren die wichtigsten menschlichen Plasmaproteine analysiert und mit den homologen Proteinen (Eiweissen) anderer Primaten sowie der nächst verwandten Flughunden, Fledermäusen und der Paarhufer verglichen. Die Resultate wurden phylogenetisch bezüglich molekularem Verwandtschaftsgrad und zeitlichem Evolutionsverlauf ausgewertet. Sie umfassten 0,1% der im menschlichen Genom vorkommenden Strukturgene, was rund 3% der menschlichen DNA ausmacht. Die Methode erlaubte es, alle etablierten Mutationen zu zählen, welche die humanen Proteine von den Homologen der anderen Arten trennen. Auch ohne DNA-­‐ und Proteinsequenzierung, die moderneren Techniken, ergaben die Resultate eine Primatenreihe in abnehmender Verwandtschaft in folgender Sequenz: Mensch – Schimpanse – Gorilla – Orang-­‐Utang – Gibbon – Altweltaffen – Neuweltaffen – Lemuren – Loris. 3.8 KÖHLER, C., Reproduktionsbiologie in Pflanzen – mit und ohne Mendel. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2006), 151 (4): 113-­‐119 Prof. Dr. Claudia Köhler, Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH Zürich Literaturbericht, wb Hinter diesem etwas trockenen Titel verbergen sich detaillierte Erkenntnisse über die Aktivität von Genen, deren Steuerung und evolutionäre Vorteile durch Ein-­‐ bzw. Ausschalten einzelner Gene der Fortpflanzungsmechanismen, was auch als „Imprinting“ oder Deutsch „Prägung“ unter dem Oberbegriff „Epigenetik“ bekannt ist. Interessanterweise gibt es diesbezüglich Parallelen zwischen der Reproduktionsbiologie von Säugetieren und Samenpflanzen. Die Autorin erwähnt eingangs historische Aspekte, dass etwa schon 5000 v.Chr. die weiblichen Blüten der Dattelpalme manuell mit Pollen der männlichen Blüten bestäubt wurden. Die Notwendigkeit der Vereinigung zweier Geschlechter für eine erfolgreiche Samenbildung sei dann im 17. Jahrhundert n.Chr. wissenschaftlich erhärtet und im 19. Jh. durch die Entdeckung des Pollenschlauches, durch den die Spermazellen zur Samenanlage gelangen, vervollständigt worden. Die heutige Pflanzenforschung konzentriert sich v.a. auf das Ackerunkraut Arabidopsis thaliana, welches eine eigentliche Modellpflanze darstellt. Sie hat einen schnellen Generationenwechsel, eine hohe Samenzahl pro Pflanze und ein kleines Genom. Dieses ist heute vollständig bekannt und in Datenbanken verfügbar, in welchen auch die Informationen zu den einzelnen Genen phänotypisch angegeben sind. Diese sind in 5 Chromosomen enthalten und haben eine Grösse von 1,2 x 108 Basenpaaren. Das Genom des Menschen gibt die Autorin um 24-­‐mal grösser an, aber mit je etwa 30‘000 Genen nicht wesentlich komplexer. Die Blüte von Arabidopsis ist zweigeschlechtlich und enthält einen weiblichen Fruchtknoten und männliche Staubgefässe, in denen die Gameten gebildet werden. Der männliche Gametophyt ist der Pollen, der weibliche die Samenanlage. Der männliche wächst zum Pollenschlauch aus, dringt in den Griffel ein und transportiert die Spermazellen zur Samenanlage. Es gibt zwei Spermazellen und weiblicherseits die Eizelle und die Zentralzelle. Man spricht von einer „doppelten Befruchtung“, weil die eine Spermazelle die Eizelle, die andere die Zentralzelle befruchten muss, damit ein Embryo entstehen kann. Dieser entwickelt sich aus der befruchteten Eizelle, während aus der befruchteten Zentralzelle das Nährgewebe für den Embryo, das Endosperm, entsteht. Wenn der Embryo das Nährgewebe aufgebraucht hat, kann er selbst keimen, eine neue Pflanze und Blüte bilden und den Generationswechsel fortsetzen. Während dem die Befruchtung in den meisten pflanzlichen und tierischen Organismen eine Voraussetzung für die Fortpflanzung ist, gibt es bei vielen Pflanzen auch Apomixis, die Erzeugung von Nachkommen ohne Befruchtung. Es entstehen dabei durch gewöhnliche Teilung der Eizelle genetisch identische Klone der Mutterpflanze. Wie das möglich ist, beschäftigt heute gemäss Köhler zahlreiche Biologen und Forscher. Die Modellpflanze Arabidopsis pflanzt sich in der Natur nicht apomiktisch fort und eignet sich daher für Experimente. Man hat ihre Samen chemisch zu Mutationen angeregt (mutagenisiert) und die Spermabildung unterdrückt. Tatsächlich wurden danach Mutanten gefunden, die ohne Pollen Samen bilden konnten. Allerdings waren ihre Embryos nicht lebensfähig. Man konnte aber daraus schliessen, dass normalerweise ein Mechanismus die autonome Teilung von Eizelle und Zentralzelle verhindert und dass diese repressive Mechanismus offenbar durch Mutation geschädigt oder zerstört werden kann. Die nächste Frage lautete nun, wie dieser molekulare Mechanismus aufgebaut sein könnte. Durch Identifizierung der betroffenen Gene und Charakterisierung der von ihnen codierten Proteine ergab sich die Vermutung eines Multiproteinkomplexes, welcher schliesslich auch nachgewiesen werden konnte. Er wurde von der Autorin als „Fertilisation Indipendent Seed“, FIS, bezeichnet. Bei Säugetieren hat man einen ähnlichen Komplex gefunden und auf den schönen Namen „Polycomb Repressive Complex 2, PRC2 getauft. Da diese Proteinkomplexe also Fehlfunktionen unterdrücken, bilden sie eine Art molekulares Gedächtnis einer Zelle, indem sie etablierte Transkriptionszustände sicher stellen. Sie bewirken aber auch eine dauerhafte Inaktivierung von Genen, die in bestimmten Organen nicht mehr gebraucht werden. Eine nächste Frage lautete nun, wie dieser Mechanismus abläuft. Die 2004 gefundene Antwort wird von Prof. Köhler zitiert: Die DNA liegt im Zellkern an Histone (Proteine) gebunden vor, was als Chromatin bezeichnet wird. Der PRC2 Komplex bindet an das Chromatin und modifiziert Histone durch Anfügen von Methylgruppen. Diese Methylierung wird durch einen weiteren Proteinkomplex, PRC1, erkannt, welcher mittels einer weiteren Histonmodifizierung das Gen ausschaltet. Der pflanzliche FIS Komplex macht im Prinzip dieselbe Genausschaltung wie der tierische PRC2-­‐Komplex. Man nimmt deshalb an, dass diese Komplexe evolutionär konserviert sind. Lediglich Proteine, welche wie PRC1 die modifizierten Histone erkennen, wurden bei Pflanzen bisher nicht gefunden. Polycomb-­‐Komplexe regulieren auch einige allelspezifische Genaktivitäten. Ein bekanntes Beispiel findet sich bei der menschlichen Embryonalentwicklung. Während normalerweise beide von den Eltern geerbten Gene am selben Locus der diploiden Chromosomen für die Entwicklung benötigt werden, so muss anderseits bei einigen speziellen Genen eines davon ausgeschaltet sein, was durch den PRC2-­‐
Komplex sichergestellt wird. Diese monoallelische Genaktivität wird „Imprinting“ (Prägung) genannt. Fehler bei dieser Aktivität eines Allels führen zu schwerwiegenden Entwicklungsstörungen. Bekannt sind etwa das von Zürcher Kinderärzten erstmals beschriebene Prader-­‐Willi-­‐Syndrom (PWS) und das Angelmann-­‐Syndrom (AS). Beide Störungssyndrome beruhen auf einem Defekt eines monoallelisch aktiven Gens auf dem Chromosom Nr. 15. Beim PWS ist das vom Vater geerbte Gen defekt, beim AS dasjenige, welches von der Mutter geerbt wurde. Obwohl dieselbe Genregion auf dem Chromosom Nr. 15 betroffen ist, sind die Krankheitsbilder der beiden Syndrome ausserordentlich verschieden. Es gibt beim Menschen etwa 80 geimprintete, also monoallelisch aktive Gene, und interessanterweise spielen viele dieser Gene auch eine wichtige Rolle bei der Pflanzenentwicklung. Diese Rolle aufzuklären war ein langfristiges Ziel der Autorin. Sie fand zwischen der Plazenta von Säugetieren und dem Endosperm von Samenpflanzen mehrere Parallelen. Beide versorgen den Embryo mit Nährstoffen der Mutter und offenbar regelt auch der FIS-­‐Komplex Imprinting bei Blütenpflanzen. Maternale Wachstumsgene werden von FIS inaktiviert, paternale hingegen nicht. Die biologische Relevanz dieses Mechanismus konnte die Autorin mit Experimenten an Arabidopsis aufklären: Bei Überwiegen väterlicher Wachstumgene wurden die Samen grösser, bei Überaktivität der mütterlichen Wachstumsgene wurden sie kleiner. Geimprintete Gene müssen also die Samengrösse regulieren. Warum dies evolutionär entstanden ist, wird von anderen Autoren zitiert: Ein von einer väterlichen Mutation vererbtes Grössenwachstum des Embryos bevorteilt diesen auf Kosten der Geschwister, da die Ressourcen der Mutter limitiert sind. Dieser Konflikt zwischen einem kurzfristigen Vorteil eines Individuums auf Kosten vieler anderer scheint die Triebkraft für die Evolution geimprinteter Gene zu sein. Wachstumshemmende Faktoren sind maternal aktiv während paternale Faktoren das Wachstum fördern. Eine Vielzahl geimprinteter Gene codieren denn auch Wachstumsregulatoren. Prof. Köhler hebt hervor, dass dieser Mechanismus die Mendelschen Gesetze verletzt, welche besagen, dass die Richtung der Vererbung keinen Einfluss auf den Phänotyp hat. Sie fügt denn gleich noch an, wie die Fortpflanzung ohne Befruchtung, also Apomixis, den Begründer der Genetik, eben den tschechischen Mönch G.J. Mendel (1822-­‐84) zur Aufgabe seiner Forschungen veranlasst hatte. Er hatte ca. 1870 bei Kreuzungsversuchen mit Erbsen mit verschiedenfarbigen Blüten (z.B. rot – weiss) zwei grundlegende, noch heute gültige Gesetze formuliert: Die Nachkommen der ersten Generation haben alle dieselbe Farbe in ihren Blüten (Universalitätsgesetz). Die Nachkommen der zweiten Generation spalten in einem bestimmten Verhältnis auf (Spaltungsgesetz): Wenn das eine Farballel dominant ist, wird das Aufspaltungsverhältnis 3:1. Wenn beide Allele gleich stark sind, spalten die Nachkommen auf im Verhältnis 1:2:1 (rot-­‐rosa-­‐weiss). Allerdings war Mendel das Konzept von Genen als Träger von Erbeigenschaften nicht bekannt. Unglücklicherweise wiederholte er die Versuche mit dem Habichtskraut Hieracium, welches sich meist apomiktisch fortpflanzt und somit Klone der Mutterpflanze liefert. Auch das konnte Mendel noch nicht wissen und er verwarf danach seine beiden Gesetze und hörte mit den Kreuzungsversuchen auf. Erst 30 Jahre später konnte der Grund für das unterschiedliche Verhalten von Erbsen und Habichtskraut geklärt werden und die Mendelschen Gesetze wurden wieder entdeckt. Aber Charles Darwin hatte infolge von Mendels Aufgabe nie etwas von diesen Anfängen der Genetik erfahren. 3.9 Ringvorlesung vom 17.11.09: Elternkonflikt als Grundlage der Evolution genetischer Prägung. Prof. Dr. Ueli Grossniklaus, ETH Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Referent absolvierte seinen Ph.D 1993 im Labor von Prof. Dr. Walter J. Gehring, wo er maternale Effekte und Embryogenese an Drosophila Fliegen untersuchte. Danach arbeitete er in der Forschung des Indischen Instituts für Wissenschaft in Bangalore auf dem Gebiet der theoretischen Biologie. Ein Jahr später kam er zum Cold Spring Labor New York, wo er sich in die Pflanzenreproduktion vertiefte. 1999 kehrte er in die Schweiz zurück ans Friedrich Miescher Institut Basel und wurde im Jahr 2000 zum Professor für Pflanzenentwicklung an die Universität Zürich berufen. Seine wichtigsten Interessensgebiete sind epigenetisches Imprinting in Pflanzen und Säugetieren und Chromatinkomplexe in der Genregulation. Prof. Grossniklaus sprach zum Thema des epigenetischen Elternkonfliktes, welcher sich sowohl bei Säugetieren wie bei Samenpflanzen findet. Er rief nochmals in Erinnerung, dass die natürliche Selektion diejenigen Variationen von Lebewesen begünstigt, welche unter speziellen Bedingungen besser überleben. Das Besondere an der sexuellen Selektion besteht darin, dass männliche Individuen einem Druck unterliegen, das Weibliche zu besitzen. Daneben gibt es auch einen Konflikt zwischen Eltern und Nachkommen sowie zwischen Geschwistern um die Ressourcen der Fürsorge. Diese Theorie gehe zurück auf die Biologen Robert Trivers und David Haig. Epigenetik: Sie überbrückt das Spannungsfeld zwischen genetischer Anlage und Umwelt. Heute wird sie definiert als „Studium der erblichen Veränderungen in der Genomfunktion, die ohne eine Änderung der DNA-­‐Sequenz auftreten. Die Frage lautet: Wie weit sind wir von der Natur vorprogrammiert, oder von der Umwelt geprägt. (Homepage Prof. Dr. Ueli Grossniklaus) Für die Forschung wird vor allem mit dem Modellorganismus Arabidopsis thaliana (Ackerkraut) gearbeitet. Es hat 5 Chromosomenpaare mit 30 000 Genen und 155 Millionen Basenpaaren. Die Samen bestehen aus der Samenschale, dem Embryo und dem Nährgewebe, dem Endosperm. Die Befruchtung ist eine doppelte: Sowohl die Eizelle wie die Zentralzelle werden von je einem Spermium befruchtet, wobei sich aus der Eizelle der Embryo und aus der Zentralzelle das Endosperm entwickelt. Die Mutter ernährt den Embryo nach der Befruchtung und muss mit ihren Ressourcen sparsam umgehen. Der Vater braucht nach der Befruchtung keine Ressourcen mehr aufzubringen für den Embryo, hat aber ein Interesse, dass dieser gut ernährt wird. Dies ist sowohl bei Samenpflanzen wie bei plazentalen Säugetieren der Fall. Die väterlichen Gene im Embryo geben die Information, dass die Mutter viele Nährstoffe bereitstellen soll, an Rezeptoren des mütterlichen Gewebes weiter. Die Mutter hat zwei Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, was als Maternaleffekt bezeichnet wird: Maternaleffekt I: Sie kann eigene Genprodukte im Ei ablegen, welche das Wachstum begrenzen (z.B. beim afrikanischen Frosch Xenopus laevis) Maternaleffekt II: Sie kann einige ihrer Wachstumsgene inaktivieren. Dieselben Gene auf demselben väterlichen Chromosom sind dann beim Embryo aber aktiv. Diese Ungleichheit wird als Imprinting oder genetische Prägung bezeichnet. Die elterlichen Genome sind nicht äquivalent. Die Evolution hat diesen Effekt relativ spät und unabhängig bei Samenpflanzen und Säugetieren „erfunden“. Defekte geprägter Gene: Wenn das mütterliche, inaktivierte Wachstumsgen defekt (deletiert) ist, wird es aktiv. Es erfolgt ein stärkeres Wachstum des Embryos. Beim Menschen ist dies der Fall beim Prader-­‐Willy-­‐Syndrom, welches durch Deletion am Chromosom 15 entsteht. Wenn das väterliche, aktive Wachstumsgen defekt ist, wird es inaktiv. Es erfolgt ein vermindertes Wachstum des Embryos. Beim Menschen ist dies der Fall beim Angelmann-­‐Syndrom, welches ebenfalls durch Deletion am Chromosom Nr. 15 entsteht, aber eben am väterlichen Allel. Beim Menschen gehen einige Fehlbildungen auf Defekte an geprägten Genen zurück. Die Auswirkung ist somit verschieden, je nachdem, ob das defekte Gen vom Vater oder von der Mutter stammt. Bei polygamen Organismen mit plazentalem Habitus hat sich die genetische Prägung also entwickelt aufgrund eines Konflikts zwischen Mutter und Vater über die Verteilung von Nährstoffen von der Mutter zum Kind. Experimentell konnte dies erwiesen werden durch die Zerstörung des mütterlichen Gens, was in ungebremstem Wachstum des Embryos resultierte. Mütterliche Gene produzieren zudem Rezeptoren, an welche die väterlichen Wachstumsfaktoren zwar andocken können, aber die Information wird nicht weitergeleitet. Mütterliche Genkomplexe können auch väterliche Allele abschalten. Die Gene regulieren sich somit selbst, sowohl positiv wie negativ. Diese Netzwerke, welche zu einem angepassten Wachstum des Embryos führen, können heute molekularbiologisch entschlüsselt werden. Die Inaktivierung von Genen geschieht bei Samenpflanzen wie bei Säugetieren auf gleiche Weise durch Methylierung (Anfügen von Methylgruppen) der Gene. Dies ist wiederum ein Beispiel von konvergierender Evolution. Auch im Gehirn scheint die Genregulation auf ähnliche Weise mit unterschiedlichen Gruppen von geprägten Genen zu funktionieren, deren Auswirkungen aber noch unklar sind. Immerhin geht man bezüglich der Nährstoffzufuhr davon aus, dass die durch Methylierung veränderte Aktivität der Gene bei späteren Generationen wieder in einer früheren Form zum Vorschein kommen kann. So soll sich eine besonders gute Ernährung in der Pubertät bei den Enkelkindern als Übergewicht zeigen. 3.10 Aus: Richard Dawkins, „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ , Ullstein Verlag, Berlin 2008 Literaturbericht, wb Genfluss und Genstammbäume Biologisch gesehen sind Individuen vergängliche Vehikel für das Überleben der Gene. Dawkins betont, dass die Abstammungslinien von Individuen und Genen sich nicht decken, da ein Individuum immer eine Mutter und einen Vater hat, ein Gen hingegen nur einen einzigen Vorfahren. Würde man für die Entstehung des Menschen ein erstes Elternpaar als Phänotypen postulieren, so wäre dieses deshalb nicht identisch mit einem ersten Genotyp von Menschen. Da der Genfluss bei Mann und Frau nicht der selbe ist, hätte eine genetische „Eva“ nicht zur selben Zeit gelebt wie ein genetischer „Adam“, sondern es hätte nach Berechnungen von Dawkins eine Distanz von einigen Tausend Jahren zwischen ihnen bestanden. Ein Individuum kann eine grosse Zahl von Nachfahren haben, und diese Stammbäume können beim Menschen durch Dokumente der Namensgebung für die Zukunft erhalten bzw. in die Vergangenheit zurückverfolgt werden. Die Gene dieses „Stammvaters“ werden aber im Lauf zahlreicher Generationen durch die geschlechtliche Fortpflanzung so stark vermischt, dass spätere Nachfahren kaum mehr etwas davon besitzen werden. Deshalb sind auch die rückblickende Bestimmung des Genflusses und der Zeitpunkte von Verzweigungen und Änderungen sehr schwierig. Die Wissenschaft hat dazu verschiedene Methoden entwickelt: Koaleszenzanalyse. Mit der Analyse von vielen Genen zusammen, kann in die Vergangenheit vorgedrungen werden. In den Genstammbäumen von Populationen und ihren Vereinigungspunkten spiegeln sich frühere Ereignisse, die sich mit Hilfe der molekularen Uhr (an Fossilien geeicht) auch zeitlich zurückverfolgen lassen. Dies erlaubt wiederum ausgehend von der heutigen Genverteilung Rückschlüsse auf die Populationsgrösse und ihre Wanderungsbewegungen. Am besten eignen sich Haplotypen (bei einander liegende Gene) für eine solche Analyse, da diese DNA-­‐Abschnitte durch die Rekombination nicht zerstückelt werden und somit über viele Generationen unversehrt erkennbar sind. Daneben fokussiert sich die Forschung auch auf die Analyse der Mitochondrien und des Y-­‐Chromosoms. Y-­‐Chromosomen werden nur von Männchen weitergegeben und eignen sich wegen ihrer Mutationsrate vor allem für die Analyse von Populationen aus relativ junger Vergangenheit. Ihre DNA ist aber nicht repräsentativ für das übrige Genom. Die Mitochondrien-­‐DNA, die nur durch die ungeschlechtliche Zellteilung (Mitose), also ohne Rekombination und nur von Weibchen weitergegeben wird, ist demgegenüber geeignet für die Analyse von Vorgängen aus sehr alter Zeit. Die Gene von Y-­‐ Chromosomen und Mitochondrien werden nicht sexuell vermischt. Dadurch ist die Rückverfolgung ihrer Vorfahren einfacher als beim übrigen Genom. Mit diesen Methoden konnten Erkenntnisse gewonnen werden über die Vergangenheit der Pflanzen-­‐ und Tierwelt Europas und ihrer Wanderungsbewegungen. Aus der Verteilung der DNA rund um den Erdball können z.B. die Dauer der Eiszeiten abgelesen werden oder die Zeitpunkte der Domestikation gewisser Pflanzen durch den Menschen. Individuen sind vorübergehende Treffpunkte der Wege, auf denen die Gene kreuz und quer durch die Geschichte reisen. Während die Individuen wieder zerfallen, sind Gene dagegen seit der erdgeschichtlichen Zeit sozusagen „ewig“. (S. 85) Triangulation: Diese Vergleichsmethode stammt aus der Sprachforschung und Linguistik, wo man eine Sprache in der Geschichte zurückverfolgen will. Man vergleicht dazu die modernen Sprachen mit bereits rekonstruierten toten Sprachen und ordnet sie hierarchisch in Familien ein, die ihrerseits zu grösseren Familien gehören. Das Triangulationsverfahren lässt sich auch in der Evolutionsforschung anwenden und erlaubt es, viele hundert Millionen Jahre in die Vergangenheit vorzudringen. Die äusseren Merkmale, die DNA-­‐und Proteinsequenzen heutiger Lebewesen können verglichen werden, da es in den DNA-­‐Texten genauso wie in Sprachen ein grossen Mass von Überlappungen gibt. Die DNA-­‐Sequenzen etwa von Menschen und Bakterien sehen sich in weiten Bereichen ähnlich und manche Abschnitte gleichen sich sogar Wort für Wort. Noch viel mehr stimmen sie miteinander überein bei nahen Verwandten wie Schimpansen und Menschen. Zudem findet man Molekülpaarungen, die das ganze Spektrum der Vergleiche abdecken von entfernten bis zu nahen Verwandten. Es finden sich einige Gene, die sich seit den gemeinsamen Vorfahren nicht verändert haben. Der genetische Code ist bei allen Arten praktisch identisch und muss bei den gemeinsamen Vorfahren der gleiche gewesen sein. Allerdings kann man bisher nicht vorhersagen, wie sich Veränderungen in den Genen auf den Bau eines Organismus auswirken. Aber wenn man einen Stammbaum von Arten rekonstruiert hat, kann man mit Hilfe der Triangulation den Zeitpunkt jeder Verzweigung berechnen. Man geht dabei davon aus, dass das Alter eines gemeinsamen Vorfahren proportional ist zur Anzahl der Unterschiede in den Gensequenzen seiner heutigen Nachkommen. Anhand des Alters von Fossilien kann man die Zeitskale dann eichen. Evolutionsstammbäume: Sichtbare Merkmale entwickeln sich aus der Umsetzung von Gen-­‐Sequenzen, welche sehr lange Ketten sind. Viele dieser Sequenzen sind aber für die Selektion „unsichtbar“, d.h. sie verursachen keine Merkmale, welche für die Evolution eine Rolle spielen und werden deshalb im Lauf der Zeit kaum verändert. Beispiele dazu sind synonyme DNA-­‐Codes und Pseudogene. Das sind zufällig verdoppelte Kopien von Genen, oder Gene, welche die gleiche Aminosäure festlegen. Die Genetiker erkennen sie als „DNA-­‐
Schrott“ im Chromosom, der nie genutzt wird. Manche Sequenzen liegen mehrfach verdoppelt im gesamten Genom verstreut. Etwa die Hälfte der menschlichen DNA besteht aus vielfach kopierten, sinnlosen Sequenzen, transponierbaren Elementen, die sich wie Parasiten den DNA-­‐Replikationsapparat zu Nutze machen, um sich im Genom auszubreiten. Eines dieser parasitischen Elemente namens „Alu“ liegt bei den meisten Menschen in Form von mehr als einer Million Exemplaren vor. Auch benutzte Gene sind oft in Dutzenden von identischen Kopien vorhanden. Hin und wieder weisen lange DNA-­‐Abschnitte bei weit verwandten Lebewesen rätselhafte Ähnlichkeiten auf. Die DNA-­‐Sequenzen von Vögeln und Säugetieren haben grössere Ähnlichkeiten, als man erwarten würde. Beide tragen in ihrer nicht codierenden DNA eine übermässig grosse Zahl von C-­‐G-­‐Paaren, zwischen denen eine starke chemische Bindung besteht. Möglicherweise brauchen warmblütige Arten eine besser gebundene DNA. Es können aber auch ganze DNA-­‐Abschnitte umorganisiert werden. Die Meinung, man könne für eine Gruppe von Arten einen einzigen Evolutionsstammbaum zeichnen, ist nicht mehr haltbar. Denn verschiedene Teile der DNA können verschiedene Stammbäume haben. Arten sind nach Dawkins Kombinationen von DNA aus ganz unterschiedlichen Quellen. Jedes Gen, ja sogar jeder einzelne Buchstabe der DNA geht seinen eigenen Weg durch die Geschichte. Somit kann jeder Aspekt eines Lebewesens einen anderen Evolutionsstammbaum haben. Ein gutes Bespiel dafür ist der Polymorphismus der Blutgruppen. Wer ein B-­‐Blutgruppen-­‐Gen hat, ist genetisch mit einem Schimpansen mit Blutgruppe B näher verwandt als mit einem Menschen mit Blutgruppe A. Die Mehrzahl der molekularbiologischen Merkmale zeigt, dass die Schimpansen unsere nächsten Verwandten sind. Mit einigen anderen Merkmalen sind wir aber am nächsten mit Gorillas verwandt, während diese beiden von uns etwa den gleichen Abstand haben. Verschiedene Gene werden eben auf unterschiedlichen Wegen vererbt und ein einzelner Stammbaum kann keine vollständige Geschichte erzählen. Ein Artenstammbaum gibt nach Dawkins weniger familiengeschichtliche Verwandtschaftsbeziehungen wieder, sondern eher ein „Mehrheitsvotum“ der Genstammbäume. Wie entstehen neue Gene und neue Eigenschaften? Im Prinzip entstehen neue Gene durch Verdoppelung von bestehenden Genen. Anschliessend gehen sie in entwicklungsgeschichtlichen Zeiträumen ihren eigenen Weg mit Mutationen, Selektion und Gendrift. Dieser Weg und die Verdoppelung kann oft anhand zurückgelassener Indizien rekonstruiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der Unterschied im trichromatischen Farbensehen des Menschen einerseits und der zu den Neuweltaffen gehörenden Brüllaffen anderseits: Die entfernten Vorfahren der Säugetiere, die säugetierähnlichen Reptilien, und die Dinosaurier hatten eine ausgezeichnete Farbwahrnehmung. Während der Dominanz der Dinosaurier getrauten sich die Säugetiere nur nachts an die Erdoberfläche und mussten dann jedes Quentchen Licht aufnehmen, ganz gleich welcher Farbe. Ihre Farbwahrnehmung degenerierte. Nach dem Untergang der Dinosaurier kamen zwar die meisten Säugetiere zu einem Leben am Tageslicht, doch ihre Farbwahrnehmung blieb bis heute schlecht. Farbwahrnehmung beruht auf unterschiedlichen Zapfen in der Netzhaut, welche empfindlich sind auf die Wellenlängen von Rot, Grün und Blau. Man spricht dann von einem trichromatischen Farbsehen. Das Nervensystem erkennt die Farbe eines Gegenstandes durch den Vergleich der Impulsraten von mindestens zwei Zellen, die auf unterschiedliche Wellenlängen empfindlich sind. Auch Fische und Reptilien, aber auch die australischen Beuteltiere, sehen in der Regel trichromatisch. Vieles spricht dafür, dass die Säugetiere während der Dominanz der Dinosaurier einen Zapfen verloren haben. Verloren ging genauer gesagt nicht der Zapfen, sondern das Gen, welches für die Empfindlichkeit des Zapfens für die entsprechende Wellenlänge codiert. Diese Gene produzieren Proteine, die Sehpigmente mit dem Namen Opsine, welche auf Licht unterschiedlicher Wellenlänge empfindlich sind und dabei Nervenimpulse abgeben. In jedem Zapfen sind zwar mehrere dieser Gene vorhanden, aber nur eines ist aktiv, bzw. eingeschaltet. Die Gene, welche Rot-­‐ und Grün-­‐Opsin produzieren, liegen auf dem X-­‐Chromosom, von welchem Frauen zwei, Männer nur eines besitzen. Das Gen für Blau ist etwas anders strukturiert und liegt auf einem Autosom, dem Chromosom Nr. 7. Das älteste Gen ist dasjenige für Blau. Die Gene für Rot und Grün entstanden daraus durch 2 Verdoppelungsereignisse, eines in älterer, das andere in jüngerer Vergangenheit. Ob ein Individuum monochromatisch, dichromatisch oder trichromatisch sieht, hängt davon ab, wie viele verschiedene Opsin-­‐Gene es in seinem Genom besitzt. Neuweltaffen haben alle das „Blau-­‐Gen“ auf dem Chromosom Nr. 7. Auf ihrem X-­‐Chromosom gibt es aber nur einen Locus, auf dem sich entweder ein rotes oder ein grünes Alles befinden kann. Die Weibchen mit zwei X-­‐Chromosomen haben zwei Möglichkeiten, ein rotes oder ein grünes Gen zu besitzen. Die Männchen mit nur einem X-­‐Chromosom haben entweder ein rotes oder grünes Gen, sind also in zwei verschiedenen Formen farbenblind. Die Weibchen sehen entweder di-­‐ oder trichromatisch, was einem Polymorphismus entspricht. Affenrudel mit trichromatischen und dichromatischen Weibchen könnten bei der Futtersuche abwechslungsweise erfolgreicher gewesen sein. Man bezeichnet dies als frequenzabhängige Selektion. Bei den Brüllaffen hat sich dabei irgendwann der glückliche Zufall einer Gentranslokation ergeben: Durch einen Fehler wurde ein ganzer Chromosomenabschnitt an ein anderes Chromosom oder an einen anderen Locus angeheftet. Auf dem X-­‐Chromosom des betroffenen Brüllaffen lagen nun ein rot-­‐Gen und ein Grün-­‐Gen nebeneinander und er konnte trichromatisch sehen. Damit hat er sich offenbar erfolgreich fortgepflanzt und das mutierte X-­‐Chromosom wurde im Lauf der Zeit an alle Artgenossen weitergegeben. Bei den Altweltaffen bis zum Menschen hat sich ebenfalls ein trichromatisches Sehen entwickelt, aber auf andere Art und Weise. Einen Polymorphismus gab es nicht, sondern auf dem X-­‐Chromosom war nur das Grün-­‐Gen vorhanden, und auf dem Autosom Nr. 7 ebenfalls das Blau-­‐Gen. Bei unseren Vorfahren kam es irgendwann zu einer Verdoppelung des Grün-­‐Gens. Diese beiden Grün-­‐Gene haben sich dann evolutiv auseinander entwickelt und so entstand langsam aus dem einen Grün-­‐Gen ein Rot-­‐Gen und damit ein trichromatisches Sehen. Dawkins nimmt an, dass die Verdoppelung des Grün-­‐Gens durch den DNA-­‐
Parasiten Alu irgendwann im Eozän bewerkstelligt wurde, da sich seine Gene an beiden Enden des Rot-­‐
Gens finden. Solche Verdoppelungen soll es häufig geben, zudem auch „Genkonversionen“, bei denen sich eine kurze Sequenz eines Chromosoms in die entsprechende Sequenz eines anderen verwandelt. Ungleiches Crossover und Konversion können zur Rot-­‐Grün-­‐Farbenblindheit führen. Nebenbei bemerkt Dawkins, dass der Mensch mit seinem trichromatischen Farbensehen im Gegensatz zu anderen Säugetieren die Farben sehr intensiv in die sexuelle Selektion einbezogen habe. Gene können also auf unterschiedlichen Chromosomen zur selben Genfamilie gehören, weil sie durch Verdoppelung entstanden sind und sich danach zu neuen Funktionen auseinander entwickelt haben. Für typisch menschliche Gene besteht eine Verdoppelungswahrscheinlichkeit von 0,1 bis 1 % je Million Jahre. Verdoppelungen können aber auch in Wellen auftreten, wenn sich ein neuer virulenter DNA-­‐Parasit wie Alu im ganzen Genom verbreitet, oder wenn sich das ganze Genom auf einmal verdoppelt. Das letztere kommt bei Pflanzen häufig vor und soll auch bei der Entstehung der Wirbeltiere mindestens zweimal geschehen sein. Gene und die Entwicklung des Individuums Das Genom wird oft als eine Art Bauplan für die Entwicklung des Individuums vom Ei bis zum erwachsenen Lebewesen angesehen. Diese Sicht ist heute aber nicht mehr haltbar. Gene steuern zwar die Embryonalentwicklung, sind aber nicht Bausteine, welche etwa nach dem Plan eines Architekten an vorbestimmte Stellen gesetzt werden und so schliesslich das Haus ergeben, wie es im Bauplan gezeichnet und berechnet wurde. DNA beschreibt nicht, wie der fertige Körper aussehen soll. Sie enthält viel mehr eine Art Kochrezept und gibt die Anweisungen, nach denen die Embryonen sich dann selbst aufbauen. Dies gilt vor allem für die frühe Phase der Embryonalentwicklung, wo der grundlegende Aufbau des Körpers durch Faltungs-­‐ und Einstülpungsprozesse von Zellschichten angelegt wird. Die späteren Entwicklungsstadien stellen dann fast nur noch ein Wachstum dieser differenzierten Schichten mit unterschiedlicher, genau kontrollierter Geschwindigkeit dar, was mit dem Begriff Allometrie bezeichnet wird. Wie die Termiten in gemeinsamer Arbeit ihren Bau errichten, so „wissen“ auch die wachsenden und sich vermehrenden Zellen, in welcher Beziehung sie zu ihren Nachbarzellen stehen. Sie wissen das, weil sie auf Konzentrationsgradienten chemischer Substanzen reagieren. Dies beginnt schon bei der Eizelle, welche ihr Verhalten an einem Oben und Unten sowie einem Vorne und Hinten orientieren muss. Der Konzentrationsgradient dafür befindet sich aber nicht in der Eizelle selbst, sondern im mütterlichen Nährgewebe. Es ist ein Protein, welches von einem mütterlichen Gen namens bicoid produziert und in die Eizelle transportiert wird. Es reichert sich an einem Ende an und wird zum anderen Ende hin geringer. Damit wird die Vorne-­‐Hinten Achse festgelegt. Solche Gradienten und Konzentrationsunterschiede innerhalb der Eizelle bleiben auch bei ihren nachfolgenden Teilungen erhalten und wirken in den einzelnen Tochterzellen, indem deren Gene unterschiedlich ein-­‐ oder ausgeschaltet werden. Auf diese Weise beginnt die Differenzierung der Zellen, also ihre unterschiedliche Entwicklung zu unterschiedlichen Geweben wie etwa Muskel-­‐, Fett-­‐, oder Nervengeweben. Neue, kompliziertere Gradienten werden dann von den Genen des Embryos selbst produziert. Sehr interessant ist dieses System bei den Gliederfüssern, deren Körper in Segmente unterteilt sind, welche etwa Antennen, Kiefer, Beine, Geschlechtsorgane oder Flügel tragen. Wie „wissen“ die Zellen der Segmente, was sie produzieren müssen? Sie wissen es durch die Vermittlung von sog. „Hox-­‐Genen“, Steuerungsgenen, die sich in den Zellen selbst einschalten. Jedes Hox-­‐Gen wird zwar vorwiegend in einem bestimmten Segment exprimiert, sein Produkt wird aber auch in weiter hinten gelegenen Segmenten in abnehmender Konzentration gebildet. Eine Zelle weiss, in welchem Segment sie sich befindet, indem sie die chemischen Produkte der verschiedenen Hox-­‐Gene und ihre Konzentrationen vergleicht, nicht indem sie etwa durch ein bestimmtes Gen determiniert würde. Die Zahl der Segmente stimmt denn auch nicht mit der Anzahl Hox-­‐Gene überein, obwohl diese Gene auf dem Chromosom in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Es hat sich gezeigt, dass dieses System bei allen Tieren vorhanden ist und dem Aufbau des Körpers während der Embryonalentwicklung dient, auch wenn keine eigentliche Segmentbauweise vorliegt. Die Anzahl der Hox-­‐Gene ist aber sehr unterschiedlich und ist durch Gen-­‐Verdoppelungen und Gendeletionen (Verkürzungen) bei verschiedenen Arten verschieden entstanden. Wenn ein solches Hox-­‐Gen versagt oder mutiert, kann es zu sogenannten „homöotischen Fehlbildungen“ kommen, dass z.B. bei einer Fliege anstelle eines Flügels ein Bein gebildet wird, weil die Zellen dieses Segmentes sich in einem „Bein-­‐Segment“ wähnen. Diese Gene wurden auch mit dem Oberbegriff Homöobox-­‐Gene bezeichnet, weil sie auf einem bestimmten Chromosom in einer bestimmten Anzahl und Reihenfolge in einer Art Box angeordnet sind. Radialsymmetrische Tiere wie die Hydra (Nesseltier) haben nur 2 Hox-­‐Gene und deren Wirkungsweise vom Zentrum zur Peripherie wird offenbar noch nicht verstanden. Bei Pflanzen, Pilzen und Einzellern hat man bisher keine Hox-­‐Gene gefunden. Pflanzen haben andere Steuerungsgene, die aber nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Nachdem die ersten Hox-­‐Gene bei der Taufliege Drosophila melanogaster gefunden worden waren, kennt man heute zahlreiche Familien von Homöobox-­‐Genen, welche in einer Art Stammbaum weitläufig miteinander verwandt sind. Der Stammbaum der Tiere handelt von Verzweigungen und Artbildungsereignissen. An diesen Stellen verdoppelten sich jeweils Gene an verschiedenen Stellen, wie eben die Homöobox-­‐Gene. Dawkins interpretiert diese Erkenntnisse mit dem schönen Satz: Tiere sind nicht einfach ein Sammelsurium von Stämmen mit charakteristischem Körperbauplan, sondern Variationen eines ganz bestimmten genetischen Themas. 3.11 DNA-­‐Analysen oder „Von der Jagd auf Viren“ Dipl. Ing. ETH Werner Schönenberger, 2010 Jedes Lebewesen unterscheidet seine Eigenschaften durch die ihm eigene DNA (deoxyribonucleic acid oder Desoxyribonukleinsäure). Diese Eigenschaft wird nicht nur in der Sequenzierung, also in der Aufschlüsselung der DNA verwendet, sondern auch in der modernen Diagnostik. Der folgende kurze Abriss soll eine Einführung in die Methodik der Jagd auf das Virus geben. Ein Virus zeichnet sich dadurch aus, dass es sich zwar ausserhalb von Zellen verbreiten, sich aber nur innerhalb der Zelle seines Wirts vermehren kann. Dies indem es seine DNA in die Zelle seines Wirts einschleust. Das Virus besteht in seiner ausserzellulären Form aus einer Kapsel und einer DNA oder RNA (Ribonukleinsäure), d.h. es besteht nicht aus einer Zelle und hat keinen eigenen Stoffwechsel. Für letzteren ist es ebenfalls auf seinen Wirt angewiesen. Um ein Virus nachzuweisen, diagnostiziert man entweder seine Auswirkungen, oder sucht nach seiner Existenz. Im Fall der Methodik der Molekulardiagnostik versucht man konkret das Virus über die ihm eigene Gensequenz oder genauer Basensignatur in seiner RNA oder DNA zu identifizieren. Wir wollen uns der Einfachheit halber auf die DNA und eine spezifische Methode konzentrieren. Bekanntlich besteht die DNA aus einer Doppelhelix, die bei Eukaryoten in einem abgegrenzten Zellkern anzutreffen ist und sich dort als ein Set von Chromosomen manifestiert. Im Gegensatz dazu findet sich die DNA bei Prokaryoten, also Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen, frei als Plasmide im Zytoplasma. Die DNA ist eine Folge von Nukleotiden, das sind chemische Verbindungen, die aus Zucker, Phosphat und Basen bestehen. Die Nukleotide bilden aneinander gereiht lange Ketten, den DNA-­‐Strang und sind dabei in Bereiche eingeteilt, welche die bekannten Gensequenzen bilden. Als Basen stehen bei der DNA die vier Varianten Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin zur Wahl (im Fall der RNA kommt als Base Uracil an der Stelle von Thymin zum Einsatz). Die einzelnen Nukleotide sind aber nicht nur über das Phosphat zu Ketten aneinander gereiht, sondern können auch mit einem anderen Nukleotid eine Paarbindung ein-­‐
gehen. Dadurch entsteht die spiralartige Doppelhelix, die aus zwei DNA-­‐Strängen besteht. Wichtig ist dabei, dass nur bestimmte Paarbildungen auftreten können: Adenin (A) bindet zu Thymin (T) und Guanin (G) bindet zu Cytosin (C). Hat nun ein Bereich eines DNA-­‐Strangs die Basenfolge ...-­‐T-­‐G-­‐G-­‐C-­‐G-­‐A-­‐A-­‐... so hat demzufolge der zugehörige paarige Strang die Folge ...-­‐A-­‐C-­‐C-­‐G-­‐C-­‐T-­‐T-­‐... Die Kenntnis dieser Eigenschaft macht man sich in der Molekulardiagnostik zunutze. Die Sequenz dieser Basen ist für jedes Lebewesen eindeutig, d.h. die Summe aller DNA-­‐Stränge bildet die Gattung, Art und Individualität jedes einzelnen Lebewesens. Will man ein Virus identifizieren, so gilt es, eine bekannte, nur diesem Virus eigene Sequenz von Basen zu finden, die eingangs erwähnte Basensignatur. D.h. eine solche eindeutige Sequenz bildet den Ausgangspunkt im Analysevorgang. Natürlich ist es praktisch unmöglich, einfach ein Stückchen DNA zu finden. Die Suche gleicht der nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Daher besann man sich auf das Prinzip der Zellteilung, bei welcher aus einer DNA eine absolut identische Kopie erstellt wird. Aber wie kann dieser Vorgang soweit beschleunigt werden, dass er zu einer Vervielfältigung in nützlicher Zeit führt? Die DNA kann durch Erwärmung aufgetrennt werden, so dass zwar die Basenpaarbindungen, nicht aber der einzelne DNA-­‐Strang aufgebrochen wird. Aber erst durch ein wärmeresistentes Enzym kann später wieder die Ergänzung zu einer vollwertigen doppelsträngigen DNA ausgelöst werden. Normale Eiweisse werden bei den hohen Temperaturen zersetzt, wie sie für die Auftrennung der DNA-­‐Stränge verwendet werden müssen. Das besagte Eiweiss wurde in einem Bakterium gefunden, das in heissen Quellen vorkommt, dem Thermus aquaticus. Der vollständige Vorgang der Vervielfältigung trägt den Namen PCR (polymerase chain reaction) und führte, nebenbei erwähnt, zu zwei Nobelpreisen. Aber wie verläuft nun die Jagd im realen Revier, d.h. im Labor? Am Anfang steht die Probe, die untersucht werden soll. Hierbei kann es sich um Gewebe oder Flüssigkeiten irgendwelcher Art handeln. Bevorzugtes Medium ist das Blut, weil es vielfach in grosser Menge gewonnen und relativ einfach behandelt werden kann. Will man nun ein Virus über die Genanalyse ausfindig machen, so sind verschiedene Prozessschritte nötig. Diese bestehen aus: A.
B.
C.
D.
Probenvorbereitung Probenaufreinigung Amplifikation Detektion Die folgende Beschreibung fokussiert sich auf eine der vielen Messvarianten. Im ersten Schritt, der Probenvorbereitung, wird die Probe in passender Form in einen geeigneten Behälter gebracht. Dies kann manuell oder in grösseren Labors über Automaten erfolgen. Ist die Probe bereit, so gilt es im zweiten Schritt die Spreu vom Weizen zu trennen. D.h. man muss die DNA vom überwiegenden Rest der Zellen extrahieren. Dies kann ebenfalls über Automaten erfolgen, indem die Zelle chemisch aufgebrochen und die DNA z.B. an magnetische Partikel gebunden wird. Über einen Waschvorgang wird die nun magnetisch verstärkte DNA durch entsprechende Separation gewonnen und am Schluss die magnetischen Partikel wieder abgetrennt. Das Resultat dieser Aufreinigung ist ein Eluat, ein Gemisch aus Lösungsmittel und gelöster Substanz, das von der ursprünglichen Zelle nur noch die DNA enthält. Dieses Eluat wird danach in ein Gerät transferiert, welches den dritten und vierten Schritt, nämlich die Amplifikation und Detektion vornimmt. Die Amplifikation, also die Vervielfältigung der DNA, wird durch einen zyklischen thermischen Prozess durchgeführt, welcher in drei Phasen erfolgt. In der ersten Phase wird die Doppelhelix durch Erwärmung in zwei Einzelstränge aufgetrennt. Diese Phase wird Denaturierung genannt und findet bei Temperaturen zwischen 80°C und 96°C statt. In der zweiten Phase, der Annealing-­‐Phase, wird ein sogenannter Primer an je einen DNA-­‐Strang angelagert. Hierzu wird die Probe auf eine Temperatur zwischen 45°C und 65°C abgekühlt. Der Primer ist ein kleines, auf die vorhin genannten Signatur des Virus abgestimmtes Stückchen DNA, das an einem Ende einen Abschluss in Form eines Markers besitzt, der bei einer Anbindung an die DNA in einer bestimmten Wellenlänge fluoresziert. D.h. wenn sich ein solcher Primer mit der DNA verbindet, kann somit die Existenz des Virus bewiesen werden, in dem das Licht der entsprechenden Wellenlänge gemessen wird. In der dritten Phase, der Elongation, wird der DNA-­‐Strang bei einer Temperatur von 72°C mit freien Nukleotiden auf eine Länge von 2000-­‐3000 Basenpaaren ergänzt. Die Ergänzung beginnt an der nicht durch den Marker abgeschlossenen Seite des adaptierten Primers. Hier kommt das oben erwähnte, vom Bakterium Thermos aquaticus stammende Taq-­‐Enzym zum Einsatz, welches die Anbindung der Nukleotide katalysiert. Wie erwähnt bleibt dieses Taq-­‐Enzym im Gegensatz zu anderen Eiweissen auch bei den hohen Temperaturen der ersten Phase stabil. Damit ist der Zyklus abgeschlossen, in welchem jeder Einzelstrang ergänzt und somit der zu findende DNA-­‐Bereich verdoppelt wurde. Ein neuer Zyklus kann beginnen. Wird nun im ersten Zyklus ein Treffer verzeichnet und man führt anschliessend 30 weitere Zyklen durch, so erhält man 230 DNA-­‐Stücke, was einer Vervielfältigung von 1'073'741'824 entspricht. Damit hat man die nötige Menge von Kopien und fluoreszierenden Markern, die gemessen werden kann. Bei jedem Zyklus wird nun eine photometrische Messung durchgeführt, die bei einem positiven Resultat, d.h. der Identifikation des Virus in der Abfolge zu einer Wachstumskurve führt. Natürlich birgt diese Methode der Virus-­‐Detektion auch Risiken. Die einzelnen DNA-­‐Stücke sind leicht flüchtig und können sich bei unbedachter Behandlung im ganzen Labor verteilen. Das bedeutet unter anderem, dass sie in benachbarte Proben eingeschleust werden könnten (Kontamination) und somit das Resultat einer Probenuntersuchung verfälschten oder gar zu falschen Resultaten führten. Eine kritische Situation, man denke z.B. an einen HIV-­‐Test. Aus diesem Grund sind genau geregelte Abläufe und Protokollierung im Laboralltag von äusserster Wichtigkeit und die Zulassung der entsprechenden Geräte eine Notwendigkeit. Der gesamte Vorgang der Diagnose benötigt seine Zeit, da sowohl DNA-­‐Separation als auch der thermische Zyklus physikalischen und chemischen Bedingungen unterliegen. Alles in allem wird der automatische Aufreinigungs-­‐ und Messvorgang mit Amplifikation und Detektion in rund 2 bis 3 Stunden ablaufen. Nebst der beschriebenen Methode gibt es natürlich verschiedenste Messprinzipien, die hier nicht beschrieben sind. Auch eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte und Phasen würden den Rahmen dieses kurzen Abrisses sprengen. Die grosse Herausforderung bei der Jagd nach dem Virus ist die Herstellung des geeigneten Primers, der sowohl das Virus selbst, aber auch seine Unterarten (Stichwort Genotyping) identifizieren kann. Und alles in nützlicher Frist, es sei an die Beispiele der Schweinegrippe oder SARS erinnert. In diesem Sinn ist die Jagd erst eröffnet. 4.
Vom Beginn des Lebens 4.1 Ringvorlesung vom 24.9.09: Evolution und Organisation. Über den Ursprung des Lebens Prof. Dr. Homayoun Bagheri, Zürich Vorlesungsnotizen von MSc. Biol. Christian Winiger, Bern Prof. Dr. Homayoun Bagheri hat seinen BSc. in Molekularbiologie und Biochemie 1992 von der Universität von Wisconsin (Madison, Wisconsin) erhalten. 1994-­‐1997 absolvierte er seine Masterausbildung in Biologie an der Yale Universität (Newhaven, Connecticut). In der Universität von Yale absolvierte Prof. Bagheri von 1997-­‐2001 sein PhD auf dem Gebiet der „Oekologie und Evolutionsbiologie. Verschiedene Forschungsarbeiten brachten Prof. Bagheri nach Santa Fe (Santa Fe Institute, New Mexico), nach Berlin ans Max Planck Institut für Infektionsbiologie sowie das Max Planck Institut für molekulare Genetik. Seit 2006 hat Prof. Bagheri eine Stelle als Assistenz Professor in der Evolutionsgenetik am Institut für Zoologie an der Universität von Zürich inne. In seiner Forschung konzentriert sich Prof. Bagheri mit den zwei Hauptmechanismen, welche zu „Evolution“ führen: die Kräfte, welche die Zusammensetzung einer Population steuern sowie der Vererbung von Eigenschaften einer Elterngeneration auf die Nachkommen. Mit seiner interdisziplinären Forschung bewegt sich Prof. Bagheri zwischen der Populationsgenetik sowie dem „Beginn der Organisation“. Dies sowohl bezogen auf einzelne Individuen als auch auf dem Level von Populationen. Die Frage nach dem Ursprung des Lebens ist wohl eine der Fragen, welche die Menschheit seit Anbeginn begeistert und beschäftigt hat. Noch heute stellt diese Frage das umfassendste Rätsel der Biologie dar. Seit jeher haben die Menschen versucht, unser Dasein und Entstehen zu erklären und jede Kultur hat ihre Schöpfungsgeschichte, welche uns über den Ursprung des Lebens unterrichtet. Die Tatsache, dass die Menschen Schöpfungsgeschichten weitergeben und aufschreiben, zeigt das Verlangen nach einer Erklärung unserer Entstehung. Heute versuchen Biologen, Chemiker und Physiker die Entstehung des Lebens auf wissenschaftliche Weise in Experiment und Theorie nachzuvollziehen. In ironischer Weise wurde die nach dem bedeutenden Evolutionsforscher Leslie Orgel (1927-­‐2007) als „second law of Leslie Orgel benannten Regel: „Evolution is smarter than you are!“ aufgestellt. Sie fasst kurz und prägnant unseren Wissensstand über den Ursprung des Lebens zusammen. Obwohl viele renommierte Forschungsgruppen bedeutende Beiträge zur Klärung dieser Fragestellung geleistet haben gibt es bis heute keine Theorie, welche den Ursprung des Lebens annähernd erklärt. Viele erarbeitete Theorien gelten als relativ unbestritten und sind durch Experimente bedingt bestätigt worden. Diese Theorien geben aber bestenfalls Ansatzpunkte für Erklärungen eines Aspekts, jedoch nie eine abschliessende, eindeutige Antwort zu einer Frage. Gesichert ist, dass der biologischen Evolution eine chemische Evolution vorausgegangen sein muss. Die Tatsache, dass wir die Begebenheiten auf der frühen Erde nur ansatzweise kennen (Elemente, Atmosphäre, Wasserhaushalt, Temperatur, Vulkanismus…) macht es schwierig, beschreibende Experimente zu gestalten. Diese Tatsache stellte auch Professor Bagheri zu Beginn seines Vortrags in den Mittelpunkt. Sein Vortrag bietet deshalb nur bedingt Antworten auf konkrete Fragen. Vielmehr wollte Professor Bagheri Ansätze und Fragen erläutern, welche die heutige Wissenschaft auf der Suche nach dem „Origin of Life“ beschäftigen, welche unabdingbar angegangen werden müssen, um Lösungsansätze zu erarbeiten und welche Schlüsselfragen zur Erstellung neuer Theorien beinhalten können. Professor Bagheri fokussierte in seinem Vortrag drei Gebiete: 1) Die Evolutionsgeschichte unseres Planeten. Voraussetzung für die Entstehung des Lebens 2) Was ist überhaupt notwendig für Leben? 3) Erkundung von anderen Planeten und Monden. Suche nach der Möglichkeit der Entstehung des Lebens ausserhalb unseres Planeten. In der Wissenschaft ist es heute unbestritten, dass der biologischen Evolution eine chemische Evolution vorausgegangen sein muss. Die „Moleküle des Lebens“ müssen sich formiert haben, zusammenlagern, polymerisieren und sich vermehren. Wo dieser Prozess stattgefunden hat ist bis heute umstritten. Vertreter der sogenannten Astrobiologie gehen davon aus, dass die Biomoleküle auf anderen Planeten, Monden, Kometen, Astroiden entstanden sind und durch Kometeneinschläge auf die Erde gebracht wurden. Andere Forschungsgruppen gehen davon aus, dass der Prozess der chemischen Evolution auf der Erde stattgefunden hat. In der Zeitspanne zwischen der Entstehung der Erde (4.5 Milliarden Jahre) und dem Auftauchen der ersten nachweisbaren Bakterien (3.5 Milliarden Jahre) müsste sich demnach diese Biomoleküle (DNA, RNA, Proteine, Lipide…) mehr oder weniger spontan gebildet haben. Um diesen Prozess theoretisch oder gar im Experiment nachzuvollziehen, müssen die Bedingungen auf der jungen Erde möglichst genau simuliert werden. Man geht davon aus, dass die Erde eine Atmosphäre bestehend aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Wasser hatte. Ausgehend von der Zusammensetzung dieser „theoretischen Ursuppe“ konnte S. Miller und H. Urey 1953 im Labor erste Biomoleküle (Aminosäuren) herstellen indem sie diese „Ursuppe“ tagelang der Hitze und elektrischen Entladungen (Blitze) ausgesetzt hatten. Diese sogenannte Ursuppentheorie machte Miller und Urey weltberühmt und das Experiment wurde in verschiedenen Varianten nachvollzogen. Heute betrachtet man diese Theorie als bedeutenden Baustein in der „Origin of Life“ Forschung, obwohl am Experiment von Miller auch bescheidene Kritik geübt wird: Man geht davon aus, dass auch bedeutende Teile von Kohlendioxid im Wasser gelöst waren (Miller berücksichtigte das Kohlendioxid nicht). Zudem fand man zwar einzelne Aminosäuren, jedoch nie Polymere aus diesen Aminosäuren was jedoch für jede Art von Leben unabdingbar wäre. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie kontrovers die Diskussion um die Entstehung des Lebens geführt wird. Professor Bagheri fokussiert auf einen weiteren möglichen Ansatz zur Beantwortung der Frage nach dem Ursprung des Lebens. Seine einfache Frage lautet: Was braucht es alles für „das Leben“? Dabei wird klar, dass sich hauptsächlich drei Merkmale für das Leben hervortun: Die Kompartimentierung, das Erbgut und der Metabolismus. Die Kompartimentierung erlaubt es einem Lebewesen (einer Urzelle), sich von der Aussenwelt abzugrenzen. Durch dieses Abgrenzen erhalten wir eine autonome Einheit – ein Individuum. Im Rahmen dieser Einheit werden die beiden anderen wichtigen Aspekte des Lebens diskutiert: das Erbgut sowie der Metabolismus. Auch diesen beide Gebiete werden in der Forschung kontrovers diskutiert und die Frage steht noch im Raume, welches der beiden Merkmale des Lebens sich zuerst ausgebildet hat. Professor Bagheri hat in seinem Vortrag explizit das Gebiet des Metabolismus hervorgehoben. Ich für meine Person denke, dass die zentralen Fragen nach dem Leben auf dem Gebiet des Erbguts und somit der Vererbung liegen. Daher werde ich dazu einige Ansätze in den Raum stellen, bevor ich die Anregungen von Professor Bagheri zu den Fragen des Metabolismus erläutere. Einfach betrachtet ist die Fortpflanzung der zentrale Antrieb jedes Lebewesens (beim Menschen spielt vielleicht noch bedingt der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Eigenbestimmung usw. mit). Die Fortpflanzung beinhaltet den Erhalt und die Weitergabe des eigenen Bauplans – seiner DNA. Die ganze Replikationsmaschinerie, die Zellhülle, der Energiehaushalt eines Lebewesens, Interaktionen zwischen den Zellen sowie soziale Interaktionen zwischen Individuen haben den einen Zweck, die eigene DNA weiterzugeben. Geht man davon aus, dass die Erbinformation (DNA/RNA) das zentrale Element des Lebens ist, müsste sich dieses logischerweise auch als erstes ausgebildet haben (es ist unwahrscheinlich, dass sich erst die anderen Biomoleküle ausgebildet haben und erst in einem anschliessenden Schritt die Information zur Synthese dieser Biomoleküle in der DNA/RNA codiert wurde). Man geht davon aus, dass die RNA das erste Biomolekül war, welches biologische Information entsprechend dem heutigen 4 Basencode gespeichert hat und vor der DNA und den Proteinen für Information, Struktur und Katalyse verantwortlich war (RNA-­‐World). In einem frühen Entwicklungsschritt müssen sich demnach die Bausteine der RNA (die Nukleotide und Nukleoside) polymerisiert haben. Heutzutage kann man sich gut vorstellen, dass diese Polymerisierung durch Mineralien katalysiert wurde. Diese primären RNA-­‐Stränge haben sich gemäss den heute geltenden Basenpaarungsregeln – Adenin paart mit Thymidin (Uracil) und Guanosin paart mit Cytosin – zu Doppelsträngen zusammengelagert, welche wiederum als Template für die weitere Polymerisierung dienen können. Findet diese Polymerisierung in einer abgeschlossenen Zellhülle statt, haben wir erste Formen von einem primitiven Lebewesen mit eigener Fortpflanzung. Professor Bagheri erläutert verschiedene Aspekte zum Thema Metabolismus von Urformen des Lebens. Dabei muss man sich vor Augen halten was „Metabolismus“ überhaupt für einen Zweck hat. Unter Metabolismus werden alle Vorgänge zusammengefasst, welche die Bereitstellung von Baustoffen und Energie zum Ziel haben. Heterotrophe Lebewesen nehmen die Baustoffe in Form von Nahrung (Proteine, Fette, Zucker) zu sich. Autotrophe Lebewesen generieren die Baustoffe über die Aufnahme von CO2 aus der Luft. Die „biologische Energie“ ist ein Protonen [H+]-­‐Gradient über eine Membran. Dieser Protonengradient wird ausgenutzt um das Molekül ATP herzustellen, welches als biologischer Energiespeicher dient. Die Herstellung und Aufrechterhaltung eines Protonengradienten über eine Membran erfordert einen Fluss von Elektronen über eine Kette von Elektronakzeptoren und –Donoren. Somit ist die Generierung von Energie nur abhängig von einem Elektronen Donor (reduzierte chemische Verbindung) und einem Endakzeptor (oxidierte chemische Verbindung). Zur Energiegewinnung werden noch heute verschiedene Donoren-­‐Akzeptorenpaare verwendet. Für die Origin of Life-­‐Forschung stehen Schwefel-­‐Eisen-­‐Verbindungen im Zentrum des Interessens. Dabei wird davon ausgegangen, dass verschiedene Oxidationsstufen von Schwefel und Eisen als Elektronen-­‐Donoren und –Akzeptoren gedient haben. „Relikte“ dieser sogenannten Eisen-­‐Schwefel-­‐Welt finden wir noch heute in der Atmungskette (Kaskade von Donoren-­‐Akzeptoren, welche die Energie in jeder Zelle breitstellen) in Form von sogenannten [Fe-­‐S]4 oder [Fe-­‐S]8 Klustern. Vor 3.5 Milliarden Jahre hat sich ein Erfolgsmodell entwickelt, welches noch bis heute das Leben auf unserem Planeten bestimmt: Die Photosynthese! Bei der Photosynthese werden Elektronen aus dem Wasser mittels Lichtenergie auf Kohlenstoff übertragen. Dabei entsteht Zucker und elementarer Sauerstoff. Der Zeitpunkt der Entstehung der Photosynthese kann einerseits aus fossilen Bakterien (Stromatolithen aus Cyanobakterien) bestimmt werden. Eine andere Methode macht sich die Tatsache zu nutzen, dass die Uratmosphäre keinen Sauerstoff enthielt. Erst mit dem Aufkommen der Photosynthese hat sich elementarer Sauerstoff in der Atmosphäre angereichert. Diese steigende Konzentration an Sauerstoff lässt sich über Jahrmillionen in Mineralien in Form von Oxiden nachweisen. Der durch die Photosynthese gebildete Zucker und Sauerstoff ermöglichte es den Lebewesen ihre Lebensweise standortunabhängiger zu gestalten. Zudem ist Sauerstoff ein sehr guter Elektronenakzeptor und ermöglicht es oxophilen Lebewesen am meisten Energie pro umgesetzte Stoffmenge zu generieren. Diese Voraussetzungen ermöglichten erst die Erschaffung komplexerer und grösserer Lebewesen so wie wir sie heute kennen. Ein erster Schritt zur Komplexität vollzog sich mit der Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Bakterien. Endosymbiontentheorie: Nach der sogenannten Endosymbiontentheorie vereinten sich Urbakterien mit Photosynthese betreibende Cyanobakterien und oxidative Bakterien (Bakterien welche Sauerstoff veratmen können). Aus diesen „Cyanobakterien“ wurden die heutigen Chloroplasten, die oxidativen Bakterien entwickelten sich weiter zu den heutigen Mitochondrien. So entstanden die eukariotischen Zellen, welche Grundlage sind für alle höheren Tiere und Pflanzen. Als letzten Punkt in seinem Vortrag erläuterte Professor Bagheri die Frage ob Leben auch ausserhalb unseres Planeten entstanden sein könnte. Verschiedene Kometen haben Biomoleküle zur Erde gebracht; ein Hinweis darauf, dass die Evolution nicht gezwungenermassen auf der Erde stattgefunden haben muss. Die Suche nach „Leben im Weltall“ konzentriert sich hauptsächlich auf die Suche nach Planeten und Atmosphären, welche ein Leben nach unseren Vorstellungen ermöglichen würden. Dazu gehört in erster Linie ein flüssiges Medium (Wasser oder flüssiges Methan oder NH3...) sowie Temperaturbereiche, welche die Entstehung von Leben ermöglichen könnten. Die Voyager Sonden welche 1980 gestartet wurden, haben inzwischen unser Sonnensystem verlassen und senden immer noch zuverlässige Daten über die Beschaffenheit von Planetenatmosphären zur Erde. Enceladus – der Mond des Saturn-­‐ entspräche mit seiner Atmosphäre aus Wasser, Kohlendioxid, Stickstoff und Methan am ehesten den Bedingungen unter welchen wir uns Leben vorstellen könne. Keine der erwähnten Forschungsgebiete oder Theorien mag erklären wie das Leben auf unserem Planeten entstanden ist. Jedoch liefern uns alle diese Forschungsansätze interessante Anhaltspunkte wie wir entscheidende Fragen angehen müssen. Es ist wahrscheinlich, dass uns die Suche nach dem Ursprung des Lebens noch Jahrzehnte beschäftigen wird oder der Ursprung des Lebens für immer im Dunkeln bleibt. Sicher ist jedoch, dass uns der Prozess der Suche nach dem Ursprung bewusst macht, was „Leben“ aus wissenschaftlicher und philosophischer Sicht bedeutet und noch lange das grösste Rätsel der Menschheit darstellt. Eukariotische Zellen sind ein Beispiel dafür, wie verschiedene, bereits bestehende Komponenten zu einer neuen arbeitsteiligen Organisationsform verschmelzen und infolge ihrer gesteigerten Komplexität mehr Aufgaben übernehmen können, als es den einfachen Vorläufern möglich war. H. Bagheri 4.2 GASSMANN, F., Komplexe Systeme, Die Vereinigung von Chaos und Ordnung. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1997) 142/2: 41-­‐48 Dr. Fritz Gassmann, Paul Scherrer Institut, CH-­‐5232 Villigen Literaturbericht, wb Es wird vielleicht nie möglich sein, die Jahrtausende alte Frage nach dem Ursprung des Lebens überzeugend zu beantworten. Es macht jedoch den Anschein, dass auf der Basis nichtlinearer, zirkulär-­‐kausaler, dissipativer Prozesse fern vom thermodynamischen Gleichgewicht neue und interessante wissenschaftliche Antworten auf Teilfragen gegeben werden können. (F. Gassmann) Der Autor erklärt einleitend, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Begriffe Determinismus und Vorhersagbarkeit makroskopischer Phänomene stark relativiert wurden. Dieser Paradigmenwechsel ging zwar von der Physik aus, hat aber unterdessen alle Disziplinen erreicht wie auch die Human-­‐ und Geisteswissenschaften. Die Begriffe Chaos und Ordnung, welche traditionell Gegenpole waren, wurden nach Gassmann zu verbindenden Elementen der Komplexität, der Selbstorganisation und Kreativität. Ordnung trägt im Sprachgebrauch sowohl die positive Besetzung von Struktur, Klarheit, Determiniertheit und Vertrauen wie auch die negative Assoziation von Sterilität, Verkrustung und Langeweile. Chaos hingegen wird verstanden als Wirrwar, Zerstörung und Angst, zeigt aber auch ein positives Umfeld von Überraschung und Kurzweil oder gar Genialität. Heute ermöglicht die Vereinigung von Chaos und Ordnung ein Verständnis natürlicher biologischer Systeme, ähnlich wie die Quantenmechanik mit der Verbindung der Gegenpole „Teilchen“ und „Welle“ zu einer sprunghaften Erweiterung der physikalischen Erkenntnisbasis führte. Die klassische Physik wurde geprägt durch Reproduzierbarkeit und Determinismus, welche sich in Phänomenen zeigen, die der starken Kausalität genügen. Kleine Änderungen der Bedingungen haben dabei keine dramatischen Auswirkungen. Dem gegenüber erwähnt Gassmann die schwache Kausalität, die sich dadurch auszeichnet, dass kleine Störungen der Anfangsbedingungen grosse Abweichungen in der zeitlichen Entwicklung der Variablen haben können. In der klassischen Naturwissenschaft sei nach eleganten, idealisierten mathematischen Lösungen gesucht worden. Die Systeme seien linearisiert worden, und die Nichtlinearitäten, welche in der Natur die Regel seien, wurden vernachlässigt oder ausgeblendet. Es wurden meist Systeme mit wenigen Freiheitsgraden behandelt, während der Zwischenbereich, in dem sich das Leben abspielt, als unattraktiv und mathematisch schwierig übersprungen wurde. Dies habe wesentlich zur Diskrepanz im Verständnis von Natur und Technik beigetragen. Vor rund 100 Jahren berechnete der Mathematiker Henry Poincaré, dass das Planetensystem auf kleinste Störungen so empfindlich reagieren könne, dass sein Zustand nach einer bestimmten Zeit nicht mehr vorhersagbar sei. Diese Aussage sei aber damals noch nicht ernst genommen werden. Erst 1961 entdeckte der Meteorologe Edward Lorenz zufällig, dass kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen von Wettervorhersagen mit zunehmendem Zeitabstand zunehmend grössere Unterschiede in den Resultaten verursachten. Er bezeichnete dies als „Schmetterlingseffekt“, wobei die Abweichungen aber nicht durch Schmetterlinge, sondern durch nicht vorhersagbare Turbulenzen entstehen. Die theoretisch mögliche Prognosezeit für das Wetter wird durch diesen Effekt auf rund zwei Wochen beschränkt. Diese Kombination eines streng deterministischen Systems mit dem Zufall wurde allerdings noch lange als unhaltbar angesehen. Lorenz entdeckte aber auch experimentell die Selbstorganisation von verschiedenförmigen „Konvektionszellen“ innerhalb von Flüssigkeiten oder Gasen, wenn diese von aufsteigender Wärme durchflossen werden. Auch diese Experimente waren schon 1916 von H. Bénard und Lord Rayleigh durchgeführt und aus den Grundgleichungen der Physik abgeleitet worden. Die Konvektionszellen wurden vom Nobelpreisträger I. Prigogine als „dissipative Struktur“ bezeichnet. Diese geordnete Struktur entsteht bei einem kritischen Wärmefluss durch das System alleine und verschwindet wieder, wenn dieser zu gering wird. Voraussetzung für die Ausbildung solcher räumlicher Strukturen ist eine Nichtlinearität in den Grundgleichungen wie etwa in der Wärmetransportgleichung. Die Zunahme der Ordnung erfolgt auf Kosten einer Entropiezunahme seiner Umgebung, womit das Gesamtsystem nicht gegen das Entropiegesetz der Thermodynamik verstösst. Die dissipative Struktur reagiert auf Störungen mit einer Art „Reparaturprozess“ und stürzt nicht ab wie etwa ein Computer. Gassmann spricht dem System eine gewisse Kreativität und Individualität zu, weil bei Änderungen des Energiedurchflusses sehr komplexe Formen entstehen, welche bei jedem Versuch anders ausfallen. Es können abrupte Strukturveränderungen auftreten, welche eine entfernte Ähnlichkeit mit biomorphologischen Entwicklungsschritten erkennen lassen. In den siebziger Jahren wurden weitere Interpretationen der Lorenz-­‐Gleichungen gefunden. Sie können übergeführt werden in die Gleichungen für ein Wasserrad, einen Laser oder zwei symbiotisch lebende Populationen, die auf einer einzigen Nahrungsquelle basieren. 1994 wurde im Technorama in Winterthur ein Wasserrad installiert, welches mit dem Wasserdurchfluss durch angehängte Gefässe und der wechselnden Drehung des Rades ein Analogon zum Konvektionsexperiment von Lorenz darstellt. Das Gewicht des Wassers in den Gefässen treibt das Rad an, der Wasserzufluss erfolgt symmetrisch und konstant und das Wasser fliesst durch Löcher in den Gefässen ab. Als Bremse wirken Schaufeln, welche durch Wassergezogen werden und Energie dissipieren. Das Wasserrad erfährt durch diese Anordnung einen stetigen Wechsel der Drehrichtung in einer sich nie wiederholenden Folge. Es weist damit keine Periodizität oder Stabilität auf. Dies wurde vom Autor mit Computermodellen bewiesen. Alle Perioden erwiesen sich als instabil, weil kleinste Störungen exponentiell anwachsen. Er veränderte darauf die Durchflussparameter schrittweise und stiess dabei auf eine unerwartete Komplexität des Bewegungsverhaltens dieses einfachen Systems. Am Computer simulierte er 20000 verschiedene Transienten (Kombinationen von Zu-­‐ und Abfluss) und fand dabei einzelne Übergänge zu stationärem oder periodischem Verhalten. Dabei trat „transientisches Chaos“ auf, nämlich unperiodisch lange Zeiten und Transienten zwischen den Übergängen von Chaos zu Ordnung, welche einer exponentiellen Verteilung genügen und somit durch eine Halbwertszeit charakterisiert werden können. Nur die Übergangswahrscheinlichkeit war konstant. Zudem fand er „Multistabilität“ in den Übergangszonen, d.h. das System besitzt für dieselben Parameterwerte verschiedene stabile oder pendelförmige Bewegungszustände. Durch eine kleine Störung geht das System wieder in chaotische Transienten über und kann dann zufälligerweise entweder wieder die stationäre Bewegung finden oder in eine Pendelbewegung übergehen. Der Autor konnte nun durch zufällige Anordnung von Störungen, was als „Rauschen“ bezeichnet wird, die Halbwertszeit der Übergänge von Chaos zu Ordnung beeinflussen. Bei der optimalen Rauschamplitude dauerte der spontane Ordnungsbildungsprozess nur wenige Minuten anstelle von rund 1000 Stunden ohne Rauschen. Er spricht deshalb von rauschinduzierten Chaos-­‐
Ordnung-­‐Übergängen und kann damit eine drastische Beschleunigung von Strukturbildungsprozessen in der Natur erklären. Eiweissmoleküle können sich etwa nach kurzen chaotischen Transienten spontan zu bestimmten räumlichen Strukturen falten, wobei thermische Zitterbewegungen die Rolle des Rauschens übernehmen. Die Natur habe aber einen noch unbekannten, wesentlich leistungsfähigeren Effekt zur schnellen Auffindung metastabiler Ordnungsstrukturen, als dies der Mensch mit Berechnungen bisher anstellen könne. Gassmann geht nun der Frage nach, ob natürliche Systeme überhaupt berechenbar seien. Sie enthalten ja wie das Wasserrad viele nichtlineare Wechselwirkungen und besitzen eine zirkulär-­‐kausale Struktur, nämlich Rückkoppelungsschlaufen durch chaotisches Verhalten und abrupte Verhaltensänderungen bei kritischen Parameterveränderungen. Prognosen über einen zukünftigen Zustand des Wasserrades kann man trotz der Simulationsmodelle nur machen, wenn sich das System in einem stabilen Zustand befindet, der durch kleine Störungen nicht aufgehoben wird. In einem chaotischen, aperiodischen Zustand des Systems, der die für Lebensvorgänge typische Kreativität aufweist, wird die Vorhersage jedoch wie etwa beim Wetter begrenzt. Noch unberechenbarer sind instabile Systeme, die durch kaum wahrnehmbare Veränderungen der Parameter in die Nähe eines kritischen Punktes gelangen können, wo sie ihr Verhalten sprunghaft ändern können. Beim Wetter und beim Wasserrad ist eine beschränkte Prognose noch möglich, beim Klimasystem oder beim Immunsystem sei es aber möglich, dass wir das Ergebnis von Eingriffen nicht im Voraus wissen können. Am Schluss kommt der Autor auf die anfangs gestellte Frage nach dem Ursprung des Lebens zurück. Er hat im Lauf dieser Arbeit gezeigt, dass einerseits sehr einfache Prozesse eine komplexe Mannigfaltigkeit von Erscheinungen erzeugen können, und dass anderseits sehr komplex aufgebaute Systeme mit vielen Freiheitsgraden einfache Ordnungsstrukturen hervorbringen können. Zudem seien für das Verständnis von lebenden Systemen weitere Eigenschaften von Bedeutung: -­‐
-­‐
-­‐
Autokatalytische Prozesse , die sich zu Zyklen und Hyperzyklen entwickeln können Ein Energiefluss durch das System, der für ein starkes Nichtgleichgewicht sorgt Mikroskopische Zufallsprozesse, die durch thermisches Rauschen oder radioaktiven Zerfall verursacht und durch nichtlineare Prozesse auf makroskopische Werte verstärkt werden, wobei Individualität und Kreativität entsteht, aber gleichzeitig die Möglichkeit der Vorhersage eingeschränkt wird. 4.3 WALDE, P., Was ist Leben? – Gedanken eines Chemikers. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004) 149/1: 3-­‐14 Prof. Dr. Peter Walde, ETH Zürich, 2004 Literaturbericht, wb Der Autor versucht Antworten auf die oben gestellte Frage von der Chemie her zu geben. Diese sieht zelluläres Leben als spezielle Form von Materie, als eine hochkomplexe Organisation und Wechselwirkung von einerseits sehr einfachen und anderseits sehr komplizierten Molekülen innerhalb abgeschlossener Zellen, oder einer definierten Ansammlung von Zellen, und im Austausch mit der Umgebung. Die evolutionären Hypothesen postulieren zudem eine Verwandtschaft sämtlicher Lebewesen und eine Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren, sowie einen spontanen Übergang von unbelebter zu belebter Materie (Autopoiese) vor ca. 4 Milliarden Jahren als Folge zunehmender Komplexität. Die Problematik dieser naturwissenschaftlichen Definition veranschaulicht Prof. Walde anhand der Fragen: „Was ist Wasser“ und „Was ist ein AIDS-­‐Virus“. Wasser kann als Molekularmodell als kovalente chemische Verbindung der Atome H-­‐O-­‐H gesehen werden. Die Verbindung ist nicht linear, sondern weist einen Bindungswinkel von 105o auf, woraus die Polarität des Moleküls resultiert. Diese rein chemische Beschreibung ist aber reduktionistisch und genügt nicht zur Erfassung der verschiedenen Eigenschaften von Wasser. Weiter müssten etwa berücksichtigt werden die Wechselwirkungen mit anderen H20-­‐ sowie mit anderen Molekülen und mit elektromagnetischer Strahlung, sowie die molekulare Dynamik bei verschiedenen Temperaturen. Auch der Aufbau aus den schweren Elementarteilchen Protonen und Neutronen (Baryonen), welche wiederum aus Quarks zusammengesetzt sind, und den leichten Teilchen (Leptonen) der Elektronen muss mit seinen Wechselwirkungen als spezielle Form von Materie gesehen werden, welche bezüglich ihres Verhaltens auch heute noch lange nicht vollständig verstanden wird. Eine andere spezielle Form von Materie beschreibt der Autor mit dem AIDS-­‐Virus. Es ist ein ca. 100 Nanometer grosser Partikel und enthält eine aus 9000 Nukleotiden bestehende Ribonukleinsäure RNA als Erbgut. Weiter findet man Enzyme, welche die spezifische Spaltung von Peptidbindungen (Proteasen), die Umwandung der RNA in DNA (Reverse Transkriptase) und den Einbau der Virus-­‐DNA in die Wirts-­‐DNA (Integrase) steuern. An der Oberfläche sind verschiedene Proteine eingebettet, die sich komplementär an Oberflächenproteine der „Helfer-­‐T-­‐Zellen des menschlichen Immunsystems binden können, womit das Eindringen der Virus-­‐DNA in die Abwehrzelle möglich wird. Walde betrachtet das Virus nicht als Lebewesen und betont, dass es nach der experimentellen Zerlegung in seine Einzelteile wieder zu einem funktionierenden Virus zusammengelagert werden kann, was bei lebenden Zellen nicht möglich ist. Das diesbezüglich klassische Experiment sei mit dem Tabak-­‐Mosaik-­‐Virus durchgeführt worden. Er betrachtet dies als Folge kinetisch und thermodynamisch kontrollierter molekularer Selbstorganisation in wässeriger Lösung bei pH 6. Trotz dem heutigen Wissen über die chemischen und physikalischen Abläufe, die in Lebewesen eine Rolle spielen, und trotz der bereits realisierten Einflussmöglichkeiten auf einige Prozesse, fehlt aber ein übergreifendes Verständnis der vernetzten Koordination der verschiedenen, teilweise parallel ablaufenden chemischen Reaktionen, sei es in einem einfachen Bakterium mit „lediglich“ 6,4 x 10 5 Nukleotidpaaren, oder in einem Elefanten. Trotz dem heutigen grossen Wissen über das menschliche Genom, so betont Walde, sollte man mit Bescheidenheit eingestehen, dass man die komplexen Zusammenhänge des Lebens noch nicht versteht. Der Autor beschränkt sich deshalb in seinen weiteren Betrachtungen auf die Charakterisierung der Lebewesen nach den heute bekannten Merkmalen. Gemeinsam ist allen Lebewesen der Aufbau aus Zellen, sei es aus einer einzigen, oder wie beim Menschen aus ca. 1013, welche miteinander kommunizieren. Weiter ist in allen Lebewesen die DNA als Informationsträger für die Synthese von Proteinen enthalten. Alle Zellen enthalten zudem Ribosomen, RNA-­‐Protein-­‐Komplexe, welche bei der Proteinsynthese eine entscheidende Rolle spielen. Weiter sind alle Zellen durch eine 5-­‐10 Nanometer dünne Membran von der Umgebung abgegrenzt, welche vor allem aus amphiphilen Lipiden besteht, in welche Proteine integriert sein können. Diese strukturellen Merkmale sind eine Voraussetzung für die dynamischen Merkmale, wie die Fähigkeit zur Reproduktion, zur Adaptation und Mutation. Die Frage nach einem prinzipiellen Unterschied zwischen einem Bakterium und einem Menschen beantwortet Walde mit einem höheren Komplexitätsgrad. Schon Bakterien kommunizieren miteinander durch den Austausch von chemischen Substanzen. Doch beim Menschen finden sich eine wesentlich höhere Vielfalt von Zellenfunktionalität und verschiedene hierarchische Ebenen spezialisierter Zelltypen. Menschliche DNA ist deshalb mit 3,2 x 109 Nukleotidpaaren viel länger als bei Bakterien und muss z.B. alle Informationen enthalten für die Zelldifferenzierung. Ein weiteres Charakteristikum ist der phylogenetische Stammbaum, über den alle Lebewesen nach den evolutionsbiologischen und molekulargenetischen Theorien miteinander verwandt sind. Als hypothetischen, letzten gemeinsamen Vorfahren deutet Walde ein hyperthermophiles einzelliges Lebewesen, ähnlichen den heute in Vulkangebieten und bei hydrothermalen Quellen lebenden Archaebakterien. Dass solche einzellige, „primitive“ lebende Systeme aus unbelebter Materie entstanden sind, wird in heute geltender Hypothese als Ursprung des Lebens betrachtet. Der Autor sieht aber keinen prinzipiellen Unterschied darin, ob dieser Ursprung auf der Erde selbst, auf anderen Planeten, in anderen Sonnensystemen oder im interstellaren Raum stattgefunden hat. Prof. Walde sieht deshalb die Frage „Was ist Leben?“ untrennbar verknüpft mit der Frage „Wie ist Leben entstanden?“. Da der Transformationsprozess von unbelebter zu belebter Materie wie erläutert nur schwer vorstellbar ist, müssen erste Lebensformen wesentlich primitiver gewesen sein als heutige Lebewesen. Walde stützt sich deshalb auf die Theorie der „Autopoiese von minimalem Leben“ nach Luisi, 2003. Man versteht darunter ein Netzwerk von Prozessen, welche zur Synthese, zur Umwandlung und zum Abbau von Komponenten der Einheit führen, wobei folgende Eigenschaften erfüllt sein müssen: 1.
2.
Die Komponenten müssen kontinuierlich das ganze Netzwerk, welches die Komponenten produziert, regenerieren. Die Komponenten bilden das ganze System als von der Umgebung klar abgegrenzte Einheit Die Autopoiese versucht also die Dynamik lebender Systeme als Ganzes zu erfassen, wobei das molekulare Verständnis der einzelnen chemischen Prozesse in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Gerade die wichtige Rolle der Kompartimentierung durch die Zellmembran wurde schon vor 40 Jahren erkannt. Der Autor widmet deshalb der Selbstorganisation von amphiphilen Molekülen zu Vesikeln, sog. Liposomen, seine nächsten Betrachtungen: Aus rein thermodynamischen Gründen können amphiphile Moleküle in einer wässerigen Umgebung spontan Kompartimente bilden, welche ein wässeriges Inneres enthalten und dieses von einem wässerigen Äusseren trennen. Ein solches Vesikel unterscheidet sich von einem einfachen Lipidmolekül ganz deutlich bezüglich seiner molekularen Komplexität, welche sich in einer lokalen Ordnung zeigt. Der Autor präsentiert zur Verdeutlichung mikroskopische Aufnahmen von Ölsäure-­‐Vesikel-­‐Suspensionen mit aus Doppelschichten aufgebauten Vesikeln. Wichtig sei, dass die Vesikel-­‐bildende Substanz amphiphilen Charakter habe, was beim Dekansäure/Dekanoat-­‐Ölsäure/Oleat-­‐Paar erfüllt sei, aber auch bei Membranlipiden, welche in heutigen Zellmembranen vorkommen. Diese spontane Zunahme molekularer Komplexität chemischer Systeme wird als EMERGENZ bezeichnet. Walde zitiert dazu den Nobelpreisträger Pier Luigi Luisi, 2002. Es sind ausserdem kompliziertere Vesikelbildner bekannt, und es könnten in präbiotischer Zeit Fettsäuremoleküle aus Kohlendioxid, Ameisensäure und Wasser entstanden sein. Vesikel werden deshalb als Modelle für „Protozellen“, supramolekulare, informationslose Strukturen als Vorstufen der ersten lebenden Zellen betrachtet. Sie können auch durch einfache chemische Reaktionen zu einer Selbst-­‐Reproduktion gebracht werden. Um ihre molekulare Komplexität zu erhöhen, können sie mit weiteren Substanzen beladen werden. Da dafür RNA/DNA interessant wäre, wird experimentell versucht, mit selbstreplikativen Oligonukleotiden bzw. Oligopeptiden ein selbst reproduzierendes Vesikel System zu schaffen, welches auch die Fähigkeit zu Mutation und Adaptation hätte. Dies wäre ein interessanter Schritt in Richtung Schaffung von „minimalem Leben „. Aber auch dies wäre nach Walde noch sehr weit entfernt von heutigen Zellen. Solche Experimente bilden einen sog. „bottom-­‐up-­‐approach“ und stehen im Gegensatz zu einem „bottom-­‐
down-­‐approach“, mit welchem versucht wird, durch Vereinfachung existierender Lebewesen zu „minimalem Leben“ zu gelangen. Walde geht auch noch auf die Rolle der RNA ein, welcher im Begriff der „RNA-­‐Welt“ eine gewisse Bedeutung zukommt. Gewisse RNA-­‐Moleküle haben katalytische Aktivitäten wie Enzyme (Ribozyme), sind aber instabiler als DNA, und ihre präbiotische, spontane Entstehung ist zur Zeit nicht vorstellbar. Selbstreplizierende und katalytische aktive RNA-­‐Moleküle sollen präbiotisch ohne Kompartimentierung ein Vorläufersystem zur heutigen DNA-­‐RNA-­‐Protein-­‐Welt gewesen sein. Der Autor steht dieser Vorstellung allerdings skeptisch gegenüber. Die Forschung geht aber trotz der genannten Schwierigkeiten weiter. Die heutige Genomik als Kenntnis aller Gene eines Lebewesens wird bereits abgelöst von der Proteomik als Kenntnis aller vom Lebewesen produzierten Proteine und von der Metabolik als Kenntnis aller Stoffwechselreaktionen. Gerade der Naturwissenschafter, so betont Prof. Walde, sollte allen Lebewesen mit grosser Achtung gegenübertreten, da sie unseren technischen Produkten und unserem Verständnis von Chemie und Biologie weit überlegen sind. Wenn Leben trotzdem als Resultat der Bildung von gewissen Molekülen und der kontrollierten und spezifischen Anordnung dieser Moleküle und deren Interaktionen gesehen wird, so sollte dies immer mit der nötigen Bescheidenheit und Respekt verbunden sein. Dies fordert der Autor auch, wo er am Schluss doch noch eine allgemeine Antwort auf die eingangs gestellte Frage zu geben versucht: Leben ist eine aus miteinander – in hochkomplexer und vernetzter Art und Weise – interagierender Molekülen aufgebaute Form der Materie, welche z.B. die Eigenschaften besitzt, sich zu reproduzieren, sich neuen Umgebungsbedingungen anzupassen und sich zu verändern, unter Weitergabe der wesentlichsten Eigenschaften der Materieform. Für die Atomphysiker wäre noch anzufügen, dass es sich letztlich um eine spezielle Form von miteinander interagierender Quarks und Leptonen handelt Der Autor schliesst aber nicht aus, dass in Zukunft durch die Entwicklung der Komplexitäts-­‐ und Informationstheorien sowie der Systembiologie ein tieferes Verständnis gewonnen werden könnte. 4.4 REIHER, M., Von der Natur lernen: Die Theorie der Stickstoff-­‐Fixierung unter milden Bedingungen. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2007) 152(3): 55-­‐62 Prof. Dr. Markus Reiher, Laboratorium für physikalische Chemie der ETH, Zürich 2007 Literaturbericht von Bruno Krummenacher, Dr. chem. Tägerwilen Die moderne Wissenschaft versucht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Methoden den noch ungelösten Geheimnissen und Grundlagen des Lebens und seiner Evolution auf die Spur zu kommen. Die Neugierde des Menschen ist eine der wichtigsten Triebkräfte für alles Forschen und Ergründen und somit ein wichtiger Motor für das Vorwärtskommen – für das Verstehen unserer Welt und der Entwicklung und der Zusammenhänge in der Natur. Die Rolle der Chemie und das Verständnis der chemischen Prozesse bei der Aufklärung über Herkunft und Entwicklung des Lebens und des Universums sind dabei von oft unterschätzter, aber dennoch grundlegender Bedeutung. Geistes-­‐ und Naturwissenschaften entwickeln dauernd zum Teil synergistische Methoden und Instrumente, um tiefer in die Grundlagen des Lebens eindringen zu können. Viele dieser mehrheitlich etablierten Methoden, wie heute z.B. auch Röntgen-­‐ und Laser-­‐basierte Methoden, sind experimentell. Mehr und mehr jedoch kommen jetzt theoretische Modellmethoden, zum Beispiel quantenmechanische Wellenfunktionen zur Berechnung der Energetik chemischer Reaktionen, dort zum Einsatz, wo experimentelle Möglichkeiten nicht oder noch nicht verfügbar sind. Durch komplexe, iterative Annäherung und durch resultierende Annahmen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten können sehr relevante Ergebnisse erzielt werden Als Beispiel dafür wurde in der Arbeit von M. Reiher die Umsetzung von Luftstickstoff zu einer Verbindung betrachtet, welche die Verfügbarkeit in der Form von Ammoniak als Dünger zur Bildung von Biomasse ermöglicht. Eine der Grundlagen für das Bestehen von Leben ist das Zusammenspiel von angepassten Angeboten der Biosphäre und der Sonnenenergie zur Produktion von Biomasse. Ein in vielen Fällen essentieller Prozess dazu ist die biologische Stickstoff-­‐Fixierung und daher als Voraussetzung die Bioverfügbarkeit von Stickstoff aus der Luft in Form von Ammoniak als Dünger. Diese Reaktion findet z.B. in sogenannten Knöllchenbakterien statt, welche symbiotisch mit gewissen Pflanzen (Leguminosen) an deren Wurzeln leben. Obwohl man weiss, dass dort eine entsprechende Umwandlung mittels des Enzyms Nitrogenase stattfindet, ist man weit von einer detaillierten experimentellen Abklärung des relevanten chemischen Systems entfernt. Industriell wird Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff mittels des Haber-­‐Bosch-­‐Prozesses bei Temperaturen von ca 450 °C und Drucken von 300 bar erzeugt. Es stellt sich nun die Frage, wie es das Enzym schafft, unter „milden Bedingungen“, wie Zimmertemperatur und Normaldruck, den Stickstoff chemisch zu binden und zu Ammoniak umzusetzen. Eine bestehende Erkenntnis ist das Vorhandensein des Biokatalysators Nitrogenase, welcher als aktives Zentrum einen Komplex, den sogenannten Eisen-­‐Molybdän-­‐Cofaktor, enthält Die genaue experimentelle Abklärung des Prozesses und seiner Phasen ist extrem schwierig, respektive momentan noch nicht möglich Hier bieten sich nun die erwähnten quantenmechanischen Berechnungen als Möglichkeit an, diverse getroffene Annahmen zu überprüfen, respektive zu erhärten. Der intellektuelle Reiz der theoretischen Chemie ist es, unabhängig von Experimenten, Eigenschaften und Verhalten von komplexen molekularen Prozessen aufgrund der quantenmechanischen Axiome zu errechnen und die relevanten Wahrscheinlichkeiten abzuklären. Leistungsfähige Computer und entsprechende komplexe Programme für quantenchemische Berechnungen sind dabei die Werkzeuge, welche es prinzipiell erlauben, derartige molekulare Prozesse im Detail und in möglichst guter Näherung vorherzusagen und somit helfen, grundlegende Prozesse des Lebens aufzuklären. Es ist von grosser Bedeutung, dass dabei die theoretische, wie die technische Chemie und weitere Wissenschaften interdisziplinär zusammenarbeiten müssen, um die angestrebten Erkenntnisse zu erlangen. Im Falle der Erforschung der Stickstofffixierung mussten dabei Strukturmodelle entwickelt und definiert werden, welche dank akzeptabler Einschränkungen die Möglichkeiten der Computerleistungen nicht überfordern. Das geschah, indem man sich auf die Betrachtung des erwähnten Übergangsmetall-­‐Clusters beschränkte. Die sich aus langjährigen Forschungen ergebenen Erkenntnisse zeigten auch die Grenzen und die bestehenden weiteren Möglichkeiten auf. Erst 2003 gelange es, ein vollumfängliches Modell für die Reduktion von molekularem Stickstoff zu schaffen (Nobelpreis für Richard Schock) und damit auch die Grundlage für die experimentelle Charakterisierung von Zwischenstufen zu schaffen. Es gelang also, mittels quantenmechanischer Methoden einen für das Leben wichtigen Prozess näher zu erkunden. Man hofft nun, weitere Mechanismen, wie z.B. die Erzeugung von Luftsauerstoff mittels eines Mangan-­‐Clusters durch Photosynthese so ergründen zu können. Da man momentan mehrheitlich kombinatorisch, basierend auf Tests von bereits bekannten Lösungen, arbeiten muss, wäre es erstrebenswert, mittels der theoretischen Chemie detaillierte Voraussagen und Erkenntnisse zur gezielten Lösung von allgemeinen chemischen Fragestellungen zu finden. 4.5 Aus: „Geschichten vom Ursprung des Lebens“ Richard Dawkins, 2009 Literaturbericht, wb Dawkins geht zurück zu den ersten ernstzunehmenden Theorien über den Ursprung des Lebens von A.I. Oparin (Russland) und J.B.S. Haldane (England) in den 1920er Jahren. Sie gingen, wie heute allgemein akzeptiert, davon aus, dass die Erde so wie andere Planeten ursprünglich eine „reduzierende“, also nicht eine mit Sauerstoff „oxidierende“ Atmosphäre hatte. Der freie Sauerstoff kam erst später dazu als giftiges Abfallprodukt der grünen Bakterien, die zunächst frei herumschwammen und später in die Pflanzenzellen aufgenommen wurden. Irgendwann entwickelte sich bei unseren Vorfahren die Fähigkeit, mit Sauerstoff zurechtzukommen und später wurden sie davon abhängig. Dass sich gasförmiger Sauerstoff, etwa aus CO2, und H2O in der Atmosphäre anreichern konnte, war aber nur möglich, weil die grünen Pflanzen beim Absterben nicht verbrannt oder zersetzt, sondern grösstenteils mit ihrem Kohlenstoff im Boden eingelagert wurden, woraus die Kohle-­‐ und Erdöllager entstanden. Wenn man diese heute verbrennt, muss man sich der Folgen bewusst sein. Bevor Leben entstand, lagen die Kohlenstoffatome grösstenteils in Form von gasförmigen Verbindungen wie Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre vor. Der Stickstoff, der heute 80% der Atmosphäre ausmacht, lag in der reduzierenden Atmosphäre an Wasserstoff gebunden als Ammoniak (HNO3 ) vor Haldane formulierte 20 Jahre vor den Experimenten von Miller und Urey folgendes Postulat: Wenn ultraviolettes Licht auf eine Mischung aus Wasser, Kohlendioxid und Ammoniak einwirkt, entsteht ein breites Spektrum organischer Substanzen, darunter Zucker und offenbar auch einige Materialien, aus denen Proteine aufgebaut sind. Heute würden sie von Mikroorganismen sofort zerstört. Aber vor der Entstehung des Lebens müssen sie sich angereichert haben. Oparin und Haldane erkannten offenbar als erste, dass infolge der reduzierenden Atmosphäre Pflanzen und Photosynthese nicht die ersten Lebensformen gewesen sein können, woraus dann die Ursuppentheorie entstand. Immerhin sahen sie in der Entstehung von Zellen den entscheidenden Schritt zu „Leben“ und massen deshalb dem Stoffwechsel die grösste Bedeutung zu. Dawkins meint aber, man hätte damals die Bedeutung der Replikation und Vererbung als Voraussetzung zu Leben unterschätzt. Er hat wie Christian Winiger v/o Protego eine grosse Sympathie zur Theorie der RNA-­‐Welt, welche am Anfang des Lebens gestanden sein könnte. Dies deshalb, weil RNA sowohl ein guter Replikator wie auch als „Ribozym“, ein gutes Enzym sei. DNA ist zwar ein noch besserer Replikator, aber kein Katalysator, Proteine wiederum sind gute Enzyme aber keine Replikatoren. RNA liegt nicht in der Doppelhelix vor wie DNA, sondern als Kette, was für Enzymfunktionen wichtig sei, weil sie sich so mit anderen Abschnitten ihrer selbst „paaren“ könne. Mit RNA wäre die Autokatalyse möglich, also die Selbstentstehung eines Zyklus aus Verdoppelung und Katalyse. Das Produkt einer ersten Replikation wäre ein Enzym, welches weitere Replikationen einleitet und wiederum Enzyme bildet, so dass es zu einer explosionsartigen Vermehrung von Gebilden kommt, die in Konkurrenz und Darwin’scher Selektion zu Vererbung fähig wären. Ein solcher autokatalytischer Zyklus wurde übrigens rein chemisch mit der Aminosäure Adenosin und Pentafluorophenylester in Chloroform nachgewiesen. Man weiss aber, dass diese Selbstverdoppelungsvorgänge durch Kopierfehler, also Mutationen, schon bald wieder zum Stillstand kommen. Schon bei kurzen RNA-­‐Ketten und DNA-­‐Abschnitten liegen die Replikations-­‐
Fehlerquoten pro Buchstaben so hoch, dass sie zerstört würden, bevor sie von ihrer Länge her ein funktionsfähiges Enzym bilden könnten. Als mögliche Lösung dieses Dilemmas erwähnt Dawkins die „Hyperzyklus Theorie“ des deutschen Chemikers Manfred Eigen. Man kann sich die zu replizierende Information zusammengesetzt vorstellen aus kleinen, kurzen Untereinheiten, die unterhalb der Schwelle von Fehlern liegen, die sich auswirken. Wenn jede Untereinheit nur in Gegenwart einer anderen katalysiert wird, ergebe sich ein stabilisierender Kreislauf von Abhängigkeiten. Der Evolutionsbiologe John Maynard Smith habe solche Hyperzyklusmodelle auch in Ökosystemen beschrieben, in denen die verschiedenen Tiere und Pflanzen in gegenseitiger Abhängigkeit spontan einen stabilen Kreislauf bilden. M. Eigen habe auch gezeigt, dass in einem Reagenzglas, welches lediglich Rohstoffe für RNA enthält, unter Beigabe eines viralen Replikationsenzyms (Replikase) spontan selbst-­‐replizierende RNA entstehen kann, welche zu adaptiven evolutiven Veränderungen fähig ist. Die Schwäche dieses Modells liegt natürlich darin, dass die Replikase vorausgesetzt wird, die man sich vor Beginn des Lebens eben noch nicht vorstellen kann. Dawkins erwähnt nur, dass die entsprechenden Forschungsarbeiten fortgesetzt würden. Des Weiteren geht er auch auf den „Ort“ ein, an dem Leben entstanden sein könnte. Es habe sich in der Wissenschaft ein Paradigmenwechsel ergeben, indem nicht mehr so sehr die Sonne als Energiespender der ersten Lebewesen angesehen wird, sondern die Hitze in den vulkanischen Tiefengesteinen am Meeresboden. Dafür sei vor allem der Astronom und Universalgelehrte Thomas Gold federführend gewesen. Aus tiefseeischen Vulkanschloten entweicht bei Temperaturen von 100° Schwefelwasserstoff, der von thermophilen Schwefelbakterien genutzt wird. Sie bilden die Grundlage für Nahrungsketten, zu deren Gliedern Röhrenwürmer, Napfschnecken Muscheln, Seesterne, Rankenfusskrebse, Krabben, Garnelen, Fische u.v.a. gehören. Gold habe gezeigt, dass die organischen Moleküle ihrer Zellwände weltweit zwischen 10 und 100 Billionen Tonnen des Gesteins ausmachen. Die Biomasse der Bakterien im heissen Tiefengestein könnte grösser sein als die des gesamten auf Sonneneinstrahlung beruhenden Lebens auf der Erdoberfläche. Gold glaube heute, dass das Leben tief unter der Erde entstanden sei und dass die Bakterien, die noch heute dort leben, die relativ unveränderten Relikte unserer entfernten Vorfahren seien. Die uns von der Erdoberfläche her bekannten Formen, die mit Licht, Kälte und Sauerstoff leben, wären somit erst später entstanden. 5.
Geologie, Fossilien 5.1 Ringvorlesung vom 1.10.09, UNI Zürich: Zeugen der Vergangenheit, missing links. Prof. Dr. Marcelo Sanchez, Zürich, Prof. Dr. Marcelo Sanchez, Argentinien Studium: Simon Bolivar Universität Venezuela Promotion in den USA Habilitation an der Universität Tübingen, BRD Seit 2006 Professor für Paläoanthropologie an der Universität Zürich Besondere Interessen: Evolutionsbiologie anhand von Fossilien, Radiation der Säugetiere und Reptilien Einige markante Feststellungen aus dem Vortrag seien den Notizen voran gestellt: -
99% aller Arten, die es ursprünglich gegeben hatte, sind bereits ausgestorben. -
Die geologische Überlieferung ist sehr unvollständig, aber mit Fossilien kann man die Transformationen besser verstehen. Die heutigen Fossilien zeigen mehr, als Darwin wissen konnte. Ein „missing link“ ist nicht ein fehlendes Glied einer Kette, an deren oberster Stelle der Mensch stehen würde, sondern ein in der Regel ausgestorbener Zweig eines Baumes und ein Experiment der Natur Organismen sind ein Mosaik von ursprünglichen und abgeleiteten Merkmalen Merkmale können leicht verloren gehen, sind aber nur schwer wieder zu gewinnen Sanchez ging von der Bemerkung Darwins aus, dass es viele Übergangsformen zwischen Arten und Unterarten geben müsse, welche in Fossilien führenden Gesteinsschichten zu finden sein müssten. Obwohl bis heute viele sehr wichtige Übergangsformen gefunden wurden, seien diese Überlieferungen aber immer noch sehr mangelhaft. Trotzdem sei die Beweislage eindeutig, dass die Arten sich nicht in einer Kette vom einfachsten bis zum kompliziertesten Lebewesen, etwa zum Menschen hinauf einander nachfolgend entwickelt hätten, sondern dass die Evolution einem riesigen Baum vergleichbar sei, welcher mit unendlich vielen Verzweigungen eine unübersehbare Vielfalt von Experimenten hervorgebracht habe, von denen die meisten gemäss Darwins Evolutionslehre ausgestorben seien. Ein eindrückliches Beispiel dafür liefert die Geschichte des Menschen selbst. Noch vor gut 2 Millionen Jahren gab es nach heutigem Wissensstand mindestens 5 Arten der Gattung Homo. Es ging Sanchez aber vor allem darum, zu zeigen, wie Fossilien zwar nicht fehlende Glieder einer Kette, aber wertvolle Belege für die graduelle, also langsame, schrittweise Evolution im Tierreich lieferten. Ein ausserordentlich wichtiges Individuum zwischen Vögeln und Reptilien wurde schon zu Darwins Zeiten 1861 mit dem Archaeopteryx lithographica gefunden. Zu diesem gesellten sich neustens weitere Funde aus China und belegen mit ihrer Mischung von Merkmalen die Theorie der Abstammung der Vögel aus zweibeinig laufenden Dinosauriern, den Therapoden. Auch die sehr speziellen Formen etwa der Pferde oder der Wale zeigten Ableitungen von Säugetieren, deren ursprüngliche, in einander übergehende Formen auf den ersten Blick nicht wieder zu erkennen, in Fossilien aber archiviert worden seien. Schon Darwins Kollege Thomas Huxley postulierte die Existenz eines Urpferdes, welches klein und gestreift gewesen sei und ein typisches Säugetiergebiss mit Schneidezähnen, Eckzähnen, Prämolaren und Molaren aufgewiesen habe. Heute liegen zahlreiche Fossilienfunde aus etwa 55 Millionen Jahren vor, welche sowohl die Grössenzunahme, das Verschwinden der Streifen und die Molarisierung des Gebisses im Sinne der Herbivoren graduell belegen. Ebenso belegt ist die Transmutation der Wale vor etwa 50 Millionen Jahren aus den Paarhufern. Sie besitzen keine hinteren Extremitäten mehr, die Hände sind zu Flossen geworden, das Gebiss ist homodont und besteht aus lauter gleichartigen Zähnen und die 7 Halswirbel sind zusammen verschmolzen. Da Paarhufer sehr schnell laufen können, haben ihre Füsse eine sagittale Bewegungsfreiheit. Diese konnte für die Flossenbewegung der Wale genutzt werden. Kollegen von Prof. Sanchez hatten ein Fossil eines Urwals gefunden mit hinteren Extremitäten und mit einem Foetus in situ, welcher mit dem Kopf voraus im Uterus lag. Da bei maritimen Säugetieren die Geburt zum Zweck der Atmungsmöglichkeit mit dem Schwanz voraus erfolgt, schliesst Sanchez, dass bei diesem Urwal mindestens die Geburt noch an Land geschah. Die entsprechenden Fossilienfunde stammen aus Wüsten in Indien und Pakistan und wurden in den letzten 20 Jahren unter sehr widrigen Bedingungen von Paläontologen ausgegraben. Säugetiere gab es natürlich nicht erst seit dem Aussterben der Saurier vor 65 Millionen Jahren, sondern schon seit ihrem langsamen Übergang vor 320 Millionen Jahren aus den Reptilien. Belege lieferten wiederum Fossilien, aber auch die heute noch lebende Schwestergruppe der Kloakentiere, der Monotremata. Die graduelle Evolution lässt sich sehr gut anhand des Kiefergelenkes zeigen. Bei Säugetieren besteht der Unterkiefer aus einem einzigen Knochen, während es bei Reptilien aus 3 weiteren Teilen besteht. Aus diesen drei Knochen entstanden bei den Säugetieren die Mittelohrknochen Hammer, Ambos und Steigbügel zur Weiterleitung des Schalls ins Innenohr. Es müsste nach der Theorie nun Übergangsformen gegeben haben, welche beide Kiefergelenke hatten, und diese wurden als Fossilien tatsächlich gefunden. Die heute noch lebenden Kloakentiere haben bereits das Kiefergelenk der Säugetiere, legen aber Eier und ernähren die Jungen mit Milch, sie haben ein Fell und das Schnabeltier z.B. hat einen hoch entwickelten elektrischen 3-­‐D-­‐Sensorapparat in seinem Schnabel zum Aufspüren von Beute. So wie bei Vögeln und Reptilien münden aber Darm, Harnweg und Fortpflanzungsorgane in eine gemeinsame Öffnung, die Kloake. Auch den Interclavicularknochen findet man bei ihnen wie bei Reptilien, hingegen nicht bei den Säugetieren. Das fossile Schnabeltier Obdurodon hatte in seinem Schnabel noch Zähne, die bei den heutigen verschwunden sind. Als Beispiel einer punktuellen Evolution erwähnte Sanchez die sprunghafte Evolution des Flugapparates bei Fledermäusen aus vier Fingern der vorderen Extremitäten. Es sind Proteine bekannt, die eine Vermehrung von Knorpel bewirken können, falls das entsprechende Gen eingeschaltet wird. Eine Besonderheit stellt der Panzer der Schildkröten dar, welcher durch Verschmelzen von Rippen entstand, wobei das Schulterblatt darunter zu liegen kam. Tetrapoden, also Vierfüsser, hatten sich ursprünglich mit je fünf Fingern entwickelt. Die meisten hatten aber einige davon verloren. 5.2 Massenaussterben und Evolution Broschüre zur Ausstellung des Paläontologischen und Zoologischen Museums der Universität Zürich, 2009. Hugo Bucher, Heinz Furrer, Michael Hautmann, Christian Klug, Marcelo R. Sanchez-­‐Villagra [11] Literaturbericht, wb 5.2.1 Das Aussterben von Arten Prof. Dr. Hugo Bucher, Direktor des Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Zürich betont, dass das Aussterben von Arten ein normales Phänomen ist. Er schätzt die heute vorhandene Vielfalt mehrzelliger Arten auf 1-­‐2 % der in den letzten 600 Millionen Jahren entstandenen Arten. Die relativ gleichmässige Veränderung der Arten wurde immer wieder von schwerwiegenden biotischen Krisen unterbrochen. Dazu zählt man sieben grosse Massenaussterbe-­‐Ereignisse, auf denen die grossen Einheiten der internationalen geologischen Zeitskala basieren. Faktoren der Aussterberate sind Körpergrösse, Fortpflanzungs-­‐ und Ernährungsstrategien, Metabolismusrate, und die Grösse des Verbreitungsgebietes. Die letzere gewinnt an Bedeutung, wenn die Aussterbeintensität zunimmt. Allerdings hat die Grösse der Aussterbeereignisse im Lauf der Erd-­‐ und Lebensgeschichte, also im Phanerozoikum, abgenommen. Die grössten Aussterberaten traten im Paläozoikum, im Erdaltertum, auf. Ab der Trias, insbesondere vom Jura bis ins Neogen nahm die Aussterbe-­‐Intensität linear ab. Die Ursache dazu sieht Bucher eindeutig in der evolutionären Zunahme der Biodiversität. Dazu gehörten die Diversifikation der Landpflanzen im späten Paläozoikum, welche eine Reorganisation des globalen Kohlenstoffzyklus zur Folge hatte. In der späten Trias erfolgte zudem die Diversifikation des modernen Phytoplanktons. Diese beiden Vorgänge bewirkten wiederum eine Diversifikation der marinen Wirbellosen und schufen komplexe Nährstoffketten mit entsprechendem Nährstoffvorrat. Eine ebenso grosse Rolle spielte offenbar die Zirkulation im Meerwasser, welche im frühen Erdaltertum nachweislich schwächer war. Stabile Wasserschichten bewirkten eine Nährstoffanreicherung in der Tiefe sauerstofffreier Schichten, wodurch Lebewesen an der Oberfläche und in den Schelfmeeren verhungerten. Im Jura zerfiel der grosse Superkontinent Pangäa, wodurch grössere Meeresströmungen entstanden. Die grossen Massenaussterbe-­‐Ereignisse werden mit besonderen globalen Ursachen verknüpft, die der Autor zur Diskussion stellt: Der Asteroideneinschlag am Ende der späten Kreide im Golf von Mexiko ist erwiesen und seine Auswirkungen werden mit einem nuklearen Winter verglichen. Er ereignete sich aber erst am Ende des Massenaussterbens und scheint eher eine Art „Gnadenstoss“ gewesen zu sein als eine primäre Ursache. Hingegen gab es verschiedene Asteroideneinschläge, die Krater von über 50 km Durchmesser hinterlassen hatten, die aber in keinem zeitlichen Zusammenhang mit Massenaussterben lagen. Meeresspiegelschwankungen hatten oft aber nicht immer eine Verbindung zu Massenaussterbe-­‐
Ereignissen. Senkung des Wasserspeigels verringerte den Lebensraum vieler bodenlebender mariner Organismen und reduzierte die Meeresströmungen. Auf den trockengelegten Kontinentalschelfen oxidierte viel organisches Material, was in der Freisetzung von CO2 und damit von Klimaveränderungen resultierte. Das Abschmelzen und Vereisen der Polkappen scheint hingegen eher mit kurzfristigen Schwankungen des Meeresspiegels koordiniert zu sein. Flutbasalte können heute am deutlichsten mit den zeitlichen Abfolgen von Massenaussterben in Zusammenhang gebracht werden. Es handelt sich dabei um gigantische, katastrophale Magmaergüsse, die aus dem Grenzbereich von Erdkern und Erdmantel stammen und innert ca. 20 Millionen Jahren an die Erdoberfläche gelangten. Sie bedecken eine Fläche etwa von der Grösse Frankreichs und finden sich heute z.B. in Sibirien, in Indien und als Ozeanische Plateaus wie im Pazifik bei Ontong-­‐Java. Während der 20 Millionen Jahre von der ersten grossen Magmablase bis zur Endspitze des Ergusses hatte sich jeweils die Lithosphäre um grosse Distanzen verschoben, so dass Reihen jüngerer Vulkane und Basaltergüsse in räumlicher Nähe der Flutbasalte zu finden sind. Gut untersucht ist etwa der Flutbasalterguss im indischen Subkontinent mit den weiter südlich auf einer Linie gelegenen Koralleninseln der Lakkadiven, Malediven und Chagos. Der immer noch aktive Schwanz der Magmablase bildet die Vulkaninsel La Réunion. Diese Ergüsse waren mit grossen klimatischen und ozeanischen Störungen verbunden und mit einer massiven Abgabe von Kohlen-­‐ und Schwefeldioxyd in die Atmosphäre. Da S02 sehr schnell mit Wasser Schwefelsäure bildet, resultieren daraus eine kurzzeitige klimatische Abkühlung, eine Schädigung der Ozonschicht und saurer Regen. Anstieg von CO2 führt zu globaler Erwärmung, Drosselung ozeanischer Zirkulation und damit zu geschichteten, sauerstoffarmen Wässern, und zu Versauerung der Oberflächenwasser. Durch die Schädigung des Phytoplanktons kann die Nahrungskette zusammenfallen und katastrophale Folgen für viele Ökosysteme haben. Prof. Bucher weist darauf hin, dass Aussterbe-­‐Ereignisse immer eine katalytische Funktion auf die Evolution und die anschliessende Diversifizierung vorher unbekannter Arten hatten. Er erwähnt als bekannte Beispiele die Ablösung der Brachiopoden durch die Muscheln nach dem Perm und diejenige der Dinosaurier durch die Säugetiere am Ende der Kreide. Es findet nach dem chemischen und physikalischen Stress des Ereignisses nicht einfach eine Erholung der vorher vorherrschenden Arten statt, sondern es erscheinen Opportunisten, denen mit der Zeit spezifischer angepasste Lebewesen folgen, die wiederum erfolgreich sein können oder auch nicht. Diese Prozesse fanden aber nie simultan auf der ganzen Erdoberfläche statt. Sie waren meist mit Grössenreduktion und Verkürzung der Generationsdauer verbunden und führten oft zu neuen, morphologisch vereinfachten Organismen, die aber wiederum die Basis für die nachfolgende Radiation bildeten. Der Autor betont aber, dass die Komplexität der geografisch unterschiedlichen Auswirkungen noch schlecht verstanden sei. 5.2.2 Aussterbe-­‐Ereignisse im Kambrium und Ordovizium [11] PD Dr. Christian Klug, Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich beschreibt die wichtigsten frühen Aussterbe-­‐Ereignisse im Kambrium und im Ordovizium. Er weist darauf hin, dass der Informationsgehalt der Gesteine mit zunehmendem Alter abnimmt, da diese wahrscheinlich verändert oder zerstört worden seien. Zudem bezieht er sich auf mehrzellige Organismen, da eigentlich nur bei Ihnen Massenaussterben zu beobachten sei. Er beschreibt anfangs die Fauna im Präkambrium, also vor 580–542 Millionen Jahren, die aus Ein-­‐ und Vielzellern bestand. Diese Fossilien wurden 1946 in Australien, in den Ediacara hills entdeckt. Es handelte sich um Seefedern ähnliche Organismen, welche auf Matten von Mikroben lebten und deshalb auch als „Gärten von Ediacara“ bezeichnet werden. Sie weisen zum Teil Ähnlichkeiten zu heutigen Tiergruppen auf und hatten aktive Bewegungsmöglichkeiten. Das Verschwinden dieser Fauna wird mit dem Auftauchen von skeletttragenden Organismen im frühen Kambrium diskutiert, mit ihrer zunehmenden Beweglichkeit und räuberischer Lebensweise. Die Mikrobenmatten und Sedimente seien regelrecht umgepflügt worden. Berner Geologen hatten aber auch 2008 entdeckt, dass am Ende des Präkambriums die Meere weitgehend umgeschichtet worden waren, dass Schwefelwasserstoffreiche Wasserschichten in flachere Meerwasserbereiche gelangt waren und somit die meisten Organismen „vergiftet“ hatten. Mit dem Beginn des Kambriums nahmen aber die skeletttragenden Organismen massiv zu, was auch als „kambrische Explosion“ bezeichnet wird. Fossillagerstätten in Kanada (Burgess Pass) und China (Chengjiang) zeigten schon vor gut 100 Jahren die Existenz verschiedenster Tiere mit und ohne Hartteile im Kambrium. Es waren Gliedertiere, wurmartige Tiere, Schwämme, Armfüsser und sogar frühe Chordaten. Neu war auch, dass sich diese Tiere nicht nur in den Sedimenten, sondern in einer Art Stockwerkbau in der Wassersäule darüber einfanden. Zuunterst über dem Meeresboden lebten Wirbellose wie Armfüsser, Trilobiten und Hyolithen, in höheren Wasserschichten fanden sich Schwämme und Seelilien, sowie kleine Vielzeller. Die Faunen des Kambriums wurden aber von vier grossen Aussterbe-­‐ Ereignissen heimgesucht, denen viele Trilobiten, Armfüsser und Conodonten zum Opfer fielen. Ihre Ursachen sieht man einerseits in einer kontinentalen Abkühlung und Vereisung, anderseits im Rückgang des Meeresspiegels, womit kalte und sauerstoffarme Wasserschichten in den Bereich der Schelfe gelangten. Die Überlebenden Arten profitierten von diesen Ereignissen und begannen das Ordovizium mit einer explosiven Zunahme ihrer Diversität. Es sei die explosivste Radiation aller Zeiten gewesen, schreibt der Autor. Die rasante Zunahme der Vielfalt der Organismen betraf vor allem Korallen, Graptolithen, Moostierchen, Seelilien, Schnecken, Muscheln und Kopffüsser. Parallel dazu erhöhte sich auch die Diversität des Phytoplanktons, woraus komplexe Nahrungsbeziehungen im marinen Bereich und eine stabile Nahrungsgrundlage mit Primärproduzenten entstanden. Aus dem späten Ordivizium wurden sogar Sporen von ersten winzigen Landpflanzen gefunden. Am Ende des Ordiviziums starben etwa 400 Gattungen dieser marinen Fauna aus, v.a. die Conodonten, Armfüsser, Trilobiten, Moostierchen und Graptolithen. Auch das Riffwachstum wurde massiv geschädigt. Als Ursache dieses Massenaussterbens vermutet man die Vereisung des Superkontinents Gondwana, welcher in die Nähe des Südpols gewandert war und eine riesige polare Eiskappe bildete. Eine Senkung des Meeresspiegels war damit ebenfalls wieder verbunden. Im Silur wiederholte sich dasselbe Szenario von Radiation und Aussterben durch Vereisungsphasen. Die Zeit des Devon überschreibt Dr. Klug mit „Sterben auf Raten“, da sie von mehreren kleineren und mittleren Aussterbe-­‐Ereignissen geprägt war, die jedoch zusammen ein grosses Massenaussterben bildeten und damit auch wieder zahlreiche neue Lebewesen evoluieren liessen. So erreichten die kiefertragenden Fische erstmals eine grosse Vielfalt und die bereits im Ordovizium begonnene Besiedelung des Landes führte im Devon zu grossen Wäldern. Die Tetrapoden, Wirbeltiere mit vier Extremitäten, erschienen als neuer evolutionärer Höhepunkt. Die kieferlosen Fische, die am Meeresboden lebten, starben aus, während dem die kiefertragenden Fische nun als Räuber alle Wasserschichten im offenen Meer eroberten. Das Devon gilt deshalb auch als Zeitalter der Fische. Panzerfische von 5 m Länge waren die grössten Raubtiere ihrer Zeit. Aber auch Knochen-­‐ und Knorpelfische (Haie) nahmen im Laufe der diversen Aussterbeereignisse zu. Das Plankton setzte sich aus pflanzlichem und tierischem zusammen, wobei letzteres gesteinsbildend war und für die relative Altersbestimmung geeignet ist. Neben den bereits genannten möglichen Ursachen von Massenaussterbe-­‐Ereignissen muss für das Devon bedacht werden, dass sich die Lage der Kontinente und der Meere massiv veränderte. Euramerika näherte sich Gondwana, welcher gleichzeitig zum Südpol hin wanderte. Dies bewirkte sowohl drastische Änderungen der Strömungsverhältnisse und eine massive Abkühlung durch die Vereisung Gondwanas. Eine weitere Abkühlung müsste erfolgt sein durch die Entstehung der Wälder, welche der Atmosphäre gut 80% ihres CO2-­‐Gehaltes entzogen hatten. Zwischen den Phasen der Abkühlung sei es im Devon aber ausgeglichen warm gewesen mit einem schmalen tropischen und einem breiten subtropischen Gürtel. Die sich an Land ausbreitende Vegetation bewirkte eine Eutrophierung der Meere durch Verfrachtung organischer pflanzlicher Substanzen und Wachstum von Algen und Phytoplankton. Diese sanken ab und wurden von Bakterien unter Sauerstoffverbrauch abgebaut, wodurch der O2-­‐Gehalt in tiefen Wasserschichten abnahm. Im nachfolgenden Karbon erreichten vor allem die Knorpelfische eine hohe Diversität durch Radiation. Aber das Karbon ist eher bekannt als Zeit der Kohle, also des üppigen Gedeihens des pflanzlichen Lebens an Land. Dieses bot wiederum die Nahrungsgrundlage für Landtiere wie Insekten, Gliedertiere, frühe Amphibien und Reptilien. Sie alle profitierten also von den vorangegangenen spätdevonischen Krisen. 5.2.3 Das grösste Massenaussterben der Erdgeschichte [11] Dr. Michael Hautmann, Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich Der Autor weist darauf hin, dass an der Grenze zwischen Erdaltertum und Erdmittelalter, und zwischen Perm und Trias, vor 250 Millionen Jahren das mit Abstand gravierendste Massenaussterben stattfand, welches den Untergang von 95% aller Arten in den Weltmeeren und massive Auswirkungen auf die Landlebewesen, sowie einen fundamentalen Wechsel in der Struktur der Biosphäre zur Folge hatte. Das Ergebnis war die Beschaffenheit der heutigen Lebenswelt. Das Massenaussterben fand in mehreren Phasen zwischen 299 und 200 Millionen Jahren vor heute statt und betraf vor allem Gruppen von Gattungen, deren Diversität schon vorher im Rückgang gewesen war. Der Autor nennt im marinen Bereich etwa die einzelligen Radiolarien des Phytoplanktons, die ebenfalls einzelligen Foraminiferen mit kalzitischem Gehäuse, die Korallen Rugosa und Tabulata sowie die Brachiopoden, zweiklappige muschelähnliche Tiere am Meeresgrund und deren Verwandte, die Moostierchen. Als weitere Opfer erwähnt er Stachelhäuter, Seelilien und alle Trilobiten. Weniger stark betroffen waren Weichtiere, Muscheln und Schnecken, Ammonoideen, Fische und Conodonten. An Land kam es ebenfalls zum Aussterben von gut 75% der Wirbeltiere und damit zu einer ökologischen Verarmung von Fauna und Flora. Die Fossilberichte sind aber wesentlich lückenhafter als diejenigen aus dem marinen Bereich. Infolge der Ansammlung von grossen Mengen von totem organischem Material kam es aber zu einem Massenvorkommen von Pilzen. Die heutigen Erklärungsmodelle für das Massenaussterben basieren auf den Faktoren Lebensraumverlust im Meer, Temperaturanstieg und Zunahme von CO2 in der Atmosphäre, Flutbasalte und Vulkanismus. Die Kontinentalpatten hatten sich zum Grosskontinent Pangäa zusammengefunden, womit die Lebenswelt einheitlicher und artenärmer, die Küstenlinien kürzer und die Schelfmeere kleiner wurden. Im späten Perm kam es zu Temperaturanstieg, auf Pangäa zur Bildung von trockenen Wüsten und zu eindampfenden Meeresbecken und grossen Salzlagern. Aus der reichen Vegetation bildete sich Kohle. Frisches Silikatgestein, bei dessen Verwitterung der Atmosphäre CO2 entzogen wird, entstand seltener. Dazu kam dann der Flutbasaltvulkanismus in Sibirien, womit 1,5 Millionen Quadratkilometer Lava mit einer Höhe von 3 km gefördert wurde. Das darin gelöste CO2 wurde in die Atmosphäre freigesetzt und förderte den Treibhauseffekt. Dazu könnten auch die in den Meeren gelagerten und ebenfalls freigesetzten Methanhydrate beigetragen haben. Die Versauerung der Meere und die stark reduzierte Kalksättigung könnten die hohen Verluste bei marinen Tieren mit kalkigen Skeletten erklären. In der frühen Trias herrschten schliesslich die höchste Temperatur und die geringste Artenvielfalt des gesamten Phanerozoikums. Es dauerte 100 Millionen Jahre, bis die Biodiversität von vor der Katastrophe wieder erreicht war. Die heute in den Weltmeeren vorherrschenden Tiere nahmen die Plätze ihrer Vorgänger ein. Einige Baupläne, wie diejenigen der Korallen wurden sogar neu erfunden. Auch an Land erhielten Lebewesen mit schneller Evolutionsrate wie die späteren Dinosaurier und Säugetiere entscheidende Vorteile. Allgemein wurde der Artenreichtum erneuert, die morphologische Vielfalt von vorher sei nicht mehr erreicht worden. Die Evolutionsforschung ist sich noch nicht im Klaren, ob das endpermische Massenaussterben alle diese Wechsel verursacht, oder nur beschleunigt hat. Auch die interessante Frage, welche Lebewesen ohne diese Katastrophe heute existieren würden, kann vorläufig nicht beantwortet werden. 5.2.4
Das Aussterben der Dinosaurier [11] Dr. Heinz Furrer, Kurator am Paläontologischen Institut und Museum der Universität Zürich Dieses Aussterbe-­‐Ereignis findet seit gut 150 Jahren in der Öffentlichkeit am meisten Interesse. Nach den Angaben von Dr. Furrer sind vor 65 Millionen Jahren am Übergang von der Kreide zum Paläogen 47% aller marinen wirbellosen Tiere, speziell die Familie der Ammoniten, welche Gehäuse bis zu 1,8 m Durchmesser entwickelt hatten, viele Muscheln, aber auch die marinen Reptilien wie Fisch-­‐ und Mosasaurier ausgestorben. An Land überlebten die Schildkröten, Schlangen und Krokodile. Auch die Vögel, die sich schon im späten Jura aus nicht fliegenden, grazilen Theropoden entwickelt hatten, überlebten, ebenso die kleinwüchsigen Säugetiere. Die Blütenpflanzen mit ihrem grossen Formenreichtum hatten keine Einbussen. In der späten Kreide begann das Aussterben der Dinosaurier zuerst mit der Gruppe der Stegosaurier und am Ende der Kreide waren alle verschwunden. In der Kreide zerbrach der Superkontinent Pangäa. Der Atlantik war bereits geöffnet und der indische Subkontinent driftete im Pazifik von Afrika nach Nordosten. Es herrschte ein warmes Treibhausklima, die Polkappen waren geschmolzen und der Meeresspiegel lag 300 m höher als heute. Es wurde offenbar viel organisches Material produziert, aber nur unvollständig abgebaut (Erdöl-­‐Gestein), und der Nährstoffeintrag in die Ozeane war erheblich. Am Ende der Kreide war dann wieder eine markante Abkühlung und ein Abfall des Meeresspiegels zu verzeichnen Zum Aussterben der Dinosaurier wurden bisher gut 100 Theorien publiziert, welche biologische, genetische, klimatische, parasitische oder ernährungsphysiologische Ursachen anführten. 1980 wurde in Italien in einer Tonschicht an der Kreide/Paläogen-­‐Grenze eine Anreicherung des seltenen Metalls Iridium gefunden, welches charakteristisch ist für Kometen. Die Iridium-­‐Anomalie wurde in der Folge in vielen anderen Grenzprofilen der ganzen Erde nachgewiesen. Daneben fand man kleine Kügelchen aufgeschmolzenen Gesteins, die nur unter dem grossen Druck eines Asteroiden-­‐Einschlags entstanden sein konnten. Schliesslich wurde in 800 m Tiefe unter der Bucht von Mexiko der Krater Chicxulub mit 180 km Durchmesser gefunden, der vom Einschlag eines extrem grossen Asteroiden am Ende der Kreide stammen musste. Der in die höhere Atmosphäre geschleuderte Staub-­‐ und Wasserdampf bewirkte eine Monatelange Verdunkelung und Abkühlung, wodurch direkt oder durch Nahrungsmangel viele Tiere und Pflanzen getötet wurden. Diese Theorie wird aber kontrovers diskutiert, da andere Asteroideneinschläge nicht in zeitlichem Zusammenhang mit Massensterbe-­‐Ereignissen stehen, und auch der Chicxulub Krater gute 300 000 Jahre vor dem Ende der Kreide entstand. Der Autor weist deshalb auf die 800 000 Jahre dauernde Beeinträchtigung des Klimas am Ende der Kreide hin, welche durch die Flutbasalteruptionen in Indien verursacht wurden. Die vulkanischen Gesteine bedeckten schliesslich hunderte von Quadratkilometern mit einer 3500 m dicken Schicht, welche Schwefeldioxid und Kohlendioxid freisetzte, und sauren Regen, Temperaturschwankungen und Versauerung der Meere verursachten. Der dramatische Einschlag des Asteroiden dürfte dann die geschwächten Lebewesen noch zusätzlich getroffen haben. Die seit der späten Trias bekannten Säugetiere mit geringer Körpergrösse wurden von diesen Ereignissen wenig getroffen, Beuteltiere allerdings stärker als Plazentarier. Erst 10 Millionen Jahre nach der Kreide/Paläogen-­‐Grenze ist eine moderne Säugerfauna nachweisbar, die aus Amerika und Afrika zu stammen scheint. Es zeigten sich Nagetiere, Primaten, Paarhufer, Unpaarhufer und Fledertiere. Einige passten sich in kurzer Zeit an ein Leben im Wasser an, so wie die Wale, die im Paläogen die von den Fischsauriern freien Meere eroberten. Die Knorpel-­‐ und Knochenfische aus dem Paläozoikum wurden vom Massensterben nicht betroffen und erreichten eine grosse Artenvielfalt im Meer-­‐ und Süsswasser. Auch Kalkalgen, Foraminiferen und Riffkorallen sowie Tintenfische erholten sich nach ca. 10 Millionen Jahren wieder. Die Frage, nach welchen Kriterien das Massenaussterbe-­‐Ereignis die Tier-­‐ und Pflanzenarten unterschiedlich getroffen hat, ist immer noch Gegenstand weiterer Forschung. 5.2.5 Aussterben im Paläogen und im Neogen [11] Prof. Dr. Marcelo Sanchez-­‐Villagra, Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich Seit dem Massenaussterben vor 65 Millionen Jahren hat es keine solche globale biotische Krise mehr gegeben. Trotzdem wird die Evolution des Lebens geprägt durch Aussterben und Neuentstehung von Arten. Dies gilt auch für uns Menschen. Selbst vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass es vor 2 Millionen Jahren noch 2 Gattungen von Hominiden mit 5 Arten gegeben haben muss. Wir sind also die letzten Überlebenden dieser Linie. Im Paläogen gab es grosse Temperaturschwankungen, wobei vor 35 Millionen Jahren eine starke Abkühlung zum Aussterben zahlreicher Säugetiere und mariner Wirbelloser geführt hatte. Danach nahm die Anzahl der Arten und Gattungen wieder enorm zu. Vor 14 Millionen Jahren wiederholte sie dieses Szenario noch einmal. Im späten Neogen verschwanden nur noch einzelne Arten aufgrund regionaler Umweltveränderungen. Die Skeletterste dieser Tiere sind in noch weichen Sedimenten einigermassen gut erhalten. Vor 8 Millionen Jahren lebten im tropischen Küstenregionen Venezuelas riesemhafte Wirbeltiere, die aber durch lokale und globale Klimaänderungen wieder ausgestorben sind und keine Nachfahren hinterlassen haben. In den letzten 2 Millionen Jahren stellen die Landorganismen gegenüber den im Wasser lebenden Arten über 90% der beschriebenen Arten dar. Das Aussterben von Arten wurde vor allem verursacht durch die raschen Klimawechsel der Eiszeiten. Die Kaltzeiten von 100 000 Jahren wurden abgelöst von kurzen Warmzeiten von 20 000 Jahren mit zum Teil höheren Temperaturen als heute. Besonders grosse Säugetiere waren stärker gefährdet als die kleinen und starben nach der letzten Eiszeit in grösserer Zahl aus. Dazu gehören etwa das Mammut, das Riesenfaultier, Wollhaarmammute, Waldelefanten, Nashörner, Bisons, Riesenhirsche, Flusspferde, Riesenvögel und Riesenbeuteltiere. Eine Einwirkung des Menschen wird aber erst in den letzten 500 Jahren für das Aussterben von anderen Tieren verantwortlich gemacht. Besonders auf Inseln starben dadurch die Mosas Neuseelands, die Dodos von Mauritius und Réunion, Elefantenvögel und Koalalemuren Madagaskars sowie zahlreiche Vogelarten auf Hawaii. Neben der Jagd war offenbar das einbringen fremder Arten ein entscheidender Grund für lokalen Verlust an Biodiversität. Der Autor betont, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die menschliche Zivilisation der letzten 10 000 Jahre, durch den Ackerbau und später die industrielle Revolution ein neues Massenaussterbe-­‐Ereignis mit steigender Intensität eingeleitet wurde. Die rasch wachsende menschliche Population bewirkt, dass jährlich etwa 12 000 Arten aussterben. Diese moderne Krise erfordert wissenschaftliche Anstrengungen an vielen Fronten. Der Druck auf die Biodiversität erfolgt vor allem über Umweltverschmutzung, Einführung standortfremder Arten, Übernutzung und Zerstörung der Lebensräume und Abholzung der tropischen Regenwälder, welche gut die Hälfte aller Arten enthalten. Dazu kommt die bereits erfolgte und zunehmende Klimaerwärmung mit der steigenden Gefahr grossflächiger Dürre, Waldbrände, Hitzewellen, tropischer Stürme und ökologischer Konsequenzen in Form von Verschiebungen der Ausbreitungsgebiete der Faunen und Flora. 5.3 MUTTER, R. J., RICHTER, M., TOLEDO, C.E., In pursuit of causes fort he greatest mass extinction: the Permo-­‐Triassic Boundary in the Southern Hemisphere. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2007) 152(3): 71-­‐78 Dr. Raoul J. Mutter, Dr. Martha Richter, Dr. Carlos E. Toledo, London, 2007 Literaturbericht, wb Wenn Darwin die geologischen Archive, also die Fossilien, als äusserst lückenhaft bezeichnet, so darf man sagen, dass seit ihm, gerade aufgrund seiner Evolutionslehre, die Suche nach Fossilien massiv und erfolgreich intensiviert wurde. Die zahlreichen Funde und die immer raffinierteren Untersuchungsmethoden bestätigten Darwins Theorie glänzend und führten zu immensen neuen Erkenntnissen und zu vielen neuen Wissenschaftszweigen. Die NGZ hat auch dazu immer wieder einzelne Arbeiten publiziert, welche als Beispiele für die Bedeutung der Fossile und der Geologie für die Evolutionstheorie dienen mögen. Die Autoren dieser Arbeit sind auf der Suche nach Ursachen für das grösste Massenaussterbe-­‐Ereignis der Erdgeschichte an der Perm-­‐Trias-­‐Grenze der Südhemisphäre. Sie sprechen vom „Fischen nach Fossilien“ in 260 Millionen Jahre alten Sedimentgesteinen eines ehemaligen epikontinentalen Meeres in Südbrasilien. Dies ist deshalb interessant, weil für die Erklärung dieses Ereignisses bisher nur die Fossilienbelege der Nordhemisphäre herangezogen worden sind. Einleitend wird darauf verwiesen, dass vor 260 Millionen Jahren die Landmasse der Kontinente im Super-­‐
Kontinent Pangaea vereinigt waren, welche aus der Nordhemisphäre Laurasia und der Südhemisphäre Gondwana bestand. Es gab zwei grosse Meere, Thetys, welches von Pangaea bzw. Laurasia umgeben war, und Panthalassa, ein riesiger Ozean, welcher Pangaea umfloss. Ausserordentliche fossile Funde haben ergeben, dass damals in einem Zeitraum von wenigen zehntausend Jahren etwa 70 – 95% aller Arten in den Meeren, im Süsswasser und an Land verschwanden. Fünf einzelne Massenaussterbeereignisse hatte es zwar schon zuvor im Lauf des Phanerozoicums zwischen 550 und 260 Millionen Jahren vor heute gegeben. Dasjenige am Ende des Perms war aber das massivste und übertraf auch bei weitem das Massensterben der Saurier vor 65 Millionen Jahren. Über seine Ursachen und Auswirkungen, die Dauer und die geographische Ausdehnung sind sich die Wissenschaftler offenbar noch wenig einig. Als mögliche Ursachen der Massensterben in der geologischen Vergangenheit nennen die Autoren Intensiven Vulkanismus, plötzliche und globale Meeresspiegel Senkungen, umfangreiche Methan Ausstösse an den Rändern der Kontinente, Sauerstoffmangel in den Ozeanen und Einschläge von Asteroiden und Meteoriten. Es kann auch Kombinationen und Abfolgen mehrerer dieser Ereignisse gegeben haben. Aus dem fraglichen Zeitraum der Perm-­‐Trias-­‐Grenze ist nur der etwa 40 km grosse Landkrater „Araguainha Dome“ in Zentral-­‐West-­‐Brasilien bekannt. Zwei Einschlagsstrukturen wurden kürzlich an der Westküste von Australien gefunden, jedoch könne ihr Alter nur ungefähr in die Zeit der Perm-­‐Trias-­‐Grenze eingeordnet werden. Die Autoren beschreiben die damalige Südhemisphäre Gondwana als flach, mit grossen, aber kaum tiefen Seen und Binnenmeeren durchsetzt, und das Klima soll sehr trocken gewesen sein. Häufige starke Stürme sollen die Knochen toter Tiere in den seichten Gewässern durcheinander gepflügt haben, sodass kaum komplett erhaltene Fossilien von Wirbeltieren gefunden würden. Da in Seen meist endemische Arten leben, ist zudem ein direkter Vergleich mit Fossilien der Nordhemisphäre offenbar kaum möglich. Die Knochen, Zähne und Schupppen der toten Fische sowie Überreste anderer Organismen wurden in den weiteren geologischen Zeiträumen in Sandstein sedimentiert und können heute in fossilführenden Schichten Brasiliens gefunden werden. Dank dem taxonomischen Rahmen geben diese Fossilien gute Informationen über die Änderungen der Diversität und der Paläoumgebung. Besonders der Zahnschmelz und die Schuppen geben etwa Auskunft über den Salzgehalt und die Temperatur des damaligen Meerwassers. Da Fische sehr sensibel auf Änderungen in ihrer Umgebung reagieren, sind ihre Fossilien zusammen mit den Daten der Landlebewesen gute Indikatoren für schnelle Wechsel in der Umwelt. Pangäa vor 260 Millionen Jahren. Die Umrisse der späteren Kontinente
sind eingezeichnet. Aus Tethys ging das heutige Mittelmeer hervor [30]
Die Autoren erwähnen solche Überreste altertümlicher Haifische, Acanthodier und Chimärenartiger. Einige dieser Fische waren um die Perm-­‐Trias-­‐Grenze weit verbreitet, so dass die Funde nicht überraschten. Zwei archaische Fischgruppen wurden jedoch gefunden, die zu dieser Zeit sonst nirgends auf der Welt vertreten waren. Man glaubte bisher, sie seien im Perm-­‐Trias-­‐Massensterben ausgestorben; nun ist ihr Überleben aber dokumentiert. Zudem seien bisher gewisse Haifischzähne nur aus älteren Schichten als dem Perm bekannt gewesen. Viele dieser fossilen Fischüberreste aus dem mittleren Paläozoikum Brasiliens seien somit einzigartig und hätten keinen Bezug zu Funden aus der frühen Trias oder zu heute lebenden Arten. Die Autoren hoffen mit diesen Funden qualitative Überlebensraten von Fischen an der Perm-­‐Trias-­‐Grenze abschätzen und sie in Bezug zu Bestandesaufnahmen in der Nordhemisphäre setzen zu können. Damit wollen sie ein genaueres Bild vom Ausmass des Aussterbens und Überlebens an der Perm-­‐Trias-­‐Grenze speziell in der Südhemisphäre erhalten. 5.4 MUTTER, R. J., Fossile Fische aus der Trias der kanadischen Rocky Mountains. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004), 149/2-­‐3:51-­‐58 Dr. Raoul J. Mutter, Edmonton, 2004 Literaturbericht, wb Der Autor hat auch in der Nordhemisphäre nach Fischfossilien gesucht und beschreibt hier seine Funde aus der Untertrias der Sulphur Mountain Formation im östlichen Britisch-­‐Kolumbien. Diese Fundstelle liefert der Paläoichtyologie mit ihrer grossen Diversität eine wichtige Referenzfauna für die Bestätigung des relativen Alters von Faunenassoziationen. Mutter misst der Trias eine grosse Bedeutung bei, weil nach dem Aussterbe Ereignis am Ende des Paläozoikums sich neue Lebensformen ausgebreitet hätten, vergleichbar mit dem „Neustart eines Computers“. 250 Millionen Jahre alte Fischfossilien wie etwa altertümliche Knochenfische, sind aus in dieser Region allerdings schon seit längerem bekannt. Die neuen Fundstellen zeigten, dass die untersten Schichten der Trias fast ausschliesslich Fischfossilien und wirbellose Tiere führen, während in jüngeren Mitteltrias Schichten mehrheitlich marine Reptilien vertreten waren. Das Hauptinteresse der Populärforschung richtete sich zuerst auf die Gewinnung von Sauriern. Die Fischfauna der Unter-­‐ und Mitteltrias sei dann erstmals 1986 beschrieben worden. Die genaue stratigraphische Herkunft aller Einzelfunde sei aber innerhalb der Untertrias nicht möglich. Oberhalb der Fischassoziationen sei im Schichtprofil aber auch eine Muschel gefunden worden, welche mit Vorbehalt in die obere Untertrias eingestuft werden könne. Der Autor zeigt damit ein Beispiel, wie heute aus bestimmten Schichten stammende Fossilien von Wirbellosen und Fischen verglichen werden können. Er erwähnt aber auch noch neue Fossilien: Schon 1870 waren in den USA Stacheln von Haifischen aus dem Oberkarbon gefunden und der Gattung Listracanthus zugeordnet worden. Durch die Feldarbeit in der Sulphur Mountain Formation konnte der Autor nun zeigen, dass es sich bei dieser Gattung um einen schlanken, aalförmigen Knorpelfisch handelte, dessen Körper von Hautzähnen und Schuppen bedeckt war. Da Knorpel gegenüber Knochen ein schlechteres Fossilisationspotential hat, sind die Funde von Knorpelfischen sehr selten. Es konnte aber erstmals ein Jungtier der Hybodontien-­‐Haifische geborgen werden, die im frühen Mesozoikum (Erdmittelalter) verbreitet waren und heute ausgestorben sind, und ebenfalls ein fast vollständiges Skelett des Knorpelhaifisches Edestus. Die Bezahnung und die Flossenstacheln sind für die Bestimmung massgebend. Weiter berichtet der Autor vom Fund eines vollständig erhaltenen, gut 2m grossen, diskusförmigen Knochenfisches, eines sog. „Ganoidfisches“, welcher in der Trias weit verbreitet war. Seine Schädelreste erlauben erstmals die Rekonstruktion des Verknöcherungsmusters. Jedoch können die phyologenetischen Verhältnisse der Trias-­‐Knochenfische in Ermangelung weiterer anatomischer Kenntnisse noch ungenügend nachgezeichnet werden. Besonders die Gruppen der Strahlenflosser und der Quastenflosser seien schwierig zu bearbeiten, da die Funde sehr bruchstückhaft seien. Zufällig wurden 1937 bei Madagaskar und 1989 im indonesischen Archipel rezente Quastenflosser gefunden. Sie galten zuvor als ausgestorben und stellen eigentliche lebende Fossilien dar, da sich ihr Skelettbau seit 400 Millionen Jahren kaum verändert hat. Dank der Skelettrekonstruktionen aus dieser Fundstelle konnte der Autor die Kenntnis der stammesgeschichtlichen Zusammenhänge erweitern. Das grösste Problem scheint in der zeitlichen Zuordnung zu Paläozoikum oder Trias zu liegen. Mit Hilfe von Muscheln und Chordatieren aus denselben Schichten versucht Mutter nun, das relative Alter dieser Fischfauna besser zu erfassen. 5.4 LETSCH, D., Unsere wandernden Kontinente – die geotektonischen Ideen des Zürcher Naturforschers Heinrich Wettstein (1831-­‐1895). In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2007) 152(4): 111-­‐117 Dominik Letsch, Zollikon Literaturbericht, wb Dominik Letsch aus Zollikon beschreibt die Theorie des Zürcher Sekundarlehrers Heinrich Wettstein, welcher dieser in seinem 1880 erschienen Buch „Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen“ vertrat. Es handelte sich um die wohl erste mobilistische Auffassung der Erde, lange bevor 1912 Alfred Wegeners Kontinentalverschiebungs-­‐Hypothese und 1960 die inzwischen klassische magnetpolinduzierte Plattentektonik Verbreitung fanden. Letsch fand als Ausgangspunkt von Wettsteins Idee die „Sonnengravitation“, welche dieser aus dem dritten Gesetz Keplers abgeleitet hatte. Danach verhalten sich die Quadrate der Umlaufzeiten von Himmelskörpern um einen Zentralkörper zueinander wie die Kuben der jeweiligen mittleren Abstände zum Zentralkörper. Daraus schloss Wettstein auf eine die Erdrotation verzögernde west-­‐gerichtete, mit der Tiefe abnehmende Kraft, die auf Körper an der Erdoberfläche wirkt, die mit zunehmender geographischer Breite abnimmt und die infolge der Erdrotation täglichen Schwankungen unterworfen ist. Diese zwar geringe rückläufige Kraft nannte er eine „Wirkung der Sonnengravitation“ und er sah sie als genügend an, dass grosse Teile der Erdkruste durch sie im Laufe der Zeit um viele tausend Kilometer verschoben werden könnten. Durch den hohen Druck des Gesteins und die erhöhte Temperatur würde sich dieses wie eine zähe Flüssigkeit in einem „latent plastischen Zustand“ verhalten. Die Sedimentschichten könnten nun bei genügender Dicke an ihrer Basis eine plastische Gleitschicht ausbilden und sich infolge ihrer unterschiedlichen Höhe in langsamer peristaltischer Bewegung übereinander schieben, bis sie auf Widerstand stossen und sich dann auffalten. Die dabei entstehenden Rutschflächen seien im Gebirge überall sichtbar. Die Kontinente galten für Wettstein als „Scharen von Schichtkomplexen, die für sich fortrücken und auf weite Erstreckung einen gleichförmigen Gang besitzen“. Mit diesen nach Westen und auch etwas polwärts wandernden Kontinenten konnte er auch erklären, warum Überreste von tropischer Flora aus dem Karbon auf der ganzen Erde, und die miozäne Braunkohle im Norden auf Spitzbergen anzutreffen sei. Es habe hier eine „Dislokation im Grossen“ stattgefunden. Solche Überlegungen seien nach Letsch erst dreissig Jahre später wieder gemacht worden. Auch im Vulkanismus und in den Erdbeben sah Wettstein dieselbe Ursache: Das Wandern ganzer Schichtkomplexe über ihr Substrat. Vulkane entstünden durch Risse und Spalten im Krustenmaterial, welches durch Bewegungsreibung aufgeschmolzen werde. Werde das Gleiten der Schichten gebremst, so entstünden Spannungen, welche in einem ruckartigen Erdbeben abgebaut würden. In den regelmässigen sich auf-­‐ und abbauenden Spannungen der Erdkruste vermutete er weiter die Ursache des Erdmagnetismus, welchen er sogar auf Weltkarten mit magnetischen Werten illustrierte. H. Wettstein hatte 1850 Theologie studiert, danach Physik bei Albert Mousson, Botanik bei Oswald Heer und Geologie bei Arnold Escher von der Linth. Nach der Sekundarlehrerprüfung 1854 wirkte er in diversen Gemeinden des Kantons Zürich als Sekundarlehrer. Er war aber wissenschaftlich ein Einzelgänger und seine Abgeschiedenheit von der damaligen Geologen Gemeinde verhinderte denn auch eine Verbreitung seiner zukunftsweisenden Theorie. Diese sei erst lange nach seinem Tod von Alfred Wegener gewürdigt worden. Letsch bewundert jedoch Wettsteins Werk, weil es trotz der damaligen dürftigen geophysikalischen Datenlage einen bemerkenswerten Versuch zu einer mobilistischen Gesamtschau der Erde darstellt. Er schliesst mit dem schönen Satz: Wir sehen in seinem Bild der wandernden Schichten und Kontinente ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie mangelhafte Datensätze durch reiche Phantasie eines mutigen, unabhängigen Autors zu einem harmonisch erscheinenden Ganzen vereint werden können. 5.5 LEU, U.B., Geschichte der Dinosaurierforschung. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1997) 142/2: 55-­‐67 Dr. Urs B. Leu, Zentralbibliothek Zürich, 1997 Literaturbericht, wb Im Paläontologischen Museum der Zentralbibliothek in Zürich zeigte Dr. Urs B. Leu anlässlich einer Ausstellung einige seltene Dokumente zur Geschichte der internationalen und schweizerischen Dinosaurierforschung. Schon im Jahr 1708 wurden in Altdorf in Franken Wirbel von Ichthyosauriern gefunden, aber als Fisch-­‐ bzw. Menschenwirbel interpretiert. 1749 barg ein Göppinger Arzt die Brustpartie eines Fischsauriers mit einem Jungtier in der Leibeshöhle. Zur selben Zeit wurden auch in England Fossilien gefunden, aber ein Verständnis für diese ausgestorbenen Meeresbewohner entstand noch nirgends. 1812 entdeckten zwei Kinder in England ein Ichthyosaurierskelett, welches erst 1824 als identisch mit dem Fossil des Göppinger Arztes erkannt wurde und die Bezeichnung Ichthyosaurus erhielt. Trotz weiterer Funde und ihrer Untersuchungen durch bekannte Naturforscher wie Richard Owen (GB) und Louis Agassiz (CH), dauerte es noch bis 1894, bis ein gut erhaltenes Fossil den Schluss zuliess, dass zwar sein Äusseres an einen Fisch erinnert, dass aber die Anatomie des Skelettes eindeutig zu den Reptilien gehört. Ähnliche Schwierigkeiten hatte die Forschung mit der Entdeckung und Zuordnung der Pterosaurier, der Flugsaurier. 1784 wurde ein erstes Exemplar gefunden, beschrieben und für ein Meerestier gehalten. Immerhin stellte schon 1801 der Begründer der Wirbeltierpaläontologie, Georges Cuvier (F) fest, dass es sich um ein fliegendes Reptil handeln müsse, ähnlich den rezenten Flugeidechsen. Dies wurde aber noch lange angezweifelt und Theorien über Schwimmvögel, Wassertiere mit langen Armen und fledermausähnlichen Säugetieren wurden diskutiert. Erst 1873 standen gut erhaltende fossile Exemplare zur Verfügung, die Cuviers Interpretation bestätigten. Die ältesten Dinosaurier Funde (griech. deinos = gewaltig, furchtbar, sauros = Eidechse) wurden zwar in China schon im zweiten vorchristlichen Jahrtausend gemacht, doch erst 1677 wurde ein Oberschenkelknochen aus einem Steinbruch in Cornwell, GB, abgebildet und beschrieben. Da er grösser war als Knochen von Pferden oder Ochsen, wurde er als Überbleibsel eines menschlichen Riesen gedeutet. Wiederum war es Georges Cuvier, der später diesen Knochen und weitere Funde mit ausgestorbenen Riesenechsen in Verbindung brachte und 1796 erstmals die offizielle Erkenntnis im „Institut national“ vortrug, dass viele Tierarten ausgestorben seien. Weitere Funde aus einem Steinbruch bei Stonesfield, GB, wurden 1818 vom Oxforder Geologen William Buckland zusammen mit G. Cuvier als Reste eines Riesenreptils interpretiert und als Megalosaurus bezeichnet. Es war der erste Vertreter der Dinosaurier, von denen bis 1990 284 verschiedene Gattungen gefunden wurden. In anderen englischen Steinbrüchen wurden 1822 Zähne gefunden, welche grosse Ähnlichkeit mit Zähnen rezenter Echsen zeigten. Der Grössenunterschied deutete auf eine Länge der fossilen Echsen von 18 m hin, was später mit weiteren Funden bestätigt wurde. Der Paläontologe und Kollege Darwins, Richard Owen, fasste die Gattungen Megalosaurus, Iguanodon und Hylaeosaurus in einer Reptiliengruppe zusammen, die er als Dinosauria bezeichnete, was sich bis 1845 offiziell durchsetzte. Eine erste „Dino-­‐Welle“ entstand in Englands Bevölkerung, als 1852 in einem Londoner Vorort der erste Kultur-­‐ und Freizeitpark Europas eröffnet wurde. Auf Anregung von Prinzgemahl Albert wurde das Parkgelände mit Modellen ausgestorbener Tiere ausgestattet, welche nach den Vorgaben von Richard Owen ausgeführt wurden. Sie erschienen als riesige, rhinozerosähnliche Reptilien, welche auf vier Füssen gingen. Der amerikanische Anatom Joseph Leidy beschrieb 1856 den ersten Dinosaurierfund in den USA, einen Hadrosaurus, und er schloss aufgrund der langen kräftigen Hinterbeine und der kurzen Vorderarme auf eine känguruhähnliche Haltung. Weitere Funde bestätigten dann das für verschiedene Dinosaurier-­‐Gattungen typische echte zweifüssige Schreiten. Jedoch wurden ab 1877 auch vierfüssige Riesen, Sauropoden, gefunden und damit wurden in Colorado und Wyoming zwei fundreiche Dezennien eröffnet, die auch als „Knochenrausch“ in die Geschichte eingingen. 1886 wurde ein prächtiges Skelett eines Stegosaurus gefunden mit den charakteristischen Rückenplatten und Schwanzstacheln. Ebenfalls während des „Knochenrausches“ wurden erste Exemplare von Diplodocus gefunden, eines 30m langen dynamischen Riesen, der auf allen Vieren ging und seinen langen Schwanz abgehoben vom Boden trug. Auch die Erforschung von Dinosauriereiern und –fusspuren wurzelt nach Leu’s Recherchen im 19. Jahrhundert. Während die Eier Einblicke in die Fortpflanzungs-­‐ und Nistverhalten gewähren, erlauben die Fusspuren Rückschlüsse auf Bewegung und Sozialverhalten der Tiere. Auch in der Schweiz setzte die Beschäftigung mit Saurierfunden schon früh ein. Der Autor erwähnt einen Vortrag des Lehrers Franz Josef Hügi, den er 1824 vor der Solothurner „Naturhistorischen Kantonalgesellschaft“ zum „System der Petrefacketen im Jura“ hielt. Darin habe er eine Sammlung von Knochen verschiedener Wirbeltiere gezeigt, wie von Haifischen, Krokodilen, Ichthyosauros, Protosauros und Megalosauros. In einem Steinbruch bei Moutier (BE) kamen zwischen 1858-­‐63 Fossilien zweier Exemplare von Megalosaurus ans Licht. Von 1915 – 1942 wurden im Klettgau (SH) Knochenreste geborgen und in Frick (AG) wurden 1962 die ersten Skelettreste eines Plateosaurus gefunden. Dort wurde auch 1984/85 das erste vollständige Dinosaurierskelett vom Präparator Urs Oberli freigelegt. Daneben ist die Schweiz reich an Fussabdrücken von Dinosauriern. Im Nationalpark wurden 1961 auf einer Platte 14 Fährten von pflanzen-­‐ und fleischfressenden Prosauropoden und Theropoden gefunden. Oberhalb von Vieux Emosson (VS) wurden 1977 weitere Trittsiegel geborgen und seit 1987 wurden im Berner Jura Fundstellen lokalisiert, von denen die Platte von Sommiswil (SO) besonders imposant ist und Spuren von Brachiosauriern aufweist. 5.6 BRINKMANN, W., Die Ichthyosaurier (Reptilia) aus der Mitteltrias des Monte San Giorgio (Tessin, Schweiz) und von Besano (Lombardei, Italien) – der aktuelle Forschungsstand. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1997) 142/2:69-­‐78 Dr. Winand Brinkmann, Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich Literaturbericht, wb Die Schweiz konnte zur Verbesserung der Kenntnisse und Datenlage der Ichthyosaurier Einiges beitragen. In den Tessiner Kalkalpen südlich des Luganer Sees, in den mitteltriassischen Schichten des Monte San Giorgio, wurden schon seit 1886 zahlreiche Fischsaurier Fossilien gefunden. Diese Schichten waren vor etwa 240 Millionen Jahren in einem flachen, von Riff-­‐Lagunen umgebenen Becken der westlichen Tethys, dem damaligen Vorläufer des heutigen Mittelmeeres, abgelagert worden. Die Beckensedimente wurden als Grenzbitumenzone des heutigen Monte San Giorgio sowie als Dolomiten des San Salvatore und Monte Caslano erhalten. Das Becken hatte zur Mitteltrias Zeit einen Durchmesser von ca. 5 – 10 km und eine Tiefe von kaum 100 m, so dass das Bodenwasser offenbar nicht mit dem Oberflächenwasser durchmischt worden war. Am Boden war somit eine sauerstofflose Zone entstanden, in welcher reduzierende Bedingungen herrschten, sodass auf den Grund absinkende Leichen nicht aufgelöst oder durch Strömungen zerstört wurden. Der Autor bezeichnet dies als eine Stagnat-­‐Lagerstätte. Organische Substanz wurde nicht zersetzt, sondern akkumulierte zu Faulschlamm und daraus entstand durch allmähliche Gesteinsbildung schliesslich Schwarzschiefer. Der Gehalt an organischer Substanz ist in den Schwarzschiefern der Grenzbitumenzone so hoch, dass früher Bitumen, der extrahierbare Anteil, als Rohstoff für eine Heilsalbe gewonnen werden konnte. Diese Vorgänge erklären, warum am Monte San Giorgio und bei Besano (etwas weiter südlich bereits in Italien) Skelette und organische Skelettsubstanz einschliesslich der Weichteile erhalten blieben. Seit 1924 sind Zürcher Paläontologen im Südtessin tätig und bergen mit grossem Erfolg mitteltriassische Tier-­‐ und Pflanzenarten. Dazu gehört eine sehr diverse Ichthyosaurier Fauna, welche vom Autor genauer umschrieben wird und interessante Besonderheiten aufweist: Es handelt sich um eine Gruppe aquatischer viviparer Reptilien, die sekundär vollkommen an ein Leben im Meer angepasst waren. Schon länger bekannt waren Mixosauridae von bis 1,5 m Länge und Shastasauridae von über 1,5 m Länge. Fischsaurier waren vivipar, also lebendgebärend, da sie nicht mehr zur Eiablage an Land gehen konnten. Ein ganz besonderer Fund besteht aus einem trächtigen Mixosaurus Weibchen, das mit Resten von 3 – 4 Embryonen von ca. 40 cm Länge geborgen werden konnte. Offenbar war es an Geburtskomplikationen gestorben, da die Embryonen in den Uteri in Kopfendlage angeordnet waren, was für sekundär aquatische, lungenatmende Vierfüsser nach Ansicht des Autors ungünstig sei. Ein ebenfalls sehr besonderer Fund stellt das vollständige und einzigartig gut erhaltene Skelett eines 47 cm langen Fischsauriers der Gattung Phalarodon dar, welche bisher nur aus der Mitteltrias von Nevada, USA, und Britisch-­‐Kolumbien, Kanada, bekannt war. Phalarodon hat weniger Zähne als Mixosaurus und unterscheidet sich von ihm besonders im Schädelbereich. Die Zähne sind in der hinteren Region abgeflacht, was als Quetschgebiss bezeichnet wird. Da auch Pflasterzahnsaurier (Placodontier) ein Quetschgebiss aufwiesen, hatte man lange die Seltenheit von Fischsaurierfunden auf eine Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Gattungen zurückgeführt. Die Analysen des Mageninhaltes und des versteinerten Kotes (Koprolith) zeigten nun aber, dass sich Mixosauros besonders von kleinen Tintenfischen ernährt hatte, während dem die schwer gebauten Placodontier die bodennah lebenden Muscheln und Schnecken gefressen hatten. Weiter wurden in der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio Fossile einer Meeresreptil-­‐Gattung Clarazia gefunden. Dieses Reptil war zwar ein gewandter Schwimmer mit einem langen Schwanz gewesen, aber seine Extremitäten waren verhältnismässig wenig an die aquatische Lebensweise angepasst und waren auch für die Fortbewegung auf dem Festland geeignet. Clarazia hatte sich von Schalentieren ernährt, welche sie mit ihren Krallen an Händen und Füssen am seichten Meeresgrund ausgraben konnte. Aufgrund der Funde am Monte San Giorgio und in Besano konnte sowohl die Taxonomie wie auch die Verbreitungsgeschichte der weltweit nachgewiesenen Mixosaurier neu geschrieben werden. 5.7 BURGA, C.A., Oswald Heers „Die Urwelt der Schweiz“ im Licht der modernen Forschung. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009), 154(3/4):97-­‐108. Prof. Dr. Conradin Burga, Geographisches Institut der Universität Zürich Literaturbericht, wb Prof. Dr. C. Burga beschreibt in seiner Studie das 1864 erschienene populäre Buch des Zürcher Paläobotanikers Oswald Heer „Die Urwelt der Schweiz“. Die damaligen, von Heer zum grossen Teil selbst erarbeiteten Kenntnisse über die Geologie vom Karbon über das Eiszeitalter bis zum 19. Jahrhundert, zur belebten und unbelebten Natur und zum Paläoklima sind darin dargestellt. Heer hatte ein grosses Wissen über den Fossilinhalt der Schieferkohlen des Zürcher Oberlandes und eiszeitlichen Ablagerungen in Europa, sowie über geomorphologische, sedimentologische, stratigraphische und paläoklimatische Fragen. Man hatte die Erdgeschichte bereits in vier Hauptperioden eingeteilt: Primär, Sekundär, Tertiär und Quartär. Besonders behandelte Heer die Verbreitung der Moränen, die Herkunft und Transportweise der erratischen Blöcke, die grossen Eisströme der Alpen, die isostatischen Landhebungen sowie die Reaktion der Pflanzen-­‐ und Tierwelt auf die Eiszeiten. Burga führt noch weitere Einzelheiten zur Eiszeitforschung an: Seit 1787 wurden in der Schweiz, in England und Skandinavien Eiszeittheorien aufgestellt, in denen eisdurchsetzte Wasserfluten postuliert wurden, und die auch J.W. Goethe zu seiner „Flutdrifttheorie“ angeregt hatten. In seinen „Naturwissenschaftlichen Schriften“ nahm er Bezug auf das „Wachstum der Schweizer Gletscher“ (1820) oder auf „Geologische Probleme und Versuch ihrer Auflösung“ (1829). Die Definition Diluvium (Sintflut !) entstand 1832 durch den britischen Geologen W. Buckland und auch Georges Cuvier stellte eine „Katastrophentheorie“ auf. Darwin und Lyell vertraten ihrerseits eine „Alpenfluttheorie“. Oswald Heer neigte jedoch der „Gletschertheorie“ seines Kollegen J. de Charpentier zu und zeigte, dass nur massive Ströme von festem Eis, also Gletscher, den Transport von riesigen Stein-­‐ und Landmassen bewerkstelligen konnten. Der Begriff Eiszeit wurde aber erst 1837 durch einen Botaniker eingeführt. Während man zuerst von nur einer Eiszeit ausging (Monoglazialismus), konnte Heer 1858 die Schieferkohlenschichten von Uznach (CH) als zwischeneiszeitliche Bildungen aus Torf erklären. 1913 wurde der Polyglazialismus in Forschungsstollen in der Innsbrucker Nordkette definitiv bestätigt. Anhand der fossilen Pflanzenfunde in den Schieferkohlenschichten konnte Heer auch auf das wechselnde Klima Rückschlüsse ziehen und zog dafür Pflanzenfunde aus Europa und Nordamerika bei. Besonders das Paläoklima des Tertiärs interpretierte er in einer Monographie und Prof. Burga weist darauf hin, dass Heers Werte durch die moderne Forschung nur geringfügig korrigiert werden mussten. Heer deutete die Hebung und Senkung des Festlandes bei Schottland und Skandinavien als Folge der Vergletscherung und Schmelze, vernachlässigte dabei allerdings die Rolle der Meeresspiegelschwankungen. Seit 1973 weiss man, dass bis vor 7500 Jahren eine Landbrücke zwischen den britischen Inseln und Europa existierte. Anhand dieser Landhebungen berechnete Heer für die Dauer einer Eiszeit etwa 112 000 Jahre, wobei er zwei solche Eiszeiten postulierte. Die Abgrenzung der Einzugsgebiete der einzelnen Gletscher nahm er anhand der Verbreitung erratischer Blöcke an, was auch heute noch gebräuchlich ist. Prof. Burga würdigt Oswald Heer als „in Fragen glazialer Formen und Prozesse sowie biogeographischer Eiszeitdynamik scharfen und kritischen, z.T. geradezu visionären Beobachter, der wesentliche Aspekte glazialer, pflanzen-­‐ und tiergeographischer Prozesse des Eiszeitalters grundsätzlich richtig erkannte sowie in quantitativer Hinsicht deren Grössenordnungen weitgehend richtig abschätzte“. 5.8 Aus: BONEWITZ, R.L., Steine & Mineralien, Dorling Kindersley Limited, London 2005 Buchbericht, wb Die geologische Zeit ist die durch Gesteinsschichten bezeugte Geschichte der Erde (Bonewitz, 2005). Die Zeitabschnitte wurden ursprünglich durch die Analyse von Fossilien sowie die Korrelation und Einteilung der Gesteinsschichten festgelegt. Durch die evolutionären Veränderungen entstanden neue Arten, während andere ausstarben. Bestimmte Organismen sind deshalb für bestimmte Zeitabschnitte charakteristisch (Leitfossilien). Sie ermöglichen eine Einteilung in verschiedene Perioden. Die radiometrische Altersbestimmung (Halbwertszeit von Radioisotopen bestimmter Elemente) machte es möglich, der anhand der Fossilien ermittelten relativen Zeitskala absolute Altersangaben zuzuordnen. Bonewitz beschreibt den Prozess der Fossilienentstehung wie folgt: Ein Fossil ist ein Überrest, ein Abdruck oder eine Spur von einem Lebewesen aus einer vergangenen geologischen Epoche. Nach R. Dawkins sollte es mindestens 10‘000 Jahre alt sein. Einige dieser Lebewesen sind in feinkörnigen Sedimentgesteinen wie Kalkstein oder Schieferton erhalten geblieben und waren Meeres-­‐ oder Seenbewohner. In den meisten Fällen haben sich die Weichteile der Pflanze oder des Tierkörpers zersetzt, und nur harte Körperteile wie Schalen, Zähne oder Holz blieben übrig. Unter dicken Sedimentschichten begraben versteinern sie mit der Zeit. Eisen-­‐ und Schwefelhaltige Sedimente bilden bei der Versteinerung manchmal Pyrit. Zirkulierende Säuren können auch die Hartsubstanzen auflösen, sodass nach dem Eindringen von Mineralien eine Negativform, ein Abguss des Lebewesens entsteht. Am Meeresboden, wo der abgesunkene Körper eines Tieres oder einer Pflanze rasch von Sedimenten bedeckt wird, stehen die Chancen für eine Versteinerung besonders gut. Meereslebewesen mit harten Schalen sind deshalb in den Fossilienfunden überrepräsentiert. Minerale dringen durch die Poren des Skeletts in das zersetzte Körpergewebe ein und hinterlassen dort Calziumcarbonat (Verkieselung). Durch den Druck der abgelagerten Sedimentschichten verfestigt sich das fossile Skelett zu Sedimentgestein. Hebt sich der Meeresboden dann in geologischen Zeiträumen, so kommt die Fossil führende Schicht an die Oberfläche. Die Erosion legt dann die Fossilien frei. Unter ganz besonderen Bedingungen können die Körper von Lebewesen unverändert erhalten bleiben. Ein Beispiel sind Diatomeen, winzige Kieselalgen, die ein Skelett aus Siliciumdioxid besitzen. Körpergewebe kann in seltenen Fällen auch sehr schnell von der Luftzufuhr abgeschnitten und damit dem Angriff anderer Lebewesen entzogen werden. Ein Beispiel dafür ist der Einschluss von Insekten, kleinen Tieren und Pflanzen in Bernstein. Ihre DNA ist allerdings nach 50‘000 Jahren zerfallen und nicht mehr rekonstruierbar. Geschmolzene Lava konnte in den Fussabdruck eines Dinosauriers oder in einen leeren Schädel fliessen. Lebewesen können Kriech-­‐ oder Fusspuren hinterlassen, welche so versteinert über Millionen von Jahren erhalten werden. Viele Fossilien bestehen deshalb nur aus einem Abdruck einer Pflanze oder eines Tieres im Gestein. Das sind etwa fossile Blätter oder die Haut eines Dinosauriers. 5.9 Aus: DARWIN, CH. R., Die Entstehung der Arten (Originaltitel: On the Origin of Species by Means of Naturals Selection, 1859). Reclams Universal-­‐Bibliothek, Berlin 1963 Bericht, wb Die Entstehungsmöglichkeiten von Fossilien waren Darwin weitgehend bekannt. Er wusste auch, dass bei Senkungen des Meeresbodens der Druck der Sedimente steigt und somit viele Fossilien entstehen, bei dessen Hebung dagegen weniger. Es interessierte ihn natürlich die Frage, ob mit Fossilienfunden ein Beweis für oder gegen seine Evolutionstheorie erbracht werden könnte. Er behandelte diese Frage in einem eigenen Kapitel in „The Origin of the Species“. Seine Kritiker hielten ihm entgegen, dass die Fossilienfunde keine Beweise für die Übergänge von Arten zu neuen Arten liefern würden. Dem erwiderte Darwin, dass nur relative wenige Lebewesen überhaupt zu versteinerten Fossilien werden können, dass diese Funde sehr lückenhaft seien und dass die Zeiträume zwischen den geologischen Schichten viele Millionen Jahre umfassten. Ferner wies er darauf hin, dass es gar nicht möglich sei, einigermassen konstante Arten von Übergangsformen und Varietäten zu unterscheiden oder gar noch festzustellen, welche Formen aus welchen anderen Arten hervorgegangen seien. Zu seiner Zeit waren zudem nur wenige Gesteinsschichten in Europa und Nordamerika überhaupt untersucht, was nur einem winzigen Teil der Erde entsprach. Er argumentierte auch, dass bei einer Senkung des Meeresbodens die Landmasse abnehme, womit viele Tier-­‐ und Pflanzenarten aussterben müssten. Bei der Hebung des Meeresbodens dagegen können infolge der grösser werdenden Landmasse zahlreiche neue Arten entstehen, aber die Sedimentablagerung und damit die Versteinerungen werden geringer. Zudem würden dann an den Küsten durch Wellenschlag und Erosion der grösste Teil der Fossil führenden Schichten zerstört. Schlussendlich schrieb er, dass in den verschiedenen aufeinanderfolgenden Formationen all die Lebensformen vergraben seien, die uns den irrtümlichen Eindruck vermitteln, sie seien plötzlich erschienen. Die Schwierigkeiten, anhand von Fossilien die Evolutionstheorie zu beweisen, würden mit diesen Überlegungen mit der Zeit verschwinden. 6. Homo sapiens 6.1 DARWIN, CH. R., Die Abstammung des Menschen (Originaltitel: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871). Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt a.M. 2009 Buchbesprechung, wb In der Einleitung zu seinem Werk über die Abstammung des Menschen schreibt Darwin: In der ersten Ausgabe meiner „Entstehung der Arten“ liess ich es bei der Andeutung bewenden, dass durch dieses Werk Licht verbreitet würde auch über den Ursprung des Menschen und seine Geschichte. Darin lag eingeschlossen, dass der Mensch hinsichtlich seines Erscheinens auf der Erde denselben allgemeinen Schlussfolgerungen unterworfen sei wie jedes andere Lebewesen. Bescheiden fügt er aber zu, die Folgerung, dass der Mensch ebenso wie andere Arten von einer alten, ausgestorbenen Form abstamme, sei schon vor ihm von Lamarck, Wallace, Lyell, Huxley, Vogt, Lubbock, Büchner und Haeckel gezogen worden. Es sei speziell von Huxley gezeigt worden, dass der Mensch in jedem einzelnen seiner erkennbaren Merkmale weniger von den höheren Affen abweiche, als diese von den niederen Vertretern derselben Ordnung. Darwin versuchte in seinem Werk aufzuzeigen, dass der Mensch der veränderte Nachkomme einer früheren, ausgestorbenen Form sei und nicht nur einem vagen „Prinzip der Entwicklung“, sondern wie alle Arten den allgemeinen Gesetzen der Evolution, also der natürlichen und sexuellen Selektion unterliegt. Dies stand im Gegensatz zur damals noch verbreiteten Meinung, der Mensch habe eine eigene, von anderen Lebewesen verschiedene Entstehungsgeschichte. Darwin widmete sich deshalb den Fragen: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Ob die menschlichen Individuen in ihrem Körperbau und ihren geistigen Fähigkeiten aus demselben Grund wie andere Lebewesen variieren und ob solche Variationen selektiert und vererbt werden Ob die Gesetze der Korrelation und der vererbten Wirkungen des Gebrauchs und Nichtgebrauchs gelten Ob der Mensch Missbildungen unterworfen sei wie Entwicklungshemmungen oder Verdoppelung von Teilen, und ob sich einige solcher Fehlbildungen als Rückschlag auf einen früheren, älteren Typus deuten lassen Ob der Mensch Varietäten, Unterrassen und Rassen erzeuge, die unterschiedlich stark voneinander abweichen und als beinahe verschiedene Arten bezeichnet werden könnten Wie es sich mit der geografischen Verbreitung derartiger Rassen verhält und wie das Produkt einer Kreuzung in der ersten und in den folgenden Generationen beschaffen sei Ob der Mensch sich so rasch vermehre, dass gelegentlich ein harter Kampf um die Existenz daraus entspringt und ob verschiedene Rassen und Unterrassen einander verdrängen Ob nützlich Abänderungen, körperliche oder geistige, erhalten werden, schädliche dagegen ausgemerzt werden Alle diese Fragen konnte Darwin bejahen und untermauerte dies mit detaillierten Beobachtungen, Fakten und Schlüssen sowohl in Bezug auf -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Den Körperbau des Menschen Die geistigen und intellektuellen Fähigkeiten Viele Krankheiten Die Embryonalentwicklung, welche in den frühen Stadien kaum Unterschiede zwischen Menschen und anderen Säugetieren zeigt -­‐
Anatomische Rudimente wie Muskeln, Nickhaut, Aussenohr, Schwanzbein, Körperbehaarung, Weisheitszähne, Blinddarm oder die rudimentären Milchdrüsen beim Mann. Der Mensch unterliege einer bedeutenden Variabilität, stellte Darwin fest. Nicht zwei Individuen derselben Rasse seien in irgendwelchen vererbbaren körperlichen oder geistigen Merkmalen gleich. Auch die korrelativen Abänderungen, also die gemeinsamen Abänderungen homologer Bildungen wie etwa Arme und Beine konnte Darwin beobachten, wenn auch nicht erklären. Diese grosse Variabilität sei für die natürliche wie für die sexuelle Selektion von grossem Vorteil gewesen. Der Mensch habe sich weit verbreitet dank seiner intellektuellen Fähigkeiten, seinen sozialen Gewohnheiten und der artikulierten Sprache, welche zwar eine hohe Hirnleistung erfordert, aber den Bau von Werkzeugen, Waffen und Kommunikationsmitteln ermöglicht hat. Schon affenähnliche Vorfahren des Menschen müssten gesellig gelebt haben, schliesst Darwin. Denn während körperliche Merkmale bei keinen Tierarten etwas zum sozialen Leben beitragen, seien geistige Fähigkeiten im ganzen Tierreich stets zum Nutzen der Gemeinschaft erlangt worden, welcher sich indirekt wieder zum Vorteil des Individuums auswirkte. Die geringe körperliche Kraft des Menschen werde in der natürlichen Selektion mehr als ausgeglichen durch die Fähigkeit, Waffen und Werkzeuge herzustellen und durch die sozialen Eigenschaften, seinen Mitmenschen zu helfen und Hilfe von ihnen zu empfangen. Im Weiteren bearbeitete Darwin die Frage, ob der Mensch sich durch seine geistigen Fähigkeiten so stark von allen anderen Tieren unterscheide, dass eine Abstammung von tiefer stehenden Formen respektive eine Einordnung in eine Gattung von heute lebenden Primaten unmöglich sei. Er zeigt jedoch, dass in den geistigen Fähigkeiten kein fundamentaler Unterschied zwischen den Menschen und höheren Säugetieren bestehe. Er führt dazu Vergleich zwischen angeborenen Instinkten und Emotionen an, die universell vorhanden sind. Er beweist, dass Tiere nicht nur lieben, sondern auch den Wunsch haben, geliebt zu werden. Er beschreibt, wie Tiere Ehrgeiz haben und Anerkennung und Lob suchen. Er fand bei Hunden Scham und Bescheidenheit sowie Eitelkeit und Stolz. Dass Tiere anhand von Nachahmung und Erfahrungen lernen und Erlerntes wieder ihren Jungen beibringen und zum Teil vererben, beweist er bei Säugetieren und Vögeln. Die im Schlaf sich einstellende Phantasie beschreibt er bei Hunden und ebenso ein gewisses Mass an Verstand, indem sie aus zwei Handlungsmöglichkeiten die bessere auswählen können. Weiter berichtet Darwin von Affen, welche Werkzeuge zum Öffnen von Früchten benutzen und sogar den Deckel eines Kastens mit Hilfe eines Stockes im Sinne eines Hebelarmes öffnen können. Auch könnten Paviane mit Gegenständen nach Menschen werfen, welche sie als Bedrohung ansehen, und sie bedecken ihren Kopf mit Strohmatten, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind. Am schwierigsten sei es, meint er, bei Tieren Formen von Abstraktion, allgemeiner Ideen und Selbstbewusstsein zu bestimmen, da niemand beurteilen könne, was in der Seele eines Tieres vorgehe. Immerhin sei zu bedenken, dass der Hund, der ganz verschieden auf einen Freund oder Feind oder auf den Befehl zur Jagd oder zur Ruhe reagiere, irgend einen Begriff oder eine Idee solcher Phänomene haben müsse. Wenn eine allmähliche Steigerung der Fähigkeit zum Selbstbewusstsein und zur Abstraktion bei den Vorfahren des Menschen postuliert werde, so entspreche dies auch der allmählichen Entwicklung dieser Fähigkeiten bei unseren Kindern. In der Sprache sieht Darwin einen der Hauptunterschiede zwischen Menschen und Tieren. Er zitiert aber einen gewissen Erzbischof Whatley, welcher bemerkt habe, „dass der Mensch nicht das einzige Tier sei, das sich einer Sprache bediene, um das auszudrücken, was in seinem Geiste vorgeht, und das verstehen kann, was in dieser Weise von anderen ausgedrückt wird“. Er führt Affenarten an, die mehrere verschiedene Laute von sich geben, um eine unterschiedliche Gefahr anzuzeigen. Auch Hunde können in unterschiedlichsten Tonlagen und Lautstärken Bellen, um Ärger, Verzweiflung, Freude oder etwa den Wunsch nach Öffnen einer Türe anzuzeigen. Der Mensch habe jedoch eine unendlich grössere Fähigkeit, die verschiedenen Laute und Ideen zu assoziieren. Ähnlichkeiten sehe man am ehesten bei den Singvögeln. Sie üben ihre Laute zur Bezeichnung von Gemütsbewegungen instinktiv aus. Aber den wirklichen Gesang und die Lockrufe lernen sie von den Eltern oder Pflegeeltern. Kanarienvögel geben erlernte Gesangsweisen ihren Nachkommen weiter und es entstehen so regional verschiedene „Dialekte“. Die instinktive Neigung, sich eine Kunst anzueignen, sei also nicht auf den Menschen beschränkt. Er meint denn auch Bezug nehmend auf einen ihm bekannten Prof. Max Müller, dass „Urmenschen“ ihre Stimme dazu benutzt hätten, echt musikalische Kadenzen hervorzubringen, um dem anderen Geschlecht zu gefallen, also im Sinne der sexuellen Selektion. Daraus postuliert er die Möglichkeit, dass die Nachahmung musikalischer Ausrufe durch „artikulierte Laute Worte erzeugt hat, die verschiedene kompliziertere Erregungen ausdrückten“. Darwin schreibt denn auch den Sprachen einen evolutiven Charakter zu: Wir beobachten in jeder Sprache Variabilität und neue Wörter tauchen beständig auf. Die besseren, kürzeren und leichteren Formen behalten die Oberhand. Auch im Schönheitssinn sieht Darwin keine neue Besonderheit des Menschen, ausser dass Empfindungen für Schönes bei uns mit komplizierten Ideen und Gedankengängen verknüpft sind. Diese Verknüpfungen sind aber bei verschiedenen Völkern und in verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich. Er weist auch darauf hin, wie männliche Vögel mit Vorbedacht ihre Gefieder und dessen prächtige Farben vor den Weibchen entfalten und dass diese beim Anblick derartiger Dinge ein gewisses Vergnügen empfinden. Helmholtz habe zudem aus physiologischen Gründen erklärt, warum Harmonien und gewisse Tonfolgen angenehm sind. Schönheit könnte also durchaus der sexuellen Selektion entstammen und ist bei Menschen mit der Neigung zu Nachahmung und Neuerfindungen um ihrer selbst willen verbunden (Mode, Stil, Kunst). Im Vermögen der Erinnerung und der Reflexion sieht Darwin auch den Ursprung von Moral und Gewissen. Moralisch nennt er ein Wesen, das imstande ist, seine früheren und künftigen Handlungen oder Motive zu vergleichen und sie zu billigen oder zu verwerfen. Diese Beurteilung entspringe aber der Sympathie, dem fundamentalen Element aller sozialen Instinkte. Sie ist langandauernder als Leidenschaften wie Hunger oder Besitzgier und kommt dem Individuum deshalb immer wieder als Richtschnur dessen in Erinnerung, wie er von seinen Mitmenschen beurteilt wird. Das Urteil anderer ist denn auch der Grund des Gewissens, denn dieses schaut zurück und dient zugleich als Führer in der Zukunft. Von diesem Gewissen beeinflusst, wird der Mensch durch lange Gewohnheit eine so vollkommene Selbstbeherrschung erwerben, dass seine eigenen Wünsche und Leidenschaften sich schliesslich kampflos seinen sozialen Sympathien und Instinkten, sowie seinem Gefühl für die öffentliche Meinung unterordnen. Darwin sieht darin eine biologische Begründung des von Kant formulierten Pflichtgefühls. Auch der Mensch, dem das Urteil anderer gleichgültig sei, sehe durch die Furcht vor Strafe, dass es auf die Dauer vorteilhafter für ihn sei, das Wohl anderer Menschen über das eigene zustellen. Auch die in allen Religionen vorhandenen Vorstellungen von Himmel und Hölle interpretiert Darwin in diesem Sinne. Die sicherste Richtschnur, meint er wiederum auf Kant bezogen, geben dem Menschen jedoch seine eigenen, durch Vernunft kontrollierten Überzeugungen. So wird sein Gewissen der höchste Richter und Mahner. Darwin weist aber darauf hin, dass die Tugenden der sozialen Sympathie zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Völkern und Stämmen und in verschiedenen Religionen stark variieren, so wie man es nach der Evolutionslehre erwarten würde. So seien das Töten von Feinden, von überschüssigen Kindern, besonders Mädchen, die Versklavung von Mitmenschen, die Beraubung von Fremden, das Verbrennen Andersdenkender oder die Foltermethoden der Indianer innerhalb geschlossener Gemeinschaften oft anerkannt worden. Auch bei der Entstehung neuer Gruppen oder Interessengemeinschaften sei Ungehorsam sofort zum Verbrechen erklärt worden. Er zitiert den Philosophen Herbert Spencer mit der Meinung, dass die Erfahrung der allgemeinen Nützlichkeit durch fortgesetzte Überlieferung und Anhäufung in uns zur moralischen Intuition geführt habe. Er sieht aber durchaus die sozialen Instinkte der Sympathie und der Hilfsbereitschaft sowohl bei Tieren wie beim Menschen als Grund für das Individuum, Billigung und Missbilligung der anderen zu beachten. Bei domestizierten Tierarten, etwa beim Hund, richtet sich das Individuum in seinen Handlungen sogar nach der Billigung durch seinen Herrn, den Menschen. Er sieht denn auch den Unterschied zwischen den Seelen der Tiere und der Menschen nicht als prinzipiellen, sondern nur als graduellen. Er führt auch zahlreiche Beobachtungen als Beweise an, dass alle zivilisierten Völker einst Barbaren waren, und dass der Mensch nicht als zivilisiert in die Welt gesetzt worden sei und einige Völker oder Stämme erst danach in eine „wilde Barbarei“ hinab gesunken seien. Die sozialen Instinkte der Individuen seien sehr nützlich für die Gemeinschaft wie für die Spezies. Sie seien deshalb höchst wahrscheinlich durch natürliche Selektion erworben worden. Nun haben zur Zeit Darwins viele Gelehrte den Einwand vorgebracht, die Quantität der geistigen Fähigkeiten könne innerhalb einer Gattung oder einer Klasse nicht derart verschieden sein wie zwischen dem Menschen und einem Affen. Sie haben dem Menschen deshalb eine besondere Stellung eingeräumt. Dem hält Darwin einen eindrücklichen Vergleich mit Insekten, nämlich zwischen der Schildlaus und der Ameise entgegen: Die weibliche Schildlaus klammert sich im Jugendzustand mit dem Rüssel an einer Pflanze an, saugt den Saft daraus, ohne sich wieder zu bewegen, wird befruchtet und legt ihre Eier. Das ist ihre ganze Lebensgeschichte. Dem gegenüber weiss man, dass Ameisen einander Mitteilungen machen und sich oft zu gemeinsamer Arbeit oder zu Spiel vereinigen. Sie erkennen ihre Gefährten nach monatelanger Abwesenheit wieder und empfinden gegenseitige Zuneigung. Sie führen grosse Bauten aus, halten sie sauber, schliessen des Abends ihre Eingänge und stellen Schildwachen auf. Sie bauen sowohl Wege wie Tunnels unter Flüssen und errichten sogar fliegende Brücken, indem sie sich aneinander klammern. Sie sammeln Nahrung für die Gemeinschaft, und wenn ein Gegenstand an den Bau gebracht wird, der für den Eingang zu gross ist, so vergrössern sie ihn und befestigen ihn dann von neuem. Sie bewahren Samen auf, dessen Keimung sie zu verhindern wissen, und den sie an der Sonne trocknen, wenn er feucht geworden ist. Sie halten sich Blattläuse und andere Insekten als Milchkühe. Sie ziehen in regulären Heeren aus zu ihren Kriegen und opfern freiwillig ihr Leben für das gemeine Wohl. Sie wandern nach einem wohldurchdachten Plan aus. Sie halten Sklaven. Sie bringen die Eier ihrer Blattläuse so gut wie ihre eigenen Eier und Puppen in warme Teile des Nestes, damit die Jungen umso schneller ausschlüpfen. Dieser riesige Unterschied zwischen der Schildlaus und der Ameise wird natürlich von vielen anderen Insekten überbrückt. Dass solche Überbrückungen zwischen Menschen und Affen nicht sichtbar sind, führt Darwin darauf zurück, dass sie ausgestorben sind. Er weist auch auf die Schwierigkeiten einer Klassifizierung hin, die sich nur auf wenige Organe oder Merkmale und nicht auf die Abstammung stützt. Wenn die Stammformen verwandt seien, so müssten auch ihre Nachkommen verwandt sein und zusammen eine Gruppe bilden. Die Grösse der Modifikationen, die jede Gruppe erlitten habe, werde durch die Bezeichnungen Gattung, Familie, Ordnung und Klasse ausgedrückt. Wenn keine Abstammungsreihen mehr leben oder dokumentiert seien, könne der Stammbaum nur dadurch festgestellt werden, dass man den Grad der Ähnlichkeit untersuche. Der Mensch sei aber den höheren Affen unendlich ähnlicher als diese irgendwelchen anderen Säugetieren. Wenn der Mensch sich nicht selbst klassifiziert hätte, so meint Darwin pointiert, würde er nie daran gedacht haben, eine besondere Ordnung für sich selbst zu gründen. Im Folgenden zählt Darwin einige Ähnlichkeiten auf, die sich nur schon an Kopf und Gesicht von Menschen und unterschiedlichen Affen zeigen. So etwa Kopfbehaarung, Bärte, Schnäuze, mimische Muskulatur und Gesichtsausdrücke für die Gemütsbewegungen. Das äussere Ohr, die ganz verschieden geformten Nasen, Stirn und Augenbrauen, sowie die unklare Grenze zwischen Stirn und behaarter Kopfhaut. Letzteres deutet er als Rückschlag auf eine Stammform, bei der die Stirn noch nicht völlig nackt war. Darwin kritisiert hiermit die Klassifizierung seines Freundes Prof. T. Huxley, welcher die Primaten in drei Unterordnungen aufgeteilt und dem Menschen eine eigene Ordnung gegeben hatte: -­‐
-­‐
-­‐
Anthropoiden (also der Mensch) Simiaden (alle Arten der Affen) Lemuriden (verschiedene Gattungen von Lemuren) Die Simiaden wurden schon damals unterteilt in: -­‐
-­‐
Catarrhinen (Affen der alten Welt, Afrika, Asien) Plathyrrinen (Affen der neuen Welt, Süd-­‐ und Mittelamerika) Da bei den Catarrhinen die Nasenlöcher ähnlich wie beim Menschen gestaltet sind und ebenfalls pro Kieferhälfte je 2 Prämolaren vorhanden sind, bei den Plathyrrinen jedoch je 3 Prämolaren und anders gestaltete Nasenlöcher, wurde der Mensch von Darwin nun neu den Altweltaffen zugeteilt. Diese wiederum unterteilte er in -­‐
-­‐
Anthropomorphe Affen, nämlich: Gorilla, Schimpanse, Orang und Gibbons (Menschenaffen) Nicht-­‐anthropomorphe Affen: Semnipithecus (Asiatische Languren, spez. Indien), Macacus (Taiwan) Darwin folgert nun aufgrund seiner Theorien, dass irgendein altes Glied der anthropomorphen Untergruppe der Catarrhinen der Stammvater des Menschen gewesen sei und diverse Merkmale mit ihm gemeinsam hatte, so das Fehlen des Schwanzes und der Gefässschwielen und die Ähnlichkeit der äusseren Erscheinung. Dazu bekam der Mensch aber weitere Modifikationen als Folge der Gehirnentwicklung und des aufrechten Ganges. Als gemeinsame Vorfahren von Altwelt-­‐ und Neuweltaffen vermutet Darwin einen ausgestorbenen Vertreter der Lemuriden, da diese in ihrer Anzahl von Prämolaren und Zähnen stark variieren. Dieser gemeinsame Vorfahre aller Simiaden sei aber mit keinem der heute lebenden Affen identisch oder ihm auch nur ähnlich. Das Gesetz der geografischen Verbreitung sagte Darwin, dass in jedem grossen Gebiet der Erde die lebenden Säugetiere nahe verwandt sind mit den ausgestorbenen Arten desselben Gebietes. Er folgert daraus, dass unsere ältesten Vorfahren so wie die Vorfahren der Schimpansen und Gorillas in Afrika gelebt haben müssen. Als Zeitpunkt der Abzweigung der Menschen von den Catarrhinen errechnete Darwin das Zeitalter des Eozäns. Er gibt natürlich zu, dass die verbindenden Glieder in dieser Klassifizierung weitgehend fehlen. Dies sei aber für alle Säugetiere der Fall, und die Gegenden, in denen solche Fossile gefunden werden könnten, seien geologisch überhaupt noch nicht erforscht. Darwin macht nun einen Versuch der Rekapitulierung des ganzen menschlichen Stammbaums: Die ältesten Stammformen waren Gruppen von Seetieren, den Larven und Aszidien ähnlich. Diese gaben einer Gruppe von Fischen den Ursprung, so niedrig organisiert wie der Lanzettfisch. Aus diesen müssen sich ganoide und den Lepidosiren ähnliche Fische entwickelt haben. Diese führen zu den Amphibien. Zu Darwins Zeit wusste man allerdings nicht, wie die Säugetiere, Vögel und Reptilien von den Amphibien und Fischen abzuleiten sind. Innerhalb der Säugetiere konnte er aber die einzelnen Schritte von den Monotremen zu den alten Marsupialiern und von diesen zu den plazentalen Säugetieren nachvollziehen. So könne man bis zu den Lemuriden aufsteigen. Hätte nur ein einziges Glied in dieser langen Kette nicht existiert, so wäre der Mensch nicht das geworden, was er ist. Er meint: Wir brauchen uns unserer Abstammung nicht zu schämen. Jedes Lebewesen, wie niedrig es auch sei, lässt uns ob seiner wunderbaren Struktur und Eigenschaften in Enthusiasmus geraten. Schliesslich widmet sich Darwin eingehend der Frage, ob die Menschenrassen als verschiedene Arten, Unterarten, Rassen, Unterrassen oder nur als Varietäten bezeichnet werden müssten. Seine zahlreichen Beobachtungen innerhalb der anatomischen und kulturellen Unterschiede, der Kreuzungs-­‐ und Fortpflanzungsfähigkeit, der Hautfarben und Sprachen geben ihm aber keine klaren, abschliessenden Antworten. Den Grund dazu sieht er darin, dass schon die Definition der „Art“ oder „Unterart“ nicht geklärt sei. Die Bestimmung von Ähnlichkeiten und Kreuzungsfähigkeiten zur Klassifizierung unterliegt der menschlichen Willkür, während die Realität der Natur eigentlich eher ein Kontinuum verschiedener Varietäten darstellt. 6.2 Ringvorlesung vom 26.11.09: Licht wird fallen auf den Ursprung des Menschen. Die Evolution des Menschen und seiner Kultur und Publikation NGZ: VAN SCHAIK, C., Auf der Suche nach den Wurzeln der Natur des Menschen. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2006), 151(1/2): 5-­‐12 Prof. Dr. Carel van Schaik, Zürich Vorlesungsnotizen und Literaturbericht, wb Prof. Dr. Carel van Schaik, Holländischer Primatenforscher und Buchautor, geb. 1953 Studium und Promotion (1979) Universität Utrecht, Arbeiten an der Princeton Universität. 1989 Assistenzprofessor an der Duke-­‐Universität in Durham 2004 Professor und Direktor des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich Da die Thematik von Prof. van Schaik‘s Ringvorlesung und seiner Publikation in der Vierteljahrschrift der NGZ sich überlappten und ergänzten, umfasst dieser Bericht sowohl die Vorlesungsnotizen wie den Literaturbericht. Van Schaik stützt sich auf den Darwin’schen Forschungsansatz und auf Darwins Werk von 1871, „The Descent of Man“. Die Divergenz von Populationen entsteht nach Darwin als Folge der Ansammlung von Adaptationen. Diese werden allmählich immer unabhängiger, bis die Paarung schliesslich unmöglich wird. Diese Prozesse laufen ständig ab, wodurch die Artenvielfalt entstanden ist. Dieses Prinzip ist für alle Arten gültig. Wenn der Ursprung einer Art untersucht werden soll, muss zuerst die Phylogenie, die Stammesgeschichte hergestellt und die nächsten Verwandten identifiziert werden. Danach muss die Verteilung der Merkmale innerhalb der Stammesverwandtschaft dokumentiert werden. Diese Merkmale können „ursprünglich“, also stammesgeschichtlich alt, oder „abgeleitet“, also Variationen der ursprünglichen Merkmale sein. Allgemeine Prinzipien der Adaptation von Merkmalen können z.T. mathematisch erklärt werden. Der Referent hat auf Java verschiedene Affenarten untersucht und gefunden, dass auf verschiedenen Inseln die Farbe, die Gruppengrösse, die Lebenserwartung, die Anzahl Kinder oder etwa auch die Anzahl der Männchen pro Gruppe stark variieren. Den Grund für diese abgeleiteten Merkmale eruierte er in der unterschiedlichen Anwesenheit von Raubtieren. Vor 15 Millionen Jahren gab es viel mehr verschiedene Menschenaffen als heute. Die abgeleiteten Merkmale wie Sprache, Kultur, Kunst, Wissenschaft, Religion etc. finden sich heute nur beim Menschen, was den Vergleich schwierig macht. Van Schaik zerlegt deshalb solch komplexe Merkmale in einzelne Komponenten und sucht dann nach Zusammenhängen zwischen ihnen und anderen Merkmalen. Eine Komponente der Kultur ist beispielsweise die soziale Übertragung von Informationen, eine Verhaltensweise, die nicht direkt genetisch verankert, sondern sozial erlernt ist. Sozial deshalb, weil der Zusammenhalt der Gruppe auf Symbolen basiert wie Riten, Gebräuche oder Moral. Die Zusammengehörigkeit ist deshalb eine ethnische und beinhaltet Technologien, Erfindungen und Wissen. Das Leben wird dadurch angenehmer. Menschenaffen verwenden keine Symbole, sondern zeigen kanalisierte Verhaltensweisen, die mit Populationsunterschieden zusammen hängen. Sie erlernen aber ebenfalls Techniken, etwa zum Essen von Samen, und verwenden Werkzeuge, deren Gebrauch nicht vererbt ist. Dies bestätigt sich darin, dass geografische Barrieren die Ausbreitung von Werkzeuggebrauch stoppen. Dass sie keine normativen Symbole für das Gemeinschaftsleben verwenden führt van Schaik darauf zurück, dass nur die Mütter für die Aufzucht der Jungen zuständig sind. Beim Mensch hingegen werden die Kinder gemeinsam aufgezogen, die Väter versorgen die Kinder und die Frauen und die Grossmütter besorgen ebenfalls Nahrung und betreuen Kinder. Ihre frühe Menopause hilft damit, innerhalb der Gruppe eine höhere Kinderzahl zu ermöglichen. Man spricht von „cooporative breeding“, woraus wiederum die „Prosozialität“ resultiert, eine spontane altruistische Nettheit bzw. Aktionen, welche Andere bevorteilen. Solche sind auch bei einigen Affenarten, z.B. den Krallenaffen bekannt. Sie haben ihrerseits eine höhere Intelligenz durch soziales Lernen und Koordination zur Folge. All das zeigte sich in der Evolutionsgeschichte der Hominiden in stets grösser werdenden Gehirnen (in Bezug zur Körpergrösse). Die Sprache verbesserte nochmals die soziale Übertragung und das Teilen und Spenden von Informationen. Übrigens werden auch Vögel durch das Spenden von Informationen schlauer. Die Fähigkeit zu Innovationen und Problemlösungen nahmen in kooperativer Arbeitsteilung zu und ermöglichten kumulatives Lernen als Aufbauen auf bereits Bekanntem. Durch eine normative Symbolkultur wurde die Gemeinschaft zusammen gehalten und erlernte kooperatives Jagen, Sammeln und Teilen. Die Kognition wurde im Dienst dieser Fähigkeiten gesteigert und die soziale Organisation wuchs als Kooperation unter Nicht-­‐Verwandten Individuen. Cooporative breeding bedingte eine langfristige normative Paarbindung und die Privatisierung des Geschlechtsverkehrs. Diese Entwicklung wird auch als kulturelle Evolution bezeichnet und es wird postuliert, dass diese beim Menschen die biologische Evolution abgelöst habe. Anderseits zeigen molekularbiologische Studien, dass sich der Mensch erst relativ spät von den Menschenaffen abgespaltet hat. Biologisch gesehen seien wir grosse afrikanische Menschenaffen, betont van Schaik. Dies zeige sich auch in physiologischen Ähnlichkeiten und in der Anfälligkeit auf ähnliche Erkrankungen. Die Forschung versuche deshalb sowohl anhand von archäologischen Fossilien den Verlauf der Evolution zu dokumentieren, als auch die allmählichen Veränderungen mit den allgemeinen evolutionären Modellen zu erklären. Einerseits sind wir Teil der Wirbeltiere, Säugetiere und Primaten mit ihren ursprünglichen Merkmalen, anderseits haben wir die (oben beschriebenen) abgeleiteten, einmaligen Merkmale, die uns das Verständnis unserer Natur zeigen könnten. Gerade etwa das Verhältnis von Egoismus zu Altruismus sei ein Gemütszustand, der mit Vergleichen mit nichtmenschlichen Primaten weiter erforscht werden müsse. Einem Aspekt der Natur, der unsere Abstammung von Affen reflektiert, widmete sich van Schaik besonders, nämlich dem Infantizid, der Kindstötung, die sich speziell bei gewissen Primaten findet. Der Ursprung dazu liegt in der Fortpflanzungsbiologie: Bei den meisten Säugetieren ist die Stillzeit kürzer als die Tragzeit und ein Weibchen kann kurz nach der Geburt wieder empfangen und gleichzeitig noch säugen. Bei Arten mit einer längeren Lebensspanne, einer langsameren Lebensentwicklung und tieferen Geburtenraten dauert die Stillzeit oft länger als die Tragzeit. Theoretisch könnten in diesem Fall zwei Generationen von Jungen das Stillen beanspruchen und sich konkurrenzieren, was die Mutter überfordern würde. Es hat sich bei diesen, und nur bei diesen Arten deshalb eine „post partum Amenorrhöe“ evoluiert, nämlich ein Ausbleiben der Menstruation nach der Geburt. Dadurch entsteht aber das neue Problem, dass Männchen den Anreiz erhalten, fremde Nachkommen zu töten, um möglichst schnell eigenen Nachwuchs zu zeugen. Dies kommt als Infantizid tatsächlich bei 40 Primatenarten vor, wenn sozial dominante Männchen nicht die Väter dieser Kinder sind. Van Schaik weist darauf hin, dass nach Untersuchungen bei Menschen Männer oft äusserst brutal mit Kindern in ihren Familien umgehen, wenn diese nicht ihre eigenen Kinder sind. Sie verhalten sich demnach so, wie man es von Primaten erwarten würde, deren Stillzeit länger als die Tragzeit ist. Dies ist ausser bei Primaten auch der Fall bei Landraubtieren, Zahnwalen, Unpaarhufern und Nagetieren der Alten Welt. Da sich bei fast allen Tierarten Verhaltensweisen evoluiert haben, die den Nachwuchs schützen, kann angenommen werden, dass Infantizid ein massiver Selektionsdruck für die Entwicklung von Abwehrmassnahmen, bzw. Schutzmechanismen für die Jungen war. Solche findet man sowohl beim Menschen wie bei nichtmenschlichen Primaten. Bei Javaneraffen hatte van Schaik in seinen Studien beobachtet, dass Männchen ihre Jungen umso besser beschützten und auch freundschaftliche Beziehungen zu den Müttern pflegten, je mehr Junge sie bereits gezeugt hatten. Ganzjährige Beziehungen zwischen den Eltern sind für Säugetiere nicht typisch, kommen aber bei Primaten und Affen vor, welche andere Gruppen aus ihrem Habitat verjagen und deren Kinder dabei töten. Ein weiterer Schutzmechanismus besteht bei Javaneraffen darin, dass Weibchen mehreren Männchen eine hohe Vaterschaftswahrscheinlichkeit suggerieren, indem sie sich mit ihnen paaren. Falls diese Männchen dominant werden, töten sie den Nachwuchs nicht, da es ihr eigener sein könnte. Gerade das Paaren während der Tragzeit, während der ja keine Empfängnis möglich ist, kann nur den Zweck haben, den Männchen eine hohe Vaterschaftswahrscheinlichkeit vorzutäuschen. Van Schaik fand denn auch tatsächlich Paaren während der Tragzeit nur bei denjenigen Primaten-­‐ und Säugetierarten, bei denen Infantizid üblich ist. Wenn beim Menschen Männer und Frauen langfristig zusammenleben und sich auch während der Trag-­‐ und Stillzeit paaren, hängt das einfach damit zusammen, dass wir Primaten sind und damit der Möglichkeit des Infantizids ausgesetzt sind. Van Schaik ist übrigens der Meinung, dass wir uns bei einem Grossteil unserer Verhaltensweisen über ihren Zweck nicht bewusst sind, was bei Tieren natürlich noch stärker der Fall sei. Andere kulturelle und für den Menschen einzigartige Merkmale wie Technologie, Kunst oder Moral sind aber noch schwieriger zu untersuchen, weil die Übergangsglieder nicht mehr vorhanden sind. Und doch müssen nach Darwin auch diese Eigenschaften in langsamer, allmählicher Entwicklung entstanden sein. Es müssten zumindest einfachere Zustände dieser Merkmale bei Säugetieren und Primaten zu finden sein, um ihre heutigen Ausprägungen rekonstruieren zu können. Wie bereits erwähnt konzentriert sich Van Schaik dabei auf das Merkmal „Kultur“, weil dieses einen sehr grossen Einfluss auf unser Verhalten hat. Er zeigt, dass Anfänge der Übermittlung sozialer Innovationen bei Primaten nicht an einem bestimmten Ort durch unabhängige Individuen erfunden werden, sondern populationsspezifische, geographische Variationen erzeugen. Van Schaik hat in einer Population von Orang-­‐Utans eines küstennahen Sumpfes in Sumatra zwei verschiedene Arten von Werkzeuggebrauch gefunden. Zum Einen wird ein Stöckchen benutzt, um an den Honiginhalt von Baumhöhlen zu gelangen. Die andere Technik verwendet Stöckchen, um die nahrhaften Samen der Neesia-­‐Frucht herauszulösen, welche von Stacheln geschützt und mit den Fingern deshalb nicht erreichbar sind. Sind nun nicht alle Tiere gleich schlau, oder bestehen ökologische Unterschiede im Habitat oder sind die Unterschiede durch Kultur entstanden? Die Neesia-­‐Frucht ist in Sumatra-­‐Borneo überall verbreitet, womit ökologische Unterschiede wegfallen. Sie wird von den einen Orang-­‐Utans mit Gewalt aufgebrochen, was allerdings nur die kräftigen Männchen schaffen, die anderen verwenden das Stöckchen. Die Verbreitung der beiden Techniken wird offenbar durch geografische Barrieren wie breite Flüsse abgegrenzt. Zudem verbringen die Tiere, welche das Werkzeug gebrauchen, wesentlich mehr gemeinsame Zeit mit den Neesia-­‐Früchten in den Bäumen. Diese Technik muss deshalb durch Beobachten anderer Tiere erlernt worden sein. Orang-­‐Utan-­‐Experten haben 24 Verhaltensweisen der Nahrungsbeschaffung, der Nestbildung und von Kommunikationssignalen gefunden, welche nur durch soziales Erlernen erklärt werden können. Je mehr gemeinsame Zeit die Tiere miteinander verbringen, desto grösser ist ihr Repertoire an Nahrungsbeschaffungstechniken. Wachsen die Jungen nur mit ihrer Mutter auf, erlernen sie nur wenige Varianten an intellektuellen Fähigkeiten, wo hingegen die sozial aufgewachsenen Jungen über wesentlich mehr Futterbeschaffungstechniken verfügen. Da solche Fähigkeiten also nicht durch die Ökologie bestimmt, sondern sozial erlernt werden, darf man sie als „Kultur“ bezeichnen. Sehr ähnliche Verhältnisse wurden auch bei Schimpansen und Bonobos gefunden, was nahelegt, dass das Fundament für unsere aussergewöhnlichen Fähigkeiten viel früher angelegt wurde, als bisher angenommen, nämlich zur Zeit der frühen grossen Menschenaffen. Van Schaik kann mit dieser Erkenntnis nun die Unterschiede der biologischen Anthropologie besser aufzeichnen: Während die grossen Menschenaffen jede ihrer kulturellen Fähigkeiten wieder neu erfinden können, hat sich beim Menschen ein sogenannter Sperr-­‐Effekt ergeben, d.h. durch die lange Zeit der Anhäufung von Wissen ist nur noch ein kumuliertes Lernen möglich, welches auf bestehenden Fähigkeiten aufbaut. Zum Zweiten verfügen Menschen über Symbole als Varianten von Signalen, welche eine willkürliche, geographisch variable Bedeutung angenommen haben, und über Institutionen, nämlich Gruppennormen, welche auf solchen Symbolen basieren. Die gezeigten Unterschiede in der gemeinsam verbrachten Zeit der Tiere derselben Art lassen den Schluss zu, dass die Intelligenzleistung ein Zusammenschluss von angeborenem Potential wie auch von Inputs durch individuelles und soziales Lernen ist. Die Fähigkeit, durch Beobachtung von Gruppenmitgliedern zu lernen, muss aber vorhanden sein, damit aus dem Gruppenleben Kultur entstehen kann. Die Evolution von angeborenen intellektuellen Fähigkeiten ist deshalb am ehesten bei Arten zu finden, welche die Veranlagung zu sozialem Lernen, also Kultur, aufweisen. Dies kann als Koevolution von Kultur und Intelligenz bezeichnet werden und wird auch bei anderen Säugetierlinien gefunden. Damit könnten wir wiederum Gesetzmässigkeiten finden und Schlüssel-­‐Variablen, welche die Geschwindigkeit des evolutionären Wandels beeinflussen. Der darwin‘sche Ansatz kann also nach van Schaik erfolgreich angewandt werden, um unsere scheinbar so einzigartigen Merkmale zu erklären. 6.3 Ringvorlesung vom 26.11.09: Die Evolution der Kunst Prof. Dr. Thomas Junker, Tübingen Vorlesungsnotizen, wb Prof. Dr. rer.nat. Thomas Junker, geb. 1957 Studium der Pharmazie in Freiburg 1989: Promotion in Marburg 1992-­‐95 : Darwin Correspondence Project an der Harvard Universität 2001: Habilitation für Geschichte und Naturwissenschaften 2006: apl. Professor an der Universität Tübingen Der Referent wies eingangs darauf hin, dass Darwin mit der Nützlichkeitstheorie alle geistigen Fähigkeiten als biologisch nützliche Anpassung zu erklären versuchte. Jede Einzelheit im Lebewesen hat einen Nutzen für die Nachkommen und entsteht durch natürliche Auslese. Als weiteres Prinzip beschrieb Darwin die sexuelle Auslese. Innerhalb der Geschlechter gibt es einen direkten Kampf unter den Individuen und die Auswahl des geeigneten Partners erfolgt durch das andere Geschlecht. Der auslesende Partner verbreitet so seine eigenen Gene. Junker stellte sich die Frage, wie sich geistige Fähigkeiten und Gefühle als biologisch nützliche Anpassung erklären lassen. Seine Antwort lautet: Durch die sexuelle Auslese. Wenn dem so ist, dann kann auch die Kunst als Anpassung an die sexuelle Auslese verstanden werden. Die ältesten Findlinge von Kunstgegenständen weisen ein Alter von gut 36 000 Jahren auf. Der Referent ist aber der Ansicht, dass Kunst schon vor etwa 200 000 Jahren, also noch vor der Auswanderung des H. sapiens aus Afrika in verschiedene Erdteile entstand, bzw. als Einzelfall erfunden wurde. Den Nutzen der Kunst sieht er in einer „Interesse weckenden Form“, in Luxus, aber auch in einem interesselosen Wohlgefallen und ästhetischen Vergnügen. Dies alles steht im Dienst der Gemeinschaftsbildung und ist zugleich ein Werkzeug zur Verständigung über unbewusste Wünsche und Ziele. Ferner bekam Kunst einen symbolischen Wert, eine spezielle Bedeutung in der Kommunikation des Unbewussten und Magischen und hat keinen reellen Gebrauchswert. Das Kunstwerk signalisiert die genetische Qualität seines Besitzers oder des Künstlers selbst. Es stellt eine Erweiterung des „Ich“ dar zum Zweck der sexuellen Auswahl. Zum „Erweiterten Ich“ gehören auch Kleidung, Wohnung, Schmuck, Auto etc. Die Biologie unserer Spezies zwingt uns, alles was man unserem „Ich“ zuordnet, ästhetisch aufzuwerten. Dabei hat es sich als entscheidend evoluiert, dass die Signale echt sind. Billige, kostenlose oder kopierbare Qualitätssignale lassen sich missbrauchen und erreichen das Ziel der Auswahl durch das andere Geschlecht nicht. Das Signal muss schwierig zu produzieren sein, bzw. muss ein Original darstellen. Die Art der interesseweckenden Form und der Schönheit wird dann durch die sexuelle Auslese bestimmt und wird zur Norm. Die Sprache der Gefühle und der Sympathie ist ebenfalls mit Schönheit und Luxus verbunden, wie etwa ein Liebesgedicht. Kunst dient in der symbolischen Bedeutung aber auch dem Gedankenaustausch und der Magie. Das gemeinschaftliche Leben des Homo sapiens hatte zur Folge, dass der Kampf um die Reproduktion in die Gruppe hineingetragen wurde. Die Signale der sexuellen Auslese sind deshalb anfällig auf Fälschungen. Eine weitere Folge des Gemeinschaftslebens war die Notwendigkeit der Identität des Individuums. Die ästhetische Kommunikation über Gefühle und Wünsche machte dies möglich. Dadurch wurde die Kooperation und Sympathie noch intensiver als bei anderen Spezies. Die Wünsche dürfen bewusst werden und sollen die Gruppe repräsentieren. Wenn dies dem Kunstwerk in Form und Inhalt gelingt, wird es als „Kunst“ anerkannt. 6.4 SCHMID, P., LE TENSORER, J.M., Out of Africa. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009), 154(3/4): 63-­‐67. Institut für prähistorische und naturwissenschaftliche Archäologie der Universität Basel Literaturbericht, wb Die Autoren dieser Arbeit bestätigen anhand der heutigen Fossilien Funde die obige Ansicht Darwins, dass der Mensch aus Afrika stammen müsse. Allerdings habe sich die Ausbreitung der Hominiden als wesentlich komplexer erwiesen, als man 1871 erahnen konnte. Aufgrund einer aussergewöhnlichen archäologischen Fundsequenz in der syrischen Wüste postuliere man heute drei unterschiedliche Ausbreitungswellen. Die frühen Hominiden hatten ein grösseres Gehirn, welches mehr Energie und Nährstoffe in Form von Eiweissen und Fetten benötigte. So seien sie zu nomadisierenden Jägern geworden und hätten schon vor 2,6 Millionen Jahren einfache Steinwerkzeuge hinterlassen. Der aufrechte Gang hätte eine variable Atemfrequenz und mit der Brustkorbatmung eine bessere Kühlung ermöglicht. Dazu hätten auch die Reduktion des Haarkleides und die vermehrte Zahl der Schweissdrüsen beigetragen. Die Manipulationsmöglichkeit zum Waffengebrauch machte die Frühmenschen vor 1,6 bis 0,7 Millionen Jahren zu einem ernsthaften Konkurrenten der Raubtiere. „OUT OF AFRICA 1“ Damit bezeichnen die Autoren eine erste Ausbreitungswelle aus Ostafrika, womit die frühen Hominiden, aber auch andere Säugetiere, vor mehr als 1,5 Millionen Jahren die nördlichen Kontinente erreichten. Seit dem frühen Miozän bestand ein Kontakt der beiden Kontinentalplatten in Form von Korridoren durch die afro-­‐arabische Region. Der Weg durch die Levante war allerdings Klimaveränderungen, Verschiebungen und Trockenheiten unterworfen und damit nicht konstant begehbar. Die Autoren erwähnen die ältesten unbestrittenen Funde von Menschenresten ausserhalb Afrikas aus Dmasini (Georgien), die auf ein Alter von 1,8 bis 1,6 Millionen Jahren datiert werden. Daneben gibt es aus demselben Zeitraum Funde von Kulturresten, nämlich in Ain Hanech (Marokko), Majunangou (China), Swartkrans (Südafrika) und Riwat (Arabische Emirate). „OUT OF AFRICA 2“ Vor 600‘000 Jahren begann bei der Gattung Homo die sog. Acheuléen-­‐Kultur, welche nach den Acheuléen-­‐Faustkeilen benannt ist. Aus dieser Gattung entstanden drei Entwicklungslinien, Homo sapiens in Afrika, Homo neanderthalensis in Europa und Homo erectus im Fernen Osten. Die Unterschiede waren sowohl morphologischer wie genetischer Art. Der europäische H. neanderthalensis ist offenbar am besten dokumentiert und die Autoren weisen auf seine grosse Anpassungsfähigkeit im glazialen Klima zwischen 190‘000 und 130‘000 Jahren vor heute hin. Die spärlichen Funde von H. sapiens in Afrika hätten keine Übereinstimmung mit H. neanderthalensis gezeigt. Die frühen modernen Menschen bekamen zwischen 250‘000 und 50‘000 Jahren vor heute den für sie typischen Schädel und den grazilen Körperbau. Aus dem fernen Osten kennen die Autoren nur spärliche Hinweise auf zwei unterschiedliche Verläufe: In Südostasien vermuten sie den javanischen H. erectus zwischen 1,6 Millionen und 70‘000 Jahren vor heute. In China hingegen habe eine Entwicklung zwischen 1 Million und etwa 150‘000 Jahren zu einer archaischen, afro-­‐europäischen Art des H. heidelbergensis geführt, welcher zwischen 600‘000 und 400‘000 Jahren als gemeinsamer Vorfahre von H. neanderthalensis und H. sapiens betrachtet werde, und welcher die Faustkeil-­‐Kultur (Acheuléen) von Afrika nach Europa gebracht habe. Die asiatischen Regionen könnten deshalb auch nicht so stark, wie man früher meinte, von westlichen Kulturen abgetrennt werden. „OUT OF AFRICA 3“ Die Autoren nehmen an, dass der anatomisch moderne Mensch vor 100‘000 Jahren zwar an Afrika gebunden, aber doch schon im Nahen Osten angekommen war. Vor 50‘000 Jahren sei er in den Nordkontinenten erschienen. Funde zeigten jedoch, dass er vor 80‘000 Jahren im Nahen Osten sogar wieder durch den Neanderthaler ersetzt worden sei. Die Unterscheidung sei jedoch schwierig, weil der Körperbau zwar modern, das Verhalten aber von demjenigen des Neanderthalers nicht unterscheid bar sei. Zudem liege das Alter dieser Funde im Grenzbereich der Radiokarbon Datierung und die Bestrahlung der Sedimente sei fundortspezifisch verschieden. Auch seien die Fundorte selten und kaum mit einer ausreichen langen Chronologie verbunden, um das Ausbreitungsmuster von H. sapiens und H. neanderthalensis zu bestimmen. Schliesslich beschreiben die Autoren noch die Funde von Hummal in Zentralsyrien, einer 14 m tiefen Freilandfundstelle in einer steppenartigen Wüste. Die Quelle sei immer wieder von Nomaden und Jägern als Basislager benutzt worden. Die Abfolge von Werkzeugen wie Faustkeile (Pebble, Acheuléen), Klingen (Humalian) und Spitzen (Mousterien) deute zusammen mit Knochenfunden auf eine zunehmende Jagd auf grosse Herdentiere wie Kamel-­‐ und Pferdeartige hin. 6.5 ZOLLIKOFER, CH.P.E., PONCE DE LEON, M., Paläoanthropologie : neue Methoden – neue Erkenntnisse. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004) 149/2-­‐3:39-­‐50 ZOLLIKOFER, CH.P.E., PONCE DE LEON, M., Facelifting für den ältesten Hominiden. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2005), 150/1-­‐2:10 ZOLLIKOFER, CH.P.E., PONCE DE LEON, M., « Generationenvertrag » im Spätpliozän. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2005),150/1-­‐2:18 PD Dr. Christoph Zollikofer und Dr. Marcia Ponce de Leon, Anthropologisches Institut der Universität Zürich Literaturbericht, wb Die erstgenannte Arbeit der beiden Autoren bildet zusammen mit ihren beiden Aufsätzen zum Facelifting und zum Generationenvertrag eine thematische Einheit. Sie werden deshalb im Folgenden zusammenfassend kommentiert. Die Autoren befassen sich mit den neueren Fossilfunden von Hominiden in Dmasini, Georgien, und im Tschad. Mit neuen Methoden der Analyse und der Forschungsansätze testen sie die evolutionären Hypothesen einerseits der Abspaltung der Humanoiden von den Menschenaffen und anderseits der ersten Auswanderung von Hominiden aus Afrika. Sie verweisen auf das interne Archiv der Lebewesen und Menschen, die DNA, und zwar sowohl die Kern-­‐DNA, wie die Mitochondrien-­‐DNA und die DNA des Y-­‐Chromosoms. Die Mitochondrien-­‐DNA liegt in jeder Zelle in vielen tausend Kopien vor, die anderen nur in je zwei (siehe dazu Weiteres im Kapitel Gene –Genome -­‐ Genetik). Die Molekularbiologie könne heute mit Hilfe der DNA-­‐Analyse ein recht gutes Bild der letzten 100‘000 Jahre der Gattung Homo erstellen. Nach gut 50‘000 Jahren ist die DNA aber soweit desintegriert, dass sie nicht mehr analysierbar ist. Für weiter zurückliegende Zeiträume ist man daher immer noch auf Funde von fossilierten Skelettresten und deren morphologische Vergleichsanalysen angewiesen. Eine weitere Möglichkeit liefert die Zuordnung von fossilen Werkzeugen, Kulturgegenständen und Nahrungsresten zu Entwicklungsstufen und Verhaltensmustern der menschlichen Vorfahren. Angesichts der bisher spärlichen Funde von Hominiden kann jeder Neufund die Ansichten über die menschliche Evolution wesentlich verändern. Die Funde in Georgien und im Tschad haben die Autoren ihren neuen Methoden unterzogen, um morphologische Merkmale zu vergleichen und zu interpretieren, und um anhand kleiner Unterschiede zwischen Individuen das Wirken der natürlichen Selektion zu zeigen. Es wird darauf verwiesen, dass die Einteilung in ein phylogenetisches Verzweigungsschema immer hypothetisch und abstrahiert sei, da sie nicht auf individuellen Vorfahr – Nachfahr-­‐Beziehungen basieren könne. Zudem kann das Divergieren der morphologischen Merkmale durch Adaptationen an gleiche Umweltbedingungen oder als Modifikationen im Leben des Individuums verursacht sein. Die letzteren sind im juvenilen Zustand bedeutsamer, da das Skelett sich in Entwicklung befindet. Es gilt dann, die beiden Zeitmassstäbe zu trennen, also die Evolution von der Individualentwicklung. Bei der Hälfte aller Fossilfunde von Hominiden handelt es sich offenbar um juvenile Individuen. Erst mit den computerunterstützten Rekonstruktionsmethoden wurde es möglich, Analysen vorzunehmen, welche diese Begebenheiten berücksichtigen. Seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen und der Entwicklung von Computertomographie (CT) wurden Fossilien stets solchen Diagnoseverfahren unterzogen. Die Autoren haben nun eine Technik der Kombination von CT, Magnetresonanzimaging MRI und Computergraphik angewandt, um Fossilien nichtinvasiv zu analysieren, zu visualisieren und in eine virtuelle Realität zu transformieren. Damit können Gesteins-­‐ und Sedimentreste mittels eines elektronischen Meissels virtuell entfernt werden, ohne das Fossil zu beschädigen. Nicht nur Aussen-­‐ sondern auch Innenflächen können dargestellt werden und Dutzende von Einzelfragmenten können zu einem dreidimensionalen Puzzle zusammengesetzt werden. Fehlende Skeletteile können oft spiegelsymmetrisch an die richtige Stelle hinein kopiert werden. Deformationen der Fossilien können computer-­‐unterstützt quantitativ-­‐geometrisch kompensiert werden, indem man reale Deformationen durchspielt und rückwärts wieder ablaufen lässt. Um nicht irgendein Wunschdenken in das Fossil hineinzuinterpretieren, werden nur anatomische Kriterien der Gattung Homo zugrunde gelegt. Mittels Stereolithographie, einem computergestützten Modellbauverfahren, können die virtuellen Fossilien in physische Realität zurück gebracht und der Paläoanthropologie als „Abguss“ zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres Problem schildern die Autoren mit dem Vergleich von Schädeln von juvenilen und adulten Individuen derselben Art. Die Frage, was sich im Entwicklungsprogramm während der Evolution verändert hat, und wie artspezifische Morphologie zustande kommt, können die Autoren mit Hilfe der „geometrischen Morphometrie“ heute besser beantworten. Mit dem Konzept eines graphischen Deformationsgitters können verschiedene Formen von Organismen durch einfache Verformung ineinander übergeführt werden. Diese Deformationsgitter stehen heute auf mathematischer Grundlage, können aber immer nur relativ zueinander ausgewertet werden. Mit dieser Methode haben die Autoren nun speziell die Dichotomie Mensch-­‐Neandertaler untersucht, da die Neandertaler unsere nächsten fossilen Verwandten waren und erst vor kurzer Zeit ausgestorben sind. Es hat sich gezeigt, dass Mensch und Neandertaler morphologisch klar getrennte Gruppen sind und dass die Unterschiede unabhängig sind vom Alter der Individuen. Es werden genetische Unterschiede im vorgeburtlichen Entwicklungsprogramm vermutet, welche so grundlegender Natur sind, dass Neandertaler und Mensch als zwei verschiedene Arten bezeichnet werden müssen. Man sieht in Ihnen die beiden modernen Spezies der Gattung Homo und die bisher letzten Vertreter der Hominiden. Sie haben bis vor 30‘000 Jahren zusammen koexistiert, und waren sich in Kultur und Verhalten ähnlich, woraus auf einen regen Austausch von Entwicklungen und kultureller Vielfalt geschlossen wird. Gelegentliche biologische Vermischung von Genen können stattgefunden haben, blieben jedoch ohne feststellbare populations-­‐biologische Folgen. Die Fundstelle in Dmasini, Georgien, war für Zollikofer und Ponce de Leon ein Glücksfall und gilt heute als die bedeutendste Hominiden Fundstelle, obwohl sie nur die Grösse eines Schrebergartens hat. 1991 wurde ein Hominiden Unterkiefer geborgen, und ab 1999 wurden vier vollständig erhaltene Schädel geborgen, vier Unterkiefer und weitere Skelettanteile wie Wirbel, Langknochen sowie eine Vielzahl von Steinwerkzeugen. Dazu kommt, dass die vulkanischen Sedimente und die reichhaltige Gross-­‐ und Kleinsäugerfauna die genaue biostratigraphische Datierung auf das Ende des Pliozäns vor ca. 1,7 Millionen Jahren zulässt. Zur Überraschung der Forscher erwiesen sich die Hirnvolumen dieser Hominiden mit 600 – 800 ccm als sehr klein und die Werkzeuge primitiv (Oldowan-­‐Kultur). Diese Dmanisi Hominiden können deshalb nicht eine bewusste, kognitiv-­‐kulturelle Auswanderung aus Afrika durchgeführt haben, so wie man es dem Homo erectus mit einem Hirn von 1000 ccm vor 1 Million Jahren zutraut. Gerade die Anwesenheit einer afrikanischen Fauna lässt die Autoren vermuten, dass es sich vielmehr um die Diffusion eines gesamten Ökosystems handelte, bei welcher die Hominiden Mitläufer waren. Da alle gefundenen Individuen ein und derselben Population entstammen, und in kurzer Zeit in vulkanische Asche eingebettet worden waren, dürfen ihre Variationen als Beweis für eine evolutionsbiologische Kontinuität betrachtet werden. Die bisherige Unterteilung der afrikanischen Vertreter der Gattung Homo in H. habilis, H. ergaster, H. rudolfensisund und H. erectus erscheint den Autoren deshalb nicht mehr so sinnvoll. Ein besonders interessantes Fossil aus Dmasini ist der Schädel D3444, welcher 2002 gefunden wurde, wobei ein Jahr später auch der dazu passende Unterkiefer zum Vorschein kam. Beide Kieferbögen waren bis auf einen Schneidezahn zahnlos. Das Individuum muss am Zustand der zahnlosen Kieferkämme gemessen längere Zeit ohne Zähne gelebt und überlebt haben. Bei freilebenden Menschenaffen ist Zahnlosigkeit bekanntlich ein grosses gesundheitliches Problem und eine markante Ernährungsbehinderung. Im spätpliozänen Dmanisi herrschten zudem rauhe Klima-­‐ und Ernährungsbedingungen. Die Fundstelle enthält auch Werkzeuge und Knochen, die auf ein systematisches Zerlegen von grossen Säugetieren hinweisen. Da Dmanisi-­‐Menschen kaum als Einzelgänger überleben konnten, gehen die Autoren davon aus, dass typisch menschliche Verhaltensweisen wie das Teilen von Nahrung und Ressourcen sowie die Unterstützung in der Gruppe zusammen mit der Weitergabe von Errungenschaften bereits bestanden. Es könnte ein Überlebensvorteil gewesen sein, betagte und behinderte Individuen „durchzufuttern“, um von ihrer Erfahrung profitieren zu können. Der Generationenvertrag dürfte also gut 1,7 Millionen Jahre alt sein, meinen Zollikofer und Ponce de Leon. Auch zum Ursprung der Hominiden selbst berichten die Autoren über neue Funde und damit wiederum über neue Theorien. Man hatte bis dahin die Trennung der Hominiden von den Schimpansen in Ostafrika vor gut 6 Millionen Jahren angesiedelt, ohne dies jedoch mit Fossilien belegen zu können. Mit dem Fund eines Australopithecinen im Jahr 1995 und eines Schädels im Jahr 2001 in der südlichen Sahara, 2500 km westlich des ostafrikanischen Grabenbruchs, wurden Belege für Hominiden vor 7 Millionen Jahren geliefert. Es muss dort am Rand des damals ausgedehnten Tschadsees eine evolutive Radiation verschiedener Tier-­‐ und Pflanzengruppen stattgefunden haben. Diese Funde wurden einer Gattung und Art zugeordnet: Sahelanthropus tschadensis. Der 2001 gefundene Schädel wurde mittels der oben geschilderten Methoden einem „Facelifting“ unterzogen. Mit computertomographischen Daten der EMPA wurde sein 3D-­‐Bild in 100 Einzeltele zerlegt und nach geometrischen und biologischen Kriterien wieder virtuell zusammengesetzt. So konnten die geologischen Ereignisse der letzten 7 Millionen Jahre virtuell zurückgespult und der Schädel in einen Neuzustand versetzt werden. Er erhielt den Taufnamen „Toumai“ (Hoffnung auf Leben, Goran-­‐Sprache) und ist für die Wissenschaft immer noch eines der berühmtesten menschlichen Fossile. Sahelanthropus ging wahrscheinlich bereits aufrecht, aber es ist nicht klar, ob er Vorfahre aller späteren Hominiden war, oder ob er als Seitenzweig wieder ausgestorben ist. Falls das Erstere zutrifft, hätte sich der Schimpanse seit 7 Millionen Jahren ebenso von seinen Vorfahren evolutiv entfernt, wie wir uns von den unseren. Toumai wird aber auch deshalb eine grosse Bedeutung zugesprochen, weil er mit dem aufrechten Gang den „Rubikon“ von den Menschenaffen zu den Hominiden überschritten hatte, hingegen mit der Hirngrösse noch zu den Schimpansen gehörte. 6.6 SARASIN, PH., Charles Darwin, Historiker. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009), 154(3/4): 53-­‐54. Prof. Philipp Sarasin, Historisches Seminar der Universität Zürich Literaturbericht, wb Der Autor hebt hervor, dass Darwins Evolutionslehre heute alle Wissensgebiete berühre, weil Evolution immer Adaptation, Anpassung an gegebene und sich verändernde natürliche Verhältnisse bedeute. Er wehrt sich deshalb gegen die heute oft vorgebrachte Vorstellung, das menschliche Verhalten, also die Ausbildung der mentalen und neuronalen Strukturen, sei im Pleistozän erfolgt und könne sich als Grundtypus von Sammlern und Jägern den kulturellen Entwicklungen der Moderne nicht anpassen. Diese Meinung postuliere, dass Biologie eigentlich unwandelbar sei, und dass Kultur schneller voranschreite als die Evolution dies mitmachen könne. Dem gegenüber vertritt Sarasin die Ansicht, schon Darwin habe eine viel optimistischere Sichtweise der Zivilisation gehabt und habe gerade in seinem Werk „The descent of Man“ eine Historizität als permanente Wandelbarkeit gesehen. Er habe einen kulturellen evolutionären Prozess von der frühen Menschheit bis zu den zivilisierten Europäern postuliert. Dies war aber keine rassistische Sicht, betont Sarasin, sondern eine evolutionäre. Die Evolution des Menschen hat nicht einfach bei der Steinzeit aufgehört, sondern läuft bis heute stetig vorwärts. Darwin hat keinen Unterschied zwischen biologischer und kultureller Evolution gemacht, sondern ist davon ausgegangen, dass auch der Mensch sich laufend anpassen könne. Im Weiteren entspreche die Evolutionslehre auch dem heutigen historischen Denken, weil sie nicht einem physikalischen Determinismus gehorche. Das heisst, die Abfolge der Anpassungen und Abänderungen können nicht zum Voraus berechnet werden, sondern sie sind von zufälligen Veränderungen der Umwelt abhängig und können nur im Nachhinein mit dem Gesetz der besseren Fortpflanzung erklärt werden. Dies bedeutet auch, dass die Meinung nicht haltbar ist, der Verlauf evolutionärer Prozesse sei in einem mutmasslichen Ausgangspunkt schon angelegt. Es gibt keine formalisierbare Logik dieses Prozesses. Dies steht in einem Gegensatz zur Embryologie, die oft, etwa von Ernst Haeckel, zum Modell für Evolutionsprozesse erhoben worden sei. Darwin hingegen betonte immer wieder die Diskontinuitäten evolutionärer Pfade: Sie können eine Zeit lang stabil bleiben und dann unter veränderten Bedingungen sehr schnell zu Modifikationen führen. Sarasin verweist zur Unterstützung dieser Aussage auf die heutigen Untersuchungen an Galapagosfinken, welche in Abhängigkeit von Klimaschwankungen unvorhersagbare Veränderungen der Schnabelgrösse zeigen. Er sieht darin eine klare Kongruenz mit der modernen Vorstellung von Geschichte als einem ereignisoffenen kontingenten Geschehen. 6.7 Zur Auswanderung der menschlichen Gene aus Afrika, In: Geschichten vom Ursprung des Lebens, [55] Richard Dawkins, 2009 Buchbericht, wb Dawkins liefert zwar sehr gute Beschreibungen der anthropomorphen Affen. Für dieses Kapitel wird es aber erst interessant bei den Vorfahren der Gattung Homo aus der Zeit von 2,5 Millionen Jahren vor heute. Sie werden der Gattung Australopithecus zugeordnet und grob in grazile und robuste unterteilt. Dawkins denkt, dass die Gattung Homo aus den grazilen hervorgegangen sei. Von beiden gibt es heute mehrere Fossilien mit schönen Namen: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
„Herr oder Frau Ples“ aus den Höhlen von Sterkfontein bei Pretoria (das Geschlecht ist noch nicht klar zugeordnet) „Dear Boy“, ein robuster Australopithecine, „Little Foot“, 4 Millionen Jahre alt und ebenfalls aus den Höhlen von Sterkfontein, und „Lucy“, die zusammen mit anderen „Lucies“ vor 3,2 Millionen Jahren in Ostafrika gelebt hatte. Aus der Zeit vor gut 2 Millionen Jahren sind aus Afrika Fossilien bekannt, die als Homo habilis, geschickte Menschen oder von Dawkins einfach als Habilinen bezeichnet werden. Der am besten erhaltene Schädel trägt die Nummer KNM-­‐1470. Dawkins setzt die Habilinen an die Stelle, wo sich das Gehirn in Relation zur Körpergrösse deutlich zu vergrössern begann. Vor 2 bis 1 Million Jahren gehörten unsere potentiellen Vorfahren zum Typ des Homo ergaster bzw. Homo erectus. Sie gingen aber nach Dawkins nicht aufrechter als H. habilis. Die Fossilienfunde „Javamensch“ und „Pekingmensch“ belegen, dass sie im Nahen und Fernen Osten sowie auf Java lebten und damit Vertreter einer frühen Auswanderung aus Afrika waren. Sie sollen ihr Fell weitgehend verloren haben, eventuell das Feuer beherrscht und Steinwerkzeuge hergestellt haben. Dawkins zitiert dann den Biologen Alan Templeton, der aus DNA-­‐Analysen schloss, dass es drei Auswanderungswellen aus Afrika gegeben haben muss. Neben dem Exodus des H. erectus oder eben H. ergaster vor 1,7 Millionen Jahren und nach der durch Fossilien belegten 2. Auswanderung postuliert er für die Zeit vor 840‘000 bis 420‘000 Jahren nochmals einen grossen Treck von Afrika nach Asien. Die ältesten Belege für Homo sapiens wurden in Herto, Äthiopien, gefunden und sind etwa 160‘000 Jahre alt. Sie gehörten zu einer Population, die nach Dawkins an der Schwelle zur anatomischen Modernität standen. Er sieht bei ihnen eine Grenze zum sog. archaischen H. sapiens, zu dem er auch den Neanderthaler zählt, und der ab 900‘000 Jahren vor heute den H. erectus abgelöst habe. Fossilien von Archaischen aus den letzten 100‘000 Jahren wurden weltweit gefunden, so der „Heidelbergermensch“, „Rhodesiamensch“ aus Sambia und der chinesische „Dalimensch“. Dawkins betont, dass die Fachleute zahlreiche verschiedene Klassifizierungen und Einteilungen des archaischen H. sapiens vorgenommen hätten, die sich nicht decken und nicht als abgeschlossen angesehen werden können. Dies sei in Anbetracht der doch spärlichen Funde und der von der Evolutionslehre her zu erwartenden Vielfalt von Variationen, Vermischungen und Unterarten nicht beunruhigend, sondern im Gegenteil zu erwarten gewesen. Genetische Signale der DNA-­‐Analyse hätten nach Templeton ergeben, dass es vor etwa 50‘000 Jahren zu einer Rückwanderung von Asien nach Afrika gekommen sei. Ebenfalls aus der DNA von Mitochondrien und Y-­‐Chromosomen liessen sich die weiteren Wanderbewegungen von Süd-­‐ nach Nordeuropa, von Süd-­‐ nach Nordasien, quer über den Pazifik und nach Australien ablesen. Auch die Besiedlung Nordamerikas vor 14‘000 Jahren über die Beringstrasse sei genetisch nachgewiesen. Zwischen den drei grossen von Afrika ausgehenden Wanderungsbewegungen flossen ständig Gene zwischen Afrika, Südeuropa und Südostasien hin und her. Es muss daher immer wieder zu einer gewissen Vermischung mit einheimischen Bevölkerungsgruppen gekommen sein. Alle diese Ereignisse seien an der Verteilung der menschlichen DNA rund um den Erdball abzulesen. Als Schlussfolgerung schreibt Dawkins: DNA ist ein historisches Nachschlagewerk, das zu lesen, der Mensch gerade erst lernt. Im Hinblick auf bestimmte Allele ist jeder von uns mit bestimmten Schimpansen näher verwandt als mit manchen Menschen. Dawkins ist auch überzeugt, dass es vor etwa 40‘000 Jahren einen „grossen Sprung nach vorne“ gegeben haben muss, durch welchen H. sapiens die Fähigkeit erhielt, raffiniertere Werkzeuge und vor allem Kunst herzustellen. Die archäologischen Funde von Kunstgegenständen und Bildern zeigen sich erst ab diesem Zeitraum. Ob der Mensch schon vorher eine Sprache hatte, ist umstritten, wenn auch Dawkins nach seinen Berechnungen anhand eines „Sprachgens“ einen Zeitraum von ca. 90‘000 Jahren schätzt. Das gesteigerte Bewusstsein, welches in die Zukunft gerichtete Vorstellungen und Lernprozesse erlaubte, sowie die Reflexionen über das „Ich“ und seine Umgebung, dürfte aber doch in der Zeit vor 40‘000 Jahren einen beachtlichen Schub erhalten haben und wurde vor gut 10‘000 Jahren mit der Sesshaftigkeit, Urbanisierung und Technisierung weiter gesteigert. So wurden auch die innerhalb und ausserhalb der Lebewesen ablaufenden Naturgesetze dem Bewusstsein immer besser zugänglich in Form von Kognition, Mathematik, Geometrie und „Wissenschaft“. Diese ganze Entwicklung wurde offenbar dank der Zunahme der Gehirngrösse in Relation zur Körpergrösse möglich, worin Dawkins eine Koevolution von „Hardware“ und „Software“ sieht. Diese Zunahme habe schon bei den Säugetieren begonnen, sei bei den Primaten ausgeprägter geworden und habe bei Hominiden und schliesslich beim Homo sapiens eine explosionsartige Steigerung erfahren. Über die Gründe dazu ist schon viel spekuliert worden. Die Geschicklichkeit der Hände, die durch den aufrechten Gang frei wurden, die zunehmende Notwendigkeit der Kommunikation in geselliger Lebensweise und auf der gemeinsamen Jagd, oder das kumulierte Erlernen von Werkzeuggebrauch-­‐ und Herstellung und vor allem die Sprache werden etwa ins Feld geführt. Dawkins zitiert da Darwin, welcher meinte: Der beständige Gebrauch der Sprache wird auf das Gehirn zurückgewirkt und eine vererbliche Wirkung hervor gebracht haben; und dies wieder wird der Vervollkommnung der Sprache zugute gekommen sein. Dawkins favorisiert ähnlich wie schon Darwin zudem die Theorie der sexuellen Selektion und zieht einen Vergleich mit den Vögeln heran. Die Auslese der klügsten und schönsten Individuen durch das andere Geschlecht könnte zur Auslese der farbenprächtigsten Exemplare wie bei Vögeln, ganz besonders beim Pfau mit seinem ausfahrbaren Gefieder, die Evolution der Intelligenz, des Schönheits-­‐ und Kunstsinns und sogar das Ablegen des Fells massiv beschleunigt haben. Sexuelle Selektion basierte nach Dawkins auf Farben und faltenfreier Haut, die von den Männchen offenbar bevorzugt worden sei. Das Fell ging bis auf die Kopfbehaarung verloren. Da die Gene zwischen Männern und Frauen ausgetauscht werden, verloren auch die Männer ihr Fell, allerdings weniger deutlich.
Nach der Zeit der Fortpflanzung widmeten sich die Frauen dem Dienst an der Gemeinschaft, entweder als Grossmütter oder in der Kinderpflege. 6.8 Ein Affenmensch mit fortschrittlichen Zügen. In: NZZ vom 9.4.10, Sybille Wehner-­‐Segesser Bericht, wb Der Aktualität halber sei diese NZZ-­‐Meldung vermerkt, wonach zwei neue afrikanische Fossilien aus einer Höhle in Malapa, Südafrika, nicht unweit von Sterkfontein in der Nähe von Johannesburg ausgegraben wurden. Es handelt sich möglicherweise um eine Übergangsform vom Australopithecus zum modernen Homo. Die beiden gut erhaltenen Skelette mit einem geologischen Alter von ca. 2 Millionen Jahren gleichen zwar hinsichtlich ihres Körperbaus und ihres geringen Hirnvolumens den bekannten Australopithecinen, die vor 3 – 2,4 Millionen Jahren in Afrika lebten. Doch glichen einige Merkmale wie der Bau des Beckens und des Schädels sowie die Länge der Beine eher der Gattung Homo. Offenbar hatten sie die Voraussetzungen für den energiesparenden menschlichen Gang. Der Zürcher Anthropologe Prof. Dr. Peter Schmid ist an der Auswertung der Funde beteiligt. Die Skelette sind sehr gut erhalten und stammen von einem jüngeren männlichen Individuum und einem ausgewachsenen weiblichen. Die Höhle, in welcher sie gefunden wurden, war aber nicht eine bewohnte Höhle, sondern ein natürlicher tiefer Schacht, von denen es in dieser Region viele gibt. Die beiden Vormenschen, die Australopithecus sediba genannt werden, waren offenbar aus Unachtsamkeit in diesen Schacht gefallen und dort verendet. Es wurden auch Skelette von anderen Säugetieren darin gefunden, denen es gleich ergangen war. Andere Schächte in der Umgebung enthielten zur Enttäuschung der Anthropologen keine Funde. Auch an diesem Beispiel zeigt es sich, wie mit jedem neuen Fund neues Licht auf den Ursprung des Menschen geworfen wird, da der Weg der Evolution nicht geradlinig, sondern windungsreich und verästelt verläuft. Dr. Peter Schmid stellt Australopithecus sediba in Zusammenhang mit Australopithecus africanus einerseits und mit Homo erectus und Homo habilis anderseits. Von Homo habilis wiederum sieht man Übergänge zu Homo ergaster und Homo heidelbergensis, wo die Abzweigung zum Neanderthaler und Homo sapiens vermutet wird. 7. Soziobiologie, kulturelle und soziale Evolution 7.1. Ringvorlesung vom 19.11.09 Das egoistische Gen. Evolution und die Soziobiologie-­‐Debatte Prof. Dr. Paul Schmid-­‐Hempel, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Die Soziobiologie und die darum geführte Debatte entstanden nach Prof. Schmid im Jahr 1975 mit dem umfangreichen Buch des Evolutionsbiologen Edward O. Wilson mit dem Titel: Sociobiology – The New Synthesis. Es wurde darin eine umfassende Sicht des Sozialverhaltens der Tiere und dessen Evolution dargestellt. Es ging also um die Biologie von sozial lebenden Organismen und der Vielfalt von Sozietäten im Tierreich. Diese wurden in vier wichtige Abschnitte unterteilt: 1.
2.
3.
4.
Die niederen wirbellosen Tiere. Sie bilden zum Teil verwachsene Sozietäten, Sozialverbände oder Kolonien von zahlreichen Einzeltieren (Zooiden) mit sich ergänzenden Funktionen und Arbeitsteilung bei Beutefang, Verdauung oder Fortpflanzung. Das Ganze kann sogar aussehen wie ein mehrzelliger Gesamtorganismus. Zu diesen Tieren gehören etwa die Moostierchen, die Korallen oder die Staatsqualle, bei welcher die Integration der Zooiden in den Gesamtverband besonders gross ist. Soziale Insekten. Dazu gehören vor allem Termiten und Ameisen sowie die Bienen und Wespen mit insgesamt etwa 20 000 Arten. Sie kennen alle die Arbeitsteilung und haben Königinnen, welche die Fortpflanzung übernehmen und Eier legen. Ihre Sozietäten können sehr einfach sein, wie etwa bei der Hummel, oder sehr ausgeklügelt wie bei der Blattscheiderameise, welche Blätter sammelt, um darauf Futterpilze zu züchten. Auch Spinnen (nicht zu den Insekten gehörend) bilden zum Teil Kolonien, um mit gemeinsamen Netzen Beute zu fangen. Soziale Wirbeltiere. Vor allem Vögel und Säugetiere. Sie bilden Herden oder jagen im Verband und die Nacktmullen in Afrika sind ähnlich sozial geworden wie Insekten: sie leben in unterirdischen Kolonien und haben eine Königin, die als einzige fortpflanzungsfähig ist. Der Mensch. Seine komplizierte soziale Organisation bewirkt, dass schon kleine Unterschiede im genetischen Programm grosse Unterschiede im Sozialverhalten nach sich ziehen. Der Referent betonte, dass das Sozialverhalten ein evolutionäres Erfolgsmodell sein müsse, wobei allerdings die komplexesten Sozialordnungen bei den ursprünglichsten Gruppen von Tieren zu finden seien. Bei der Staatsqualle kommt es sogar zu einer eigentlichen Verschmelzung der einzelligen Individuen. Dagegen sind die Organisationen der höheren Wirbeltiere biologisch gesehen eher einfach. Gemeinsam sind aber allen sozialen Organisationen die folgenden Elemente: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Arbeitsteilung Kooperation Kommunikation Konflikte um Zugang zur Fortpflanzung: Wer darf von den Anstrengungen der Gruppe profitieren und seine Gene und Nachkommen in die nächste Generation weitergeben. Diese Elemente sind nach Edward Wilson auch für den Menschen die Hauptbestandteile des genetischen Programms für sein Sozialverhalten. Mit dieser Aussage habe er allerdings zahlreiche Kritik und Feindseligkeiten auf sich gezogen, denn man sah in seinen Aussagen, dass Gene das Verhalten des Menschen bestimmen würden, Parallelen zu Rassismus und Eugenik. Zusammen mit der Kritik an der Soziobiologie wurde nun auch die führende Rolle der Selektion für die Adaptation bezweifelt und argumentiert, es könnte auch Merkmale ohne Anpassungswert geben, welche eher als Nebeneffekt entstanden seien. Man zog für diese Kritik sogar die mittelalterliche Kirchenarchitektur bei, und zwar die Spandrillen der Basilika von San Marco in Venedig. Sie könnten ein Ergebnis von Selektion zur Schaffung von Platz für das Anbringen von Mosaiken sein, oder anderseits ein Nebenprodukt der Statik, welche bestimmte Konstruktionsformen erfordert hätte. Diese Diskussion habe aber immerhin zum Studium der Grenzen und Möglichkeiten von Adaptation beigetragen, fasste Prof. Schmid-­‐Hempel zusammen. Dass Gene das Verhalten des Menschen steuern, wurde aber auch unter dem Thema Evolution des Altruismus auf molekularbiologischer Basis untersucht. Die Hauptfrage lautete: Wie kann Kooperation im Laufe der Evolution entstehen und welchen Selektionsvorteil hat Altruismus als „Selbstlosigkeit“, wenn doch durch Altruismus die eigene Fitness reduziert wird? Wenn dank der altruistischen Hilfe eines Individuums A an ein Individuum B eine soziale Organisation der solitären Lebensweise evolutionär überlegen ist, müsste sich dies in der Steigerung der Nachkommenzahl als darwinsche Fitness zeigen, indem B durch die Hilfe von A mehr Nachkommen hervorbringt. Ein Beispiel dafür findet sich bei der Honigbiene, wo die Arbeiterinnen keine Eier legen, sich also nicht Fortpflanzen, sondern zugunsten ihrer Kolonie das Nest gegen Fressfeinde verteidigen und dabei sogar den Tod in Kauf nehmen. Dieses Problem war auch Darwin schon bekannt (Siehe Kapitel VIII in The Origin of the Species) und er sah darin eine Gefahr für seine Evolutionstheorie. Falls ein vererbter Altruismus immer die anderen begünstigt, so würde dieser schnell durch die Evolution eliminiert. Der Referent erläuterte, dass man dieses Problem auch mit der Theorie der Gruppenselektion nur teilweise lösen könne. Diese besagt, dass Gruppen mit vielen Egoisten, nämlich Individuen, welche das altruistische Programm nicht in sich haben, von rein altruistischen Gruppen verdrängt würden. Wenn man sich aber vorstellt, dass Egoisten in altruistische Gruppen eindringen und umgekehrt Altruisten in egoistische Gruppen eindringen, dann wankt diese Theorie. Der Egoist fährt in der altruistischen Gruppe nämlich gut, denn er profitiert von der Hilfe der anderen, trägt aber nichts zu deren Kosten bei. Umgekehrt wird der Altruist von den Egoisten nichts erhalten, sondern immer nur zahlen. Die Leistungsfähigkeit der beiden Gruppen müsste sich deshalb einander annähern. Gruppenselektion scheint aus diesem Grunde nicht zu funktionieren. Prof. Schmid-­‐Hempel stützt sich deshalb auf die Gene als Träger der verhaltensbestimmenden Erbinformationen, welche weitergegeben werden, während dem die Individuen sterben und die Gruppen durch den Wechsel der Individuen ebenfalls einem steten Wandel unterliegen. Wie gross der Einfluss der Gene auf Altruismus tatsächlich ist, zeigt er wiederum am Beispiel der Bienen: Im Bienenstaat sind alle Mitglieder Weibchen, nämlich Töchter der Königin. Söhne bestehen nur zur Zeit der Paarungsflüge und sind für die Arbeit in der Kolonie bedeutungslos. Die Arbeiterinnen helfen die Brut aufzuziehen, die zwar nicht die ihrige ist, in welcher sich aber wiederum Töchter der Königin befinden, also „Schwestern“ der Arbeiterinnen. Nun ist es so, dass bei Insekten wie Bienen, Ameisen und Wespen durch Befruchtung eines Eis mit Spermien ein diploides Weibchen entsteht, während dem aus einer nicht befruchteten Eizelle ein haploides Männchen entsteht. Diese genetische Ungleichheit hat zur Folge, dass Schwestern untereinander zu 75% miteinander verwandt sind. Bei Säugetieren sind Schwestern nur zu 50% miteinander verwandt. Die genetischen Programme von Bienenarbeiterinnen sind daher zu 75% auch in ihren Schwestern vorhanden, die sich fortpflanzen. Dazu gehört nun auch das altruistische Programm – die Arbeiterinnen helfen ja den königlichen Schwestern und schaffen eine stabile soziale Lebensweise – und dieses Programm hat nun höhere Chancen, seine Kopien an die nächste Generation weiterzugeben. Die soziale Lebensweise hat also einen Hebeleffekt für einen höheren Erfolg bei gleicher Investition gegenüber der solitären Lebensweise. Altruismus ist so gesehen eine Folge des Egoismus des genetischen Programms. Richard Dawkins nannte dies bereits 1976 das „Egoistische Gen“. Der Evolutionsbiologe William Hamilton sprach diesbezüglich schon 1964 vom Prinzip der „Inklusiven Fitness“, wonach für den Erfolg eines Verhaltens oder eines Merkmals nicht nur die Kosten für den Handelnden, sondern auch die Vorteile für die davon betroffenen Nachbarn gezählt werden müssten, und zwar in Relation zu deren Verwandtschaftsgrad mit dem Handelnden. Nach dieser „Hamilton-­‐Regel“ setzt sich ein Verhalten dann durch, wenn es Verwandten zugute kommt, oder wenn es einen hohen Nutzen gegenüber den Kosten beinhaltet. Damit stellte Hamilton soziales Verhalten auf eine mathematische Grundlage von Genen und geriet zusammen mit der ganzen Soziobiologie in die harsche Kritik von Psychologen und Soziologen. Es handelt sich aber lediglich um Biologie, wie etwa das Beispiel, dass die Körperzellen den Gameten bei der Fortpflanzung behilflich sind. Sie sind miteinander verwandt und haben dieselben Gene. Somit hat auch die altruistische Körperzelle einen Nutzen aus ihrer Hilfe, weil ihr genetisches Programm weitergegeben wird, nicht aber der Körper selbst. In den letzten 20 Jahren haben nach Prof. Schmid die Forschungsresultate die genetische Theorie des Sozialverhaltens in grosser Fülle bestätigt. Das Beispiel der Arbeiterinnen unter den Bienen, welche ihre Investitionen vielmehr, nämlich zu im Verhältnis von 3:1 ihren Schwestern als ihren Brüdern zukommen lassen, zeigt, dass für dieses Verhalten keine kognitiven Fähigkeiten notwendig sind. Ähnliche Verhältnisse findet man bei Malariaparasiten, die simple Einzeller sind. Sogar Schleimpilze folgen diesem Prinzip: Zur Fortpflanzung bilden sie aus Tausenden von Einzellern einen gemeinsamen Fruchtkörper, welcher von einem nicht reproduzierenden Stiel getragen wird. Nun gibt es darunter auch solche Einzeller, die sich nicht an der Formung des Stiels beteiligen, also „Egoisten“. Sie werden selektiv von der Teilnahme am reproduzierenden Fruchtkörper ausgeschlossen. Auch dies beruht nicht auf kognitiven Fähigkeiten, sondern auf einem Gen, welches für die Haftung der Zellen untereinander verantwortlich ist. Es lässt nur gleiche oder ähnliche Varianten von Zellen für die Bildung des Fruchtkörpers zu. Die Erkennung erfolgt anhand von Oberflächensubstanzen der Zellen. Auch beim Menschen spielt Verwandtschaft für altruistische Hilfe eine grosse Rolle, vor allem wenn der Nutzen der Hilfe sehr gross oder gar lebenswichtig ist. Das Erbrecht zum Beispiel geht davon aus, dass Verstorbene ihr Vermögen ihren Kindern und Verwandten überlassen wollen. Anderseits sind Stiefeltern zu ihren Kindern meist weniger liebevoll als zu eigenen Kindern. Die „Genetische Theorie“ könnte nach P. Schmid natürlich zur Folge haben, dass Altruismus nicht mehr aus Moral abgeleitet würde, sondern dass umgekehrt Moral als Resultat von Strategien zum Überleben von Genen und von Konkurrenz zwischen genetischen Programmen gedeutet werden müsste. Daraus ergäbe sich notwendigerweise eine Diskussion mit den Geistes-­‐ und Religionswissenschaften. Einem originellen Aussenseiter, dem Chemiker und Journalisten George R. Price gelang schliesslich etwa 1967 eine Vereinheitlichung der Selektionsebenen. Nach dem Studium von Hamiltons Schriften suchte er nach einer übergeordneten mathematischen Lösung für die Fragen der Verhaltensevolution und die Analyse von Selektionsvorgängen. Diese Lösung sollte sich auf allen Stufen und Einheiten von Evolution, auf der Ebene der Gene, der Individuen, Populationen und Arten anwenden lassen. Sie wurde schliesslich als Price‘ Kovarianz-­‐Gleichung bekannt. Sie kann die gesamte evolutionäre Änderung eines Merkmals berechnen indem sie zwei Komponenten addiert: Einerseits die Änderung aufgrund der erwarteten Fitnessänderung bei einer Merkmalverschiebung. Anderseits die Änderung, welche durch den Zusammenhang (Kovarianz) mit den Umweltfaktoren zustande kommt, zu denen auch die Anwesenheit von Verwandten in der Nachbarschaft gehört. Damit wird die Merkmalsänderung nach der Fitnessänderung, also der Anzahl Nachkommen, und der Umwelt-­‐ bzw. Nachbarschaftsänderung also der Konkurrenz der nachfolgenden biologischen Ebene berechnet. Die Prinzipien der Inklusiven Fitness wie auch die Gruppenselektion folgen damit derselben Logik. Die wichtigste Gruppierung, welche eine Kovarianz im Sinn von Price bildet, ist damit die Verwandtschaft, weil sie die ähnlichsten Gene besitzt. Gruppen, die nicht auf Verwandtschaft beruhen, spielen hingegen eine untergeordnete Rolle. Prof. Schmid–Hempel schloss mit den Worten, dass die Soziobiologiedebatte die Evolutionstheorie revolutioniert habe, indem sie nun auch soziales Verhalten erklären könne. Polarisierende Persönlichkeiten und brisante biologische Erkenntnisse seien der Motor der Debatte gewesen, die heute noch die Gemüter erhitze. Er meinte: Genauso wie zu Darwins Zeiten wird es letztlich auch der Fortschritt im Verständnis der Evolutionsprozesse sein, der uns sagt, wie viel der Mensch nur ein anderes soziales Tier ist, oder was ihn darüber hinaus noch auszeichnet. 7.2. Ringvorlesung vom 29.10.09 Evolutionäre Spieltheorie. Die moderne Analyse von Konflikt und Kooperation im Sinne Darwins. Prof. Dr. Peter Hammerstein, Berlin Vorlesungsnotizen, wb Prof. Dr. rer. nat. Peter Hammerstein , 1949 Studium von Biologie, Mathematik und Wirtschafttheorie. Schüler des Evolutionsbiologen John Maynard Smith und des Spieltheoretikers Reinhard Selten. Gründer des Instituts für theoretische Biologie an der Humboldt-­‐Universität Berlin. Leiter des dortigen Forschungsverbundes für „Robustheit, Modularität und evolutionäres Design lebender Systeme“ Der Referent zeigte in seiner Vorlesung den Dialog und die Verbindung zwischen den Spieltheorien als Forschungsgebiet von Konflikt und Kooperation einerseits und der Evolutionsbiologie anderseits, woraus die „evolutionäre Spieltheorie“ hervorging. Er beschrieb zuerst die Spieltheorie als wissenschaftliche Disziplin, die 1944 von Mathematikern und Ökonomen (Von Neumann und Morgenstern) entworfen worden war, um ein mathematisches Fundament für die Wirtschaftswissenschaft zu schaffen. Es ging um die Problematik wirtschaftlicher Entscheidungen, die eine Auswirkung im Umfeld von Konkurrenten und Konsumenten haben und die für ihren Erfolg eine Berücksichtigung des nur vage bekannten Verhaltens dieser Interaktionspartner verlangen. Die Spieltheorie hat ihren Namen daher abgeleitet, dass sie solche strategischen Interaktionen mit Spielen wie Schach, Poker oder Gesellschaftsspielen vergleicht und analysiert. Das “Spiel“ wird dabei als „mathematisches Modell einer strategischen Interaktion“ verstanden und die Spieler werden als „Akteure“ bezeichnet. Der Erfolg eines Spielers wird als „Auszahlung“ benannt, welche aber nicht finanzieller Natur sein muss, sondern vom Akteur definiert wird. Analog zu den Anforderungen an ein Gesellschaftsspiel muss ein Modell der Spieltheorie festlegen: -­‐
-­‐
-­‐
Wer sind die Spieler? Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen für sie? Wie hängt der Erfolg des Einzelnen vom Verhalten aller anderen Spieler ab? Eine zentrale Bedeutung hat dabei der Begriff der „Strategie“. Spieltheoretiker verstehen darunter ein Verhaltensprogramm, welches beschreibt, wie man sich in den unterschiedlichen Situationen verhalten würde, die prinzipiell in einem Spiel auftreten können. Wie die Strategie zustande kommt, bleibt dabei offen und der Begriff der „Situation“ ist subjektiv, da der Akteur über den Stand der Dinge, wie etwa die Spielkarten seiner Gegner, nur Vermutungen und Spekulationen anstellen kann Die Spieltheorie kann nun nach Hammerstein einerseits nach Modellen suchen, in denen sich das wirkliche menschliche Verhalten bei Konflikt und Kooperation widerspeigelt. Dies ist der beschreibende Ansatz, der sich an naturwissenschaftlichem Denken orientieren muss. Anderseits kann die Theorie als Grundlage zu Empfehlungen dienen, wie der Mensch strategisch handeln sollte, um erfolgreich zu sein. Darin sieht er einen normativen Ansatz im Sinne der Geistes-­‐ und Sozialwissenschaften. Die Anfangsjahre der Spieltheorie wurden diesbezüglich von der sogenannten „Maximin-­‐Strategie“ (John von Neumann) geprägt. Sie bestand aus dem Ratschlag, die kleinstmöglichen Auszahlungen zu berechnen und diejenige Strategie zu wählen, für die diese kleinste Auszahlung am grössten wäre. Diese Strategie habe sich aber nur bei sog. Nullsummenspielen bewährt, betont Hammerstein, bei denen die Summe von Gewinn und Verlust für zwei Spieler gleich Null ist. Im Jahr 1951 hat dann der Mathematiker John Nash das Konzept des „Nash-­‐Gleichgewichts“ berechnet. Es besagt, dass die Strategien der Spieler Paare bilden, die wechselseitig beste Antworten aufeinander finden. Jede der beiden Strategien soll gegenüber der anderen eine maximale Auszahlung erzielen. Dabei hat keiner der Spieler einen Anreiz, von seiner Strategie abzuweichen. Allerdings weist Hammerstein darauf hin, dass im realen Leben im Gegensatz zum Spiel die Strategien der gegnerischen Akteure meist nicht bekannt sind. Dieses Problem konnte nur mit einem eigentlich unerlaubten Kunstgriff entschärft werden, nämlich mit der Annahme, dass alle Spieler rational handeln und denken, und dass sie das voneinander wissen. Dies besagt folglich, dass alle Akteure schlüssige Präferenzen hätten und die auftauchenden mathematischen Probleme innert kürzester Zeit lösen könnten. Damit befindet man sich aber wiederum nicht im realen Leben, da selbst hochrationale Akademiker nachweislich oft kognitiven und optischen Täuschungen unterliegen. Der Referent beschrieb anhand eines Beispiels, wie gerade im Alltag nicht rational oder mathematisch gehandelt wird: Man möchte etwa sein Auto für 20 Min. parkieren und müsste dabei Fr. 2.-­‐ in die Parkuhr für eine ganze Stunde einwerfen. Wenn man nicht bezahlt, riskiert man eine Busse von Fr. 20.-­‐. Mathematische Berechnungen zeigen, dass es finanziell günstiger ist, die Fr. 2.-­‐ nicht einzuwerfen. Trotzdem bezahlen die meisten Autofahrer die Parkgebühr und handeln damit nicht streng rational. Der Gesetzesbruch wäre billiger, wäre aber mit einem moralischen Problem verbunden. Dieses ist die konsistente Präferenz des Menschen, die als Vermeidung einer Bestrafung seinen Nutzen maximiert. Die These des „homo oeconomicus“ ist also eine Fiktion. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Kunde zwischen Artikeln mit verschiedenen Preisen wählen muss: Er kauft nicht das Billigere, sondern den Artikel, dessen Markennamen er bereits kennt. Die Werbung nützt diese „Wiedererkennungs-­‐Heuristik“ längst erfolgreich aus. Der Ökonom Reinhard Selten hat infolge dieser Beobachtungen 1965 die Theorie des Nash-­‐
Gleichgewichts zu perfektionieren versucht indem er den Begriff „rationale Entscheidung“ neu definierte. Er musste die Tatsache mit einbeziehen, dass ein Spieler seinen Erfolg vorsätzlich schmälert, was bedeutet, dass seine Strategie in bestimmten Situationen ein irrationales Verhalten vorschreibt. Selten untersuchte dies anhand des sog. „Ultimatumspiels“ mit folgenden Spielregeln: Ein Betrag soll unter zwei Spielern A und B aufgeteilt werden. A darf ein selbstgewähltes Angebot machen, B einen Teil des Betrages auszuzahlen. B kann nur zusagen oder ablehnen. Eine Verhandlung und ein weiteres Angebot gibt es nicht. Das Angebot von A ist deshalb ein Ultimatum. Lehnt B das Angebot ab, erhalten beide Spieler nichts. Das Nash-­‐Gleichgewicht würde nun sagen, dass beide Spieler auf die Strategie des andern die beste Antwort bereit halten. A müsste eine Aufteilung zu je 50% vorschlagen, da er wüsste, dass B nur diese Lösung akzeptieren würde. Für B wäre aber die Ablehnung eines Angebotes von 49% irrational, da dieses immer noch besser als 0 wäre. Das irrationale Denken ist für B nun aber kein Nachteil, weil es A dazu zwingt, 50% anzubieten. Wäre B rein rational, so würde das Nash-­‐Gleichgewicht darin bestehen, dass A nur 1% anbieten müsste und dass B damit über den Tisch gezogen würde, obwohl er immer noch besser fahren würde als mit 0. Selten nannte dieses Nash-­‐Gleichgewicht „perfekt“, da es nicht im Widerspruch zur Rationalität stehe. Allerdings deckt es sich nicht mit den Erfahrungen im Alltag und im Experiment. Dort lassen sich die Akteure nämlich nicht über den Tisch ziehen und akzeptieren nur Angebote, die nicht allzu weit von 50% abweichen. Die Spieltheorie konnte also unter Annahme einer reinen Rationalität menschliches Verhalten nicht erklären. Rationalität erwies sich gerade im Experiment der Spiele als überzogenes Konzept und konnte keine klugen Verhaltens-­‐ und Entscheidungsrichtlinien herleiten. Die Interpretation des Nash-­‐Gleichgewichts machte erst Fortschritte, als die Evolutionstheorie als Retter in der Krise beigezogen und damit die Zusammenführung zur evolutionären Spieltheorie realisiert wurde. Dies war die Leistung der Evolutionsbiologen John Maynard Smith und George Price zwischen 1973 und 1982. Smith sah in Strategien nicht Handlungskonzepte, die von Individuen frei wählbar sind, sondern erbliche Verhaltensprogramme, die nach Darwin von der natürlichen Selektion über Fitness im Sinne der Populationsgenetik adaptiert und evoluiert werden. Innerhalb einer Population findet ein reproduktiver Wettbewerb zwischen Strategien statt. In einer stabilen Umwelt ergibt sich mit der Zeit eine Überlegenheit einiger Strategien, welche dann der Evolution keine Angriffsflächen mehr bieten. Smith nannte solche Strategien „evolutionär stabil“ (ESS). Diese haben mit Nash-­‐Gleichgewichten die Eigenschaft gemeinsam, dass sie keinen Anreiz zu Veränderungen mehr bieten. Prof. Hammerstein sieht darin den geschlossenen Bogen der spieltheoretischen Konzeptbildung. Natürlich bedeutet dies nicht, dass etwa Managementstrategien von Unternehmen vererbt würden. Hingegen kann soziales Lernen in Populationen ähnliche Eigenschaften haben wie der darwinsche Prozess. Das Nash-­‐Gleichgewicht kann durch Ausprobieren (Mutation) und Imitation der Strategien besonders erfolgreicher Individuen (Selektion) gelernt werden. Das heisst aber nicht, dass Strategien geistige Fähigkeiten voraussetzen würden und auf den Menschen beschränkt wären. Hammerstein definiert ja Strategie als Verhaltensplan, der beschreibt, wie Informationen in Handlungen umgesetzt werden sollen. In der Biologie entwirft die Evolution diese Pläne und Programme und diese können auch auf den Menschen übertragen werden. Aus dem Tierreich erwähnt Hammerstein das Beispiel der Wasserflöhe, die sich mit einer Art Helm gegen Raubfeinde wehren. Sie können im umgebenden Wasser chemische Spuren ihrer Feinde wahrnehmen und dann Energie in die Produktion von Helmen investieren. Dies ist ein strategisches Programm, welches in ihrer Entwicklungsbiologie eingraviert ist und nicht über ein Gehirn läuft. Das in der Evolution entstandene biologische Merkmal ist nicht so sehr der Helm selbst, als vielmehr ein adaptives Programm, sich in Abhängigkeit von Situationen einen unterschiedlichen, jeweils wohl definierten Körperbau zuzulegen. Die Evolution hat hier tatsächlich eine Strategie erfunden, betont Hammerstein, und dieser Aspekt sei für unser Verständnis der Natur oft unentbehrlich. Der Referent hat deshalb auch Konflikt und Kooperation aus spieltheoretischer Sicht betrachtet. So hätten das Ultimatumspiel und die Idee des perfekten Nash-­‐Gleichgewichts durchaus eine Bedeutung in der Biologie. Im Laufe der Evolution haben sich etwa Brutpflegekonflikte unter den Geschlechtern abgespielt, die sich heute noch in den Mustern des elterlichen Aufwands zeigen. Ein Geschlecht kann früher als das andere einen Vorteil davon haben, die Nachkommen zu verlassen. Bei Fischen sind das oft die Weibchen, bei Säugetieren eher die Männchen. Daraus entsteht eine Art Ultimatumspiel: Das desertierte Geschlecht macht dem Paarungspartner das 1%-­‐Angebot: „Meine Gene und Keimzellen kannst Du behalten, darüber hinaus gebe ich nichts“. Der verlassene Partner wird durch die Rationalität der natürlichen Situation gezwungen, die Brut zu versorgen und das Angebot des „perfekten Nash-­‐Gleichgewichts“ anzunehmen. Das Beispiel der Konflikte zwischen männlichen Rivalen zeigt ebenfalls, wie evolutionäre Spieltheorie sowohl den tödlichen Kampf wie auch die Vermeidung der Kampfeskalation erklären kann. Artgenossen sind wegen ihrer identischen Ansprüche die ärgsten Konkurrenten eines Tieres. Gegner schätzen sich aber vor und während dem Kampf gegenseitig ein und einer von ihnen gibt auf, bevor er ernsthaft Schaden nimmt. Das ist nicht Pazifismus, sondern Strategie im Sinne eines Nash-­‐Gleichgewichts, also die beste Antwort auf die Strategie des Gegners. Hammerstein lehnt denn auch die von Konrad Lorenz postulierte „Tötungshemmung innerhalb einer Art“ ab. Sie ist heute genauso wie die Idee der „Arterhaltung“ empirisch nicht mehr haltbar. Hammerstein beschrieb weiter die Ringkämpfe der Erdkröten am Laichgewässer, wie sie schon 1979 von anderen Forschern beobachtet worden waren: Ein Männchen trifft auf ein paarungsbereites Weibchen im Wasser und springt auf ihren Rücken. Ein Rivale erscheint und springt ebenfalls auf den Rücken des Weibchens. So können bis zu 6 Männchen auf dem Weibchen sitzen und dieses kann infolge des Gewichtes ertrinken. Trifft dies ein, ist der Fitnessvorteil der Männchen gleich Null. Wenn das einzelne Männchen aber nicht um seine Position kämpft, ist sein Fitnessvorteil ebenfalls Null. Eine „vernünftige“ Lösung muss also im Sinne der Biologie gesucht werden. Sie wurde damit gefunden, dass die Männchen sich ihre Grösse mit Lauten mitteilen. Die Spieltheorie kann zwar auch die ausserverwandtschaftliche Kooperation unter Menschen verständlich machen indem sie zeigt, dass die Kooperation durch Androhung von Strafe erzwungen werden kann. Das Problem liegt aber in den Fragen, warum die Bestrafung als solche zustande kommt und warum für die Bestrafung ein Aufwand betrieben wird, der grösser ist als der individuelle Nutzen daraus. Zudem werden auch Personen bestraft, die man nie mehr wieder sehen wird. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass die Kooperation in wiederholten Spielen spieltheoretisch einfacher erklärbar ist als evolutionär. Dabei führen die Akteure nämlich Buch über das kooperative Verhalten der Partner und beantworten dieses nach dem Prinzip „Wie Du mir so ich Dir“ (engl. Tit for Tat). Diese Strategie des „reziproken Altruismus“ wäre bei einmaligen Begegnungen evolutionär nicht stabil und findet sich interessanterweise nur bei Primaten. Aber nur bei Menschen bleibt die Beachtung eines Hilferufs über längere Zeit bestehen. Bei anderen Primaten verblasst die Hilfsbereitschaft schnell wieder. Zudem sind sie, wie etwa Schimpansen, beim Essen auf sich selbst fokussiert. Prosoziales Verhalten ist allein beim Menschen weitaus stärker ausgebildet. Ebenso die Emotionen, welche eine „indirekte Spur aus früheren Zeiten“ darstellen. So ist Scham eigentlich eine subjektive Bestrafung für eine Normverletzung und stammt aus Zeiten, als man durch eine solche in grosse Gefahr geriet. Die psychosomatischen Symptome der Scham sind denn auch etwa dieselben wie diejenigen der Angst. Unsere Vorfahren hatten offenbar drastische Strafen bei Regelverletzungen wie Ausschluss aus einer schützenden Gruppe. Kooperation unter anderen Tieren ist aber nicht reziprok altruistisch, sondern genetisch bedingt und funktioniert deshalb nur unter nahen Verwandten. Man glaubte zwar in den 1980er Jahren bei Vampir-­‐Fledermäusen eine altruistische Hilfestellung ausserhalb von Verwandtschaft gefunden zu haben. Hungrige Tiere betteln bei Artgenossen und erhalten oft eine Spende. Eine satte Fledermaus kann dann ihren Mageninhalt herauswürgen und der Bettlerin übergeben. Bei der genaueren Untersuchung stellte sich aber heraus, dass diese Spende nur den verwandten Individuen gewährt wird und damit nicht auf einer inneren Buchführung im Sinne von „Tit for Tat“ beruht. Nur der Mensch scheint die kognitive Kapazität zu haben, um vergangene Interaktionen im Gedächtnis behalten, bewerten und für die Evaluation späterer Hilfeleistungen heranziehen zu können. Strategien für Kooperation und Konflikte benötigen aber prinzipiell keine Kognition, was sich besonders bei Mikroorganismen zeigt. Ein eindrückliches Beispiel sind die intrazellulären Bakterien Wolbachia, welche Insekten infizieren. Sie werden maternal, also über das Zytoplasma der Insekteneier vererbt. Daraus entsteht ein evolutionärer Konflikt zwischen der Bakterien-­‐DNA und der nuklearen DNA im Zellkern des Wirtes. Die letztere wird ja über Söhne und Töchter weitergegeben, die Wolbachien-­‐DNA aber nur auf über Töchter, da Spermien für die Übertragung von Wolbachien ungeeignet sind. Im Organismus der Söhne ist das Erbgut der Wolbachien sozusagen „lebendig begraben“, was an die Endosymbiose der Mitochondrien erinnert. Die strategische Analyse nach der Spieltheorie kann nun voraussagen, dass Wolbachien mit männlichen Wirten nicht kooperieren, weil ihnen dies evolutionär nichts bringt. Im Gegenteil würde es ihnen nützen, wenn möglichst wenige Söhne und möglichst viele Töchter entstehen. Diese Voraussage wurde verifiziert mit der Beobachtung, dass Wolbachien tatsächlich genetische Söhne verweiblichen können, dass sie beim Wirtsinsekt Jungfernzeugung herbeiführen können, bei welcher nur Töchter entstehen, und dass sie Söhne oft systematisch töten und damit den Töchtern das Leben erleichtern. Die Logik dieses evolutionären Konfliktes liegt also einfach in den unterschiedlichen Vererbungswegen der Wirts-­‐DNA und der Bakterien DNA. Nun könnte in der Folge das Gen für die Vermännlichung bei den infizierten Insekten aussterben. Tatsächlich gibt es Arten, bei denen nur noch 1 Männchen auf 100 Weibchen vorkommt. Irgendwann ist aber eine Mutante zu erwarten, welche das Männermorden stoppt und damit einen sehr hohen Selektionsdruck erhält. Auch diese Voraussage ist bei einer Insektenart gefunden worden. Nach 80 Jahren war bei ihr das Männermorden verschwunden. Die Strategien von Wolbachien sind aber oft noch raffinierter: Sie können bei den Wirtsinsekten eine Paarungsinkompatibilität herbeiführen indem sie die Spermien vergiften und damit funktionslos machen. Wenn bei derselben Wirtspopulation aber auch die Eier infiziert sind, haben die Wolbachien wieder ein Interesse an der Fortpflanzung dieser Tiere. Sie produzieren ein Gegengift, welches die Spermien wieder funktionstüchtig macht. Mit dieser doppelten Manipulation haben sie die totale Kontrolle über ihre Wirtsorganismen. Die Insektenweibchen bezahlen mit ihrer Infektion eigentlich ein Schutzgeld an die Wolbachien. 7.3 HELBLING, J., Koevolution und die Sozialwissenschaften. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2002) 147/3:115-­‐124 Prof. Dr. Jürg Helbling, Ethnologisches Seminar der Universität Zürich Literaturbericht, wb Der Autor zeigt in seiner Arbeit, dass eine rein biologisch-­‐genetische Evolutionstheorie im Sinne der Soziobiologie nicht genügt, um menschliches Sozialverhalten, sozialen Wandel und kulturelle Phänomene in Wirtschaft, Industrie und Güterverteilung zu erklären. Er benutzt zwar das darwinistische Forschungsprogramm um Probleme wie Kooperation, Konflikt und Konkurrenz unter dem Begriff „Evolutionsökonomie“ zu lösen, passt es aber an die Analyse sozialer und kultureller Phänomene an. Der Soziobiologie hält er entgegen, dass ein reiner Bezug zu den Genen sowie zum Individuum als Vehikel von Genen, zum Fortpflanzungserfolg oder zum Kampf um die Ressourcen wie auch zur verwandtschaftlichen Nähe der kooperierenden Individuen die Diversität von Gesellschaften in verschiedenen Weltregionen und unterschiedlichen Zeitepochen, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Strukturen sowie die komplexen Beziehungen in mehrdimensionalen Umwelten nicht erklären könne. Hingegen sieht er evolutionäre Selektionsprozesse in nicht-­‐biologischen, sondern kulturellen und sozialen Kontexten. Dazu gehören etwa der Erfolg von Firmen und Unternehmungen, die sich mit spezifischen Produktions-­‐ und Marketingstrategien bewähren, auch der Erfolg von Marktkonkurrenz gegenüber Staatswirtschaft, der Erfolg von neuen gegenüber alten Technologien, die Senkung von Produktionskosten und die Steigerung von Profiten. Es geht dabei nicht mehr um einen Fortpflanzungserfolg, sondern um wirtschaftlichen oder politischen Machtgewinn oder um Zuwachs von Reputation. Die Mehrdimensionalität von Umwelten zeigt sich in wirtschaftlichen, symbolischen, politischen, natürlichen und strategischen Bedingungen. Firmen und Gruppen haben als Selektionseinheiten interne Umwelten in Form ihrer Mitarbeiter, Kader, Werte, Technologien und Normen, anderseits aber auch externe in Gestalt der konkurrierenden Firmen, und anderer Staaten. In der Biologie hingegen sind einzig die Gene Selektionseinheiten. Individuen und Gruppen interagieren aber auch in Koevolution mit einer spezifischen Dynamik. Es werden nicht nur erfolgreiche Individuen und Gruppen selektioniert, sondern auch erfolgreiche Strategien, Technologien, Institutionen und Organisationen. Der Autor sieht darin evolutionäre Prozesse im Sinne Darwins, indem Individuen und Gruppen für spezifische Strategien, Institutionen und Organisationen durch mehrdimensionale Umwelten selektioniert werden. Die Strategien und Selektionsprozesse setzen schon beim Individuum ein, welches als Akteur möglichst grossen ökonomischen und politischen Nutzen sucht, bei möglichst kleinen Nachteilen. Akteure, auch Gruppen, handeln interessen-­‐ und vorteilsorientiert, oder auch in der Routine von bewährten Strategien. Akteure könnten nun theoretisch durch planerisch festgelegtes Handeln die Selektion aushebeln. Da aber Strategien und Technologien stets variieren, unterliegen sie zweifelsohne einer Selektion. Soziale Akteure sind auch nie über ihre Handlungsresultate und Alternativen im Voraus vollständig orientiert, sondern sie agieren und interagieren immer in einer unsicheren Umwelt. Zudem sind sie unterschiedlich und unvorhersehbar mit Ressourcen ausgerüstet und müssen deshalb verschiedene Strategien wählen. Die Resultate der Akteure werden daher immer einer Selektion durch den Erfolg ausgeliefert sein. Dies zeigt der Autor anhand folgender Beispiele: 1.
2.
3.
4.
Konkurrierende Unternehmer in einer kapitalistischen Marktwirtschaft Gesellschaften ohne Staat (Jäger und Sammler, nomadische Kleingruppen und Feldbauern) Kriegerische Selektion und Akteurstrategien in tribalen Gesellschaften Selektion durch natürliche Umweltbedingungen bei Wildbeutern Zum Beispiel 1: Unternehmungen planen ihre auf Profitmaximierung ausgerichtete Produktion anhand der zu erwartenden Marktbedingungen. Die Marktentwicklung ist aber nicht vorhersagbar, da sie auf Marktkonkurrenten, Konjunktur, Handlungsinterferenzen mit Arbeitnehmern und Politikern oder Preis und Nachfrage beruht. Der Erfolg des Unternehmens unterliegt damit einem darwinschen Selektionsdruck. Firmen können natürlich mit Preisabsprachen und Kartellen sowie Zusammenschlüssen in Konzernen ihre Selektionsrisiken minimieren, aber nicht ausschalten. Somit sieht Helbling in Konkurrenz und Kooperation zwei gleichzeitig auftretende Formen der Koevolution von kapitalistischen Unternehmen. Denselben Mechanismus ortet er auch in politischen Parteien, welche ihre Interessen mit ideeller Abgrenzung einerseits, mit Kooperation in der Koalition oder der Kollegialregierung anderseits einer Selektion aussetzen müssen. Zum Beispiel 2: Gesellschaften ohne Staat bestehen aus autonomen, selbstversorgenden nomadischen Kleingruppen wie Sippen, Familien oder auch Bauerndörfern, welche analog den modernen Firmen als Organisation aufgefasst werden können. Ihre Mitglieder tauschen Nahrungsmittel, feiern zusammen Feste, legen Konflikte bei und entscheiden über kollektive Belange. In der Gruppe haben Individuen grössere Vorteile bei der Kooperation, Zusammenlegung von Ressourcen und Verteidigung als alleine ausserhalb einer Gruppe. Daraus resultiert eine Gruppenselektion. Die Gruppen müssen sich an ihre jeweiligen Umwelten anpassen. Die Umwelten bestehen einerseits aus dem natürlichen Habitat mit seinen landwirtschaftlichen Möglichkeiten, und anderseits aus der sozio-­‐politischen Dimension der anderen Gruppen in derselben Region. Die Selektionserfordernisse der beiden Umwelten können sich allerdings gegenseitig ausschliessen, was der Autor an den Beispielen 3 und 4 zeigt. Zum Beispiel 3: Kriegerische Feldbaugesellschaften im Hochland von Neuguinea passen sich an ihre Habitate an durch die Produktion von Knollenfrüchten und durch Schweinezucht. Die Sozio-­‐politische Umwelt wird dagegen durch Kriege und Allianzen bestimmt. Das Überleben der Lokalgruppen hängt von ihrer militärischen Schlagkraft und damit von ihrer Grösse und der Anzahl der Alliierten ab, welche mit Schweinefleisch beschenkt werden. Eine Gruppe muss sich daher vergrössern, Alliierte gewinnen mit dem Verschenken von Schweinen und sie muss ihre landwirtschaftliche Produktion steigern, um die Gruppenmitglieder und die Schweine zu ernähren. Dies führt zu einer Übernutzung der Ressourcen in den Habitaten. Kleine Gruppen, welche eine nachhaltige ökonomische Landwirtschaft betreiben, können keine Alliierten gewinnen und im militärischen Wettbewerb nicht bestehen. Ihr Land wird bald von mächtigen Gruppen annektiert und für die kriegerischen Zwecke übernutzt. In diesen Gesellschaften ist der Krieg der wichtigste Selektionsfaktor und nur Gruppen, die sich entsprechend anpassen, können überleben. Es findet eine Koevolution statt zwischen dem Krieg unter Feinden und Kooperation unter Alliierten. Gleichzeitig besteht in der kriegerischen Umwelt eine erfolgsfördernde Koevolution zwischen Menschen, Schweinen und Nutzpflanzen sowie zwischen domestizierten Tieren und Pflanzen gegenüber ihren Konkurrenten. Zum Beispiel 4: Gerade umgekehrte Verhältnisse fand der Autor in den Wildbeutergesellschaften der australischen Aborigines, der San-­‐Buschleute in der Kalahari, bei Pygmäen und bei Inuit der Arktis. In riesigen Territorien jagen und sammeln kleine mobile Gruppen von ca. 25 Personen, weichen einander durch Wanderungen aus und führen kaum je Kriege gegen einander. Die Mobilität ist dabei ein entscheidender Faktor. Die Gruppengrösse wird durch die Ressourcen beschränkt, darf aber ein bestimmtes Minimum nicht unterschreiten, um Ertragsunterschiede noch ausgleichen und kollektive Jagd ausführen zu können. Die verfügbare Ressourcenmenge ist dabei der entscheidende Selektionsfaktor. Unkriegerische Kooperation ist also in Koevolution mit der Natur des Habitates ein Vorteil und ermöglicht Mobilität zwischen Gruppen und Familien in Krisenzeiten. Hohe Geburtenraten bedeuten gerade keinen Selektionsvorteil und die Domestizierung von Tieren und Pflanzen ist gering. Hebling legt nun die Koevolution durch die Grösse und Art der Habitate, der Lebensweise und Gruppengrösse sowie der sozio-­‐politischen Umwelt auch der Entstehung des Krieges zugrunde. Mobile Gruppen von Wildbeutern haben sich im Meso-­‐ und Neolithicum in sesshafte Gruppen von Fischern und Bauern transformiert. Dabei kam es während des Pleistozäns zu einer Abnahme der Wildtierpopulationen und der Jagderträge, zu einem Massensterben der Megafauna und zu einem Rückgang der Savannen. Durch die nacheiszeitliche Entstehung von Flüssen und Seen wurde Fischfang möglich sowie die Domestikation von Tieren und Pflanzen. Daraus entstand ein zunehmender Prozess von Sesshaftigkeit und Abhängigkeit von lokal konzentrierten Ressourcen. Die Bevölkerungszahlen nahmen zu und Distanzen zwischen den Dörfern nahmen ab. Konflikte wurden trotz genügender Ressourcen als Kriege intensiviert, weil Lokalgruppen einander nicht mehr ausweichen und vertrauen konnten. Der Autor zitiert zahlreiche Literatur, wonach Kriege historisch erstmals im Meso-­‐ und Neolithikum entstanden seien, auch wenn es Gewalt zwischen Einzelpersonen auch in Wildbeutergesellschaften gegeben habe. Die im Beispiel 3 beschriebenen Prozesse müssten auch in der Steinzeit zwischen lokalen Gruppen so abgelaufen sein, da jede Gruppe ihr Überleben nur mit militärischer Stärke und Allianzen sichern konnte. Eine Strategie der einseitigen Friedfertigkeit hätte andere Gruppen lediglich zu Überfällen ermuntert. Hingegen konnte ein übergeordneter Staat (bzw. ein Reich) mit zentraler Sanktionsgewalt die Kriege zwischen lokalen Gruppen verhindern, was denn auch schon in der Steinzeit eingeführt wurde. Die Entstehung einer kriegerischen Umwelt sieht Helbling also als das nicht beabsichtigte Resultat von Sesshaftigkeit in einem anarchischen System. Sie brachte den Menschen aber keine Vorteile, da diese sich mit hohen Rüstungskosten und Verlusten von Menschenleben und Ressourcen an diese Lebensweise anpassen mussten. Knappheit an Ressourcen und Frauen waren daher Folgen, nicht Ursachen eines endemischen Kriegszustandes. Weitere Überlegungen widmet der Autor nun noch dem Verhältnis zwischen dem Handeln des Einzelnen (Akteurstrategie) und der Gruppenselektion. Unabhängig vom Staat schliessen sich Akteure zu Gruppen zusammen, weil die individuellen Vorteile darin grösser sind als ausserhalb einer Gruppe. Der Einzelne verzichtet deshalb auf individuelle Vorteile zugunsten der Vorteile in der Gruppe. Diese müssen aber grösser sein als allfällige Nachteile durch erzwungene Gruppenkonformität. Solche entstehen, weil innerhalb der Gruppen wie in Staaten Normen, Werte, Sanktionen und Institutionen als Selektionsbedingungen herrschen. Die Sanktionen können positiv sein (Belohnung) oder negativ (Bestrafung). Die Art der Gruppenselektion, etwa Krieg oder natürliches Habitat, hat Rückwirkungen auf die Normen und Werte und damit auf die Präferenzen der Akteure. Ein Mann kann entweder als mutiger Krieger geachtet sein oder umgekehrt als geschickter Jäger. Eine Mutter kann ebenso mit zahlreichen Söhnen, also heranwachsenden Soldaten, einen guten Ruf erlangen oder umgekehrt als kundige Sammlerin. Gruppen-­‐ und individuelle Selektion sind so gleichzeitig wirksam, können aber auch Zielkonflikte erzeugen. Zum Beispiel können die Interessen des Einzelnen der Gruppe schaden, oder die Normen und Werte der Gruppe können vom Einzelnen einen zu hohen Verzicht auf eigene Vorteile verlangen. Auch in dieser Beziehung vergleicht Helbling tribale Feldbaugesellschaften mit Wildbeutergesellschaften: Im Beispiel 3, in den kriegerischen Feldbaugesellschaften Neuguineas, belasten Knollenanbau, Schweinezucht, Feste für Alliierte und die Ausdehnung der Gruppengrösse die Ressourcen, sind aber militärisch unumgänglich. Dieser Selektionsfaktor ist rückgekoppelt mit Handlungsnormen und Idealen, welche Gewaltbereitschaft prämieren. Die gruppeninterne Selektion belohnt kampfbereite Männer, Akteure, die viele Schweine für die Alliierten bereitstellen und Mütter mit vielen Söhnen. Trotzdem kommt Trittbrettfahren häufig vor, weil es mehr individuelle Vorteile bietet, als im Krieg getötet oder verwundet zu werden oder die Familien zu verlieren. Die Anführer gelten als kluge Organisatoren von Kriegen, Diplomaten bei Alliierten und mutige Kämpfer. Sie konstruieren daraus ihre Macht und Reputation und sie üben Druck auf die Gruppenmitglieder aus, in den Krieg zu ziehen. Da dies nicht bei allen gelingt, entsteht eine Präferenzhierarchie der Akteure, d.h. je mehr mutige Krieger sich finden, je weniger Trittbrettfahrer darunter sind, desto eher überlebt die Gruppe in der kriegerischen Umwelt. Umgekehrt ist es wiederum in den Wildbeutergesellschaften von Beispiel 4. Die Interessen der Individuen und der Gruppe divergieren weniger stark, da es für beide lediglich um einen kurzfristigen Ertrag aus den Ressourcen eines Areals geht, welches wenig später wieder verlassen wird. Die individuelle Mobilität zwischen den Gruppen führt zudem zu einer unbeabsichtigten Anpassung der Gruppengrösse an die Ressourcen. Die Jagdbeute wird unter allen Gruppenmitgliedern gleichmässig aufgeteilt. Auch hier gibt es Trittbrettfahrer in Form von faulen Jägern. Die fleissigen Jäger produzieren somit einen externen Nutzen für die Gruppe und drosseln mit der Zeit ihren Jagdeifer, um nicht ausgenutzt zu werden. Dadurch sinkt der Gesamtertrag der Gruppe. Trotzdem wird an der gleichmässigen Verteilung der Beute festgehalten, sofern die Gruppe in ihrer Zusammensetzung stabil bleibt. Da aber viele Akteure die Gruppe oft wechseln, werden die Beuteanteile mit Präferenz an Individuen verteilt, von denen man früher auch schon einen Anteil erhalten hatte, an andere aber nicht. Gruppenkonformes, altruistisches Verhalten wird also belohnt, egoistisches Verhalten wird hingegen bestraft, selbst wenn es sich um Verwandte handelt. Hier decken sich die Beobachtungen des Autors mit der bekannten „Spieltheorie“, welche er denn auch zur Erklärung von Kriegen zwischen Verwandten in tribalen Gesellschaften heranzieht. Zum Schluss betont Helbling noch einmal, dass der darwin‘sche Forschungsansatz wichtige sozialwissenschaftliche Probleme wie Kooperation, Akteurstrategien, Konflikte, Gruppenkonkurrenz und sozialen Wandel erklären kann, dass man ihn dazu aber aus seinem biologisch-­‐genetischen Kontext herauslösen muss. Man kommt hier vom Begriff der biologischen Evolution zur kulturellen und sozialen Evolution. Das Grundprinzip ist aber dasselbe, dass es nämlich Phänomene gibt, die variieren und dass die Variationen einer Selektion durch die Umwelt und in Koevolution durch andere Individuen und Gruppen unterliegen. 7.4 DIETRICH, V.J., Die Wiege der abendländischen Kultur und die minoische Katastrophe – ein Vulkan verändert die Welt. In: Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2005) Prof. Dr. Volker J. Dietrich, Institut für Mineralogie und Petrographie, ETH Zürich Literaturbericht, wb Der Autor hat 15 Jahre auf Forschungs-­‐ und Segelschiffen in der Ägäis verbracht und stiess schon früh auf den Kykladeninseln Paros und Antiparos auf fussballgrosse Lavafindlinge, die nach ihrer mineralogischen Zusammensetzung nur von der Vulkaninsel Santorin stammen konnten. Die Ausgrabungen auf Santorin hatten unter gut 100 Meter dicken Bimsmassen die minoische Stadt Akrotiri wieder zum Vorschein gebracht. Sie hatte einen natürlichen Hafen und die aufgefundenen Fresken zeigten Zeugnisse eines ausgedehnten Seehandels auf Langschiffen. Um die Entwicklung der bronzezeitlichen ägäischen Kulturen zu verstehen, zeigt Dietrich die steinzeitlichen Frühkulturen und ihre klimatischen Verhältnisse der letzten 20‘000 Jahre auf. Aus der frühen und mittleren Steinzeit, dem Paläolithikum 20 000 – 8300 v.Chr. und dem Mesolithikum 8300-­‐6000 v.Chr. sind nomadisierende Wildbeutergesellschaften bekannt. Danach traten in gradueller Entwicklung im unvereisten Vorland der alpinen Gebirge die ersten sesshaften Ackerbauern und Viehzüchter auf. Der Meeresspiegel in der Ägäis lag in der letzten Eiszeit um bis zu 120 m tiefer als heute. Die Landoberfläche der Ägäischen Inseln war deshalb noch in der Frühsteinzeit wesentlich grösser. Kulturelle Erzeugnisse aus dieser vorkeramischen Zeit stammen aus Höhlen und Kleinsiedlungen und beinhalten Gerätschaften für Haushalt und Garten, sowie Waffen wie Speere und Steinbeile. Es finden sich aber auch Figurinen aus gebranntem Ton und erster Schmuck. Die als „Venus-­‐Kult“ bezeichnete Darstellung weiblicher Körper lassen auf eine weibliche Dominanz im Sinnbild der Geburt und der Inkarnation schliessen. Zwischen 13 000 und 11 000 Jahren v.Chr. wurden durch die grossen Schmelzwassermengen riesige Küstengebiete des Schwarzen und des Kaspischen Meeres überflutet und die Süsswasser des Kaspischen Meeres ergossen sich ins Schwarze Meer und über den Bosporus ins Marmarameer. Ein Durchbruch von Meerwasser füllte in kurzer Zeit das Becken des Golfs von Korinth sintflutartig auf. Grosse, mit Schmelzwasser gefüllte, mäandrische Flüsse verwandelten die eiszeitlichen Steppenlandschaften in fruchtbare Tiefebenen. Ein tief greifendes Ereignis setzte zwischen 7500 und 7200 Jahren ein, indem durch den Anstieg des Wasserspiegels im östlichen Mittelmeer und durch grössere Erdbeben der Bosporus einbrach. Innerhalb weniger Jahrzehnte ergoss sich Meerwasser aus der Marmarasee ins Schwarze Meer. Funde aus versunkenen Siedlungen und Terrassenbeständen belegen dieses katastrophale Ereignis. Die Siedler wanderten nach Süden und Westen aus und wurden zu sesshaften Bauern einerseits in den Urstromtälern von Euphrat, Tigris und Jordan („fruchtbarer Halbmond“), anderseits in den Ebenen Makedoniens und Thessaliens. Das Klima erwärmte sich erstmal zwischen 12 000 und 10 000 vor heute (Alleröd-­‐Zeit), worauf für 1000 Jahre nochmals eine Abkühlung erfolgte (Dryas). Erst danach setzte sich die nacheiszeitliche Erwärmung durch und führte zu einem trockenen Klima (Praeboreal). Im Boreal (7000-­‐6000 v.Chr.) und im Atlantikum (6000-­‐3000 v.Chr. herrschte ein warm-­‐feuchtes Klima mit üppiger Vegetationsentfaltung. Daraus resultierte die Bevölkerungsexplosion mit Ackerbau und Viehzucht im östlichen Mittelmeerraum. Der Autor verfügt über modernste archäologische Daten, welche eine progressive Entwicklung des Kulturgutes der ägäischen Inselwelt und des griechischen Festlandes im Neolithikum, 6500-­‐3300 v.Chr., belegen. Entscheidende Elemente waren offenbar die Schifffahrt und das Bevölkerungswachstum. Die grösseren Inseln Rhodos, Zypern und Kreta wurden schon im 7. Jahrtausend von Südanatolien her besiedelt. Die Sporaden wurden im 6. Jahrtausend von Thessalien her und die Kykladen schon im 8. Jahrtausend von der Argolis her zum Fischfang benutzt. Dietrich führt 51 neolithische Siedlungen in Griechenland und der ägäischen Inselwelt an. Es wurden Knochenreste von Ziegen und Schafen sowie Samen von Weizen, Gerste, Hafer und Linsen gefunden. Obsidian, das schwarze, harte vulkanische Glas, wurde als Schneidewerkzeug und Pfeil-­‐ und Speerspitzen gefunden und stammte von der Kykladeninsel Milos. Einfarbige gebrannte Töpferware tauchte auf und um 5000 v.Chr. die ersten Angelhaken. Die Keramik-­‐Brenntemperatur konnte schliesslich auf 800° gesteigert werden, womit farblich und formlich vielfältige „Bandkeramik“ mit Glasur (Urfirnis) möglich wurde. Der weiträumige Tauschhandel ist aus dieser Zeit nachgewiesen. Die ersten Schiffe der Siedler und Fischer waren flossähnliche, aus Schilf und Bambus geflochtene, mit Häuten verstärkte Boote. Damit konnten nur kleine Distanzen bei ruhiger See bewältigt werden. Eine eigentliche maritime Entwicklung war noch nicht möglich. Immerhin gab es um ca. 4000 v.Chr. ein nahezu industrielles Zentrum für Obsidian Pfeilspitzen auf den Kykladen, 60 km von Milos entfernt. Keramikprodukte und Kultformen bekamen bereits regionale Eigenständigkeiten. Befestigungsanlagen bestanden aber nicht. Hingegen entstand auf den Insel Limnos eine erste Stadtkultur mit ca. 1500 Einwohnern. Die Inseln wurden mit Fischfang, Schiffahrt und Handel zunehmend verknüpft, wobei die Kykladen und Santorin an Bedeutung gewannen. Kreta entwickelte sich dank seiner Grösse eigenständig, hatte aber engen Kontakt mit den ägäischen Inseln, Kleinasien und Nordafrika. Im gesamten östlichen Mittelmeerraum bis in den Vorderen Orient und Ägypten hatte sich ein auf die Mutterschaft konzentrierter Inkarnationsglaube etabliert, welcher von zahlreichen weiblichen Figurinen ähnlich der bekannten „Venus von Willendorf „ (ca. 20‘000 v.Chr.) dokumentiert wird. Die Frau war Herrin des Hauses und mit üppigen Körperformen das Idealbild des Mannes. In der Natur sah man Parallelen dazu durch das jährliche Wiedererblühen der Pflanzen. Die Fortpflanzung der Tierwelt zu den immer wieder genau gleichen Kreaturen schien auf das Prinzip einer Wiedergeburt hinzuweisen. Diese naturverbundene Weltanschauung wurde zu einer Religion, welche von Gott-­‐Mutter-­‐Gestalten und Göttinnen dominiert wurde. Gerade Kreta war reich an Kultstätten und symbolischen Gegenständen wie Opfertischen, Kelchen und Schalen. Gegen Ende der Jungsteinzeit im 4. Jahrtausend wurden die Behausungen besser befestigt und der Handel zwischen den Inseln mit Obsidian und Agrarprodukten nahm zu. Die Kenntnisse der Schifffahrt wurden damit zu einem dominierenden Faktor, welcher vor den benachbarten Grossreichen der Hettiter, Sumerer und Ägypter einen gewissen Schutz bot. Die Inselbewohner hatten uneingeschränkten Zugang zu allen Handelsgütern, wurden wohlhabend und erfuhren eine grössere soziale Differenzierung. Im 3. Jahrtausend v.Chr. zeigten sich bereits Inseltypische Kulturen in der Keramik, in Ornamenten und Marmorfiguren. Als Kupferzeit, Chalcolithicum, 4500-­‐3500 v.Chr. bezeichnet man eine Übergangsperiode von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit. Dies beruht einerseits auf zahlreichen Funden von Kupferwaren um das ganze östliche Mittelmeer aus dieser Zeit. Anderseits ist der Begriff auch Ausdruck der Tatsache, dass Bronze nicht einfach von einem Tag zum anderen erfunden wurde, sondern in einer umfangreichen empirischen Metallurgie mit zahlreichen Lager-­‐ und Verarbeitungsstätten langsam entwickelt wurde. Auch Eisenerze wurden schon im Paläolithikum in der Nordägäis abgebaut, dienten aber lediglich als Rotocker-­‐Farbe für Höhlen-­‐ und Körperbemalungen. Im Neolithikum waren Thasos, Chalchidiki und Thrazien Rohstoffregionen für Kupfererze, Gold und Zinnstein. Vulkane und Hydrothermalsysteme im östlichen Mittelmeer liessen Erzlagerstätten auf fast allen ägäischen Inseln entstehen. In der Frühphase der Metallverarbeitung wurde weiches Kupfer mit Steinwerkzeugen zu Äxten, Beilen, Pfeil-­‐ und Speerspitzen bearbeitet. Gold wurde für Schmuck verwendet. Später wurden kupferhaltige Erzklumpen vermahlen, mit Holzkohle vermischt und bei 1000° erhielt man flüssiges Kupfer und Blei. Die Bronzemetallurgie begann mit der Vermischung von Kupfer zu 85% mit Zinn zu 15%, welche in eine Bronze-­‐ Schmelze übergeführt und in Formen gegossen wurde. Die Abgüsse wurden schliesslich verfeinert und mit Einlagen von Gold, Silber und Edelsteinen zu kunstvollen Gegenständen und Waffen verarbeitet. Die eigentliche Bronzezeit, 3300-­‐1000 v.Chr. war durch die Etablierung von Dynastien in Mesopotamien und Ägypten gekennzeichnet. Diese basierten auf dem technologischen Fortschritt der Bronzeprodukten und Waffen, der Transportmittel auf Rädern und dem Bau hölzerner Schiffe. Demgegenüber blieb es auf dem griechischen Festland und auf Kreta bei kleinen agrikulturellen Siedlungen. In der kykladischen Inselwelt blühte hingegen der Rohstoffhandel mit Kupfer, Blei, Silber und Gold aus Attika, dem Peloponnes und einigen Inseln, besonders Milos mit ihren zahlreichen Bodenschätzen. Um 2700 v.Chr. kamen offenbar die ersten Langboote aus Zedernholz aus der Levante in Gebrauch. Sie hatten die Form eines Fisches, einen breiten, tiefliegenden Bug, waren 10-­‐12m lang und konnten mit bis zu 20 km/h gerudert werden. Auf ihnen beruhte der Beginn der Seefahrt im östlichen Mittelmeer. Der Handel ist mit Keilschrifttafeln aus dieser Zeit belegt. Man spricht nun von einer kykladischen Gesellschaft von Fischern, Händlern und Kunstproduzenten, in welcher die Frau eine höhere intellektuelle und religiöse Stellung innehatte und eine Verbindung zu einer Gottheit hatte. Männer wurden meistens mit Waffen dargestellt und scheinen eine erste hierarchische Ordnung eingeleitet zu haben. Das Ende dieser Kultur ging einher mit den kriegerischen Wirren rivalisierender Stadtstaaten wie Ur, Babylon, Ashur und Sippor und durch die Bildung des Akkadischen Reiches in der Levante. Befestigungsanlagen erschienen nun bei allen grösseren Siedlungen mit Ausnahme von Kreta. Erst nach dem Zerfall des kriegerischen akkadischen Reiches kam wieder der Handel auf mit den Küstenstädten der Levante (Ugarit, Arrad, Biblos etc.) und nun auch mit Ägypten unter Pharao Sesostris I. Man spricht nun von der Minoisch-­‐Kykladischen Kultur, 2000-­‐1628 v.Chr., welche den Kykladern auf den Inseln der Ägäis neuen Wohlstand brachte. Der Schiffsbau war klar von ägyptischen Nilschiffen dominiert. Bis 20m lange und 4m breite Einmastsegler mit symmetrischen Holzrümpfen und zusätzlicher Ruderbesatzung erlaubten Seefahrten auf dem offenen Meer, auch bei schlechtem Wetter. Sie konnten nun auch Kreta erreichen, das bisher eine eigene, abgeschottete, sich selbst ernährende Lebenswelt dargestellt hatte. Es gab dort weder Befestigungsanlagen noch eine Waffenindustrie und auch keine metallischen Rohstoffe. Es war jedoch reich an Agrarprodukten und begann nun einen blühenden Handel mit Rohstoffen und Textilien aus der Levante und Ägypten. Es entstanden Herrschaftshäuser, die Keramikkunst blühte auf und minoische Handelsniederlassungen entstanden im ganzen östlichen Mittelmeer unabhängig von den Kykladern. Eine besondere Stellung hatte die Vulkaninsel Santorin, damals „Kallisti“ (die Schönste) genannt. Sie war eine Ringinsel, die um einen Calderakrater, also einen Einbruchkrater einer weit zurückliegenden Eruption, angeordnet war. Sie stellte einen natürlichen Hafen dar, welcher zahlreichen Schiffen Schutz und den Einwohnern grosse Handelsvorteile bot. Die Fresken in der ausgegrabenen Stadt Akrotiri zeigen das Leben in Wohlstand und die Existenz von Werften, in denen Schiffe aus Eiche, Papel oder Lärche gebaut wurden. Diese stammten aus Ägypten oder Kreta, ebenso die Segel und Takelage. Die minoischen Galeeren hatten eigene Typen entwickelt, welche zur Wasserung und Beladung eine ausklappbare Heckplattform hatten. Sie hatten flache Böden und wurden zur Stabilisierung mit Steinen beschwert, welche je nach Situation auch wieder abgeworfen werden konnten. Eine Kapitänskajüte bot den Kadern der Mannschaft Schutz. Die Ruderer waren zugleich Krieger und etwa 20-­‐40 Mann an der Zahl. Die Fresken von Akrotiri lassen den Schluss zu, dass eine eigentliche kykladisch-­‐minoische Seeherrschaft existierte, wobei grosse Flotten von Handels-­‐ und Kriegsschiffen die Waren von und zu den Häfen in Ägypten, der Levante und Kleinasiens transportierten. Ein Bild zeigt sogar eine Siegesfeier für eine heimkehrende Flotte, welche von einer Priesterin begrüsst wird. Auf Kreta selbst entwickelte sich eine reiche Kultur an Agrarprodukten (Oliven, Getreide, Öl und Wein) und an importierten Rohstoffen und Gold, Elfenbein, Edelstein und Seide. Die bestehenden Siedlungen wurden durch Adaption architektonischer Elemente aus der Levante und aus Ägypten zu luxuriösen Herrenhäusern und Palästen erweitert (Palast-­‐Kultur). Bekannt sind vor allem die vier Anlagen von Knossos, Mallia, Phaistos und Zakros. Es waren aber nicht „Königspaläste“, sondern Herrschaftshäuser der adligen Grossfamilien, die laufend erweitert werden konnten und einen Innenhof aufwiesen. Die Keramikprodukte zeigen in -­‐Der „Diskos von Phaistos“, Tontafel aus minoischer Zeit, Mitte des 17. Jahrhunderts v.Chr. Fundort Phaistos, Kreta, aus: O DISKOS THS FAISTOY, Heraklion 2006 [66] verschiedenen Stilarten (Palaststil, Kamaresstil) die hochentwickelte Lebensart der Minoer, welche auch in Musik und Sport ihren Ausdruck fand. Im Gegensatz zu den Kykladern betrieben die minoischen Kreter kaum Waffentechnik oder militärische Anlagen. Ihre von natürlicher Harmonie getragene Religion kannte keine bösen Geister und musste keinen Glauben erzwingen, sondern bestand aus einem matriarchalischen System von jungen, hübschen, fruchtbaren Göttinnen, die von jungen Jägern umgeben waren. Weibliche Marmor-­‐Idole symbolisierten als Grabbeilagen die Inkarnation, die Spende neuen Lebens. Grosse Tempelanlagen gab es keine. Minoische Herrscher wurden mit einer religiösen Zeremonie als Inkarnation einer „lebenden Göttin“ eingesetzt. Auf dem „Diskos von Phaistos“ findet sich eine zeremonielle Beschreibung in Pictographien, die teilweise entziffert sind. Der minoische Mann symbolisierte seine Kraft mit dem Bild des Stieres und seinen Hörnern. Stierspringen war eine beliebte Sportart zwischen Frauen und Männern. Aus den Hörnern des Stieres entstand die abstrahierte minoische Doppelaxt. Neben den erwähnten Pictographien auf rituellen, runden Tontafeln gab es auf Siegeln kleinere Hieroglyphen Texte. Zusätzlich gab es auf rechteckigen Tontafeln, Vasen und rituellen Gegenständen eine Silbenschrift, die heute als „Linear A“ bezeichnet wird und Elemente der proto-­‐
phönizischen Zeichenschrift und ägyptischer Hieroglyphen enthält. Prof. V. Dietrich beschreibt nun, wie um 1628 v.Chr. der Vulkanausbruch von Santorin / Kallisti diese in Jahrhunderten und Jahrtausenden gewachsene Kultur so nachhaltig zerstörte, dass praktisch nichts mehr davon übrig blieb. Die Eruptionsgeschichte dieses Vulkans kann heute anhand der pyroklastischen Ablagerungen, ihrer regionalen Verbreitung und der von anderen grossen Vulkanausbrüchen bekannten Prozesse abgeleitet und rekonstruiert werden. Die Katastrophe bahnte sich mehrere Monate vorher an. Im Zentrum der Ringinsel traten übel riechende Gase aus, das Wasser wurde siedend heiss und Erdbeben erschütterten den Boden. Da solche Phänomene bis dahin niemandem bekannt gewesen waren, müssen sie wohl als Zeichen erzürnter Gottheiten gedeutet worden sein. Nahezu alle Bewohner scheinen die Insel samt ihrer Habe verlassen zu haben. Bis zum Beginn der Eruption muss aber noch eine Regenzeit stattgefunden haben und einige Menschen kamen nochmals zurück und führten an Häusern und Strassen Reparaturarbeiten aus. Als die eigentliche Eruption begann, liessen sie ihre Werkzeuge zurück und flohen überstürzt. Die Eruption begann mit einer explosiven Vorläuferphase von mehreren Wochen, in welcher hydroklastische Wasserdampfexplosionen eine Spalte im Schildvulkan bewirkten. Die nachfolgende Aschensäule erreichte bereits 10 km Höhe und eine erste Ascheschicht bedeckte die Stadt Akrotiri. Darauf folgte eine starke Explosion, während der in wenigen Stunden etwa 2 km3 Magma gefördert wurden und mehrere Dezimeter Ablagerungen hinterliessen. Die Aschensäule erreichte nun eine Höhe von 35 km und verdunkelte den Himmel vollständig. Starke Winde bliesen die Asche nach Südosten. Nach einigen Tagen oder Wochen kam es zu einer zweiten, wesentlich stärkeren Eruption. Die Aschensäule hatte eine Temperatur von bis zu 300° und ergoss sich über die Insel. Asche aus dieser zeitlich nicht genau abgrenzbaren Phase fand sich in Kleinasien, Syrien, Israel und im Nildelta. Eine dritte Phase folgte analog der zweiten Eruption und öffnete den Krater auf die heute bekannte Grösse der Caldera. Die vierte und stärkste Phase war durch pyroklastische Ströme und Aschenwolken gekennzeichnet, die bis in die Stratosphäre reichten und hochtemperierte Glutwolken in Bodennähe erzeugten. Insgesamt wurden 30-­‐40 km3 Magma ausgeworfen, die vierzigfache Menge der bei der Mt.-­‐St.-­‐
Helens-­‐Eruption 1980 geförderten Gesteine. Dabei kam es zu submarinen Hangrutschungen und frontalen Druckwellen, welche bereits erste Tsunamis, Riesenwellen, verursachten. Der so entstandene Explosionskrater füllte sich mit Schutt und Schlamm und brach nach einigen Tagen ein. Ein Bereich von 5 x 10 km sank in mehreren Phasen bis zu 800 m tief ein und löste massive Schwankungen des Meeresspiegels aus, was nun als Riesentsunami in Erscheinung trat. Mit diesen Wellen wurden grosse Mengen an Bims und Schutt nach Kreta und zu den östlichen Küsten des Mittelmeeres verfrachtet. Dietrich schätzt die Höhe der Riesenwellen auf 50 – 100 m und die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung auf bis zu 100 km/h. Die Flutwellen hatten damit ein riesiges Zerstörungspotential an den Küsten, an denen sie aufliefen. Auf Kreta wurden sicher die Orte Mallia und Phaistos sowie die Flottenbasis Kato Zakro zerstört, und auf Rhodos die Küstenstadt Kyrbe. In Sagen und Überlieferungen wird von zerstörerischen Wellen an den Küsten Kretas und Rhodos, des Peloponnes, im Golf von Argolis, im Saronischen Golf, und in Attika berichtet. Deukalion, der Stammvater der Hellenen, rettet sich gemäss der Legende aus der Flut, mit der Zeus die Menschen vernichten wollte. Der Autor geht davon aus, dass nach den vorangehenden Erdbeben die Tsunamis in Kreta massive Vernichtungen der Behausungen und Kulturen angerichtet hatten. Die Paläste, nahe der Küste gelegen, fielen ihnen zum Opfer, die Kommunikation brach zusammen und Anarchie und Chaos stellten sich unmittelbar ein. Die gesamten Flotten waren zerschlagen, ebenso Vorratshäuser und Handelswaren. Der Glaube an die friedfertige Natur erlosch, übermächtige, erzürnte Götter waren vom Himmel und aus dem Meer gestiegen, das Böse verkörpernd. Die wohlhabende Elite verliess Kreta auf Schiffen, die Landbevölkerung blieb zurück. Auf anderen Inseln und auf dem griechischen Festland wurden neue Niederlassungen gegründet, die nun befestigt und militärisch organisiert waren. Die matriarchalische minoische Religion wich einem imperialistischen Polytheismus. Zeus, der allmächtige Gottvater, gebot über die anderen Götter, die menschliche Eigenschaften besassen und sich mit den Menschen vermischen konnten, um „Halbgötter“ hervorzubringen. (Einheimische Kreter nehmen heute noch an, dass auch Menschen geopfert wurden, um die Götter zu besänftigen. Man habe besonders schöne, grosse, junge Paare dazu ausgesucht. Red., nicht dokumentiert). Auf dem Peloponnes entstand die neue Kultur der „goldenen mykenischen Epoche“ und ihre Städte wurden von Rittern, Generälen und Fürsten regiert. Die Neuordnung basierte auf militärischen Grundsätzen und das Streben nach Macht und Reichtum prägte die Gesellschaften. Bronzewaffen wurden nun in grossen Mengen produziert, einachsige Kampfwagen wurden eingeführt, neue Paläste wurden monumental auf Hügeln gebaut wie etwa die Akropolis von Mykene, vergoldete Rüstungen wurden zu Standessymbolen, ein elitärer monumentaler Totenkult wurde eingeführt und von den Phöniziern wurde eine konsequente Buchstaben-­‐ und Zahlenschrift abgewandelt übernommen (Linear-­‐B), welche die Grundlage für das spätere Griechische Alphabeth wurde. Dieses Militärreich der Mykener hinterliess mehrere monumentale Grabstätten mit grossen Waffen-­‐ und Goldfunden. Gesunkene, heute geborgene Handelsschiffe dokumentieren mit ihren Rohstoffen, Schmuckwaren, Keramikprodukten und Waffen die Handelsbeziehungen im ganzen Mittelmeerraum. Auch auf Kreta stellte sich die Militärherrschaft und Administration der Mykener ein. Mit Hilfe der Seefahrtskenntnisse von früher konnte die Verbindung zum Peloponnes aufrechterhalten werden. Die Paläste wurden repariert und auf Hügeln wurden neue Befestigungen errichtet. Der Handel mit der Levante und Ägypten wurde von zypriotischen Seefahrern durchgeführt. Die Mykener zeigten aber kein grosses Interesse an Kreta, da es weiterhin starke Erdbeben gab und da das griechische Festland von den Bodenschätzen her wesentlich interessanter war. Auch Troja war als Tor zu Kleinasien attraktiv und möglicherweise trugen die Feldzüge in dieser Richtung sowie die Einfälle der Dorer zum Untergang der Mykener um 1100 v.Chr. bei. Dietrich vermutet aber wiederum, dass zahlreiche starke Erdbeben die sozialen Strukturen der Mykener aufgeweicht und damit den Niedergang hauptsächlich herbeigeführt hätten. Prof. Dietrich betont, dass die Veränderungen in Kultur, Politik und Religion im östlichen Mittelmeerraum der letzten 10000 Jahre vielmehr durch die geo-­‐dynamischen Aktivitäten der Erdkruste verursacht wurden, als etwa durch räuberische, kriegerische Überfälle. Grosse Erdbeben hinterlassen augenblicklich totale Verwüstung, Brände, soziales Chaos, Plünderungen und Anarchie. In früheren Zeiten waren diese Veränderungen noch tiefgreifender infolge fehlender Kommunikations-­‐ und Transportmittel. Eine Hinwendung zu militärisch-­‐patriarchalischen Gesellschaften war oft die Folge davon. 7.5 Neolithic Art in Romania WULLSCHLEGER, M., CHAMAY, L., VAN DER WIEHLEN, F., Neolithic Art in Romania. Katalog zur Ausstellung „Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus Rumänien“, Historisches Museum Olten, 2008 Buchbesprechung, wb 1. Die Neusteinzeit im Donau-­‐Karpathen Gebiet Die Klimatischen Bedingungen hatten sich zum Beginn des Holozäns wesentliche verändert. Zwischen 8000 und 6500 Jahren v.Chr. entwickelten sich die Flora und Fauna zum heutigen Muster. Wälder und Prärien hatten die arktische Tundra der Eiszeit ersetzt und boten den Menschen reichlich Nahrung und Wild. Im heutigen Rumänien lebten damals sowie auch in Zentraleuropa und nördlich des Schwarzen Meeres mobile Jäger-­‐ und Sammlergesellschaften. Wann die ersten Kontakte zu neusteinzeitlichem Lebensstyl stattfanden, ist unklar. Immerhin entwickelte sich für kurze Zeit die „Schela Cladovei-­‐Kultur“, von welcher bereits eine grössere Zahl unterschiedlicher Werkzeuge und Wohnhäuser gefunden wurden. Sogar Spuren spiritueller Rituale konnten identifiziert werden. Der Übergang zu Sesshaftigkeit, Landwirtschaft und Viehzucht wurde offenbar durch den Zufluss von Neuzuzügern zur ansässigen Gesellschaft gebracht und stellte eine ideologische Revolution dar. Trotz der Sesshaftigkeit kam es aber doch stets zu Umzügen in andere nahe gelegene Gebiete. Die archäologischen Daten wie etwa die Einteilung der Häuser lassen darauf schliessen, dass die Familie und die nahe Verwandtschaft das Fundament der gesellschaftlichen Gruppen war. Die grundlegende Transformation der Gesellschaften zeigt sich auch in religiösen Belangen. Aufgrund der zahlreichen Figurinen, welche Frauen darstellten, kann vermutet werden, dass diese eine hohe Stellung innehatten. Das ethno-­‐kulturelle Phänomen, welches 7. Jahrtausend v.Chr. im Donaugebiet zur Herausbildung der neusteinzeitlichen Zivilisation führte, kam dann aus dem Süden, nämlich aus dem heutigen Griechenland. Wie die Beziehungen zu den ansässigen Jäger-­‐ und Sammlergesellschaften sich gestalteten, ist leider unbekannt. Dies geschah zuerst im Banat und im Donaudelta. Daneben gab es aber auch noch Mittelsteinzeitliche Gesellschaften, welche vor allem vom Fischfang lebten. Sie gebrauchten aber auch schon Töpfereien von Einwanderern. Um 6000 v.Chr. wandten sie sich vom Fischen und Sammeln ab und begannen Viehzucht, Fleischnahrung und Getreideanbau. Dies gehörte nun zum Neusteinzeitlichen Lebensstyl, welcher von Einwanderern mehr und mehr durchgesetzt worden war. Die gefundenen Daten zeigen eine Entwicklung, die etwa zu dieser Zeit in ganz Europa stattfand. Die neusteinzeitliche Landnahme im heutigen Rumänien fand in verschiedenen Wellen statt, welche ihren Ausgang im Süden, z.T. sogar in Anatolien hatten, und zuletzt bis ins Donaudelta vorstiessen. Siedlungen wurden gerne auf Hügeln und Plateaus angelegt, von denen aus die Umgebung eingesehen werden konnte, aber auch in Tälern mit Flüssen und anderen Wasserquellen. Die Häuser wurden aus Holz und Schilf rechteckig gebaut und hatten 1-­‐3 Räume auf gut 20 – 100 m2. Sie scheinen von je einer Familie bewohnt gewesen zu sein. Es wurden sogar obere Stockwerke gefunden, was auf eine Grossfamilie mit Grosseltern schliessen lässt. Ställe für Haustiere wurden in nächster Umgebung der Wohnhäuser gefunden. Die Räume hatten meist einen Ofen und wurden zum Schlafen sowie tags zum Kochen, Handwerken und zu sozialen Zwecken gebraucht. Dörfer bestanden aus Häusern, die in Reihen aneinander gefügt wurden. In ihrer Mitte gab es oft ein grosses Gebäude zu kultischem Zweck und auch Befestigungen wurden gefunden. Die Siedlungen hatten einen Abstand von etwa 8-­‐10 km zu einander, so dass das dazwischen liegende Land aufgeteilt und kontrolliert werden konnte. Einzelne Siedlungen zeichneten sich aus durch grössere Funde von Handelsware, Rohmaterialien wie Gold oder Kupfer, Kunstgegenständen und verzierten Werkzeugen. Andere wieder lassen auf religiöse Zentren schliessen, welche von führenden Familien mit besonderer Stellung und mit Sammlungen von Prestigeobjekten regiert wurden. Während dem vor der Neusteinzeit keine Befestigungen vorkamen, gab es nun Befestigungsringe aus Holz, welche entweder eine ganze Siedlung oder den inneren Teil umschlossen. Die neue Ära war also gekennzeichnet durch Landwirtschaft, Viehbestand, soziale Gruppierung und Verteidigung. Die Sesshaftigkeit liess dem Menschen die Zeit und das Leben zu etwas Stabilem werden, welches sich in einem Heim abspielte. Es war dann vielleicht logisch, dass auch die Zeit nach dem Tod ein Heim brauchte. Das Grab wurde zu einem Ort, in welchem der Mensch entsprechend seinem Status weiter leben konnte. Ein genaues Bild der Vorstellungen zu einer Existenz nach dem Tod ist aus jener Zeit aber nicht eruierbar, wenn auch Grabbeigaben wie Schmuck oder Werkzeuge einen solchen Glauben vermuten lassen. Während in der frühen Steinzeit die Verstorbenen im Dorf selbst und sogar in den Wohnhäusern begraben wurden, wurden aus späterer Zeit eigentliche Totenstädte gefunden. Die Skelette lagen auf dem Rücken, umgeben von Gegenständen aus ihrem Arbeitsleben, was auf eine fortgeschrittene Arbeitsteilung hinweist. Es sind aber auch andere Bestattungspositionen bekannt, deren Bedeutung nicht klar ist. 2. Die Indo-­‐Europäisierung Die Archäologie zeigt, dass der Übergang von der Neusteinzeit zur Bronzezeit mit der Indo-­‐
Europäisierung zeitlich gekoppelt ist. Historisch gesehen fand damit eine grosse ethnische, kulturelle und ökonomische Umwälzung statt, welche die Landkarte dieses riesigen Gebietes neu strukturierte. Während die ansässigen Menschen von mediterranem Typ mit Palaeo-­‐ und Protoeuropäischen Komponenten waren, brachten die Zuwanderer aus dem Norden grosse und schlanke Individuen und sie machten flache oder hügelige Gräber. Die archäologischen Funde, insbesondre der Töpferware aus dieser Zeit zeigte ihren verschiedenen Stilen, dass während mehrerer Jahrhunderte kleine Gruppen von Zuwanderern eintrafen und mit den Ansässigen zusammenlebten. Die Autoren konnten dies besonders anhand der „Cucuteni“-­‐Kultur zeigen, welche etwa ab 4700 v.Chr. mit einer hochstehenden Töpferkunst hervortrat und mit der Zeit von Produkten minderer Qualität durchsetzt wurde. Das Zusammenleben verschiedener heterogener Gruppen ermöglichte aber offenbar ein gegenseitiges Lernen, welches zu weitgehenden Veränderungen führte. Es kristallisierte sich ein Übergang zur Bronzezeit heraus. In den Karpathen erschienen Siedlungen der sog. „Globular Amphora“-­‐Kultur. Sie waren vorwiegend Hirten, liessen sich auf den Hügeln nieder, hatten eine strenge soziale Hierarchie, andere religiöse Bräuche, ein anderes Nahrungsmittel-­‐Management, einen anderen Häuserbau und andere Formen der Töpferei. Eine ähnliche Entwicklung wurde im Süden der Karpathen gefunden mit dem Zuzug mobiler Gruppen aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres. Hier scheint es aber nicht zu einem Zusammenleben mit ansässigen Einwohnern gekommen zu sein, sondern zu deren Verdrängung. Weiter kam es zu Einflüssen aus der frühen Bronzekultur in Mazedonien, so dass sich insgesamt ein komplexes Bild von Veränderungen ergibt, welche verschiedene Formen mobiler Siedlungen entstehen liess. Die Meinung, die Sesshaftigkeit habe sich in „friedlicher“ und stabiler Landwirtschaft gezeigt, ist nach Meinung der Autoren nicht haltbar. Es herrschte offenbar eine grosse Vielfalt an Jagdmethoden, die sogar noch eine grössere Rolle spielten als zu den Zeiten des Nomadentums. Es wurde in Gruppen gejagt und die Jäger waren Angehörige eines höheren sozialen Status und Spezialisten, die ihre Trophäen auch öffentlich zeigten. Möglichweise diente dies auch zur Einschüchterung von Feinden. Daneben war auch die Fischerei verbreitet. Es wurden Boote gefunden, Steinanker, Fischhaken und Harpunenspitzen. Aus den Fischknochen, Schneckenhäuschen und Muscheln, die in einigen Siedlungen in riesiger Zahl gefunden wurden, kann die Bedeutung der aquatischen Nahrungsquellen bis in 7.Jahrtausend v.Chr. zurück verfolgt werden. Haustiere und Viehzucht waren zum Teil bereits bei ansässigen Gruppen vorhanden, so etwa der Hund, Schafe, Geissen, Schweine und Kühe. Mit den Zuzügern entstand aber erst eine eigentliche, auf Vieh-­‐ und Schweinezucht basierende, sesshafte Argarwirtschaft die aber von Dorf zu Dorf variieren konnte. Über das spirituelle Leben in dieser Zeit gibt es zwar viele archäologische Funde. Bei diesen kann aber oft nur schwer zwischen Kunst und Religion unterschieden werden. Man vermutet, dass die religiösen Bräuche aus Anatolien kamen und dass es vor allem der menschliche Körper war, welcher transzendente Vorstellungen repräsentierte. Die Figurinen wurden offenbar in Serien hergestellt, und von Künstlern individualisiert. Die meisten stellen Frauen dar, später aber auch ein Paar, dessen Erscheinungsbild variierte. Der Kopf konnte etwa durch eine Maske bedeckt sein. Die Mutter-­‐Figuren waren sehr zahlreich, konnten sich vielleicht auf hochstehende Personen beziehen und wurden in verschiedenen Hypostasen dargestellt. Frauenfiguren wurden auch als Gefässe oder als natürliche Figurinen Wasser tragender oder schwangerer Frauen geschaffen. Sie zeigen damit auch einen Einblick in das damalige Alltagsleben. Männliche Figuren wurden meist anthropomorphisch, aber auch zoomorphisch, nämlich als Stier dargestellt. Der Stier, oder auch nur seine Hörner, finden sich in der ganzen Region dieser Zeit in Heiligtümern und Kulträumen. Sie sind aus Terracotta, Stein, Kupfer oder Gold gefertigt. Sie wurden mit Jagdritualen assoziiert und mit magischen Kräften, welche von Beutetieren ausgingen. Kleine zoomorphe Skulpturen waren ebenfalls ein Charakteristikum in der Jungsteinzeit. Es wurden sowohl wilde wie domestizierte Tiere dargestellt. Für Zeremonien scheinen Objekte mit Wildtieren, besonders solche mit Hörnern verwendet worden sein. Einige Kulturen stellten vor allem Skulpturen aus ihrem wirtschaftlichen Bereich her, so etwa Fische, wenn der Fischfang die Hauptnahrungsquelle war. In den Siedlungen gab es Gemeinschaftsräume, deren Bedeutung anhand der darin gefundenen Gegenstände eruiert werden konnte. Einerseits waren es dorfpolitische Versammlungsräume, anderseits konnten sie als Sanktuarien erkannt werden. Der bekannteste Raum wurde im Banat bei der Stadt Parta entdeckt und gilt als der älteste Sakralraum Europas: Er enthielt einen Altar, eine Opferschale, eine anthropomorphe Tonstatue, einen tragbaren Herd und einen Aschekübel. Am gleichen Ort wurde ein 70 m2 grosser, unterteilter Raum gefunden, in welchem sich eine 1.8 m grosse Monumentalskulptur befindet, welche aus zwei Figuren zusammengesetzt ist. Die eine ist eine Frauenfigur, welche als Göttin angesehen wird. Die andere hat einen männlichen Oberkörper und einen Stierkopf, vermutlich ein Gott, denn zu seinen Füssen fanden sich mehrere Opferschalen und Gegenstände aus der Landwirtschaft. In die gegenüberliegende Wand war ein rundes Fester mit einem Halbmond aus Ton eingelassen. In anderen Sanktuarien wurden dekorierte Säulen ausgegraben und Skulpturen, die an die griechischen Fruchtbarkeitsgöttin Demeter erinnern. Die Herstellung von Steinwerkzeugen hatte zwar ein hohes Niveau erreicht, doch wurde immer häufiger Ton eingesetzt, um die Gegenstände des Alltags wie Schüsseln und Trinkgefässe herzustellen. Auch darin hatte sich der menschliche Erfindungsgeist erheblich gesteigert. Anfangs wurden Tontöpfe in Herden gebrannt, später konstruierte man spezielle Installationen wie Öfen mit zwei Kammern. Auch einfache Drehsysteme wurden gefunden, die offenbar von speziellen Handwerkern bedient wurden, um eine grosse Zahl perfekter Gefässe herzustellen. Die Wahl der Formen und Dekorationen zeigt, dass Ausdruck und Überlieferung von Traditionen und Ästhetik existierten. Generell waren die Dekorationen auf der Töpferware figurativ. Es waren geritzte oder farbig gemalte Bänder, Linien, Dreiecke, Kreise oder Rechtecke. Später erhielten die Tongefässe einen metallischen Glanz und das vorherrschende Dekorationselement wurde die Spirale in verschiedenen Formen und Typen. Auch Figurinen wurden lokal verschieden mit Spiralen verziert und poliert. Die kleinen individuell bemalten und dekorierten Skulpturen sind typisch für einige Kulturen der Steinzeit im heutigen Rumänien. Farben waren weiss, rot und schwarz und es entwickelte sich eine Abstraktion der Formen, die für verschiedene Orte typisch war. Die Produkte der Töpferkunst zeigen, dass sich die Steinzeitmenschen eine Umgebung schufen, welche die biologische Realität des Alltags transzendierte und ihrer Existenz eine neue Dimension gab. Prof. Dr. Sebastian Bonhoeffer, 1965 Institut für integrative Biologie, Zürich Studium der Biologie, Physik und Musik PhD und Dissertation in Oxford über theoretische Biologie Rockefeller Universität New York 1999 Friedrich Miesche Institut Basel 2001 Forschungsprofessor ETH Zürich 2005 Professor für theoretische Biologie ETH Zürich 8. Evolution und Medizin 8.1 Ringvorlesung vom 12.11.09, UNI Zürich Evolution und Krankheit. Was Evolution für die Medizin bedeutet Prof. Dr. Sebastian Bonhoeffer, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Referent fokussierte sein Referat auf die Gebiete der Medizin, in denen Evolutionsbiologie als Ursache von Krankheiten sichtbar und in Behandlungskonzepten mit einbezogen wird. Dazu gehören etwa Allergien in einer veränderten Umwelt, Infektionen durch evolvierte Erreger, Krebs, Erbkrankheiten, Schwangerschaftskomplikationen als genetische Konflikte zwischen Kind und Mutter, oder Alzheimer Demenz. In einem ersten Teil widmete sich Prof. Bonhoeffer dem Problem, dass sich der Mensch historisch an eine Umwelt angepasst hatte, welche von unseren Lebensbedingungen der letzten 200 Jahre stark verschieden war. Die heutigen, nachteiligen Konsequenzen aus dieser Anpassung werden als „Hygiene Hypothese“ bezeichnet. Schon 1989 wurde postuliert, dass ein Zusammenhang mit Hygiene in der Kindheit und dem späteren Auftreten von Allergien besteht. Das Allergierisiko soll einhergehen mit einer geringen Zahl von Infektionen in der Kindheit. Diese Hypothese wird nun im Lichte der Epidemiologie von Asthma, einer chronischen Entzündung der Atemwege, betrachtet. Die Daten zeigen, dass Asthma seltener vorkommt bei den jüngeren Geschwistern einer Familie, bei Kindern, die ab dem ersten Lebensjahr Kinderkrippen besuchen, bei Kindern aus Haushalten mit Haustieren und bei Kindern in Entwicklungsländern. Immunologisch erklärt man sich dies mit folgendem Prinzip: Das menschliche Immunsystem verteidigt sich mit verschiedenen Mitteln gegen unterschiedliche Erreger. Der Schutz gegen Wurminfektionen funktioniert auf der Basis von Th2-­‐Helferzellen. Der Schutz gegen Viren und Bakterien, die in die Zellen eindringen, wird dagegen mit Th1-­‐Helferzellen sichergestellt. Da früher Wurminfektionen so häufig waren wie virale und bakterielle Infektionen, hat sich im Immunsystem eine Balance eingestellt zwischen den beiden Typen von Helferzellen. In der westlichen Welt haben die Wurminfektionen indessen massiv abgenommen, womit sich auch die Th-­‐2 Immunantwort zurückgebildet hat. Diese ist aber auch verantwortlich für das Risiko, an Asthma zu erkranken. Solange die Abwehr von Wurminfektionen ein Selektionsvorteil war, hat die natürliche Selektion gut gegen Asthma selektiert. Für unsere heutige Umwelt ist die Anpassung an die früheren Lebensverhältnisse aber ungünstig und hat das erhöhte Auftreten von Asthma zur Folge. Obwohl der Mechanismus der Regulation noch kontrovers diskutiert wird, seien die Datenlage und ihre Interpretation doch eindeutig. Ein anderes Thema evolutionsbiologisch bedingter Erkrankungen sind Erbkrankheiten. Eigentlich müssten diejenigen von der Evolution eliminiert werden, welche vor dem fortpflanzungsfähigen Alter auftreten. Sie sind denn auch wirklich eher selten, selbst wenn die verursachenden Gene rezessiv sind, also einzeln keinen Effekt haben. Einige treten aber in einzelnen Populationen gehäuft auf. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Sichelzellanämie. Diese Bluterkrankung wird durch ein mutiertes Gen für den roten Blutfarbstoff Hämoglobin verursacht. Die roten Blutkörperchen sind dann nicht rund, sondern sichelförmig und sterben bei geringem Sauerstoffdruck ab. Das mutierte Hämoglobin-­‐Gen kommt in Schwarzafrika sehr häufig vor (1:250) und die homozygoten Träger (mit zwei Kopien des mutierten Gens) haben eine strak verminderte Lebenserwartung. Die Ursache, dass dieses Gen trotzdem verbreitet ist, liegt darin, dass heterozygote Träger (mit nur 1 mutierten Gen) resistent sind gegen Infektionen durch den Einzeller Plasmodium falciparum, einen sehr aggressiven Malariaerreger. Derselbe Mechanismus liegt vor bei der Thalassämie, einer Bluterkrankung, welche eine verringerte Produktion von Hämoglobin verursacht mit 10%-­‐iger Mortalität bis zum 20. Altersjahr, aber anderseits vor dem Malariaerreger Plasmodium vivax schützt. Das Auftreten von Thalassämie im heuten Mittelmeerraum stellt also in Relikt dar aus früheren Zeiten, als Malaria häufig war. Genetische Konflikte in der Schwangerschaft zeigen, dass die symbolische Eintracht zwischen Mutter und Kind evolutionsbiologisch etwas differenzierter gesehen werden muss. Zwar sind auch nach dem Konzept der „inklusiven Fitness“ des bekannten Biologen Bill Hamilton kooperative Interaktionen zwischen eng verwandten Individuen zu erwarten. Viele Gene zwischen Mutter und Kind sind ja identisch und zwischen ihnen besteht kein Konfliktstoff. Das Potential für genetische Konflikte besteht aber bei den nicht identischen Genen. Bekannt sind auch die Arbeiten des Biologen Robert Trivers über genetische Konflikte unter Geschwistern und solche in der Schwangerschaft. Ein verbreiteter Konflikt ist die Praeklampsie, ein schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck, der bei 10% der Schwangerschaften auftritt. Der Grund wird in den unterschiedlichen evolutionären Interessen des Kindes und der Mutter gesehen. Es ist zwar im gemeinsamen Interesse, dass das Kind gesund zur Welt kommt, aber die Mutter hat auch ein Interesse daran, noch weitere Kinder zur Welt zu bringen, was hingegen das erste Kind nicht interessiert. Zudem sind die folgenden Kinder mit der Mutter enger verwandt als mit dem ersten Kind. Die heutige Erklärung der Praeklampsie besagt, dass Gene im Kind einen erhöhten Blutdurchfluss durch die Plazenta bewirken, um ihre Nahrungszufuhr zu maximieren. Dies erhöht den Blutdruck auf Kosten der evolutionären Interessen der Mutter. Die Evolution von Krankheitserregern spielt eine grosse Rolle, da diese im Vergleich zum Menschen viel kürzere Generationszeiten, grössere Populationen und höhere Mutationsraten haben. Eigentlich erscheint es paradox, dass Viren und Bakterien Krankheiten verursachen, da sie ja nur in lebendigen Wirten leben und sich fortpflanzen können. Man kann deshalb ableiten, dass Erreger über lange Zeiträume zu einer geringen Schädlichkeit (Virulenz) evoluieren, und dass besonders virulente Mikroorganismen erst seit kurzem in menschlichen Populationen zirkulieren. Dies bestätigt sich bei den schädlichen Erregern wie HIV (AIDS, Immundefizienz), SARS oder West-­‐Nile-­‐Virus. Allerdings gibt es auch Beispiele, die nicht dieser Erwartung folgen, so etwa das Masern Virus. Man vermutet, dass es vor etwa 10 000 Jahren im Zusammenhang mit dem Ackerbau und der zunehmenden Bevölkerungsdichte in die menschlichen Populationen gekommen ist und sich seither hartnäckig mit unveränderter Virulenz darin hält. Jährlich sterben auch heute noch weltweit etwa 600 000 Kindern an Masern. Bei neueren Viren wie H1N1 oder HIV wird die Entwicklung mit grossem Interesse der Evolutionsbiologen verfolgt. Experimente mit Viren, die gegen die Kaninchenplage in Australien eingesetzt wurden, zeigten, dass das Virus einerseits im Wirt eine genügend hohe Konzentration erreichen muss um effizient übertragen zu werden, dass anderseits die Schädigungen am Wirt minimiert werden sollten. Daraus resultiert oft ein mittleres Mass an Virulenz. Der Mensch wehrt sich natürlich gegen die Krankheitserreger sowohl unbewusst auf molekularbiologischer immunologischer Ebene als auch bewusst mit den Einsatz von Medikamenten. Die Parasiten ihrerseits reagieren wiederum darauf mit der Evolution von Resistenz Nur wenige Jahre nach der ersten Verwendung von Penicillin wurde in englischen Spitälern eine grössere Anzahl von resistenten Infektionen beobachtet. Eine schnelle Resistenzbildung zeigte sich bis heute auch bei der medikamentösen Bekämpfung von Malaria und HIV. Dies ist unzweifelhaft ein evolutionärer Prozess, obwohl in manchen Lehrbüchern noch von „Entstehung“ statt von Evolution von Resistenz die Rede ist. Oft muss im Genom nur eine einzige Base ausgewechselt werden, um ein anderes Protein zu synthetisieren und damit Resistenz zu erreichen, was durch die Selektion der entsprechenden Mutanten problemlos in kurzer Zeit möglich ist. Gerade aus evolutionsbiologischen Gründen ist heute aber die Erkenntnis gewachsen, Infektionen mit mehreren Medikamenten gleichzeitig zu behandeln, um damit die Anzahl überlebender Erreger zum minimieren. Diese Kombinationsatherapien sind zwar kostenaufwendiger und zeigen auch mehr Nebenwirkungen, erweisen sich aber als tatsächlich wirksamer. Gerade die Behandlung von HIV brachte die empirischen Resultate, dass Kombinationstherapien der Verabreichung von einzelnen Medikamenten hintereinander weit überlegen sind. Infolge dieser Konsequenz ist HIV heute zwar noch nicht heilbar, aber auch kein Todesurteil mehr. Man stellt sich nun in der Evolutionsbiologie die Frage, seit wann das Virus HIV in der menschlichen Bevölkerung zirkuliert. Dazu hilft die Anwendung von evolutionären Stammbäumen in der Medizin Phylogenetische Stammbäume zeigen die Verwandtschaftsbeziehungen unter den Arten, welche heute vor allem aufgrund genetischen Materials erstellte werden. Diese Stammbäume kommen nicht nur auf die Beziehungen höherer Organismen zur Anwendung, sondern auch derer Krankheitserreger. Professor Bonhoeffer hat in seiner Arbeitsgruppe phylogenetische Methoden zur besseren Bekämpfung von HIV erarbeitet. Aus den Stammbäumen geht hervor, dass die Immundefizienz-­‐Viren des Menschen, nämlich HIV-­‐1 und HIV-­‐2, eng verwandt sind mit Immundefizienzviren, die in verschiedenen Affenarten zirkulieren und deshalb Simian Immunodeficiency Virus, SIV genannt werden. Der phylogenetische Stammbaum zeigt, dass HIV-­‐2 am engsten verwandt ist mit dem SIV einer Affenart Westafrikas, der „Russmangaben“. HIV-­‐1 ist dagegen am engsten verwandt mit dem SIV in Schimpansen. Die beiden HIV-­‐
Typen müssen also separat von den beiden Affenarten auf den Menschen übertragen worden sein. Die ältesten HIV-­‐Viren von menschlichen Patienten stammen aus dem Jahr 1959 aus dem Kongo (Kinshasa). Sie sind genetisch aber bereits so unterschiedlich wie heutige Subtypen. Wenn ihre genetische Diversifizierung schon immer etwa gleich schnell ablief, kann man berechnen, dass die HIV-­‐Epidemie schon anfangs des 20. Jahrhunderts begonnen haben muss. Dabei zeigte es sich, dass diejenigen SIV-­‐
Schimpansenviren, die mit HIV-­‐1 am engsten verwandt sind, aus dem Osten Kameruns stammen. Man vermutet deshalb den Ursprung der HIV-­‐1 Epidemie in dieser Region, wo die Flüsse aus dem Osten Kameruns in den Kongo fliessen. Anfangs des 20. Jahrhunderts waren diese grossen Ströme die massgeblichen Transportwege in dieser Region und somit Grundlage für die Verbreitung des Virus. Der Referent hat aber vor allem die HIV-­‐Epidemiologie in der Schweiz bearbeitet und hat dabei phylogenetische Methoden angewandt, um die Krankheit besser eindämmen zu können. Die Schweizerische Kohortenstudie (SHCS) sei weltweit eine der besten und umfangreichsten Sammlungen klinischer HIV-­‐Daten. Gut 50% aller Patienten in der Schweiz nehmen daran teil. Man geht Prof. Dr. Andreas Plückthun (1956) Biochemisches Institut der Universität Zürich Mitbegründer der Morphosys AG und der Molecular Partners AG. Interessen: Design und Entwicklung neuer Proteine und synthetischer Antikörper dabei insbesondere der Frage nach, welche Rolle die unterschiedlichen Übertragungswege (Transmissionsgruppen) spielen. Drei Wege sind hauptsächlich bekannt: Heterosexueller (HET-­‐Gruppe) und homosexueller (MSM-­‐Gruppe) Geschlechtsverkehr und die Benutzung unsteriler Injektionsnadeln bei Drogenkonsumenten (IDU-­‐Gruppe). Die Gensequenzen der Viren einer grossen Zahl dieser Patientengruppen wurden erstellt und phylogenetisch analysiert. Falls die Viren vornehmlich innerhalb dieser Transmissionsgruppen weitergegeben werden, müsste sich dies in der Gensequenz zeigen. Die äussersten Äste des Stammbaumes müssten zeigen, dass eng verwandte Viren aus denselben Gruppen stammen. Dies war in Bonhoeffers Untersuchung tatsächlich der Fall innerhalb der MSM-­‐Gruppe, jedoch nicht bei den anderen zwei Gruppen. Der Referent schloss daraus, dass die IDU-­‐Gruppe die Epidemie in der HET-­‐Gruppe antreibt. Daraus wiederum konnte die Realisierung eines besseren Zugangs zu sterilen Nadeln für Drogenkonsumenten abgeleitet werden, was anhand der Datenanalyse nachweisbar einen weitreichenden positiven Effekt auf die Kontrolle der Epidemie in der HET-­‐Gruppe hatte. HIV-­‐Krankheitsverlauf und phylogenetische Bäume Phylogenetische Methoden werden von Prof. Bonhoeffer aber auch eingesetzt zu Klärung der Ursachen des unterschiedlichen Verlaufs der HIV-­‐Infektion. AIDS, nämlich die Symptome der HIV-­‐Infektion als Krankheit, entsteht oft schon 2 Jahre nach der Infektion, in anderen Fällen erst nach Jahrzehnten. Es stellte sich somit die Frage, ob dieser Unterschied in der Genetik des Virus oder des Patienten zu suchen sei. In den phylogenetischen Stammbäumen konnte Bonhoeffer zeigen, dass nahe beieinanderliegende Virustypen eine ähnlich hohe „Viruslast“ (Konzentration der Viren im Blut) verursachen, was für den Krankheitsverlauf massgebend ist. Die Daten der Schweizerischen Kohortenstudie lassen darauf schliessen, dass die Rolle der Virusgene etwa dreimal wichtiger ist als diejenige der Patientengene, dass es also drauf ankommt, mit welchem Virustyp man infiziert wird. Die Forschungsarbeiten im Grenzbereich der Evolution und der Medizin sind nach Ansicht des Referenten sehr vielversprechend und werden weiter an Bedeutung gewinnen. 8.2 Ringvorlesung vom 22.10.09 Evolution im Reagenzglas -­‐ Wege zu neuen biomedizinischen Wirkstoffen Prof. Dr. Andreas Plückthun Vorlesungsnotizen von Dr. chem Hans Widmer Das Prinzip von Mutation und Selektion entdeckte Darwin, als er die Vielfalt von Lebewesen studierte. Er beobachtete die Natur also auf der Ebene der Spezies und erkannte, dass diese durch Veränderungen im Erbgut entstanden sein mussten. Die zugrundeliegen-­‐den biochemischen und molekularen Mechanismen waren ihm damals aber nicht bekannt. Weiter sah er, dass die Natur einen Selektionsdruck ausübte und dadurch nur jene Spezies überlebten, die sich am besten an die Gegebenheiten er Umwelt anpassten. Dass auf der Grundlage dieser nunmehr seit 150 Jahren bekannten Prinzipen äusserst innovative Erkenntnisse und praktische Ergebnisse erzielt werden können, legte der international bekannte Biochemiker Andreas Plückthun anschaulich und eindrücklich in seinem Vortrag am 22. Okt. 2009 dar. Dabei geht er insofern über Darwin hinaus, als er die Vorgänge in der Natur nicht nur beobachtet und erklärt, sondern selbst gestaltet und dazu verwendet, neuartige Produkte herzustellen. Seine Vision ist es, die Darwin’schen Prinzipien von Diversifizierung und anschliessender Selektion anzuwenden, um therapeutisch wirksame Proteine zu erzeugen. Statt wie Darwin ganze Lebewesen zu studieren, beschäftigt er sich mit der Welt der Proteine. Er begibt sich somit auf die molekulare Ebene, die mit den heute verfügbaren Werkzeugen der Molekularbiologie manipulierbar ist. Proteine sind die eigentlichen Akteure jeder Zelle. Sie erfüllen Funktionen als chemische Fabriken, um Bausteine auf-­‐ und abzubauen, sie versorgen die Zellen mit Energie und entsorgen Abfall, sie steuern die Signalübertragung und ermöglichen Sinneswahr-­‐
nehmungen. Alle Proteine sind aus den gleichen 20 Aminosäuren aufgebaut, und nur deren verschiedene Reihenfolge bestimmt die beinahe unendliche Vielzahl von Formen und Funktionen. Letztere sind zwar aufgrund der Aminosäuresequenz allein schwierig voraussehbar, aber der relativ einfache Bauplan nährt den Traum, selber Proteine herzustellen, die etwas Nützliches tun. Man muss also wissen, wie man Proteine herstellen kann und wie man ihre Funktion überprüfen kann. Und hier setzt Prof. Plückthun an. Er verwendet Methoden, die er letztlich der Natur entnommen und auf geschickte Weise im Labor nachgebaut hat. Wie entwirft die Natur Proteine? – Durch die Evolution. Es braucht also ein Verfahren, um Varianten von Proteinen herzustellen und eine Möglichkeit, die Geeignetsten auszuwählen. Proteine werden von Ribosomen synthetisiert, die selbst aus Proteinen bestehen und aus bakteriellen Zellen isoliert werden können. Diese übersetzen den Bauplan, der in der DNA vorliegt, in Proteine. In diesen Bauplan können zufällige Mutationen eingeführt werden – die molekulare Ursache der Diversifizierung. Ausgehend von einer DNA Sequenz, die ein bestimmtes Protein kodiert, werden im Reagenzglas durch die Polymerasen-­‐Kettenreaktion (PCR) Kopien hergestellt. Dabei werden die Bedingungen so gewählt, dass beim Kopieren zufällige Fehler auftreten. Dadurch entstehen Mutanten der ursprünglichen DNA Sequenz, die dann als Gemisch von ca. 1012 Varianten vorliegen -­‐ eine respektable Zahl. Der erste Schritt wäre also getan, die Diversität ist gewährleistet. Nun müssen aus diesen DNA Varianten die entsprechenden Proteine hergestellt und nach einem Gütekriterium selektiert werden. Die gewünschte Eigenschaft eines Proteins kann darin bestehen, ein Zielmolekül zu erkennen und daran zu binden. Ein Antikörper kann beispielsweise spezifisch ein bestimmtes Protein an der Oberfläche einer Zelle erkennen. Diesen Vorgang kann man messen. Damit hat man ein Kriterium in der Hand, um geeignete Antikörper auszuwählen. Das Gemisch von DNA Sequenzen kann also im Reagenzglas in eine entsprechende Zahl von verschiedenen Proteinen übersetzt und diese aufgrund ihrer Bindung an ein Zielmolekül sortiert werden. Die überwiegende Zahl der Mutationen verschlechtert die Eigenschaften des Proteins, aber in sehr seltenen Fällen kann die Bindung wie gewünscht stärker werden. Dies entspricht dann der Nadel im Heuhaufen. Wenn dank der grossen Diversität ein Protein mit stärkerer Bindung gefunden wird, stellt sich die Frage, welche Mutationen die DNA Sequenz aufweist, die dieses Protein kodiert. Dafür hat Prof. Plückthun die sogenannte Ribosom Display Methode entwickelt. Dabei bleiben die DNA und das nach deren Bauplan synthetisierte Protein mit dem Ribosom physisch verbunden. Nach der Selektion kann dieses Partikel isoliert und die genetische Information direkt abgelesen werden. Daran kann ein weiterer Zyklus von Mutation und Selektion angeschlossen werden, um die Eigenschaften weiter zu verbessern, oder die DNA kann direkt verwendet werden, um das Protein in grösseren Mengen herzustellen. Diese Methoden sind raffiniert und haben grosses Anwendungspotential. Prof. Plückthun hat auf dieser Grundlage zwei Biotech Firmen gegründet (Morphosys und Molecular Partners). Diese Firmen sind darauf ausgerichtet, therapeutische Wirkstoffe zu finden, unter anderem für die Tumorbekämpfung. Viele herkömmliche Krebsmittel wirken relativ unspezifisch und greifen auch gesunde Zellen an. Dagegen haben Antikörper das Potenzial, Krebszellen besser zu erkennen. Traditionell werden Antikörper durch Immunisierung von Tieren, z.B. Mäusen, gewonnen, aber das ist kein geeigneter Weg, um Wirkstoffe für Krebspatienten zu finden. Mittels der beschriebenen Methoden lassen sich Antikörper im Reagenzglas herstellen. Das Repertoire an Varianten ist dabei noch grösser als dasjenige des Immunsystems. Antikörper lassen sich sogar durch andere Proteinklassen ersetzen, die vielleicht noch bessere Eigenschaften besitzen. Das Ziel ist es, mit geringen Dosen an Medikamenten bessere Wirkungen und vor allem weniger unerwünschte Nebenwirkungen zu erhalten. Bereits sind mehrere durch „Evolution im Reagenzglas“ entstandene Proteine als Kandidaten für Medikamente in der klinischen Erprobung. Sie zeigen viel-­‐versprechende Ergebnisse. Das Potential ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Mit diesen Methoden können Proteine so massgeschneidert werden, dass sie mehrere Bindungsstellen gleichzeitig erkennen. Dadurch verspricht man sich eine noch selektivere Wirkung auf die krebsartigen statt auf die gesunden Zellen. Auch in anderen Forschungsgruppen werden Wege verfolgt, gezielte Aenderungen in Proteinen einzubauen. So hat zum Beispiel Prof. Peter Schultz am Scripps Forschungsinstitut in La Jolla, Kalifornien, eine Methode entwickelt, mit der eine einundzwanzigste, in der Prof. Dr. Martin Ackermann, Prof. für Mikrobielle Evolution am Institut für Integrative Biologie der ETH Zürich Biologiestudium in Basel 1997 abgeschlossen 2002 Promotion bei Prof. Steve Stearns, Basel Bis 2005 San Diego, theoretische Biologie Natur nicht vorkommende Aminosäure in Proteine eingebaut werden kann. Dies eröffnet wiederum eine 2006-­‐08 Assistent für den Schw. Nationalfonds neue Dimension, die Welt Ab 2008 ausserordentlicher Professor ETH der Proteine zu erweitern. Oder wie er selbst zu sagen pflegt, kann er damit zeigen, wie die Natur aussehen würde, wenn Gott am siebten Tag nicht geruht hätte! Diese Forschungsergebnisse zeigen, dass Darwin’s Erkenntnisse über die Evolution immer noch aktuell und direkt anwendbar sind. In Kombination mit modernen Technologien ergeben sich faszinierende Perspektiven für die Grundlagenforschung als auch für biomedizinische Anwendungen heute und in der Zukunft. 8.3. Ringvorlesung vom 5.11.09, UNI Zürich Evolution und Unsterblichkeit – Die Evolution von Alterung verstehen und ACKERMANN, M., Über die evolutionären Ursprünge der Alterung. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2008) 153(1/2): 27-­‐33 Prof. Dr. Martin Ackermann, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Inhalt der Ringvorlesung deckte sich über weite Strecken mit der Publikation des Autors in der Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich vom April 2008. Dieser Bericht fasst deshalb die Vorlesung und die Publikation zusammen. Der Referent ging drei wichtigen Fragen nach: -­‐
-­‐
-­‐
Altern alle Lebewesen oder gibt es potentiell unsterbliche Organismen? Altern nur Eukaryoten oder auch Prokaryoten wie Bakterien? Wieso altern Organismen? Wo liegen die Vorteile? Prof. Ackermann zeigte gerade anhand der Person von Charles Darwin, wie in der Embryonalentwicklung, in der Kindheit und Jugend ein höchst komplexes Programm abläuft, welches trotz Fehlern zu einem gut funktionierenden Organismus führt, während im Alter das eigentlich viel einfachere Erhalten der Funktionen nicht mehr gelingt. Mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, und die Aussicht auf erfolgreiche Fortpflanzung nimmt ab. Es gibt aber noch andere Risikofaktoren für das Überleben wie Raubtiere, Infektionskrankheiten, Unfälle oder Hunger. Da einzellige Organismen an erster Stelle bei der Entstehung des Lebens standen, ist die Frage erheblich, ob Bakterien altern oder nicht. Bis vor kurzem nahm man an, dass sie nicht altern, was bedeutete, dass das Prinzip des Alterns erst mit mehrzelligen Organismen entstanden wäre. Man nahm das an, weil man bei Bakterienzellen keinen Unterschied zwischen den Eltern und ihren Nachkommen sah. Somit würden aber alle Individuen einer Population mit der Zeit gleichzeitig infolge von Mutationen mehr Schädigungen im Erbgut aufweisen und die Gruppe dieser Lebewesen würde bald aussterben. Erfolgreicher sind Lebewesen jedoch, wenn bei der Fortpflanzung der Nachkomme seine „biologische Uhr“ sozusagen zurückstellt und sein Leben mit dem Alter Null beginnt. Dies muss dadurch geschehen, dass der Nachkomme einen reparierten, verjüngten Datensatz an Genen bekommt, während das von Mutationen veränderte, also gealterte Genom bei den Eltern, bzw. der Mutter verbleibt. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung bleibt der Schaden immer auf die Mutter begrenzt, während die Kinder einen neuen, verjüngten Datensatz erhalten. Ackermann hat nun nachgeprüft, ob bei Bakterien durch die Zellteilung zwei identische Tochterzellen entstehen, oder ob eine gealterte Mutterzelle und eine verjüngte Tochterzelle entstehen. Seine Arbeiten mit Caulobacter crescentus und die Arbeiten anderer Forscher mit Escherichia coli haben gezeigt, dass tatsächlich eine alternde Mutterzelle nach der Zellteilung zurückbleibt und anderseits eine verjüngte Tochterzelle entsteht. Die Teilungsfähigkeit von Bakterien erwies sich dabei als abhängig vom Alter der Zelle. Während dem sich junge Zellen schnell und häufig teilen, verringert sich ihre Teilungsaktivität im Alter und hört schliesslich ganz auf. Diese Resultate legen nahe, dass Alterung nicht erst mit dem Erscheinen von Eukaryoten und mehrzelligen Organismen entstand, sondern evolutionär älter ist als bisher angenommen. Alterung ist also nachteilig für das Individuum, aber von Vorteil für seine Nachkommen. Trotzdem ist Altern nicht einfach ein Sachzwang, da es von diversen Genen in der Geschwindigkeit beeinflusst wird. Eigentlich müssten Gene, die Altern beschleunigen, durch die Evolution eliminiert werden, was aber nicht der Fall ist. Die berühmten Evolutionsbiologen wie Haldane und Williams haben deshalb schon vor gut 50 Jahren eingewendet, dass die meisten Lebewesen aus anderen Gründen sterben, bevor sie an den Folgen des Alters zu leiden beginnen, dass der Fortpflanzungserfolg aber davon abhängt, wie schnell sie sich zur Reproduktionsfähigkeit entwickeln, und dass deshalb die Zeit nach der Fortpflanzung für die Evolution nicht mehr von Bedeutung sei. Arten mit hohen äusseren Risikofaktoren wie etwa Fressfeinde, welche dem Leben der Individuen schon früh ein Ende setzen, müssten sich deshalb früh fortpflanzen, und gegen die Alterung würden sich deshalb keine Strategien evoluieren. Dies gilt etwa für die Maus. Dem gegenüber hätten Arten mit wenigen Fressfeinden und geringen Risikofaktoren mehr Zeit, sich zur Fortpflanzungsfähigkeit zu entwickeln und damit würden auch frühe Alterungsvorgänge von der Evolution wirksam eliminiert. Diesen Effekt zeigt etwa die Fledermaus. Prof. Ackermann hat mit seiner Arbeitsgruppe Experimente mit Bakterien durchgeführt und über 7000 Generationen hinweg die evolutiven Veränderungen beobachtet, die dadurch entstanden, dass immer nach 10 Zellteilungen 99% der Zellen eliminiert wurden. Es setzten sich dabei spontane Mutanten durch, die früher zur Zellteilung fähig waren und nach 2000 Generationen zeigte sich eine Mutante, die schneller alterte. Die evolutionäre Erklärung für Alterung gilt also auch für Bakterien: Wegen äusserer Risikofaktoren wirkt natürliche Selektion nur schwach auf das späte Leben und wird durch eine Verstärkung dieser Faktoren weiter abgeschwächt. Analoge Experimente wurden mit Drosophila Fliegen gemacht, die im Labor künstlich einerseits einem unsicheren, anderseits einem sicheren Leben ausgesetzt wurden. Die Gruppe mit sicheren Lebensbedingungen wurde nach zahlreichen Generationen älter. Auf den Menschen übertragen heisst das: Genetische Veranlagungen zu Krankheiten im Alter sind entstanden, weil unsere Vorfahren infolge schlechter Ernährung und insuffizienter Gesundheitsvorsorge nicht alt wurden und sich früh fortpflanzten. Es ist bezeichnend, dass sich die Fortpflanzung bei der heutigen guten Ernährungslage und Gesundheitsvorsorge bereits in einen späteren Altersabschnitt verlagert hat. Hingegen leiden auch Leute, die in der Jugend ein gutes Immunsystem hatten, im Alter oft an Alzheimerdemenz. Sie waren zwar besser gerüstet zur Fortpflanzung, doch ihre biologische Leistung im Alter ist evolutionär irrelevant. Zusammenhänge von Eigenschaften im Alter und in der Jugend sind allerdings noch wenig erforscht. Unser heutiges Vorstossen in ein hohes Alter bringt aber die Nachteile des Systems zum Vorschein. Alterung existiert, weil sie in der Natur nicht relevant ist. Sie ist kein Programm, sondern eine Ansammlung von kleinen Problemen, die früher in der freien Wildbahn keine Rolle gespielt haben. Alterung ist keine Ursache von Evolution. Die erwähnten Experimente des Referenten zeigten zudem, dass asymmetrische Fortpflanzung und Alterung bei einfachen Organismen zusammenhängen. Da die Mutterzelle und die Tochterzelle nicht identisch sind, sondern die gealterten Gene in der Mutterzelle zahlreicher sind, ist die Alterung der Mutterzelle vorprogrammiert und verstärkt sich bei jeder ihrer Zellteilungen. Die Mutter übernimmt den Schaden und verliert ihre potentielle Unsterblichkeit. Stattdessen altert sie und wird sterben. Nur wenn dieses System einen Vorteil bringen kann, ist die Alterung in der Geschichte des Lebens verständlich. Dazu hat Ackermann Computersimulationen vorgenommen, in denen einzellige Lebewesen mit einem gewissen Mass an Abfallmolekülen und Schädigungen an den Anfang von Fortpflanzungszyklen gesetzt wurden. Über mehrere Tausend Generationen wurden evolutionäre Vorgänge von Variation und Selektion bezüglich ihres Erfolges beobachtet. Zum Start wurde den „Zellen“ eine symmetrische Schadensverteilung vorgegeben. In allen Durchläufen änderte sich die Symmetrie nach zahlreichen Generationen spontan zur Asymmetrie, welche stets erfolgreicher war. Der Grund ist eigentlich sehr einfach. Während bei einer symmetrischen Schadensverteilung aus 1 Zelle 2 Zellen mit mittlerer Überlebenserwartung entstehen, so ergibt sich bei der asymmetrischen Verteilung 1 Zelle mit einer hohen und 1 Zelle mit einer tiefen Überlebensrate. Die Qualität der überlebenden Zelle ist damit höher als diejenige der Mutterzelle. Dadurch werden Zellen mit viel Schadensmenge aussortiert und die Schadensmenge in den Zellen mit Asymmetrie nimmt mit jeder Generation ab. Gene für asymmetrische Schadensverteilung verbreiten sich und dominieren am Schluss die Populationen. Damit zeigt sich Alterung als evolutionär erfolgreiches Prinzip und potentielle Unsterblichkeit ist wohl kaum zu erhalten. Altern scheint eine grundsätzliche Eigenschaft von Lebewesen zu sein. Diese Erkenntnisse bieten zwar noch keinen direkten Nutzen für den Menschen. Bakterien und insbesondere eukaryotische Einzeller wie die Hefe Saccharomyces cerevisiae erlauben aber fundamentale Einblicke in die Alterung und die Identifizierung von Genen, welche die Geschwindigkeit der Alterung beeinflussen. Ein nächster Schritt wird die Analyse der molekularen Mechanismen und die Isolierung von Mutanten mit veränderter Alterung sein. Grossmutterhypothese: Als Grossmütter bei der Nachwuchspflege sind ältere Frauen für die Fitness der Gruppen wirksamer, als wenn sie ihr gealtertes Erbgut weitergeben würden. Prof. Dr. Rolf Zinkernagel, geb. 1944, 1962-­‐68 Medizinstudium in Basel 1969-­‐70 Labor für Elektronenmikroskopie, Uni Basel 1971-­‐73 Institut für Biochemie, Uni Basel 1973-­‐75 Inst. für Mikrobiologie, Canberra, Australien Ringvorlesung vCom 1976-­‐79 Dept. F8.4. ür Immunpathologie, La Jolia, al. 8.12.09, ETH Zürich 1979-­‐88 Ass. Professor Abt. für Pathologie , Universitätsspital Zürich, 1988-­‐92 Professor für Pathologie, Universität Zürich „Intelligent Deesign“ oder Evolution in den Wissenschaften Seit 1992 Vorsteher des Institut für xperimentelle Immunologie, Zürich 1996 Nobelpreis für Medizin Prof. Dr. Rolf Zinkernagel, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Referent betonte eingangs gleich einmal, dass es die moderne Biologie ohne Charles Darwin nicht gebe. Um Erkenntnis über die Schöpfung zu gewinnen, hatten die Menschen schon immer Hoffnungen und Vorstellungen. Diese brauchen nicht bewiesen zu werden. Allerdings sind auch die Wissenschafter empfänglich für irrationale Vorstellungen, obwohl etwa die Medizin mit rationalen, molekularen Erkenntnissen sehr erfolgreich ist. Die Evolutionslehre ist sehr rational und postuliert, dass Veränderungen im Genom zu veränderten Proteinen, diese wiederum zu veränderten Merkmalen, also Variabilität führen, und dass diese einer Auswahl unterliegen. Trotzdem verbinden 52% der Schweizer diese Erkenntnis mit der irrationalen Vorstellung eines „Intelligent Design“, also mit der Idee, dass hinter diesem Mechanismus eine schöpferische Planung stecke, was auch als Kreationismus bezeichnet wird. In den USA schätzt man sogar einen Anteil von 55% der Bevölkerung, der kreationistische Ideen vertritt. In Island hingegen nur 6%. Unter diesen Kreationisten finden sich Zweifler infolge falscher Informationen, Angstmacher und Menschen mit falschen Hoffnungen, etwa dass sie auch ohne Impfungen virale Infekte von sich fern halten könnten. Ihre Argumente werden auch von den Medien gerne mit viel Publizität umgeben. Aber auch die Wissenschaft überträgt oft Begriffe aus der menschlichen Ideenwelt auf die Natur. Etwa beim Immunsystem, wo von „Gedächtnis“, „Kraft“ oder „Schutz“ die Rede ist, und wo moderne Termini wie „Netzwerke“ oder „Supression“ auf molekulare und zelluläre Systeme übertragen und angewandt werden. Dasselbe gelte für Vorstellungen wie „generelle Impfstoffe“ und für Hoffnungen auf Impfung gegen HIV (AIDS), Malaria oder Tb. Auch die Meinung, das Immunsystem hätte am liebsten steril lebende Menschen, ist nicht haltbar. Im Gegenteil wird seine Kompetenz durch Infektionen trainiert. Damit die Immunabwehr funktioniert, ist ein Mindesttiter an Antikörpern notwendig. Dies beginnt schon vor und nach der Geburt eines Kindes. Die Mutter überträgt Serumantikörper auf das Kind. Es bekommt einen genügenden Titer zum Training des eigenen Immunsystems. Gleichzeitig müssen aber Infektionen stattfinden. Diese werden durch die heutige Kinderhygiene verhindert. Gegen Kinderlähmungen gab es z.B. früher keine Antikörper, was ungebremste Infektionen ermöglichte. Einerseits enthält die Muttermilch Antikörper, anderseits erfolgt ein aktiver Übergang von Antikörpern durch die Plazenta. Bei den Kühen werden Antikörper im „Kolostrum“ konzentriert, welches die Kälber trinken. Die Plazenta der Kuh hat nämlich zwei Membranen, die von Antikörpern nicht passiert werden können. Infektionen sind Stimuli für die Aufrechterhaltung von Gedächtniszellen des Immunsystems. Dies sind Viren mit Antigenen, wie sie etwa bei periodischen Grippen oder Schleimhautinfektionen auftreten. Ohne diese Re-­‐Expositionen geht der Schutz verloren. Viren mutieren und variieren im Lauf der Zeit, was aber sehr unterschiedlich ausfällt. Es sind biologische Systeme, welche an Gegebenheiten adaptieren, aber auch plötzliche Sprünge machen können. -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Polio-­‐ und Masern-­‐Viren variieren nicht. Die einmal etablierte Impfung ist deshalb sehr wirkungsvoll. Influenza (Grippe)-­‐Viren variieren ausserhalb des menschlichen Individuums. Die Impfung muss deshalb immer wieder angepasst werden. HIV-­‐, Malaria und HCV-­‐Viren variieren und mutieren im menschlichen Individuum selbst. Die Erreger sind in riesiger Zahl und in zahlreichen Variationen vorhanden. Eine Impfung und das Immunsystem kommen deshalb immer zu spät und haben keine Chance. Zwischen Erreger und Mensch besteht eine Koevolution. Wenn die infizierten Individuen sterben, gehen auch die Viren unter. Diese werden deshalb durch evolutionäre Adaptation verträglicher, weil sie mit denjenigen Individuen überleben, welche die Infektion überleben. Bis dahin muss man sich gegen neue Viren mit Hygiene und antiviralen Substanzen helfen. Die Evolution von Erregern und ihre Koevolution mit dem Menschen kann nicht gebremst werden, meinte Zinkernagel abschliessend. Es sei deshalb sowohl gefährlich, sich falsche Hoffnungen auf Infektionsfreiheit zu machen, aber auch falsche Zweifel an der Medizin und Molekularbiologie zu hegen. 8.5 SCHWYZER, M., Virus, wohin des Weges? Wirtswechsel und ihre Folgen für die menschliche Gesundheit. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009) 154(1/2): 1-­‐9 Prof. Dr. Martin Schwyzer Literaturbericht von Dr. sc.nat. Markus Schmid, St. Gallen Der Autor erklärt in seinem Artikel, dass Viren sich nur in lebenden Wirtszellen vermehren. Ausserhalb der Zelle bestehen sie aus Erbmaterial (Genom; RNA oder DNA), das in einem Proteinmantel mit oder ohne Lipidhülle verpackt ist. In diesem Zustand sind sie tote Materie. Innerhalb der Zelle wird das Genom ausgepackt und vermehrt, sowie in Virusproteine umgesetzt. Aus dem neuen Material werden Tausende quasi identische Nachkommen-­‐Viren zusammengebaut, die weitere Zellen infizieren können. In ihrer Fähigkeit zur eigenen Vermehrung (Replikation) sind Viren als lebendig zu bezeichnen; es ist aber kein autonomes, sondern ein von der Zelle geborgtes Leben. Erfolgreiche Viren verursachen oft milde oder unbemerkte Infektionen und lassen ihren angestammten Wirt meist am Leben. Bei einem Wirtswechsel kann das Gleichgewicht der Kräfte gestört sein. Der neue Wirt ist auf den Erreger nicht vorbereitet und erkrankt schwer. Umgekehrt durchläuft ein Virus viele Vermehrungszyklen, bis es sich an einen neuen Wirt anpasst und seine Virulenz reduziert. Es sei hier kurz erwähnt, dass sich ein Virus auch ziemlich rasch an den Einsatz von antiviralen Mitteln (z.B. Neuraminidase-­‐Hemmer gegen Influenzaviren) anpassen und eine Resistenz entwickeln kann. Das Genom ist Programm und Triebfeder eines jeden Virus und unterliegt wie das Genom höherer Organismen den Gesetzen der Evolution. Langsam und stetig verändert sich dessen Nukleotidsequenz, da die für die Vermehrung zuständigen Enzyme die Vorlage leicht fehlerhaft kopieren und somit die neu entstandenen Genome erbliche Veränderungen (Mutationen) erwerben. Funktionelle Mutationen können sich nur über viele Vermehrungszyklen hinweg durch Auswahl der Tüchtigen behaupten. Selbstverständlich ist das Virus nicht willentlich tüchtig, da es wie ein Automat den Instruktionen des Genoms folgt. Von Tieren auf Menschen übertragene Viruskrankheiten (virale Zoonosen) sind z.B. Tollwut, H5N1-­‐
Influenza und Zeckenenzephalitis. Die Globalisierung lässt nun weitere Viren aus ihren ökologischen Nischen heraustreten. Sie tragen exotische Namen wie Ebola und Chikungunya oder Abkürzungen wie WNV und SARS. Welche Viren könnten auch für die Schweiz relevant werden und wie bereiten wir uns vor? 4 Zoonosen wurden von Autor näher beschrieben. •
Tollwut, eine klassische Zoonose Das Tollwut-­‐ oder Rabiesvirus besitzt eine ca. 12000 Basen lange RNA, die in einer Protein-­‐ und Lipidhülle verpackt ist. Drei verschiedene Virusproteine (G, M und N) bilden die geschossförmige Hülle des Virus, wobei das G-­‐Protein für das Eindringen in die Wirtszelle verantwortlich ist. Es bildet eine Art Stachelkleid (Spikes), das spezifisch auf ein Zelloberflächen-­‐Protein passt, den Acetylcholin-­‐Rezeptor. Dieser dient normalerweise der Nervenleitung, weshalb das Virus mit Vorliebe an Nervenzellen bindet und so durch Fusion der Virusmembran mit der Zellmembran ins Innere dringt. Am Anfang der Infektion steht der Biss eines tollwütigen Tieres. Die Viren aus dessen Speichel infizieren das offen gelegte Muskelgewebe, wo ein alternativer Virusrezeptor vorhanden ist. Dieser bindet schwächer als Nervenzellen, unterstützt aber das Eindringen des Virus. Via periphere Nerven gelangt das Virus ins Zentralnervensystem, wo es die Tollwutsymptome auslöst und in die Speicheldrüsen, wo es bereit ist für eine weitere Bissinfektion. Die Inkubationszeit dauert vergleichsweise lange -­‐ mehrere Wochen bis Monate. Ist das Virus aber einmal im Nervensystem, so führt es unausweichlich innert 10 – 14 Tagen zum Tod, sowohl beim Menschen wie auch bei Haus-­‐ und Wildtieren. Es ist das pure Gegenteil der vorhin beschriebenen milden Infektion, denn Tollwutviren verfolgen eine sogenannte „hit-­‐and-­‐run“ Strategie. Sobald sie in die Speicheldrüse gelangen, lösen sie bei einem Teil der erkrankten Opfer Aggressivität aus und erreichen so neue Wirtstiere. Dass der Wirt danach stirbt, ist nicht relevant, solange genügend gesunde, ungeimpfte Tiere sich gerade in Reichweite des Bisses befinden. In Europa begann die neue Ausbreitung der Tollwut durch Füchse nach dem 2. Weltkrieg in der Gegend von Weissrussland. Sie schritt voran mit ca. 50 km/Jahr und erreichte 1967 erstmals die Schweiz. Zuerst versuchte man, durch Begasung der Fuchsbaue die Population unter die kritische Grenze von 1 Fuchs pro 2 km2 zu senken. Doch neue Füchse wanderten in die leeren Baue ein, und die Krankheit schritt noch schneller voran. Die ersten von der Tollwutzentrale eingeleiteten Impfversuche 1978 im Wallis waren hingegen erfolgreich. Von da an wurden in verseuchten Gebieten 2-­‐mal jährlich Köder (Hühnerköpfe) mit lebend-­‐abgeschwächtem Impfstoff ausgelegt. Andere europäische Länder folgten bald diesem Beispiel. Es brauchte aber fast 20 Jahre hartnäckiger Bemühungen, bis die Schweiz 1996 von der Tollwut befreit wurde. Die Tollwut-­‐Impfung wurde durch Louis Pasteur 1885 eingeführt. Ein Knabe wurde von einem tollwütigen Hund gebissen, worauf ihm die Spritze mit Rabies-­‐Impfstoff das Leben rettete. Heute ruht die postexponentielle Prophylaxe (PEP) auf 3 Säulen: Rasche Reinigung + Desinfektion der Wunde, passive Immunisierung mit Tollwut-­‐Hyperimmunserum und aktive Immunisierung mit Rabies-­‐Impfstoff. Wenn die Viren während ihrer langen Inkubationszeit abgefangen werden, gelingt es fast immer, die Erkrankung zu verhindern. Sobald die Viren in den Nervenzellen sind (einige Tage vor den ersten Symptomen), ist es unweigerlich zu spät! Schlussfolgerung für die Schweiz: Die Schweiz ist seit 1996 dank einem hervorragenden Impfprogramm frei von Tollwut. Allerdings müssen wir wachsam bleiben. Im Jahr 2003 wurde in Genf bei einem Findlingshund, der aus Nordafrika stammte, Tollwut festgestellt. Wichtig ist die Beobachtungsgabe des Tierarztes und dass die tierärztliche Ausbildung gefährliche, aber ausgemerzte Erreger nicht vernachlässigt. Zur Minimierung des Risikos der Einschleppung von Fällen aus dem Ausland wurde von der Schweiz (noch vor der EU) eine strenge, moderne Einfuhrregelung für Hunde und Katzen aus Tollwut-­‐Risikoländern nach dem Modell von Schweden und Norwegen erlassen. Die Bekämpfung von Tollwut in Asien und Afrika ist eine globale Herausforderung. Gute Human-­‐
Impfstoffe existieren, aber arme Länder können sie nicht bezahlen. Paradox ist, dass allein in Indien jährlich über 1 Million postexpositionelle Prophylaxen durchgeführt werden. Die bessere Lösung wäre die konsequente Impfung aller Hunde. Dies scheitert aber daran, dass nur ein Teil aller Hunde einem Besitzer zugeordnet werden können, welche zudem mausarm sind und nicht durch das Gesetz gezwungen werden können, Geld zur Impfung der Hunde auszugeben, das sie nicht einmal für ihre kranken Kinder besitzen. Eine Lösung wird wohl erst realistisch im Rahmen einer stetigen Entwicklung dieser Länder aus der Armut heraus. •
Chikungunya, eine neu aufgetretene Zoonose Im April 2005 trat auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean eine Krankheit auf, die von grippeähnlichen Symptomen begleitet war, vor allem Gliederschmerzen und Fieber. Diese blieben monatelang bestehen und entwickelten oft eine Art Polyarthritis. Die Krankheit fand wenig internationale Bedeutung, bis ab Dezember 2005 fast ein Drittel der Bevölkerung betroffen war und sich die Krankheit rasch nach Mauritius, Madagaskar, Sri Lanka, Indien und weitere tropische Länder ausbreitete. Neu war der massive Ausbruch; die Krankheit selbst war keine Unbekannte. Der Erreger wurde erstmals 1953 in Ostafrika isoliert. „Chikungunya“ ist Suaheli für „gebückt gehen“ und bezieht sich auf die chronischen Gliederschmerzen. In Afrika, wo kleinere und grössere Ausbrüche auftraten, ist es eine Zoonose, die von Primaten via Moskitos auf Menschen übertragen wird. In Asien läuft die Übertragung wegen der grossen Bevölkerungsdichte vorwiegend zwischen Moskito und Mensch ab (Epidemie in Bangkok 1962 und 1991). Das Chikungunya-­‐Genom ist eine einzelsträngige RNA von knapp 12000 Nukleotiden. Seit 2005 wurden die Sequenzen zahlreicher Virusisolate bestimmt und Stammbäume erstellt. Besonders aufschlussreich ist eine Mutation (A226V) in einem viralen Hüllprotein, welches die Vermehrung des Virus im Darm von Tiger-­‐Mücken 100-­‐fach verstärkt. Ohne diese Mutation vermehrt sich das Virus überwiegend in anderen, eher nachtaktiven und tierliebenden Moskito-­‐Arten (Gelbfiebermücke). Tiger-­‐Mücken sind aber den ganzen Tag aktiv und stechen bevorzugt Menschen und haben sich in den letzten Jahren von ihrem ursprünglichen Standort in Südostasien massiv ausgebreitet. Man findet sie nun in grossen Teilen der USA, in Mittelmeerländern wie Italien und Spanien, aber auch im Tessin. Schuld daran ist der Handel mit gebrauchten Reifen. Diese werden in grosser Zahl im Freien gelagert, füllen sich mit Wasser und sind ein ideales Biotop für Moskitos. Deren Eier werden dann zusammen mit den Reifen rund um den halben Erdball transportiert. Im Sommer 2007 brach das Chikungunya-­‐Fieber in Italien in der Region von Ravenna aus und erfasste rund 300 Personen. Ein Tourist hatte das Virus mit der A226V-­‐Mutation aus Indien mitgebracht und für lokale Ausbreitung waren genügend Tiger-­‐Mücken vorhanden (sie fliegen nur ca. 200 Meter weit). Auch in folgenden Jahren trugen viele heimkehrende Touristen das Virus in sich, aber es kam zu keinen weiteren Ausbrüchen. Entweder war der Fall von Ravenna speziell (wegen hoher Viruskonzentration im Blut) oder die Schutzmassnahmen wurden verbessert. Diese sind: sofortige Absonderung des Patienten, damit er nicht gestochen wird, Schutz der umliegenden Bevölkerung vor Moskitos und Reduktion der Moskito Population durch Beseitigung der Brutstätten oder mit Hilfe von unfruchtbaren Männchen. Schlussfolgerung für die Schweiz: Diese Krankheit ist bisher in der Schweiz erst in einem Einzelfall 2006 aufgetreten. Da sich aber die Tiger-­‐Mücken in der Schweiz etabliert haben, ist ein grösserer Ausbruch wie in Ravenna denkbar. Hier sind diagnostische Früherkennung von importierten Fällen und die Abschirmung der Mücken wichtig. Im Kanton Tessin wurde ein Projekt Tiger-­‐Mücken lanciert, nicht nur wegen der Übertragung des Chikungunya-­‐Virus, sondern wegen des Dengue-­‐Virus aus der Familie der Flaviviren, welches auf die gleiche Weise verbreitet wird und ebenfalls schon in Italien gefunden wurde. Dengue ist das weltweit grösste Arbovirus (von Insekten oder Spinnenartigen, z.B. Zecken, übertragene Viren) Problem. Eine Million Infektionen werden jährlich gemeldet und ein Vielfaches davon bleibt ohne Meldung. Die Symptome reichen von mildem Fieber bis zu schweren Hämorrhagien (Blutungen) und Schock. •
Ebola und Marburg, gravierende aber lokal beschränkte Zoonosen Von März bis Juli 2005 dauerte der Ausbruch eines hämorrhagischen Fiebers, das im Norden von Angola über 200 Todesopfer forderte. Das waren mehr als 80% aller Erkrankten, darunter viele Kinder und auch Pflegepersonal. Zur Identifikation wurden Blutproben in einem Hochsicherheitslabor untersucht. Man fand krumme, fadenförmige Gebilde aus der Familie der Filoviren, erstaunlicherweise aber nicht das Ebolavirus, das in diesen Teilen Afrikas schon früher aufgetreten war, sondern das bisher auf Ostafrika beschränkte Marburgvirus. Beide Viren sind wegen ihrer hohen Letalität sehr gefürchtet. Zum Glück werden sie nur bei relativ engem Kontakt zwischen Menschen übertragen, so dass Ausbrüche auf lokale Gebiete Afrikas beschränkt bleiben. Ebola ist ein kleiner Fluss im Kongo. Marburg ist allerdings kein afrikanischer Name, sondern bezieht sich auf die erstmalige Beschreibung des Virus 1967, als in Marburg, Frankfurt und Belgrad gleichzeitig Laborpersonal erkrankte. Dieses hatte sich an einer Lieferung von grünen Meerkatzen aus Uganda infiziert. Bereits damals wusste man, dass Filoviren Zoonosen verursachen können. Bis heute nicht völlig geklärt ist aber die Frage nach dem Ursprung und dem Wirtereservoir dieser Viren. Sie ist schwierig zu beantworten, weil die Krankheit nur sporadisch und in sehr unzugänglichen Gebieten auftritt und weil es viel Mut und Idealismus braucht, dieses Feld zu erforschen. Die ersten Ausbrüche mit Ebolaviren wurden 1976 verzeichnet. Seither zeigte sich die Krankheit in einem Dutzend Ausbrüchen in Afrika, die sich 3 verschiedenen genetischen Typen zuordnen lassen. Wo versteckt sich dieses Virus? Es besteht der gut begründete Verdacht, dass Menschen sich an Affenfleisch (Bushmeat) infizieren. Affen sind für Ebolaviren sehr empfänglich und erkranken so schwer wie Menschen, weshalb sie wohl nicht das ursprüngliche Virusreservoir sind. Es muss eine andere Tierart sein, die das Virus über lange Zeit ohne Schaden beherbergt, möglicherweise ein Beutetier von Affen? Das Marburgvirus hingegen tritt seltener auf. Ein massiver Ausbruch erfolgte 1998-­‐99 im Kongo nahe der Grenze an Uganda und Sudan. Die meisten Betroffenen hatten dort in illegalen Goldminen gearbeitet oder waren Familienangehörige. Das liess auf Fledermäuse als Virusreservoir schliessen. Diese sind in der Tat imstande, das Virus zu vermehren, ohne krank zu werden. Ein lückenloser Beweis konnte wegen den oben beschriebenen Schwierigkeiten, verstärkt durch Kriegswirren im Kongo, noch nicht erbracht werden. Schlussfolgerung für die Schweiz: Diese Zoonosen werden wohl weiterhin auf die tropischen Gebiete Afrikas beschränkt bleiben, wenn der Import von Primaten getestet wird. Bei der Rückkehr von Reisenden müsste ein Marburg-­‐ oder Ebolapatient isoliert und das Pflegepersonal geschützt werden. Eine weitere Gefahr ist überall auf der Welt denkbar: Einsatz von Viren als Terrorwaffe. Um dagegen gerüstet zu sein, werden seit 2001 die Filoviren intensiver untersucht und Impfstoffe entwickelt. In Afrika ist aber die Tragödie der AIDS-­‐
Epidemie unvergleichlich grösser als die relativ seltenen Filovirus-­‐Ausbrüche. Verbesserte Gesundheitsversorgung im Hinblick auf AIDS könnte auch gegen Filoviren Verbesserung bringen. •
H5N1-­‐Influenza, Tierseuche oder Zoonose? Die „Vogelgrippe“ war 2005-­‐2006 in aller Munde. Inzwischen ist es aber wieder still geworden, weil die weltweite Epidemie (Pandemie) noch nicht eingetreten ist. Der Erreger der klassischen Geflügelpest, wie die „Vogelgrippe“ unter Fachleuten heisst, ist ein Influenza-­‐A-­‐Virus (Familie der Orthomyxoviren) und infiziert vor allem Vögel, Schweine, Pferde und Menschen. Obwohl jede Wirtsspezies ihr eigenes Influenzavirus hat (beim Menschen: das Grippevirus), sind Infektionen einer fremden Wirtsspezies gelegentlich möglich. So wird der Weg des Influenzavirus von Wildvögeln über Hausgeflügel zum Schwein und als Zoonose zum Menschen postuliert. Das Influenza-­‐A-­‐Virus trägt 2 Proteine in seiner Lipidhülle, das Hämagglutinin (H) und die Neuramidase (N), welche beide in zahlreichen Subtypen vorkommen. Bis jetzt sind 16 Subtypen für H und 9 für N bekannt. Die Informationen für H und N steckt in einzelnen RNA-­‐Genom-­‐Segmenten, die sich in den Viren nach Infektion im Wirt mischen können. Deshalb sind grundsätzlich alle Kombinationen von H1-­‐H16 mit N1-­‐N9 möglich. Bestimmte Kombinationen, so H5N1, H7N3 oder H9N2, sind speziell pathogen für Vögel. Innerhalb eines Subtyps beobachtet man wieder zahlreiche Stämme, die unterschiedlich pathogen sind. So spricht man von „high pathogenic avian influenza (HPAI). Diese Variabilität ist auf eine hohe Mutationsrate zurückzuführen, was auch die Entwicklung von Impfstoffen erschwert. Es sind vor allem die HPAI-­‐Stämme von H5N1-­‐Influenza, welche die Öffentlichkeit beschäftigen. In Hong Kong starb 1997 ein Kind an ungewöhnlich fulminanter Grippe. Der Erreger war ein geflügelspezifisches H5N1-­‐Influenzavirus. Das Kind hat sich direkt an infiziertem Geflügel angesteckt. Auf die gleiche Art steckten sich weitere 17 Menschen an, wovon 5 starben. Die Seuchenpolizei schritt ein. Die Märkte mit Lebendgeflügel wurden gesperrt und über 1.3 Mio. Vögel getötet. In Hong Kong hatten diese Massnahmen Erfolg. Eine neue Welle der „Vogelgrippe“ ging 2002 von China aus und erfasste ab 2003 grosse Teile Südostasiens und konnte trotz grosser Anstrengungen nicht gestoppt werden. Wichtig an dieser Stelle: es ist immer noch in erster Linie eine Geflügelkrankheit. Bis 2008 mussten über 240 Mio. Vögel getötet werden, was für Länder wie Indonesien, China, Vietnam oder Thailand besonders schlimm war, da Geflügel in diesen Ländern eine wichtige Nahrungsbasis darstellt. Gemäss WHO-­‐Statistik sind von 2003 bis heute 387 Menschen an H5N1-­‐Influenza erkrankt, wovon 245 starben. Praktisch alle hatten sich direkt an krankem Geflügel infiziert. Gelingt es, die klassische Geflügelpest auszumerzen, wofür es inzwischen Impfprogramme gibt, sollte die Gefahr für die Menschen gebannt sein. Allerdings ist aber in Indonesien ein Fall bekannt geworden, wo eine Frau H5N1 Influenza von Geflügel erwarb und dann an andere Familienmitglieder weitergegeben hatte. Damit rückt der Übertragungsweg von Mensch zu Mensch näher in den Bereich der Möglichkeit. Zudem breitet sich auch die klassische Geflügelpest, begünstigt durch Handel und Tourismus, sowie durch Vogelzug, nach Westen aus. Für eine Entwarnung ist es deshalb zu früh. Es kann aber niemand sagen, ob und wann wieder eine Influenza-­‐Pandemie ausbrechen wird. Schlussfolgerung für die Schweiz: Die klassische Geflügelpest brach letztmals 1930 in einem Schweizer Betrieb aus. Dass die Schweiz ein volles Menschenalter von dieser Seuche verschont blieb, ist guter Hygiene und konsequenter Überwachung und Meldepflicht zu verdanken. Etwas Glück war wohl auch dabei, denn andere europäische Länder mit ähnlichen Massnahmen mussten Ausbrüche hinnehmen, so Italien 1999 mit Verlusten von 13 Mio. Hühnern und Truten. Im Oktober 2005 erreichte das H5N1-­‐Virus Osteuropa und im Februar 2006 die Schweiz, was zum temporären Verbot der Freilandhaltung in der ganzen Schweiz im Winterhalbjahr 2005/2006 führte. Weniger restriktive, auf Seengebiete beschränkte Massnahmen, wurden in den Folgejahren getroffen. So liess sich bis heute vermeiden, dass das H5N1-­‐Virus in die Population von rund 8 Mio. Schweizer Nutztieren eindrang. Wachsamkeit ist jedoch weiterhin angebracht. Jedes Jahr erkranken in der Schweiz rund 200000 Menschen an der saisonalen Grippe, 1000 bis 5000 werden hospitalisiert und 400 bis 1000 sterben an den Folgen. Der Erreger war bisher nie das H5N1-­‐
Influenzavirus, sondern Virus vom Typ H1N1, H3N2 sowie Influenza B. Dagegen sind Impfstoffe verfügbar, die jedes Jahr aktualisiert werden. Pandemien mit einer viel höheren Morbidität und Mortalität sind 1918, 1957 und 1968 aufgetreten. Voraussetzung für eine Pandemie ist, dass ein neuartiges, dem menschlichen Immunsystem unbekanntes Virus auftritt, dass es krank macht und dass es leicht von Mensch zu Mensch übertragen wird. Solange die letzte Voraussetzung nicht erfüllt ist, geht vom H5N1-­‐Virus keine Pandemie-­‐
Gefahr aus. Ebenso gut können uns Influenzaviren anderer Subtypen überraschen. Um in jedem Fall so gut wie möglich vorbereitet zu sein, hat die Schweiz einen Pandemieplan ausgearbeitet (einsehbar bei: www.bag.admin.ch). •
Dank Für die Durchsicht dieser Zusammenfassung danke ich Dr. Franziska Schmid-­‐Wehrle, ehemalige Mitarbeiterin des Institutes für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe (IVI), Mittelhäusern BE, wo im Hochsicherheitstrakt nicht nur Zoonosen wie H5N1 Influenza studiert werden, sondern auch Viren, welche für Tiere hochansteckend, aber für den Menschen ungefährlich sind (z.B. Maul-­‐ und Klauenseuche oder Blauzungenkrankheit). 8.6 MÜLLER, L., FRAEFEL, C., Mehr als nur Fieberbläschen: Herpes simplex-­‐Viren im Dienste der Gesundheit. In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004) 149/4:87-­‐94 PD Dr. Cornel Fraefel, Virologisches Institut Universität Zürich, 2004 Lars Müller, MD, Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA, 2004 Literaturbericht, wb Die Autoren stellen in dieser Arbeit die Thematik und die vorklinischen Untersuchungen ihrer gentechnologischen Forschung vor. Sie benutzen genmanipulierte Herpes simplex Viren als Vektoren (Gen-­‐Vehikel) bei der somatischen Gentherapie und onkolytische (tumortötende) Herpesviren zur Tumortherapie. Herpesviren sind beim Menschen als verschiedene Typen Krankheitserreger, wobei vor allem die Fieberbläschen, seltener Hornhaut oder Gehirnentzündungen bekannt sind. Das Virus ist etwa 120-­‐300 nm gross und besteht aus einer doppelsträngigen DNA, welche von einer Eiweisshülle umhüllt ist. Diese wiederum wird von einer Hülle aus Glykoproteinen (Proteine mit Kohlenhydrat-­‐Gruppen) umfasst, welche sich aus der Kernmembran der Wirtszelle ableitet und für das Eindringen des Virus verantwortlich ist. Gentherapie besteht im Wesentlichen darin, dass therapeutische Gene in somatische (Körper-­‐) Zellen oder in Keimbahnzellen transferiert (eingeschleust) werden. Die somatische Gentherapie hat die Behandlung von Krankheiten zum Ziel, welche durch einen Gendefekt in allen Körperzellen (monogenetisch) verursacht sind, des Weiteren die Therapie von Krebserkrankungen sowie von konventionell nur unzureichend heilbaren Infektionskrankheiten wie etwa HIV (AIDS). Um therapeutische Gene in Zielzellen zu transferieren gibt es drei Kategorien von Methoden: 1.
2.
3.
Viren, welche in Wirtszellen eindringen und deren Metabolismus manipulieren können, dienen als Vektoren, indem sie mit therapeutischer Fremd-­‐DNA beladen werden Liposomale Vektoren (siehe „Liposomen“), deren Membran mit der Zielzelle fusionieren kann, worauf DNA eingeschleust wird physikalische Methoden wie Injektion oder Elektroporation (Einschleusen mittels elektrischem Feld) Die viralen Vektoren sind am effizientesten und werden heute am meisten benutzt. In der somatischen Gentherapie wurden anfangs hauptsächlich Retroviren benutzt, welche den Vektor sehr stabil ins Genom der Wirtszelle Integrieren und so eine langfristige Genexpression garantieren. Es hat sich aber gezeigt, dass dadurch eine Fehlregulation der körpereigenen Gene, eine sog. Insertionsmutagenese, entstehen kann, was in einigen Behandlungsfällen zu Leukämien geführt hatte. Daneben werden auch häufig Adenoviren (Schnupfenerreger) als Vektoren eingesetzt. Sie bieten einen hocheffizienten Gentransfer in teilende und nichtteilende Zellen, lösen aber unerwünschte, starke Immunreaktionen aus. Kleine, nicht pathogene Viren aus der Familie der Parvoviren lösen dagegen kaum Immunreaktionen aus und integrieren sich auf Chromosom 19. Die daraus abgeleiteten Vektoren sind aber sehr klein und verlieren deshalb diese Fähigkeit. Das Herpes-­‐simplex-­‐Virus Typ 1 (HSV-­‐1) hat die Entwicklung vielseitiger Vektoren ermöglicht. Diese können viele teilende und nichtteilende Zellen infizieren und ermöglichen den Gentransfer in zahlreiche Gewebe. Sie können grosse Mengen fremder DNA transportieren, wesentlich mehr als Retroviren und oft ganze Genloci, und da die virale DNA ausserhalb der Chromosomen bleibt, entsteht keine Insertionsmutagenese. HSV-­‐1 Viren können durch die Deletion essentieller Gene und deren Ersatz durch Fremd-­‐DNA zu „entschärften“ Vektoren werden. Eine andere Technik lässt den HSV-­‐1 Viren nur noch minimale Reste ihres Genoms, so dass sie zwar noch infektiös, aber nicht mehr vermehrungsfähig sind, und kloniert diese danach in ein bakterielles Plasmid. Daraus entsteht ein sog. Amplikonvektor. Auf ihm kann sehr viel Fremd-­‐DNA untergebracht werden. Nach Verpackung dieser Vektoren in HSV-­‐1 –Verpackungszellen stehen hochinfektiöse Herpesviren bereit, die therapeutische Gene oder Markergene mit hoher Effizienz in diverse Gewebe befördern können. Mit raffinierten Techniken hergestellte Amplikonvektoren lösen keine Immunreaktion aus und sind nicht toxisch. Allerdings ist das Vektorgenom nach Infektion einer Zelle unfähig, sich zusammen mit dem zellulären Genom zu vermehren. Es geht mit der Zeit verloren und die Expression der therapeutischen Gene stoppt. Es werden deshalb sog. hybride Vektoren hergestellt, welche mit Hilfe genetischer Elemente anderer Viren, z.B. Parvoviren oder Epstein-­‐Barr-­‐Virus (Herpes-­‐Familie) zur Replikation mit dem zellulären Genom fähig sind. Die Vorteile der Amplikonvektoren bleiben dabei erhalten und die Fremdgene werden stabil exprimiert, was für die somatische Gentherapie unerlässlich ist. Man spricht bei solchen kombiniert hergestellten Vektoren auch von Designer-­‐Vektoren. Die Autoren stellen im Weiteren das Anwendungsgebiet der Herpes Viren zur Tumormedizin (Onkologie) dar. Onkolytische Viren sind gentechnisch verändert, um durch Vermehrung in Krebszellen diese gezielt zu zerstören, ohne aber gesundes Gewebe zu schädigen. Diejenigen viralen Gene, welche die Vermehrung in normalen Zellen ermöglichen, werden entfernt. Zur Zeit ist offenbar die Behandlung von Hirntumoren am besten untersucht, wobei das gentechnisch veränderte Herpesvirus G207 zum Einsatz kommt. Die Wirksamkeit dieses „Designer-­‐Virus“ wurde auch gegen Darm-­‐ Brust-­‐ und Prostata-­‐Krebs gezeigt. Gendeletionen verhindern eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus in gesunden, nicht teilungsaktiven Zellen, was sich mit Hilfe eines eingeschleusten Markergens (IacZ) klinisch überprüfen lässt. Zur weiteren Absicherung könnte das Virus bei Bedarf mittels konventioneller antiviraler Medikamenten wie Acyclovir wieder aus dem Organismus entfernt werden. Die Autoren führen erste klinische Anwendungen aus dem Jahr 2000 an, wobei 21 Patienten mit Hirntumoren eine stereotaktische Injektion von G207 Partikeln erhalten und gut vertragen hatten. Neuere Tendenzen gehen dahin, den Designer-­‐Viren noch immunmodulatorische Gene aufzuladen, um die Aktivierung des Immunsystems am Ort des Tumors zu erreichen. Für diese Immunstimulierung ist z.B. das Zytokin (Signalstoff) IL-­‐2 zuständig. G207 kann als Helfervirus für die Herstellung von Amplikonvektoren benutzt werden, welche für IL-­‐2 codieren. Die Autoren geben der Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft durch die Verwendung von gentechnisch veränderten Herpesviren die Korrektur zahlreicher angeborener und erworbener Erkrankungen ermöglicht wird, und dass durch onkolytische Herpesviren in betroffenen Patienten erzielt werden kann. Prof. Dr. Hans-­‐Johann Glock (1960) Ord. Professor am Philosophischen Seminar der Universität Zürich Präsident der Philsophischen Gesellschaft Zürich Visiting Professor University of Reading GB Spezialgebiete: Philosophie des Geistes, Sprachphilosophie, Geschichte der analytischen Philosophie 9. Evolution, Philosophie und Theologie 9.1 Ringvorlesung vom 17.12.09, UNI Zürich: Das philosophische Erbe. Evolutionäre Erkenntnistheorie Prof. Dr. Hans-­‐Johann Glock, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Referent schickte gleich voraus, dass evolutionstheoretische Überlegungen die philosophische Reflexion über Erkenntnis nicht ersetzen kann. Erkenntnistheorie bzw. Epistemologie beschäftigen die Philosophie schon seit den Vorsokratikern, obschon sich der Ausdruck erst im 19. Jh. eingebürgert hat. Glock betonte, die Philosophie sei die Mutter aller Wissenschaften, an ihr führe kein Weg vorbei, da nur sie die Erkenntnis selbst zum Thema habe. Die meisten wissenschaftlichen Disziplinen streben zwar nach Erkenntnis, befassen sich aber nicht mit ihr. Es ist die Erkenntnistheorie zu unterscheiden von der einzelwissenschaftlichen Untersuchung zur Erkenntnis. Philosophische Fragen zur Erkenntnis lassen sich durch empirische Befunde nicht lösen. Resultate wissenschaftlicher Arbeiten sind noch keine Erkenntnis. Philosophisch Debatten können durch Beobachtungen und Experimente nicht entschieden werden. Sie beziehen sich eher auf die Relevanz, welche diese für philosophische Probleme haben. Diese Probleme umschrieb Professor Glock mit drei Fragen: -­‐
-­‐
-­‐
Was ist Wissen? Gibt es echtes Wissen überhaupt? Wie können wir Wissen erlangen? Die erste Frage ist eine Analyse des Wissensbegriffs und anderer die Erkenntnis betreffender (epistemischer) Begriffe wie Wahrheit, Überzeugung, Rechtfertigung, Grund, Gewissheit oder Wahrnehmung. Solche analytischen Fragen finden sich bereits bei Platon und sind heute wieder aktuell. Kognitionswissenschaftliche Theoriebildungen müssen begleitet werden von Überlegungen zu den Begriffen des Wissens und der Methoden, auf welche sich Forschungsprojekte beziehen. Es kann etwa um Fragen gehen, welche Relevanz empirische Daten für das haben, was unter Wissen verstanden wird. Die zweite Frage bezieht sich vor allem auf den Skeptizismus, welcher bestreitet, dass wir überhaupt Wissen besitzen können. Man könnte ja nach Déscartes nur träumen statt leben und am kommenden Tag aus dem Traum erwachen, und die Welt wäre völlig anders. Die Gegner glauben, die Widerlegung des Skeptizismus sei eine zentrale Aufgabe der Erkenntnistheorie. Die dritte Frage spielt in der Debatte um die Quellen und Grenzen der menschlichen Erkenntnis eine entscheidende Rolle: Können wir in unserem Streben nach Erkenntnis auf die Vernunft setzen (Rationalisten), oder auf die Erfahrung (Empiristen). Die Wissenschaftstheorie wird von dieser Frage bestimmt. Im Folgenden rekapitulierte der Referent die Grundsäulen der Evolutionstheorie, der Entstehung und Vererblichkeit von Variationen und ihre Auslese durch die Umwelt, durch andere Organismen oder durch das andere Geschlecht. Die biologischen Arten sind nicht unveränderlich, wie von Aristoteles bis Linnaeus allgemein angenommen worden war. Sie sind vielmehr aus einem gemeinsamen Ursprung entstanden durch den nicht zielgerichteten Prozess der Evolution, der auch heute noch stattfindet. Besser angepasste Individuen haben eine grössere Chance, sich fortzupflanzen (Fitness), wodurch sich der Anteil der adaptiven Gene im Genpool erhöht. Die Vielfalt der Lebewesen ist nach Darwin also nicht gottgegeben, sondern Resultat eines dynamischen Prozesses. Auch der menschliche Geist und die ihm zugrunde liegenden Organe haben einen evolutionären Ursprung. Der Mensch und die heute lebenden Menschenaffen haben einen gemeinsamen Vorfahren. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass kognitive Fähigkeiten, die wir mit den Menschenaffen teilen, bereits bei diesem letzten gemeinsamen Vorfahren angelegt waren. Evolutionäre Erkenntnistheorie betrifft darwinistische Ideen zur Evolution von Kognition. Es haben sich zwei Strömungen herausgebildet: Der amerikanische Pragmatismus verknüpfte die Idee der Praxis mit derjenigen der Evolution. Erkennen sei kein passives Abbilden einer unabhängig von uns existierenden objektiven Realität, sondern ein aktiver Prozess, in dem sich das Subjekt mit seiner Umgebung auseinander setzt. Die dazu notwendige Kognition ist das Instrument der darwinistischen Fitness. Dem gegenüber vertritt der zeitgenössische Naturalismus eine empirische Psychologie, welche aus dem Input von Sinnesreizungen ein Output an wissenschaftlichen Theorien liefert. Die evolutionäre Erkenntnistheorie sei eigentlich eine naturalisierte Erkenntnistheorie, die sich an der Evolutionstheorie orientiert. Dabei erhebe sie den Anspruch, erkenntnistheoretische Fragen dadurch zu lösen, dass sie kognitive Phänomene als das Produkt evolutionärer Prozesse begreift. Heute unterscheidet man bei der evolutionären Erkenntnistheorie auch zwischen einer -­‐ Evolution of Epistemological Mechanisms (EEM), die sich auf die Phylogenese von kognitiven Fähigkeiten und Organen bei Mensch und Tier bezieht, und einer -­‐ Evolution of Epistemological Theories (EET), welche die Entwicklung von wissenschaftlichen Theorien und Ideen untersucht. Innerhalb der EEM wird wiederum unterschieden zwischen einer realistischen und einer konstruktivistischen Strömung. Im Realismus erscheint es wohlbegründet, dass es eine subjektunabhängige Wirklichkeit gibt, die wir zumindest teilweise erkennen können. Denn nach der Evolutionslehre wäre eine Art, deren Überzeugungen grob falsch wären, längst ausgestorben. Anderseits passen unsere Erkenntnisstrukturen auf die objektiven Strukturen der Welt, weil sie sich ja in Anpassung an diese Welt herausgebildet haben. Dem ist der Konstruktivismus diametral entgegengesetzt, welcher meint, die Evolution beweise, dass es eine objektive Wirklichkeit gar nicht gibt. Das was uns als solche erscheint, ist lediglich das Produkt unseres Gehirns. Traditionelle Erkenntnistheorie und Erkenntnis selbst werden von Darwin nicht erklärt. Denn nach Glock ist die Evolutionstheorie keine Fundamentalwissenschaft, aus der sich die anderen Wissenschaften ableiten liessen. Sie erklärt keine mathematischen, physikalischen oder chemischen Zusammenhänge, sondern ihre Begründung hängt teilweise von ihren eigenen Methoden ab. Allerdings geht die evolutionäre Erkenntnistheorie zu Recht davon aus, dass Erkenntnis ein biologisches Phänomen ist, da doch nur körperliche Wesen erkennen können. Ebenso ist es richtig, dass die Entstehung der kognitiven Fähigkeiten und der dazu gehörenden Organe durch die Evolutionstheorie erklärt werden kann. Doch zur Beantwortung der Fragen nach dem Wesen der Erkenntnis oder der Logik trägt sie wenig bei. Sie würde anderseits mit der Loslösung von Logik und Philosophie ihr eigenes Fundament untergraben. Der Wissensbegriff konnte bisher weder von der evolutionären noch von der traditionellen Erkenntnistheorie geklärt werden. Die EET besagt, die Entwicklung der Wissenschaften sei ein evolutionärer Prozess von Versuch und Irrtum. Dies widerspricht aber der Natur wissenschaftlicher Theoriebildung mit ihren Ansprüchen auf Erkenntnis, Überlegung und Zielausrichtung. Theorien müssen den gefundenen Daten entsprechen und den zugrunde liegenden Modellen. Allerdings können die Randbedingungen Resultat von Variation und Selektion sein. Würde hingegen der Anspruch auf Rationalität bei der Theoriebildung aufgegeben, würde der Unterschied gegenüber religiösen Schöpfungsmythen dahinfallen. Wissenschaftsentwicklung steht zudem in einem Gegensatz zur Diversifizierung in der biologischen Evolution. Wissenschaft sieht sich zwar von der Methode her erkenntnistheortisch höher als Mythen, nicht einfach als deren Diversifizierung, doch dass Homo sapiens höher stünde als andere erfolgreiche Arten, ist ein nicht haltbarer Anthropozentrismus ohne biologische Grundlage. Die EET könnte den evolutionstheoretischen Ast, auf dem sie sitzt, selbst absägen. Die Wissensbegründung und Wissen selbst sind nach Ansicht der Skeptiker nicht erreichbar. Meine Überzeugungen, die materielle Welt betreffend, kann ich nicht in den Status von Wissen erheben. Nach Glock ist es umstritten, ob diese Zweifel je ausgeräumt werden können. Die Evolutionstheorie könne dies als empirische Wissenschaft schon gar nicht leisten. Gerade die Erfahrung wird ja von Déscartes Traumargument infrage gestellt. Zudem könne die kausale Erklärung der Genese eines Erkenntnisanspruchs die Gültigkeit dieses Anspruchs weder beweisen noch widerlegen. Immerhin könne die Evolutionsbiologie potentiell erklären, wie das Vermögen, die Welt zu erkennen, entstanden ist, wenn man voraussetzt, dass wir die dazu nötigen kognitiven Fähigkeiten besitzen. Das sei hingegen wiederum keine neue Spielart der Erkenntnistheorie. Das Verhältnis der evolutionären Erkenntnistheorie zu Realismus und Konstruktivismus war ein letztes Thema der Vorlesung. Konstruktivisten sagen, Erkennen sei kein Erfassen einer von uns unabhängigen Welt, sondern vielmehr ein andauerndes Hervorbringen einer Welt durch das Erkennen. Diese Aussage wird auch durch neurobiologische Überlegungen gestützt: Alle auf uns einwirkenden Stimuli werden im Gehirn in elektro-­‐chemische Impulse umgewandelt, und zwar auf eine evolutionär adaptive Weise. Die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, bestände damit nur im Gehirn als elektro-­‐
chemische Impulse. Die Wirklichkeit wäre somit eine Simulation des Gehirns. Glock sieht darin aber einen Fehlschluss: Das Gehirn müsste selbst eine Simulation sein, die sich als Simulation selbst erzeugt. Zudem sind Objekt und Erkennen grundlegend für unsere epistemischen Begriffe. Überzeugungen sind ihrer Natur nach wahr oder falsch, je nachdem, ob es sich so verhält, wie sie sagen. Nur dann handelt es sich um Wissen. Professor Dr. Gereon Wolters studierte katholische Theologie in Innsbruck 1065-­‐76, Philosophie und Mathematik in Tübingen 1967-­‐69, in Kiel 1970, und schloss mit dem Staatsexamen 1972 in Tübingen ab. Er habilitierte in Konstanz 1977 in Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Seit 1988 ist er Auch der Realismus lässt sich nicht immer evolutionsbiologisch begründen. Daraus, dass eine Assistenzprofessor an der Universität Konstanz und Visiting Professor an den Universitäten wahr ist, folgt a
nicht, dass sie evolutionär erfolgreich ist. Umgekehrt können z.B. religiöse Zürich, Bern, PÜberzeugung ittsburgh und Rom, sowie m Max Planck Institut Berlin. Vorstellungen der Evolutionstheorie widersprechen, aber trotzdem zu einer höheren biologischen Fitness führen. Wahre Überzeugungen kann man nicht als diejenigen bestimmen, welche die Fitness erhöhen. Der Erkenntnisanspruch der Evolutionstheorie unterminiert sich also auch im Realismus selbst. Der Schlüssel zur Natur des Wissens liegt also nicht in der Evolution. Wohl aber der Schlüssel zur Genese unserer grundlegenden biologisch verankerten kognitiven Vermögen und der kulturell vermittelten kognitiven Fähigkeiten und Leistungen. Die Beziehung zwischen biologischer und kultureller Entwicklung stellt sowohl die traditionelle wie auch evolutionäre Erkenntnistheorie vor knifflige Probleme. 9.2. Ringvorlesung vom 17.12.09 Die Evolutionstheorie und die Philosophen. Prof. Dr. Gereon Wolters, Konstanz. Vorlesungsnotizen, wb Der Referent stellte zwei Hauptfragen an den Anfang: Was hat die Philosophie der Evolutionstheorie zu sagen, und was kann die Philosophie möglicherweise von der Evolutionstheorie lernen. Die Philosophie habe als Wissenschaftsphilosophie eine ganze Menge zur Evolutionstheorie mit ihrem komplexen Status als wissenschaftliche wie historische Theorie zu sagen, betonte Prof. Wolters. Ferner gehe es auch um den Bestätigungsstatus einzelner ihrer Hypothesen. Die Philosophie liefert hier Methoden aus der Wissenschaftstheorie und der Logik. Zur Frage, welches die Auswirkungen der Evolutionstheorie auf die Philosophie sind, verwies Wolters einerseits auf die Uneinheitlichkeit und historische Entwicklung der Evolutionslehre selbst, wie auch auf die noch grössere Uneinheitlichkeit der Philosophie. Es gibt so viele Meinungen darüber, was Philosophie sei, wie es Philosophen gibt. Die überzeugendste Charakterisierung von Philosophie sieht der Referent in der Logik-­‐Vorlesung von Immanuel Kant, welche 1806 posthum publiziert worden war: „Das Feld der Philosophie lässt sich auf Folgendes bringen: 1.
2.
3.
4.
Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen“. Wolters formuliert das so: Philosophie befasst sich auf eine rationale, allgemein nachvollziehbare Weise mit den Bedingungen und Grenzen unseres Wissens, mit der Rechtfertigung moralischen Handelns und der Begründung unserer religiösen Auffassungen. Und eben diese drei, Wissen, Moralität und Transzendenz, machen für Kant den Kern des Menschlichen aus. Darwin habe nun den zutiefst bewegenden Gedanken hinzugefügt, dass der Mensch mit dem Tierreich in einer historischen Kontinuität gemeinsamer Abstammung steht. Die Beziehung der Evolutionstheorie zum Wissen liess der Referent nun weg, da sie sich in der Vorlesung von Prof. H.-­‐J. Glock findet, und widmete sich in der folgenden Passage der „Evolutionären Ethik“ Ein wichtiges Ergebnis der Evolutionstheorie ist, dass wir sowohl anatomische, physiologische und Eigenheiten des Verhaltens mit unseren nächsten Verwandten teilen. Diese haben einen evolutionsrelevanten Faktor. Ein Hase z.B., der beim Herannahen eines Raubtieres nicht flüchten, sondern ein gemütliches Verhalten zeigen würde, könnte nicht lange überleben. Seine Flucht ist nicht erlernt, sondern angeboren. Dasselbe gilt für das Sexualverhalten, welches arttypisch sein muss, um nicht aus der Fortpflanzung auszuscheiden. Es bestehen also genetische Verhaltensdispositionen als Wahrscheinlichkeiten, dass sich Angehörige einer bestimmten Art auf eine gewisse Weise verhalten. Dadurch scheinen einfache Organismen stärker determiniert zu sein als höhere wie der Mensch. Die Frage ist, wie sehr uns unsere Gene zu Knechten machen, oder wie sehr die evolvierte kulturelle Umwelt eine von der Biologie unabhängige Rolle spielt. Darwin habe die Macht der Kultur sowie der Erziehung und der Umwelt unterschätzt und zu viele unserer Eigenschaften als angeboren angesehen. Dies sei dann noch stärker bei seinem Vetter Francis Galton zum Ausdruck gekommen, welcher die Eugenik daraus abgeleitet habe. Daraus schliesst der Referent, dass die Evolutionstheorie unsere Verhaltensweisen kaum mit Förderung der Fitness erklären kann. Einige unserer moralischen Überzeugungen seien sogar Fitness mindernd. Die Evolutionstheorie könne zwar die Genese moralischer Überzeugungen kausal erklären, aber nicht begründen, ob und wann sie wertvoll oder verwerflich seien. Dazu präzisierte Wolters noch die Begrifflichkeiten: 1. Tatsachen aus Hypothesenbildung, Beobachtung und Experiment können keine Werte und Normen begründen. Empirie kann den Sachverhalten keine ästhetischen oder moralischen Werte zuordnen oder zu Handlungen auffordern. Es gibt keine normative Kraft des Faktischen. 2. „Handeln“ läuft bewusst ab und kann gedankliche Gründe haben. Sich verhalten“ braucht nicht bewusst zu sein, sondern kann durch materielle Umstände verursacht sein. Die Gründe des Handelns sind nicht automatisch „gut“ 3.
4.
Handlungen heissen „moralisch“, wenn sie im Interesse anderer erfolgen. Sie sind ein Spezialfall sozialen Handelns und damit evolutionären Untersuchungen zugänglich. Darwin selbst zählte Sympathie, Treue und Mut zu den Qualitäten, welche schon von den Vorahnen des Menschen durch natürliche Selektion und ererbte Gewohnheit erworben worden waren. Unter „Moral“ versteht Wolters faktisch bestehende Orientierungssysteme, unabhängig davon, ob sie „moralisch wertvoll“ sind. Kirchen haben etwa ihre Moral, aber auch Banken. Die Moral braucht also eine Rechtfertigung durch die „Ethik“. Diese ist folgedessen die Theorie der Moral. Die Evolutionstheorie erklärt nun etwa mit Hilfe der Soziobiologie die Entstehung von Verhaltensdispositionen. Diese können aber wie etwa die Liebe der Eltern zu ihren Kindern von anderen Dispositionen überdeckt werden (Rabeneltern) und haben eben einen gewissen Wahrscheinlichkeitscharakter. Die Soziobiologie weist den Altruismus dem Egoismus zu, sofern er als Fitness zur wirksameren Weitergabe der eigenen Gene führt. Ebenfalls kommt die Reziprozität zum Zuge, indem der Wohltäter fitnessmässig wiederum kompensiert wird. Wenn aber auch dies wegfällt, etwa bei Spenden für Katastrophenopfer am anderen Ende der Welt, dann muss die menschliche Fähigkeit zu autonomer Reflexion, zu Fragen nach Gründen des Handelns mit einbezogen werden. Selbst wenn diese Reflexionsfähigkeit evolutionär entstanden ist, hat dies keinen Einfluss auf ihre Resultate. Die Resultate der Selbstreflexion müssen nicht fitnesssteigernd sein. Dazu gehören etwa die Menschenrechte oder Gerechtigkeitsfragen. Die Evolutionstheorie kann also Beiträge zur Moral leisten, aber nicht zu deren Begründung, der Ethik. Die Philosophie hat dies auch als Unterscheidung von Genese und Rechtfertigung thematisiert. Ein evolutionärer Nutzen einer Handlung rechtfertigt nicht ihren moralischen Wert. Die autonome ethische Reflexion nimmt aber gerne wissenschaftliche Studien als Faktenbasis zur Kenntnis. Evolution und Religion war das Thema des zweiten Teils der Vorlesung. Wolters erwähnt Darwin mit den Äusserungen zum „Gefühl religiöser Ergebung, welches sich zusammensetze aus Liebe, vollkommener Unterwerfung unter ein erhabenes, geheimnisvolles Etwas, einem starken Abhängigkeitsgefühl, Furcht, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Hoffnung auf ein Jenseits und vielleicht noch anderen Elementen“. Darwin verglich dies sogar mit der Liebe und Treue eines Hundes zu seinem Herrn. Zu allfälligen Mechanismen der Evolution religiöser Gefühle forschte und schrieb er allerdings nichts. Von späteren Evolutionsbiologen wie Edward Wilson vorgebrachte Argumente der Fitnesssteigerung von Populationen durch die Kohäsionskraft von Religionen hält Wolters in Anbetracht fehlender wissenschaftlicher Resultate nichts. Auch sei es spekulativ, anzunehmen, die früher einmal gültigen Umstände würden auch heute noch zutreffen und seien für die Charakterisierung von Religion ausreichend. Mythenbildung, etwa, die im Buddhismus nicht vorkomme, sei keine Begründung für Religion, ebenso wenig eine bildhafte Darstellung der Realität, die beim Islam fehle. Ein unangemessener Begriff der Religion sei auch der Mangel, welcher den neuen Atheisten anhafte, die im wissenschaftlichen Gewand daherkämen. Damit meinte er vor allem Richard Dawkins, für den Religion ein Nebenprodukt der kindlichen Gehorsamsdisposition gegenüber den Eltern sei. Seine Vorstellung von „Gotteswahn“ sei eine reine Spekulation, welche sich die Glaubwürdigkeit wissenschaftlich-­‐empirischer Aussagen zunutze mache. Aber gerade am empirischen Belegen fehle es im „wissenschaftlichen Atheismus“. Wolters hat deshalb eine der evolutionären Ethik analoge These. Man muss die Funktionalität von Verhaltensweisen unterscheiden vom Wahrheitsgehalt der religiösen Auffassungen. Moralische Verhaltensdispositionen können genauso „gut“ oder „verwerflich“ sein wie religiöse. Das Programm, kulturelle Phänomene mit der Naturwissenschaft erklären zu wollen, wird allgemein als Naturalismus bezeichnet. Diesem fehlen aber oft die empirischen Belege, obwohl der Nutzen naturwissenschaftlicher Hypothesen zur Erklärung kultureller Phänomene nicht bezweifelt wird. Schlussendlich habe die wissenschaftliche Erklärung der Entstehung und Entwicklung des Lebens aber doch zur Folge gehabt, dass die frühere Sicht eines „göttlichen Designers“ als „Zufluchtsort der Unwissenheit“ nicht mehr haltbar sei. Damit sind aber nicht zugleich auch Gott und der Glaube zu Ende. Die Religion sei indessen mehr auf die Ebene der Gefühle verlagert worden, auf ein Reduit der Innerlichkeit. Professor Rippe ist Professor für praktische Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Er hat permanente Lehraufträge an der Fachhochschule Nordwestschweiz (Wirtschaftsethik), an der VetSuisse und an den veterinärmedizinischen Fakultäten Bern und Zürich. Er ist Präsident folgender Ethikkommissionen: -­‐
-­‐
-­‐
9.3 Ringvorlesung vom 3.12.09 Eidg. Ethikkommission für Bioethik Kant. TVerirrungen ierversuchskommission im 2ZH 0. Jahrhundert. Ethikkommission von Exit Darwin und die beiden Gesichter des ethischen Individualismus. Buch: Ethik im ausserhumanen Bereich Prof. Dr. Klaus-­‐Peter Rippe, Karlsruhe Vorlesungsnotizen, wb Zu den moralischen Konsequenzen, die aus Darwins Evolutionstheorie diskutiert werden, gehört auch die Frage des ethischen Individualismus. Dieser Begriff hat nach Rippe mindestens drei Bedeutungen: 1.
In einer ersten Bedeutung spricht man von Individualismus, wenn allein Individuen Objekte unserer moralischen Verpflichtungen sind. Im Gegensatz dazu kümmert sich der Kollektivismus um die Verpflichtungen von Gemeinschaften. 2.
Eine zweite Bedeutung besteht darin, eine Handlung dann als gut zu beurteilen, wenn sie für ein Individuum gute Auswirkungen hat. Der ethische Individualismus oder gar Egoismus würde dann gebieten, nur das eigene Gute zu fördern. Im Gegensatz dazu steht der ethische Altruismus, wonach das Wohl der anderen zu fördern ist. Dabei gibt es wiederum Spielformen des Kollektivismus, welcher das Gute für eine Gemeinschaft, eine Rasse oder eine Art fordert. 3.
Die dritte Bedeutung handelt davon, dass das Individuum nicht aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Rasse oder Abstammung als gut oder schlecht beurteilt werden darf. Es darf für das Individuum keine moralische Ungleichheit eingefordert werden, welche einer tatsächlichen oder angenommenen Eigenschaft seines Kollektivs entsprechen würde. Das Individuum ist eine Person mit individuellen Eigenschaften und Leistungen. Professor Rippe ging es nun um die Frage, welche Bedeutsamkeit Darwins Gedanken für die Ethik hatten und haben. Er erwähnt zuerst den kollektivistischen „Sozialdarwinismus“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts, welcher eigentlich nicht von Darwin stammt. Es ging um die Forderung, dass Personen eine natürliche Verpflichtung hätten, sich für das Wohl ihrer eigenen Rasse einzusetzen. Dies entsprang der Annahme, jedes Wesen sei darauf ausgerichtet, den Fortbestand der eigenen Art zu sichern, und beim Menschen beziehe sich dies auf die Rasse. Man bezeichnet diese Idee auch als „ethischen Naturalismus“. Heute ist aber weder die Annahme der „Arterhaltung“ noch diejenige der „Rasse“ noch haltbar oder empirisch belegt. Die Evolutionstheorie wurde auch oft mit wirtschaftlichem Liberalismus gekoppelt, so bereits von einem Zeitgenossen Darwins, dem Philosophen Herbert Spencer. Er postulierte, die Naturgesetze sollten auch in der Gesellschaft wirken. Die Freiheit des Einzelnen sollten nur durch die Freiheit der Anderen eingeschränkt werden. Anderen zu schaden, ist also moralisch verboten. Im Recht auf moralische Gleichheit und Freiheit ist Fortschritt zu erwarten. Jeder Einzelne entfaltet darin seine Individualität und führt ein gutes Leben. Wenn sie so wohlhabend werden, haben sie die Verpflichtung, den Armen zu helfen. Staatliche Eingriffe werden abgelehnt, da sie den Einzelnen bei der Erreichung seiner wirtschaftlichen Ziele stören. Kritiker sahen allerdings im Namen Darwin den Gedanken einer Ellbogengesellschaft, in der jeder für sich, statt für die anderen sorge. Der amerikanische Präsidentschaftskandidat William J. Bryan sorgte sich 1914 gar um den Zusammenhalt der Gesellschaft, da das Streben nach Vervollkommnung, also die Konkurrenz, die Liebe unter den Individuen ausschalten würde. Prof. Rippe ist aber nicht damit einverstanden, dass aus der Evolutionstheorie ein ethischer Naturalismus im Sinne moralischer Forderungen abgeleitet werden könne. Auch wenn sich das Leben biologisch nach der natürlichen Selektion entwickelt, kann daraus nicht geschlossen werden, dass dies ein moralisches Vorbild sei. Es käme einem Spagat gleich, anzunehmen, das was in der Natur sei, sei zugleich gut und dieser ethische Naturalismus würde ein Naturrecht begründen. Ebenso wenig lässt sich mit dem ethischen Naturalismus ein ontologischer Naturalismus verbinden, der sagt, dass Aussagen über die Aussenwelt nur dann wahrheitsfähig seien, wenn sie direkt auf Erfahrung beruhen. Naturwissenschaftliche Beschreibungen haben keine ethische Wertung. „Gut“ wäre sonst eine Eigenschaft von Gegenständen. Eine „wertrealistische These“ könnte die Existenz objektiver Werte behaupten. Doch das Argument, eine Überzeugung sei wahr, weil sie fast alle Menschen intuitiv für wahr halten, ist ein Fehlschluss. Intiutionen haben keine Begründungsfunktion. Moralische Intuitionen widerspiegeln lediglich die in der Erziehung und Sozialisation erworbenen Überzeugungen. Die Annahme der Existenz objektiver Werte und eines moralischen Sinnes, der Wahrheit erschliessen würde, genügt methodischen Anforderung nicht. Im zweiten Teil der Vorlesung behandelte Prof. Rippe die Auswirkungen der Evolutionstheorie auf die Problematik der Gattungseigenschaften im Sinne der anfangs erwähnten dritten Bedeutung des ethischen Individualismus. Diese ist wissenschaftlich und argumentativ gut begründet. Aus der Evolutionstheorie lassen sich direkt zwar keine moralischen Normen ableiten, aber sie liefert „stützende Gründe“ für die Ethikdiskussion. So ist etwa die Leidensfähigkeit eines Tieres ein empirisches Argument, dem eine ethische Funktion zukommt. Anderseits ist Darwins These, dass der Mensch zwar besondere Merkmale habe, dass aber von einem „Hoch“ und „Tief“ der Entwicklung eigentlich nicht gesprochen werden könne, eine Gefährdung der moralischen Sonderstellung des Menschen. Die Frage ist, ob damit auch die Menschenwürde selbst gefährdet wäre. Die moralische Sonderstellung des Menschen werde meist mit seiner Vernunftnatur begründet, erklärte der Referent. Dabei gibt es aber strukturelle Probleme: Nicht alle Menschen sind vernünftig. Menschen mit Demenzen und geistigen Behinderungen, Kleinkinder u.a. sind nicht mehr oder noch nicht oder gar nie vernünftig. Sie hätten also keine Menschenwürde. Man bezieht sich deshalb auf die Gattungseigenschaften. In jedem Menschen sei die Vernunftnatur angelegt und bestimme seine Menschenwürde auch wenn sie nicht in Erscheinung trete. Diese Position ist aber wieder mit zwei Problemen behaftet: Sie basiert eigentlich auf einer moralisierenden Naturphilosophie, die wie erwähnt nicht haltbar ist. Anderseits würde sie das teleologische Weltbild stützen, wonach die Organismen als Ziel bereits im Keim angelegt seien. Dies wird aber von der Evolutionstheorie und von der modernen Molekularbiologie bestritten. Der Begriff „Art“ ist lediglich ein menschlicher Klassifikationsbegriff, um unterschiedliche Populationen zu identifizieren. Artzugehörigkeit bedeutet eine gewisse reproduktive Isolation. In der Natur gibt es aber keine Arten, nur Individuen mit fliessenden Übergängen. Auch molekularbiologisch entfaltet sich in jedem einzelnen Wesen ein individuelles Genom, nicht dasjenige seiner Art. Auch wenn man den philosophischen Begriff der Kategorie verwendet, welcher dem Menschen im Unterschied zum Tier ein Personsein zuschreibt, kommt man nicht weiter. Denn damit wäre man auf metaphysische Annahmen angewiesen, die sich nicht begründen lassen. Der Bezug zu biologischen Kategorien lässt sich nicht ausschalten und Telos, als festgelegtes Ziel von Lebewesen ist nicht haltbar. Es beginnt offenbar alles bei einem individuellen Genom, in dem nicht notwendigerweise die Möglichkeiten angelegt sind, Person zu werden. Die Lehre von der Vernunftnatur des Menschen stützt sich eigentlich auf eine vordarwinistische Naturphilosophie. Man benutzt damit also eine brüchige Stütze. Auch wenn man mit dem „Common Sense“ argumentiert, Gattungseigenschaften seien graduell verschieden und man dürfe Menschen aufgrund diese Unterschiede verschieden behandeln, kann der Common Sense irren. Wir werden Menschen moralisch also nicht gerecht, wenn wir sie einer allgemeinen Klasse zuordnen. Angenommen, es würde ein ausnehmend intelligenter Schimpanse geboren, er könnte sprechen, denken, einen Schulabschluss machen und Hochschulreife erlangen. Darf man ihn nun verkaufen, in Experimente einbeziehen und von der Hochschule ausschliessen, weil er ein Schimpanse ist? Unser heutiger moralischer Common Sense fordert uns dazu auf, Individuen als Individuen zu nehmen und nicht als Angehörige einer Gattung, einer Rasse oder eines Geschlechts. Die Annahme von individuell unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten ist empirisch unstrittig. Rasse und Geschlecht hingegen sind keine moralischen Unterscheidungsgründe, die von irgendwelchen Gerechtigkeitstheorien gestützt würden. Mit dem ethischen Individualismus in seiner dritten Bedeutung steht man also in Bezug auf die Menschenwürde auf weit sichererem Boden als mit der „moralischen Sonderstellung des Menschen“. Prof. Dr. Hans-­‐Konrad Schmutz Studium der Anthropologie in Zürich 1981 Promotion 9.4. Rgingvorlesung vom 3N.12.09, ETH Zürich: Weitere Studien über eschichtliche Aspekte der aturwissenschaften und soziale Implikationen Eugenische Udtopien und der frühe Darwinismus 2007: Professor für Geschichte er Naturwissenschaften an der Universität Zürich Direktor des N
Winterthur Paturkundemuseum rof. Dr. Hans-­‐Konrad Schmutz, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Der Referent schockierte das Auditorium gleich zu Beginn mit alten Bildern aus dem kommunistischen Moskau, die zeigten, wie Wissenschaftler den Soldaten der Roten Armee den „Neuen Menschen“ erläuterten, welcher den Kampf ums Überleben gewinnen werde. Danach zeigte der Referent Bilder vom „Zweiten Internationalen Eugenikkongress„ im New Yorker American Museum of Natural History im Jahr 1921. Federführend war der renommierte Eugeniker H. H. Laughlin, welcher einen wissenschaftlich begründeten Rassenkampf vertrat und vor der Einwanderung „Minderwertiger“ warnte. Mit Hinweisen auf Darwin, von dem sogar eine Büste ausgestellt war, wurde behauptet, die galoppierende Verstädterung hätte die Evolution ausgeschaltet und zu einer „Degeneration“ des Volkskörpers geführt. Dem „müsse mit rassenhygienischen“ Massnahmen entgegengetreten werden. Wenige Jahre später erliess das US-­‐amerikanische Parlament restriktive Einwanderungsgesetze. Die Fehlinterpretation von Darwins Werk hätte fataler nicht erfolgen können: Anstatt darin die Basis für die modernen Lebenswissenschaften zu erkennen, gingen linke wie rechte Sozialutopisten daran, den „Volkskörper“ (an sich schon ein unhaltbarer Begriff) mit züchterischen Mitteln zu kurieren, um der Evolution nachzuhelfen. Daraus entstanden biologistische Metaphern in der Politik wie „der Überlebenskampf des Stärkeren“, „Krieg als Ersatz für die natürliche Selektion“, die „Züchtung des Tüchtigsten“, das „Ringen zwischen den Völkern“ mit „höchster Anspannung der Kräfte“ oder der „Vorteil, der dem nach Erbanlage und kultureller Ausstattung höher Stehenden gebührt“. Solche Worte wurden u.a. auch vom Zürcher Anthropologen O. Schlaginhaufen im Jahr 1916 publiziert. Sogar ein Sohn und ein Vetter Darwins, Francis Galton, hatten sich auf solche Auslegungen eingelassen. Galton meinte, dass geniale Männer über lange Zeiträume hinweg in einzelnen Familien gehäuft auftreten würden. Um dies zu fördern, begründete er die Eugenik. Seine Darwin – Wedgewood – Galton – Familie sei von solcher Genialität durchdrungen. Die tiefe Geburtenrate von erfolgreichen intelligenten Bevölkerungsschichten sei eine Gefahr für den Volkskörper. Die Eugenik sei in diesem Sinne eine „künstliche Selektion“. Aber auch in anderen Aspekten war Darwins Werk bewusst oder unbewusst falsch gedeutet worden. Die „Abstammung von Affen“ wurde von Strassensängern und Zirkusleuten, in Karikaturen und Glossen zum Gespött der Leute gemacht. Von ernsthafteren Kritikern wurde das Primat der Selektion angezweifelt und lautstark vor „verheerenden Auswirkungen eines säkularisierten Naturbegriffs auf die Moral“ gewarnt. Die Suche nach Bindegliedern zwischen Mensch und Affe beflügelte die Fantasie und löste Ängste aus. Es gab ein „monogenetisches Rassenmodell“, welches besagte, dass sich alle menschlichen Varietäten aus einem Stamm entwickelt hätten. Die Menschheit wurde in fünf Rassen eingeteilt, wobei der weisshäutige Kaukasier als ästhetischer Bezugspunkt galt. Daneben gab es das „polyphylenetische Rassenmodell“, welches von unterschiedlichen Ursprungsstämmen ausging. Auf dieses Modell hatten sich die Verteidiger der Skalvenhaltung gestützt. Anderseits übernahm man von Lamarck, dass sich die „Zweihänder“, die Bimana, langsam aus den „Vierhändern“, den Quadrumana“ entwickelt hätten und man schloss daraus, dass sich einzelne Menschengruppen auf unterschiedlicher Evolutionshöhe befänden. Der Afrikaner wurde dadurch wieder näher zum Affen gestellt und die Urbevölkerung galt durchwegs als primitiv. Damit wurde auch die „Fürsorgepflicht“ des überlegenen weissen Kolonisten gegenüber seinen dunkelhäutigen „Schutzbefohlenen“ begründet. Die Biologisierung der Gesellschaft führte zu einer naturgesetzlichen Rechtfertigung der eigenen Nation. Nur so kann man sich die Worte eines Pariser Anthropologen erklären: „Anders als die übrigen Deutschen seien die Preussen eine Mischrasse mit hohem slawischen Anteil. Darin liege die eigentliche biologische Ursache ihrer Brutalität und ihres Hasses auf die kulturell überlegenen Franzosen“. Auf deutscher Seite zählte der führende Berliner Mediziner Rudolf Virchof die Frage nach der „Nation“ zu den anthropologischen Forschungsgebieten. Das Volk galt als Gemisch aus ungleichen Rassen, deren Bildung nach der Eiszeit abgeschlossen worden sei. Er organisierte um 1900 die morphometrische Untersuchung von mehr als 6 Millionen Schulkindern. Mit Messzirkeln wurden so nicht nur die Ursprünge der eigenen Geschichte analysiert, sondern auch Gebietsansprüche und Kolonialpolitik begründet. Auch in der Schweiz arbeitete der erste Ordinarius für Anthropologie an der Universität Zürich, Rudolf Martin, an einer „Schweizerischen Rassenkunde“. Verheerend mutet heute ein Satz von ihm an: „Ist doch gerade die Rassenzusammensetzung vielfach massgebend geworden für die geschichtliche Entwicklung und den Kulturzustand gewisser Gegenden“. Sein Nachfolger, Otto Schlaginhaufen, führte zwischen 1927 und 1935 eine Grossuntersuchung an 35 000 Stellungspflichtigen durch, um „Grundlagen für eine praktische Rassenhygiene zu schaffen“. Er verstand darunter, dass durch „künstliche Selektion der verweichlichte Volkskörper kuriert werden sollte“. 1925 wurde eine „Julius-­‐Klaus-­‐Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene“ gegründet, welche solche Untersuchungen zu „Mischlingsfragen“, aber weniger die Sterilisationen finanzierte. Sterilisationen wurden auch aus „finanziellen Gründen“ durchgeführt, da „minderwertige Menschen sonst auf Staatskosten in Spitälern gehalten werden müssten“ Schlaginhaufen fürchtete allerdings schon in den 20er Jahren, rassenhygienische Zwangsmassnahmen fänden in einer direkten Demokratie niemals eine Mehrheit. Der Kanton Waadt regelte 1928 die Sterilisation gesetzlich. Im Kanton Zürich übertrug man dagegen diese Kompetenz an Vormund und Arzt. An der eingangs erwähnten Eugenik Ausstellung in New York war übrigens auch die Schweiz mit einer Tafel „rassetypischer Portraits“ vertreten. Auch 1945 nach dem Kriegsende erloschen die eugenischen Fantasien nicht. Der Referent erwähnt, dass die Firma CIBA 1962 27 führende Wissenschafter nach London einlud, um über die „biologische Zukunft des Menschen“ nachzudenken, wobei viele Experten sozialutopische Fernziele im Visier hatten und zu neuen technischen Eingriffen in den „kranken Volkskörper“ rieten. Der Zivilisationspessimismus zeigte sich auch in einer „Sorge um die negative Beziehung zwischen Fortpflanzungsrate und sozialer Stellung“. Man meinte, die evolutive Höherentwicklung des Menschen über künstliche Befruchtungen mit ausgewählten Samen und Klonen aus Spermienbanken steuern zu müssen. Die Molekularbiologie sollte die Sterilisationen ersetzen. Prof. Schmutz schloss mit Zitaten von Jürgen Habermas, welcher 2001 vor Biogenetik und Gentechnologie dahingehend gewarnt hatte, dass neben den Chancen auf Heilung von Krankheiten auch die Gefahr einer verbesserten Eugenik bestände. Die alte Forderung, das „Minderwertige am Volkskörper“ auszumerzen, stecke zum Teil auch in modernen Tendenzen. Auf die Frage aus dem Auditorium, wie sich die christlichen Kirchen zur Eugenik gestellt hätten, antwortete Professor Schmutz, sie hätten sich im 19. Jh. und bis 1935 neutral, die amerikanischen Protestanten und Freikirchen sogar unterstützend verhalten. Als jedoch erkennbar wurde, dass im Nazi-­‐
Deutschland Menschen mit Behinderungen und angeborenen Schädigungen in grossem Massstab umgebracht wurden, hätten sich die Kirchen ganz klar von der Eugenik distanziert. Auch Otto Schlaginhaufen, so erklärte ein älterer Herr aus dem Auditorium, der ihn noch gekannt hatte, habe seinen Fehler aus demselben Grund eingesehen und habe die Eugenik verlassen. Eine weitere Frage nach Gründen für die Verbannung der Eugenik beantwortete Schmutz mit der Rolle der Molekularbiologie. Sie erleichterte die Erkenntnis, dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Gene im moralischen Sinne gibt. Ebenso, dass sich eben keine normativen Grundlagen und Wertungen aus der Naturwissenschaft ablesen lassen. Eine weitere Frage betraf Kriterien für die Grundlage der Menschenrechte. Dazu sieht Schmutz heute vor allem die Leidensfähigkeit eines Lebewesens. Der Mensch als sozial lebendes Wesen hat Empathie für seine Mitmenschen. Ihre Verstärkung mit kulturellen Regeln bringt Gerechtigkeit. Die Frage nach einer hypothetischen „Anerkennung“ z.B. von Neanderthalern, falls einige heute noch leben würden, Professor Dr. Dr. h.c. Friedrich Wilhelm Graf (1948) lehrt systematische Theologie und Ethik an der Universität München. Nach Studien in Theologie, Philosophie und Geschichte in Wuppertal und Tübingen habilitierte er 1986 und wurde für systematische Theologie und Theologiegeschichte nach Augsburg berufen. Einige Jahre später w
echselte er nder ach M
ünchen. ebenfalls beantwortete Referent mit der „Leidensfähigkeit“, sowie Merkmalen wie Sprache und Kognition. Man habe aber um 1926 versucht, durch eine Kreuzung von Afrikanerinnen mit Schimpansen 1999 wurde eein „missing link“ zu züchten. Die Jungen, die aber nicht lebensfähig gewesen seien, habe man allerdings r als erster Theologe mit dem Leibniz-­‐Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. zu den Tieren gezählt. 9.5 Ringvorlesung vom 10.12.09: Theologische Debatten um die Evolutionstheorie Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Wilhelm Graf, München Vorlesungsnotizen, wb Der Referent, welcher in systematischer Theologie habilitiert hatte, stellte seine Vorlesung unter die Thematik, welche der Evolutionslehre diametral gegenübersteht, nämlich den Kreationismus. Es handelt sich hierbei nach Graf um ein christlich-­‐jüdisch-­‐islamisches, also monotheistisches Phänomen, welches aus den USA stammt und mit Anleihen aus der Wissenschaft „Modernität“ vorgibt, um damit Sinn vortäuschende Autorität zu schaffen. In den USA vertreten heute gut 2/3 der Staatsbürger auf irgendeine Art und Weise kreationistische Ideen. Sogar bei Biologielehrern sei der „Aberglaube“ zu finden, dass die allmähliche Entwicklung von Biomolekülen zu Zellen und von einfachen zu komplexeren Lebewesen zurückzuführen sei auf zielgerichtete, schöpferische Eingriffe Gottes, die schon von Anfang an für den Menschen bestimmt gewesen seien. Graf nennt dies ein „religiös-­‐wissenschaftliches Überlappungsphänomen“. Die moderne Religionsgeschichte zeige Vereinigungen von Wissenschaft und Religion, welche bis zur Reformation zurück verfolgt werden könnten. Wissenschaft will dem gegenüber aber nicht Wahrheit und Autorität herstellen, sondern in Frage stellen und verunsichern. Darwin sei von den monotheistischen Religionen anfangs noch gut aufgenommen worden. Erst als sich die Evolutionstheorie immer mehr als ein universales Erklärungsprinzip herausschälte, sei sie in die Kritik der Kirchen und der staatlichen Autoritäten geraten. Dies habe damit zu tun, dass der Schöpfungsbegriff und die Schöpfungssprache schon immer, seit dem Reich der alten Römer bis zur Gründung der USA politisch angewandt worden sei. Der Versuch, Territorien und Länder zu sakralisieren, habe seine Tradition in der Politisierung der Religion und in der Sakralisierung der Politik. Dies zeige sich heute in den USA unter dem Begriff „Zivilreligion“. Somit handelt es sich beim Kreationismus eigentlich nicht um eine zur Evolutionslehre konkurrierende Theorie über den Anfang der Welt und des Lebens oder der Entstehung und des Aussterbens von Arten, sondern um eine normative Ideologie über Grundstrukturen von Realität und Ethik. In den Sprachen, die Schöpfung beschreiben, sieht der Referent eine bestimmte Ordnungslogik, um den umfassendsten Ordnungsrahmen zu benennen, der allem menschlichen Handeln als unverfügbar vorausliege. Basisinstitutionen der Gesellschaft wie Ehe, Familie, Staat, Monarchie und Obrigkeit werden zu Schöpfungsordnungen sakralisiert. Wer eine bestimmte Institution als vom Schöpfer selbst gestiftet deutet, will sie der Verfügung des Menschen entziehen. Wer eine Schöpfungssicht durchsetzt, verfügt über eine religiös-­‐politische Deutungsmacht. Prof. Graf zählt im Folgenden einige typische Merkmale und Anzeichen kreationistischen Gedankengutes und Propaganda auf: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Beeinflussung der Bildungssysteme darüber, was gelehrt werden darf Die Selbständigkeit von Religionsgemeinschaften (Sekten) wird gefördert Evolutionsbiologen werden bedroht Kreationisten sind keine einheitliche Gruppe Schöpfungsmythen werden mechanistisch interpretiert und gelesen Bibeltexte werden mit Fluttheorien und mit geologischer „Evidenz“ verwissenschaftlicht (wird in den USA als Forschung subventioniert). Englische und anglikanische Fundamentalisten hatten schon im 19. Jh. kritisiert, mit der Evolutionstheorie liessen sich keine stabilen sozialen Strukturen erbauen. Möglicherweise war das mit ein Grund, dass die Schriften Darwins danach von der Katholischen Kirche auf den Index der verbotenen Schriften gesetzt wurden. Um 1920 waren es vor allem die US-­‐Demokraten, welche behaupteten, die Evolutionslehre würde das Vertrauen in den Staat untergraben. In Tennessee wurden Gesetze gegen das Verbreiten der Evolutionstheorie erlassen, später aber wieder zurückgezogen („Affenprozesse“). Mit überlangen Gerichtsverfahren wurde eine Polarisierung angestrebt über die Frage, wer die Deutungsmacht der Realität habe. Solche Themen tauchen heute wieder bei Fundamentalisten auf. Es sind denn auch vor allem die kleinen Sekten, einzelne Aktivisten und Laien oder etwa traditionalistische Untergruppierungen der grossen Konfessionen, welche pseudowissenschaftliche Argumente für den Kreationismus vorbringen, kaum die grossen Kirchen selbst. In neuster Zeit würden sie auch den Begriff der liberalen offenen Gesellschaft für die Forderung missbrauchen, beide Theorien in den Schulen zu lehren und dann die Schüler selbst entscheiden zu lassen. Die Leistungskraft religiöser Angebote sei heute bereits generell mit Politik und Wissenschaft liiert, meinte der Referent abschliessend. Es gehe den Kreationisten darum, -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Traditionelles Ideengut zu stabilisieren Autorität zu begründen in Krisenzeiten Komplexität zu reduzieren Autorität und Ideengut in gut funktionierende soziale Netzwerke zu implementieren und sie damit zu bestätigen sich mit der Wissenschaft vordergründig zu verbünden, um die Grenzen zu verwischen 9.6 Ringvorlesung vom 10.12.09, UNI Zürich: Darwin und die Religion. Die Fitness und die Religion. Ein theologischer Blick auf Darwins Evolutionstheorie Prof. Dr. Hans Weder, Zürich Vorlesungsnotizen, wb Prof. Weder hat als reformierter Theologe an der Universität Zürich vor allem über die Hermeneutik (Auslegungsfragen) der Gleichnisse in den Evangelien gearbeitet. Er setzte seinem Referat den bekannten Satz des Deutschen Philosophen F. W. J. Schelling (1775-­‐1854) voran: Die Natur schlägt im Menschen die Augen auf und bemerkt, dass sie da ist. Die Natur schreitet sozusagen vom Dasein zur Selbstwahrnehmung. Mit dieser Sicht wäre der Schöpfungsglaube mit der Evolutionstheorie durchaus vereinbar. Man kann die Religion als Emergenz der Evolution betrachten, als eine Folge mit unbekannter Ursache und unbekannter Wirkung. Der Ausdruck „Gott“ müsste dann für „Unerklärliches“ stehen. Das heisst aber nicht, dass der Glaube dort beginnen würde, wo die Erklärungen zu Ende sind. Unter „Gottebenbildlichkeit“ kann man verstehen, dass Gott dem Menschen dieselbe Verantwortung für die Schöpfung überträgt, wie er sie selbst wahrnimmt. Weder erinnerte an Feuerbach, welcher die Religion auf die Aussage reduzierte hatte, der Mensch habe sich Gott nach seinem Bild erschaffen. So gesehen wäre das Sakrale ein Konstrukt unseres Gehirns. Weder ist demgegenüber der Meinung, der Mensch habe mit dem Sakralen etwas Übergeordnetes entdeckt. Die Frage, ob die Religion auch der „Fitness“ diene, beantwortete er mit dem Hinweis, dass Religion Wissen zwar nicht ersetzen, jedoch den Umgang damit im Sinne der Fitness und damit der Schöpfung positiv beeinflussen könne. Die Bedeutung der Religion liege aber viel weniger bei der Erklärung von Unerklärbarem, als vielmehr bei der sakralen Durchdringung des Altruismus. Dieser sei zwar ein Produkt der Evolution. Doch die Forderung, nicht nur diejenigen zu lieben, die einem auch lieben, sondern gerade die anderen, die Feinde, stamme aus der Religion und beinhalte einen unbegrenzten Altruismus, welcher über den natürlichen hinausgehe. Weitere Gedanken widmete der Referent dem Zusammenhang von Religion und Personalität. Das Individuum sei ein Empfänger sakraler Personalität, ohne allerdings gefragt zu werden, und es müsse selbst entscheiden, ob es diesen Gottesgedanken als Angeredeter annehmen wolle. Die Personalität liege denn auch gerade in dieser freien Entscheidung und mache den Menschen zu einem Gast dieser Erde. Dies bedeute auch eine Versöhnung zwischen Mensch und Gott, die aber nicht erzwungen werden könne. Ob dies ein Beitrag zur evolutionären Fitness sei, könne er so nicht beantworten, meinte Prof. Weder, doch würde er in Würdigung der Besonderheiten unserer Spezies keine scharfe Grenzlinie zwischen Mensch und Natur ziehen. Den Begriff der Komplexität als „Zusammenarbeit des Verschiedenartigen“ sieht Weder schliesslich verwirklicht in der reflektierenden Ästhetik, in der Entdeckung des Heiligen und im Sinn für das Unantastbare. Die Natur und den Menschen deutet er als „Krone der Schöpfung“, aber nicht mit dem Zweck und Inhalt einer Herrschaft des Menschen, sondern in Betrachtung ihrer Würde durch Gott am 7. Schöpfungstag. 9.7 REHMANN-­‐SUTTER, C., Eigener Sinn. Kritik der Gegenständlichkeit von „Leben“. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004) 149/1: 29-­‐37 Christoph Rehmann-­‐Sutter, Prof. Dr. phil., dipl. biol., Institut für Geschichte und Epistemologie der Medizin. Arbeitsstelle für Ethik in den Biowissenschaften, Basel Literaturbericht von Lic. Phil. I Martin Baumann, Zürich In diesem Artikel diskutiert Rehmann-­‐Sutter die philosophische Kontroverse zur Frage «Was ist Leben», respektive inwiefern die Frage die Gegenständlichkeit des Lebens voraussetzt. Der Begriff Substantivismus wird dabei von Substanzialismus differenziert. Unter dem starken Bezug zur Ethik wird nach theoretischen Alternativen gesucht. Davon wird der Ansatz einer organischen Praxis aufgegriffen, welcher zu einer relationalen Theorie von Leben führt, die davon ausgeht, dass lebendig