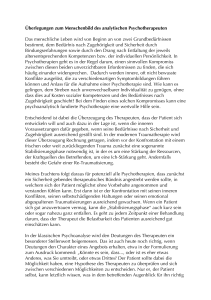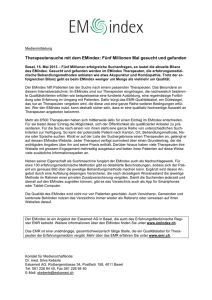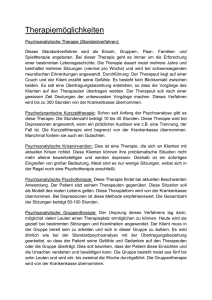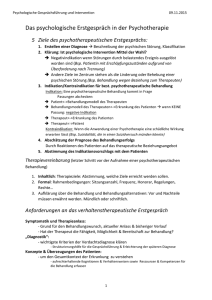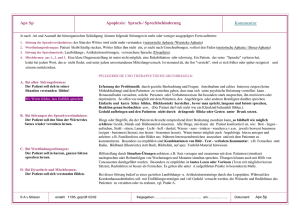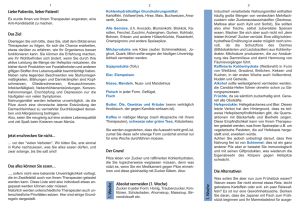fronten herrschen
Werbung
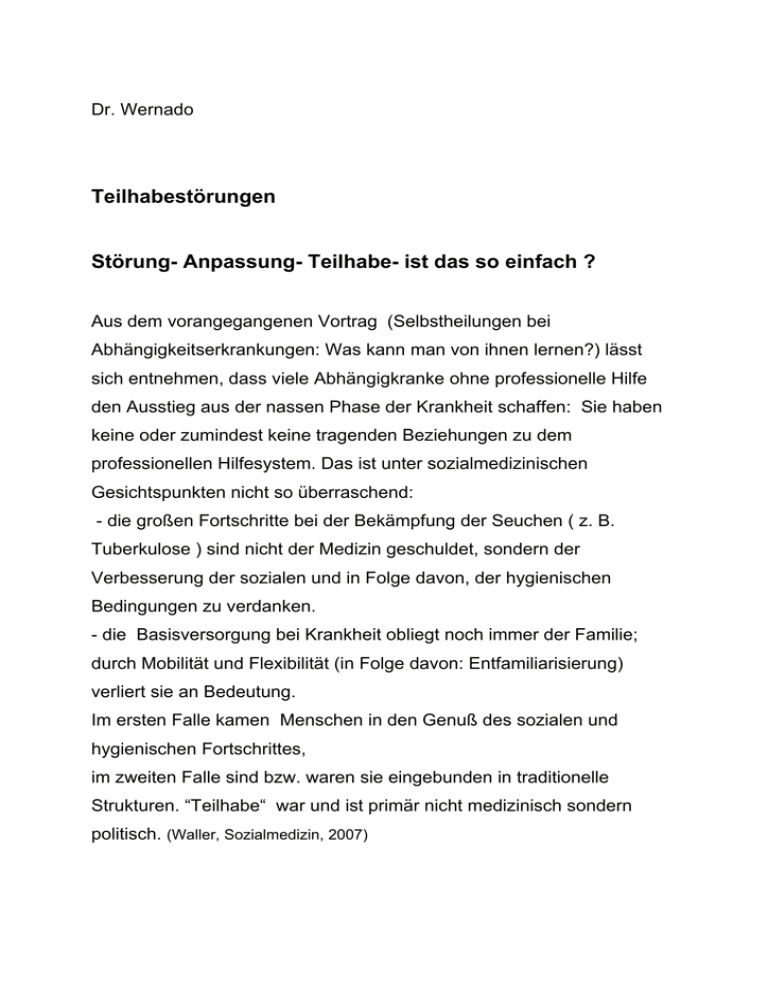
Dr. Wernado Teilhabestörungen Störung- Anpassung- Teilhabe- ist das so einfach ? Aus dem vorangegangenen Vortrag (Selbstheilungen bei Abhängigkeitserkrankungen: Was kann man von ihnen lernen?) lässt sich entnehmen, dass viele Abhängigkranke ohne professionelle Hilfe den Ausstieg aus der nassen Phase der Krankheit schaffen: Sie haben keine oder zumindest keine tragenden Beziehungen zu dem professionellen Hilfesystem. Das ist unter sozialmedizinischen Gesichtspunkten nicht so überraschend: - die großen Fortschritte bei der Bekämpfung der Seuchen ( z. B. Tuberkulose ) sind nicht der Medizin geschuldet, sondern der Verbesserung der sozialen und in Folge davon, der hygienischen Bedingungen zu verdanken. - die Basisversorgung bei Krankheit obliegt noch immer der Familie; durch Mobilität und Flexibilität (in Folge davon: Entfamiliarisierung) verliert sie an Bedeutung. Im ersten Falle kamen Menschen in den Genuß des sozialen und hygienischen Fortschrittes, im zweiten Falle sind bzw. waren sie eingebunden in traditionelle Strukturen. “Teilhabe“ war und ist primär nicht medizinisch sondern politisch. (Waller, Sozialmedizin, 2007) Betrachten wir den Begriff der Teilhabestörung näher, indem wir uns die Bestandteile des Wortes anschauen: Teil-habe-störung: Zunächst: Teil Es ist ein Bestandteil des Ganzen, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, so eine allseits vertraute Weisheit. Zu dem Begriff „Teil“ gehört auch „teile und herrsche“, da man ja bekanntlich mit kleinen Brocken besser zurecht kommt als mit zu großen Bissen; hätten die Banker im zurückliegenden Jahr mehr geteilt, wäre die Finanzkatastrophe so nicht eingetreten. Vieles funktioniert nach den Gesichtspunkten „teilen und herrschen“, denn das Ausspielen von Partikularinteressen ist für einen Herrscher einfacher als die Situation, in der er organisierten Fronten gegenüber steht; wenn wir in die Geschichte schauen, finden wir genügend Beispiele dafür: die alten Römer haben so ihr Imperium ausgeweitet; ein Armenhaus der Welt war und ist Süd- und insbesondere Mittelamerika, mit den Vermächtnissen des letzten Jahrhunderts; unter dem Blickwinkel „teilen und herrschen“ waren mittelamerikanische Staaten Privatbesitz amerikanischer Firmen (wie z. B. der American Fruit Company), die sich die Länder aufgeteilt haben. Sinnloser Exkurs in die politische Gegenwart oder Vergangenheit? Mitnichten. Wenn wir solche Fakten, die wir ja kennen, mitbedenken, bedeutet das auch, dass „teil-nehmen“ und „teil-haben“ berechtigte Ängste davor auslösen können, aufgeteilt und verwertet zu werden. Der solidarische Gedanke, „ich bin ein Teil von“ steht im Widerspruch zu den Erwartungen nach Mobilität und Flexibilität, die der Arbeitsmarkt, auf den hin wir rehabilitieren, fordert. Zahlreich sind die Patienten, die wegen Montagetätigkeit ihrer traditionellen Teilhabe an der Familie verlustig gingen und diesen Verlust mit Alkohol zu bewältigten versuchten. Jeder von Ihnen, der in der letzten Zeit in einer großen Klinik gewesen ist und durch die Räume der Funktionsdiagnostik geschoben wurde, von gehetzten oder gelangweilten Mitarbeitern begleitet, weiter zum nächsten Untersuchungsgang, wird ähnliches erlebt haben: Kein ungeteiltes „ganzheitliches“ Interesse, nur: Magen, Lunge, Oberbauch. Die Organe wurden aufgeteilt, in der Hoffnung und Erwartung, sie zu beherrschen, hohe Präzision, unglaublich viel Kompetenz, um den Preis des Verlustes der Beziehung zum Patienten, der alleingelassen wird bei der Notwendigkeit zur Integration all dieser bedrohlichen Einzelheiten. Unsere Patienten wären gesund, wenn sie dieser Form der „Teilhabe/Teilnahme“ (nur ein Teil des Körpers wird wahrgenommen) ausreichend misstrauen könnten. Unter dem Blickwinkel ihrer Geschichte ist gesundes Misstrauen ihre Sache nicht; entweder pathologisches Misstrauen oder Bedürfnis nach Idealisierung mit Verzicht auf Bereitschaft, kritisch zu überprüfen. Sie kennen das aus den Alltagssituationen: Kliniken oder Beratungsstellen werden entweder idealisiert oder entwertet; normales „kritisches“, „reifes“, „erwachsenes“ Umgehen in der Auseinandersetzung ist auf der Grundlage der Störung unserer Patienten nicht zu erwarten. Der Begriff der Teilhabe: Ich soll teil „haben“. „Haben“ ist ein Gegenpol von „Sein“ und „Haben“ wird in aller Regel verbunden mit „Besitzen“. Ich habe eine Zahnbürste, ich habe ein Auto. Sie kennen die Situation von kleinen Kindern, die noch nicht richtig zu gehen in der Lage sind, aber mit ausgestreckten kleinen Fingern auf etwas zeigen und im Schmelze ihrer Kindhaftigkeit mit dem Wort „Haben“ unmissverständlich dem sog. Primärsozialisationsobjekt, also der Mutter, verdeutlichen, dass es Riesenkrach gibt, wenn dieser Wunsch nach „Haben“ nicht erfüllt wird. Smarties an den Kassen von Supermärkten üben eine solche Faszination aus, dass Mütter mit Angstschweiß reagieren, wenn sie sich diesem Ort nähern müssen. Das „Haben“ hat auch etwas Imperatives, das den Gegenüber zum Unterwerfen drängt und ihn ängstigen kann. Unsere Patienten sind uns ähnlich und doch im Rahmen ihrer digitalen Anlage von Idealisierung und Unterwerfung anders. Anders insofern, dass mangelhaft ausgeprägte Ich-Funktionen Ihnen nicht ermöglichen, z. B. nicht-schädigende Kompromisse zu finden. Allerdings ziehen wir aus den sog. Ähnlichkeiten immer dann Gewinn, wenn wir missachten, dass die Unterschiede entscheiden – und nicht die Ähnlichkeiten. Ein Fehler in der Arbeit mit Drogenpatienten war das Motto „Wir alle haben eine Sucht.“ Dieses Angebot zur Kumpanei hat Drogenpatienten viel geschadet. Sie zu „Duzen“ hat (auch) diese Wurzel. Die Idee, dass es sich bei Abhängigkranken um sich selbst bestimmende Subjekte handelt, die sich frei entscheiden können, ist unter dem Blickwinkel der Erfahrungen der Psychotherapie ziemlich hanebüchen. Jenseits der Frage, inwieweit es überhaupt möglich ist, sich frei zu entscheiden, möchte ich das auf den Aspekt fokussieren, dass alles das, was mit Abhängigkeitserkrankung zu tun hat, einem Wiederholungszwang unterliegt (und somit nicht frei entschieden wird), missbraucht werden kann und von den Patienten eben auch „vergiftet“ wird. Wenn sie „Freiheit“ einfordern, glauben sie, das Recht zu haben, wie z. B. mit den Worten: „Lassen Sie mich mit dem Thema Nikotin in Ruhe - deshalb bin ich nicht hier.“ (in einer Reha-Klinik), so ein Patient mit Zustand nach Herzinfarkt und Asthma bronchiale, der zu Lasten der Solidargemeinschaft sein Spray mit der rechten Hand inhaliert und mit der linken das Nikotin gierig einsaugt. Er verweist darauf, dass er das Recht hat, „selbst-bestimmt“ damit umzugehen. Wenn man „Teil-hat“, hat man Rechte. Das gerät dann in Widerspruch, wenn das Recht „teilzuhaben“ zu Lasten des Ganzen geht, wie in dem eben genannten Fall, wo in sinnloser Weise Medikamente eingesetzt werden, ohne auf die Primärnoxe zu verzichten. Hier beginnen dann Störungen, die wir unter den Gesichtspunkten: sozial interaktionell und intrapsychisch näher betrachten können. Zur sozialen Seite: Für den Rentenversicherungsträger ist eine Störung dann gegeben, wenn die Solidargemeinschaft dadurch gestört wird, dass jemand seine Beiträge zum Sozialversicherungssystem nicht mehr leisten kann. Die Grundannahme lautet: Es ist ihm/ ihr deshalb nicht möglich, weil er/ sie eine Krankheit hat. Aufgabe der Institutionen (Krankenkasse, Rentenversicherungsträger Kliniken, Beratungsstellen) ist es, zu helfen/ Sorge zu tragen dafür, diese „Störung“ zu beseitigen. Dazu werden Instrumente verwendet wie z. B.: die Psychotherapie; und wir sollten nicht vergessen, dass Psychotherapie unter diesem Blickwinkel ein Instrument ist, um diese soziale Störung zu bewältigen. Vor wenigen Tagen wurde aus der Tagespresse von Prof. Holsboer, Direktor des Max-Planck-Institutes München, berichtet, dass er der Meinung ist, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis biochemische, neurophysiologische und genetische Abläufe im Gehirn soweit entschlüsselt sind, dass durch eine 1:1-Medikation und/oder Psychosonden psychische Erkrankungen geheilt werden können. Hätte er Recht, wäre Schluss mit Psychotherapie, wenn diese Behandlungsmethode bezüglich Effektivität und Effizienz jener überlegen wäre. Wir wissen über Placebowirkungen aus Studien und viel Kritisches von der Art und Weise, wie Daten erhoben und interpretiert werden: Sie alle haben das im Laufe Ihres Berufslebens erfahren oder werden es noch erfahren, wie z. B. bei der Campral/Acamprosat-Diskussion. Wissen Sie noch, wie die Ergebnisse präsentiert wurden? Fast wie in der Kirche wurde man zum Glauben genötigt, dass diese Anticravingsubstanz den Königsweg darstellen wird, wenn sie mit psychosozialer Begleitung verbunden ist. Wir wissen alle, was in der Zwischenzeit daraus geworden ist. Zurück zu den Störungen, unter dem Blickwinkel der interpersonellen Seite: Der Suchtkranke stört im Sozialgefüge. Er stört zu Hause, die Kinder, die Eltern, die Freunde, Bekannte. Der Partner oder die Partnerin sind durch den Menschen, der Suchtmittel gebraucht, gestört. Hier findet ein Störungsverständnis seinen Ausdruck, das Sie aus den Familienseminaren und Paargesprächen gut kennen:“ Bitte reparieren - so stört er, früher war er besser, verwandeln sie ihn in den Zustand wie früher.“ Bekanntlich kommen bei Verwandlungsprozessen neue Störungsbilder zutage: Im Falle des Suchtkranken: Er stört im Rahmen seiner Trockenheit (wenn er eigenständig, vielleicht rechthaberisch und eigensinnig, manchmal im schwierigen Sinne auch „unabhängig“ wird) und er stört, da er nicht mehr so pflegeleicht funktioniert wie in den Tagen, als er noch getrunken hat. Das Ideal wäre die Kombination zwischen den Vorteilen seiner nassen Zeit, verbunden mit den Vorzügen der Abstinenz? Der Gedanke, dass jede Lösung ein Problem heraufbeschwört, das bewältigt werden will, ist suchttypisch nicht auf der Rechnung: Sucht und Suchttherapie werden als „Heilung“ verstanden und eben nicht als Prozess der Stabilisierung. Somit kämen wir auf den Kern der Störung: Nämlich die intrapsychische Seite des Problems. Ich folge W. D. Rost, wenn er immer wieder darauf verweist, dass ein Suchtmittelabhängiger - selbst wenn er in seinem Leben nie psychotrope Substanzen zu sich nähme - trotzdem ein Störungsbild aufweist, das ihn psychotherapeutisch behandlungsbedürftig macht. Dieser Behandlungsbedürftigkeit liegen Persönlichkeitsstörung zu Grunde, die sich recht genau beschreiben lassen. In aller Regel zeigen sie sich durch Wiederholungszwänge, die außerhalb des unmittelbaren Bewusstseins des Subjekts liegen; sie ist verbunden mit Ich-FunktionsDefiziten, wie z. B. Empathieschwäche, Unfähigkeit sich in andere einzufühlen, fehlende Signalangst: z. B. fühlen sich Patienten in der Lage, in Kneipen zu gehen und dort nur Wasser zu trinken. Es besteht chronische Unfähigkeit, zwischen Innen und Außen zu trennen. Diese theoretische Beschreibung, („ Unfähigkeit, zwischen Innen und Außen zu trennen“), bedeutet: Es ist dem Patienten nicht klar, wer woran schuld und wer wofür verantwortlich ist. Diese mangelhafte Fähigkeit zur Trennung von Ursache und Wirkung, von Verantwortlichkeit und Ausgeliefertheit, von Täter und Opfer wird süchtig so gewendet, dass andere, die Umstände, der Betreuer, der Mann von der Agentur für Arbeit, der Chef oder die Kollegen Schuld sind. Neuerdings wird das „Mobbing“ sehr gerne genutzt, um sozialkompatibel in der Abhängigkeit verharren zu können. Es beginnt „Ängste“ und „Depressionen“ als Verschleierungsdiagnosen abzulösen. Ich habe noch nie einen Alkoholkranken gesehen, der sich nicht in seiner nassen Phase gemobbt gefühlt hat. Da es aber zu den größten Kränkungen gehört, wenn man jemandem sagt -und er es nicht von sich weisen kann-, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist, können wir uns vorstellen, was passiert, wenn wir das mit Patienten tun. Wir lösen aus, dass der- oder diejenige verletzt reagiert, eine Zweitmeinung einholt, wobei es immer wieder „Fachleute“ gibt, die das „anders“ sehen, bagatellisieren und/oder sich der Auseinandersetzung durch Unterwerfung entziehen. Wir wissen von den Alkoholkranken: Wenn er in der einen Kneipe nicht das kriegt, was er will, geht er in die nächste. Mit den Fachleuten macht er es ähnlich. Der Pluralität der Behandlungsweisen von Sucht folgt die Willkürlichkeit in dem Gebrauch der Argumente, die die Sucht pflichtgemäß fordert, soll sie weiter fortgeführt werden. Und so haben wir dann ein Scharnier zwischen der intrapsychischen Seite (die Unfähigkeit zu erkennen: was gehört wohin?) und der sozialen Seite, indem falsche Attribuierungen vorgenommen werden. Nachfolgend Auszüge aus einem Entlassungsbericht einer Reha-Klinik (Diabetologie), in der die Störung der Teilhabe näher beschrieben wird: „Abschlussbericht Sozialberatung: Alkoholabusus (Suchtberatungsstelle mit Einzelgesprächen, Gruppenangeboten, Selbsthilfegruppen, Alkoholentwöhnungsbehandlung) Erörterung des Werdeganges zur Alkoholentwöhnungsbehandlung im Rahmen einer stationären Therapie und Motivation zur Alkoholentwöhnung. Der Patient reflektiert seinen Alkoholabusus. Er wisse, dass es in seiner Region – in xxxxxx- eine Suchtberatungsstelle gibt.“ Dies ist der Bericht einer beschäftigungstherapeutischen Ausgestaltung sozialarbeiterischen Tuns: Falls der Pat. schon in jener Beratungsstelle war, kann er dem Sozialarbeiter sehr viel besser erklären, was es dort an Angeboten gibt. Und nichts hätte gehindert, den Pat. anrufen zu lassen, damit der sich zeitnah einen Termin nach der Entlassung beschafft. So wurde aber nach dem Motto „gut, dass wir darüber geredet haben“ verfahren und brav dokumentiert. Psychologischer Abschlussbericht (Zusammenfassung): Im Rahmen der Exploration ergeben sich Anhaltspunkte auf eine Abhängigkeitsentwicklung bei prädisponierenden Persönlichkeitsfaktoren. … Ziel der Gespräche war die Förderung der Motivation zu einer Suchtbehandlung. Diesbezüglich zeigte sich der Patient prinzipiell interessiert. Im Zusammenhang mit einer Langzeitentwöhnung wird Ambivalenz erkennbar. Der Patient wurde über Aspekte der Sucht und Behandlungsmöglichkeiten beraten.“ Diagnosen: … 2. Alkoholabusus F 10.2 Der Patient wird hier der Teilhabe an der medizinischen Versorgung entzogen: entweder er ist abhängig-krank oder nicht. Ist er es, lautet die korrekte Diagnose nicht: „Abusus“ ,sondern Abhängigkeit. Manifeste, also praktizierte Abhängigkeit ist aber eine Kontraindikation für eine Reha- Maßnahme bei Diabetes mellitus. … Ziele des Reha- Teams … Aufbau der Motivation zur Alkoholabstinenz Die Reha-Ziele wurden mit dem Patienten abgestimmt. Rehabilitationsverlauf: ...Bei bekannter Alkoholproblematik wurde der Patient, zur Förderung und Motivation einer Suchtbehandlung psychologisch mitbetreut. Diesbezüglich zeigte er sich prinzipiell interessiert. Der Alkoholkonsum wurde während des Reha- Aufenthaltes deutlich reduziert, eine vollständige Abstinenz wurde jedoch nicht erzielt.“ Vollständige Abstinenz wird am Arbeitsplatz vorausgesetzt, im notwendigen Fall auch kontrolliert. Die Unfallverhütungsvorschriften weisen präzise auf, welche Einschränkungen derjenige hat, der unter Alkoholeinfluss steht. Aber Reha darf man alkoholisiert (und nicht kontrolliert) unter Anleitung von Medizinern, Psychologen und Sozialarbeitern machen. Solche Formen der Teilhabe gefallen Suchtkranken. Das Reha-System hat Anteil an der Chronifizierung und wird hier zum co-Süchtigen… Wenn mit der Ich-Funktionsschwäche des Patienten eine Funktionsschwäche eines Therapeuten, einer Beratungsstelle, einer Klinik, einer Krankenkasse oder eines Rentenversicherungsträgers korrespondiert und nicht klar und unmissverständlich Grenzen gezogen werden, Möglichkeiten und Angebote benannt, aber auch Verpflichtungen konsequent eingefordert werden, die damit verbunden sind, sofern diese Über-Ich-Schwäche aller Beteiligten agiert wird (nach dem Motto: man will sich die Finger nicht schmutzig machen), ist das ganze System des Teufels und letztlich dem Untergang geweiht. Ausgerechnet Betriebswirte kommen nun und machen das Über-Ich zum Thema: Sie ersetzten Über-Ich durch rote und schwarze Zahlen, rot = Arbeitsplatz gefährdend und Existenz bedrohend, schwarz = gut und zukunftsweisend, aber nicht Arbeitsplatz garantierend und legen den Finger in die Wunde: Sie haben ein Beurteilungssystem zur Verfügung gestellt (das sich im Moment auch durchsetzt), das für die Therapeuten kränkend ist. Diese Kränkbarkeit resultiert daraus, dass der Finger auf Mängel verweist, nämlich die Über-Ich-Schwäche der Therapeuten: Sie substituieren trotz Beikonsum, man hält sich mit vielerlei Begründungen nicht an die Vorgaben – siehe oben zitiertes Beispiel ; es gibt „akzeptierende“ Drogenarbeit (welch ein Begriffsunsinn!), statt beharrlich entgegen zu treten: Beziehung ist besser als Droge und beides schließt sich aus. Diese Problematik hat ihre historischen Wurzeln: Der Verlust eines tragenden Vaterbildes, die berechtigte Kritik am Patriarchat, der Schatten der Systeme, in denen die Väter versagt haben (was nicht gleichbedeutend damit ist, dass die Mütter nur die Guten waren), hinterlässt Lücken in uns und den Patienten, so dass die Störung „Sucht“ wesentlich auch als Gestörtheit in Bezug auf Normen und Werte beschrieben und verstanden werden kann. Kaum Fähigkeit, angemessen Ansprüche zu stellen, kaum Willen, sich einer Realitätsprüfung zu stellen und sich unterzuordnen (eher unterwerfen und maulen) und kaum Fähigkeit, angemessen zu widersprechen -und eben nicht: zu schlucken oder zu schlagen. Ich gehe davon aus, dass das für beide gilt. Immer für Patienten, manchmal auch für Therapeuten. Wenn nun Teilhabestörung darauf reduziert wird, dass der- oder diejenige funktionieren soll, dann wissen wir nur zu gut, dass das aus den eben genannten Gesichtspunkten nie wird klappen können. Ich würde nun gerne einen Blick in die Institutionen werfen, um zu zeigen, wie sich diese Störungen dort ausprägen können. Kosten- und Effizienzdruck bestimmen unsere Diskussion. Kein ernst zu nehmender Psychotherapeut hat das Bedürfnis, lebenslang einen Patienten zu behandeln. Sofern Ablöseprozesse und –grenzen nicht mit bedacht werden, handelt es sich niemals um Therapien, sondern um Chronifizierung im Gewand der „Therapie“. Wir müssen uns nicht sagen lassen, dass therapeutische Prozesse auf Zeit angelegt sind. Phantasien von Grenzenlosigkeit teilen wir allerdings mit den NichtTherapeuten: Natürlich haben auch wir solche Gedanken (wobei sie bei uns allerdings im Vorbewussten bleiben) von grenzenloser Wirksamkeit, etwas, was Betriebs- und Volkswirtschaft im Moment chronisch agiert: Grenzen des Wachstums werden nicht mitgedacht, das Bruttosozialprodukt muss steigen und Erlöse ebenso. Grenzen der Einsparungsmöglichkeiten werden kaum, wegen Kostendruck, thematisiert. Wohin wird das führen? Wo sind die Grenzen? An welcher Stelle findet so etwas statt wie reflektierte Entscheidung und Verzicht auf Kontrollverlust? „Lösungen“ wie bei Abhängigen, nach dem Motto: „Hoffentlich geht es bei mir gut“? Der Kontrollverlust des zurückliegenden Jahres bezüglich der Finanzsituation hat einen Vorteil: Betriebswirte und Therapeuten haben gemeinsam Dreck am Stecken betreffend ihre Phantasien von Grenzenlosigkeit, keiner kann mehr dem anderen vorhalten, er habe da keine Aktien im Verfahren. Beide sind keine Vorbilder für Suchtkranke, von denen sie den Verzicht auf den Kontrollverlust einfordern. Therapeuten stehen stets in Gefahr, um ein Linsengericht die Kenntnisse der Psychotherapie an die Nachfragenden zu verhökern, wenn sie sich intrapsychisch, gruppendynamisch, institutionell, sozial oder finanziell Vorteile erhoffen. Es fehlt an gesundem Selbstwert, der auch ermöglicht zu sagen: „Das geht so nicht“, sich entgegenstellt und keine faulen Kompromisse eingeht. Das Instrument der Orientierung sind die Antworten auf die Fragen -hat der Patient etwas davon / erreicht ihn diese Veränderung? -kann die Institution das leisten/ solide leisten, ohne süchtige Selbstausbeutung? -welche Instrumente zur Veränderung stehen zur Verfügung? Die Masse der Patienten, mit denen wir im stationären Bereich zu tun haben sind „frühgestört“. Das sind diejenigen, von denen Rost berechtigterweise sagt: Ob sie trinken oder nicht, behandlungsbedürftig sind sie auf alle Fälle. Da Psychotherapeuten nicht im Schutze des weißen Kittels und der hightech Technologie intervenieren, die als Übertragungsauslöser hervorragend geeignet sind, eine Täter-Opfer-Situation herzustellen, Abhängigkeitsstrukturen zu erzeugen, Riesenerwartungen auszulösen und zu entwickeln, mit allen Absurditäten, wie wir sie bei der Hühnergrippe gerade hinter uns gebracht haben, da sie also alle diese Möglichkeiten nicht haben (welch ein Glück, wie verführbar könnten sie sonst noch werden) stehen sie nackt da. Sie haben nichts außer den Fähigkeiten, dem Patienten professionell zu begegnen, so, wie sie sind, kriegen sie alles ab: Die Übertragungen aus der Kindheit, die Probleme der jüngeren Vergangenheit (und insbesondere die negativen) und auch, wenn chronischen Idealisierung sie trifft, ist ihnen das aus guten Gründen nicht recht. Es ist nicht einfach, diesen Fels in der Brandung abzugeben, an dem sich die Wellen der Persönlichkeitsstörung brechen; es ist schwer genug, das im 4-Augen- oder gruppentherapeutischen Verfahren zu leisten, und es ist noch viel schwerer, wenn die eigene Position problematisiert wird durch Umbruchsituationen, betreffend Wirksamkeitsdiskussionen, evidenzbasierter Therapie, Kosten-Nutzen-Analyse und Dokumentationspflicht. Störungen dann auf beiden Seiten: Der Patient ist durch seine „Frühstörung“ nicht in der Lage, unübersichtliche Situationen zu bewältigen und Therapeuten sind es oft auch nicht, weil sie schon sehr früh, nämlich knapp nach Betreten der Einrichtung bei ihrer Arbeit gestört werden, wenn Anforderungen gestellt werden, die sie nicht unbedingt überzeugen. Es bleibt Ambivalenz. Ambivalenz ist die Grundlage zu unsicherer Gebundenheit. Sie ist bei unseren Patienten in ihrer Geschichte immer zu finden, keiner, der aus sicheren Gebundenheiten in seiner Kindheit kommt und eine Abhängigkeitsentwicklung genommen hat. Schwierig, wenn er dann auf unsicher gebundene Therapeuten trifft, die ihre unsichere Bindungsstörung so weiter geben, indem sie „curricular“ mit dem Patienten umgehen. Curricular bedeutet: wie in einer Großfamilie: Das Individuelle (immer wieder in Therapiekonzepten ganz besonders herausgestellt – aber: bleibt wirklich genügend Zeit dafür, das in Ruhe und Geduld angemessenen langsam auch zu respektieren?) geht verloren. Die „Behandelnden“ verhalten sich dann wie eine Mutter mit 7 Kindern: Natürlich wird sie jedem gerecht – sagt sie - natürlich geht sie auf jedes individuell ein – sagt sie - und ignoriert, dass das bei diesen Bedingungen überhaupt nicht möglich ist. Das Selbstbild wird erhalten, Hilflosigkeit und Überforderung in Grandiosität verwandelt (so macht es doch der Suchtkranke auch…) und gelegentlich durch Suizid (bei Therapeuten dann durch burn out oder innere Kündigung) nicht reif bewältigt. Curricular bedeutet für den Therapeuten „Schleusenwärter“: Eine Stufe höher hieven, noch ein Modul, einen Baustein nach dem anderen. Wir sind in der Pädagogik wieder so weit, zur Kenntnis zu nehmen, dass mit modularem Unsinn bei Kindern wenig zu erreichen ist und Störungen von Studenten (ich habe eine Reihe in Therapie) zeigen, dass sie häufig an der Bindungsarmut oder Bindungslosigkeit zu einer Peergroup und insbesondere zu den Dozenten scheitern. Niemand entwickelt sich und lernt ohne Beziehungen. Wenn narzisstisch gestörte oder schizoide Pat. mit scheinbar so wenig an Beziehung auskommen, ist das nicht Ausdruck der Reife, sondern Ergebnis ihrer Störung. Im ersten Falle der Angst vor Kränkung geschuldet, im zweite Fall der Angst vor Fragmentierung bei Nähe. Da aber Beziehungslosigkeit im modularen Gewand zunehmend das Instrument wird, mit dem behandelt wird, kann es nicht ausbleiben, dass es bestenfalls ein Zufallsprodukt ist, wenn ein Patient davon profitiert. Bilitza beschreibt diesen Konflikt so: Nach diesem psychoanalytischen Verständnis benötigt gerade der Suchtpatient sichere, Halt gebende Beziehungen und eine heilende emotionale Bindung an Therapeuten, Personal und Mitpatienten, wie die Untersuchung von Therapieabbrüchen immer wieder belegt. Ich halte daher Konzepte der Summierung von indikationsbestimmten Therapiemodulen für sehr problematisch, die dem Suchtpatienten eine Vielzahl von Therapeuten unterschiedlicher Provinienz in verschiedenen homogenen Gruppen mit wechselnder Patientenzusammensetzung bieten. Der Verlust und kurzfristige Wechsel von Beziehungen, der in der Pathogenese der Patienten erfolgte, wiederholt sich so im therapeutischen Prinzip der Behandlung und kann unter diesen Voraussetzungen nicht genügend bearbeitet werden. Interdisziplinäre Fallkonferenzen oder Teambesprechungen, damit diagnostische Einschätzungen und therapeutisches Vorgehen abgestimmt werden, können die in diesem Fall therapeutisch gewollte Beziehungslosigkeit wohl nicht ausreichend ausgleichen (Bilitza, Psychotherapie der Sucht, 2008, S. 110) Schauen Sie sich Ihre eigene Praxis an: Wie oft können Sie Kontinuität garantieren, die diesen Namen auch verdient? Wie oft sind Kriseninterventionen, Urlaub, Krankheit Aspekte, die diesem Gesichtspunkt im Wege stehen? Um so viel Klarheit wie möglich herzustellen: Diskontinuitäten und Frustrationen gehören zum Leben und die Erwartung, dass ein Therapeut ganz alleine für einen Patienten zur Verfügung steht, ist grandios, unmenschlich und undurchsetzbar, letzten Endes wegen der omnipotenten Kontrolle durch einen einzigen Therapeuten dem Patienten auch nicht zu wünschen. Aber ist das, was wir bieten, wirklich Bindung? Wenn Kontinuität notwendig ist, warum steht sie dann nicht im Mittelpunkt unseres Handels? Wenn das Beste für unseren Patienten die Zeit ist, die wir ihm zuwenden, geben wir sie ihm auch in ausreichendem Maße? Ausreichend bedeutet nicht: grenzenlos, und wir können das gut unterscheiden, ob wir unberechtigte, häufig der Übertragung geschuldete oder berechtigte Schuldgefühle wegen objektiver Defizite in der alltäglichen Arbeit haben; Supervision hilft, den Unterschied herauszuarbeiten. Aus der eigenen Supervisionstätigkeit weiß ich nur zu gut, dass diese Frage aufgeworfen und von Mitarbeitern häufig auf der persönlichen Schuldgefühlsebene beantwortet wird. Bei der Pharmakotherapie ist zu gewährleisten, dass die Kontinuität der Medikation jederzeit garantiert ist. Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden und nur wenn der Wirkspiegel ausreichend hoch ist, ist eine therapeutische Wirkung zu erwarten. Wenn die therapeutische Intervention, die indikativ angemessen ist, abbricht, weil Kollegen „einspringen“, die „vertretungsweise“ intervenieren, sind unsere Patienten geeignete Opfer zum Wiederholungszwang. Entweder sie rebellieren und rebellieren dann natürlich an der falschen Stelle, weil sie nicht in der Lage sind, auf der Grundlage ihrer Ich-Funktions-Defizite die exakten Punkte auch geduldig zu analysieren und zu besprechen oder sie unterwerfen sich. Dann sind sie unauffällig, wie Kinder aus Patchworkfamilien, die scheinbar ganz unauffällig sind und deshalb mit dem Prädikat „guter Patient“ (weil er nicht störte) im Therapiebericht bedacht werden. Das Dumme ist, dass bei nicht ausreichendem Spiegel z. B. in der Antibiotikabehandlung Immunisierungsprozesse einsetzen können. Wie oft sind 2., 3., 4. Rehabilitationsmaßnahmen diesem Dosisfehler also der mangelhaften Zuwendung geschuldet ? Störungen sind notwendig für Reifung. Der Analytiker Winnicot hat das auf den Begriff gebracht, als er die Diskussion über die angeblich notwendige perfekte Mutter als Voraussetzung dafür, dass eine gesunde Kindheit durchlebt werden kann, karikierte, indem er davon sprach, dass es nicht um die perfekte Mutter geht, sondern um „good enough mothering“, und das bedeutet: gut genug. Und das bedeutet: mit Fehlern und Schwierigkeiten, aber: mit der Gewissheit: -Mutter ist da; -sie meint es gut; -und, wenn beides im Moment nicht vorliegt, gibt es ein Grundvertrauen, dass das wieder eintreten wird. Kein Patient hat dieses good enough mothering in seiner Biografie erlebt. Wer von den Patienten bekommt es in angemessener Weise im Rahmen der Behandlung? Um zu diesem Kern vorzustoßen, lässt sich der Satz von Augustinus verwenden, einfach und handlungsrelevant: „Hasse den Irrtum, aber liebe den Irrenden.“ Wenn die Rahmenbedingungen für einen therapeutischen Eros nicht stimmen, dann wird es nichts mit therapeutischem Erfolg. Stellen Sie sich vor: ein bedürftiges Kind im Bettchen, das auf den Arm der Mutter will und stellen Sie sich vor, dass die Mutter unwillig ist, vielleicht eine Zigarette im Mundwinkel hat, es zwar auf den Arm nimmt, aber gleichzeitig in den Fernseher guckt. Und wie oft nähern sich Therapeuten ihren Patienten, indem sie sie – bildlich ausgedrückt – auf den Arm nehmen, weil sie gar nicht in der Lage sind, an der Situation ihrer Patienten teil zu haben, da sie noch in Konferenzen stecken oder die nächste Konferenz schon in Kopf haben, den letzten Entlassungsbericht oder die Dokumentationspflicht. Teilhabestörung: Bertha von Suttner hat vor dem 1. Weltkrieg in einer flammenden Rede darauf hingewiesen, dass kein Mensch auf die Idee käme, Feuer mit Benzin zu löschen. Im Krieg wird aber Blut mit Blut gelöscht. Das war eine kurze, prägnante Version der Kritik an einem Unsinn, der nach dem Motto von Watzlawik „mehr von demselben“ funktioniert. Wir stehen in Gefahr, einen ähnlichen Wahnsinn zu betreiben, wenn wir nicht verhindern, wie durch „immer mehr“ die süchtige Spirale in der Institution dominiert und Patienten in exakt süchtiger Weise betrifft. Supervision ist ein notwendiges Instrument, um die Begrifflichkeiten und Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu ordnen. In dem Film „Die Feuerzangenbowle“ hat der Schüler Pfeiffer („mit 3 statt mit 2 f“) das Schulsystem und seine formale Gläubigkeit karikiert , indem er Schilder aufstellte: „Schule wegen Umbauarbeiten geschlossen“. Schüler und Lehrer gingen freudig erregt nach Hause und der Herr Direktor war erstaunt, dass er auf den Fluren an diesem Vormittag nichts hörte. In der eiligst einberufenen Lehrerkonferenz überschlugen sich die Ideen, wie man denjenigen zur Rechenschaft zieht und bestraft, der so etwas gemacht habt. Erich Ponto (er spielt einen nicht ganz ernst genommenen Kunstlehrer) hat diesen Kontrollverlust bei der Suche nach Lösungen angemessen charakterisiert und gezeigt, was man tun kann, um sich davon nicht anstecken zu lassen. Jupiter (so hieß der Rektor mit Spitznamen) hat ihn gefragt: „Was schlagen Sie denn vor, was wir tun sollen?“ und er antwortete: „Ich schlage vor, da tun wir gar nichts.“ Er repräsentiert das, was Öttingers Spruch von der Gelassenheit meint und was für die Behandlung der Suchterkrankung unabkömmlich ist: nämlich zu unterscheiden zwischen dem, was unmöglich ist (und ich möchte das in unserem Falle erweitern: was unsinnig ist) und was nur sehr schwer zu erreichen ist. Die von ihm geforderte Gelassenheit findet sich in Suchtbehandlungseinrichtungen zu selten. Nicht jeder Wahnsinn muss in Institutionen implantiert werden, wenn er nur die Drehzahl steigert. Drehzahlsteigerung (und hierfür sind die Leiter verantwortlich!) führt zu hypomaner Auslenkung, hypomane Auslenkung ist zutiefst ungesund und endet entweder im Herzinfarkt oder in der Depression. Wenn wir von Prävention reden (und wir machen Rehabilitation, wo dieser Begriff mit sekundärer und tertiärer Prävention ja eine zentrale Rolle spielt), dann müssen wir uns auch das Recht nehmen, zu prävenieren, zuvorkommen, Falsches angemessen zu benennen und Richtiges zu verteidigen. Es scheint mir oft so zu verlaufen wie bei Suizidenten, die aus dem 13. Stock springen mit dem Hinweis, 12 Stockwerke würde das schon gut gehen. Hier liegt die Störung auf einer Ebene, die wir mit Patienten teilen, wenn wir den alten Spruch, aus dem Lateinheft nicht beachten: Quidquid id est, prudenter agas et respice finem. Was immer du tust, handle besonnen und bedenke das Ende. In der Sprache der Psychotherapeuten ist damit die Fähigkeit angesprochen, Probleme angemessen zu antizipieren und Normen und Werte angemessen zu beachten. Natürlich auch bei dem Thema: Teilhabestörung.