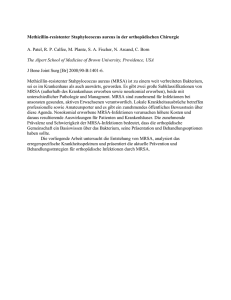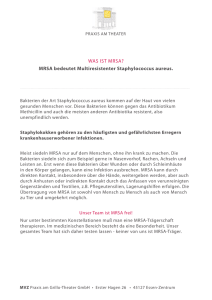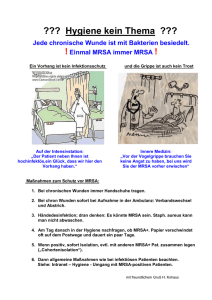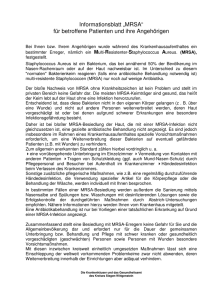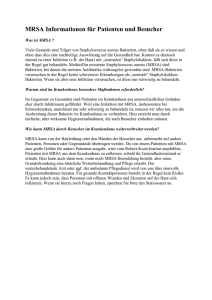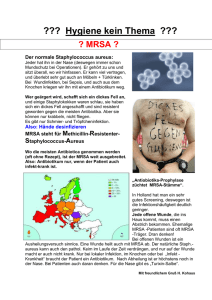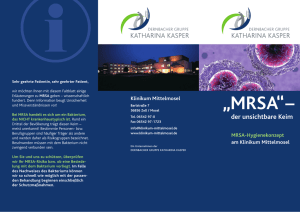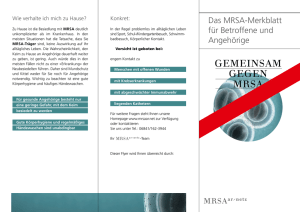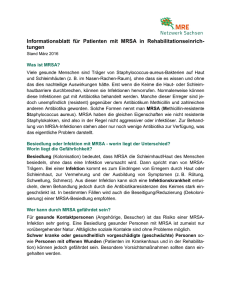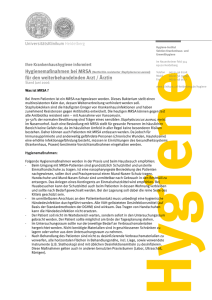Mit MRSA nach Hause- Erleben und Erfahrungen Betroffener
Werbung

Mit MRSA nach HauseErleben und Erfahrungen Betroffener Eine empirische Untersuchung Diplomarbeit zur Erlangung des Grades „Diplom Pflegewirtin (FH)“ Katholische Fachhochschule Nordrhein – Westfalen Abteilung Köln Fachbereich Gesundheitswesen Studiengang Pflegemanagement Vorgelegt von: Bärbel Schümann Im Sohl 27 51643 Gummersbach Erstprüfer: Prof. Dr. Frank Weidner Zweitprüfer: Diplom Pflegewirt Guido Heuel Datum der Abgabe: 28.06.2007 Wer nicht gewahr werden kann, dass ein Fall oft Tausende wert ist, und sie alle in sich schließt, wer nicht das zu fassen und zu ehren imstande ist, was wir Urphänomene genannt haben, der wird weder sich noch anderen jemals etwas zur Freude und zum Nutzen fördern können Johann Wolfgang von Goethe Danksagung Mein allergrößter Dank gilt meinem Ehemann Jens und meinen Töchtern Diana und Steffi, die mich während des gesamten Studiums sehr unterstützt und mir während der Bearbeitung dieser Arbeit viel Verständnis und Geduld entgegengebracht haben. Außerdem danke ich allen Interviewpartnern und deren Angehörigen, dass sie mir dank ihrer Offenheit, die Erstellung dieser Arbeit ermöglicht haben. Jürgen Zervos- Kopp und Bruder Peter Schiffer danke ich für die mühevolle Arbeit des Korrekturlesens und für die hilfreichen Verbesserungsvorschläge zur besseren Verständlichkeit. Frau Schmidt und Frau Gumprich danke ich für ihre Transkriptionsunterstützung. Auch Herrn Prof. Dr. phil. F. Weidner danke ich sehr herzlich für seine verständnisvolle Begleitung während der Bearbeitungszeit dieser Arbeit. Sowohl inhaltlich, als auch formal, waren seine Verbesserungsvorschläge sehr hilf- und lehrreich. Mit MRSA nach Hause – Erleben und Erfahrungen Betroffener I Allgemeiner Teil Inhaltverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis II Theoretischer Teil Seite 1 Einleitung........................................................................................................ 1 1.1 Problemstellung und Entwicklung der Antibiotikaresistenz.......................... 2 1.2 Begriffserklärungen und medizinische Grundlagen..................................... 2 - Vorkommen von MRSA............................................................................. 4 1.3 Forschungsinteresse und Erkenntnisgewinn............................................... 5 - Forschungsfeld........................................................................................ 6 - Forschungsfrage...................................................................................... 7 1.4 Vorgehensweise und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit........................... 8 1.5 Ursachen und Bedeutung des Krankheitsbildes.......................................... 9 - Begünstigende Faktoren......................................................................... 9 1.6 MRSA-Surveillance Systeme....................................................................... 10 1.7 MRSA und gesetzliche Vorgaben................................................................ 12 - Kontrollorgan in der ambulanten Betreuung........................................... 12 - Arbeitsschutzgesetz................................................................................ 12 - § 33 SGB V............................................................................................. 13 - § 40 Abs. 2 SGB XI................................................................................. 13 1.8 Auswirkungen des Krankheitsbildes............................................................ 14 - Epidemiologische Auswirkungen............................................................ 14 - Ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen................................ 14 - Soziologische Auswirkungen.................................................................. 15 1.9 Isolation durch MRSA.................................................................................. 16 - Heilungsparadigma................................................................................. 16 - Akute Erkrankung (Akuizität).................................................................. 16 - Chronische Erkrankung (Chronizität)...................................................... 17 - Grenzgänger zwischen akuter und chronischer Erkrankung................... 17 - Isolation im Strafvollzug........................................................................... 18 - Isolation als Hygienemaßnahme............................................................. 19 - Isolationsauswirkung............................................................................... 19 1. 10 Zusammenfassung des theoretischen Teils.............................................. 21 2 Literaturrecherche........................................................................................... 22 2.1 Vorgehensweise und Datenbanken............................................................. 22 2.2 Schlagworte................................................................................................. 24 2.3 Erste Ergebnisse der Literaturrecherche..................................................... 26 2.4 Handrecherche............................................................................................ 28 2.5 Eigenrecherche............................................................................................. 28 2.6 Einordnung der Fundstücke......................................................................... 29 2.7 Literaturanalyse........................................................................................... 31 2.8 Zusammenfassung der Literaturrecherche.................................................. 32 III Methodischer Teil / Empirischer Teil 3. Definition Empirische Sozialforschung (soziologisch).................................... 33 3.1 Historische Entwicklung der qualitativen Sozialforschung........................... 34 - Soziologische Entwicklung...................................................................... 35 - Psychologische Entwicklung................................................................... 35 3.2 Herstellung sozialer Wirklichkeiten.............................................................. 36 4. Gütekriterien nach Mayring............................................................................ 36 5. Datenerhebung............................................................................................... 38 5.1 Das Interview als Instrument qualitativer Forschung................................ 38 5.2 Formen des qualitativen Interviews............................................................. 39 6 Vorgehen anhand der Methode...................................................................... 41 6.1 Forschungsethik........................................................................................... 41 6.2 Interviewtechnik........................................................................................... 41 6.3 Rolle und Fähigkeiten des Interviewers....................................................... 42 6.4 Samplingstrategie........................................................................................ 43 6.5 Ein- und Ausschlusskriterien....................................................................... 44 6.6 Akquise der Interviewpartner....................................................................... 45 6.7 Untersuchungsgruppe.................................................................................. 46 6.8 Durchführung der Interviews........................................................................ 46 6.8.1 Interviewleitfaden...................................................................................... 47 6.8.2 Interviewvorgehen..................................................................................... 48 6.8.3 Postskript.................................................................................................. 53 6.8.4 Transkript.................................................................................................. 53 6.8.5 Transkriptionsregeln................................................................................. 55 7 Datenauswertung............................................................................................ 56 7.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring...................................................... 56 7.1.1 Bestimmung der Analyseeinheiten............................................................ 56 7.1.2 Paraphrasierung inhaltstragender Textstellen.......................................... 56 7.1.3 Generalisierung der Paraphrasen............................................................. 57 7.1.4 Erste und zweite Reduktion...................................................................... 55 7.2 Episodenidentifikation................................................................................... 59 7.3 Zusammenfassung des methodischen Teils................................................ 60 VI Ergebnisteil / Empirischer Teil 8 Definition Empirische Sozialforschung (philosophisch).................................. 61 8.1 Darstellung des Kategoriensystems............................................................. 62 8.2 Darstellung einzelner Kategorien und Episoden.......................................... 63 8.3 Andere Ergebnisse...................................................................................... 77 8.4 Hauptkategoriebildung für Klinik Relevanz................................................... 80 8.5 Hauptkategoriebildung bezogen auf die Forschungsfrage........................... 80 9 Interpretation der Ergebnisse.......................................................................... 81 9.1 Beziehungsbildung der Hauptkategorien..................................................... 82 9.2 Beziehungsbildung der Hauptkategorien zueinander................................... 83 9. 3 Zusammenfassung des Ergebnisteils.......................................................... 85 V Schlussteil 10 Abgleich zwischen Empirie und Theorie....................................................... 86 10.1 Diskussion der Ergebnisse und Erkenntnisgewinn.................................... 95 10.2 Schlussfolgerungen.................................................................................... 99 10.3 Methodenkritik anhand der Gütekriterien Mayrings.................................... 104 10.4 Kritische Würdigung der Arbeit und der angewandten Verfahren.............. 105 10.5 Resümee und Ausblick............................................................................... 106 VI Anhang Literaturverzeichnis............................................................................................ 109 Internetverzeichnis............................................................................................. 117 Anhangverzeichnis............................................................................................. 118 Erklärung der Eigenständigkeit Einverständniserklärung Abbildungsverzeichnis Seite Abbildung 1 MRSA Vorkommen................................................... 5 Abbildung 2 Schutzkleidung.......................................................... 15 Abbildung 3 Taxonomie der Haupt- und Unterkategorien............. 85 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1 Literaturrecherche KFH........................................... 22 Tabelle 2 Eigene Recherche................................................... 23 Tabelle 3 Relevanzzuordnung der Literaturrecherche............ 25 Tabelle 4 Relevanzzuordnung mit Thema der Studie............. 27 Tabelle 5 Fundstückzuordnung der Studien............................ 29 Tabelle 6 Transkriptionsregeln mit Interviewbeispieltexten..... 55 Tabelle 7 Generalisierungsbeispiel......................................... 57 Tabelle 8 Reduktionsbeispiel.................................................. 58 Abkürzungsverzeichnis Abs. Absatz CD ROM Compect Disk Read-Only Memory DGKH Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie d.h. das heißt et al. und Andere (lat.) IfSG Infektionsschutzgesetz KISS Krankenhaus- Infektions- Surveillance- System lasv Länder-Arbeitskreis zur Erstellung von Hygieneplänen lögd Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen MDS Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. MRSA Methicillin-resistente stapylococcus aureus nlga Niedersächsisches Landesgesundheitsamt NNIS National-Nosocomial- Infektions- Surveillance NRZ Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen o.g. oben genannt ÖGD Öffentlicher Gesundheitsdienst OLG Oberlandesgericht RKI Robert Koch Institut z.B. zum Beispiel z.T. zum Teil 1 Einleitung Die Resistenzsituation verschiedener Erreger gegenüber einer Reihe von Antibiotika hat sich deutlich ausgeweitet und parallel dazu steigt die Bedeutung von Staphylococcus aureus als Erreger nosokomialer 1 Infektionen. Staphylococcus aureus ist als wichtiger Verursacher von Infektionen, innerhalb und außerhalb des Krankenhauses, anzusehen.2 Die ständige Verbreitung von MRSA stellt nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern auch Mitarbeiter in der ambulanten Versorgung vor immer größer werdende Probleme.3 Aufgrund kürzerer Verweildauer im Krankenhaus werden zunehmend früher multimorbide Patienten ins häusliche Umfeld entlassen.4 Fraglich, wie Patienten, pflegende Angehörige, nachbehandelnde Ärzte und ambulante Pflegedienste auf die frühere Entlassung und das Zusatzproblem MRSA eingestellt sind. Während die Hygiene im Krankenhaus seit mindestens drei Jahrzehnten Gegenstand von Regelungen ist und ständig überwacht wird, sind ebenfalls zunehmend Veröffentlichungen und Empfehlungen zur Hygiene in Alten- und Pflegeheimen erschienen. Demgegenüber liegen bisher kaum Berichte über den Zustand im Bereich der ambulanten Pflege vor.5 Die RKI- Empfehlung zur Heimhygiene weist allerdings darauf hin, dass sie auch für andere Betreuungsformen hilfreich sein kann, z.B. die häusliche Krankenpflege.6 1 vgl. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung• Gesundheitsschutz 1999, Mitteilung: der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am RKI, Seite 954 (RKI Empfehlung) 2 vgl. Neuhaus et al., Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd), Studie zum Vorkommen von Methicillin-resistenten Staphylococcus-aureus in Alten- und Altenpflegeheimen 2002, Seite 8 (lögd Studie 2002) 3 vgl. Ludwig, Risiko Routine, In: Heilberufe 07/ 2005, Seite 32ff 4 vgl. Panknin, Jeder Dritte stirbt an einer Infektion, In: Heilberufe 07/ 2006, Seite 24 5 vgl. Popp et al., Hygiene in der ambulanten Pflege, BundesgesundheitsblattGesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 2006, Seite 1195 (RKI Mitteilung) 6 vgl. RKI Mitteilung 2005, Seite 1061 1 Pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung, waren im Jahr 2002, in Deutschland 2 Millionen Menschen. Davon werden 1,4 Millionen in der häuslichen Umgebung gepflegt.7 1.1 Problemstellung und Entwicklung der Antibiotikaresistenz Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) sind seit 1963 bekannt, haben seitdem erhebliche Verbreitung erfahren8 und sind weltweit gefürchtete Erreger nosokomialer Infektionen.9 10 11 12 13 Die trickreiche Abwehr der Bakterien gegenüber Antibiotika ist nicht neu, sondern wurde bereits nach industrieller Einführung des Penicillins beobachtet. Mitte der 40er Jahre kam es zu ersten Resistenzen, zu Unempfindlichkeiten von Keimen gegen die einstige Infektions- Wunderwaffe. Zweifelhafte Popularität genießt bis heute der Erreger Staphylococcus aureus. Bakterien, wie der genannte Erreger, verfügen über mehrere Abwehrmechanismen zur Verteidigung vor Antibiotika. Sie bilden ein Enzym (Betalactamase) mit dem der Betalaktam-Ring des Antibiotika gespalten wird. Ohne diesen Ring sind Antibiotika wirkungslos und werden mit Hilfe einer Membranpumpe direkt wieder aus der Zelle heraus geschleust.14 1. 2 Begriffserklärungen und medizinische Grundlagen Nachfolgend werden die Begriffe, wie Staphylococcen, Staphylococcus aureus und MRSA differenziert betrachtet. 7 vgl. RKI, In: Expertise zum 2. Armuts-und Reichenbericht der Bundesregierung 2005 vgl Witte et al., In: Hautarzt 2005, Seite 731 9 vgl Neuhaus, In: Deutsches Ärztblatt 07/ 2003, Seite 2921 10 vgl. Kischke, In: Heilberufe spezial Hygiene 2005, Seite 30 11 vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr.5/ 2005, Seite 30 12 vgl. www.rki.de, Pressemitteilungen 2005, Seite 1, letzter Aufruf: 20.05.06 13 vgl. Heuck et al., In: Hygiene & Medizin 2000, Seite 191 14 vgl. Nikman, In: Desinfacts Special, Seite 1 8 2 Begriffserklärung Staphylococcen Staphylococcen sind Bakterien und physiologischer Bestandteil der Hautflora und besiedeln Gegenstände, Pflanzen und Tiere. Beim Menschen ist der häufigste Vertreter der Staphylococcus Epidermis, der die gesunde Haut besiedelt und hilft, den Säureschutzmantel aufzubauen und zu erhalten.15 Staphylokokken siedeln sich mit Vorliebe auf der menschlichen Haut und Schleimhaut, z.B. in Achselhöhlen, Nasenvorhof, Rachen oder Darm an. Da sie dabei aber nicht zwangsläufig Infektionen auslösen, wird unterschieden zwischen einer Kolonisation (Besiedelung) und Infektion.16 Begriffserklärung Staphylococcus aureus Das Bakterium Staphylococcus aureus ist als Verursacher von Infektionen innerhalb und außerhalb des Krankenhauses anzusehen. Es kolonisiert vorrangig die Hautflora des Nasenvorhofs, wobei etwa 20% der Bevölkerung ständig und ca. 60% der Bevölkerung damit intermittierend kolonisiert sind. Ausgehend vom Vestibulum nasi kann der Erreger sich auf andere Haut- und Schleimhautbereiche ausbreiten.17 Bei abwehrgeschwächten Menschen können Staphylococcen, insbesondere Staphylococcus aureus, schwere Infektionen verursachen, wie Wundinfektion, Lungenentzündung und Sepsis.18 Eine reine Kolonisation, d.h. Anwesenheit von Erregern auf der Haut, Schleimhaut, in offenen Wunden, Exkreten oder Sekreten ohne klinische Symptome, ist keine Infektion.19 Begriffserklärung MRSA Den gleichen Ausbreitungsweg, wie oben beschrieben, kann die Methicillin-resistente Variante von Staphylococcus aureus nehmen. Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) verursachen die 15 vgl. Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), In:Maßnahmenplan beim Auftreten von MRSA 2002, Seite 1 16 vgl. RKI, In: Definition nosokomialer Infektionen 2005, Seite 6 17 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 954ff 18 vgl. lögd Studie 2002, Seite 8 19 vgl. RKI, In: Definition nosokomialer Infektionen 2005, Seite 6 3 gleichen Krankheiten wie Staphylococcus aureus. Nur dass sie aufgrund ihrer Antibiotikaresistenz wesentlich schwieriger zu behandeln sind, da nur noch wenige Antibiotika zur Behandlung in Frage kommen.20 Die Methicillinresistenz von Staphylococcus aureus , d.h. die Unempfindlichkeit des Erregers gegenüber sogenannten staphylococcenwirksamen, penicillinasefesten Penicillinen, stellt gegenwärtig den für die klinische Praxis problematischen Resistenzmechanismus dar. Die Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus- Stämme sind nicht nur gegenüber allen Betalactamantibiotika resistent, sondern zeigen in der Regel auch das Phänomen Unempfindlichkeiten der gegenüber Antibiotikaklassen.21 Multiresistenz, d.h. Substanzen einer mehrerer Durch die Antibiotika Unempfindlichkeit werden Therapiemöglichkeiten von MRSA- Infektionen entscheidend eingeschränkt, so dass MRSA Infektionen zu einem signifikanten Risikofaktor für betroffene Menschen werden.22 Staphylococcus aureus sind weltweit gefürchtete Erreger nosokomialer Infektionen.23 24 25 26 27 Das Robert Koch- Institut (RKI) ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung undPrävention, deren Kernaufgaben die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere der Infektionskrankheiten sind.28 Vorkommen von MRSA Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit einem MRSA Vorkommen in der Bevölkerung von 10-30% im Mittelwert, die Skandinavischen Länder verzeichnen einen Anteil von 1-5%, die südlichen 20 vgl. lögd Studie 2002, Seite 8 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 954 22 vgl. a.a.O., Seite 954 23 vgl. Neuhaus, In: Deutsches Ärztblatt 07/ 2003, Seite 2921 24 vgl. Kischke, In: Heilberufe spezial Hygiene 2005, Seite 30 25 vgl. www.rki.de 2005, Seite 1, letzter Aufruf: 20.05.06 26 vgl. Heuck et al., In: Hygiene & Medizin 05/ 2000, Seite 191 27 vgl. Quientel, Witte 2006, Seite 11ff 28 vgl. RKI, In: Aufgaben und Gesetzliche Grundlagen des RKI 2005, Seite 1 21 4 Länder von 25-50%.29 Die folgende Abbildung verdeutlicht das MRSA Vorkommen innerhalb Deutschlands. Dabei wurden jeweils Höchstwerte zugrunde gelegt. Vorkommen von MRSA, BRD 30,00% 30% 25% 20% 15% 10% 3,00% 1,00% 5% 0% Im Kra nk enh aus Priv a te H aus hal te Vorkommen von MRSA Abbildung 1: Vorkommen von MRSA, Höchstwerte, (Ableitung aus: Quintel, Witte, MRSA- eine interdisziplinäre Herausforderung, Socio-medico Verlag, Wiesbaden 2006, Seite 27 ff), Eigene Darstellung 1.3 Forschungsinteresse und Erkenntnisgewinn In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der MRSA-Stämme weltweit deutlich angestiegen. Laut Wernitz und Veit beträgt der Anteil von allen Staphylococcus aureus Isolaten im Jahr 2001 bereits 20,7%, im Krankenhaus.30 In der täglichen Arbeit wird die Pflege von MRSA besiedelten - und oder infizierten Patienten bei den Pflegekräften als sehr belastend empfunden. Belastungen, wie: Schwitzen unter der Schutzkleidung, (erschwerend kommen die Sommertemperaturen hinzu), Bewegungseinschränkung, erschwerte Kommunikation durch Mundschutz, eingeengter Blickkontakt 29 vgl. European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) MRSA Bakteriämie-Raten in Europa 2004 30 vgl. Wernitz, Veit, In: Management & Krankenhaus 2005, Seite 16 5 durch Mundschutz, der „innere“ und äußere Schutzmantel hemmt die Patientennähe.31 Meiser und Brehmer beschreibenden eindeutigen zeitlichen und personalen Mehraufwand bei der Pflege von MRSAErkrankten anhand offener, nicht teilnehmender, strukturierter 32 33 Beobachtung. Forschungsfeld Bisher liegen kaum Berichte über den Hygienezustand in der ambulanten Betreuung vor. Daher wurde von Popp et al., ein im Auftrag des Landesinstitutes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd) in Münster gefördertes Projekt „Hygiene in der ambulanten Pflege“ durchgeführt.34 Popp et al. folgert u.a. in der genannten Untersuchung, dass in der ambulanten Betreuung verantwortliche Pflegekräfte und Hygienepläne fehlen. Außerdem bestehen Defizite im Bereich der Händedesinfektion, Verbesserung in der Müllentsorgung sollte geschehen und die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten sei problematisch, da diesen oft die erforderlichen Kenntnisse fehlen.35 Der MDK stellt bei Qualitätsprüfungen im Raum Baden-Württembergs fest, dass im zeitlichen Verlauf immer mehr Patienten im häuslichen Umfeld von immer weniger, dafür aber von größeren Pflegediensten betreut werden. Beobachtete Defizite fanden sich besonders im Bereich der Hygiene.36 Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, sich verstärkt mit der Hygiene in der ambulanten Betreuung und den damit verbundenen Erfahrungen Betroffener auseinanderzusetzen. Insbesondere des Zusatzproblems MRSA. Es besteht daher Forschungsinteresse, zu eruieren, mit welchen Problemen Betroffene einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung konfrontiert werden. 31 vgl. Hartmann, In: Hygiene & Medizin 07/ 2005, Seite 234ff vgl. Meiser, Brehmer, In: Die Schwester/ Der Pfleger 12/ 2002, Seite 980ff 33 vgl. Meiser, Brehmer, In: Die Schwester/ Der Pfleger 01/ 2003, Seite176ff 34 vgl. RKI 2006, Seite 1 35 vgl. a.a.O., 2006, Seite 1195ff 36 vgl. Mohrmann et al. 2005, Seite 1 32 6 Die nachfolgende Literaturrecherche verdeutlicht, dass viele Studien dem Thema der Antibiotikaresistenz gewidmet sind, aber nur wenige Studien sich mit soziologischen Auswirkungen der Erkrankung beschäftigen. Daher besteht sowohl wissenschaftliches als auch pflegerisch praktisches Forschungsinteresse bezüglich der Thematik. Forschungsfrage Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit greift das Erleben und die Erfahrungen Betroffener mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung auf. Darauf aufbauend sollen Erkenntnisse gewonnen werden, welche Hilfestellungen Betroffene benötigen, um mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Kolonisation in der häuslichen Umgebung leben zu können. 7 1.4 Vorgehensweise und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit In den folgenden Kapiteln werden zum Vorverständnis des Themas „MRSA in der häuslichen Umgebung“, Ursachen, Bedeutung, Auswirkungen und gesetzliche Vorgaben vorgestellt. Anschließend werden die soziologischen Auswirkungen der Isolation dargestellt. Im Kapitel „Literaturrecherche“ wird der Zugang der verschiedenen Datenbanken und der Weg zu den Interview-Fragestellungen beschrieben. Dabei ist das Vorverständnis als vorläufig anzusehen, da qualitative Forschung, nach Kleinjung, den Weg der Überwindung des Vorverständnisses im Forschungsprozeß geht.37 Erst aufgrund der Datenerhebungsergebnisse kommt der Forscher durch Interpretationstechniken zu typisierenden Aussagen und darüber zu theoretischen Konzepten über die Konstellationen sozialer Wirklichkeit.38 Der Empirische Teil gliedert sich in die Bereiche Methodische Einführung, Vorgehen anhand der Methode und Darstellung der Ergebnisse. Im Ergebnisteil ist jedes Interviewzitat alphabetisch, mit Seitenzahl und Zeilennummer gekennzeichnet. Beim Abgleich zwischen Theorie und empirischen Ergebnissen, sind zur besseren Unterscheidung die Angaben zum Interview im Fließtext hinterlegt. Literaturangaben erfolgen wie in der gesamten Arbeit in der Fußnote. Im Ergebnisteil wird aufgrund der vorangegangenen Kategoriebildung, eine Taxonomie entwickelt, wie die Betroffenen aufgrund ihrer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion ihre Situation erlebt und empfunden haben. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung des Erlebens und die Erfahrungen Betroffener mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung. 37 38 vgl. Kleinjung 1982, Seite 231, Witzel 1985, Seite 233, In: Lamnek 2005, Seite 347 vgl. a.a.O., Seite 347 8 1.5 Ursachen und Bedeutung des Krankheitsbildes Nosokomial, abgeleitet aus dem griech., bedeutet Krankenhaus Infekt.39 Nosokomiale Keime müssen außerhalb des Makroorganismus lebensfähig sein und sich im Krankenhausbereich ausbreiten lassen. Sie sind in zahlreichen, zum Teil typischen Biotopen des Krankenhausmilieus zu finden.40 Nosokomiale Infektionen werden meist durch banale Erreger verursacht, deren Übertragung gleichzeitig mit der Behandlung und Pflege erfolgt. Als Haupt- Übertragungsursache gelten Vernachlässigung klassischer Hygienevorschriften, mangelnde Qualifikation des Personals, unkritische Anwendung von Antibiotika, Platzmangel, Zunahme hospitalisierter Problempatienten mit veränderten immunologischen Reaktionsmechanismen und überholte bautechnische Konzeptionen. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Kontaktinfektion, wobei als Hauptübertragungsweg 41 anzusehen sind. die Hände von medizinischem Personal Außerdem können die Erreger aerogen durch Staub und Tröpfchen übertragen werden.42 Eine Schlüsselrolle für die weltweit drastisch ansteigende Zahl nosokomialer Infektionen durch antibiotikaresistente Keime, spielen dabei MRSA.43 44 Begünstigende Faktoren einer MRSA Kolonisation bzw. Infektion Folgende Risikofaktoren führen zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer MRSA Besiedelung des Nasen-/ Rachenraumes:45 • Zunehmendes Alter / Abnehmende Mobilität / Hohe Pflegestufe • Geschlecht männlich / Lang andauernde Antibiotikatherapie • Hospitalisierung in den letzten 6 Monaten / Periphere Durchblutungsstörungen 39 vgl. Gruyter, Psychyrembel CD-Rom, 258 Auflage 1997 vgl. Beck,Schmidt 1986, Seite 91 41 vgl. Kaminski et al. 2002, Seite 350 42 vgl. Baumgartner, Möllmann 2003, Seite 139 43 vgl. lögd Studie 2002, Seite 7 44 vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr.5/ 2005, Seite 36 45 vgl. lögd Studie 2002, Seite 7 40 9 • Endoprothese / Dekubitus / Ulcus cruris / Andere Grundkrankheiten • Längerer Heimaufenthalt / Katheter, insbes. Harnwegskatheter Das Robert-Koch- Institut weist daraufhin, dass unstrukturierte Mundhygiene und mangelnde Prothesenpflege die Voraussetzung von Karies, Gingivitis- und Parodontose begünstigt und das Infektionsrisiko in der Mundhöhle beginnend und davon weiter ausgehenden Infektionen (z.B. Pneumonie, zweithäufigste Endokarditis) nosokomiale fördert. Infektion Pneumonien nach sind die Harnwegsinfektionen, allerdings mit einer wesentlich ungünstigeren Prognose.46 In der Konsequenz werden Patienten, mit o.g. Risikofaktoren, sowie Patienten mit bekannter MRSA Anamnese, bei Wiederaufnahme in die Klinik gescreent.47 1.6 MRSA-Surveillance-Systeme Fast alle Systeme sind nicht nur auf die Überwachung von MRSA, sondern auch auf andere Erreger und deren Resistenzen ausgerichtet. Die folgenden Überwachungs-Systeme haben unterschiedliche Zielsetzungen und berechnen je nach Zielsetzung unterschiedliche MRSA Raten.48 Paul Ehrlich Gesellschaft / PEG • Regelmäßige Empfindlichkeitsprüfung und Resistenzen gegenüber Antibiotika in Deutschland und mitteleuropäischem Raum über einen langen Zeitraum • Einheitliche Anwendung der Goldstandard- Diagnostik German Network for Antimicrobial Resistance Surveillance / GENARS • Zeitnahe Analysen • Einheitliche Anwendung der Goldstandard- Diagnostik 46 vgl. Vogel, Exner, In: Hygiene & Medizin 10/1985, Seite 351ff vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr.19/ 2005, Seite 148 48 vgl. Quintel, Witte 2006, Seite 37ff 47 10 European Antimicrobial Resistance Surveillance / EARSS • Ermöglicht den europäischen Vergleich • Konzentration auf klinische Isolate Krankenhaus- Infektions-Surveillance-System / KISS KISS Allgemein: • Zeitnahe Beurteilung von Trends • Konzentration auf klinische Isolate KISS: MRSA- Daten von Intensivstationen: • Charakterisierung der MRSA-Belastung der Intensivstationen • Differenzierung nach Infektionen und Kolonisationen sowie nach auf die Intensivstation mitgebrachten und dort erworbenen MRSA MRSA- KISS: • Charakterisierung der MRSA- Belastung der Intensivstationen • Ermöglicht Vergleiche zwischen den Krankenhäusern Surveillance der Antibiotikaanwendung und der bakteriellen Resistenzen auf Intensivstationen / SARI • Konzentration auf Intensivstationen • Resistenzbeurteilung im Zusammenhang mit der Antibiotikaanwendung 11 1.7 MRSA und gesetzliche Vorgaben Kontrollorgan in der ambulanten Betreuung Gemäß § 114 Abs. 3 des SGB XI, sind für die ambulante Betreuung, Vorgaben des Medizinischen Dienstes maßgeblich. Die Prüfung bezieht sich auf die Verhinderung nosokomialer Infektionen. Danach haben die ambulanten Pflegedienste die relevanten Empfehlungen der beim RobertKoch- Institut eingerichteten Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention einzuhalten.49 Als da sind: • Händehygiene • Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen • Prävention der nosokomialen Pneumonie • Prävention und Kontrolle von Methicillin- resistenten Staphylococcus aureus- Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen Außer den o.g. RKI Empfehlungen finden bei MDK Prüfungen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH): Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären Krankenund Altenpflege/Rehabilitation“, Berücksichtigung.50 Arbeitsschutzgesetz Der Arbeitgeber ist gemäß §§ 3 und 4 des ArbSchG dazu verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter der Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen.51 Für ambulante Pflegedienste bedeutet dies, dass die Versorgung MRSA Betroffener mit höheren Kosten verbunden ist. Denn der Arbeitgeber darf die Kosten für die erforderlichen Schutzkleidung, Arbeits- und Gesundheitsmaßnahmen Schutzhandschuhe, Mundschutz, (z.B. Haube, 49 vgl. Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (MDS) (Hrsg.) Richtlinien/ Erhebungsbogen/ MDK-Anleitungen 2005, Seite 102 50 vgl. a.a.O., Seite 104 51 vgl. Arbeitsgesetze 1999, Seite 254 12 Händedesinfektionsmittel, Hautschutz- und Hautpflegemittel etc.) nicht den Beschäftigten auferlegen. Händedesinfektionsmittel gehören sowohl zum Patienten- als auch zum Mitarbeiterschutz und sind als Betriebsmittel anzusehen.52 Unterlassene Rechtsprechung, für Händedesinfektion Angehörige von wertet Gesundheitsberufen, die als Behandlungsfehler.53 § 33 SGB V Desinfektionsmittel gelten als „Nichtarzneimittel“ und stellen gemäß §33 SGB V kein Hilfsmittel dar, da es sich primär um kein sächliches Mittel handelt. Zur Aufnahme der Desinfektionsmittel in den Hilfsmittelkatalog, bedarf es gemäß § 139 Abs. 2 SGB V, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln, eines Qualitätsnachweises des Herstellers, über Funktionstauglichkeit und therapeutischen Nutzen des Hilfsmittels.54 Des weiteren obliegt die Aufnahme der Entscheidungskompetenz der Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich.55 Pflegehilfsmittel zählen zu dem Leistungskatalog der Pflegekassen. § 40 Abs. 2 SGB XI Bei Pflegehilfsmitteln, die im „Pflegehilfsmittelverzeichnis“ aufgelistet sind, wird zwischen technischen Pflegehilfsmitteln und zum Verbrauch 56 bestimmten Pflegehilfsmitteln unterschieden.“ Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel zählen: saugende Bettschutzeinlage, Schutzkleidung (Fingerlinge, Einmalhandschuhe, Mundschutz, Schutzschürzen) und Desinfektionsmittel. Diese können gemäß § 40 Abs. 2 SGB XI über die Pflegekasse bezogen werden, wobei der monatliche Betrag von 31 Euro nicht überschritten werden darf.57 Eine ärztliche Verordnung als Voraussetzung für die Abgabe eines Pflegehilfsmittels durch die 52 vgl. Fischer-Böhm, Korrespondenz 2006 vgl. OLG Düsseldorf 04.06.1987, VersR 1988 54 vgl. Neubert, Robbers 2005, Seite 388 55 vgl. Shadiakhy, Korrespondenz 2006 56 vgl. Kühn 2001, Seite 50ff 57 vgl. Neubert, Robbers 2005, Seite 525 53 13 Pflegekasse, ist im Bereich der Pflegeversicherung nicht vorgesehen.58 1.8 Auswirkungen des Krankheitsbildes Epidemiologische Auswirkungen Für Krankenhäuser stellt das Landesinstitut des Öffentlichen Gesundheitsdienstes NRW (lögd NRW) für Deutschland eine Zunahme des MRSA- Vorkommens innerhalb von 8 Jahren von 1,7% (1990) auf 15,2% (1998) fest, bezogen auf die Anzahl der nachgewiesenen Staphylococcus- aureus Fälle.59 Nach Huggett schwankt die MRSA Rate in deutschen Krankenhäusern innerhalb einer Klinik nach Risikobereich zwischen 0 und 35%.60 In den USA brach eine gänzlich neue MRSA- Variante > Community acquired MRSA< (cMRSA) aus, die nicht Krankenhaus assoziiert zu sehen ist. In Europa sind Ausbrüche dieser Variante bisher nicht bekannt.61 Ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen Neben dem persönlichen Leid der Betroffenen werden jährliche Zusatzkosten in Höhe von 1,5 Mrd. Euro verursacht.62 Nach Wernitz und Veit, sind darin noch nicht die Kosten für Rehabilitation, Arbeitsausfall und Versicherungsschäden vorliegen. 63 enthalten, zu denen keine Schätzungen Die Mehrkosten entstehen durch: • steigende Inzidenz von MRSA Infektionen64 • verlängerte Liegezeit und verstärkten Hygienemaßnahmen65 • gesperrten Betten in Isolierzimmern66 58 vgl.http://sgbkv.rla.aok.de, In: Gemeinsames Rundschreiben zur Versorgung mit Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln nach dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung, Seite 15, letzter Aufruf: 15.11.2006 59 vgl. lögd Studie 2002, Seite 8 60 vgl. Huggert, In: Management & Krankenhaus 2005, Seite 17 61 vgl. Quientel, Witte 2006, Seite 31 62 vgl. RKI Mitteilung 2004, Seite 314 63 vgl. Wernitz, Veit, In: Management & Krankenhaus 2005, Seite 16 64 vgl. Wernitz et al. CIM 2005, Engemann et al. CID 2003, In: Euregio MRSA - net, lögd Münster (Hrsg.) 2005, Seite 9 (lögd Studie 2005) 65 vgl. Abramson et al., In: Infection Control.1999, In: lögd Studie 2005, Seite 9 66 vgl. Papia et al., In: Infect. Control 1999, In: lögd Studie 2005, Seite 9 14 Soziologische Auswirkungen Gemäß der RKI- Empfehlung sind MRSA kolonisierte bzw. infizierte Patienten räumlich getrennt von anderen Patienten unterzubringen, möglichst in Zimmern mit eigener Naßzelle und einem Vorraum mit Schleusenfunktion. Eine gemeinsame Unterbringung mehrerer Patienten mit MRSA ist möglich (Kohortenisolierung).67 Bei Widereinweisung in die Klinik werden Patienten mit bekannter MRSA Anamnese solange isoliert, bis ein negativer Befund vorliegt.68 Somit sind MRSA infizierte und/ oder kolonisierte Patienten, neben dem persönlichen Leid und verlängerter Liegezeit, Isolationsbelastungen ausgesetzt.69 70 71 Das Robert Koch Institut konstatiert, dass die „mit der Isolierung und der Stigmatisierung verbundenen Belastungen für den Patienten, Faktoren sind, die konsequente Umsetzung geeigneter Hygienemaßnahmen behindern.“72 Laut RKI Empfehlung ist „beim Betreten des Patientenzimmers ein Kittelwechsel vorzunehmen und der und-Nasen-Schutz anzulegen.“73 Abbildung 2: Schutzkleidung Die Schutzkleidung kann in der Arbeit mit einem MRSA kolonisierten und/ oder infizierten Patienten eine psychologische Barriere darstellen.74 67 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 955 vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr. 42/ 2005, Seite 2 69 vgl. www.rki.deContect/Presse/Pressemitteilung, letzter Aufruf : 16.01.2007 70 vgl. Abramson et al., In:Infection Control. 1999, In: lögd Studie 2005, Seite 9 71 vgl. Bossard et al., In:Krankenpflege Soins Infirmiers 2003, Seite 22 72 vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr.5/ 2005, Seite 35 73 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 955 74 vgl. Nußbaum, In: Pflegen Ambulant 01/ 2007, Seite 10 68 15 Ambulante Pflegedienste sind gehalten, MRSA Betroffene zur Vermeidung einer Keimverschleppung zuletzt zu versorgen und sich entsprechend zu schützen.75 1.9 Isolation durch MRSA Heilungsparadigma Die Wurzeln medizinischer Betrachtungsweise des Menschen gehen auf das vorherrschende mechanistische Naturmodell zurück, ein mechanischreduktives Heilungsparadigma.76 Dabei liegt dem biomedizinischem Mensch- Maschine Modell „eine starke Betonung des kurativen, heilenden Ansatzes im Sinne der Wiederherstellung von Lebensfunktionen zugrunde.“77 Siebold bezeichnet den Ansatz als „sensualistische Reduktion.“ Damit ist gemeint, dass auf der Ebene der Körpermaschine alle nicht meßbaren Größen ausgeblendet werden und versucht wird, das Fallgeschehen auf technisch einfache meßbaren Größen zu reduzieren.78 Im Falle von MRSA ist dies schwierig, denn hier findet Darwins These „ Survial of the fittest“,79 Überleben des Passensten,80 Anwendung. Wie bereits beschrieben hat das Bakterium Staphylococcus aureus, Überlebensmechanismen gegen Antibiotika entwickelt und kontakariert damit das medizinische Heilungsparadigma. Nachfolgend wird das medizinische Heilungsparadigma zum besseren Verständnis am Modell von „Akuizität“ und „Chronizität“ erklärt. Akute Erkrankung (Akuizität) Akute Erkrankungen beruhen überwiegend auf klar abgrenzbaren Zusammenhängen von Krankheitsursache und Krankheitswirkung. Das Problem kann gelöst werden, indem die Krankheitsursache behoben und somit das Therapieergebnis rational nachvollziehbar und mit hinreichender 75 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 955 vgl. Kristel, In: Weidner, Isfort (Hrsg.) Pflegequalität und Pflegeleistung I 2001, Seite 19 77 a.a.O., Seite 19 78 vgl. Siebolds, In: Merke (Hrsg.) 1998, Seite 189 79 vgl. Watzlawick 2003, Seite 20 80 vgl. PONS 2003, Seite 419 76 16 Sicherheit vorhersehbar ist.81 Siebolds bezeichnet dies als ursachenbezogene Therapie und als die Idealvorstellung klassisch naturwissenschaftlicher Medizin. Dabei spielt die Art und Weise, wie sich der Patient in seiner Erkrankung verhält, eine eher unbedeutende Rolle. Ebenso spielt die gefühlsmäßige und soziale Situation bei einer akuten Erkrankung eine weitaus geringere Rolle als bei einer chronischen. Chronische Erkrankung (Chronizität) Chronische Erkrankungen sind wesentlich komplexer als akute. Ihrer Definition nach sind sie unheilbar und laufen über eine lange Zeit.82 Chronische Erkrankungen „sind bestimmt durch die unauflösbare Verbindung naturwissenschaftlich- psychosozialen Faktoren.83 Da medizinischer viele Faktoren“ unterschiedliche und Faktoren wechselseitig und unlösbar miteinander verbunden sind, lassen sich einzelne, isolierte Ursache-Wirkungszusammenhänge nicht abgrenzen. Dieses vernetzte Krankheitssystem wird auf jede Einzelintervention, mit einer das gesamte System betreffende Systemveränderung reagieren.84 Betroffene mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion leiden meist an mehreren chronischen Grunderkrankungen 85 und mitunter gleichzeitig, an akuten Beschwerden. Hinzu kommt eine Antibiotika- Unempfindlichkeit sowie eine MRSA Kolonisation und/ oder Infektion. Grenzgänger zwischen akuter und chronischer Erkrankung Die Gleichzeitigkeit von akuter und chronischer Erkrankung verleiht Betroffenen den Status eines „dauernden Grenzgängers“.86 Ärzte sind jedoch meist „im Management akuter Erkrankungen ausgebildet“ und werden somit versuchen, auch die chronischen Anteile so behandeln, „als ob sie eine akute Erkrankung wären.“ 87 81 vgl. Siebolds 1998, Seite 190 vgl. a.a.O., Seite 191 83 a.a.O., Seite 191 84 vgl. a.a.O., Seite 191ff 85 vgl. lögd Studie 2002, Seite 7 86 vgl. Siebolds 1998, Seite 192 87 a.a.O., Seite 192 82 17 Typische Merkmale einer chronischen Krankheit, wie etwa eine unklare Ätiologie, führen häufig zur Stigmatisierung. Diagnosen, die sich medizinisch nicht begründen lassen, werden häufig dem „magischen Bereich“ zugeordnet.88 Erkrankungen, unklarer Ursache oder bei denen keine wirksame Therapie möglich ist, gelten als dubios, mysteriös, gefürchtet, häufig als ansteckend und somit als isolationsbedürftig.89 Betroffene, die nicht in das klassische Ursache– Wirkungsprinzip passen, werden durch Isolation aus der Gruppe der klar abgrenzbar zu Behandelnden ausgeschlossen. Isolation im Strafvollzug Im Strafvollzug wird Isolation (Einzelhaft) als Bestrafung eingesetzt. Wobei das Wesentliche der Strafe nicht als Bestrafung zu sehen war, sondern ein Versuch zu bessern, zu erziehen und zu „heilen“.90 Foucault spricht in diesem Zusammenhang, vom Körper als Instrument oder Vermittler, in den man durch Einsperren eingreift, das Individuum einer Freiheit beraubt, die sowohl als ein Recht wie als Besitz betrachtet wird.91 „[...] man raubt alle Rechte, ohne Leiden zu machen; man erlegt Strafen auf, die von jedem Schmerz frei sind.“ 92 Etymologisch ist Isolation vom ital. Begriff Isola, „Insel“ (lat. Insula; vgl. Insel) abgeleitet und bedeutet ursprünglich, etwas zur Insel machen, etwas von allem anderen abtrennen. Abtrennen, wie eine Insel vom Festland.93 Die Auswirkungen des Entzuges sozialer Nähe sind in unserer Gesellschaft durchaus bekannt. 88 vgl. Weidmann 2001, Seite 61 vgl. Sontag 1977, In: Lubkin 2002, Seite 176 90 vgl. Foucault 1994, Seite 17 91 vgl. a.a.O., Seite 18 92 a.a.O., Seite 19 93 vgl. Herkunftswörterbuch 2001, Seite 369 89 18 Isolation als Hygienemaßnahme Im Klinikbetrieb werden die Betroffenen isoliert, um eine Übertragung von MRSA zu verhindern, Ausbrüche mit MRSA zu begrenzen bzw. die Entstehung endemischer Situationen abzuwenden und 94 Zusatzkosten in betroffenen Einrichtungen zu vermeiden. letztlich Vergleichbar mit der Zielsetzung im Strafvollzug, wird in der Klinik unter Hygiene heute „krankheitsverhütende Medizin“ verstanden, die Mikroorganismen zum Außenfeind erklärt und heftig bekämpft.95 Rituale permanent auf den Dabei weisen hygienische Außenfeind hin, wie etwa die Isolationsmaßnahme.96 Innerhalb der Klinik wird der Bereich der Hygiene den pflegerischen Mitarbeitern zugeordnet, „sie sind für die Asepsis zuständig.“97 Nach Weidmann`s Eindruck, gerät jemand der „Hygiene“ thematisiert, in die Rolle eines Kontrollierenden.98 Die Zuständigkeit spiegelt sich in der Rechtswissenschaft wieder, die im Schlußteil ausführlicher behandelt wird. Isolationsauswirkung Die Betroffenen erleben die Situation als einer von „Anderen auferlegten sozialen Isolation“, die für manche Menschen schwer verständlich ist.99 Wie bereits erwähnt, spricht Foucault vom Körper als Instrument oder Vermittler, in den man durch Einsperren eingreift, das Individuum einer Freiheit beraubt, die sowohl als ein Recht wie als Besitz betrachtet wird.100 Durch die Einsperrung entstehen möglicherweise ungewollte, aber unvermeidliche Konsequenzen, nämlich der seelischen Schmerzen.101 Auch Fachleute im Gesundheitswesen, die die soziale Isolation, ausgehend von ihrem problemzentrierten klinischen Ansatz betrachten, sehen darin mehr negative als positive Aspekte.102 Nach Weiss sind 94 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 955 vgl. Richter 1986, In: Weidmann 2001, Seite 61 96 vgl. a.a.O., Seite 62ff 97 a.a.O., Seite 66 98 vgl. a.a.O., Seite 65 99 vgl. Biordi, In: Lubkin 2002, Seite 289 100 vgl. Foucault 1994, Seite 18 101 vgl. a.a.O., Seite 25 102 vgl. Biordi, In: Lubkin 2002, Seite 290 95 19 kennzeichnende Emotionen sozialer Isolation, Langeweile und das Gefühl der Marginalität oder des Ausgeschlossenseins. Wobei Marginalität das Gefühl bezeichnet, von der erwünschten Mitgliedschaft sozialer Netzwerke oder Gruppen ausgeschlossen zu sein.103 Kennzeichen sozialer Isolation sind: Gefühlsverflachung, Lebenssinn- und zweck, Gedankenversunkenheit, fehlender Kommunikation, Verlust Gefühl von des Getrenntseins, aktive Abkapselung und sensorische Defizite.104 Die Betroffenen sehen sich einer Macht- Zwang Situation, ausgehend von der klinischen Einrichtung, ausgesetzt. Für Foucault ist die Technologie der Macht, als Prinzip Menschenrettung zu sehen.105 Die Betroffenen jedoch finden sich in einem kritischen Lebensereignis wieder, das Veränderungen des Selbstkonzeptes bewirkt.106 Dadurch löst sich die gegenwärtige Existenz von seiner vergangenen Existenz ab und die Vorstellungen vom Selbst und der Zukunft sind getrübt oder sogar zerstört.107 Isolation löst Widerstand aus, 108 dem erneut mit einer Macht-Zwang-Strategie begegnet wird, die auf dem Einsatz von Macht oder Druck beruht. Schuld und/ oder Beschämung kann durch die Macht-Zwang-Strategie ausgelöst werden und wird nicht selten in der Gesundheitsversorgung eingesetzt.109 Häufig bestehen die mit der Macht-Zwang-Strategie erreichten Änderungen nicht fort, wenn die dahinterstehende Macht wegfällt. Wie im Falle einer Entlassung aus der Klinik.110 Eine der wichtigsten Interventionen zur Unterstützung Betroffener, ist die Unterstützung durch Familienangehörige.111 112 103 vgl. Weiss 1973, In: Lubkin 2002, Seite 291 vgl. Lien-Gieschen 1993, In: Lubkin 2002, Seite 294 105 vgl. Foucault 1994, Seite 34 106 vgl. Käppeli 2005, Seite 17 107 vgl. a.a.O., Seite 19 108 vgl. Spradley 1980, In:Lubkin 2002, Seite 502 109 vgl. Chin, Benne 1976, In: Lubkin 2002, Seite 500ff 110 vgl. a.a.O., Seite 500 111 vgl. Stephens & Bernstein 1984, Weeks & Cuellar 1981, In: Lubkin 2002, Seite 297 u. 500ff 112 vgl. Heuel, In: Soziale Netzwerke und Interventionen 2007, Seite 4ff 104 20 1.10 Zusammenfassung des theoretischen Teils Weltweit stellen MRSA Infektionen ein eskalierendes Problem in stationären Einrichtungen dar, da sich die Resistenzsituation gegenüber einer Reihe von Antibiotika deutlich verschlechtert hat. Parallel dazu steigt die Bedeutung von Staphylococcus aureus als Erreger nosokomialer Infektionen. Diese Situation stellt nicht nur Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern auch in der ambulanten Versorgung vor immer größer werdende Probleme. Da MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der Klinik räumliche Trennung von anderen Patienten nach sich zieht, sind die Betroffenen Isolations- und Stigmatisierungsbelastungen ausgesetzt. Es konnten keine Studien zur Forschungsfrage, des Erlebens und der Erfahrungen mit MRSA in der häuslichen Umgebung, gesichtet werden. Daher besteht sowohl wissenschaftliches als auch pflegepraktisches Forschungsinteresse, ob und welche Bedürfnisse Betroffene zum Umgang mit MRSA in der häuslichen Umgebung haben. 21 2 Literaturrecherche 2.1 Vorgehensweise und Datenbanken Der Zugang der Literaturrecherche erfolgte über die Bibliothek der KFH NW Abtl. Köln und über WISE, einer Datenbank des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (dip) in Köln. Dort wurden unter dem Schlagwort „MRSA“ 10 Treffer angezeigt. Davon entfielen 6 Treffer auf Artikel der Fachzeitschriften: Pflegezeitschrift, Pflege, heute, Heilberufe, Die Schwester/ Der Pfleger und Pflegen ambulant. Weitere 5 Treffer zeigten Fachbücher mit medizinischen Inhalt zu MRSA an, sowie zwei Diplomarbeiten von Absolventinnen des Studienganges Pflegepädagogik der KFH NW Abt. Köln. Titel Arbeitsabläufe bei der Autor Meiser, M. Verlag Die Schwester Der Pflege von MRSA- Brehmer, M. Pfleger, Melsungen, Erkrankten Teil 1 Jahrg. 41, Heft 12, 2002 Arbeitsabläufe bei der Meiser, M. Die Schwester Der Pflege von MRSA- Brehmer, M. Pfleger, Melsungen, Erkrankten Teil 2 Hygiene zwischen Theorie Jahrg. 42, Heft 1, 2003 Becker, O. und Praxis- ein Problem? Balk Info, 05/ 2001 BLV Verlagsgesellschaft mbH; 05/2001, Seite 176-180 Die Resistenzlage wird Nußbaum, B. immer problematischer Pflegezeitschrift 55, 2002, Heft 7, Seite 474-479 Gut geschützt zum Brömmling, M. Hausbesuch Pflegen ambulant Melsungen, 17. Jahrg. 01/06, Seite 7-9 Die Qualität der pflegeri- Hulstert, H. Pflege , Hans Huber schen Beziehung: Ein Verlag, Bern, 14. Jahrg. Anforderungsprofil Heft 01/01, Seite 39-45 22 Baumgartner, K., Urban & Fischer, 2003 Häusliche Pflege Möllmann Education pflegender Stiletto, P. Köln NW Abt. Köln, 2003 Angehöriger von MRSA/ Diplomarbeit ORSA Pat.- Wegbereitung zur Entwicklung eines Konzeptes Erhebung der Banek- KFH NW Abtl. Köln, 2005 Bildungsanforderungen des Schwiddessen, Pflegepersonals bezüglich S. und der Pflege von an MRSA Lonnemann, R. Diplomarbeit besiedelten / infizierten Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen Tabelle 1: Literaturrecherche KFH, Eigene Darstellung Literaturrecherchen speziell zum Thema „ Entlassungsmanagement MRSA kolonisierter und/ oder infizierter Patienten“ waren ergebnislos. Nach persönlicher Schwiddessen und Kontaktaufnahme Lonnemann, zu den machten Autorinnen diese auf eine Banekdritte Diplomarbeit der KFH zu Thema „MRSA“ aufmerksam. Der Titel lautet, wie folgt: Titel Autor Verlag Wie erlebt ein Patient die Hartmann, C. KFH NW Abtl. Isolation im Krankenhaus Köln, 2004 aufgrund einer Infektion oder Besiedelung mit multiresistenten Staphylococcus aureus? Tabelle 2: Eigene Recherche, Eigene Darstellung 23 In Stiletto`s Arbeit wurde anhand narrativer Interviews mit pflegenden Angehörigen von an MRSA / ORSA besiedelten- und oder infizierten Patienten, ein Wunschkatalog der Angehörigen erstellt.113 Banek- Schwidessen und Lonnemann`s Arbeit behandelt das Thema bezogen auf Alten- und Pflegeheimen und der Inhalt kann nur bedingt auf die häusliche Pflege übertragen werden. Die Arbeit von Hartmann imponiert durch die Offenheit und Betroffenheit der Interviewpartner.114 2.2 Schlagworte Die Eingabe des Schlagwortes „MRSA“ in Google generierte 4454 Treffer. Zur Eingrenzung des Gegenstandes der Untersuchung und um der Forschungsfrage „Wie erleben Betroffene ihre MRSA Kolonisation und oder Infektion in der häuslichen Umgebung“ näher zu kommen, wurden die Suchbegriffe präzisiert. Die Suche erfolgte in deutscher und englischer Sprache. Englische Schlagworte waren: MRSA AND isolation Treffer 1628 MRSA AND isolation AND home care MRSA AND home care 7 14 MRSA AND home care AND costs 1 MRSA AND home care AND desinfection 0 MRS AND home care AND desinfection AND costs 0 MRSA care management 0 MRSA AND care management 0 MRSA AND outpatient 64 MRSA AND outpatient AND costs 0 MRSA (Titel) AND outpatient 8 113 vgl. Stiletto, In: Diplomarbeit zur Erlangung des Grades „Diplom- Berufspädagogin (FH) 2003, Seite 65 114 vgl. Empirischer Teil: Vorgehen anhand der Methode 24 Weitere Recherche erfolgte über die Datenbanken: DIMDI Medline Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information / Kostenfreie Datenbank Zugang erfolgte über http://gripsdb.dimdi.de Carelit Literatur- Informationssystem für Krankenpflege und Krankenwesen / Kostenpflichtige Datenbank Zugang erfolgte über Bibliothek der KFH Köln Cinahl Cumulative Index of Nursing & Allied Health Literature Kostenpflichtige, internationale, pflegespezifische Datenbank Zugang erfolgte über Bibliothek der KFH Köln Medline Alert International, Medizinische Information. Teilweise kostenpflichtige Datenbank Zugang erfolgte über http://www.medpilot.de DAHTA @DIMDI Deutsche Agentur für Health Technology Assessment des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information / Kostenfreie Datenbank Zugang erfolgte über www.dahta@dimdi Digibib.net Digitale Bibliothek / Datenbank: WISO Sozialwissenschaften (GBI) / Kostenfreie Datenbank Zugang erfolgte über http:www.digibib.net Zur weiteren Eingrenzung wurden die gefundenen Studien nach Relevanz für die Thematik geordnet. Datenbank Schlagworte Jahrgang Treffer Relevanz Cinahl Erleben, Isolierung, Studie 1994-2005 119 1 1994-2006 247 1 MRSA Nosokomiale Infektion Hygiene MRSA Ambulante Pflege Überleitungspflege Infektionskrankheit Erreger Carelit Ambulante Pflege MRSA Ambulante Pflege und Infektion ambulante Pflege 25 Medline MRSA Alert MRSA Ambulante Pflege 2000-2006 50 2 2002-2005 9 ----------- 2001-2003 1 1 1987-2000 12 1 MRSA AND outpatient DIMDI MRSA outpatient Isolation of methicillin- resistant Staphylococcus aureus DAHTA MRSA Digibib.net HIV Chronisch Krank Tabelle 3: Relevanzzuordnung der Literaturrecherche ,Eigene Darstellung 2.3 Erste Ergebnisse der Literaturrecherche Nach umfangreicher Literaturrecherche wird deutlich, dass sich die wissenschaftliche Literatur bezüglich des Themas MRSA, überwiegend mit Wirksamkeitsstudien von Antibiotikagruppen befaßt. Daher unrelevant für die vorliegende Arbeit. Des weiteren wurden Studien zur Infektionsprävention auf Intensivstationen gesichtet und ebenfalls unrelevant. Außerdem konnten Studien zur Infektionsbegrenzung in Alten und Pflegeheimen gesichtet werden. Davon war eine Studie relevant, da sie Hinweise zur Versorgung im häuslichen Bereich lieferte. Zudem wurden einige Studien in mehreren Datenbanken gleichzeitig gefunden. Eine Studie zur soziologischen Sichtweise der Thematik konnte gesichtet werden.115 Diese war ebenfalls in mehreren Datenbanken gleichzeitig zu finden. Eine weitere Studie betraf Aidsbehandlung, war aber von Bedeutung, da sie Hinweise auf das Wesen chronischer Erkrankung liefert. Nach erfolgter Zuordnung der Themen sind folgende Studien von Bedeutung für die vorliegende Arbeit: 115 vgl. nachfolgende Tabelle: Relevanz (Cinahl) 26 Datenbank Schlagworte Jahr Cinahl Erleben 1994- Ausnahmezustand Isolierung 2005 Patientinnen Studie Carelit Thema der Studie Autor Relevanz für Bossard et al. 1 und Pflegende Ambulante 2000 MRSA Informationsblätter Niedersächsi Pflege und u. Hygieneblätter 1 sches Landes MRSA Gesundheitsamt Medline MRSA 2003 Methicillin- resistente Neuhaus Alert Ambulante Staphylokokken- In (Deutsches Pflege Altenheimen ebenso Ärzteblatt) 1 häufig vertreten wie in Krankenhäusern 2002 Studie zum Vorkommen von MRSA in Alten- und Lögd Studie NRW Altenpflegeheimen DAHTA MRSA 2001- Bewertung Dettenkofer 2003 unterschiedlicher et al. 1 Hygienekonzepte zur Kontrolle von MRSA Auswertung von 699 wissenschaftlichen Artikeln Tabelle 4: Relevanzzuordnung mit Thema der Studie, Eigene Darstellung Auf ein vom Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd) Münster gefördertes Forschungsprojekt „Hygiene in der ambulanten Pflege“,116 wurde die Autorin durch eine Fachzeitschrift aufmerksam. Nach persönlicher Kontaktaufnahme zum Autor, überließ dieser den unveröffentlichten 116 Abschlußbericht des Forschungsprojektes. Der vgl. Popp et al., In: Hygiene & Medizin 01/ 2006, Seite 45 27 Forschungsbericht steht ebenfalls als Download auf der Homepage des RKI zur Verfügung. Der Literaturliste des Berichtes konnte ein weiterer wichtiger Hinweis auf den Artikel der Autoren Witte et al. entnommen werden. 2.4 Handrecherche Da es sich um ein Hygienethema handelt, wurden Beiträge der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Hygiene und Medizin“ (Jahrgänge 1999-2006) zum Thema „MRSA“ gesichtet. Folgende Fachbeiträge waren für die vorliegende Arbeit von Bedeutung: • 5 Epidemiologische Bulletin (2 relevant für ambulante Betreuung) • Modell Gütersloh • 6 Fachbeiträge zur Klinikhygiene • Nosokomiale Infektionen auf Intensivstationen • Lögd Studie, MRSA Vorkommen in Altenheimen • Lögd Studie, Euregio MRSA- net • Wie erleben Patienten die Isolation im Krankenhaus aufgrund einer Infektion oder Kolonisation mit MRSA (Hartmann) • Hinweis auf relevante, normative RKI Empfehlungen 2.5 Eigenrecherche Die normativen Vorgaben stehen zur Eigenrecherche auf der Homepage des Robert Koch Instituts (RKI) als Download zur Verfügung. • Prävention und Kontrolle von Methicillin- resistenten Staphylococcus aureus- Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen (1999) • Infektionsprävention in Heimen (2005) Die letzte Empfehlung „[...]gilt primär für solche Einrichtungen, in denen medizinische und damit assoziierte pflegerische Maßnahmen außerhalb von Krankenhäusern durchgeführt werden. Sie kann jedoch auch für 28 andere Formen der Betreuung (z.B. Hauskrankenpflege) hilfreich sein“117 Ambulante Pflegedienste haben die relevanten Empfehlungen der beim Robert- Koch- Institut eingerichteten Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention einzuhalten.118 Als da sind: • Händehygiene (2000) • Prävention der nosokomialen Pneumonie (2000) • Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen (1999) • Prävention und Kontrolle von Methicillin- resistenten Staphylococcus aureus- Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen (1999) Außer o.g. RKI Empfehlungen finden bei MDK Prüfungen, Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH): Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären Kranken- und Altenpflege/Rehabilitation“, Berücksichtigung.119 2.6 Einordnung der Fundstücke Nach umfangreicher Recherche werden die Fundstücke nach medizinischer Relevanz, gesetzliche Vorgaben und soziologischen Aspekten geordnet. Priorität bei der Zuordnung erhält die aktuellste Literatur. Medizinische Relevanz Autor MRSA- eine interdisziplinäre Herausforderung, 2006 Quintel, Witte Hygiene in der ambulanten Pflege, 2006 Popp, et al. Jeder Dritte stirbt an einer Infektion, 2006 Panknin Modell Gütersloh, 2006 Bergen Lögd Studie, Euregio MRSA- net (Hrsg.), 2005 Friedrich 117 vgl. RKI Empfehlung 2005, Seite 1061 vgl. Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (MDS) (Hrsg.) Richtlinien /Erhebungsbogen/MDK-Anleitungen 2005, Seite 102 119 vgl. MDS 2005, Seite 104 118 29 Eine Herausforderung für die Dermatologie, 2005 Witte, et al. Der Einfluß von MRSA auf die deutsche Wernitz, Veit Volkswirtschaft, 2005 Prävention und Kontrolle von MRSA, 2005 Kischke MRSA- Sceening auf der Intensivstation, 2005 Huggert Epidemiologisches Bulletin, .5/ 2004 RKI Epidemiologisches Bulletin, 19/ 2003 RKI Methicillin-resistente Staphylokokken in Altenheimen Neuhaus et al. ebenso häufig vertreten wie in Krankenhäusern, 2003 Studie zum Vorkommen von MRSA in Alten- und Neuhaus. Altenpflegeheimen, 2002 Pneumonien im Krankenhaus, 1985 Vogel, Exner Gesetzliche Vorgaben Infektionsprävention in Heimen, 2005 Autor RKI Richtlinien /Erhebungsbogen/MDK-Anleitungen, 2005 MDS (Hrsg.) Händehygiene, 2000 RKI Prävention und Kontrolle von Methicillin- resistenten RKI Staphylococcus aureus- Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen, 1999 §33 SGB V Neubert, Robbers §§ 114 Abs. 3 SGB XI Neubert, Robbers § 40 Abs. 2 SGB XI Neubert, Robbers Soziologische Aspekte Autor Erhebung der Bildungsanforderung des BanekSchwidessen, Lonnemann Pflegepersonals bezüglich der Pflege von an MRSA besiedelten/ infizierten Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen, 2005 Wie erleben Patienten die Isolation im Krankenhaus Hartmann aufgrund einer Infektion oder Kolonisation mit MRSA, 30 2004 Education pflegender Angehöriger von MRSA/ORSA Stiletto Patienten, 2003 Ausnahmezustand für Patientinnen und Pflegende, Bossard et al. 2003 Chronisch Kranksein, 2002 Lubkin Die Qualität der pflegerischen Beziehung, 2001 Hulskers Tabelle 5: Fundstückzuordnung der Studien, Eigene Darstellung 2.7 Literaturanalyse Im Anschluß an die Literaturrecherche erfolgt die Analyse der geordneten Literatur. Nach Abschluß der Analyse kristallisieren sich drei große Themenbereiche heraus, die für das Forschungsinteresse zum Erleben und Erfahrungen von Betroffenen mit MRSA in der häuslichen Umgebung von Bedeutung sind. Der Begründungzusammenhang zu den Fragestellungen in den Interviews wird im empirischen Teil, unter „Durchführung der Interviews“, ausführlicher beschrieben. Beispielhaft seien hier genannt: 1. Information zur Erkrankung • Mangel an Erklärungen sind die meist genannten Ursachen für Angst, Furcht und Ärger120 2. Information zu Schutzmaßnahmen und Händedesinfektionsmitteln • Händedesinfektionsmittel gelten als Nichtarzneimittel und stellen kein Hilfsmittel dar121 3. Sozialkontakte 3.a Familienleben / Alltagssituation • Mangelnder sozialer Austausch durch Isolation, belastet Patienten und Angehörige122 • Isolation wird als belastendes Gefühl des Alleinseins empfunden123 120 vgl. Hulskers 2001, Seite 41 vgl. §§ 33 SGB V 122 vgl. Bossard et al. 2003, Seite 22 123 vgl. Lubkin 2002, Seite 293 121 31 3.b. Sozialkontakte, Reaktionen Außenstehender • Wegen der Schutzkleidung kommen einige Besucher nicht oder bleiben nur kurz124 124 vgl. Hartmann 2004, Seite 154ff 32 2.8 Zusammenfassung der Literaturrecherche Nach umfangreicher Literaturrecherche können nur wenige Studien bezogen auf das Erleben und die Erfahrungen MRSA Betroffener in der häuslichen Umgebung gesichtet werden. Der überwiegende Teil der Studien zum Themenbereich MRSA befaßt sich mit Wirksamkeitsstudien verschiedener Antibiotika und Forschungen im Bereich der Infektionsprävention. Im Abschluß an die Literaturrecherche werden die Fundstücke nach klinischer Relevanz, normativen Vorgaben und soziologischen Aspekten geordnet. Nach erfolgter Literaturanalyse kristallisieren sich drei große Themenbereiche heraus, die für das Forschungsinteresse von Bedeutung sind. Die Themenbereiche wie Information zur Erkrankung, Information zu Schutzmaßnahmen und Sozialkontakte, finden sich im Interviewleitfaden wieder, der im empirischen Teil näher beschrieben wird. 33 II Empirischer Teil 3 Definition Empirische Sozialforschung (soziologisch) Empirische Sozialforschung ist gemäß der Definition Atteslanders „die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen. Empirisch bedeutet, dass theoretisch formulierte Annahmen an Spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden. Systematisch weist darauf hin, dass dies nach Regeln zu geschehen hat. Theoretische Annahmen und die Beschaffenheit der zu untersuchten sozialen Realität sowie die zur Verfügung stehenden Mittel bedingen den Forschungsablauf. Unter der Methode der empirischen Sozialforschung versteht man die geregelte und nachvollziehbare Anwendung von Erfassungsinstrumenten, wie: Befragung, Beobachtung, Inhaltsanalyse.“125 Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit gliedert sich in: • Historische Entwicklung der qualitativer Sozialforschung • Vorgehen anhand der Methode • Darstellung der Ergebnisse Historische Entwicklung der qualitativer Sozialforschung Hier wird die Zielsetzung und Vorgehensweise qualitativer Sozialforschung dargelegt. Zunächst wird die historische Entwicklung der Forschung vorgestellt. Dabei bezieht sich die Autorin im wesentlichen auf Aussagen der Autoren Flick und Lamnek. Vorgehen anhand der Methode Bezogen auf die Forschungsfrage: „Wie erleben Betroffene ihre MRSA Kolonisation und oder Infektion in der häuslichen Umgebung?“, wird die methodische Vorgehensweise qualitativer Sozialforschung durch praktische Beispiele untermauert. Somit wird der wissenschaftliche Anspruch des Begründungszusammenhangs126 zwischen theoretischem Hintergrund und praktischer Umsetzung hergestellt. Dem Leser wird so 125 126 Kuckartz, In: Einführung in die sozialwissenschaftliche Statistik 2006 vgl. Axmacher 1991, Seite 121 34 leichtere Orientierung und schnellere Übertragbarkeit auf das Alltagserleben ermöglicht. Das Vorgehen anhand der Methode wird in der Vergangenheit beschrieben. Darstellung der Ergebnisse Nachdem die Definition empirischer Forschung aus philosophischer Sicht dargelegt wird, werden die aus den Interviews resultierenden Kategorien vorgestellt. Warum welche Kategorie ausgewählt wurde, wird anhand eines Ankerbeispieles belegt. Das Ankerbeispiel ist eine konkrete Textstelle, die für die entsprechende Kategorie als besonderes Beispiel gilt. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die gefundenen Unterkategorien übergeordneten Hauptkategorien zugeordnet. 3.1 Historische Entwicklung der qualitativen Sozialforschung Zunächst setzen sich in der historischen Entwicklung der Sozialforschung die „härteren“, experimentell und quantifizierend konzipierten Ansätze, gegen die „weichen“, verstehenden, offenen und qualitativ- beschreibenden Ansätze durch. Die qualitative Forschung soll dem Forschungsgegenstand in stärkerem Maße gerecht werden, als es in der quantitativen Forschung möglich ist.127 Qualitative Sozialforschung beschäftigt sich, neben der Verwendung von Texten, mit Konstruktionen von Wirklichkeiten. Mitte der 1980er Jahre entwickelte sich qualitative Forschung „ zu einem kontinuierlichen Prozeß der Konstruktion von Versionen von Wirklichkeiten“.128 Gemeint ist, dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit entwickelt und entsprechend sein Erleben interpretiert. Der Interviewte erzählt möglicherweise sein Erleben dem Interviewer anders, als er es einem anderen Interviewer, in einem anderen Fragekontext erzählt hätte. Der Interviewer interpretiert das Gehörte so, wie es in seine konstruktivistische Sichtweise paßt. Der Leser 127 128 vgl. Flick 2005, Seite 22 Flick 2005, Seite 24 35 interpretiert das Gelesene ebenso wie er es in „seiner Wirklichkeit“ empfindet und versteht.129 Systemtheoretische Ansätze sprechen in diesem Zusammenhang von autopoetischen Prozessen und dass jeder Mensch in seinen, ihm eigenen Wirklichkeitskonstruktionen seine Welt, sein Erleben, seine Krankheit und Gesundheit interpretiert.130 Soziologische Entwicklung der Sozialforschung Ausgehend vom Symbolischen Interaktionismus werden verschiedene alternative und aktuellere Strömungen aufgegriffen und interpretiert.131 Phänomenologie → im Sinne Heideggers Strukturalistische Denkweisen → im Sinne Foucault Feministische und postmoderne Wissenschaftskritik → Ansatz von Geertz (1973). Laut Denzin, ist das Ziel des Interpretativen Interaktionismus, die gelebten Erfahrungen dem Leser zugänglich zu machen.132 Psychologische Entwicklung der Sozialforschung Psychologische Forschung geht davon aus, dass jedes Individuum, ähnlich wie der Wissenschaftler, Theorien über das Funktionieren der Welt entwickelt, diese im Rahmen des eigenen Handelns anwendet, überprüft und ggf. korrigiert. Dabei steht der Gedanke der qualitativen Sozialforschung zu einem großen Teil auf der Konzentration der Sicht des Subjektes und dem Sinn, der mit Erfahrungen und Ereignissen verbunden wird. Sowohl die Erforschung subjektiver Sichtweisen, als auch der theoretische Hintergrund des Symbolischen Interaktionismus stellen einen Teil des Feldes qualitativer Forschung dar.133 Neuere psychoanalytische Forschung ist bestrebt, das Unbewußte, sowohl in der Gesellschaft als auch im Forschungsprozeß, aufzudecken. Dazu dient die Analyse des Forschungsprozesses und die Beziehung des 129 vgl. a.a.O., Seite 25 vgl. Simon 2001, Seite 16 131 vgl. Flick 2005, Seite 36ff 132 vgl. Denzin 1989a,Seite 10, In: Flick 2005, Seite 37 133 vgl. Flick 2005, Seite 38 130 36 Forschers zu denjenigen, die interviewt oder beobachtet werden, um herauszufinden, wie die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtsein funktioniert.134 3.2 Herstellung sozialer Wirklichkeiten Wenn nach der Art und Weise gefragt wird, wie Menschen in interaktiven Prozessen ihre sozialen Wirklichkeiten herstellen, wird die Begrenzung auf das Subjekt theoretisch und methodisch überschritten. Soziale Wirklichkeiten, und somit gute Interviews, wird in der Lebenswelt der betroffenen Menschen hergestellt. In Situationen, die ihnen fremd und unangenehm sind, sollte kein Interview stattfinden.135 Neuere Entwicklungen in den Sozialwissenschaften stellen die Frage, ob das Interesse an Texten, die zu Interpretationszwecken erstellt wurden, nicht nur den Forschern dient, sondern auch den Untersuchten. Denn diese werden im interpretierten Text schließlich zum Thema.136 Der Ansatz der „sozialen Repräsentation“ wird zunehmend als theoretischer Rahmen für qualitative Analysen genutzt, die sich mit der sozialen Konstruktion von Phänomenen wie Gesundheit und Krankheit beschäftigen. Methodisch können verschiedene Formen des Interviews und teilnehmende Beobachtung verwendet werden. 4 Gütekriterien nach Mayring Es kann nicht genügen, wenn der Forscher „gültige Interpretationen“ der untersuchten Gruppe erbringt, es müssen auch Regeln entwickelt werden, nach denen anderen Forschern möglich ist, diese Interpretationen zu überprüfen.137 Mayring zerlegt in seiner qualitativen Inhaltsanalyse einzelne, zuvor festgelegte Interpretationsschritte. Dadurch wird die Analyse für andere Forscher überprüfbar, nachvollziehbar und auf andere 134 a.a.O, Seite 44 vgl. Lamnek 2005, Seite 388 136 vgl. Flick 2005, Seite 45 137 vgl. Lamnek 2005, Seite 146 135 37 Gegenstände übertragbar. Somit wird sie zur wissenschaftlichen Methode.138 Mayring verzichtet auf die klassischen Gütekriterien wie Validität und Reliabilität und empfiehlt sechs weitere Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung.139 1.Verfahrensdokumentation Die Verfahrensdokumentation ist eine sehr detaillierte und weitgehende Darstellung des Vorgehens, um den Forschungsprozeß intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. Dargestellt werden Erhebungsverfahren, Daten von Interviews oder Beobachtungen, Aufzeichnung und Transkription von Texten, sowie deren Analyse.140 2. Argumentative Interpretationsabsicherung Die Interpretation muß in sich schlüssig und Brüche erklärt werden, Alternativdeutungen sind zu suchen und zu überprüfen. Argumentative Interpretationsabsicherung ist wichtig, weil qualitativer Sozialforschung aus quantitativer Perspektive häufig Willkür oder Beliebigkeit unterstellt wird.141 3. Regelgeleitetheit Nach Mayring muß sich „auch qualitative Forschung an bestimmte Verfahrensregeln halten, systematisch ihr Material bearbeiten“. 142 Lamnek konstatiert, das die geforderte Systematisierung möglicherweise manchem Forscher zu weit geht, da sie Offenheit und Flexibilität tendenziell reduziert.143 4. Nähe zum Gegenstand Qualitative Forschung sollte daraufhin überprüft werden, ob sie auf die 138 vgl. Mayring 2005, Seite 11ff vgl. Mayring 2002, In: Lamnek 2005, Seite 146 140 vgl. Lamnek 2005, Seite 146, vgl. Flick 2005, Seite 117 141 vgl. Lamnek 2005, Seite 147 142 Mayring 2002, Seite 104, In Lamnek 2005, Seite 147 143 vgl. Lamnek 2005, Seite 147 139 38 natürliche Lebenswelt der Betroffenen gerichtet ist und deren Interessen einbezogen sind. Daher ist die Nähe zum Gegenstand ein methodologisches Grundprinzip qualitativer Forschung.144. 5. Kommunikative Validierung Analyseergebnisse können auf Wahrheit und Gültigkeit hin überprüft werden, indem die Interviewpartner mit den Auswertungsergebnissen konfrontiert werden. Was die Absicherung der „Rekonstruktion subjektiver Bedeutung angeht, werden aus diesem Dialog wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse“ gewonnen.“ 145 6. Triangulation Triangulus, dreieckig ; Dreieck, ist einer aus der lat. Bildung » tres « drei und lat. » angulus « Winkel, Ecke “, entlehnt.146 Denzin (1978) begrenzt den Begriff nicht auf drei Lösungsmöglichkeiten, sondern seiner Meinung nach soll versucht werden, mit Hilfe verschiedener Methoden, Theorieansätze, Interpreten, Datenquellen etc, Phänomene umfassender, abgesicherter und gründlicher zu erfassen. Für Lamnek macht die Schwierigkeit des Qualitätsmaßstabes aus, daß die Übereinstimmung verschiedener Befunde und Interpretationen nicht immer gegeben ist.147 5 Datenerhebung 5.1 Das Interview als Instrument qualitativer Forschung Zur Herstellung möglichst natürlicher Situationen und dem Erhalt authentischer Informationen eignen sich qualitative Interviews.148 Nach Flick wird qualitative Sozialforschung weniger an der Interviewtechnik und Interpretationsverfahren, als an der spezifischen Offenheit und Reflexivität des Forschers festgemacht. Damit sich der Forscher und seine Forschung 144 vgl.a.a.O, Seite 147 Mayring 2002, Seite 106, In: Lamnek 2005, Seite 147 146 Herkunftswörterbuch 2001, Seite 606 147 vgl. Lamnek 2005, Seite 147 148 vgl. a.a.O., Seite 329ff 145 39 nicht um die Entdeckung des tatsächlich Neuen bringt, sollte er die Haltung einer „gleichschwebende Aufmerksamkeit“, einnehmen.149 „[...] folgt man bei der Auswahl seinen Erwartungen, so ist man in der Gefahr, niemals etwas anderes zu finden, als man bereits weiß, folgt man seinen Neigungen, so wird man sicherlich die mögliche Wahrnehfälschen.“ 150 Das Interviewgespräch verläuft üblicherweise in drei Phasen. In der Einstiegsphase werden Angaben zur eigenen Person gemacht und das Gespräch beginnt mit einer Einstiegsfrage. Die Hauptphase ist geprägt von einer Erzählphase und Fragen nach der zentralen Problematik. Die Abschlußphase schließt mit Dank und Erläuterung der weiteren Vorgehensweise ab. 5.2 Formen des qualitativen Interviews Es lassen sich verschiedene Formen des qualitativen Interviews unterscheiden, beispielhaft seien hier genannt: Fokussiertes Interview: Die älteste Form qualitativer Interviews und von Merton und Kendall (1956) zu einer quasi eigenständigen Forschungsmethode Forschungsmethode weiterentwickelt, ist das fokussierte Interview. Der Forscher erstellt aufgrund seiner Felderfahrung einen Interviewleitfaden und konfrontiert damit den Teilnehmer.151 Tiefen- oder Intensivinterview Eine von Koolwijk (1974) entwickelte Interviewtechnik, die durch tiefliegende Motivstrukturen des Befragten, Wirklichkeitsstrukturierung aufzeigen soll, die dem Befragten nicht bewußt sind. Die Deutung der 149 vgl. Flick 2005, Seite 69ff Flick 2005, Seite 70 151 vgl. Lamnek 2005, Seite 368ff, vgl. Flick 2005, Seite 118ff 150 40 Aussagen geschieht eher im Sinne des Forschers und seines theoretischen Ansatzes, z.B. in der Psychoanalyse.152 Narratives Interview Ein von Schütze (1977) aus der Biographieforschung entwickeltes offenes Interviewverfahren. Es läßt Orientierungsmuster des Handelnden erkennen, da die Erzählungen auf retrospektivischer Interpretation aus Sicht des Handelnden beruhen.153 Problemzentriertes Interview Witzel (1985) hat ein Interviewverfahren entwickelt, das einen Problembereich mit Hilfe verschiedener Methoden betrachtet und analysiert. Nach Lamnek wird beim problemzentrierten Interview, ebenso wie beim narrativen Interview, der Befragte zu Gesprächsbeginn gebeten zu erzählen. Hier ist eine Vertrauensatmosphäre als Voraussetzung unabdingbar. Das wissenschaftlich Problemzentrierte bestehenden Interview Konzept. Die beruht auf einem Vorgehensweise ist halbstrukturiert, kommt dem offenen Gespräch nahe und ist zentriert auf die Problemstellung ausgerichtet. Als Kommunikationsstrategie werden der Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierung, spezifische Sondierung und Ad-hoc-Fragen genannt. Ein vorgeschalteter Kurzfragebogen soll dazu beitragen, dass der vom Befragten entwickelte Erzählstrang zum Tragen kommt.154 Episodisches Interview Das von Flick (1995) entwickeltes Verfahren ist eine Kombination aus Narration und Befragung.155 Hier ist der Ausgangspunkt die Annahme, dass Erfahrungen der Subjekte hinsichtlich eines bestimmten Gegenstandsbereiches in Form narrativ-episodischem Wissen und in Form semantischem Wissen abgespeichert und erinnert werden.156 Im 152 vgl. Lamnek 2005, Seite 371ff vgl. Lamnek 2005, Seite 357ff, vgl. Flick 2005, Seite 191 154 vgl. Lamnek 2005, Seite 363ff, vgl. Flick 2005, Seite 34ff 155 vgl. Lamnek 2005, Seite 362 156 vgl. Flick 2005, Seite 158ff 153 41 richtigen Moment werden Erzählungen stimuliert und nachgefragt. Dabei wird die Phantasie des Betroffenen angesprochen und angeregt. 42 6 Vorgehen anhand der Methode 6.1 Forschungsethik In der Helsinki Deklaration wird unterschieden zwischen therapeutischer und nicht therapeutischer Forschung. Während therapeutische Forschung dem Patienten eine experimentelle Behandlung bietet, wird therapeutische Forschung durchgeführt, um Wissen für eine Disziplin zu generieren, wovon möglicherweise zukünftige Patienten profitieren.157 Die letzt genannte Forschungsart, beinhaltet folgende Prinzipien: • Der Forscher muß Leben, Gesundheit, Privatsphäre und Würde der Probanden schützen • Der Forscher muß größte Sorgfalt walten lassen, um die Teilnehmer vor Schaden zu bewahren • Bei der Forschung muß die Bedeutung der Zielsetzung, möglichen Risiken der Teilnehmer überwiegen.158 6.2 Interviewtechnik Die Kombination aus problemzentriertem und episodischem Interview wird in der Literatur nicht explizit beschrieben. Als Kommunikationsstrategie werden Frage-Antwort-Sequenzen und Erzählungen miteinander verbunden. Da der Gegenstand der Forschung die Methode bestimmt, eignet sich die Kombination beider Interviewformen zur Befragung MRSA Betroffener. In Form eines Alltagsgespräches begab sich die Autorin auf die Ebene der Interviewpartner, ohne die professionelle Distanz zu verlieren. Mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen wurden während der Interviews beide Interviewtechniken im Wechsel angewandt. 157 158 vgl. Burns, Grove 2005, Seite 186 vgl. a.a.O., Seite 186 43 Fragestellungen mit Anteilen des problemzentrierten Interviews erhielten die Kennzeichnung → PI Fragen mit Anteilen des episodischen Interviews erhielten die Kennzeichnung → EI 159 Die Äußerungen weitere Anwesenden beim Interview, erhalten zur besseren Unterscheidung eine kursive Kennzeichnung (in Interview A und E ist dies die Ehefrau, in Interview F der Ehemann, in Interview G der Sohn). Eine Ausnahme bildet Interview B. Hier übersetzt die Enkelin für ihre türkische Großmutter. Da die Großmutter hin und wieder deutsche Gesprächsbeiträge liefert, werden nur ihre Aussagen gekennzeichnet. 6.3 Rolle und Fähigkeiten des Interviewers Der Interviewer hat die Rolle eines professionellen Fremdens inne, welcher in das Untersuchungsfeld zum soziologischen Lernprozeß einsteigt. Dabei sollte der Forscher versuchen, das Fremde zu erreichen, damit die Forschungssubjekte etwas erzählen können, was für den Forscher neu ist.160 Der Forscher soll sowohl involviert und als auch distanziert sein und über große Geduld und Toleranz für ungewisse Aussagen verfügen. Dabei soll das Vorverständnis über die zu untersuchende Gegebenheit als vorläufig angesehen werden und mit neuen, nicht übereinstimmenden Informationen überwunden werden.161 Der Erfolg qualitativer Forschung hängt wesentlich von der Klarheit der Formulierung der Fragestellungen ab. Je unklarer die Fragestellungen formuliert sind, desto eher besteht die Gefahr, dass eine Menge Daten produziert werden, vor denen der Forscher bei der Interpretation relativ hilflos steht.162 Ziel soll sein, dass der Forscher eine klare Vorstellung über seine Fragestellung entwickelt und dabei offen bleibt für neue und bestenfalls überraschende Erkenntnisse. Über folgende Fähigkeiten sollte 159 vgl. Anhang A vgl. Flick 2005, Seite 93 161 vgl. Lamnek 2005, Seite 580 162 vgl. Flick 2005, Seite 76ff 160 44 der Interviewer verfügen:163 163 vgl. a.a.O., Seite 87 45 • Fähigkeit zur Kommunikation und Herstellung von Beziehungen • Fähigkeit zur Aushandlung von Nähe und Distanz zum Untersuchten, der Offenlegung, Transparenz und Aushandlung wechselseitiger Erwartungen, Ziele und Interessen • Fähigkeit zur Ausbalancierung des Spannungsfeldes von Vertrautheit und Fremdheit Die Sicht des Subjektes kann in verschiedener Hinsicht rekonstruiert werden. Im Hinblick auf die Intention der Befragung werden bei dem Befragten einerseits Informationen abgerufen, die den Forscher interessieren und andererseits kann der Interviewer Informationslieferant sein.164 So können z.B. Hygienefragen, die sich während des Interviews ergeben und für den Betroffenen von Bedeutung sind, anschließend bearbeitet werden und die Beantwortung dem Betroffenen später mitgeteilt werden. 6.4 Samplingstrategie Wörtliche übersetzt bedeutet „sampling“ Stichprobenerhebung.165 Nach Lamnek richtet sich die Auswahl der Interviewpartner nach den Kriterien des Theoretical Sampling. „[...] Da es nicht um Repräsentativität sondern um typische Fälle geht, werden keine Zufallsstichproben gezogen. Man sucht sich nach seinen Erkenntnisinteressen einzelne Fälle für die Befragung aus. Da die Suche interessengeleitet erfolgt, ist eine weitgehende Selbstkontrolle des Forschers insoweit erforderlich, als er vermeiden muß, durch seine (theoretischen) Vororientierungen eine verzerrte, weil untypische, Auswahl vorzunehmen.“ 166 Flick differenziert zwischen theoretischem und statistischem Sampling. Einer der Unterschiede ist, dass beim statistischen Sampling die Stichprobengröße vorab definiert ist.167 Für die Untersuchung der vorliegenden Arbeit wurden keine Stichproben gezogen. Hier handelt es 164 vgl. Lamnek 2005, Seite 332 vgl. PONS 2003, Seite 1044 166 Lamnek 2005, Seite 386 167 vgl. Flick 2005, Seite 105 165 46 sich um eine reine Untersuchungsteilnehmer Einschlußkriterien zu den Zufallsuntersuchung, Kriterien entsprechen der hatten.168 wobei vorher Die die festgelegten Quantität der Interviewpartner tritt in den Hintergrund, da qualitative Interviews höhere Kompetenz als standardisierte Befragungen vom Interviewer erfordern.169 Für die vorliegende Untersuchung wurden fünf Frauen und drei Männer ausgewählt, die Erfahrungen mit einer MRSA Besiedelung und oder Infektion in der häuslichen Umgebung gemacht haben. Da eine Betroffene der Aufzeichnung nicht zustimmte, wurde dieses Interview aus Mangel an Interviewpartnern als Pretest gewertet. Die Ergebnisse des Pretestes flossen nicht mit in die Analyse ein. 6.5 Ein- und Ausschlußkriterien Mit dem Ausdruck Feldzugang, ist der Zugang zum untersuchenden Feld gemeint. Mit „Feld“ kann eine bestimmte Institution, eine Familie oder eine Gruppe von „Biographieträgern“ sein. In der vorliegenden Untersuchung sind es Betroffene, die mit einer MRSA Besiedelung –und/ oder Infektion in ihrer häuslichen Umgebung leben. Zur Akquise von Interviewpartnern, werden folgende Ein- und Ausschlußkriterien festgelegt: Einschlußkriterien Ausschlußkriterien • Erfahrungen mit MRSA • Fehlende Erfahrung mit Infektion oder Kolonisation in MRSA Infektion oder der häuslichen Umgebung Kolonisation in der häuslichen Umgebung • Betreuung in der häuslichen • Entlassung direkt nach Umgebung Hause • Eingewöhnung in der • Keine häuslichen Umgebung Teilnahmezustimmung • Erinnerungsfähigkeit • Fehlende Erinnerung • Demenzerkrankung 168 169 vgl. 6.5 Ein-und Ausschlußkriterien vgl. Lamnek 2005, Seite 356 47 6.6 Akquise der Interviewpartner Schneeballprinzip Die Suche erfolgte im Raum NRW durch Bekannt machen des Forschungsthemas im klinischen Bereich und durch Mundpropaganda der Berufskollegen. Diese wurden aus Datenschutzgründen gebeten, MRSA kolonisierte oder infizierte Patienten zu fragen, ob sie bereit sind, an einem Interview teilzunehmen. Bei deren Zustimmung wurden die Namen der Forscherin mitgeteilt, die sich dann mit den Betroffenen in Verbindung setzte. Auf diesem Wege konnten zwei Interviewpartner rekrutiert werden. Die Mehrzahl der Betroffenen befand sich entweder in schlechtem Allgemeinzustand oder waren dement, um an einem Interview teilnehmen zu können. Zeitungsinserat In der örtlichen Presse wurde ein Inserat aufgegeben (siehe Anhang A), allerdings erfolglos. Aus der Distanz heraus betrachtet, ist der mangelnde Erfolg nicht weiter erstaunlich, da sich während der Interviews herausstellte, dass der Begriff „MRSA“ weitgehend unbekannt ist. Vielmehr wird der Ausdruck „Keim“ von den Betroffenen benutzt. Ambulante Pflegedienste Ambulante Pflegedienste wurden kontaktiert, mit der Bitte MRSA kolonisierte oder Interviewteilnahme infizierte Patienten zustimmen. Auf zu diesem fragen, Wege ob sie einer konnten zwei Interviewpartner akquiriert werden. Sozialarbeiter Mehrmalige Nachfragen bezüglich der Interviewpartnersuche bei zwei Sozialarbeitern waren erfolglos. Kommilitonen Eine von achtundzwanzig Kommilitonen stellte den Kontakt zu einer Wundmanagerin her, die zwei Interviewpartner rekrutierte, wovon eine Betroffene die Aufzeichnung ablehnte. Hausarzt Durch Information eines Hausarztes über Forschungsabsichten konnten zwei Interviewpartner gewonnen werden. 48 6.7 Untersuchungsgruppe Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte im Raum Nordrhein-Westfalen nach den genannten Einschluss- und Ausschlusskriterien. Die Untersuchungsgruppe setzt sich zusammen aus vier weiblichen und drei männlichen Interviewpartnern, im Alter zwischen 60 und 85 Jahren. Sechs Interviewpartner sind Rentner, ein Teilnehmer Frührentner. Fünf Betroffene sind verheiratet, eine Betroffene verwitwet und eine weitere Betroffene ist alleinstehend. Zwei Interviewpartner hatten zum Interviewzeitpunkt eine MRSA Infektion in der Wunde, mit der Diagnose „Diabetes Fußsyndrom“ und „Ulcus cruris“. Eine Interviewpartnerin hatte eine MRSA Infektion in der Bauchwunde, eine andere Betroffene war MRSA Dauerausscheider. Drei Betroffene waren zum Interviewzeitpunkt saniert, hatten aber in der Vergangenheit Erfahrungen mit MRSA in der häuslichen Umgebung gemacht. 6.8 Durchführung des Interviews Die Interviewpartner wurden zur Terminabsprache telefonisch kontaktiert. Sechs Interviews fanden im persönlichen Umfeld der Betroffenen statt, ein Interview in einer Großstadtklinik in NRW. Jedem Interviewteilnehmer brachte die Autorin als Dank für die Interviewbereitschaft ein kleines Präsent mit, was deutlich zur Vertrauensbildung beitrug. Alle Interviews beruhten auf Freiwilligkeit und der Zusage, das Interview jederzeit abbrechen zu können. Zu Beginn des Gesprächs erhielten die Interviewpartner ein Schreiben, mit der Zusicherung der Anonymisierung ihrer Daten.170 Eine Interviewpartnerin lehnte trotz dieser Erklärung die Aufzeichnung ab, aus Sorge vor Repressalien bei erneuter Klinikeinweisung. Ein weiterer Interviewpartner bestand während des Interviews auf Abschalten des Gerätes. 170 vgl. Anhang A 49 Bei fünf Interviews waren Familienangehörige anwesend, was aber keineswegs eine Störung darstellte. Das Interview, welches in der Klinik stattfand, war nicht ungestört. Kurzfragebogen Bei dem Kurzfragebogen handelt es sich um ein erstes Medium der Datenerhebung- und Erfassung. Die Autorin hat auf einen Kurzfragebogen verzichtet, da Informationen bezüglich des sozialen Hintergrundes unverzüglich nach jedem Interview in einer Checkliste zum Postskript dokumentiert wurden.171 6.8.1 Interviewleitfaden Pretest Ob der Interviewleitfaden den kognitiven Anforderungen des Befragten entspricht, wird in einem sogenannten „kognitiven Interview“ beim Pretest ermittelt. Hierbei handelt es sich um einen Leitfaden, der nach evtl. Evaluation für die übrigen Befragungen herangezogen wird.172 Die Ergebnisse des Pretests (Interview D) flossen nicht mit in die Analyse und Auswertung ein, daher erscheinen im Ergebnisteil nur Aussagen der Interviewteilnehmer A, B, C, E, F, G und H. Im Anschluß an den Pretest wurde eine leichte Korrektur des Interviewleitfadens vorgenommen.173 Fragestellungen Die Fragestellungen erwachsen häufig aus der persönlichen Biographie des Forschers, seinem sozialen Kontext oder Berufsalltag.174 Die Entscheidung für oder gegen bestimmte Fragestellungen tragen zur Reduktion der Vielfalt und zur Strukturierung des Untersuchungsfeldes bei. 171 vgl. Anhang A vgl. Prüfer, Rexroth 2005, Seite 3 173 vgl. Anhang A 174 vgl. Flick 2005, Seite 78ff 172 50 Forschungsgegenstand Der Forschungsgegenstand ist das Erleben und die Erfahrungen mit einer MRSA Infektion und/ oder Kolonisation in der häuslichen Umgebung. Um den Fragenkatalog nicht zu eng zu gestalten, werden die Fragen verschiedenen Themenbereichen zugeordnet.175 Da der Gegenstand der Forschung die Methode bestimmt, ist als Forschungsinstrument das Problemzentrierte Interview Mittel der Wahl. Gleichzeitig soll dem Betroffenen auch die Möglichkeit gegeben werden, kontextbezogene Darstellungen in Form von Erzählungen weiterzugeben. Dazu eignet sich das episodische Interview.176 In der vorliegenden Untersuchung wurden beide Interviewformen miteinander verknüpft und neben den problemgerichteten Fragen erfolgte immer wieder die Aufforderung zu erzählen. 6.8.2 Interviewvorgehen Bezogen auf die Forschungsfrage: „Wie erleben Betroffene ihre MRSA Kolonisation und oder Infektion in der häuslichen Umgebung?“, sollen nachfolgende Fragestellungen Aufschluß geben. Da Pflegewissenschaft dem Begründungszwang unterliegt177, werden die Fragestellungen literaturgestützt begründet. Mögliche Fragen, die während des Interviews gestellt wurden, werden bei der Interviewform des Problemzentrierten Interviews mit PI, die des Episodischen Interviews, mit EI gekennzeichnet. Einstiegsphase: In diesem Interview werde ich Sie immer wieder darum bitten, mir Situationen zu erzählen, in denen Sie bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse mit Ihrer MRSA Besiedelung – und oder Infektion gemacht haben (EI). 175 vgl. Anhang A vgl. Flick 2005, Seite 191 177 vgl. Axmacher 1991, Seite 121 176 51 Begründungszusammenhang zur Erzählaufforderung: Ziel des episodischen Interviews ist es, Erfahrungen in allgemeiner, vergleichender Form darzustellen und gleichzeitig entsprechende Situationen und Episoden zu erzählen.178 Das Krankheitserleben und die Bewältigungsformen sind individuell, denn persönliche Biographie und soziale Gegebenheiten wirken darauf ein.179 Gesprächseinstieg → Beschreiben Sie Ihre Krankheit (PI) Allgemeine Sondierung → Erzählen Sie doch bitte, was hat Ihnen der Arzt zu Ihrer Krankheit gesagt? (PI) → Können Sie sich an eine bestimmte Situation erinnern? (EI) Begründungszusammenhang zur den Fragestellungen Ärztlicher Kontakt ist für Betroffene wichtig, um genügend Informationen zu erhalten und um Fragen stellen zu können. Dadurch kann Vertrauen aufgebaut werden.180 Laut Bott ist der Erwerb von ausreichendem Wissen über die Therapieanforderung die Voraussetzung für eine erfolgreiche eigenverantwortliche Therapie.181 Hulstert beschreibt, dass Erklärungsmangel die meist genannten Ursache, für Angst, Furcht und Ärger sind.182 Erfahrungen, die im „Patient Learning Center“ in Bosten/ USA, gemacht wurden, zeigten, das Patienten, die über ihre Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten informiert wurden, motivierter sind an ihrem Gesundheitsprozeß aktiv mitzuarbeiten und schneller genesen.183 Hauptphase – Erzählphase In der Hauptphase wird nach der zentralen Problematik gefragt. Dabei fragt der Interviewer nach, faßt zusammen und spiegelt dem 178 vgl. Flick 2005,Seite 160 vgl. Simon 2001, Seite 14ff 180 vgl. Hartmann 2004, Seite 154 181 vgl. Bott 2000, In: Stiletto 2003, Seite 15 182 vgl. Hulskers 2001, Seite 41 183 vgl. Abt-Zegelin 09/ 1997 und 01/ 2000 179 52 Interviewpartner seine Auffassungen. Auch hier wird der Betroffene immer wieder dazu angeregt, sich an bestimmte Situationen zu erinnern. Bei entsprechender Gelegenheit werden Ad-hoc Fragen; Rückmeldungen; Interpretationen und Verständnisfragen seitens des Interviewers gestellt. Dies dient dem Verständnis des Interviewers.184 • Erzählen Sie mir doch bitte Ihren Tagesablauf. Wann und wo hat dabei Ihre MRSA Besiedelung oder Infektion eine Rolle gespielt? (EI) • Ad-hoc-Frage → Hat Ihnen in dieser Situation etwas gefehlt? (PI) • Habe ich das richtig verstanden, hat Ihnen der Arzt nicht gesagt, ob Sie Schutzmaßnahmen anwenden sollen? (PI) Fällt Ihnen dazu eine Geschichte ein, in der Sie sich Rat gewünscht hätten? (EI) Begründungszusammenhang zu o.g. Fragestellungen Gemäß fünftem Sozialgesetzbuch gelten u.a. Händedesinfektionsmittel als Nicht- Arzneimittel und stellen kein Hilfsmittel dar.185 Folglich werden Händedesinfektionsmittel nicht rezeptiert und sind von den Betroffenen selbst zu zahlen. Stiletto beschreibt ebenfalls in ihrer Arbeit, dass Händedesinfektionsmittel nicht verschrieben werden.186 Da offensichtlich Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit MRSA bestehen, wünschen sich Betroffene und deren Angehörige Hilfeangebote und Ratschläge von Professionellen.187 188 • Wenn Sie sich einmal zurück erinnern, wie war die Reaktion Ihrer Familie und Angehörigen, als Sie aus dem Krankenhaus nach Hause kamen? (PI) Könnten Sie mir die entsprechende Situation erzählen? (EI) 184 vgl. Lamnek 2005, Seite 365 vgl. §§ 33 SGB V 186 vgl. Stiletto 2003, Seite 102ff 187 vgl. Banek-Schwidessen, Lonnemann 2005, Seite 84 188 vgl. Stiletto 2003, Seite 109 185 53 Begründungszusammenhang zu o.g. Fragestellungen 1. Sozialkontakte, Familienleben / Alltagssituation: Isolierte Patienten fühlen sich ausgegrenzt, empfinden das Gefühl des Alleinseins angewiesen. und sind in besonderem Maße auf Sozialkontakte 189 Hartmann beschreibt, dass Rückhalt der Familie wichtig ist. Weiter beschreibt die Autorin, dass die Angehörigen aus Angst vor einer MRSAInfektion gar nicht oder nur kurz zu Besuch kommen.190 Mangelnder sozialer Austausch durch Isolation, belastet Patienten und Angehörige.191 • Wenn Sie sich einmal zurück erinnern, wie war die Reaktion Ihrer Nachbarn, oder Bekannte als Sie aus dem Krankenhaus nach Hause kamen? (PI) Können Sie mir eine entsprechende Situation erzählen?“ (EI) • Ad-hoc-Frage → Hat Ihnen in dieser Situation etwas gefehlt? (PI) Begründungszusammenhang zu o.g. Fragestellungen 2. Sozialkontakte, Reaktionen Außenstehender Es bestehen Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit MRSA.192 Isolierten Betroffenen sind aufmunternde Worte und Außenstehende zum Sprechen wichtig. Ansonsten fühlen sie sich von der Umwelt ausgeschlossen.193 Im Kantonspital Chur wurde eine qualitative Studie vom Leid der Betroffenen und der Belastung durch Isolation durchgeführt. Die Autorinnen stellen fest, dass mangelnder sozialer Austausch den Patienten und den Angehörigen zu schaffen macht und es daher der Unterstützung des Pflegepersonals bedarf.194 189 vgl. Lubkin 2002, Seite 293ff vgl. Hartmann 2004, Seite 154 191 vgl. Bossard et al. 2003, Seite 22ff 192 vgl. Banek- Schwidessen, Lonnemann 2005, Seite 84 193 vgl. Hartmann 2004, Seite 155ff 194 vgl. Bossard et al. 2003, Seite 22ff 190 54 Abschlußphase Die Abschlußphase der Interviews war geprägt von einer besonders vertrauensvollen Atmosphäre. Die männlichen Interviewpartner, die zu Gesprächsbeginn distanziert waren, berichteten gegen Ende des Gesprächs offen über ihre berufliche Entwicklung und Probleme. Die Interviewpartner wurden informiert, dass noch weitere Betroffene interviewt werden, die mit einer MRSA Infektion und/ oder Kolonisation zu Hause leben oder gelebt haben. Nochmals wurde ihnen die wissenschaftliche Aufbereitung der Daten erklärt, dass die Ergebnisse in einer schriftlichen Arbeit zusammenfließen und dass das Ergebnis keinen Rückschluß auf einzelne Interviewpartner zuläßt. Abschließend bedankte sich die Autorin, für die Bereitschaft, die persönliche Situation geschildert zu haben. Bis auf zwei Interviewpartner, bedankten sich auch diese, dass jemand nachfragt, wie die Erkrankung mit dem „Keim“ empfunden wurde. Und dass Hoffnung besteht, mit der vorliegenden Arbeit anderen Betroffenen helfen zu können. Diktiergerät Sechs von acht Interviews wurden mittels Diktiergerät aufgezeichnet und später transkribiert. Eine Interviewpartnerin lehnte die Aufzeichnung aus Sorge vor Repressalien bei erneuter Klinikeinweisung ab. Dieses Interview wurde aus Mangel an Interviewpartnern als Pretest gewertet.195 Eine andere Interviewpartnerin wurde zweimal aufgesucht, da sie aus Sorge vor Repressalien dem gesamten Interview zunächst nicht zustimmen wollte. Nach Anfertigung eines Mustertranskriptes196 stimmte sie schließlich der Interviewaufzeichnung zu. Das Gerät hat anschließend leider nicht aufgezeichnet, doch im Anschluß an das Interview wurde ein Gedächtnisprotokoll angelegt. 195 196 vgl. Anhang A vgl. Anhang A 55 6.8.3 Postskript Zusätzlich zum Transkript wurde ein Postskript nach jedem Interview angefertigt.197 Es enthält Angaben zur Interviewdauer, Stimmung während des Interviews, Bemerkungen zur Wohnungseinrichtung, weiterer anwesenden Personen, Störungen und persönliche Befindlichkeit des Interviewers, sowie Gesprächsinhalte vor und nach dem Interview.198 Hilfreich war eine Checkliste, die nach jedem Interview ausgefüllt wurde und bei Transkriptionsunklarheiten nochmals eingesehen werden konnte.199 6.8.4 Transkript Im nächsten Schritt der Forschung werden verbale oder visuelle Daten durch Dokumentation und Transkription in Texte verwandelt.200 Unter Transkription ist die Umwandlung einer Schrift in eine andere zu verstehen, wobei die Ursprungssprache möglichst lautgetreu wiedergegeben werden soll.201 Das Transkript ermöglicht den kritischen Nachvollzug des Interviews und der Interpretationen.202 „In der qualitativen Sozialforschung ist man meistens nicht an der Wiedergabe der rein sprachlichen Phänomene interessiert (sondern eher an den Inhalten).“ 203 Nach Mayring empirischen stellt Sinne die eine Transkription neue gesprochener Datengenerierung, Sprache bzw. im eine Datentransformation dar. Wobei zu beachten ist, welche Gütekriterien hier Geltung besitzen, wie sie bestimmt werden können und wie Fehlerquellen auszuschließen sind. Außerdem ist der Zeitaufwand für die Transkription nicht zu unterschätzen, da die Reliabilität durch wiederholtes 197 vgl. Lamnek 2005, Seite 137 vgl. Anhang B 199 vgl. Anhang A 200 vgl. Flick 2005, Seite 29, vgl. Lamnek 2005, Seite 390 201 Wahrig 1997, Seite 1236 202 vgl. Lamnek 2005, Seite 390 203 Mayring, Gläser-Zikuda (Hrsg.) 2005, Seite 49 198 56 Kontrollhören deutlich gesteigert wird.204 Das bestätigt eine zehntägige Transkriptionszeit für ein sechzigminütiges Interview.205 Daher wurde aus Gründen der begrenzten Diplombearbeitungszeit zwei Sekretärinnen gebeten, drei Interviews zu transkribieren. Die Sekretärinnen, selbst Anfänger auf diesem Gebiet, erhielten vor der Bearbeitung ein Mustertranskript 206 sowie Transkriptionsregeln.207 204 vgl. a.a.O., Seite 48ff vgl. Anhang B, Beispiel Transkript Interview C 206 vgl. Anhang A 207 vgl. 6.8.5 Transkriptionsregeln 205 57 6.8.5 Transkriptionsregeln Jedes Interview erhält eine Kennzeichnung durch Großbuchstaben (A-H), Seiten- und Zeilenangaben, sowie einen Zahlencode, der das Datum erkennen läßt (20070226 → 26.02.2007).208 Unkenntlichmachung von Namen, Orten und Institutionen durch Ersetzen von ....(Ort), .... (Name) und .....(Institution). Dokumentation von Weinen und Lachen, in kursiv (weint), sowie Bedeutung der nachstehenden Symbole. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Symbole und deren Bedeutung anhand von Textbeispielen des Interviews A. Symbol [ (0.2) <Aw:::> Wort <Fische-> <.hhh> WORT (Worte...) Bedeutung der Symbole Textbeispiele, dem Transkriptionsbeispiel entnommen / Interview A Überlappende Sprache: Der [ Ja, ja klar. [ exakte Punkt, an dem der eine zu [ warum Sie jetzt wieder sprechen beginnt, während der isoliert werden andere noch redet [...] Pausen: innerhalb und zwischen Öh (0.5), da sind die Sprecherwechseln, in Sekunden Meinungen, bißchen auch, angeben wo ich Dispute hatte Gedehnte Töne:Lautdehnungen Weil ich ein < sehr ::> äh, durch Doppelpunkte im Verhältnis aktiver Mensch bin, an für zur Länge der Dehnung sich un dat, dat is dat, wat wat mir auffällt Unterstreichung markiert Auch mit dieser, dieser Betonungen oder Dickdarmentzündung die ich Hervorhebungen da hatte, is weg Ein Bindestrich zeigt an, dass ein wo ich so`n agiler Mensch Wort oder Laut abgebrochen wird bin, lieg jetzt im Krankenhaus Hörbares Einatmen wird als <.hhh> transkribiert (die Zahl der <h> s ist proportional zur Länge des Einatmens) Erhöhung der Lautstärke wird durch Großbuchstaben angezeigt Klammern grenzen unsichere Transkriptionen ab Im Gegenteil, ich hab`mich gefreut, dat ich wieder zu Hause bin. <.hh> Zeile im Beispiel Zeile 49 u. 50 Zeile 21 Zeile 94 u. 95 Zeile 102 Zeile 442 Zeile 64 dat ich, äh (0.5) Zeile 34 fürchterlich VERÄRGERT war (Ja und ich da saß), wußte Zeile 47 gar nicht, wat los war. Tabelle 6: Transkriptionsregeln mit Interviewbeispieltexten, (Ableitung aus: Flick 2005, Seite 254) Eigene Darstellung 208 vgl. Anhang B, Beispiel Transkript Interview C 58 7 Datenauswertung 7.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring Nach Transkription der Daten, werden diese analog der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert. „Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt.“209 Die Inhaltsanalyse zeichnet sich durch Regelgeleitetheit und Theoriegeleitetheit der Interpretation aus. Das Material wird als Einbettung in den Kommunikationsprozeß verstanden und der Interpret muß bei der Analyse stets angeben, auf welchen Teil im Kommunikationsprozeß er seine Schlußfolgerungen bezieht.210 7.1.1 Bestimmung der Analyseeinheiten Das Ziel der objektiven Hermeneutik ist das Herausarbeiten von latent versteckten Sinnstrukturen, die hinter den Einzelaussagen stecken. Dazu muß vorher festegelegt werden, wie der Text analysiert werden soll.211 Für die vorliegende Arbeit wird als Analyseeinheit die Kodiereinheit festgelegt. Der Text wird bis auf den kleinsten Materialbestandteil hin analysiert und dieser anschließend festgelegt. „Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.“212 7.1.2 Paraphrasierung inhaltstragender Textstellen Im nächsten Schritt Transkriptionstextes werden wiederholt die und Aussagen innerhalb schmückenden des Vokabeln weggelassen. Das Wort Paraphrase stammt von dem Wortstamm Phrase ab, das aus dem griech. hervorgeht und soviel wie anzeigen, sagen oder 209 Mayring 2003, Seite 11 a.a.O., Seite 42ff 211 vgl. Lamnek 2005, Seite 532ff 212 Mayring 2003, Seite 53 210 59 bedeutet.213 aussprechen Des weiteren wird paraphrasieren „ausschmücken, verzieren, umspielen“ beschrieben 214 praktischen von Anwendung einem „Abschälen“ mit und gleicht in der unbrauchbaren Gesprächsbestandteilen. 7.1.3 Generalisierung der Paraphrasen Im nächsten Schritt wird aufgrund des vorliegenden Materials das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion bestimmt. Paraphrasen, die unterhalb des Abstraktionsniveaus liegen, Oberhalb des Niveaus Paraphrasen, liegende werden verallgemeinert. werden zunächst belassen.215 Seite / Interview C Zeilennummer Transkriptionstext S.2/ Z. 70-74 S. 4 / Z. 180-184 Ach, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist doch, ich hab`da keine Lust mehr dazu. Da wird irgendwas (0.2) Ich weiß es NICHT, ich muß sagen, ich bin (0.2) zwar interessiert an solchen Sachen, aber (0.2) (mittlerweile) langweilt mich das, weil Von sich aus sagen die Leute nix, ja? komisch, weil sie sagen, diese Ärzte warum dat so lebenswichtig ist, man ist danach kommunikations(0.2) desinteressiert und fragt auch nicht mehr nach. Wenn die mit mir nicht reden wollen, dann red`ich eben mit denen auch nicht. Paraphrasierung Generalisierung Keine Lust mehr zu Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Zwar interessiert an solchen Sachen, aber von allein sagen die Leute nichts Keine Lust zu Kommunikation zwischen Arzt und Patient Von allein sagen die Leute nichts Kommunikationsdesinteressiert, fragt auch nicht nach. Reden nicht mit mir, rede ich nicht mit denen Reden nicht mit mir, rede ich nicht mit denen Tabelle 7: Generalisierungsbeispiel, Eigene Darstellung 213 Herkunftswörterbuch 2001, Seite 606 vgl. Wahrig 1997, Seite 942 215 vgl. Mayring 2003, Seite 61 214 60 7.1.4 Erste und zweite Reduktion Gestrichen werden bedeutungsgleiche Auswertungseinheiten und Paraphrasen Paraphrasen, die innerhalb auf dem der neuen Abstraktionsniveau als unwesentlich inhaltstragend erachtet werden. Übernommen werden die Paraphrasen, die weiterhin als inhaltstragend erachtet werden.216 Abschließend werden Gegenstand und Paraphrasen ähnlicher mit gleichem Aussage zu oder einer ähnlichem Paraphrase zusammengefaßt und gebündelt. Möglicherweise können Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammengefaßt werden.217 Um die Lebenswelt der Betroffenen natürlich und deren Informationen so authentisch wie möglich darzustellen, wird bei der Datenreduktion auf Beibehalten der Alltagssprache geachtet. Das Beibehalten der Alltagssprache spiegelt sich in der Kategoriebildung wieder. Seite / Interview C Zeilennummer Generalisierung 1.+2. Reduktion Kategorie (K) S.2/ Z. 70-74 Von allein sagen Leute nichts Sagen nichts Reden nicht mit mir Reden Mehr reden Reden S. 4./ Z. 180-184 S. 14-15 Z. 673-688 Keine Lust zu Kommunikation zwischen Arzt und Patient Von allein sagen die Leute nichts Reden nicht mit mir, rede ich nicht mit denen Götter in Weiß, aber man hätte mehr reden sollen, einfach reden, menschlich und zur Verfahrensweise etwas sagen müssen Kategorie Reden (K1) Tabelle 8: Reduktionsbeispiel, Eigene Darstellung 216 217 vgl. a.a.O., Seite 62 vgl. a.a.O., Seite 62 61 7.2 Episodenidentifikation Bedeutsame Erzählungen zu einzelnen Themenbereichen werden im Anschluß an die Kategorienentwicklung herausgefiltert. Um eine Erzählung von einer Aussage abzugrenzen ist eine Definition hilfreich. Eine Episoden-Definition ist in der Literatur nicht eindeutig beschrieben. Nachfolgend wird eine Definition vorgestellt, die für die vorliegende Arbeit entwickelt wurde und nur für diese Arbeit Geltung findet. „[...] Griech. epeisÓdion, das etwa mit > Hinzukommendes< wiederzugeben ist, bezeichnete in der altgriechischen Tragödie die zwischen die einzelnen Chorlieder eingeschobenen Dialogteile. Da der Chor der Hauptträger der Handlung war, wurden die hinzukommenden Dialogteile der handelnden Personen als unwesentliche Nebensache empfunden.“ 218 Zur Kriterienerstellung der Definition „Episode“ soll die vorangegangene Erklärung im umgekehrten Hinzukommende<, zwischen Sinne mehreren dienen. Hier Aussagen soll die > eingeschobener Erzählung nicht als unwesentliche Nebensache, sondern als Hauptsache gelten. Kriterien, die an eine Episode gestellt werden (für diese Arbeit geltend) 219 218 219 • Zwischen zwei Aussagen eingeschobene Erzählung • Auswahl durch den Interviewpartner • Verbindung von Erzählung und Argumentation • Beschränkung auf Alltagswissen Herkunftswörterbuch 2001,Seite 183 vgl. Definition nach Flick 2005, Seite 191, modifiziert durch die Autorin 62 7.3 Zusammenfassung des methodischen Teils In den qualitativen Sozialwissenschaften liegt der Fokus auf gegenstandsbegründender Theoriebildung der Daten und dem untersuchten Feld. Unter Einbeziehung von Theorie wird die Komplexität des untersuchten Gegenstandes verdichtet. Bezogen auf die Forschungsfrage: „Wie erleben Betroffene ihre MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung?“, wird die Frage nach dem Erleben und den Erfahrungen theoretisch hergeleitet. Soziale Wirklichkeit wird in der Lebenswelt der betroffenen Menschen hergestellt. Um den Problembereich der Betroffenen betrachten und analysieren zu können, ist das Problemzentriertes Interview, nach Witzel, Mittel der Wahl. Es beruht auf einem wissenschaftlich bestehenden Konzept, die Vorgehensweise ist halbstrukturiert, kommt dem offenen Gespräch nahe und ist zentriert auf die Problemstellung ausgerichtet. Das Episodische Interview ist ein von Flick (1995) entwickeltes Verfahren und eine Kombination aus Narration und Befragung. Der Betroffene hat die Möglichkeit, ihm bedeutsame Erzählungen mitzuteilen. Die Kombination von Problemzentriertem und Episodischem Interview wird in der Literatur nicht explizit beschrieben. Da sie weitgehend der Alltagskommunikation entspricht, wird eine Kombination beider Interviewformen in der vorliegenden Arbeit angewandt. Zur Kriterienerstellung der Episodendefinition, wird eine Kombination aus Flicks Definition und einer, in der Arbeit entwickelten Definition, angewandt. Diese Definition gilt nur für die vorliegende Arbeit. Die sechs Gütekriterien Mayrings, unter Verzicht auf Validität und Reliabilität, finden in der vorliegenden Arbeit Anwendung. Ebenso erfolgt die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews nach den Vorgaben Mayrings. 63 Somit wird der Methode der empirischen Sozialforschung, eine geregelte und nachvollziehbare Anwendung von Erfassungsinstrumenten angewandt. 8 Definition Empirische Sozialforschung (philosophisch) Für den Soziologen Atteslander bedeutet empirisch, dass theoretisch formulierte Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden.220 Etymologisch wurde das Adjektiv „empirisch“ im 18./19. Jahrhundert aus dem gleichbedeutenden griech. „em-peirikÓs“ entlehnt und bedeutet „auf Erfahrung beruhende Erkenntnis“. 221 „[...] gehört zum Adjektiv griech. ém-peiros » erfahren, kundig « das sich mit seiner eigentlichen Bed. .» im Versuch, Wagnis seiend « zu griech. peira .» Versuch, Wagnis « stellt.“ 222 Gemäß philosophischer Betrachtungsweise, ist Empirismus eine erkenntnis- theoretische Position die, entgegen des Rationalismus, alles Wissen auf die Erfahrung als Ursprung und Rechtfertigungsgrund zurückführt. Die Erfahrung wird dabei meist begriffsfrei, als rein Gegebenes gedacht. Locke untersuchte Ursprung und Wesen der Erkenntnis und kommt zu dem Schluß, dass Menschen nicht mit Ideen geboren werden, sondern sie erwerben sie aufgrund ihrer erkenntnistheoretischen Erfahrungen. Der Verstand allein vermag nicht aus sich heraus Ideen hervorzubringen. Eindrücke gehen immer auf eine direkte Sinnerfahrung zurück. Vorstellungen dagegen, werden durch Erinnerung aus den Eindrücken oder durch Kombination verschiedener Vorstellungen gebildet. Die Aufgabe des Verstandes ist es nun, verschiedene Vorstellungen richtig miteinander zu verbinden. Die Prinzipien, von denen sich der Verstand dabei leiten läßt, sind Ähnlichkeit, räumliche und zeitliche Nähe und Kausalität.223 220 vgl. Kuckartz 2006 vgl. Wahrig, 1997, Seite 417 222 Herkunftswörterbuch 2001, Seite 179 223 vgl. Schülerduden Philosophie 2002, Seite 109 221 64 Die Analyse der Ergebniskategorien erfolgt ebenfalls nach den Prinzipien der Ähnlichkeit. Das heißt, Aussagen von Betroffenen mit gleichem oder ähnlichem Inhalt werden zu einer Kategorie zusammengefasst. 65 8.1 Darstellung des Kategoriensystems Bezogen auf die Forschungsfrage: „Wie erleben Betroffene ihre MRSA Kolonisation und oder Infektion in der häuslichen Umgebung“, ergeben sich die nachfolgend vorgestellten Kategorien aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Nach Mayring kann somit eine Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriesystems am Ausgangsmaterial stattfinden.224 225 Um eine Rücküberprüfung des Datenmaterials zu ermöglichen, werden einzelne Ankerbeispiele, einzelnen Kategorien (K) zugeordnet. Die Ankerbeispiele erhalten nach der 2. Reduktion einen Titel, der in den einzelnen Beispielen wiederzufinden ist. Die Ankerbeispieltitel sind ebenfalls in den jeweiligen Kategorien wiederzufinden. Kategorie 1 Reden Kategorie 2 Vergessen Kategorie 3 Angst, Andere anzustecken Kategorie 4 Arbeitsplatz Kategorie 5 Zum Schluß Kategorie 6 Verkleiden Kategorie 7 Normal Kategorie 8 Gefährlich Kategorie 9 Wäsche Kategorie 10 Hausarzt Kategorie 11 Schuld Kategorie 12 Ernst nehmen Kategorie 13 Keim Die in Anhang B befindliche Tabelle, 226 Kategorien, Interviews die den jeweiligen enthält die oben aufgelisteten mit entsprechender Zeilennummer zugeordnet sind. 224 vgl. Mayring, Gläser-Zikuda (Hrsg.) 2005, Seite 211 vgl. Mayring 2003, Seite 60 226 vgl. Anhang B, Kategorieentwicklung 225 66 8.2 Darstellung einzelner Kategorien und Episoden Nach Flick lautet häufig geäußerte Kritik, qualitative Forschung mache Interpretationen und Ergebnisse dadurch transparent, dass Zitate aus Interviewprotokollen eingeflochten würden.227 Das geschieht ebenfalls in der vorliegenden Arbeit, da dies das einzige Mittel zur Herstellung des Begründungszusammenhanges zwischen der Aussage und daraus gewonnener Erkenntnis ist. Damit erkennbar ist, dass es sich um ein Transkriptzitat handelt, ist unterhalb des Zitates der Großbuchstabe des Interviews, Seite und Zeilennummer angegeben. In der Sozialwissenschaft ist der Text, „[...] vor allem ein Instrument der Vermittlung und Kommunikation von Erkenntnis und Wissen.“ 228 Um zu verdeutlichen, warum welche Kategorie ausgewählt wurde, wird ein Ankerbeispiel an den Anfang und das Ende eines Kategorieblockes gestellt. Ein Ankerbeispiel ist eine konkrete Textstelle des Transkriptionstextes, die für ein besonderes Beispiel gilt. Es ist eine Vorgabe eines Beispiels durch die Autorin, um die Übereinstimmung zwischen ihr und der Zuverlässigkeit der Einstufung (Reliabilität) zu erhöhen.229 Ankerbeispiel der Kategorie Reden Entnommen aus dem Transkriptionstext des Interview C: „Jedenfalls, da ist nix Großartiges gesacht worden. Man hätte vielleicht ein bißchen mehr reden müssen, einfach so menschlich, einfach mal REDEN, ne?“ Interview C, Seite 14, Zeile 681 Die wörtliche Zitation ist mit Seiten- und Zeilenangabe des jeweiligen Transkriptionstext angegeben. Ebenso ist angegeben, in welchem Interview und welcher Zeilennummer das jeweilige Ankerbeispiel zu finden ist. 227 vgl. Flick 2005, Seite 317 Flick 2005, Seite 345 229 vgl. http://www.sozpsy.uni-hannover.de, letzter Aufruf:12.05.2007 228 67 Zur weiteren Verdeutlichung einer Kategorie, werden zu manchen Kategorien, Episoden (E) mit prägnantem Episodentitel dargestellt. Kategorie 1.:Reden(K1) Es wird eine mangelnde Kommunikation zwischen Arzt und Patient erlebt. Jeder der Interviewpartner gibt an, vom Pflegepersonal informiert worden zu sein, dass eine Infektion mit einem „Keim“ vorliegt. Doch die Betroffenen wünschen sich mehr Aufklärung und Information von ärztlicher Seite. Es besteht der Wunsch nach Aufklärung einerseits zur Krankheit selbst und andererseits zu Verhaltensweisen und Umgang mit der Erkrankung „Jedenfalls, da ist nix Großartiges gesacht worden. Man hätte vielleicht ein bißchen mehr reden müssen, einfach so menschlich, einfach mal REDEN, ne? So nach dem Motto: „ So .....(Name), Du hast den Keim jetzt, beziehungsweise NICHT mehr (lacht) weil es war ja negativ, im ....(Monat)....(Jahr), ja und dann hätte man, kleine Verfahrensweise vielleicht etwas sagen müssen.“ Interview C, Seite 14-15, Zeile 681-685 Ankerbeispiele • Keiner wat sagen • Die weiß gar nix • Reden • Wat sollen se sagen • Nicht verstehen • Bißchen mehr Aufklärung Interview A B C E G H Zeilennummer 45, 57, 260, 307 294, 306 31, 183 52, 57 32,117 10, 80, 94, 177 Fehlende Gespräche zwischen Arzt/ Pflegepersonal und Patient wirken sich als zusätzliche Belastung, zu dem ohnehin belastenden Krankheitserleben, aus. Aufgrund fehlender Gespräche fühlen sich die Patienten allein gelassen und empfinden eine Verschlechterung ihres Krankheitserlebens. „Schlecht ging es mir, ich hab den ganzen Tag geweint. [ Wegen diesem Virus, weil ich wußte nicht, wie er ist, was es ist und ich weiß nicht mal bis HEUTE, die Ärzte sagen, ich bin ja kein Arzt.“ Interview G, Seite 13, Zeile 112-115 68 Episode „Kommunikation ist Kappes“ (E1) „Bezogen auf den KEIM. Sonst nicht, ich meine, ich hab` mich ja nicht krank gefühlt. Ich hab`, ich hab`dem Arzt befolgt. Der Arzt hat gesagt „Junge, da ist, könnte sein, dat die.....(Verbandtechnik) irgendwie verbacken, vielleicht ist sie auch gewandert, man voriges Jahr, ich war dabei, hier im Badezimmer, ein Teil der....(Verbandtechnik) entfernt. Ich wußte aber nicht, daß ein Teil, ich dachte die ganze ....(Verbandtechnik) wär raus. Aber (0.3), keine Ahnung, hat man mir aber auch nicht gesagt, hat man vielleicht auch selber nicht gewußt und der Doktor....(Name) sachte zu mir, ganz großzügig: „Dat ist mir auch schon mal passiert, dat man Teil der ....(Verbandtechnik) vergißt (0.2). O.k. Wenn dat eben öfter passiert, dann will ich (lacht) nix sagen, dann ist dat eben so, dann eben PECH gehabt. Na jut, jetzt hat man offensichtlich die restliche Dinge entfernt und hat jetzt vorigen .....(Tag) noch mal kontrolliert ....(Name des Feiertages), war die Operation, zwei Wochen später, hat man, wie jesacht, noch mal operativ da was gemacht, irgend `ne....(Wundversorgung) gelegt, man hat mir das gesagt, ich hab` s aber vergessen. Ich kann mir, ist ja ein ....(Name der Erkrankung), ist total alles kaputt, tektonisch, und <.h> ich weiß nicht, wat die da mit den Knochenresten, nennt sich glaub`ich ....(Name der Operationstechnik), da holen die dann irgendwie ab und zu mal was raus oder auch nicht und (0.2) eigentlich ist der Keim DRIN und könnte den Fuß zerstören und kann auch in den ganzen Körper, Blutver <.hh> alle diese Schlagworte hört man, aber man kriegt das so nicht so richtig zusammen, weil keiner sich die Mühe macht, oder denkt, der Typ ist zu doof oder was weiß ich. <.hh> Ist halt Patient, wat soll man dem groß erklären. (0.2) Ich mein, wir sind hier die Ärzte, ratz, fatz, und die Sache wird so in dem Sinne geklärt. Ich mein, ich hab`nix gegen die Ärzte, aber die Kommunikation ist KAPPES, die ist nicht vorhanden, ja?“ Interview C, Seite 6-7, Zeile 288-313 Kategorie 2.: Vergessen (K2) In der häuslichen Umgebung sind strikte räumliche Isolierungen wie im Krankenhaus unter anderem aus rechtlichen Gründen nicht möglich.230 Das wird von den Betroffenen als Befreiung empfunden, wenn sie nach erlebter Isolation aus der Klinik nach Hause entlassen werden. In der häuslichen Umgebung gerät die MRSA Infektion oder Kolonisation in Vergessenheit. Bei krankenhauserfahrenen Betroffenen entsteht der Eindruck, daß der „Keim“ erst wieder auftaucht, wenn sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. 230 vgl. Nußbaum, In: Pflegen Ambulant 02/ 2007, Seite 10ff 69 „Kein Keim, jo, wat is dat denn?Ich hab`et ihm (Hausarzt) auch nie, wat soll ich ihm sagen, er hat ja den Entlassungsbericht GELESEN, und (0.2) da ist keimtechnisch weiter (lacht) keine Verhaltensvorschrift erfolgt <und::> der wird wohl vejessen sein. Ich wiederhole mich jetzt, dann kommen Sie wieder hier hin und dann fängt die KEIMSTORY wieder von vorne an.“ Interview C, Seite 3, Zeile 126-130 Ankerbeispiele Interview Zeilennummer • Wird wohl weg sein A 219 • Vergessen C 129 719, 725, 452 • Keim ist Nebensache E 726, 753 • Keine Gedanken gemacht F 34 • Ignoriert H 305 Der Umgang mit dem „Keim“ und entsprechende Schutzmaßnahmen damit werden in der häuslichen Umgebung nicht mehr thematisiert. Daher entsteht der Eindruck, dass der Keim nur in der Klinik, oder nur dort in der Tragweite, zum Ausbruch kommt. „Wenn ich jetzt zu Haus geblieben wär, und wär weiter so, mehr oder weniger mit ner ....(Hilfsmittel) rumgegangen, dann wär der Keim offensichtlich nicht so zum Ausbruch gekommen. Interview C, Seite 3, Zeile 97-99 Kategorie 3.: Angst, Andere anzustecken (K3) Ausschließlich von den weiblichen MRSA Betroffenen wird angesprochen, dass sie Sorge haben, ihre Angehörigen und Bekannte zu infizieren. Für sie selbst bestehe keine Sorge. Keiner der männlichen Interviewpartner spricht davon, Angst zu haben, Familienangehörige zu infizieren. Daher scheint es sich um einen geschlechtsspezifischen Unterschied zu handeln. „Und außerdem immer, wenn ich entlassen wird, ist die Angst hier, ich habe eine Enkel-,Urenkeltochter, die ist 12 Monate alt und die Kinder noch dazu und die Enkel noch dazu, da hab ich immer Angst.“ Interview G, Seite1, Zeile 22-27 70 Ankerbeispiele • Interview • Ist traurig, dass wir das auch B kriegen G Für mich bleiben • Für mich keine Sorge H Zeilennummer 133, 177, 196, 221, 239 24, 240, 247, 357, 563, 602, 773, 794, 851, 864, 882 395, 410, 417, 467, 587, Für sich selbst, empfinden die weiblichen Betroffenen keine Sorge. Lediglich die Angst besteht, Angehörige, Freunde und Bekannte zu infizieren. „Sorge, ich würde Andere anstecken, für mich selbst hatte ich überhaupt kene Sorge“. Interview H, Seite 18, Zeile 587 Im Interview mit dem übersetzenden türkischen Mädchen wird deutlich, wie wichtig sensible und der Muttersprache gemäße Information und Aufklärung im Umgang mit der Infektion oder Kolonisation ist. „Sie will mich küssen und kann sie nicht und dann weint sie und sagt, wieso das nicht kann.“ Interview B, Seite 3, Zeile 133-134 Episode „Wartezimmer“ (E2) „[die Angst ist dass ich meine Mitmenschen anstecke [Für mich selber ist jetzt kein Problem mehr, weil ich bin da gewöhnt ne. Aber wie ich was ich weiß dass ich ein Viren hab, wie kann ich denn andere Leute das antun. Dass die dasselbe mitmachen wie ich? Das möchte ich nicht! Auch wenn ich in der Praxis gehe, ich stehe meistens draußen im Flur, nur dass ich kein Kontakt so habe, weil es sind ja auch ältere Leute wie ich ne! [Ja sicher ist das Veränderung, große Veränderung Ich setz mich ins Wartezimmer beim Arzt, wenn nicht viele Leute sind, zum Beispiel, wenn drei vier sind und jüngere, aber wenn alte Leute sind, da setz ich mich nicht hin, weil ich hab Angst, dass ich die Leute anstecke. Und ich möchte das nicht haben.“ Interview G, Seite 16-17, Zeile 775-790 71 Kategorie 4.: Arbeitsplatz (K4) Der in Interview G anwesende Sohn der Interviewpartnerin sagt, dass er Sorge habe seinen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn bekannt würde, dass er sich mir dem Keim infiziert hätte. Er beabsichtigte in der Folgezeit zum Arzt zu gehen und sich zur Sicherheit abstreichen zu lassen. „Wir machen uns auch Sorgen, wir können den Arbeitsplatz verlieren. Und ohne Arbeit, was können wir machen? Dat weiß äh schon ich schon sechs Monate schon mit dem Virus.(Sohn).“ Interview G, Seite 13, Zeile 622-624 Ankerbeispiele • Arbeitsplatz verlieren Interview G Zeilennummer 282, 622 „Und jetzt hab ich ein Termin beim Hausarzt, ich will auch abstrichen lassen.(Sohn).“ Interview G, Seite 6, Zeile 282 Kategorie 5.: Zum Schluß (K5) Ambulante Pflegedienste sind gehalten, MRSA Betroffene zur Vermeidung einer Keimverschleppung zuletzt zu versorgen.231 Drei Interviewpartner hatten Erfahrungen mit einer MRSA Kolonisationund/ oder Infektion und Betreuung durch ambulante Pflegedienste. Betroffene, die aufgrund möglicher Keimverschleppung am Ende der Tour versorgt werden, erleben dies als Beeinträchtigung. Sie und ihre Angehörigen müssen sich auf andere Zeiten einstellen, der Lebensrhythmus und ihr Tagesablauf werden dadurch verändert. „Ja. Und ja nachdem se. Dann müssen wir sofort, muß ich sehen das ich Zeug kriege und wir werden sie jetzt zum Schluß immer nehmen. Äh, in der ganzen Reihe, ich war sowieso in der Mitte, (0.3), ja. In der Versorgung, immer zum Schluß. Da hab ich gedacht, ich muß noch eine Stunde länger auf sie warten. Dat war meine erste einschneidende Folge davon. Das hat die Sache verändert, und ganz schön. Ja, ja. Um Elf Uhr bin ich meistens erst versorgt worden.“ Interview H, Seite 8, Zeile 346-343 231 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 955 72 Ankerbeispiele • Mittags die Grundpflege • Kein Tag ohne Pflege • Kein Wort zuviel Interview E F H Zeilennummer 521, 524 26 352, 363, 453, 615, 619, 901 Das Anlegen der Schutzkleidung ist in der Versorgungszeit der Betroffenen inbegriffen. Faktisch muß diese Zeit von dem vorgegebenen Versorungszeitfenster abgezogen werden und die Versorgung, d.h. die Zeit für die Pflege gestrafft werden. Dadurch wird Betroffenen möglicherweise weniger Aufmerksamkeit aufgrund fehlender Gespräche gewidmet. „Ja, obwohl, äh, die Schwester vom Pflegedienst hat jetzt 12 Minuten Zeit, um mich zu waschen und anzuziehen. Man muß sich mal vorstellen. 12 Minuten. Das mußten sie innerhalb dieser Zeit leisten, und das konnte se nicht. Deshalb war se verdreht. Sie, sie, sie, sie bemühte sich korrekt zu sein, aber ich, ich, hatte so beobachtet, kein Wort zuviel.“ Interview H, Seite20, Zeile 873-897 Die Atmosphäre während der pflegerischen Versorgung zwischen Klient und Pflegekraft kann als sehr angespannt empfunden werden. Die Betroffene erlebt ein strikt geplantes Zeitmanagement, bei dem Anteilnahme keine Berücksichtigung findet. „Auch nich mal ne ANTEILNAHME, auch nich, KEIN WORT. Es war alles auf letzte Minute ausgenutzt“. Interview H, Seite20, Zeile 901 und 909 73 Episode „Ach, Du Schreck“ (E3) „Mir war das gar nicht ganz klar. Die haben gesacht, wenn sie nach Hause kommen, dat is nicht schlimm. Und äh, dann kam der .....(Tag), da kam die Schwester und die sachte, ich habe ja nur Vertretungsdienst übers Wochenende, ich laß die, den Brief solange zu, bis morgen die Schwester .....(Name) kommt, die äh, ist ja zuständig für sie. Und ich hatte für Montag, äh, einen Brief für den Arzt. Und Montagmorgen kam die Schwester und hatte sofort den Brief, und ratsch, ratsch den Brief, is so eine Schwester, die so ruckzuck alles macht. <.hhh>. UND DANN FING DIE AN ZU SCHREIEN, ACH DU SCHRECK. Jetzt müssen wir uns verkleiden und so, ach, jetzt haben sie nen Keim, und oohlala, ne die war ganz außer sich. Wir haben doch keine Zeit, das ist doch alles abzuähäh, abgestempelt, abgestöpselt mit Minuten und <.hhh>. Ich hatte nachher vor, ihr mal zu sagen, sie tun so, als wenn ich Schuld an dem Keim wär. So hat se mich behandelt (lachen). Ja. Und ja nachdem se. Dann müssen wir sofort, muß ich sehen daß ich Zeug kriege und wir werden sie jetzt zum Schluß immer nehmen. Äh, in der ganzen Reihe, ich war sowieso in der Mitte,“ (0.3) Interview H, Seite 7-8, Zeile 328-348 Kategorie 6.: Verkleiden (K6) Bei Patienten mit Nachweis von MRSA, sind Kleidung und Schutzausrüstung in der ambulanten Pflege in das Barrierekonzept eingebunden.232 Die Schutzkleidung wird in der Pflege von MRSA Betroffenen als Barriere erlebt.233 234 Die Betroffenen und Pflegepersonen bezeichnen das Anlegen der Schutzkleidung als „Verkleidung“. „Der Arzt hat gar nichts gesagt, sondern der Pfleger. Der Pfleger kam und sagte, sie haben einen Keim. Ich sagte, was für einen Keim?. Ja, das haben viele Leute hier im Krankenhaus. Das ist nicht schlimm, das ist nur bei kranken Leuten und sie müssen, wir kriegen jetzt ein Schild an die Tür und die Leute, die sie besuchen, müssen sich verkleiden und auch die Schwestern und die Pfleger.“ Interview H, Seite 1, Zeile 10-15 232 vgl. Nußbaum, In: Pflegen Ambulant 02/ 2007, Seite 10 vgl. Meiser und Brehmer, In: Die Schwester/ Der Pfleger 12/ 2002, Seite 980ff 234 vgl. Meiser und Brehmer, In: Die Schwester/ Der Pfleger 01/ 2003, Seite 32ff 233 74 Ankerbeispiele • Haarhäubchen und Maske • Mund nicht gebunden • Maske • Immer verkleiden • Beschützt • Verkleiden Interview A B C E G H Zeilennummer 40 35, 199 112 398, 604 262 14, 34, 41, 195, 337, 432 Nicht jeder Mitarbeiter legt die vorgeschriebene Schutzkleidung an. Daher entsteht bei den Betroffenen der Eindruck, dass das Gesundheitsrisiko nicht so groß sein kann. „Die Schwestern und Pfleger nahmen das Verkleiden noch nicht so ernst. Sie kamen manchmal so unverkleidet, sie kamen:: äh, äh sie hatten auf`m Badezimmer, da hatten se so`n Kittel hängen. Manche haben sich nicht umgezogen. Ich dachte, das kann ja so schlimm nicht sein.“ Interview H, Seite 1-2, Zeile 40-59 Kategorie 7.: Normal (K7) Betroffene, die nicht auf die Betreuung ambulanter Pflegedienste angewiesen sind, erleben ihre häusliche Umgebung als normal. Sie sind froh, wieder in ihrer häuslichen Umgebung zu sein und empfinden keine Veränderung im Alltag. „Alle sind zu Besuch gekommen. Meine Mutter hat gesagt, meine Oma hat gesagt, dass die Abstand halten sollen, aber die Besuchen haben gesagt: “Egal, egal. Ist zu doof und so, <.h>, da kann nichts passieren. Die haben meine Oma immer geküßt und gearmt. Alles normal.“ Interview B, Seite 5, Zeile 225-234 Ankerbeispiele • Normal, normales Umfeld • Alles normal • Kein Thema • Ganz normal Interview A B C E Zeilennummer 63, 76, 467 234 720 316 Das Thema „Keim“ wird in der häuslichen Umgebung nicht mehr angesprochen und gerät dadurch in Vergessenheit. Die Betroffenen ignorieren ihn und denken nicht mehr daran. 75 „Wenn das nicht mehr besprochen wird, dann wird das im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr thematisiert und dann ist dat nicht, Sie denken nicht mehr dran, die Ärzte sagen auch nix. Ja nä, der Hausarzt hat ja gesacht.....(Name) hast Du `en Keim gehabt oder so.“ (0.3). Ist für die wahrscheinlich auch kein Thema, ich weiß et nicht.“ Interview C, Seite 15, Zeile 724-728 Kategorie 8.: Gefährlich (K8) Für Betroffene ist es schwer nachvollziehbar, warum sie im Krankenhaus isoliert werden und zu Hause keine Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Die Isolation löst bei Betroffenen ein Gefühl von „Gefährlichkeit“, sprich einer Gefahr für Andere, aus. Sie fragen sich daher immer wieder, ob sie eine Gefahr für Andere darstellen. Auch wenn ihnen versichert wird es sei nicht gefährlich, bleibt die Unsicherheit. Für die Betroffenen ist schwer verständlich, warum sie allein liegen müssen, wenn die Erkrankung ungefährlich ist. „Isoliert ganz allein in ein Zimmer und dann sagt die Ärztin, es wäre nicht gefährlich.“ Interview G, Seite 2, Zeile 47-48 Ankerbeispiele • Todkrank • muß aufpassen • Gefährlich • Keiner schützen • Nicht gefährlich • Isoliert und nicht gefährlich • Nicht schützen Interview A B C E F G H Zeilennummer 270 157 94, 480, 115 33 48 190 Keiner der Betroffenen gibt an, dass Verhaltensmaßnahmen zur Händedesinfektion erfolgt sind. Weder zur Anwendung, noch zur Beschaffung von Händedesinfektionsmittel sei etwas gesagt worden. Im nachfolgenden Ankerbeispiel wird lediglich angemerkt, dass durch Unachtsamkeit eine Keimverschleppung von der Wunde auf andere Körperregionen erfolgen kann. „Mit Hand nix immer die operieren machen und dann keine Angst. Aber mit Hand, die operieren und dann Angst bleibt hier. Hier: muß aufpassen.“(Großmutter). 76 „ Nicht, nicht in dem Bauch, sondern dass dingens. Sonst krigt sie irendgendwo anders.“(Enkelin) Interview C, Seite 4, Zeile 155-167 Kategorie 9.: Wer macht die Wäsche (K9) Keiner der Betroffenen beschreibt, dass unaufgefordert von ärztlicher Seite Aussagen zur Wäscheversorgung gemacht werden. Wenn überhaupt, werden die Betroffenen eher zufällig mit dem Thema konfrontiert und suchen sich selbstständig Rat und Unterstützung. Im folgenden Ankerbeispiel hat die Pflegeperson des ambulanten Pflegedienstes darauf aufmerksam gemacht. „Und die rief mich an, die hatte mich auch aus Österreich versucht anzurufen und war ziemlich betroffen, dass ich im Krankenhaus war und die sachte, ich komme und hole mir die Wäsche und mach die. Und da brachte mich die Schwester, die ....(Institution)- Schwester dadrauf und sachte, sie haben den Keim in der ....(Körperregion), ich weiß nicht, ob das geht, dass die die Wäsche macht.“. Interview H, Seite 9, 390-395 Ankerbeispiele • Ganzheitlich • Extra Sack • Sauber halten • Nicht jeden Tag • Wäsche Interview C E F G H Zeilennummer 413 223, 681, 682, 689 39 94, 96 293, 385, 481 „Ja. Und dann war ich dabei, als die den Arzt von hier aus angerufen hat. Und dann hat der Arzt sie beruhigt. Ja, und hat gesagt, für gesunde Leute macht das nichts. Ziehen sie Handschuhe an, wenn sie die Wäsche sortieren und so. Das ist eine Vorsichtsmaßnahmeregel, aber sie brauchen nicht Sorge zu haben, dass da irgendwas passiert.“ Interview H, Seite 10, 473-487 77 Episode:“ Ganzheitlichkeit (E4) Hat man Ihnen gesagt, wie Sie Ihre Wäsche behandeln sollen? Können Sie sich da an eine bestimmte Situation erinnern? (Interviewer) „<Nein:::>, solche konkreten Lebenszusammenhänge wie Wäschebehandlung werden ja gar nicht <erwähnt::>, dat wär ja <.hh> Mein, Sie müssen ja (0.2), Sie kennen ja (0.2)Ich hab` ja Verständnis, daß man den Mensch nicht ganzheitlich sehen kann, dat an dem Fuß auch noch ein Mensch dran ist, das will ich von keinem verlangen, ja? Also, dat ist, ne, im Ernst, das ist nicht ironisch gemeint. Aber dat verlange ich von keinemn, ne? (0.3) ich mein, dat ist Ich mein, die Spezialisierung ist eben so, dass es Leute gibt., die sich da CHIRURGISCH, dat ist vollkommen korrekt. Wie sollte es anders gehen? Es kann einer nicht alles machen, ne, ich mein. Es kann einer nicht Zähne ziehen und Füße gleich setzen. Wär ja blöd, ne? <.h> Gegen die Spezialisierung (0.2) ist ja nix einzuwenden, nur eben, die hat ja dann eben den Nachteil, das man immer nur den....(Körperregion) sieht.“ Interview C, Seite 9-10, Zeile 411- 426 Kategorie 10.: Hausarzt (K10) Die Betroffenen erwähnen keine bedeutsamen Veränderungen oder Unterschiede in der hausärztlichen Versorgung während ihrer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion. Dabei scheint das Hygienebewusstsein bei den niedergelassenen Ärzten unterschiedlich ausgeprägt zu sein. „Der Hausarzt hat sich nicht verkleidet. Der hat sich ganz normal so. Der hat sich normal verhalten und die Schwestern, die haben sich, wie gesagt, deshalb kamen die immer so spät, weil sie dann sich erst verkleideten am Schluß. Ich war die letzte Patientin.“ Interview H, Seite 9, 390-395 Ankerbeispiele • Der läßt dat so • Hausarzt weiß nix • 14 Tage zu Hause • Viel zu tun • Kommt nicht auf nen Tag an Interview A C E G H Zeilennummer 217 231, 331 363 682 432, 502 „Der ....(Facharztbezeichnung) der dat machen tut, der hat bis jetzt noch nicht gewußt, dass ich den Keim hab.“ Interview E, Seite 17, Zeile 807-809 78 Episode „Nicht auf `nen Tag“(E5) „Der Hausarzt hat gesagt, für gesunde Leute macht das nichts. Ziehen Sie Handschuhe an, wenn sie die Wäsche sortieren und so. Das ist eine Vorsichtsmaßnahmeregel, aber Sie brauchen nicht Sorge zu haben, dass da irgendwas passiert. Und das war für mich eine generelle Erleichterung. Ja. Und dann, äh, rief mich die, (0.4) Arztpraxis an von dem Doktor, von meinem Arzt, von meinem Arzt an und dann war der Doktor da gerade und dann sagt er, äh, (0.3) morgen kommen wir vielleicht und nehmen neue, äh, (0.2) ich weiß nicht... Nen Abstrich. Ja. Aber kommt ja auch nich auf nen Tag an. Sagte der Arzt. Und dann kam die Schwester, die ....(Institution)- Schwester und dann sachte ich, der Arzt hat gesacht, es kommt auf nen Tag nicht an und dann wurden die böse. Und, äh, dann hat sie den Arzt angerufen, aber da war ich nicht dabei. Hat se von der.....(Institution) angerufen. Und dann hat der Arzt ihr auch gesagt, kommt ja nicht auf einen Tag an. HERR DOKTOR, WAT HAM SIE FÜR NE AHNUNG, WAT DAT FÜRN UMSTAND ALLET GIBT, STÄNDIG UMZUZIEHEN UND SO. Sie, das wissen Sie nicht, das kommt doch schon auf jeden Tag an. (lachen) und dann kam dann die, schickt die, am nächsten Tag schickt er denn ein Mädchen von der Arztpraxis.Und dann hat die ne Abstrich gemacht. Die hat sich auch nicht verkleidet.“ Interview H, Seite 10-11, Zeile 480-523 Kategorie 11.: Schuld (K11) Manche Betroffene empfinden, dass ihnen der Eindruck vermittelt wird, sie seien verantwortlich für ihre MRSA Kolonisation und/ oder Infektion. Sie empfinden ein Schuldgefühl und sind sich keiner Schuld bewusst. „Nervliche Sache, in dem Moment, in dem ich mir fürchterlich Gedanken mach, wat ist jetz los. Wat, wat passiert hier mit Dir. Was, wat praktizieren die hier mit dir, wat is los? So was, ich bin mir keiner Schuld bewußt, ich bin mit, mit`m .....(Erkrankung) hier.“ Interview A, Seite 4, Zeile 173-174 Ankerbeispiele • Keiner Schuld bewußt • Nicht schuld Interview A H Zeilennummer 172 341 „Ich hatte nachher vor, ihr mal zu sagen, sie tun so, als wenn ich Schuld an dem Keim wär. So hat se mich behandelt (lachen).“ Interview H, Seite 8, Zeile 340-343 79 Kategorie 12. Ernst nehmen (K12) Die Betroffenen äußern den Wunsch nach Aufklärung und Information. Nach Gewissheit, dass der Keim einmal weggeht und dass er ungefährlich für Außenstehende ist. Außerdem möchten die Betroffenen mit und in ihrer persönlichen Erkrankung ernst genommen werden. „Die Ministerin Schmidt, die hat jetzt am ....(Tag) bei der .....(Name) in dem Fernseh, hat se gesacht, wir müssen runter kommen von dem Minutenberechnen. Hat se gesacht. Das man ernst genommen wird. Man will ernst genommen werden als Patient.Und menschlich genommen.JA, ne, ne, das ist so unmenschlich. Wenn de se schon mal sachte aufstehen, so ich sachte, ich bin kein Hund, sachte ich dann, ne. Oder so, ne. Wenn ich das empfinde, ich bin sehr empfindlich dadrin. Ernst genommen zu werden. Ich will aber auch das gar nicht verlieren, diese Empfindsamkeit. Ich meine, das sind wir uns Menschen schuldig. Als wenn man alles berechnen könnte. Es bleibt doch immer was übrig. Was, was man Menschlichkeit nennt. Interview H, Seite 21-22, Zeile 957-1028 Ankerbeispiele • Veränderung bei den Ärzten • Gewißheit • Menschlichkeit Interview A G H Zeilennummer 300-308 347-350 1024-1027 „Veränderung, die sollte meiner Meinung nach bei den Ärzten passieren. Dat, das man <mal::>, vernünftig informiert wird.“ Interview A,Seite 7, Zeile 303-308 Kategorie 13. Keim (K13) Die Betroffenen benutzen weder den Begriff MRSA oder Staphylococcus aureus. Ihnen wurde lediglich gesagt, dass sie einen „Keim“ haben. Um welchen Keim es sich genau handelt, sowie Ursache und Therapiemöglichkeit wird ihnen auch auf Nachfragen nicht ausreichend erklärt. „Der Pfleger kam und sagte, sie haben einen Keim. Ich sagte, was für einen Keim?. Ja, das haben viele Leute hier im Krankenhaus. Das ist nicht schlimm, [...] “ Interview H, Seite 1, Zeile 10-12 80 Ankerbeispiele • Keim • Krankenhauskeime • Keimstory • Keime geholt • Keim • Auch den Keim Interview A B C E G H Zeilennummer 18, 277, 312 30, 93 4,54, 13, 589, 36 2, 47, 60, 173, 257 697 338, 283, 64, 85, 12, 138 „Ja, äh, zu meiner Erkrankung, also jetzt den Keim betreffend, ist mir an für sich sehr wenig gesagt worden.“ Interview A, Seite 1, Zeile 7-8 8.3 Andere Ergebnisse Die Forschungsfrage zielt auf das Erleben und die Erfahrungen mit „MRSA in der häuslichen Umgebung“ ab. In den Interviews werden ebenfalls Themen angesprochen, die nicht direkt die Forschungsfrage betreffen, sondern eher für den Klinikbetrieb von Bedeutung sind. Obwohl folgende Ankerbeispiele überwiegend für den Klinikaufenthalt relevant sind, erhalten sie ebenfalls eine Kategorienzuordnung. Die jeweiligen Kategorien sind mit KK gekennzeichnet und stehen für „Kategorie Klinik“. Auch hier wird die jeweilige Kategorie von zwei Ankerbeispielen eingerahmt. KK 1 Allein gelassen KK 2 Nicht mehr ins Krankenhaus KK 3 Wollte keiner kommen KK 4 Wollten mich nicht nehmen Kategorie 1: Allein gelassen (KK1) Während des Klinikaufenthaltes wird das Erleben des Alleinseins nicht immer als Belastung empfunden. Doch wenn das Gefühl des „Allein gelassen seins“ aufgrund der Isolation belastend empfunden wurde, sind die Erlebnisse noch Wochen nach Entlassung aus der Klinik präsent und nehmen einen großen Teil innerhalb des Interviews ein. Teilweise stehen 81 diese Erlebnisse einer erneuten Einweisung entgegen. Die türkische Interviewpartnerin berichtet: „Die sagen, was hast Du? Ich, Immer Angst. Ich immer, nix gut, immer alleine, alleine, alleine. Ich immer denken, denke (Großmutter)“ Interview B, Seite 2, Zeile 83-84 Ankerbeispiele • Wie son`n Aussätziger allein gelassen • Immer alleine, alleine, alleine • Isolation • Ertragen • Gesperrt • Persönlichkeit wird eingeschränkt Interview A B C F G H Zeilennummer 317, 502 84 560 17 391 842 „Ja, wo ich dann so (0.3) ziemlich ratlos war, sag ich mal, ich hätte gern mal eh mit nem Arzt da vernünftig drüber gesprochen, Auswirkungen, un un, so. Da kam keiner. Wurde praktisch, wie so`n Aussätzigen da alleine gelassen und fertig. Un dat hab ich nich verstanden.“ Interview A, Seite 11, Zeile 502-505 Allerdings kann eine Isolation auch als Vorteil und das Alleinsein als wohltuend empfunden werden. Denn nicht jeder Mitpatient ist ein guter Gesprächspartner mit dem man sich versteht. „Wenn Sie mal zwei Kollegen haben, die vielleicht blöd sind, dann werden Sie noch kränker, ne? Wenn Sie allein liegen, dat ist je nach Mentalität auch schön und gut, aber man ist eben nicht alleine. Dat ist aber wieder en`anderes Problem, dat ist vielleicht ein soziales Problem.“ Interview C, Seite 4, Zeile 147-152 Kategorie 2: Nicht mehr ins Krankenhaus (KK2) Das Isolationserleben kann derart traumatisch sein, dass diese Erlebnisse auch nach Entlassung in Erinnerung bleiben und einer erneuten Klinikeinweisung entgegenstehen. „Das es Jemand verändert un dat man auch vielleicht mal andere Gedanken kriegt, und versucht irgendwie aus dieser, dieser Prämisse rauszukommen, von wegen, Ah, Du gehst nich mehr ins Krankenhaus, Du läßt Dir das nicht mehr bieten.“ Interview A, Seite 9, Zeile 421-424 82 Ankerbeispiele • Nicht mehr bieten • So schnell nicht ins Krankenhaus Interview Zeilennummer A 422 E 564 „Deshalb kriegt mich auch so schnell keiner mehr ins Krankenhaus.“ Interview E, Seite 12, Zeile 561-565 Kategorie 3: Wollte keiner kommen (KK3) Die Isolation in der Klinik aufgrund einer MRSA Infektion oder Kolonisation hat Auswirkungen auf die pflegerische Versorgungsqualität. Die Betroffenen fühlen sich unzureichend behandelt, da sie mitunter lange warten müssen, bis eine Pflegekraft auf ihren Ruf reagiert. Die Betroffenen vermuten, weil das Anlegen der Schutzkleidung unbequem ist, würden Pflegekräfte dies verweigern und die Betroffenen nicht so versorgen, wie jemanden der keine MRSA Kolonisation und/ oder Infektion hat. „Ja, ich kann mich noch dran erinnern, (husten), dat ich von Schwestern schlecht behandelt wurde, also immer Wollte keiner reinkommen (Ehefrau). Weil sie sich alle umziehen mußten. Ja. Dat se dat nicht gerne machen, ne!“ Interview E, Seite 4, Zeile 144-152 Ankerbeispiele • Wollte keiner kommen • Keiner kam Interview Zeilennummer E 146, 575 G 439 „Alle haben sich umgezogen und keiner kam.“ Interview G, Seite 10 Zeile 439 Kategorie 4: Wollten mich nicht nehmen (KK4) Eine MRSA Infektion oder Kolonisation kann dazu beitragen, dass nachbehandelnde Einrichtungen die Aufnahme eines Betroffenen aus Kostengründen verweigern. „[...] und da hatt`ich den KEIM und da hieß es, im .....(Name/ 83 Institution)„ Sie müssen erst isoliert werden, und, eh, es wird sie nie ein anderes Krankenhaus übernehmen.“ Interview C, Seite 13, Zeile 587- 589 Ankerbeispiele Interview Zeilennummer E 242 • Die wollten mich nicht nehmen 591 • Wird Sie nie ein anderes Krankenhaus C übernehmen „Mit den Patienten, die Pfleger die da warn in in in äh .... (Ort) die kannten das gar nicht, dat war gar nicht so bekannt, oder haben noch keine Patienten gehabt die den Keim hatten. Die wollten mich ja gar nicht nehmen.“ Interview E, Seite 5-6, Zeile 238-242 8.4 Hauptkategoriebildung für Klinik Relevanz Die Kategorien, die für den Klinikaufenthalt von Bedeutung sind, werden in einem weiteren Arbeitsschritt einer großen Hauptkategorie zugeordnet. Somit stellen die bisher vorgestellten Kategorien, Unterkategorien dar, die nun zu einer Hauptkategorie zusammengefaßt werden.235 Die Unterkategorien, die für den Klinikbetrieb von Bedeutung sind (KK), werden der Hauptkategorie (HKK) „Schlecht behandelt“ zugeordnet. Dabei steht HKK für Hauptkategorie Klinik. Schlecht behandelt (HKK) Allein gelassen KK 1 Nicht mehr ins Krankenhaus KK 2 Wollte keiner kommen KK 3 Wollte mich keiner nehmen KK 4 8.5 Hauptkategoriebildung, bezogen auf die Forschungsfrage Die Unterkategorien, bezogen auf die Forschungsfrage, stehen relativ ungeordnet 235 und unsystematisch nebeneinander. Um sie zu vgl. Mayring 2003, Seite 89 84 systematisieren, werden sie ebenfalls in einem weiteren Arbeitsschritt mehreren Hauptkategorien zugeordnet. Nach Abschluß dieser Zuordnung, entstehen vier große Hauptkategorien (HK), denen die entsprechenden Unterkategorien (K) zugeordnet werden. Hauptkategorien (HK) 1. Fehlende Gespräche (HK) 2. Abwehr (HK) 3. Fehlende Anteilnahme (HK) 4. Alltagserleben (HK) Fehlende Gespräche Abwehr Reden K1 Vergessen K2 Verkleiden Alltagserleben Fehlende Anteilnahme K6 Schuld Ernst K11 Normal K7 K12 nehmen Angst, Andere K3 anzustecken Zum K5 Schluß Arbeitsplatz K4 Gefährlich K8 Wäsche K9 Hausarzt K10 Keim K13 9 Interpretation der Ergebnisse Die Interpretation der Ergebnisse versteht die Autorin analog der philosophischen Betrachtungsweise als erkenntnistheoretische Position, die im Gegensatz zum Rationalismus, Erfahrungen als rein Gedachtes begreift.236 Die Interpretation der Ergebnisse finden unter Berücksichtigung, der inhaltsanalytischen Gütekriterien Mayrings, Argumentative Interpretationsabsicherung (schlüssige Interpretation, Brüche erklären, Alternativdeutungen suchen) und Nähe zum Gegenstand 236 vgl. Schülerduden Philosophie 2002, Seite 109 85 statt. Um das Erleben und die Erfahrungen Betroffener möglichst realistisch darzustellen, erfolgt die Interpretation unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten. Nach Allport, ist Sozialpsychologie eine Disziplin, „die versucht zu verstehen und zu erklären, wie die Gedanken, Gefühle und Handlungen von Individuen durch die wahrgenommene, vorgestellte oder implizierte Gegenwart anderer beeinflußt wird.“ 237 9.1 Beziehungsbildung der Hauptkategorien Die vier Hauptkategorien: Fehlende Gespräche → Abwehr → Fehlende Anteilnahme → Alltagserleben, werden in Beziehung zueinander gebracht. Eine andere Anordnung der Hauptkategorien läßt auf folgende mögliche Beziehung zueinander schließen. Abwehr (K6) führt Alltagserleben zu Normal (K7) Fehlender Anteilnahme (K5, K11, K12) führt zu Fehlende Gespräche (K1, K2, K3, K4, K8, K9, K10, K13) Die Schutzkleidung wird von den Betroffenen mit „Verkleidung“ beschrieben und als Abwehr ihnen gegenüber empfunden. Aufgrund der Abwehr empfinden die Betroffenen fehlende Anteilnahme, die dazu führt, dass Gespräche nicht stattfinden. Die Hauptkategorie „Alltagserleben“ steht isoliert neben den übrigen Kategorien, da sie sich mit der Aussage „Normal“, nicht der Systematik zuordnen läßt. Das deckt sich mit Aussagen der Interviewpartner, die beschreiben, dass sie nach erlebter Isolation während des Klinikaufenthaltes den Keim ignorieren, als Nebensache empfinden und im Gegensatz zum stationären Aufenthalt keine Veränderung im häuslichen Umfeld spürbar ist. 237 Allport 1968, In. Wagner, Vorlesungsskript Sozialpsychologie 2007, Seite 5 86 Obwohl der Betroffene in Interview E Unterstützung durch den Pflegedienst erhält und aufgrund seiner MRSA Infektion erst Mittags die Grundpflege durchgeführt wird, empfinden er und seine Ehefrau den Alltag als „normal“. „Ganz normal. Keim ist eigentlich nicht die Hauptsache bei uns (Ehefrau) [Keim, ich weiß doch nicht (07). Der Keim tut ja nicht weh, dat soll aber soll aber an der Prozeß von der Heilung, da soll et äh angeblich drin, äh ich äh es wird ja ja wegen Haushalt wird ja nichts gemacht.“ Interview E, Seite 7, Zeile 321-327 „[Und mittags ist die Grundpflege [ (Ehefrau). Also Vormittag sagen wir mal so zwischen 10 und 12 Uhr, genau weiß man das nicht so.“ (Ehefrau)“ Interview E, Seite 11, Zeile 522-526 9.2 Beziehungsbildung der Hauptkategorien zueinander Obwohl die Hauptkategorie „Schlecht behandelt“ für den Klinikaufenthalt relevant ist, wird diese Hauptkategorie (HKK) mit den Hauptkategorien bezogen auf die Forschungsfrage (HK) konfrontiert und ebenfalls in Beziehung zueinander gebracht. Abwehr (HK) Alltagserleben (HK) Fehlende Anteilnahme (HK) Fehlende Gespräche (HK) Schlecht behandelt (HKK) Nach zuletzt durchgeführter Beziehungsbildung der Hauptkategorien zueinander, stellt sich die Taxonomie so dar, dass die „Abwehr der Betreuungspersonen“ zu „fehlender Anteilnahme“ führt, dies wiederum zu „fehlenden Gesprächen“, was summativ von den Betroffenen mit „schlecht behandelt“ beschrieben wird. Nach wie vor steht die Hauptkategorie „Alltagserleben“ isoliert neben den übrigen Hauptkategorien. In der folgenden Abbildung wird dargestellt, dass die Abwehr der Pflegenden als fehlende Anteilnahme und fehlende Gespräche erlebt 87 werden, die im Oberbegriff „Schlecht behandelt“ münden. Die empfundene „schlechte Behandlung“ führt dazu, dass sie ihren Alltag als „normal“ erleben. 88 Taxonomie Legende: Abwehr (HK) Verkleiden (K6) Führt zu Mündet in Fehlende Anteilnahme (HK) Schuld (K11) Ernst nehmen (K12) Zum Schluß (K5) Alltagserleben (HK) Fehlende Gespräche (HK) Reden (K1) Angst, andere anzustecken (K3) Vergessen (K2) Arbeitsplatz (K4) Gefährlich (K8) Wäsche (K9) Keim (K13) Hausarzt (K10) Normal (K7) Schlecht behandelt (HKK) S Allein gelassen (KK1) Nicht mehr ins Krankenhaus (KK2) Wollte keiner kommen (KK3) Wollte mich keiner nehmen (KK4) Abbildung 3: Taxonomie der Hauptkategorien und Unterkategorien zum „ Erleben und Erfahrungen Betroffener mit einer Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung“, Eigene Darstellung“ Obwohl die Kategorie „schlecht behandelt“ eher für den Klinikbetrieb relevant ist, verdeutlicht die Taxonomie, dass diese Kategorie nicht isoliert zu sehen ist. Die Taxonomie zeigt, dass das Erleben und die Erfahrungen Betroffener mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der Klinik, Auswirkungen auf das Erleben in der häuslichen Umgebung hat. Erst durch die empfundene „schlechte Behandlung“ in der Klinik, wird das Alltagserleben als befreiend und normal empfunden. 89 9.3 Zusammenfassung des Ergebnisteils Für den Soziologen Atteslander bedeutet Empirie die Überprüfung theoretisch formulierter Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten. Die philosophische Betrachtungsweise begreift Empirismus als erkenntnistheoretische Position ist, die im Gegensatz zum Rationalismus, Erfahrungen als rein Gedachtes begreift. Als rein Gedachtes, versteht die Autorin ihre Darstellung der Ankerbeispiele der jeweiligen Interviewtranskripte, die in einzelnen Unterkategorien zusammengefaßt sind. Zur Darstellung möglichst realistischer Lebenswelt der Betroffenen, wird weitestgehend die Alltagssprache beibehalten. Bezogen auf die Forschungsfrage des „Erlebens und der Erfahrungen Betroffener mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Kolonisation in der häuslichen Umgebung“, sind dreizehn Unterkategorien in einem weiteren Arbeitsschritt zu vier Hauptkategorien zusammengefaßt worden. Von Interesse für den Klinikbetrieb ergeben sich aufgrund der Interviewtranskripte vier Unterkategorien, die in einer Hauptkategorie zusammengefaßt sind. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die fünf Hauptkategorien miteinander in Beziehung gebracht, woraufhin sich eine Taxonomie abbilden läßt. Die Hauptkategorie „Alltagserleben“ steht dabei isoliert, da sie sich mit der Aussage „Normal“ nicht der Taxonomie zuordnen läßt. Die Taxonomie verdeutlicht, dass das Erleben und die Erfahrungen Betroffener mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der Klinik, Auswirkungen auf das Erleben in der häuslichen Umgebung hat. Denn erst durch die empfundene „schlechte Behandlung“ aufgrund der Isolation wird das Alltagserleben als „Normal“ erlebt. 90 Schlußteil 10 Abgleich zwischen Theorie und Empirie Damit nach Mayring Ausgangsmaterial eine stattfinden Rücküberprüfung kann, werden der Theorie am Literaturangaben mit Zitationsangabe, mit den empirischen Ergebnissen durch Interviewzitate belegt und abgeglichen.238 Der Abgleich zwischen empirischem und theoretischen Teil erfolgt analog der Einordnung der Literaturrecherche nach medizinischer Relevanz, normativen Vorgaben und soziologischen Aspekten. Nachfolgend werden Übereinstimmungen zwischen Theorie und empirischen Ergebnissen dargestellt. Medizinische Relevanz Begünstigende Faktoren einer MRSA Kolonisation- bzw. Infektion Übereinstimmung zwischen Theorie und Empirie liegt in der Aussage, dass sowohl patienteneigene, als auch mit der Behandlung assoziierte Faktoren eine MRSA Kolonisation, bzw. Infektion begünstigen.239 Folgende Interviewpartner weisen entsprechende Faktoren auf: • Zunehmendes Alter (Interviewpartner E, F,H) • Abnehmende Mobilität (Interviewpartner A, C, E, H) • Katheter, insbesondere Harnwegskatheter (Interviewpartner E) • Andere Grundkrankheiten → Diabestes mellitus: Interviewpartner C, E , z.B. offene Wunden: A, B, C,E, F) • Hospitalisierung in den letzten 6 Monaten (Interviewpartner A, B, C, E, G, H) • Langandauernde Antibiotikatherapie (Interviewpartner E) „Im Krankenhaus. Übrigens war ich zum 19. Mal im Krankenhaus,“ Interview H, Seite 3, Zeile 114-115 238 239 vgl. Mayring 2003, Seite 60 vgl. lögd Studie 2002, Seite 7 91 Antibiotikaresistenz Die Methicillinresistenz von Staphylococcus aureus , d.h. die Unempfindlichkeit des Erregers gegenüber sogenannten staphylococcen wirksamen, penicillinasefesten Penicillinen, stellt gegenwärtig den für die klinische Praxis problematischen Resistenzmechanismus dar.240 Für Betroffene und Behandler ist das eine schwierige und mitunter langwierige Situation, bis ein verträgliches Antibiotika gefunden wird. Ein Interviewpartner äußert explizit eine Antibiotikaunverträglichkeit (Interview E, Seite 12:Zeile 562) „Ja, ja wäre schön, wenn was gefunden würde, aber das ist natürlich (04) nicht so einfach, wenn Sie die ganzen Antibiotika nicht vertragen, ne, dann muß man suchen bis er das verträgt, ne!“ (Ehefrau) Interview E, Seite 12, Zeile 561-563 Ursachen nosokomialer Infektionen Nosokomiale Infektionen werden meist durch banale Erreger verursacht, deren Übertragung gleichzeitig mit der Behandlung und Pflege erfolgt. Als Haupt-Übertragungsursache gelten Vernachlässigung der klassischen Hygienevorschriften, mangelnde Qualifikation des Personals, unkritische Anwendung von Antibiotika, Platzmangel und Zunahme hospitalisierter Problempatienten mit 241 Reaktionsmechanismen. veränderten 242 Chirurgische immunologischen Intensivstationen und Einheiten für die Betreuung Neugeborener und Brandverletzter sind besondere Risikobereiche.243 „[...] dann haben se mich operiert, dat is aber derart schief gegangen die Operation, dat ich zur Intensiv runter mußte, weil dat so lange gedauert hat. Ja und dann hab ich nachher noch mal wieder eine Bypass-Operation gekriegt und dann habe ich mir wohl die Keime geholt.“ Interview E, Seite 1-2, Zeile 43-47 240 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 954 vgl. a.a.O., Seite 954 242 vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr.5/ 2005, Seite 36 243 vgl. a.a.O., Seite 37ff 241 92 Die Betroffenen benutzen nicht den Ausdruck MRSA, sondern sprechen von „dem Keim“ (A 1: 18, 7: 312, B 1:30, 2:93, C 1:4, S.2:54, 13:589, E 2:47-60, 4:173, G 15:697, H 7:388, 6:283, 2: 64+85). Lediglich einem Interviewteilnehmer ist der Name des Bakteriums Staphylococcus aureus bekannt. Alle übrigen Betroffenen sprechen von dem „Keim“. Den Keim im Krankenhaus erworben zu haben, geben an: A1:30-31, C 11:505, E 2:4548, G 2:79. „[Ne, ich sacht ja 2001 kamen zum ersten Mal die Staphylokokken, ich sach extra diesen Begriff, staphylococcus aureus, [...]“ Interview C, Seite 15, Zeile 717-718 Hausärztliche Versorgung In der Literatur wird eine oftmals problematische Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten beschrieben, da ihnen teilweise die erforderlichen Kenntnisse fehlen.244 Fachliche Defizite von seiten der Hausärzte werden von vier Interviewpartnern beschrieben (A 5:217, C 5:230, E 8:363, H 11:511). „Sie kriegen ja auch hier keine Verhaltens <.hh>, sach ich jetzt, vom Krankenhaus, oder vom Hausarzt, oder, ach der andere Hausarzt weiß sowieso nix. Nach dem Motto: <.h> „Seien Sie vorsichtig, SIE sind vielleicht nicht gefährdet, aber <.h> jemand Externer könnte vom Keim betroffen werden.“ Interview C, Seite 5, Zeile 230-233 Gesetzliche Vorgaben Mehraufwand Nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern auch in der ambulanten Versorgung werden die Mitarbeiter vor immer größer werdende Aufgaben gestellt.245 Ambulante Pflegedienste sind gehalten, MRSA Betroffene zur Vermeidung einer möglichen Keimverschleppung zuletzt zu versorgen.246 (E 8:347). 244 vgl. Hibbeler 2006, In: Popp et al. 2006, Seite 18 vgl. Ludwig 2005, Seite 32ff 246 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 155 245 93 „Dann müssen wir sofort, muß ich sehen das ich Zeug kriege und wir werden sie jetzt zum Schluß immer nehmen“ Interview H, Seite 8, Zeile 346-347 Für die Einrichtung bedeutet das erhöhten Mehraufwand durch Umstellung des Tourenplanes und erhöhten Zeitdruck, da die Zeit des Umkleidens in der Versorgungszeit inbegriffen ist. Der Ergebnisbericht der MDK Qualitätsprüfungen Baden-Württembergs bestätigt, dass immer mehr Patienten von immer weniger und größeren Pflegediensten versorgt werden.247 Eine Interviewpartnerin beschreibt die Einhaltung eines strikten Zeitplanes. „Ja, obwohl, äh, die Schwester vom Pflegedienst hat jetzt 12 Minuten Zeit, um mich zu waschen und anzuziehen. Man muß sich mal vorstellen. 12 Minuten. Das mußten sie innerhalb dieser Zeit leisten, und das konnte se nicht.“ Interview H, Seite20, Zeile 873-897 Für ambulante Pflegedienste ist die Versorgung MRSA Betroffener mit höheren Kosten verbunden, weil der Arbeitgeber die Kosten für die erforderlichen Arbeits-und Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Mundschutz, Haube, Händedesinfektionsmittel, Hautschutz-und Hautpflegemittel etc.) nicht den Beschäftigten auferlegen darf. Händedesinfektionsmittel gehören sowohl zum Patienten- als auch zum Mitarbeiterschutz und sind als Betriebsmittel anzusehen.248 „Ich hab mir gekauft Desinfeziersmittel, ich hab mir gekauft Desinfizier für Bad und Toilette für die Hände, ich hab mir diese Seife gekauft, [...]“ Interview G, Seite 1, Zeile 24-27 Schutz Gemäß den Vorgaben des RKI sind bei Betreten des Patientenzimmers ein Kittelwechsel vorzunehmen und der Mund und Nasen-Schutz anzulegen.249 Die Betroffenen sprechen im Zusammenhang mit der 247 vgl. Mohrmann et al. 2005a, Seite 245ff Fischer-Böhm 2006, Korrespondenz 249 vgl. RKI Empfehlung 1999, Seite 955 248 94 Schutzkleidung von „Verkleiden“. Sie erleben, ein inkonsequentes Verhalten bei Mitarbeitern in bezug auf Anlegen der Schutzkleidung (A 3:133, B 5:198, E 3:132, H 2:45). „[...] teilweise kommt der Arzt mit nem Kittel und so schützt sich, teilweise auch nicht.“ Interview E, Seite 3, Zeile 122-123 Hinweise für inkonsequentes Verhalten in Bezug auf Schutzmaßnahmen und Händehygiene sind in der Literatur zu finden. Laut Pittet sind die Ursachen für inkonsequentes Verhalten bezüglich der Schutzmaßnahmen, Händehygiene und somit begünstigende Faktoren in der Übertragung von MRSA von Personal auf Patienten: Mangelnde Ausbildung und Erfahrung, mangelnde Kenntnis der geltenden Empfehlungen, Beruf Arzt, männliches Geschlecht und „Status des Unbelehrbaren.“250 Desinfektionsmittel Gemäß SGB V gelten Händedesinfektionsmittel als Nichtarzneimittel und stellen kein Hilfsmittel dar.251 Folglich werden Händedesinfektionsmittel nicht rezeptiert und sind von den Betroffenen selbst zu zahlen. Eine Interviewpartnerin berichtet, dass sie Desinfektionsmittel selbst gekauft hat. Die übrigen Betroffenen machen keinerlei Angaben zur Beschaffung und Gebrauch von Desinfektionsmitteln. „Ich hab mir gekauft Desinfiziersmittel, ich hab mir gekauft Desinfizier für Bad und Toilette für die Hände, ich hab mir diese Seife gekauft, aber das geht nicht weg.“ Inter view G, Seite 1, Zeile 24-.28 250 251 vgl. Pittet et al 2004, In: RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr. 5/ 2005, Seite 36 vgl. §§ 33 SGB V 95 Soziologische Aspekte Stigma Die in der Literatur beschriebene Stigmatisierung bei chronischen Erkrankungen und/ oder Erkrankungen unklarer Genese, 252 253 wird von allen Betroffenen beschrieben (A 7:319, B 2:85, C 5:239, F 1:20, G 9:421, H 18 852). Während Interviewpartner A das Gefühl vermittelt wird, ein Aussätziger zu sein, präzisiert ein Betroffener das Stigma, mit der Aussage: „Deswegen ist dat ja immer so blöd. Wenn man hier, „Ach der KEIM,“ sofort Einzelzimmer, zack, zack“ Interview C, Seite 5, Zeile 238-239 Literaturangaben belegen, dass die Nichtbeachtung eines Stigmas eher gut angepaßten Stigmatisierten gelingt, die ihre Identität akzeptieren und sich schon einige Zeit mit dem Stigma auseinandergesetzt haben.254 „[...] ich habe ihn ignoriert.“ Interview H, Seite7, Zeile 305 Macht-Zwang-Strategie Die Betroffenen beschreiben, sobald sie sich nach der Entlassung aus der Klinik im häuslichen Umfeld befinden, empfinden sie ihren Alltag als normal. Der Keim wird nicht mehr thematisiert, interessiert niemanden außerhalb des Krankenhauses und gerät somit in Vergessenheit. „Die Keimstory hat keinen mehr interessiert. Außerhalb des Krankenhauses“ Interview C, Seite 10, Zeile 454 Aussagen der Literatur belegen, dass die erreichten Änderungen wegfallen, sobald die dahinterstende Macht der Macht-Zwang-Strategie wegfällt.255 Wie hier, im Falle der Entlassung aus der Klinik. 252 vgl. Weidmann 2001, Seite 61 vgl. RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr.5/ 2005, Seite 35 254 vgl. Dudley 1983, In: Lubkin 2002, Seite 177 255 vgl. Lubkin 2002, Seite 500ff 253 96 Betroffene, die keine Veränderung ihres Tagesablaufes durch die Versorgung des ambulanten Pflegedienstes erfahren, erleben ihren Alltag als normal (A 2:63, B 5:234, C 15:720, E 7:316). Gefährlich Gängige Diagnosen, die sich medizinisch nicht begründen lassen, werden dem magischen Bereich zugeordnet.256 Typische Merkmale einer Erkrankung, mit ungeklärter Ursache oder unwirksamer Therapie, gelten als mysteriös und häufig als ansteckend.257 Obwohl nicht alle Betroffenen Sorge haben, Außenstehende zu infizieren, stellen sich alle aufgrund der Isolation die Frage, ob ihre Erkrankung gefährlich sei. Außerdem ist den Betroffenen unklar, welches Ausmaß der Gefährlichkeit die Erkrankung im häuslichen Umfeld darstellt (A 6:270, B 4:157, C 2:94, E 3:115, F 1:33, G 2:48, H 4:190). „Isoliert ganz allein in ein Zimmer und dann sagt die Ärztin, es wäre nicht gefährlich.“ Interview G, Seite 2, Zeile 47-48 Die Ungewißheit, ob die Erkrankung gefährlich ist oder nicht, verstärkt sich durch fehlende ärztliche Aufklärung oder Information.258 „Obwohl ich gar nicht wußte, wat los ist. Man wird einfach weggesperrt und fertig. Aber einem richtig wat sagen, kein Arzt, kein Pfleger, kein Nichts. Konnte einem keiner wat sagen.(Ja und ich da saß), wußte gar nicht, wat los war.“ Interview A, Seite 2, Zeile 44-46 Freiheitsentzug Die von „Anderen auferlegte soziale Isolation“ wird in der Literatur als individueller Freiheitsentzug beschrieben. Die Freiheit von Betroffenen wird sowohl als persönliches Recht, wie auch als Besitz betrachtet.259 256 vgl. Parin 1978, Seite 384, In: Weidmann 2001, Seite 61 vgl. Sonntag 1977, In: Lubkin 2002, Seite176 258 vgl. Hulskers 2001, Seite 41 259 vgl. Foucault 1994, Seite 18 257 97 „ Und das se vor de Tür stehen, hier in dieses Zimmer darf ich nicht rein, es sei denn, ich verkleide mich. Dat finde ich nicht in Ordnung. Die Persönlichkeit wird eingeschränkt, ja.“ Interview H, Seite 18-19, Zeile 831-853 Nicht alle Betroffenen beschreiben explizit eine Einschränkung der Persönlichkeit. Doch alle Interviewpartner erleben die Isolation als „eingesperrt sein“ (A 7:319, B 2:85, C 5:239, F 1: 20, G 9:421, H 18: 852). Seelische Schmerzen Aufgrund der Isolation, kommt es möglicherweise zu ungewollten, aber unvermeidlichen Konsequenzen. Der Verursachung seelischer Schmerzen.260 Die Betroffenen bezeichnen diese seelischen Schmerzen jeweils individuell unterschiedlich. „Nö, durfte nich raus. Durfte Zimmer nich verlassen. Dat drängt mich dann un dann (0.2) dann gibt bei mir eins, entweder so oder so. Da ich nich raus konnte, also, dat is meiner Meinung auch, diese ganze Verfahrenweise is (0.5) ähm, auch ne psychische Sache, ne?“ Interview A, Seite 4, Zeile 161-164 Während eine Betroffene beschreibt „es ging mir schlecht“, sagt ein anderer „Ich war traurig“, oder „Die Nerven ballern hoch.“ Aber die Gesamtaussage der isolierten Betroffenen durch MRSA lautet: „Im Krankenhaus wird man krank“ (A. 4:164, B 2:87, C 5:239, E 4:190, G 3:113). Schuldgefühl Gefühle der Schuld oder Beschämung können aufgrund der Isolation und durch die Macht-Zwang-Strategie ausgelöst werden.261 Zwei Interviewpartner haben Gefühle des Schuldigseins verbalisiert (A 4: 174, H 8: 342, 18:824). „Ja, dass man äh, äh, sich schuldig fühlt. Ich hab was gemacht, was nich in Ordnung ist, deshalb sondern sich jetzt die anderen ab. So nen 260 261 vgl. a.a.O., Seite 18 vgl. Chinn, Benne 1976, In: Lubkin 2002, Seite 500ff 98 ganzes Gefühl hat man.“ Interview H, Seite 18, Zeile 824-826 Reden Laut Bott ist der Erwerb von ausreichendem Wissen über die Therapieanforderung eigenverantwortliche die Voraussetzung Therapie.262 Daher für ist eine ärztlicher erfolgreiche Kontakt für Betroffene wichtig, um genügend Informationen zu erhalten und um Fragen stellen zu können.263 Hulstert beschreibt, dass Erklärungsmangel die meist genannten Ursache, für Angst, Furcht und Ärger sind. In einer Untersuchung von Walker et al. (1998) waren Pflegefachkräfte die häufigsten Lieferanten für Informationen über chirurgische Vorgänge und Pflege.264 „Schlecht ging es mir, ich hab den ganzen Tag geweint. [ Wegen diesem Virus, weil ich wußte nicht, wie er ist, was es ist und ich weiß nicht mal bis HEUTE, die Ärzte sagen, ich bin ja kein Arzt.“ Interview G, Seite 2, Zeile 112-118 Erfahrungen, die im „Patient Learning Center“ in Bosten/ USA, gemacht wurden, zeigen, das informierte Patienten, die über ihre Erkrankungen und Therapie-Möglichkeiten informiert wurden, motivierter sind an ihrem Gesundheitsprozeß aktiv mitzuarbeiten und dadurch schneller genesen.265 „einfach so menschlich, einfach mal REDEN, ne?“ „[...] ja und dann hätte man, kleine Verfahrensweise vielleicht etwas sagen müssen.“ Interview C, Seite 15, Zeile 684 und 687 Alle Betroffenen geben an, nicht genügend Information zur Krankheit selbst und zu Schutzmaßnahmen erhalten zu haben. Die Aufklärung über den Keim und Isolationsnotwendigkeit erfolgte durch Pflegepersonal (A, 1:22, B 6:291, C 1:18, E 2:52, G 1:10, H 1:33). Literaturangaben bestätigen, dass der Bereich der Hygiene pflegerischem Personal 262 vgl. Bott 2000, In: Stiletto 2003, Seite 15 vgl. Hartmann 2004, Seite 154 264 vgl. Walker et al. 1998, In: Hulskers, In Pflege 01/ 2001, Seite 41 265 vgl. Abt-Zegelin, In: Schwester/ Der Pfleger 09/1997und 01/2000 263 99 zugeordnet wird.266 „Der Arzt hat gar nichts gesagt, sondern der Pfleger. Der Pfleger kam und sagte, sie haben einen Keim.“ Interview H, Seite 1, Zeile 10-11 10.1 Diskussion der Ergebnisse und Erkenntnisgewinn Die in der lögd-Studie 2002 festgestellten Risikofaktoren für eine MRSA Besiedelung können durch die Interviews verdeutlicht werden. Aufgrund der vorliegenden, unterschiedlichen Grunderkrankungen (Interviewpartner A, B, C, E, F), werden wiederholte Krankenhauseinweisungen erforderlich (Interviewpartner A, B, C, E, G, H). Bei Krankenhauseinweisungen werden gemäß der RKI Empfehlung, Patienten mit genannten Risikofaktoren, sowie bekannter MRSA Anamnese, auf Vorliegen einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion gescreent. Bei Vorliegen eines positiven Befundes und bei Patienten mit bekannter MRSA Anamnese, werden diese solange isoliert, bis ein negativer Befund vorliegt.267 Ein Interviewpartner präzisiert das Procedere mit der Aussage, dass der Begriff „Keim“ in der Klinik mit Einzelzimmer verbunden ist (C 5: 239). Das das Bakterium Staphylococcus aureus häufigster Vertreter nosokomialer Infektionen ist, wird durch die Interviews (A1:30-31, C 11:505, E 2:45-48, G 2:79) deutlich. Die sowohl in der medizinischen, als auch in der soziologischen Literatur beschriebene Stigmatisierung und somit Belastung für die Betroffenen, haben alle Interviewpartner erlebt (A 7:319, B 2:85, C 5:239, F 1:20, G 9:421, H 18 852). Aufgrund der Isolierung kommt es zu ungewollten, aber unvermeidbaren seelische Auswirkungen, die von den Betroffenen schmerzhaft erlebt wurden (A 4:164, B 2:87, C 5:239, E 4:190, G 3:113). Zwei Interviewpartner äußern ein Gefühl des Schuldigseins (A 4: 174, H 8: 342, 18:824), selbst für ihre MRSA Kolonisation und/ oder Infektion verantwortlich zu sein. 266 267 vgl. Weidmann 2001, Seite 66 RKI, In: Epidemiologisches Bulletin Nr. 42/ 2005, Seite 2 100 Das Informationsmangel bezüglich der Erkrankung Ursache für Angst, Furch und Ärger sind, bestätigen die Interviews (A 1:22, B 6:291, C 1:18, E 2:52, G 1:10, H 1:33). Die Interviews verdeutlichen, dass ihnen der Begriff MRSA fremd ist und benutzen den Ausdruck „Keim“ (A 1: 18, 7: 312, B 1:30, 2:93, C 1:4, S.2:54, 13:589, E 2:47-60, 4:173, G 15:697, H 7:388, 6:283, 2: 64,85). Der Informationsmangel verstärkt das Gefühl, an einer dubiosen, mysteriösen, gefürchteten und gefährlichen Erkrankung zu leiden (A 6:270, B 4:157, C 2:94, E 3:115, F 1:33, G 2:48, H 4:190). Obwohl die Erkrankung von allen Interviewpartnern möglicherweise als gefährlich angesehen wird, haben lediglich die weiblichen Betroffenen Sorge, ihre Familienangehörigen und Bekannte zu infizieren (B 3:34, G 1:24, H 13: 588). Mögliche Erklärung dafür ist, wie Literaturhinweise belegen, dass in der Vergangenheit an der Betreuung chronisch Kranker oft die erweiterte Familie und die nicht berufstätige Ehefrau beteiligt war. Somit die Krankenpflege, den weiblichen Familienangehörigen oblag.268 Isolation verbinden die Betroffenen mit schlechter Behandlung, weil sie erlebt haben, dass sie oft lange nach ihrem Ruf warten müssen, weil Pflegefachkräfte nicht oder nur ungern das Patientenzimmer betreten (E 4:146, G 10:439). Dies kann dazu führen, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen werden möchten (A 9:423, E 12:564). Das Gefühl wird verstärkt durch das in der Literatur beschriebene Wegfallen der Macht-Zwang-Strategie. Nach erfolgter Entlassung erleben die Betroffenen ihr häusliches Umfeld als normal (A 2:63, B 5:234, C 15:720, E 7:316). Da der „Keim“, der Umgang damit und entsprechende Schutzmaßnahmen in der häuslichen Umgebung nicht thematisiert werden, entsteht der Eindruck, dass der Keim nur in der Klinik zum Ausbruch kommt (C 3:99). Der Hausarzt spricht das Thema ebenfalls nicht an und somit gerät der „Keim“ im Alltagserleben in Vergessenheit (A 2:63, B 5:234, C 15:720, E 7:316). 268 vgl. Lubkin 2002, Seite 505 101 Keiner der Betroffenen gibt an, Verhaltensmaßnahmen zur Händedesinfektion erhalten zu haben. Weder zur Anwendung, noch zur Beschaffung von Händedesinfektionsmittel sei etwas gesagt worden. Die Interviews zeigen, dass die häusliche Versorgung als normal erlebt wird, wenn keine Versorgung durch den ambulanten Pflegedienst erforderlich ist (A 2:63, B 5:234, C 15:720, E 7:316). Ansonsten stellen die Interviews heraus, dass aufgrund möglicher Keimverschleppung, Betroffene am Ende einer Tour versorgt werden. Dadurch erfahren die Betroffenen und ihre Angehörigen eine Veränderung ihres TagesRhythmus und veränderten Tagesablauf (E 11:521, F 1:26, H 8:352). Außerdem besteht Übereinstimmung zur Literatur, dass ein striktes Zeitmanagement von Mitarbeitern ambulanter Pflegediensten einzuhalten ist, da die Umkleidezeit in der Versorgungszeit inbegriffen ist.269 Das kann zur Folge haben, dass Anteilnahme bei der Versorgung verloren geht (H 20:901). Durch die Interviews wird deutlich, dass alle Betroffenen nicht genügend Information zu ihrer Erkrankung selbst und zu Schutzmaßnahmen erhalten haben (A 1:22, B 6:291, C 1:18, E 2:52, G 1:10, H 1:33). Alle Betroffenen sind vom Pflegepersonal zum Erreger und zur Isolationsnotwendigkeit aufgeklärt worden. Sowohl das Informationsdefizit, als auch die Isolationsbelastungen und damit verbundenen Einschränkungen in der pflegerischen Versorgungsqualität, werden als schlechte Behandlung empfunden (E 4:146, G 10:439). Diese Erfahrung, kann dazu führen, dass die Betroffenen nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen werden möchten (A 9:423, E 12:564). 269 vgl. Mohrmann et al. 2005a, Seite 245ff 102 Aussagen zum Keim Weder der Ausdruck MRSA noch staphylococcus aureus sind bei den Betroffenen bekannt. Daher sprechen sie ausschließlich von „dem Keim“. Es ist ein mysteriöser Keim, den man sich im Krankenhaus „eingefangen“ (A 7: 332) oder „geholt“ (E 2:47) hat. Auf die Frage, was das für ein Keim sei, wird einer Interviewpartnerin vom Pflegepersonal erklärt, das sei nicht schlimm, nur Kranke müssten sich schützen (H 1:10-15, B 5:214, C 16:695). Eine detaillierte Aufklärung über Infektionsweg und die Ursachen der Resistenzentwicklung unterbleiben. Der Keim scheint ein Krankenhauskeim zu sein, weil er nur von Bedeutung ist, wenn man im Krankenhaus ist. Außerhalb des Krankenhauses wird „der Keim“ nicht thematisiert (C 2: 62). Vielleicht ist er immer latent und wird nur im Krankenhaus virulent (C 2:87-88) und wäre nicht zum Ausbruch gekommen, wenn man zu Hause geblieben wäre (C 3:99). Die Betroffenen haben den Eindruck, dass der Keim von der Nase in die Wunde wandert und umgekehrt (E 13:617, C 11:532). Der Keim schmerzt nicht und stellt sich außer in den Abstrichen nicht dar (A 1:28, E 9:398, H 13:597). Aber etwas scheint mit dem Keim „nicht zu stimmen“ (G 10:474), denn im Krankenhaus „kommt niemand ohne Maske und Handschuhen ins Patientenzimmer hinein und dass soll es ungefährlich sein?“ (G 8:350). Außerdem müssen Außenstehende „vor dem bösen Keim geschützt werden“ (C 12:555). Eine Betroffene beschreibt, dass sie das Gefühl hatte, sie habe etwas gemacht, „was nicht in Ordnung sei“ und darum würden sich die Anderen absondern (H 18:818-820). Ein anderer Interviewpartner empfand, dass er „wie ein Aussätziger weggesperrt“ wurde (A 11:502) und alle nur „vermummt“ hereinkamen (A 7: 297). Da sich das Personal umziehen muss, betritt das Personal seltener das Patientenzimmer (E 3: 148). Daher empfindet ein Betroffener weniger gut 103 behandelt worden zu sein, als jemand, der keinen Keim hat (E 3: 164). 104 11.2 Schlußfolgerungen Mögliche Gründe dafür, warum Pflegekräfte seltenen zu MRSA Patienten gehen, sind wie bereits beschrieben, das unbequeme Anlegen der Schutzkleidung, schwitzen unter der Schutzkleidung und „festgenagelt sein“ in einem Zimmer. Prinzipiell ist es jedoch möglich, das in der Versorgung MRSA Betroffener dieses Paradigma vorherrscht, an das einfach „geglaubt“ oder das „vorgeschoben“ wird. Gibt es nicht weitere mögliche Gründe, warum MRSA Patienten gemieden werden? Ist es nicht möglich, dass eine Form der Systemabwehr vorliegt, die dazu führt, dass Pflegefachkräfte seltener zu MRSA Patienten gehen? 1. Das aseptische Dilemma Unter Hygiene versteht man heute „krankheitsverhütende Medizin,“ die Mikroorganismen zum Außenfeind erklärt und heftig bekämpft.270 Hygienische Rituale weisen dabei permanent auf den Außenfeind hin. Die Rituale spielen sich mit einem tiefen Ernst ab, der aus der Innenperspektive kaum wahrgenommen wird.271 In der Klinik wird der Bereich der Hygiene den pflegerischen Mitarbeitern zugeordnet, „sie sind für die Asepsis zuständig.“272 Die Zuständigkeit spiegelt sich in der Rechtswissenschaft wieder und so führen Richter in einem Hygieneurteil dazu aus: „Die allgemeine und spezifische Hygiene gehört zum pflegerischen Bereich, für dessen Einhaltung, Überwachung und Kontrolle nicht der ärztliche Dienst, sondern der Krankenhausträger bzw. dessen pflegerische Leitung zuständig und für Fehler haftbar ist. Insofern findet der Rechtsgedanke des § 282 BGB entsprechende Anwendung, als es um den Bereich des voll beherrschbaren Risikos der allgemeinen Gewähr hygienischer Verhältnisse geht.“ 273 270 vgl. Richter 1986, In: Weidmann 2001, Seite 61 vgl. a.a.O., Seite 62ff 272 a.a.O. 2001, Seite 66 273 OLG Zweibrücken 2004, Seite 8 271 105 In Weidmanns Untersuchung wird deutlich, dass Pflegefachkräfte mit „Argusaugen“ darüber wachen, dass auch ärztliche Mitarbeiter hygienische Maßnahmen anwenden.274 Des weiteren führt der Autor aus, dass Mitarbeiter, die eine hygienische Bewußtseinsperspektive verinnerlicht haben, eine Angst vor Ansteckungsgefahr häufig im Patientenkontakt mitschwingt.275 Nach Weidmanns Eindruck, werden die Mikroorganismen zum Außenfeind erklärt, der die Menschen bedroht und verfolgt. Der Bedrohung wird begegnet, indem die Pflegefachkräfte sich selbst zum Verfolger machen und zwischenmenschliche Kontakte zu MRSA- Betroffenen meiden. Sind Kontakte unvermeidlich, werden seiner Meinung nach durch rituelle Hygienemaßnahmen die Keime „abgewaschen“, um wieder rein zu sein.276 Dies ist im Falle eines Multi resistenten Staphylococcus aureus gleich doppelt schwierig. Einerseits kann so viel desinfiziert werden, wie möglich, in vielen Fällen ist eine Sanierung aussichtslos (MRSA Dauerausscheider). Zusätzlich besteht die Gefahr der eigenen Kontamination und eines Weitertransportes zu anderen Patienten. Somit liegt der Gedanke nahe, dass es sich bei der Aussage „Ich ziehe nicht so gern die unbequeme Schutzkleidung an“, um eine Form der Systemabwehr aufgrund Eigeninteresse handelt. 2. Heilungsparadigma Wie Eingangs beschrieben, handelt es sich bei den Ursprüngen medizinischer Betrachtungsweise um eine Reduzierung von meßbaren Größen, die nach dem Ursache-Wirkungsprinzip behandelt werden. Bei akuten Erkrankungen vergleichbar mit einer Reparatur. Allerdings ist das Reparaturparadigma bei chronischen Erkrankungen nicht anzuwenden, da viele unterschiedliche Faktoren wechselseitig und unlösbar miteinander verbunden sind. Daher lassen sich einzelne isolierte Ursache- 274 vgl. Weidmann 2001, Seite 67 vgl. a.a.O., Seite 98 276 vgl. a.a.O., Seite 106ff 275 106 Wirkungszusammenhänge bei chronischen Erkrankungen nicht abgrenzen. Auch Pflegefachkräfte „bekommen viel medizinisches Fachwissen mit auf den Weg, das sie nicht anwenden dürfe.“277 Somit sind auch sie Heilungsparadigmatisch geprägt und versuchen, einen Patienten mit einer Kolonisation und/ oder Infektion wie einen akut Erkrankten zu pflegen, bzw. versuchen ihn reparieren zu wollen. Dies stellt sich im Falle von MRSA als schwer lösbar dar, denn eine Unempfindlichkeit gegen eine Antibiotikaklasse ist nicht zu reparieren. Die Suche nach Alternativlösungen gestaltet sich schwierig, da bei den Betroffenen oft mehrere, unterschiedliche Grunderkrankungen vorliegen, diese oftmals chronisch krank sind. Zu Patienten die durch häufige, langandauernde Krankenhausaufenthalte geprägt sind, gestaltet sich die Beziehungsaufnahme mitunter schwierig. Die Erleichterung gelingt nicht durch den Versuch der intensiveren Beziehungsaufnahme, sondern durch eine weitergehende Distanzierung.278 Auch hier ist die Aussage „Ich ziehe nicht so gern die unbequeme Schutzkleidung an“, als eine Form der Abwehr aufgrund Selbstschutzes anzusehen. 3. Vernachlässigung der klassischen Hygienevorschriften Ursachen für die Verbreitung von MRSA sind u.a. „Vernachlässigung der klassischen Hygienevorschriften“ und als Hauptübertragungsweg gilt der Direktkontakt über kontaminierte Hände.279 Kann die Abwehr nicht Ausdruck des schlechtes Gewissens sein, mit eigenen Fehlern konfrontiert zu werden? Der Patient wurde möglicherweise in der Krankenhausumgebung von der betreuenden Pflegefachkraft selbst oder dem Arzt mit dem MRSA Erreger kolonisiert. Diese Möglichkeit erfordert zur Aufrechterhaltung einer eingespielten Balance eine große Portion Systemabwehr, um den Betroffenen weiter zu 277 Weidmann 2001, Seite 103 vgl. a.a.O. Seite 82 279 vgl. Kaminski et al. 2002, Seite 352 278 107 pflegen. 108 Auswirkungen der Systemabwehr Heintel und Krainz sprechen von verschiedenen Auswirkungen der Systemabwehr. Nach Aussagen der genannten Autoren ist Systemabwehr unbewußte unreflektierte und blinde Abwehr, die im Sinne einer Reaktionsautomatik geschieht, zur Aufrechterhaltung einer eingespielten Balance. Spielen hier nicht unbewußte Ängste der Pflegenden mit hinein?280 Der Angst vor Ansteckungsgefahr im Patientenkontakt?281 Hierbei kann einerseits die Angst vor der eigenen Infektion eine Rolle spielen, andererseits scheint der Unwille mit einem Betroffenen länger allein konfrontiert zu sein aus einer Systemabwehrreaktion herzurühren. Der Patient verlangt nach Nähe in Form von Pflege, Information und Anteilnahme. Der Systemabwehrgedanke zwingt den Pflegenden jedoch aufgrund etwaiger, eigener Schuldigkeit den betroffenen Patienten auszugrenzen. Möglicherweise spielt die Angst vor der eigenen Infektion oder der Übertragung auf Familienangehörigen eine Rolle. Den Betroffenen werden (wenn überhaupt) nur wage und wenig hilfreiche Informationen zur Erkrankung mitgeteilt. Sind Pflegefachkräfte uninformiert über Ausbreitung, Entstehung und Gefährlichkeit der Erkrankung? Oder ist die mangelhafte Informationsweitergabe an die Patienten ebenfalls eine Form der Systemabwehr ? 1. Verleugnung, Es wird nur das gesehen, was man erträgt. Das reicht von der Wahrnehmungsverzerrung bis hin zur Illusionsbildung.282 Die ständige Konfrontation mit der eigenen Unzulänglichkeit und eigenen Fehlern (Vernachlässigung klassischer Hygienevorschriften) muß zwangsläufig Verleugnung nach sich ziehen, um weiterhin im traditionellen System arbeiten zu können. Daher wird der Betroffene ausgegrenzt und eigene Unzulänglichkeiten ausgeblendet. 280 vgl. Heintel, Krainz 1998, Seite 171 vgl. a.a.O., Seite 98 282 vgl. a.a.O., Seite 176 281 109 2. Suche nach Schuldigen Um eigenes Schuldempfinden abzuwehren, wird den Betroffenen Schuld 283 mit an dem Keim gegeben und die Krankheitserreger können „ungehindert den weißen Gewändern 284 weitergetragen werden.“ als Symbole der Unbeflecktheit Zwei Interviewpartner empfanden, dass ihnen das Gefühl vermittelt wurde, sie seien „schuld an dem Keim“ (A 4: 174, H 8:342). 3. Hinausreden auf höhere Stellen Statt für den Betroffenen die Information verständlich und einfühlsam vorzubereiten, wird gesagt: „Das sind Vorschriften vom Gesundheitsamt, darum müssen wir isolieren (A 3:124). Laut Heintel und Krainz, ist das „Hinausreden auf höhere Stellen“ keine wirkliche Akzeptanz, sondern eine Handlungslähmung und spricht für fehlenden Aktionismus. Somit wird deutlich, dass die Systemabwehr zwei Ziele verfolgt. Während einerseits eigene Unzulänglichkeit ausgeblendet und dem Betroffenen selbst die Schuld an dem „Keim“ gegeben wird, kann andererseits der Status der „Unbeflecktheit“ aufrechterhalten werden. 283 284 vgl. a.a.O., Seite 176 vgl. Weidmann 2001, Seite 98 110 11.3 Methodenkritik anhand der Gütekriterien Mayrings Die Methodenkritik erfolgt anhand der sechs Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung, unter Verzicht der klassischen Kriterien wie Validität und Reliabilität.285 Verfahrensdokumentation Die Untersuchung erfolgte analog der zusammenfassenden Inhaltsanalyse Mayring und ist vollständig und detailliert beschrieben, zur Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses. Argumentative Interpretationsabsicherung Die Ergebnisse sind in 13 Unterkategorien erfaßt, die vier großen HauptKategorien zugeordnet wurden. Zudem ergeben sich vier Unterkategorien, die eher von klinischem Interesse sind, die einer großen Hauptkategorie zugeordnet wurden. Um nach Alternativdeutungen zu suchen, werden die fünf Hauptkategorien miteinander in Beziehung gesetzt, so daß eine Taxonomie entwickelt werden kann. Die einzelnen Arbeitsschritte sind durch Transkriptionszitate gestützt, so dass jederzeit Rückschluß auf das Datenmaterial möglich ist. Regelgeleitetheit Die Erarbeitung der Ergebnisse wurde unter Anwendung des Verfahrens qualitativer Inhaltsanalyse Mayrings durchgeführt und somit systematisch nachvollziehbar und regelgeleitet. Nähe zum Gegenstand Durch die Kombination von Problemzentriertem und Episodischem Interview hatten die Betroffenen die Möglichkeit, ihr Erleben mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung zu schildern. Daher ist die Nähe zum Gegenstand gegeben. 285 vgl. Mayring 2002, In: Lamnek 2005, Seite 146 111 Kommunikative Validierung Aufgrund der begrenzten Diplomarbeitszeit wurde auf das Vorhaben, die Interviewpartner mit den Ergebnissen zu konfrontieren, verzichtet. Triangulation In der vorliegenden Arbeit wurde das Interview als Einzelmethode als Instrument qualitativer Forschung angewandt und somit die Nutzung verschiedener Lösungswege nicht gegeben. 11.4 Kritische Würdigung der Arbeit und der angewandten Verfahren Der gewählte Untersuchungsansatz sowie die Wahl der Untersuchungsmethoden und Datenauswertung haben sich als geeignet erwiesen. Durch die Kombination aus Problemzentriertem und Episodischem Interview war die Nähe zum Gegenstand gegeben. Dies hatte einerseits den Vorteil, dass die Betroffenen sehr offen Einblick in ihre Erfahrungen und Erleben zuließen, doch andererseits war es für die Autorin nicht immer leicht, die analytische Distanz zu wahren. Denn für die Autorin, selbst „Angehörige“ einer Klinik, bestand keine soziale Distanz zu dem Untersuchungsfeld.286 Allerdings erhielt die Autorin durch die Offenheit der Interviewpartner, Einblicke in die Erfahrungen der Betroffenen, die ihr bisher Unbekannt waren.287 Daher konnte das Vorverständnis über die zu untersuchende Gegebenheit als vorläufig angesehen werden und wurde mit neuen Informationen überwunden.288 Von besonderer Bedeutung war für die Autorin die Erfahrung, welches Vertrauen ihr, als Fremde, entgegengebracht wurde. Die männlichen Interviewteilnehmer waren, im Gegensatz zu den weiblichen, zu Beginn etwas distanziert. Doch gegen Ende wurden viele vertrauliche Einzelheiten mitgeteilt. 286 vgl. Weidmann 2001, Seite 7 vgl. Flick 2005, Seite 93 288 vgl. Lamnek 2005, Seite 580 287 112 Alle Interviewpartner genossen, dass sich jemand Zeit für sie nahm. 113 11.5 Resümee und Ausblick Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass das Interview als Instrument qualitativer Sozialforschung, einen systematischen Einblick in die Erlebenswelt Betroffener erlaubt. Mit wissenschaftlichem Instrument kann die private Welt des Betroffenen einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion erfaßt werden. In dem, was der Betroffene von sich selbst sagt und den verbalisierten Erfahrungen Bedeutung verleiht, können die Erlebnisse interpretiert und zu Ergebnissen aufbereitet werden. Die Interviews verdeutlichen, dass die Betroffenen eine Abwehr ihnen gegenüber empfinden, die sich in fehlenden Gesprächen und fehlender Anteilnahme widerspiegelt. Die Abwehr führt dazu, dass verzögert oder gar nicht auf den Patientenruf reagiert wird. Oder, wie im Erleben einer Betroffenen, kommt morgens bei der grundpflegerischen Versorgung eine Pflegefachkraft ins Zimmer und anschließend den ganzen Vormittag nicht mehr. Die Abwehr führt dazu, dass mit den Betroffenen zu wenig (oder gar nicht) kommuniziert wird. Die Interviews verdeutlichen, dass alle Betroffenen nicht von ärztlicher Seite aufgeklärt wurden. Wichtig war ihnen jedoch, dass sie (überhaupt) und in verständlicher Art und Weise aufgeklärt werden. Die fehlenden Gespräche ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamten Interviewverläufe, bzw. durch die gesamten Therapieverläufe der Betroffenen. Aufgrund der fehlenden Gespräche erhalten die Betroffenen unzureichende Information zu ihrer Erkrankung, wissen nicht, ob ihre Erkrankung gefährlich oder ansteckend ist, wissen nicht, ob ihre Wäsche oder der Abfall besonderer Behandlung bedarf, werden zu Schutzmaßnahmen und/ oder Händedesinfektionsmittel weder aufgeklärt, noch deren Beschaffung thematisiert. Da den Betroffenen all diese Informationen fehlen, haben sie nur die Möglichkeit auszudrücken: „Ich bin schlecht behandelt worden“ und möchten aufgrund von MachtZwang Erfahrungen „nicht mehr ins Krankenhaus“ eingewiesen werden. Da all diese Erfahrungen im häuslichen Umfeld keine Rolle spielen, 114 erleben die Betroffen, ungeachtet der Tatsache ob sie sich selbst als infektiös erachten oder nicht, ihr Alltagsleben als normal. Die Beantwortung der Forschungsfrage, wie Betroffene ihre MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung erleben, lautet: „Nach Erfahrungen mit der Macht-Zwang Strategie in der Klink, normal.“ Die Beantwortung der Frage, welche Hilfestellungen Betroffene benötigen, um mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion in der häuslichen Umgebung leben zu können, lautet neben medizinischer Behandlung und pflegerischer Betreuung, Anteilnahme und Menschlichkeit. Wie die Ergebnisse sich des weiteren darstellen, bewirkt die Betreuung von Betroffenen mit einer MRSA Kolonisation und/ oder Infektion, bei Pflegefachkräften eine Art Abwehr. Dabei ist fraglich, ob das vorherrschende Paradigma „Die Schutzkleidung ist zu warm und unbequem“, nur ein Vorwand ist, um die Patienten zu meiden. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die Triangulation von Hygieneverantwortlichkeit, Angst vor Infektion und nicht gelingendem „Reinwaschen“ nach Kontakt mit Betroffenen, Scheitern des Heilungsparadigmas und Konfrontation mit eigenen Fehlern (Vernachlässigung klassischer Hygienevorschriften), ursächlich für die Abwehr von Pflegefachkräften sind. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, muß eine erfolgreiche Behandlung scheitern. Oder anders gesagt, es wäre erstaunlich, wenn sich unter den genannten Aspekten der Systemabwehr eine gelungene Klientenbeziehung und eine gute Betreuung gestalten ließe. Zu diesem Thema würde sich eine weitere Untersuchung anbieten. Eine Befragung von Pflegefachkräften könnte Aufschluss darüber geben, welche Form der Abwehr dazu führt, MRSA Patienten zu meiden. Eine Untersuchung mit der Forschungsfrage, welche Form der Systemabwehr Pflegekräfte daran hindert, den ohnehin durch die Isolation belasteten Betroffenen, eine in allen Aspekten gute Behandlung zukommen zu lassen. 115 „NEIN, sie, sie, sie, sie bemühte sich korrekt zu sein, aber ich, ich, hatte so beobachtet, kein Wort zuviel. Auch nich mal ne ANTEILNAHME, auch nich, KEIN WORT. Es war alles auf letzte Minute ausgenutzt. [ Angespannt, weil sie das in der Zeit, ja genau. Sie war angespannt. Und das war ihr lästig. Denn, se hatte so und so nich genug Zeit. Und sie ist so fix und äh, (0.2) genau, aber kein Wort zuviel und nix, und keine Anteilnahme. Und da kam se gar nicht dazu. Ja, ja. Aber das hat mich, da hat mir die Anteilnahme tatsächlich gefehlt. Ja. Ruckzuck, alles. Mmh. <.hh> Die Ministerin Schmidt, die hat jetzt am....(Tag) bei der (Name) in dem Fernseh, hat se gesacht, wir müssen runter kommen von dem Minutenberechnen. Hat se gesacht. Ja, ja. <.hhh> JA SICHER. Das man ernst genommen wird. Man will ernst genommen werden als Patient. Und menschlich genommen. JA, ne, ne, das ist so unmenschlich. Wenn de se schon mal sachte aufstehen, so ich sachte, ich bin kein Hund, sachte ich dann, ne. Oder so, ne. Wenn ich das empfinde, ich bin sehr empfindlich dadrin. Ernst genommen zu werden. Ich will aber auch das gar nicht verlieren, diese Empfindsamkeit. Ja Ich meine, das sind wir uns Menschen schuldig.“ Interview H, Seite 19-22, Zeile 873-1002 116 Literaturverzeichnis Abt-Zegelin, A., Patient-learning-Center, In: Die Schwester/ Der Pfleger, Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Jahrgang 36, Heft 9/1997 und Jahrgang 39, Heft 1/2000 Arbeitsgesetze, Beck-Texte Deutscher Taschenbuch Verlag, 55.Auflage Nördlingen 1999 AWMF, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, Gemeinsame Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapeutische Medizin, 2000 Axmacher, D., Pflegewissenschaft-Heimatverlust der Krankenpflege, In: Rabe-Kleberg u.a. (Hrsg.): Pro Person: Dienstleistungsberufe in der Krankenpflege, Altenpflege und Kindererziehung, Bielefeld 1991, Seite 120-138 Banek-Schwidessen, S., Lonnemann, R., Erhebung der Bildungsanforderung des Pflegepersonals bezüglich der Pflege von an MRSA besiedelten/ infizierten Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen, In: Diplomarbeit zur Erlangung des Grades Diplomberufspädagogin (FH), Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen Abteilung Köln, Fachbereich Gesundheitswesen, Studiengang Pflegepädagogik, Köln 2005 Baumgartner, L., Reinhard, K., Möllmann, R., Dr. (Hrsg.), Häusliche Pflege heute Urban & Fischer Verlag, 1. Auflage München Jena 2003 Beck, G., Schmidt, P., (Hrsg.) Hygiene in Krankenhaus und Praxis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1986 Bergen, P., Hygiene für ambulante Pflegeeinrichtungen, Urban & Fischer, 1. Auflage, München 2006 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Schriften für Gesundheit bei der Arbeit, Druckhaus Dresden GmbH, Dresden 2006 Bossard, Haas, Patientinnen S., und Schwazenbach, Pflegende, H., Ausnahmezustand In:Krankenpflege Soins für Infirmiers, Jahrgang 96 Heft 2003, Seite 22-23 117 Brömmling, M., Gut geschützt zum Hausbesuch, In: Pflegen Ambulant, Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Jahrgang 17 Heft 1/2006, Seite 8 Bruckner, U., Ziegler, G, Theiss, S., Jodes- Laßner,. U., Köhler, C., Reus, U., Uhl, A., Veit- Zenz, A., Medizinische Dienste der Spizenverbände der Kranken- e.V (Hrsg.) MDS 2005 Burns, Nancy, Grove, Susan, K., (Hrsg.), Pflegeforschung verstehen und anwenden, Urban & Fischer Verlag, 1. Auflage München 2005 Bühling, A., Hiller, I., Hofmann, A., Kober, P., Kubisch, M., Schicht, B., Länder-Arbeitskreis zur Erstellung von Hygieneplänen nach §36 IfSG, Rahmen – Hygieneplan für ambulante Pflegedienste, Stand 10/2003, http://www.lasv.brandenburg.de/ De Gruyter, W., Pschyrembel, 258. Auflage Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), In:Maßnahmenplan beim Auftreten von MRSA Fischer-Böhm, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Korrespondenz 2006 Flick, U., Qualitative Sozialforschung, rowohlts enzyklopädie, 3. Auflage Hamburg 2005 Foucault, M., Überwachen und Strafen, Die Geburt des Gefängnisses, Suhrkamp Verlag, 1. Auflage Frankfurt 1994 Friedrich, A. Euregio MRSA-net:Chancen für den ÖGD, lögd, http:// www.mrsa-net.org, 2005 Glehr, R., Kriterien hausärztlicher Leitlinien, [email protected] Hartmann, C., Wie erleben Patienten die Isolation im Krankenhaus aufgrund einer Infektion oder Kolonisation mit MRSA? In: Hygiene & Medizin, mhp Verlag, Jahrgang 30 Heft 7/2005, Seite 234-243 Hartmann, C., Wie erleben Patienten die Isolation im Krankenhaus aufgrund einer Infektion oder Kolonisation mit MRSA? In: Diplomarbeit zur Erlangung des Grades Diplomberufspädagogin (FH), Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen Abteilung Köln, Fachbereich Gesundheitswesen, Studiengang Pflegepädagogik, Köln 2004 118 Heintel, P., Krainz, E., Was bedeutet „Systemabwehr“ In: Götz, K., (Hrsg.): Theoretische Zumutungen. Vom Nutzen der Systemtheorie für die Management-Praxis., Carl-Auer-Systeme, 2. Auflage Heidelberg 1998 Heuck, D., Fell, G., Hamouda, O., Claus, H., Witte, W., Erste Ergebnisse einer überregionalen Studie zur MRSA- Besiedelung bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, In: Hygiene & Medizin, mhp Verlag , Jahrgang 25 Heft 5/2000, Seite 191 Herkunftswörterbuch, Bibliografisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2001 Heuel, G., Unterrichtsskript Arbeitsfeld Ambulante Dienste/Altenhilfe, In: Soziale Netzwerke und Interventionen 2007 Hinke, K., Kampf der Keime, In: Heilberufe spezial Hygiene, Urban & Vogel 2005 Huggett, S., MRSA-Screening auf der Intensivstation, In:Management & Krankenhaus, GIT Verlag, Jahrgang 26 Heft 6/2005 Hulskers, H., Die Qualität der pflegerischen Beziehung: Ein Anforderungsprofil, In: Pflege 2001, Verlag Hans Huber Bern Jahrgang 14 Heft 1/01 Höpken, M.E. Dr, Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, Informationsblatt Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Privat-häusliche, ambulant-pflegerische ärztliche Versorgung, Versorgung, ambulant- Stand 02/2005, http://www.nlga.niedersachsen.de Kaminski, A., Rohr, U., Schlösser, S., Muhr, G., MRSA-kolonisiertes medizinisches Personal:Opfer oder Täter?, In: Trauma und Berufskrankheit , Springer Verlag Heft 3/2002, Seite 350- 353 Käppeli, S. (Hrsg.) Pflegekonzepte, Phänomene im Erleben von Krankheit und Umfeld, Band 2, Hans Huber Verlag, 3. Auflage Bern Göttingen Toronto Seattle 2005 Kischke, J., Prävention und Kontrolle von MRSA, In: Heilberufe spezial Hygiene, Urban & Vogel 2005, Seite 10-14 Kühn, D., Werner, B., Taschenatlas zur Pflegeversicherung, Asgard 119 Verlag Hippe, Sankt Augustin 2001 Lamnek,S., Qualitative Sozialforschung, Beltz Verlag, 4. Auflage Weinheim, Basel 2005 Lubkin, I., M., Chronisch Kranksein-Implikationen und Interventionen für Pflege und Gesundheit-, Hans Huber Verlag, 1. Auflage Bern •Göttingen• Toronto • Seattle 2002 Ludwig, A., Risiko Routine, In Heilberufe, Urban & Vogel Verlagsgesellschaft, Jahrgang 58 Heft 7/2006, Seite 32 ff Landeinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd) (Hrsg.) Neuhaus, B., Bocter, N., Braulke, Ch., Heuck, C., Witte, W., Studie zum Vorkommen von Meticillin-resistenten Staphylococus-aureus in Alten- und Altenpflegeheimen, Bielefeld 2002 Landeinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd) (Hrsg.) Friedrich, A., Euregio MRSA-net:Chancen für den ÖGD, www.mrsanet.org, Münster 2005 Mayring, P., Gläser-Zikuda, : (Hrsg.), Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2005 Mayring, P, Qualitative Inhaltsanalyse, Beltz Verlag, 8. Auflage Weinheim und Basel 2003 Mayring, P., Einführung in die qualitative Sozialforschung, Beltz Verlag, 5. überarbeitete und neu gestaltete Auflage Weinheim, 2002 Meiser, M. Brehmer, M.Arbeitsabläufe bei der Pflege von MRSAErkrankten 1. Teil, In: Die Schwester/ Der Pfleger, Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Jahrgang 41 Heft 12/2002, Seite 980-985 Meiser, M. Brehmer, M.Arbeitsabläufe bei der Pflege von MRSAErkrankten 2. Teil, In: Die Schwester/ Der Pfleger, Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Jahrgang 42 Heft.1/2003, Seite 32-36 Mohrmann, M, Lotz-Metz, G., Böhler, T., Hannes, W., Der Pflegeprozess als Instrument der Qualitätssicherung in der ambulanten Pflege- Ergebnisse der Qualitätsprüfungen in Baden-Württemberg, Gesundh. Ökon. Qual manag. 10, 2005a, Seite 245-251 120 Mohrmann, M, Lotz-Metz, G., Böhler, T., Hannes, W., Qualitätsprüfungen Ambulanter Pflegedienste in Baden-WürttembergÜberblick über die Erfahrungen aus 6 Jahren flächendeckender Untersuchungen durch den MDK, Gesundheitswesen 67, 2005, Seite 694-77 Neubert, D., Robbers, J., Krankenhausrecht 2005, Deutsche Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf 2005 Neuhaus, B., Bocter, N., Braulke, C., Heuck, C., Witte, W., Studie zum Vorkommen von Methicillin- resistenten Staphylococus-aureus in Altenund Altenpflegeheimen, lögd Bielefeld 2002 Neuhaus, B., Methicillin-resistente Staphylokokken In Altenheimen ebenso häufig vertreten wie in Krankenhäusern, In: Deutsches Ärzteblatt , Deutscher Ärzte Verlag , Jahrgang 100 Heft 45/2003, Seite 2921-2922 Nikman, S., Infektionen an der Schwelle der Beherrschbarkeit, In:Desinfacts Spezial, Bode-Science-Competence Nikman, S., .Resistenzen auf dem Vormarsch, In: Heilberufe PflegeKolleg, Urban & Vogel Verlagsgesellschaft, MRSA- Prävention und Therapie Teil 1, Seite 2 Nußbaum,B,, Schutzkleidung: Barriere in der Pflege von MRSA-Patienten, In: Pflegen Ambulant , Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH, Jahrgang 18 Heft 2/2007, Seite 10-11 Nußbaum, B., Die Resistenzlage wird immer problematischer, In: Pflegezeitschrift, Kohlhammer Verlag, Jahrgang 55 Heft 7/2002, Seite 479 Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf, Urteil vom 04.06.1987, VersR 1988 Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken, Urteil vom 27.07.2004, Altenzeichen 5U 15/2002 Panknin, H.-T., Wie häufig kommt es bei einfachen Pflegeverrichtungen zu einer Kontaktübertragung von MRSA?, In: Hygiene & Medizin, mhp Verlag, Jahrgang 30 Heft 5/2005, Seite 166-167 121 Popp, W., Hilgenhöhner M., Dogru- Wiegand, S., Hansen, D., DanielsHaardt, I., Hygiene in der ambulanten Pflege, Eine Erfassung bei Anbietern, Bundesgesundheitsb. Gesundheitsforsch. Gesundheitsschutz, 2006, Seite 1195- 1204 Popp, W, Unveröffentlichter Abschlußbericht Projekt „Hygiene in der ambulanten Pflege“, Essen 2006, Seite 1-25 Popp, W., Dogru, S., Hilgenhöhner, M, Hansen, D., Hygiene in der ambulanten Pflege, In: Hygiene & Medizin, mhp Verlag, Jahrgang 31 Heft 1/2006, Seite 45 Prüfer, P., Rexroth, M., Kognitive Interviews , In: ZUMA How-to- Reihe, Nr.15, 2005,Seite 3 Quintel, M., Witte, W., MRSA- eine interdisziplinäre Herausforderung, Socio- Medico Verlag, Wiesbaden 2006, Robert Koch Institut (RKI), Bundesgesundheitsblatt-GesundheitsforschGesundheitsschutz, Hygiene in der ambulanten Pflege, Eine Erfassung bei Anbietern, Popp, W., Dogru, S., Hilgenhöhner, M, Hansen, 2006, Seite 1195- 1204 RKI, Definitionen nosokomialer Infektionen, 2005, Seite 1-60 RKI, Infektionsprävention in Heimen, Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert KochInstitut, Bundesgesundheitsbl. Gesundheitsforsch. Gesundheitsschutz 48, Springer- Verlag 2005, Seite 1061-1079 RKI, Epidemiologisches Bulletin, Fachtagung der AG Nosokomiale Infektionen am RKI zur Intensivierung der Umsetzung von Präventionsstrategien bei MRSA Nr.5/2005 RKI, Epidemiologisches Bulletin, Aktuelle Daten und Informationen zu Infektionskrankheiten und Public Health, Oktober Nr.42/2005 RKI, 30 Jahre Kommission für Krankenhaushygiene, Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut, Bundesgesundheitsbl. Gesundheitsforsch. Gesundheitsschutz 47, Springer- Verlag 2004, 313-322 122 RKI, Gesundheitsberichterstattung des Bundes Nosokomiale Infektionen, Verlag Robert Koch- Institut, 2002 RKI, Händehygiene, Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention Bundesgesundheitsbl. am Robert Gesundheitsforsch. Koch- Institut, Gesundheitsschutz 43, Springer- Verlag 2000, 230-233 RKI, Empfehlung zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphyloccus aureus-Stämmen /MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen, Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert KochInstitut, Bundesgesundheitsbl. Gesundheitsforsch. Gesundheitsschutz 42, Springer- Verlag 1999, Seite 954-958 Shadiakhy, Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, Korrespondenz 2006 Schäffler, A., Menche, N., Bazlen U, Kommerell, T., Pflege Heute, Gustav Fischer Verlag Stuttgart Jena·Lübeck Ulm 1998, Seite 942-943 Schülerduden Philosophie, Bibliografisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2002 Siebolds, M., Das verrückte Handeln der Akteure im Gesundheitswesen, In: Merke, K., (Hrsg.): Umbau oder Abbau im Gesundheitswesen Bd.2, Berlin 1998, Seite 189-205 Simon, F. B., Die andere Seite der Gesundheit, Ansätze einer systemischen Krankheits-und Therapietheorie, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2001 Stiletto, P.,Education Patienten- pflegender Wegbereitung Angehöriger Entwicklung eines von MRSA/ORSA Konzeptes, In: Diplomarbeit zur Erlangung des Grades Diplomberufspädagogin (FH), Katholische Fachhochschule Nordrhein- Westfalen Abteilung Köln, Fachbereich Gesundheitswesen, Studiengang Pflegepädagogik, Köln 2003 Ullrich, L., (Hrsg.) Pflege, Thieme Verlag, Stuttgart 10. Auflage New York 2004, Seite 152 123 Vogel, F., Exner, M., Pneumonien im Krankenhaus, In: Hygiene & Medizin, mhp Verlag, Jahrgang 10 Heft 9/1985, Seite 351-365 Wagner, U., Skript der Vorlesung Sozialpsychologie 1, Fachbereich Psychologie, Phillipp- Universität Marburg, 2007 Watzlawick, P., Die erfundene Wirklichkeit, Piper Verlag, 16. Auflage München 2003 Weidmann, R., Rituale im Krankenhaus, Urban & Fischer Verlag, 3. Auflage München Jena 2001 Weidner, F., Isfort, M., Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. (Hrsg.), Zwischenbericht zur ersten Phase des Projektes „Entwicklung und Erprobung eines Modells zur Planung und Darstellung von Pflegequalität und Pflegeleistungen“, In: Pflegequalität und Pflegeleistung I, Freiburg/ Köln 2001 Weidner, F., (Hrsg.), Pflegeforschung praxisnah, Mabuse Verlag, 2. Auflage Frankfurt am Main 2000 Weigert, Johann, Hygienemanagement und Infektionsprophylaxe, Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hannover 2005 Wernitz, M.,Veit, S., Der Einfluss von MRSA auf die deutsche Volkswirtschaft, In: Management & Krankenhaus, GIT Verlag, Jahrgang 24 Heft 6/2005, Seite 16 Witte, W., Wiese-Posselt, M., Jappe, U., Community MRSA Eine Herausforderung für die Dermatologie, In: Der Hautarzt, Springer Verlag, Jahrgang 56 Heft 8/2005, Seite 731-738 Witte, W., Braulke, Ch., Heuck, D., MRSA in Deutschland, Hygiene & Medizin, mhp Verlag, Jahrgang 25 Heft 2000, Seite 11 Ter Woort, A., Neuheit:Berührungsfreie Händedesinfektion, In: Management & Krankenhaus, GIT Verlag, Jahrgang 24 Heft 11/2005, Seite 33 124 Internetverzeichnis www.amb.vedor.de/00005/infomaterialien/medizin.pdf www.bbraun.de www.bode-chemie.com / COM, scientific communication,Infektionen an der Schwelle der Beherrschbarkeit, In:Desinfacts Spezial, Bode-ScienceCompetence www.lasv.brandenburg.de www.mrsa-net.org www.rki.de/ www.rki.deContect/Presse/Pressemitteilung www.amb.vedor.de/00005/infomaterialien/medizin.pdf www.heilberufe-online.de/pflege/heilberufe-sonderhefte/hygiene http://sgbkv.rla.aok.de, In: Gemeinsames Rundschreiben zur Versorgung mit Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln nach dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung 125 Anhangverzeichnis Anhang A Inserattext Erklärung über Anomymität Postskript Checkliste Interviewleitfaden Mustertranskript Auswertung Pretest Anhang B Beispiel Postskript Beispiel Transkript Beispiel erste und zweite Reduktion Kategorieentwicklung Ergebniskategorien mit Unter-und Hauptkategorien Episodenidentifikation 126