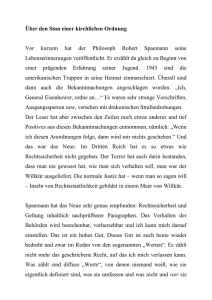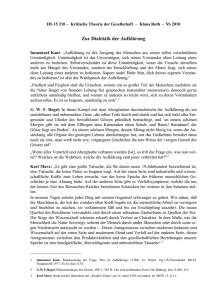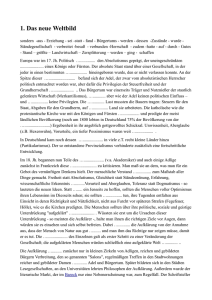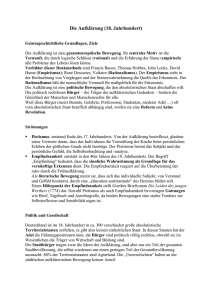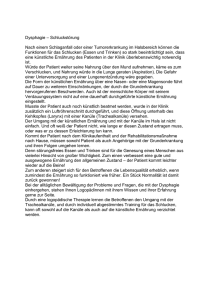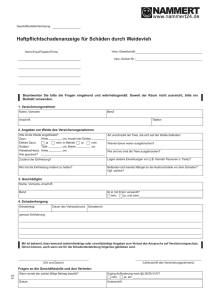01999-97.00443.00728.00000.001.L.BK .N.Grundlagen der
Werbung

Schmidt, v. d. Osten & Huber Rechtsanwälte und Notare Dr. jur. Franz-Josef Dahm www.soh.de Grundzüge der Arzthaftung Haftungsgrundlagen Dokumentationspflicht I. – Behandlungsfehler – Aufklärungsprobleme - Sachverhalt Der nachstehend geschilderte Arzthaftungsfall vermag aber in anschaulicher Weise anhand eines relativ einfach gelagerten medizinischen Sachverhalts zu zeigen, wo die typischen Probleme der Arzthaftung in Zusammenhang mit dem Vorwurf einer Verletzung des Pflichtenkanons liegen. Ein 54 Jahre alter Patient, 120 kg schwer, kommt im Mai 2003 wegen zunehmender Beschwerden im Bereich der linken Schulter zur Behandlung bei einem Facharzt für Orthopädie. Aus der Vorgeschichte ist bekannt, dass der Kläger beruflich ehemals als Profitaucher und Tauchlehrer tätig war. Nachdem er an der sogenannten „Caisson“-(Druckluft-)Krankheit gelitten hat, ist er zu 100 % erwerbsunfähig. Bekannt sind Vorerkrankungen des Bewegungsapparates mit Spondylose, instabiler Wirbelsäule, Radikulopathie, Lumboischialgie in Zusammenhang mit einem erlebten Bandscheibenvorfall. Wie erwähnt, kam der Kläger im Mai 2003 wegen Beschwerden an der linken Schulter in fachärztliche Behandlung, die sich durch Bewegungseinschränkungen und Druckschmerzhaftigkeit bemerkbar machten. Ein Trauma hat der Kläger nicht angegeben, allerdings gibt es in den Behandlungsunterlagen einen Hinweis darauf, dass die Beschwerden praktisch schon vier Jahre alt sind. Diagnostiziert wurde eine Periarthropathia humeroscapularis. In den Monaten Juni, Juli, also nahezu in monatlichem Abstand, erhielt der Klägerin intraartikuläre Injektionen, wobei mehrfach dokumentiert ist: „Kein Hinweis auf Rötung oder Überwärmung.“ Gegenstand des Vorwurfs ist insbesondere die Behandlung am 26.08.2003, die in diesem Falle durch einen Assistenzarzt der Praxis (oder einen Vertreter) erfolgt ist, der aber ebenfalls Facharzt für Orthopädie ist sowie die nachfolgende Behandlung durch den Praxisinhaber. Am 26.08.2003 wurde durch den Vertreter des Beklagten eine zunehmende Schmerzsymptomatik im Sinne eines deutlichen Kapselmusters diagnostiziert, 2 so dass hier – wie auch schon in den Vormonaten – eine intraartikuläre Injektion eines Schmerzmittels und von Cortison durchgeführt worden sind. Am 27.08.2003 war – in diesem Falle wieder durch den Praxisinhaber – festzustellen, dass die linke Schulter nicht mehr beweglich war, eine Abduktion war nur bis 80 Grad möglich. Dokumentiert sind zunehmender Druckschmerz, aber kein Hinweis für Rötung oder Überwärmung. Zum weiteren Procedere ist festgehalten eine Überweisung zum MRT. Am 01.09.2003 wurde in einer radiologischen Praxis eine Magnetresonanztomographie durchgeführt. Hierbei ergaben sich folgende Diagnosen: - Tendinopathie Supraspinatussehne - Zyste am Humeruskopf - Kein Hinweis für Ruptur - Impingementsyndrom bei tiefstehendem Acromium Als Procedere ist festhalten eine Therapie mit i.a.-Injektionen, Infusion von Schmerzmitteln sowie Reizstrom und Krankengymnastik. Diese Therapie wurde in der Folgezeit bis zum 18.09.2003 nahezu täglich fortgesetzt, ohne dass letztlich eine Besserung zu verzeichnen war. Für den 19.09.2003 ist dokumentiert eine stationäre Aufnahme zur Arthroskopie zum 01.10.2003; bis zur stationären Aufnahme Fortsetzung der Schmerztherapie je nach Intensität. Zuletzt findet sich eine Eintragung am 26.09.2003 mit „keine Rötung oder Überwärmung im Bereich des Schultergelenks“. Vorausgegangen war am 22.09.2003 eine ambulante Aufnahme zur Aufnahmeuntersuchung im Krankenhaus. In dem ausführlichen Anamnesebogen (sechs Seiten) findet sich kein Hinweis auf Überwärmung oder Entzündung, obwohl entsprechende Stichworte enthalten, aber nicht angekreuzt sind. Am 01.10.2003 findet sich – soweit ersichtlich – erstmals der Hinweis anlässlich der stationären Aufnahme im späteren Arztbrief, dass der Kläger seit vier Jahren an Schulterbeschwerden leide. Ferner ist dokumentiert eine Erhöhung des CRP-Wertes (C-reaktives Protein, normal bis 8,2, ab 50 mg/dl schwere bakterielle Entzündung) auf 47,8 mg/dl, was ein deutliches Entzündungsanzeichen darstellt. Am 02.10.2003 wird dann in Narkose die Arthroskopie durchgeführt. Hierbei entleerte sich eine „trübe“ Flüssigkeit; festgestellt wurden eine Entzündung der Error! AutoText entry not defined. 3 Gelenksinnenhaut, ein Defekt von ca. 1,5 cm an der Supraspinatussehne; dokumentiert ist ferner an der Gelenkpfanne eine „allenfalls geringe“ Erweichung. Bei der darauf folgenden offenen Operation wurde zusätzlich eine Schleimbeutelentfernung vorgenommen. Histologisch ergab sich das Bild einer Bursitis subacromialis (hochaktiv chronisch floride, teils fibrinos eitrig); im Abstrich waren „geringe“ Keimzahlen von staphylococcus aureus zu finden. Eine Revisionsoperation wurde am 11.10.2003 durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Arrosion zwischenzeitlich narbig ausgefüllt war; ein Abstrich ergab sich geringe Keimzahlen von Bacillus spp mit fraglicher pathologischer Bedeutung. Am 28.10.2003 wurde der Patient entlassen. Die MdE wurde mit 100 % beschrieben. Im Entlassungsbericht heißt es u.a., dass eine Verbindung zwischen Supraspinatusruptur und Entzündung fraglich sei. II. Klageverfahren Im Dezember 2005 leitete der Kläger ein Klageverfahren ein, in dem eine Reihe von Vorwürfen gegenüber beiden Behandlern (Praxisinhaber und Vertreter) erhoben worden sind. Folgende Problembereiche wurden innerhalb der 20-seitigen Klagebegründung angesprochen: 1. Das Behandlungsverhältnis („Vertrag“) mit dem Praxisinhaber bzw. dem Vertreter. Dabei lassen sich anhand des vorliegenden Falles – wie wir noch sehen werden – anschaulich die unterschiedlichen Haftungsverhältnisse zwischen dem Praxisinhaber und einem Vertreter oder Assistenzarzt darstellen (dazu näher Andreas, Arztrecht 2003, 88). 2. Die Behandlungsrüge, für die typisch der Vorwurf fehlerhafter Diagnosestellung oder Therapie ist, wurde gestützt auf die Aspekte: Mangelnde Hygiene (Übergehen von Leitlinien) sowie eine Verletzung der Befunderhebungs- und Sicherungspflicht. 3. Bei der – in einem Behandlungsfehlerprozess nicht fehlen dürfenden Aufklärungsrüge wurden folgende Aspekte angesprochen Grundaufklärung (?), Risikoaufklärung, Verlaufs- bzw. Sicherungsaufklärung, fehlende Belehrung über Behandlungsalternativen. Aus der Verteidigungssituation ergab sich die Notwendigkeit, zur „hypothetischen“ Aufklärung und zum Alternativverhalten des Klägers Stellung zu nehmen. 4. Die Dokumentationsrüge bemängelte fehlende Eintragung in der Behandlungskarte bzw. äußerte den Verdacht einer Fälschung durch entsprechendes Nachtragen. 5. Letztlich befasste sich die Klage mit Ausführungen zur Kausalität des Arzthandelns für die eingetretenen Folgen und bemühte sich, die Error! AutoText entry not defined. 4 Voraussetzungen für eine Beweislastumkehr durch groben Behandlungsfehler bei vollbeherrschbarem Risiko nahezulegen. Zu 1. Behandlungsverhältnis (Dienst-„Vertrag“) Wir sprechen meist ganz selbstverständlich davon, dass der Arztvertrag grundsätzlich „Dienstvertrag“ ist, obwohl zwischen Arzt und Patient in aller Regel gerade kein Vertragsverhältnis besteht. Lediglich im Bereich der privatärztlichen Behandlung oder bei Wahlarztleistungen im Krankenhaus liegen die Voraussetzungen für einen „echten“ Vertrag vor. Dies ergibt sich für den Privatpatienten daraus, dass er gegenüber dem Arzt als Behandlungspartner gegenübersteht, wobei das Versicherungsverhältnis das Beziehungsgeflecht zwischen Arzt und Privatpatient nicht berührt. Für den Krankenhausbereich ist dies eindeutig § 17 KHEntgG zu entnehmen, der davon spricht, dass Wahlleistungen vor der Erbringung schriftlich zu vereinbaren sind (wenn diese Vereinbarung auch zwischen Patient und Krankenhausträger zu treffen ist) und die Besonderheit besteht, dass in der Regel ein sogenannter „Arzt-Zusatzvertrag“ geschlossen wird. 90 % der Patienten werden allerdings auf der Basis des Sachleistungsprinzips nach den Vorgaben des SGB V behandelt. Bezeichnenderweise kommt im SGB V der Begriff des „Vertrages“ beim Verhältnis Patient/Arzt überhaupt nicht vor. Wenn sich der BGH (z.B. Urt. v. 10.3.1981, NJW 1981, 2002) in ständiger Rechtsprechung des Begriffs des Behandlungsvertrages bedient, hat dies seine Grundlage darin, dass nach § 39 SGB V Versicherte einen Anspruch auf vollstationäre Behandlung haben und die Krankenhausbehandlung alle Leistungen umfasst, die zur Wiederherstellung der Gesundheit erforderlich sind. Damit korrespondiert „§ 76 Abs. 4 SGB V: Die Übernahme der Behandlung verpflichtet den Vertragsarzt bzw. an der ambulanten Versorgung teilnehmende Ärzte und Einrichtungen gegenüber dem Versicherten zur Sorgfalt nach den Vorschriften des bürgerlichen Vertragsrechts. Die Übernahme ist also entscheidend. Dieses Rechtsverhältnis ist dargestellt in der sogenannten „Viererbeziehung“. Zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenkasse werden gesamtvertragliche Regelungen getroffen, die unmittelbar verbindlich sind für den zugelassenen Vertragsarzt als Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung. Auf der anderen Seite besteht zwischen Krankenkasse und Versichertem ein Versicherungsverhältnis, aus dem der Versicherte einen Anspruch auf ärztliche Behandlung als Sachleistung hat. Dabei wird Inhalt und Umfang der Leistungen in der Regel durch den Gesamtvertrag und das Sozialversicherungsrecht näher bestimmt. Auf der Ebene Vertragsarzt /Patient wird der Behandlungs„vertrag“ gewissermaßen durch die Verpflichtung zur Einhaltung bürgerlich rechtlicher Sorgfalt fingiert. Neben dieser „vertraglichen oder (besser:) quasi vertraglichen“ Beziehung zwischen Arzt und Patient kommt im vorliegenden Fall die Rechtsbeziehung zu dem Vertreter des Vertragsarztes bzw. seinem Assistenten hinzu. Zwischen Vertreter/Assistent und Versichertem/Patient besteht kein Vertragsverhältnis. Error! AutoText entry not defined. 5 Das in diesem Falle – echte – Vertragsverhältnis besteht nur zwischen Vertreter und Geschäftsherr (regelmäßig Leistung von Diensten im Anstellungsverhältnis oder als freier Mitarbeiter). Dies bedeutet, dass der Vertreter/Assistent im Innenverhältnis zum Patienten Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfe bezogen auf den Behandlungsvertrag ist. Mangels vertraglicher Beziehungen zwischen Vertreter/Assistent und Versichertem haftet dieser nicht aus Vertrag, sondern nur gem. § 823 BGB wegen sogenannter „unerlaubter Handlung“. Diese Unterscheidung ist nicht ganz ohne Bedeutung, wie wir nachstehend sehen müssen. Für unseren Sachverhalt ist daher festzuhalten, dass der Vertragsarzt letztlich quasi – „vertraglich“ und gesetzlich (nach § 823 BGB) haftet, wohingegen den Vertreter/Assistent nur kraft Gesetzes (§ 823 BGB) eine Haftung trifft. Wird der Vertreter allerdings – mit in Anspruch genommen, hat er im Innenverhältnis gegen den „Geschäftsherrn“ (Vertragsarzt) einen Freistellungsanspruch unter dem Aspekt der „gefahrengeneigten Arbeit“. Der Umfang der Freistellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens, welches der Vertreter/Assistent an den Tag gelegt hat. Bei leichter oder einfacher Fahrlässigkeit kommt der Freistellungsanspruch voll zum Tragen; im Falle grober Fahrlässigkeit besteht der Freistellungsanspruch nicht mehr, so dass spätestens hieraus die Notwendigkeit resultiert, sich einer eigenen Haftpflichtversicherung zu versichern, die aus den geschilderten Gründen auch wesentlich kostengünstiger ist als die Versicherung des Prinzipals. Zu 2. Behandlungsrüge Die Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche richtet sich nach einem vergleichsweise einfachen Schema, das gekennzeichnet ist von den fünf „W“. Wer (Kläger) will was (Schadenersatz) von wem (Beklagter) woraus (Anspruchsgrundlage). Obwohl danach die Anspruchsgrundlage das entscheidende Merkmal der Betrachtung darstellt, findet man bei der Prüfung von Behandlungsfehleransprüchen in Urteilen und der Literatur häufig noch nicht einmal einen Paragraphen genannt. Dies hat seine Ursache wohl darin, dass sich Verfahren in Zusammenhang mit Behandlungsfehlern verselbstständigt haben, so dass etwa die Kommentierung von Jansen (bei Rieger, Lexikon des Arztrechts, „Behandlungsfehler“) ganz ohne Nennung von Vorschriften des Zivilrechts auskommt. 2.1 Rechtsgrundlagen der zivilrechtlichen Haftung (SchModG) Das seit dem 1.1.2002 geltende BGB in der Neufassung des SchModG hat ein wenig frischen Wind in die Diskussion der zivilrechtlichen Problematik der Arzthaftung gebracht, die ansonsten geprägt ist durch eine immer differenzierter – und komplexer – werdende obergerichtliche Rechtsprechung. Error! AutoText entry not defined. 6 Mangels besonderer Vorschriften über die Arzthaftung gelten die allgemeinen Vorschriften des Schuldrechts über die dienstvertragliche Haftung einerseits bzw. die in Anspruchskonkurrenz stehende Haftung aus Deliktsrecht wegen unerlaubter Handlung (§ 823 ff.) andererseits. Dienstvertragliche Haftung bedeutet zugleich, dass grundsätzlich der Arzt nur zur Leistung von Diensten unter Beachtung der im Rechtsverkehr bestehenden Sorgfaltspflichten verpflichtet ist. Er haftet also nicht nach werkvertraglichen Grundsätzen, denen die Herbeiführung eines Erfolgs und damit eine weitergehende Haftung eigentümlich ist. Erkennbar werden die Unterschiede im zahnheilkundlichen Bereich, wo etwa die Herstellung von Prothesen werkvertragliche Elemente beinhaltet. Grundsätzlich gilt, dass der Anspruchsteller beweispflichtig für die anspruchsbegründenden Tatsachen ist, soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorsieht. Den Unterschied erkennt man an § 280 a. F. und § 280 n. F. BGB. Konsequenz der Formulierung der a.F., dass die Leistung infolge eines vom Schuldner zur vertretenden Umstandes unmöglich wird, war die Beweislast für das Vertretenmüssen beim Anspruchsteller, so dass der Patient den Beweis für das Verschulden erbringen musste. Nunmehr braucht der Gläubiger (Patient) nach der n. F. nur noch die Pflichtverletzung zu beweisen; das nunmehr in S. 2 zum Ausdruck kommende Regel-Ausnahmeprinzip legt den Beweis für das Nichtvertretenmüssen dem Schuldner, mithin dem Arzt auf. Bezogen auf unseren Fall bedeutet dies: Im Verhältnis zum Praxisinhaber ist der Patient günstiger gestellt, da der Praxisinhaber darlegen und beweisen muss, dass den für ihn tätigen Vertreter/Assistenten kein Verschulden trifft. Zu ersetzen sind bei Verletzung vertraglicher Ansprüche zunächst materielle Schäden (Verdienstausfall, Unterhalt, Vermögensschäden, Haushaltshilfe usw.). Hinsichtlich des Schmerzensgeldes hat die Neufassung des BGB ebenfalls wesentliche Verbesserungen zugunsten des Patienten mit sich gebracht. Nach der a.F. von § 253 BGB konnte ein Schmerzensgeld nur in gesetzlich bestimmten Fällen gefordert werden, nämlich nach § 847 BGB für den Fall der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit. § 847 BGB setzte eine unerlaubte Handlung nach § 823 BGB voraus, insbesondere also wiederum den Verschuldensnachweis. Da die Neufassung des § 253 BGB jetzt auch wegen des Nichtvermögensschadens (Schmerzensgeld) eine billige Entschädigung für vertragliche Ansprüche bei Verletzung des Körpers und der Gesundheit zulässt, wird hier der Paradigmenwechsel deutlich: Ein Schmerzensgeld kann der Patient auch dann beanspruchen, wenn er ein Verschulden des Arztes nicht nachweisen kann, dem Arzt aber auch nicht die Exkulpation gelingt. Wir haben also eine Gleichschaltung von vertraglicher und gesetzlicher Haftung, die einer Gefährdungshaftung gefährlich nahe kommt. Die Ausnahme besteht wiederum für unseren Vertreter/Assistenten, der nur nach § 823 BGB wegen unerlaubter Handlung in den Haftungskreis gelangt; Error! AutoText entry not defined. 7 diesem gegenüber muss der Patient also nach wie vor das Verschulden beweisen. Gleichwohl muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Unterschiede eher einem juristischen Glasperlenspiel gleichen. Schließlich muss der Patient weiterhin beweisen, dass der Schuldner (Arzt) seine Pflichten aus dem Schuldverhältnis verletzt hat. Ist dieser Nachweis zu erbringen, liegt natürlich auch die Annahme nahe, dass die Verletzung schuldhaft geschehen ist – woher sollte sonst die Pflichtverletzung resultieren. Es kommt also zu einer weitgehenden Übereinstimmung zwischen dem vertraglich geprägten Pflichtenkreis und der gesetzlich geprägten Haftung für unerlaubte Handlung im Bereich des Verschuldens, wobei Pflichtenkreis und Verschulden (Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt) letztlich geprägt sind durch die Einhaltung der „lex artis“ im Sinne der im Rechtsverkehr gebotenen Sorgfalt (Fahrlässigkeit). 2.2 Vorwurf mangelnder Hygiene 2.2.1 Sachverhaltsergänzung Zunächst ist zum Sachverhalt zu ergänzen, dass der Vorwurf der Klage dahin geht, der Vertreter/Assistent habe am 26.08.2003 ohne Mundschutz, ohne sterile Handschuhe und ohne ausreichende Desinfektion „gearbeitet“. Demgegenüber lässt sich der Beklagte damit verteidigen, die Handdesinfektion sei mit üblichen Mitteln für mindestens eine Minute erfolgt und nach der sogenannten „no-touch-Methode“ durchgeführt worden. Der Patient kann sich ausweislich des Klagevorgehens zwar an die Handdesinfektion nicht mehr unmittelbar erinnern, Frage ist jedoch, warum er sich Jahre danach an die anderen Vorfälle erinnern kann, obwohl wir – z. B. im Hinblick auf die Aufklärungsproblematik – aus den Untersuchungen von Gostomczik schon aus den 70er Jahren wissen, dass die durchschnittliche Halbwertszeit der Erinnerung eines Patienten – etwa über ihm zuteil gewordene Aufklärung – nur einige Tage oder Wochen reicht. Inzwischen werden auf der Klägerseite immer häufiger Fachanwälte für Medizinrecht tätig, die gewohnt sind, ärztliches Handeln nach strengeren Kriterien zu hinterfragen, um zum Erfolg zu kommen. Darauf wird der Arzt sich künftig einstellen müssen. Im vorliegenden Fall ist es naheliegend, dass die Klägervorwürfe ausgerichtet worden sind an den Leitlinien der AWMF und Behauptungen aufgestellt werden, welche ärztlicherseits nur schwer widerlegt werden können. Erinnern wir uns aber an die obige Betrachtung zu § 280 n. F. BGB. Danach obliegt dem Gläubiger (Patient) nach wie vor der Nachweis der Pflichtverletzung; erst der Beweis für das Nichtvertretenmüssen liegt beim Arzt. Im vorliegenden Fall ist jedenfalls unstreitig, dass „ohne Mundschutz“ gearbeitet worden ist. Aber: Allein das Auftreten einer Infektion lässt noch Error! AutoText entry not defined. 8 keinen Rückschluss auf fehlerhaftes Vorgehen zu und begründet keinen Anscheinsbeweis (OLG Hamm, Urt. v. 30.11.2005 – 3 U 61/05, MedR 2006, 288). 2.2.2 Leitlinien der AWMF, Nr. 029/06 Bei der AWMF handelt es sich um eine Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich-Medizinischen Fachgesellschaften, welche regelmäßig zu medico legalen Problemen Tagungen abhält, die dem interdisziplinären Austausch dienen. Schon früh hat sich die AWMF der Aufgabe verschrieben, mit Hilfe von Leitlinien zu Behandlungsstandards oder –schemata zu kommen. Leitlinien haben daher den Vorteil, dass sie einerseits – zudem, wenn sie evidenzbasiert sind – Vorlagen für eine bestmögliche Behandlung geben, andererseits zwingen sie den Arzt bei Nichtbeachtung ganz natürlich in einen Erklärungsnotstand. Vorliegend sehen die Leitlinien für intraartikuläre Injektionen u.a. Folgendes vor: - Die Desinfektion der Hände mit einem Antiseptikum bei einer Einwirkungszeit von mindestens einer Minute - Nach vorausgehender hygienischer Handdesinfektion sind sterile Handschuhe zu verwenden. - Bei einer Gelenkpunktion mit Spritzenwechsel hat der Arzt eine Gesichtsmaske zu tragen. Daneben existieren weitere Hinweise, von denen jeder weiß, dass sie in der Praxis nicht zwingend beachtet werden (z. B. nur die Anwesenheit zweier Personen, was Patient oder Arzt – je nach dem, wo die Beweislast liegt – in zusätzlichen Erklärungs- bzw. Beweisnotstand bringen kann). 2.2.3 Formelle Bedeutung der Leitlinien Wie schon zuvor angesprochen, erschöpft sich die Bedeutung von Leitlinien nicht in sich. Richtigerweise werden sogenannte „Leitlinien“ als Empfehlungen zur Unterstützung bei der Entscheidung über angemessene Maßnahmen (z. B. Diagnostik, Therapie, Nachsorge) angesehen, wie sie die AWMF selbst definiert. Besser spricht man daher von Therapieempfehlung, weil dies anders als der Begriff der „Leitlinie“ in sprachlicher Hinsicht nicht so stringent besetzt ist. Leitlinien haben sogar in das SGB V zu Beginn des Jahres 2000 und in Einklang mit der dort herrschenden Reform-Euphorie Eingang gefunden, als man geglaubt hat, allein durch Begrifflichkeiten die Qualität des Gesundheitswesens zu verbessern. Allerdings ist der in § 137e Abs. 3 SGB V (i.d.F. GKV-Reformgesetz 2000) enthaltene Hinweis auf „evidenzbasierte Leitlinien“ zugunsten der „Richtlinien-Kompetenz“ des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) entfallen; der Begriff der evidenzbasierten Error! AutoText entry not defined. 9 Leitlinien findet sich nur noch in § 137f SGB V für die sog. DiseaseManagement-Programme (DMP). Error! AutoText entry not defined. 10 Die eigentliche Bedeutung der Leitlinien lässt sich für die „Chronikerprogramme“ an § 137f Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB V dahin festmachen, dass die Behandlungen nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft unter Berücksichtigung von evidenzbasierten Leitlinien oder nach der jeweils besten, verfügbaren Evidenz sowie unter Berücksichtigung des jeweiligen Versorgungssektors erfolgt. Leitlinien sind also nicht zwingend behandlungsimmanent, sie sind aber zu berücksichtigen. Dies gilt natürlich in erster Linie, soweit der GBA Richtlinien unter Verwendung evidenzbasierter Leitlinien erlassen hat; im Übrigen ist die materielle Bedeutung – insbesondere im Hinblick auf die den Arzt zukommende Therapiefreiheit - nicht abschließend geklärt. Leitlinien haben bislang in der Entscheidungspraxis des BGH keine Rolle gespielt; lediglich in dem u.a. von Dressler herausgegebenen RWS-Skript zum Arzthaftungsrecht finden sie am Rande Erwähnung. Folgt man allerdings Seminarhinweisen von Dressler (Mitteilung von Danner, MedR 1999, 242), werden sich für die Zukunft Auswirkungen bei der Beurteilung ärztlicher Verhaltenspflichten, der Beweislastverteilung, im Rahmen der Feststellung der Schadensursächlichkeit nicht ausschließen lassen können. Empfehlenswert ist in Anlehnung an Dressler eine ausdrückliche Dokumentation für das Abweichen von einer Leitlinie, die Angabe einer Begründung und die Dokumentation der Aufklärung hierüber unter dem Aspekt, dass zur Verfügung stehende Behandlungsalternativen mit dem Patienten erörtert worden sind, soweit sie ernsthaft in Betracht kommen. Immerhin ist noch anerkannt, dass es bei ärztlichem Handeln nicht um die Beachtung von DIN-Normen oder technischen Automatismen geht, sondern um weit komplexere Geschehnisse. Die gegenwärtige Haltung der Instanzgerichte ist noch von Distanz gekennzeichnet; so hat das OLG Naumburg im Urteil vom 19.12.2001 (MedR 2002, 471) ausgeführt, die Leitlinien der AWMF hätten derzeit lediglich „Informationscharakter“ für die Ärzte selbst und würden keine verbindliche Handlungsanleitung für praktizierende Ärzte darstellen. Dies gilt allerdings nach Auffassung des OLG nur angesichts der anhaltenden Diskussion um die Legitimität der Leitlinien. In einem weiteren Urteil hat das OLG Stuttgart am 22.2.2001 (ArztR 2003, 135) ausgeführt, dass die Nichtbeachtung der Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie hinsichtlich einer Thrombozytenkontrolle nicht zwingend als unverständlicher Fehler im Sinne der Rechtsprechung des BGH zur Beweislastumkehr zu beurteilen ist. Allein die Aufnahme einer Behandlungsregel in eine Leitlinie bedeutet nicht, dass die Behandlungsmaßnahme zum elementaren medizinischen Standard gehört. Die gegen dieses Urteil eingelegte Revision ist vom BGH mit Beschluss vom 18.12.2001 (IV ZR 108/01) nicht angenommen worden. Allein diese, die Wirkungen einer Leitlinie noch beschränkenden Entscheidungen vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass ein „gefährlicher Kreislauf“ in Gang gesetzt worden ist (so schon Ulsenheimer, Protokoll Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ der AWMF vom 17./18.11.2000, S. 10; vgl. auch Weidinger, Leitlinien in der Medizin – Risikopotential für die Haftpflicht von Ärzten?, Vortragsmanuskript). Error! AutoText entry not defined. 11 2.2.4 Materielle Bedeutung Die in den Leitlinien beschriebene Vorgehensweise ist zunächst auch für den Nichtmediziner durchaus einsichtig. Mittels der Hautdesinfektion wird eine Minderung der Keimzahl erreicht. Voraussetzung ist allerdings, dass die sterile Kanüle ohne Handberührung in das Gelenk eingeführt wird. Sterile Handschuhe erhöhen den Schutz vor einer Kontamination (sofern sie tatsächlich steril sind). Ob allerdings eine Gesichtsmaske diesen Schutz nachhaltig verbessert, wird sachverständiger Beurteilung bedürfen; jedenfalls wird das Tragen einer Gesichtsmaske nur dann als zwingend angesehen, wenn ein Spritzenwechsel (Dekonnektion) erforderlich wird, etwa indem die zur Therapie notwendige Menge nicht mit einer Spritze verabreicht werden kann. Immerhin existiert im vorliegenden Fall ein Urteil des LG Waldshut vom 30.1.2004 – 2 O 2/04 – nach einem Gutachten des Mikrobiologischen Instituts der Universität Tübingen. Hiernach ist das Risiko bei Anwendung der „no touch-Methode“ nicht wesentlich erhöht und sind Anforderungen an eine Schutzbekleidung nicht wie sonst bei operativen Eingriffen geboten (vgl. auch LG Essen, Urt. v. 18.10.2006 – 1 O 56/04: fehlender Mundschutz allein erhöht nicht zwingend das Infektionsrisiko; anders für die Lipomentfernung OLG Hamm, Ur. V. 11.10.2005, MedR 2006, 215) . 2.2.5 Organisationsfehler In rechtlicher Beziehung muss hervorgehoben werden, dass die Verletzung von Hygieneregeln zu den Fehlern gehören, die im vollbeherrschbaren Bereich von Arzt und Krankenhaus liegen und damit Organisationsfehler darstellen. Bei dieser Konstellation nimmt die Rechtsprechung keine Rücksicht darauf, dass personelle oder sachliche Engpässe bisweilen eine ordnungsgemäße Organisation verhindern können. Den Verantwortlichen (Arzt oder Krankenhausträger) obliegt es, die Betriebssicherheit der medizinisch-technischen Einrichtungen zu gewährleisten. Organisationsfehler im vollbeherrschbaren Bereich führen daher in aller Regel zu einer Umkehr der Beweislast. Bezogen auf unseren Fall sieht man daher, welche praktische Bedeutung die Leitlinien haben können, zumal sich die Leitliniengläubigkeit insbesondere unter den jüngeren Sachverständigen zu verfestigen scheint. Was nicht problematisiert worden war, ist die Tatsache, dass es letztlich für die Einhaltung des Sorgfaltsmaßstabs möglicherweise darauf ankommt, ob infolge eines Spritzenwechsels das Tragen einer Gesichtsmaske als notwendig anzusehen ist oder nicht (Der Sachverhalt gibt darüber keine Auskunft). Dabei muss man allerdings nicht schon Jurist sein, um sich fragen zu dürfen, warum nur der Arzt eine Gesichtsmaske tragen muss und nicht auch der Patient, der in aller Regel gewohnt ist, dem Arzt beim Spritzenwechsel interessiert zuzusehen und damit das Kontaminationsrisiko gleichermaßen erhöht. Error! AutoText entry not defined. 12 2.2.6 Vorwurf der Verletzung der Befunderhebungspflicht Zunächst darf auch hier noch einmal vorab auf den Sachverhalt rekurriert werden. Am 26.08.2003 erfolgte die Injektion durch den Vertreter/Assistenten. Am 27.08.2003 wurde die Überweisung zum MRT erteilt. Am 01.09.2003 erfolgte eine weitergehende Behandlung mit Infusionen, i.a.Injektionen und Krankengymnastik. Am 19.09.2003 erfolgte die Vorstellung im Krankenhaus. Ob eine Verletzung der Befunderhebungspflicht vorliegt, die ebenfalls zur Beweiserleichterungen bis zur Umkehr der Beweislast führen kann (BGH, Urt. v. 6.7.1999, NJW 1999, 3408; Ratzel in Dahm/Möller/Ratzel, MVZ-Handbuch, S. 226, Fn. 16 m.w.N.), bedarf letztlich sachverständiger Beurteilung. Hierbei wird es auf die Beurteilung der Magnetresonanztomographie (MRT) ankommen. In dem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Befundung des MRT ausschließlich Sache des Radiologen nach den Vorgaben der Weiterbildungsordnung ist, wohingegen dem Orthopäden lediglich eine Befundbewertung in dem Sinne obliegt, dass er den mitgeteilten Befund bei der späteren Behandlung berücksichtigt. Eventuell ist auch daran zu denken, ob eine Sonographie hätte weiterführend sein können bzw. ob dem Arzt im Sinne der behaupteten Entzündung das Unterlassen einer Labordiagnostik vorwerfbar ist. Hier streiten beide Seiten – dazu noch im Folgenden -, ob es Anzeichen für eine Entzündung gegeben hat und ob die entgegenstehende Dokumentation in der Behandlungskarte stichhaltig ist. Die Verletzung der Befunderhebungspflicht muss auf der anderen Seite abgegrenzt werden zum sogenannten „Diagnosefehler“. Diagnosefehler (soweit sie nicht gleichzeitig Befunderhebungsfehler sind) beurteilt die Rechtsprechung nur mit Zurückhaltung als Behandlungsfehler (vgl. Quaas/Zuck, Medizinrecht, S. 268). Irrtümer bei der Diagnosestellung sind insofern eher verzeihbar, als zu Beginn einer Erkrankung Symptome nicht immer eindeutig sind und verschiedenste Ursachen haben können. Der Arzt ist allerdings verpflichtet, eine „Arbeitshypothese“ stets kritisch zu prüfen, solange die endgültige Diagnose nicht getroffen ist (vgl. BGH, Urt. v. 8.7.2003, GesR 2003, 352). 2.2.7 Weitere Behandlungspflichten Unabhängig von unserer Fallbetrachtung sind aus dem Kanon der Behandlungspflichten folgende Einzelaspekte erwähnenswert: - Die notwendige Wahrung medizinischer Standards, unabhängig von der Diskussion um die Bedeutung der Leitlinien. Error! AutoText entry not defined. 13 - - Die Beachtung gesetzlicher Vorschriften beim Geräteeinsatz (zum Teil Organisationsbereich) wie - Medizinproduktegesetz - Medizinproduktebetreiberverordnung - Röntgenverordnung - Strahlenschutzverordnung Die Vermeidung eines Organisationsverschuldens im weiteren Sinne, wie dies geprägt ist durch die Begriffe: - Horizontale Arbeitsteilung (Zusammenarbeit der verschiedenen Facharztgebiete untereinander auf gleicher Ebene, insbesondere zwischen Anästhesist und Chirurg; Angehörige unterschiedlicher Fachgebiete dürfen sich auf das jeweils andere Fachgebiet verlassen, soweit nicht offensichtliches Versagen erkennbar wird). - Vertikale Arbeitsteilung (Verteilung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Entscheidungshierarchie im Krankenhaus von Assistenzarzt zu Chefarzt). - Delegation von Leistungen unter Beachtung des jeweiligen Kenntnis- und Wissensstandes - Einhaltung des Facharztstandards; nicht der Facharzt muss zwingend tätig werden – erfolgt die ärztliche Betreuung aber nicht durch einen Facharzt, ist der Arzt bzw. das Krankenhaus für die Wahrung des Facharztstandards beweisbelastet. In unserem Fall wäre dies sicherlich problematisiert worden, wenn der Assistent/Vertreter sich noch in der Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie befunden hätte, was indes nicht der Fall gewesen ist. Übrigens bedeutet dies nicht, dass der Weiterbildungsassistent nur „unter enger Aufsicht“ in der Weiterbildungszeit tätig werden könnte. Vielmehr kommt es auf den jeweiligen Ausbildungsstand an, so dass gegen Ende der Weiterbildungszeit der Assistent natürlich in weitgehend größerem Umfang allein tätig werden kann, als etwa zu Beginn der Weiterbildungszeit (Möller, MedR 1998, 62; Dahm in Rieger, Lexikon des Arztrechts, 2001, „Assistent“, Rn. 18). - Eine besondere Variante des Organisationsverschuldens ist das bei einem Zusammenspiel von vertikaler Arbeitsteilung, Delegationsversagen und Nichteinhalt des Facharztstandards mögliche Übernahmeverschulden. Dies liegt darin begründet, Error! AutoText entry not defined. 14 dass der Arzt, an den bestimmte Aufgaben delegiert werden, weiß, dass er für die Durchführung fachlich noch nicht hinreichend befähigt ist. Die Rechtsprechung – insbesondere im strafrechtlichen Bereich – verlangt hier von dem Arzt eine Remonstration bishin zur Verweigerung bei der Mitwirkung. Insofern sind bemerkenswert Ausführungen des OLG Hamm in einem kürzlich ergangenen Beschluss vom 8.6.2005 (3 Ws 473476/04, MedR 2006, 358), die wörtlich zitiert werden sollen: „Aber auch von dem operierenden Assistenzarzt ist die Einhaltung von Sorgfaltspflichten zu verlangen. Zwar darf der noch in der Weiterbildung stehende Arzt grundsätzlich darauf vertrauen, dass die für seinen Einsatz und dessen Organisation Verantwortlichen für den Fall von möglichen Komplikationen, zu deren Beherrschung, wie sie wissen müssen, seine Fähigkeiten nicht ausreichen, die gebotene Vorsorge tragen (Laufs, NJW 1995, 1590, 1597); diesem Anspruch ist durch die Anwesenheit und Beteiligung des fachärztlichen Oberarztes vorliegend auch genüge getan worden. Gewisse Qualifikationsanforderungen sind indes nach Auffassung des Senats – in Übereinstimmung mit der Auffassung des OLG Koblenz (vgl. OLG Koblenz, NJW 1991, 2967) – auch an einen Assistenzarzt zu stellen, der unter Aufsicht eines qualifizierten Facharztes operiert. Selbst ein assistierender Fachart ist nämlich nicht in der Lage, jeden „anfängerbedingten“ Fehler des Operateurs zu verhindern oder die möglicherweise erheblichen Folgen für den Patienten, auch wenn er den Fehler sofort erkennt, in jedem Falle zu beheben. Demgemäß hat der operierende Assistenzarzt vor Setzen eines endgültigen Schnittes im Gewebe und der Heranführung einer thermischen Hakenelektrode an das Gewebe sicherzustellen, dass die anatomischen Verhältnisse nicht verkannt werden und eine eindeutige Identifizierung der betroffenen Strukturen .... stattfindet. Dabei handelt es sich um einen so elementaren Grundsatz, dass die Einhaltung auch ohne weiteres von einem Assistenzarzt, mithin einem Arzt in der Weiterbildung zum Facharzt, auch wenn er sich noch am Beginn der Facharztausbildung befindet, zu verlangen ist.“ Zu 3. Aufklärungsrüge Vorwegzuschicken ist eine Bemerkung des ehemaligen Vorsitzenden des Arzthaftungssenats beim Bundesgerichtshof, Dr. Steffen, in MedR 2004, 501: „Immer noch ist die Aufklärung des Patienten (umstandsbezogen) über die Risiken der Behandlung (artenbezogen) Streitpunkt Nr. 1 in der Arthaftung.“ Error! AutoText entry not defined. 15 3.1 Grundlagen der Aufklärungspflicht Die Verpflichtung des Arztes zur Aufklärung des Patienten hat verschiedene rechtliche Grundlagen, die letztlich vom verfassungsrechtlich begründeten Recht des Patienten auf Selbstbestimmung (Art. 1, 2 GG) getragen werden. Insoweit dient die Aufklärung dem Schutz der Würde und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Hinter dieser allgemeinen Herleitung treten die eigentlichen zivilrechtlichen bzw. strafrechtlichen Aspekte der Aufklärungsverpflichtung immer mehr in den Hintergrund, obwohl die verfassungsrechtliche Komponente nur bedeutsam ist, wenn man auch eine „Drittwirkung der Grundrechte“ in den Behandlungsvertrag akzeptiert. Zivilrechtlich hat die Aufklärungspflicht jedenfalls ihren Ursprung im Inhalt des Behandlungsvertrages (s.o. § 280 n. F. BGB: „Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis“). Die strafrechtliche Komponente der Aufklärungsverpflichtung wird geprägt dadurch, dass körperliche Eingriffe grundsätzlich nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig sind; diese Einwilligung wiederum ist nur wirksam, wenn die dazu notwendige Einsichtsfähigkeit vorliegt, die wiederum von dem herbeizuführen ist, der den Eingriff vornimmt. Zuletzt hat die Verpflichtung zur Aufklärung Eingang in die Berufsordnung und verschiedene Einzelgesetze gefunden; von letzteren sind erwähnenswert die gesetzlichen Bestimmungen zur Durchführung von Kastrationen, Transfusionen, Transplantationen und im Arzneimittelgesetz bei Durchführung von Arzneimittelversuchen. Die Beweislast für die Erfüllung der Aufklärungspflicht liegt grundsätzlich beim Arzt. 3.2 Aufklärungsarten (nach Laufs) Je nach Ziel- und Zweckrichtung unterscheidet man unterschiedliche Aufklärungsarten und -formen. Ihnen allen ist gemein, dass entweder besondere Pflichten konkretisiert werden, um Schaden von dem Patienten abzuwenden oder besondere Ziele verfolgt werden, die auch drittschützende Wirkung haben können (z. B. Schutz der Angehörigen – Kontaktpoliomyelitisfall). Leider ist die Terminologie nicht einheitlich; zum Teil verwahrt sie sich auch gegen eine abschließende Erfassung, weil immer wieder eine Überschneidung in Grenzbereichen vorkommt. Dies wird an den nachfolgenden Aufklärungsarten ohne weiteres deutlich, da die jeweilige Modalität je nach Vorgriff auch Gegenstand einer anderen Betrachtung sein kann. Die nachstehende Betrachtung folgt einer Übersicht von Laufs (in Rieger, Lexikon des Arztrechts, 2. Aufl. 2001 „Aufklärungspflicht“). Danach können grob getrennt werden die Selbstbestimmungsaufklärung, welche durch den Verlauf der ärztlichen Behandlung geprägt ist und die Sicherungsaufklärung, welche sich eher mit den Folgeerscheinungen einer ärztlichen Behandlung – auch gegenüber Dritten – befasst. Error! AutoText entry not defined. 16 a) Unter dem Stichwort „Selbstbestimmungsaufklärung“ erwähnenswert folgendes Aspekte: sind 3.2.1 Die Grundaufklärung verlangt eine Unterrichtung des Patienten „im Großen und Ganzen“ dergestalt, dass dem Patienten ein allgemeiner Eindruck von der Schwere des Eingriffs und der Art der Belastungen bewusst wird, die möglicherweise für seine künftige Lebensführung zu befürchten sind (z. B. OLG Brandenburg, NJW-RR 2000, 24). 3.2.2 Die Diagnoseaufklärung beinhaltet eine Information des Patienten über den medizinischen Befund; hier ist immer die Frage zu beantworten, ob bei besonders schweren Krankheitsbildern und infauster Prognose dem Patienten entsprechende Aufklärung zuteil werden muss. Dabei ist der Arzt in eine hohe Verantwortung gestellt, die sich am ehesten noch mit dem Wort von Schlegel erfassen lässt: „Aufklären, aber auch hoffen lassen“. Einer von Laufs gegebenen Empfehlung zur Nichtaufklärung (a.a.O. Rn. 3) vermag ich nicht zu folgen; dies gilt jedenfalls dann, wenn eine infauste Prognose Anlass dafür ist, ärztlich gebotene Maßnahmen vorzunehmen oder nicht gebotene zu unterlassen. 3.2.3 Die Verlaufsaufklärung gibt Auskunft über Art, Umfang und Durchführung eines Eingriffs und ist weitgehend identisch mit der „Grundaufklärung“; hierzu zählt auch die Information über solche Folgen, die sicher zu erwarten sind (z. B. Operationsnarben, Unfruchtbarkeit als Folge einer Gebärmutterentfernung); daraus wird auch der Unterschied zur Risikoaufklärung deutlich. 3.2.4 Die Risikoaufklärung vermittelt Informationen über die Gefahren eines ärztlichen Eingriffs, d.h. über mögliche dauernde oder vorübergehende Nebenfolgen, die sich auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht mit Sicherheit ausschließen lassen. Aufzuklären ist über die typischen Risiken und Gefahren des Eingriffs (aber auch seine Unterlassung). Es kann nicht genug betont werden, dass es auf die Typizität und nicht in erster Linie auf die Risikohäufigkeit ankommt, da das Bestreben des Arztes ja dahin geht, typische Risiken mit Erfolg zu vermeiden. Hinzu kommt, dass Häufigkeitsstatistiken durchaus ihre eigene Problematik aufweisen. Die Risikoaufklärung umfasst folgende Aspekte: 4.1 Art und Umfang des Eingriffs 4.2 Eventuelle Behandlungsalternativen (konservativ/invasiv); vgl. BGH, Urt. v. 15.03.2005 – VI ZR 313/03, MedR 2005, 599. 4.3 Reine Diagnoseeingriffe (Erforderlichkeit) Error! AutoText entry not defined. 17 4.4 Schönheitsoperationen (unmissverständlich und schonungslos); vgl. auch zur Blutspende BGH, Urt. v. 14.03.2006 – VI ZR 79/04, MedR 2006, 244 Besonderheiten gelten für die mutmaßliche Einwilligung beim Einwilligungsunfähigen 3.2.5 Die wirtschaftliche Aufklärung ist zunächst eine rein zivilrechtliche Verpflichtung, die man richtigerweise eher der Sicherungsaufklärung zurechnen sollte, da sie nicht durch das Selbstbestimmungsrecht geprägt ist, sondern gewissermaßen Ausdruck der Verpflichtung des Arztes zur Mitteilung besserer Kenntnisse über die materiellen Folgen des Behandlungsverhältnisses (z. B. Wahlleistungsvereinbarung, Erstattungsfähigkeit von Leistungen; Kostentragungspflicht bei NichtGKV-Leistungen). b) Die Sicherungsaufklärung (auch „therapeutische“ Aufklärung, BGH, VersR 2005, 228) verfolgt das Ziel, den Patienten vor weitergehenden Schäden zu bewahren, die nicht in erster Linie durch Auswirkungen auf die körperliche Integrität geprägt sind: 3.2.6 Aufklärung über allgemeine Umstände, die für die Lebensführung bedeutsam sind (z.B. bei Ablehnung eines gebotenen diagnostischen oder therapeutischen Eingriffs). Dazu gehört auch die Belehrung darüber, bei Verstärkung oder Sistieren von Problemen erneut einen Arzt aufzusuchen (BGH, Urt. v. 16.11.2004, VersR 2005, 228). 3.2.7 Information über die Diagnose, soweit diese nicht Gegenstand der Selbstbestimmungsaufklärung ist. Hierbei geht es insbesondere um eventuelle Nachteile für Dritte, z. B. bei ansteckenden Erkrankungen wie HIV, Hepatitis B oder auch bei der Möglichkeit des Auftretens einer Kontaktpoliomyelitis durch Impfung mit Lebendviren. 3.2.8 Aufklärung über die Medikation, insbesondere hinsichtlich Risiken und Nebenwirkungen. Typisches Beispiel ist das Auftreten eines Ulkus nach Verabreichung von Antiphlogistika, insbesondere wenn bei magenempfindlichen Patienten fehlende Sicherungsmaßnahmen hinzukommen. Auf den Beipackzettel und das Lesen desselben sollte sich der Arzt eher nicht verlassen, auch wenn das LG Dortmund (MedR 2000, 331) zumindest das Lesen des Beipackzettels zu den originären Patientenpflichten gerechnet hat (a.A. BGH, Urt. v. 15.03.2005, VersR 2005, 834). Zuletzt ist in dem Zusammenhang erwähnenswert die Verpflichtung zur Aufklärung über mögliche Gefahren, die sich aus der Benutzung eines Fahrzeuges im Anschluss an eine Behandlung ergeben können; dabei Error! AutoText entry not defined. 18 handelt es sich natürlich nur um ein Beispiel, denn entsprechende Folgen können auch mit sonstigen beruflichen Tätigkeiten eines Patienten verbunden sein, wenn und soweit der Arzt diese im Rahmen der Anamnese erfragt hat. 3.3 Fallprobleme: a) Grundaufklärung Im vorliegenden Fall wurde eine mangelnde Grundaufklärung nicht gerügt. Die Aufklärung „im Großen und Ganzen“ beinhaltet Folgeerscheinungen mit - seltenen, aber spezifischen Begleitrisiken, - die mit gravierenden Belastungen für den Patienten - oder seine Lebensführung verbunden sind Hier liegt es nahe, als einen solch gravierenden Umstand die Schulterversteifung anzusehen, nachdem der Patient im Folgenden geltend gemacht hat, durch den Eintritt an der Ausübung der Segelei gehindert zu werden. Man muss sich in dem Zusammenhang ohnehin damit abfinden, dass in Schmerzensgeldklagen immer mehr Freizeitbeschäftigungen in den Vordergrund treten – insbesondere wenn Patienten über eine lange Leidensgeschichte verfügen und in der Erwerbsfähigkeit, nicht jedoch in der Freizeitgestaltung gemindert sind. In besonderem Maße sollte bei Injektionen im Wirbelbereich zwei möglichen Folgen Aufmerksamkeit gewidmet werden, die zuletzt noch in der Publikation der Ärztekammer Nordrhein aus der Arbeit der Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler als vermeidbare Fehler bei therapeutischen Infiltrationen geschrieben worden sind (S. 41). Als unbedingt aufklärungsbedürftig sind anzusehen das mögliche Auftreten eines Pneumothorax als Folge einer Verletzung der Lunge und das Auftreten zentral-nervöser Reaktionen sowie allergischer bzw. vargovasaler Reaktionen bishin zum anaphylaktischen Schock oder zum Herzstillstand. Beides sind keine theoretischen Probleme, sondern solche, mit denen sich die Gerichte zu befassen haben. Zur Erfüllung dieser Grundaufklärung reicht z. B. folgender Satz vollständig aus, wie er in einem Aufklärungsmerkblatt nachzulesen ist: Error! AutoText entry not defined. 19 „Schwerwiegende Komplikationen im Bereich lebenswichtiger Funktionen und bleibende Schäden sind sehr selten, aber nie auszuschließen.“ b) (Eigentliche) Risikoaufklärung Die eigentliche Risikoaufklärung dient dazu, dem Patienten die Entscheidungsgrundlagen zu geben, ob er auch angesichts der Verwirklichung möglicher Risiken in die Behandlung einwilligen will. Dabei kommt der Risikohäufigkeit nur relative Bedeutung zu, wie eingangs dargelegt. Selbst Risiken in der Größenordnung von 1 : 4,5 Millionen wie bei der Kontaktpoliomyelitis sind trotz ihrer Seltenheit eben und gerade als typisch und damit aufklärungsbedürftig anzusehen. Natürlich kann andererseits ein hohes Risiko im Promillebereich (das Infektionsrisiko bei intraartikulären Injektionen wie hier liegt bei 1 : 10.000 bis 30.000) die statistische Risikohäufigkeit einen Rückschluss auf die Typizität zulassen; umgekehrt gilt dies aber nicht. Grund für diese Art der Differenzierung ist der Umstand, dass Grundlage dieser Betrachtung eine rechtsbezogene Prüfung ist, bei der die Rechtsprechung nicht dem Zwang unterliegt, Häufigkeitsstatistiken auf deren Sachgerechtigkeit zu hinterfragen. Dass im vorliegenden Fall die mögliche Entwicklung einer Schulterentzündung als typische Folge aufklärungsbedürftig war, dürfte außer Zweifel stehen – ist übrigens auch Gegenstand der rechtlichen Hinweise in den AWMF-Richtlinien. c) Sicherungsaufklärung Unter das Stichwort „Sicherungsaufklärung“ hat der BGH (Urt. v. 16.11.2004, VersR 2005, 228) auch eine Sachverhaltsgestaltung subsummiert, die auch der Verlaufsaufklärung hätte zugerechnet werden können (sog. „therapeutische“ Aufklärung). Es ging dabei um einen Patienten, der am 6.1.2000 abends Lichtblitze am Auge festgestellt und sich noch am selben Tag dem Bereitschaftsdienst vorgestellt hatte. Dieser konnte keine auffälligen Befunde erheben (Augeninnendruck, Gesichtsfeld, Augenhintergrund). Am 11.1. trat bei dem Patienten eine massive Netzhautablösung auf, die trotz zweier OP’s eine erhebliche Beeinträchtigung der Sehfähigkeit nach sich zog. Den fehlenden Hinweis auf notwendige Kontrolluntersuchungen (Empfehlung: Bei Sistieren sofort einen Arzt konsultieren!) hat der BGH als grobe Verletzung der therapeutischen Error! AutoText entry not defined. 20 Sicherungsaufklärung angesehen, weil nicht auszuschließen war, dass ein Facharzt nicht bemerkte, aber für einen Facharzt erkennbare Anzeichen der Netzhautablösung erkannt und eine erfolgreiche Therapie durchgeführt hätte. Der vom BGH angenommene grobe Behandlungsfehler führte zwangsläufig zur Umkehr der Beweislast. d) Behandlungsalternativen Weiterer Vorwurf – insbesondere nach operativen Eingriffen – ist immer wieder, dass dem Patient keine Entscheidungsfreiheit zwischen einem noch möglichen konservativen Vorgehen und einem (mit Risikoeintritt verbundenen) operativ-invasiven Vorgehen geblieben ist. Typisch für den Vorwurf der Aufklärung über Behandlungsalternativen ist gerade der orthopädische und chirurgische Bereich. Im vorliegenden Fall hätte er sich darauf beziehen können, dass der Arzt statt einer Injektion (Reagieren) Krankengymnastik hätte verordnen können, um zunächst die weitere Entwicklung und ggf. eine Besserung abzuwarten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine echte Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Behandlungsmethoden besteht. In diesem Falle hat der Patient die Entscheidungshoheit und besteht kein therapeutischer Vorrang für die Wahl einer bestimmten Methode durch den Arzt. Dies ist vorrangig eine durch Sachverständige zu beantwortende Frage. Dabei muss man trennen für die Zeit bis zum 26.08.2003 (von der Klage vorrangig gesehenes Initialereignis) und die Zeit ab 26.08.2003. Auffällig ist jedenfalls anhand der Behandlungsunterlagen, dass bis zum 26.08.2003 nur eine Schmerztherapie durch intraartikuläre Injektionen erfolgt ist, während in der Zeit ab 26.08.2003 auch physikalisch medizinische Maßnahmen ergriffen wurden und Krankengymnastik zusätzlich zur Anwendung kam. Dies hat natürlich im Wesentlichen seinen Grund darin, dass die physikalische Therapie und die Krankengymnastik vorzugsweise nicht auf die Vermeidung von Entzündungserscheinungen ausgerichtet sind, sondern auf die Vermeidung einer Schulterversteifung als mögliche Folge. Weitgehend ungelöst sind in dem Zusammenhang die durch Budgetierungen im kassenärztlichen Bereich ausgelösten Probleme (vgl. Dahm in Rieger, Lexikon des Arztrechts, 2. Aufl. 2004, „Wirtschaftlichkeitsprüfung“, Rn. 23). 3.4 Exkurs 3.4.1 Umstände der Aufklärung Grundsätzlich obliegt die Aufklärung dem behandelnden Arzt; erfolgt die Aufklärung durch einen von diesem beauftragten Arzt – wie im klinischen Alltag durch Befassung von Assistenzärzten Error! AutoText entry not defined. 21 üblich -, trägt der verantwortliche Behandler das Risiko fehlerhafter Aufklärung. Dies gilt auch im Verhältnis zum Nachbehandler. Die Art der Aufklärung ist grundsätzlich so zu gestalten, dass diese (auch wegen des therapeutischen Effektes) gesprächsweise zu erfolgen hat; eine Aufklärung allein durch Übergabe von Formularen (z. B. eines Beipackzettels) hält der BGH für nicht ausreichend. Formulare sind insoweit nur hilfreich hinsichtlich der Dokumentation, weil sie im Sinne der Rechtsprechung des BGH „einigen Beweis“ für eine erfolgte Aufklärung liefern können und damit die Möglichkeit für eine Parteivernehmung des Arztes als Beweismittel über die erfolgte Aufklärung ermöglichen. Ausländer sind grundsätzlich in ihrer Heimatsprache aufzuklären; die zivilrechtliche Rechtsprechung macht sich über die damit verbundenen Kosten indes keine Gedanken – insbesondere wenn dies die Mitbefassung eines Dolmetschers erfordert; das BSG (NJW 1996, 806), hat solche Dolmetscherkosten jedenfalls nicht als erstattungsfähig angesehen. Für den Zeitpunkt der Aufklärung ist von Folgendem auszugehen: - Bei Routineeingriffen ist die Aufklärung am Vormittag ausreichend. Im Regelfall ist jedoch die Aufklärung während des Vortages durchzuführen, um den Patienten hinreichende Überlegungszeit zu geben, um nicht unter Entscheidungsdruck zu kommen. - Bei geringfügigeren Eingriffen (z. B. KarpaltunnelOperation) kann auch die Einwilligung am Operationstag genügen. - Weit aus stringenter ist die Rechtsprechung allerdings bei planbaren Eingriffen; hier hat die (Erst-)Aufklärung bereits zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem die Entscheidung über die Durchführung des Eingriffs erfolgt und der Termin zur Durchführung vereinbart wird. Grundsätzlich ist ein Verzicht auf die Aufklärung durch den Patienten möglich („volenti non fit iniuria“). Darüber hinaus kann eine Aufklärung dann entbehrlich sein, wenn es sich um einen „voraufgeklärten“ Patienten handelt. Es muss also nicht vor jeder Injektion neu aufgeklärt werden, wenn die Aufklärung zu einem früheren Zeitpunkt – ggf. auch in Zusammenhang mit einer anderen Behandlung – stattgefunden hat. Error! AutoText entry not defined. 22 3.4.2 Erklärungsmängel Erklärungsmängel finden sich vorzugsweise dann, wenn die Einwilligung durch Willensmängel beeinträchtigt wird (insbesondere durch unrichtige oder unzutreffende Aufklärung), oder wenn sich die Frage nach der Einwilligungsfähigkeit eines Patienten stellt. Dabei kommt es nicht zwingend darauf an, ob ein Patient volljährig ist; auch der Minderjährige ist aufzuklären und kann wirksam Träger der Einwilligungserklärung sein, sofern er hinreichend einsichtsfähig ist in Art und Umstände sowie Folgen der Behandlung. Eine einheitliche Betrachtung ist daher nicht möglich; sie richtet sich vielmehr nach dem konkret beabsichtigten Eingriff und der Aufnahmefähigkeit des Patienten. Volljährige Personen können sich der Durchführung einer Behandlung selbst im Falle der Notwendigkeit vollständig versagen; typisches Beispiel ist die Verwendung von Blutprodukten in Zusammenhang mit der Behandlung von Angehörigen der „Zeugen Jehovas“. Ist der Patient einsichtsunfähig, ist für ihn ggf. ein Pfleger zu bestellen, der die notwendigen Entscheidungen für den Patenten treffen kann; dabei ist in der praktischen Durchführung häufig im Verhältnis zu den dafür zuständigen Amtsgerichten streitig, ob eine Pflegerbestellung auch dann geboten ist, wenn sich die notwendige Entscheidung nach den Kriterien der „mutmaßlichen Einwilligung“ treffen lässt. Auch die mutmaßliche Einwilligung erfolgt beim einsichtsunfähigen Patienten ohne eigentliche Aufklärung (Angehörige können insoweit behilflich sein, sind aber nicht eigentliche Entscheidungsträger); maßgeblich ist das, was der konkrete Patient in seiner Situation für sich als richtig entscheiden würde, was nicht zwingend mit dem Willen und Wollen Dritter (auch nicht des Arztes) in Einklang stehen muss. Bei nicht einwilligungsfähigen Minderjährigen ist die Aufklärung und Einwilligung beider Elternteile erforderlich, wenn es sich um einen Eingriff mit weitreichenden Folgen handelt. 3.5 Vermeidung von Haftungsfolgen bei der Aufklärung 3.5.1 Wesentliches Moment des „Risk-Managements“ ist natürlich die Aufklärung über die Grundlagen zur Wahrung der Entscheidungshoheit des Patienten. 3.5.2 Dokumentation Wie ausgeführt, erfordert die Aufklärung ein persönliches Gespräch; in den üblicherweise verwendeten Aufklärungsbögen Error! AutoText entry not defined. 23 sollten die wesentlichen Aspekte handschriftlich eingetragen werden. Bei echten Behandlungsalternativen sollten auch das konkret geplante Vorgehen beschrieben werden und die zur Verfügung stehenden Alternativen Erwähnung finden. Zumindest sollte sich der Arzt angewöhnen, bei erfolgter Aufklärung diese durch ein entsprechendes Kürzel in den Behandlungsunterlagen zu dokumentieren, was auch im praktischen Praxisalltag geschehen kann (beispielsweise durch ein „A“. Solche Kürzel sind zwar in der Literatur (z. B. RumlerDetzel) kritisch gesehen worden, können aber gleichwohl – jedenfalls im Sinne der 3.5.3 „Immer-so“-Rechtsprechung (OLG Karlsruhe, MedR 2003, 229) beweisrechtlich gewertet werden. Die „Immer-so“-Rechtsprechung erkennt an, dass sich Zeugen in aller Regel Jahre nach dem schadensstiftenden Ereignis natürlich an Art und Umstände des Aufklärungsgesprächs im Einzelfall nicht mehr erinnern können – alles andere wäre eigentlich ein Grund dafür, die Zeugen als unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Um so wichtiger ist es, Grundlagen einer solchen „Immer-so“Rechtsprechung zu bilden und in regelmäßigen Abständen nachgeordnetes Personal (Arzthelferinnen) hinzuziehen, damit man im Bedarfsfalle über Zeugen verfügt, die bestätigen können, dass ein bestimmter Aufklärungsinhalt typischer Gegenstand des Arzt-Patientengesprächs ist. 3.5.4 Sollte auch dies nicht helfen, kann die Dokumentation im Sinne der Rechtsprechung zum „einigen Beweis“ (BGH, NJW 1985, 1399) weiter helfen, wonach jedenfalls dann, wenn einiger Beweis (durch Dokumentation) für die Aufklärung erbracht ist, dem Arzt im Zweifel geglaubt werden kann, dass sich die Aufklärung in einer bestimmten Form vollzogen hat. Das LG Essen (Urt. v. 18.10.2006 – 1 O 56/04) spricht insoweit zu recht von einem „Vertrauensvorschuss“ für den behandelnden Arzt. 3.5.5 Letztlich darf hier – wie zum Behandlungsfehler allgemein – angemerkt werden, dass man sich zunächst voreiliger Äußerungen ohne sachkundige Beratung enthalten soll und auch bei den Begrifflichkeiten Zurückhaltung wahren sollte. So reicht es oft aus, statt von „äußerst“ unwahrscheinlich, von „eher“ unwahrscheinlich zu sprechen, um die notwendige Relativierung herbeizuführen. 4. Dokumentationsrüge Error! AutoText entry not defined. 24 Von besonderer Bedeutung im Arzthaftungsprozess ist die sogenannte „Dokumentationsrüge“, auch wenn Dokumentationsversäumnisse grundsätzlich keine eigenständige Haftung begründen. Verletzungen der Dokumentationspflicht lösen aber ggf. für den Patienten Beweiserleichterungen bis zur Beweislastumkehr aus und haben daher ihre eigenständige Bedeutung. Sachverhaltshinweis: Erinnern wir uns an die eingangs gegebene Sachverhaltsdarstellung, derzufolge in der elektronisch geführten Patientenkarte beim Behandler Folgendes gleich an mehreren Tage dokumentiert ist: „Kein Hinweis für Rötung oder Überwärmung“ (1.7.2003; 27.8.2003; 3.9.2003; 29.9.2003). Demgegenüber sind anlässlich der Krankenhausbehandlung des Patienten dokumentiert: „Erhöhte Entzündungsparameter“ (am 1.10.2003) Keine Hinweise hierauf befinden sich bei der ambulanten Vorstellung zur Vorbereitung der stationären Aufnahme im Anamnesebogen vom 22.9.2003. Demgegenüber ist in den Behandlungsunterlagen dokumentiert für den 19.9.2003 folgender Hinweis: „Stationäre Aufnahme zur Arthroskopie für den 1.1.2003 vorgesehen“. Hier bliebe ggf. die Frage zu klären, woher der Behandler dies bereits am 19.9.2003 – vor Durchführung der ambulanten Eingangsuntersuchung im Krankenhaus gewusst hat. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass der Behandler hierüber mit dem Krankenhaus im Vorfeld gesprochen und eine entsprechende Festlegung getroffen hat – was möglicherweise klärungsbedürftig ist. 4.1 Dokumentationspflicht 4.1.1 Rechtsgrundlage der Dokumentationspflicht ist der Umstand, dass den Arzt im Behandlungsverhältnis Nebenpflichten treffen, die ihre Ursache in der „Schadensminderungspflicht“ haben und bezwecken, Ärzte und Pflegepersonal über den Verlauf der Behandlung zu informieren. 4.1.2 In diesem Sinne ist die sachgerechte Dokumentation zunächst Gedächtnisstütze für den Arzt, soll aber auch im Error! AutoText entry not defined. 25 Patienteninteresse das Behandlungsgeschehen absichern und abbilden. Rechtsgrundlage ist einmal der Arzt-Patienten-Vertrag; weitergehende Vorgaben finden sich in der Berufsordnung (§ 10), wonach über die in Ausübung des Berufs gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen sind. Eine Reihe von Spezialgesetzen sehen besondere Dokumentationsverpflichtungen vor, wie die Strahlenschutzverordnung und die Röntgenverordnung; § 30 HeilBG-NW besagt zudem ausdrücklich, dass die Kammerangehörigen insbesondere auch die Pflicht haben, über die in Ausübung ihres Berufs gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen Aufzeichnungen zu fertigen (§ 30 Nr. 3). 4.1.3 Inhaltlich muss die Dokumentation darauf ausgerichtet sein, Zeit und Ort des jeweiligen Behandlungsgeschehens festzuhalten, sowie Aufzeichnungen hinsichtlich Anamnese und Diagnostik vorzusehen, die grundlegenden Therapieschritte festzuhalten; sie sollte sich darüber hinaus – schon im Eigeninteresse – auf Umfang und Inhalt einer erfolgten Aufklärung beziehen. 4.1.4 Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen darüber, wann der Dokumentationspflicht zu genügen ist. Grundsätzlich haben Eintragungen in die Behandlungsunterlagen „zeitnah“ zu erfolgen; dies schließt nachträgliche Eintragungen nicht aus, solange der Arzt nicht die Änderungsbefugnis verloren hat. Hierbei ist darauf zu achten, dass keinerlei Irrtum über die Person des Ausstellers (bzw. des Eintragenden) erfolgt, da ärztliche Behandlungsunterlagen grundsätzlich den Urkundsbegriff im Sinne des Strafgesetzbuches erfüllen und nachträgliche Veränderungen mit einer Täuschung über die Person des Ausstellers eine Urkundenfälschung darstellen können (§ 267 StGB). Der Zeitpunkt der Vornahme von Veränderungen ist daher zu dokumentieren. 4.1.5 Ergänzt wird die Dokumentationspflicht durch die Aufbewahrungspflicht, die in aller Regel 10 Jahre beträgt (so § 10 Abs. 3 BO, § 57 Abs. 2 BMV-Ä, § 28 RöV), soweit das Gesetz nicht ausdrücklich längere Aufbewahrungsfristen fordert (bei der Strahlentherapie 30 Jahre, nach § 14 Transfusionsgesetz 15 Jahre, nach § 11 Transfusionsgesetz 20 Jahre für die Spenderdokumentation. 4.2 Befundsicherungspflicht und Beweiserleichterung Ein anschauliches Beispiel für die Verletzung der Dokumentationspflicht gibt das Urteil des BGH vom 13.2.1996, NJW 1996, 1589 – „EKG“). Die Verletzung der Error! AutoText entry not defined. 26 Befundsicherungspflicht (Organisationsaufgabe der Behandlerseite) hat für den Patienten Beweiserleichterungen bis zur Umkehr der Beweislast bzw. zur Umkehr der konkreten Beweisführungslast zur Folge (vgl. auch BGH, VersR 2001, 1030). In dem Fall des BGH ging es darum, dass der Patient vormittags über Schmerzen im Brustbereich klagte, was der Arzt zum Anlass nahm, ein EKG zu erstellen und auszuwerten. Für den Nachmittag hatte der Arzt weitere Untersuchungen eingeplant und den Patienten zunächst nach Hause entlassen. Mittags erlitt der Patient einen Herzinfarkt; im anschließenden Behandlungsfehlerprozess war aus den Behandlungsunterlagen nur noch ersichtlich, dass ein EKG durchgeführt worden ist; auch lag noch die schriftliche Auswertung vor, das EKG selbst konnte nicht mehr aufgefunden werden. 4.2.1 Bei seiner Entscheidung konnte der BGH – sachverständig beraten – davon ausgehen, dass die Thoraxschmerzen einen positiven EKG-Befund hinreichend wahrscheinlich erscheinen ließen und dass für diesen Fall sich die vorläufige Entlassung des Patienten als fehlerhaft dargestellt hätte, da der Patient entweder unter ärztlicher Aufsicht (bis zum Nachmittag) hätte bleiben müssen oder eine notfallmäßige Einweisung ins Krankenhaus erforderlich gewesen wäre. 4.2.2 Der BGH hat dem Patienten zunächst eine Beweiserleichterung dahin gewährt, dass den Patienten nicht mehr die Beweislast dafür treffen soll, dass tatsächlich ein beginnendes Infarktgeschehen vorgelegen hat, auch wenn dies noch nicht zu einer vollständigen Umkehr der Beweislast führen musste. Ausdrücklich betont der BGH die Verpflichtung zur Befundsicherung als Organisationspflicht (BGH, NJW 1996, 780), was nunmehr auch aus § 280 n. F. BGB hergeleitet werden kann. 4.2.3 Dass die schriftliche Auswertung des EKG-Befundes vorgelegt werden konnte, hat der BGH nicht als ausreichend erachtet, weil vorliegend nicht die Durchführung des EKG als solches in Frage stand, sondern gerade die Richtigkeit des EKG. Der Kläger musste also nicht mehr beweisen, dass das EKG einen Infarkt erkennen ließ. 4.2.4 Damit war der Beweis für die Ursächlichkeit – auch diese muss der Patient beweisen – für den später eingetretenen Tod noch nicht erbracht. Hier half der BGH dem Patienten damit weiter, dass die zunächst gewährte Beweiserleichterung bis zur Umkehr der Beweislast erstreckt wurde. Error! AutoText entry not defined. 27 4.2.5 Ausgehend von der These, dass eine fehlerhafte Auswertung des EKG einen fundamentalen Diagnoseirrtum beinhaltet hätte oder die Nichterhebung eines EKG einen eklatanten Verstoß gegen die Befunderhebungspflicht dargestellt hätte, konnte von einem groben Behandlungsfehler ausgegangen werden (vgl. BGH, Urt. v. 29.5.2001, ArztR 2001, 343). Diese Bewertung wurde allerdings nicht etwa aus der „hohlen Hand“ getroffen, sondern unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Sachverständige eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen gravierenden Befund (größer als 90 %) unterstellt hatte. Hinzu kam, dass bei dem Patienten zusätzlich Bluthochdruck bestand, eine Herzvergrößerung gegeben war und der Patient über Thoraxschmerzen geklagt hatte. Unter Berücksichtigung aller Umstände, auch der angesprochenen Indizien wäre eine Verkennung des EKG-Befundes grob fehlerhaft gewesen. 4.2.6 Die Wertung, ob ein grober Behandlungsfehler vorliegt oder nicht, ist Rechtsfrage, die notwendigerweise vom Gericht zu beantworten ist, für die aber eine sachverständige Begutachtung unerlässlich ist. Kritisch bewertet hat der BGH im vorliegenden Fall die erkennbar von großer Zurückhaltung geprägten Ausführungen des Sachverständigen (Hinweis: Auch die Verletzung der Aufklärungspflicht kann unter bestimmten Umständen als grober Behandlungsfehler bewertet werden, BGH, Urt. v. 16.11.2004, VersR 2005, 228). 4.2.7 Derartige Beweiserleichterungen beruhen im Ergebnis auf Billigkeitserwägungen zur Abhilfe von Beweisnot für den Patienten unter Abwägung des Umstandes, dass der Arzt derjenige ist, der über das bessere Wissen verfügt. Auch wenn die Dokumentation nicht dazu dient, dem Patienten Beweise für einen späteren Arzthaftungsprozess zu verschaffen oder zu sichern, ergeben sich aus der Nichtwahrnehmung der Dokumentationspflicht nachteilige Folgen bei der Rechtsverteidigung. 4.3 Vermeidungsstrategien Die in der Praxis bedeutsame Frage ist, in welcher Weise der Arzt mit der Verpflichtung zur Dokumentation vernünftigerweise umzugehen hat. 4.3.1 Festgehalten werden muss zunächst, dass die vielfach – oft zu recht – geführte Klage über den Umfang der Dokumentation nicht dem Arzt, sondern allenfalls dem Kläger hilft. 4.3.2 Es führt kein Weg an der Folgerung vorbei, dass die Dokumentation eher mehr als weniger beinhalten sollte. Natürlich ist nicht zu übersehen, dass eine ansonsten sorgfältige Dokumentation, die einen später als entscheidend aus der expost-Betrachtung angesehenen Gesichtspunkt nicht enthält, eher Error! AutoText entry not defined. 28 schädlich als nützlich ist; aus der späteren Betrachtung ließe sich folgern, dass Nicht-Dokumentiertes eben auch nicht geschehen ist. Dabei handelt es sich insofern aber um ein Scheinproblem, als dieser Umkehrschluss stets einer fehlenden Dokumentation vorgehalten werden kann. 4.3.3 Wesentlich ist auch, dass keine nachträglichen Veränderungen ohne entsprechende Kenntlichmachung vorgenommen werden dürfen; dabei dürfte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass nachträgliche Eintragungen oder Veränderungen der Behandlungsunterlagen das Datum der Vornahme erkennbar werden lassen und ersichtlich wird, welche Person die Änderungen vorgenommen hat. Ansonsten droht der Verlust an Glaubwürdigkeit, aber auch der Verlust des Versicherungsschutzes – abgesehen davon, dass auch hier eine Umkehr der Beweislast nahe liegt. 4.3.4 Dies führt zu der Empfehlung, möglichst zeitnah zu dokumentieren und eine abschließende Prüfung der Behandlungsunterlagen spätestens bei Beendigung des Behandlungsfalles vorzunehmen – ggf. auch eine Epikrise anzulegen. 4.3.5 Als empfehlenswert ist die Dokumentation folgender ärztlicher Maßnahmen anzusehen: Diagnose, Untersuchungen, Funktionsbefunde, Medikation, besondere Anweisungen, ggf. Gründe für ein Abweichen vom Standard. Hinsichtlich des Verlaufs der Erkrankung empfiehlt sich das Festhalten der Aufklärung, selbstverständlich der OP-Berichte, des Narkose-Protokolls, Auftreten von Zwischenfällen, Wechsel des Operateurs, sorgfältige Kontrolle bei „Anfänger-Behandlung“ und der Intensivpflege. Im Übrigen obliegt natürlich die Anfertigung der Pflegeprotokolle dem betreffenden Pflegepersonal. Auch hier ist meines Erachtens der Arzt der Kontrolle der Pflegeberichte nicht enthoben, zumal diese häufig Hinweise auf Beobachtungen des Pflegepersonals enthalten, die oftmals für die ärztlichen Entscheidungen und ihre Überprüfung bedeutsam sind. Dr. jur. Franz-Josef Dahm, Rechtsanwalt und Notar Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Medizinrecht Sozietät Schmidt, von der Osten & Huber Haumannplatz 28-30 45130 Essen www.soh.de Error! AutoText entry not defined.