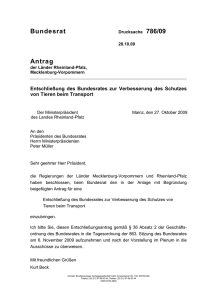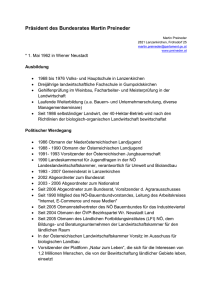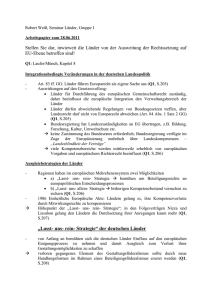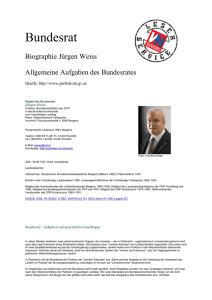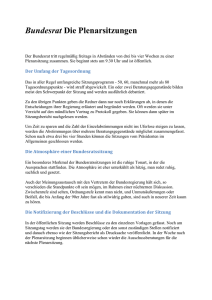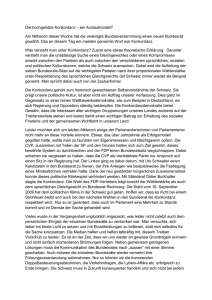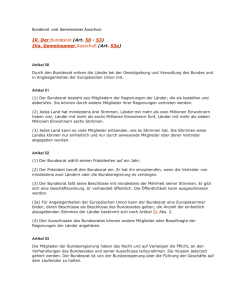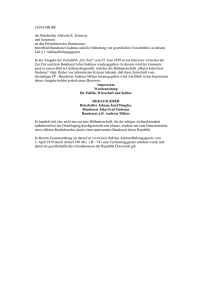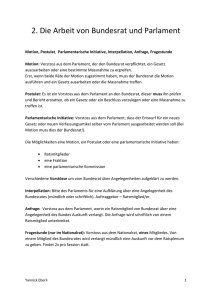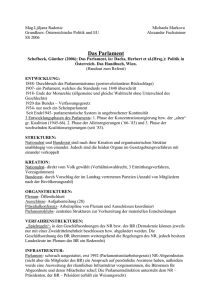Zur Zukunft des Regierungssystems der Schweiz
Werbung

Zur Zukunft des Regierungssystems der Schweiz Eine Auslegeordnung der möglichen Reformen des Schweizer Bundesrates für die kommende Generation Referent: Claude Longchamp, Politikwissenschafter, Lehrbeauftragter der Universitäten St. Gallen und Zürich, Verwaltungsratspräsident und Institutsleiter gfs.bern Gehalten vor dem Juvenat dem Aargauischen Jugendrat Aarau, 21. November 2009 21. November 2009 Copyright by gfs.bern Meine sehr verehrten Damen und Herren Ich habe die Einladung, vor dem Juvenat, dem Aargauischen Jugendrat, zu sprechen, aus zwei Gründen gerne angenommen: Zuerst erinnert mich der Aargau an meine eigene politische Sozialisation. Ich bin in Aarau ins Gymnasium gegangen und politisiert worden. Nach dem Studium bin ich aber weggezogen, um Politikwissenschafter zu werden. Sodann motivierte mich der Saal, indem wir heute sind: Denn der Aargauer Grossratssaal ist der älteste in der Schweiz, das im Halbrund entstanden ist und so eine wichtige politische Botschaft hat. Alle haben die öffentliche Sache vor Augen, wenn sie auf den Redner aus ihrer Mitte schauen. Doch alle nehmen dabei eine unterschiedliche Perspektive ein, wenn sie ihm zuhören. Sie haben mich gebeten, zur Zukunft des politischen Systems der Schweiz zu sprechen, und dabei insbesondere auf das Regierungssystem und seine möglichen Reformen einzugehen. Ich werde mich diesem Auftrag in drei Schritten annähern: Der erste ist historisch ausgelegt; es geht mir darum zu verstehen, was die Konstanten im politischen System der Schweiz sind. Der zweite bezieht sich auf die aktuelle Reformdiskussion in der Schweiz, die namentlich mit den Erschütterungen des Jahres 2009 entstanden sind: Stichworte wie Finanz- und Wirtschaftskrise, Aufhebung des Bankgeheimnisses, Schwarze Listen der OECD, Geiseln in Libyen mögen als Stichworte genügen, um klar zu machen, um was es hier geht: Nämlich um die aktuelle Stimmungslage, die unser politisches System schrecklich veraltet aussehen lässt. Im dritten und letzten Teil will ich mich dann als Politikwissenschafter mit den hauptsächlichen Vorschlägen für eine Reform namentlich des Bundesrates beschäftigen, um zu einem Schluss zu kommen, der sowohl den inneren wie auch den äusseren Rahmendingungen des Regierungssystems genügend Rechnung tragen könnte. Die Eigenheiten des politischen Systems der Schweiz Auch wenn der Aargau gelegentlich als Stammland der Habsburger bezeichnet wird, die im Wasserschloss einst Grafen waren, bevor sie Herzöge von Österreich, deutsche Könige und römische Kaiser wurden, muss man gleich von Beginn weg festhalten: Die Monarchie als politisches System ist in der Schweiz unbedeutend. Die Kultur, die wir entwickelt haben, ist nicht auf eine Person zugeschnitten, die alles bestimmt. Sie ist nicht auf göttliche Fügung ausgerichtet, sodass es sich nicht lohnt, sich mit dem eigenen Leben zu beschäftigen. Vielmehr ist der eidgenössische Gedanke als Form der Selbstverwaltung von Städten und Ländern im 13. Jahrhundert entstanden, hat sich gehalten, weiter entwickelt und zu einer Emanzipierung der Eidgenossenschaft vom Kaiserreich geführt, was früh das republikanische Verständnis von Politik gefördert hat. Die Republik ist denn auch der Gegensatz zur Monarchie. Es ist die Staatsform, bei der das Staatsvolk sich selber regiert, weil es – und nicht der Kaiser, König oder Fürst – am Gemeinwohl interessiert ist. Wir kennen drei Typen von Republiken: die aristokratische, die bürgerliche und die Volksrepublik. Mit der französischen Revolution ist das alte Regime der aristokratischen Republiken in halb Europa in Frage gestellt worden. 1798 wurde die Schweiz eine moderne Republik, aus der, nicht ohne Gegentendenzen, 1848 die Schweizerische Eidgenossen2 schaft als bürgerliche Republik entstanden ist. Staatsvorstellungen, wie sie in Volksrepubliken Gültigkeit haben, sind in der Schweiz kaum je relevant gewesen. Zu den Eigenheiten der bürgerlichen Republik in den Schweizer Kantonen gehört die frühe Demokratisierung. Schneller waren nur die USA. In den 1830er Jahren brachen die fortschrittlicheren Kantone auf, versprachen den Bürgern in den Kleinstädten und den Bauern auf dem Lande Freiheiten und gewannen so die Oberhand gegen die Patrizier und Zünfte, die vormals die Herrschaft ausübten. Auf schweizerischer Ebene waren 1848 und 1874 markante Einschnitte der Demokratisierung. Denn 1848 erhielt die Schweiz ein Parlament, bestehend aus National- und Ständerat, das die Regierung – den Bundesrat – wählt, während 26 Jahre danach die Volksrechte eingeführt wurden, mit denen wir die Sachentscheidungen von Parlament korrigieren können oder dem Parlament auch bindende Vorschriften für sachbezogene Beschlüsse machen können. Damit ging die Schweiz deutlich weiter als die meisten Demokratien bis heute. Denn diese folgen in der Regel dem britischen Vorbild, wonach ein Parlament genügt, das vom Volk gewählt wird, um von einer Demokratie zu sprechen. Die wichtigste Weiterentwicklung ausserhalb der Schweiz ist die Volkswahl der Regierungsspitze, also eines Präsidenten oder einer Präsidentin. Bei uns ist das nicht so: Unser Bundespräsident ist der Chef des Bundesrates und er wird durch diesen selber bestimmt. Er ist auf ein Jahr gewählt, wobei sich die Bundesräte entsprechend der Amtsdauer abwechseln. Man kann es so sagen: Das politische System der Schweiz ist durch die Vorstellungen der bürgerlichen Republik bestimmt, die frühzeitig demokratisiert wurden, wobei die Volksrechte die Macht des Parlamentes beschneiden. Dafür haben wir wenig direkten Einfluss auf die Regierungsbildung, was auch eine Konsequenz hat: Mit dem reinen parlamentarischen, aber auch mit dem präsidentiellen politischen System geht der Wettbewerbsgedanke verstärkt einher. Die Erringung der politischen Macht geschieht über die Erringung der Mehrheit im Parlament oder über den Sieg bei der Präsidentschaftswahl. Wem das gelingt, der regiert alleine. Entsprechend fördert der Wettbewerbsgedanke die Vorstellung der Politik als Alternanz – als Abwechslung von Mehrheiten. Die direkte Demokratie mit Sachabstimmung kompliziert das parlamentarische System, denn die Entscheidungen bei Wahlen sind von jenen bei Referendums- oder Initiativeabstimmungen verschieden. Und die Mehrheit im Parlament kann zerfallen, wenn Regierungsparteien in Sachfragen in die Opposition gehen. Deshalb vertragen sich Wettbewerbsgedanke und direkte Demokratie schlecht. Oder anders gesagt: Direkte Demokratien tendieren dazu, den Wettbewerbsgedanken vor allem bei der Bestimmung der Regierung zugunsten der Konkordanz einzuschränken. Entsprechend ist der Bundesrat nur phasenweise nach der Mehrheitsregel zusammengesetzt worden, seit 1959 indessen nie mehr. Immer hat sich die Auffassung durchgesetzt, ihn aus mehr Parteien als nötig zusammensetzen, damit er nicht nur im Parlament abgestützt ist, sondern auch die Opposition einer Partei in Sachfragen erträgt. Deshalb besteht der Bundesrat seit fast genau 50 Jahren aus VertreterInnen von FDP, CVP, SP und SVP. Mehrheiten in der Bundesregierung sind möglich, selbst wenn eine Partei ausschert; schwierig ist es erst, wenn zwei Parteien sachpolitisch eine andere Position vertreten. Das gilt nicht nur im Bundesrat, sondern auch in beiden Parlamentskammern und in der Regel auch bei Volksabstimmungen. Doch sind es nicht immer die gleichen Parteien, welche die sachpolitische Mehrheit ausmachen. Mitte-rechts bestimmt meist, wenn 3 es um Finanzen, Wirtschaft und Armee geht, während in Fragen der Aussenpolitik, der Umwelt oder der Gesellschaft meist Mitte-links die Mehrheiten herstellen. Doch haben wir heute keine reine Konsenspolitik mehr. Das ist offensichtlich. Die Polarisierung zwischen SVP und SP respektive Grünen ist viel zu gross, dass wir noch von Konsenspolitik sprechen könnten. Aber wir haben unverändert ein Konkordanzsystem mit sachpolitisch variablen Mehrheiten. Das hat seinen Grund in den Zwängen der direkten Demokratie, jedoch nicht nur. Auch die kulturelle Vielfalt der Schweiz mit ihren zahlreichen Regionalismen, Konfessionen und Sprachen bedingen die politische Kooperation, die nicht alleine durch parteipolitische Mehrheiten bedingt ist. Urteile zum Zustand des politischen Systems heute Ist das jedoch ein gutes oder schlechtes System? In den Medien schwanken die Antworten zwischen Strukturkonservatismus und aktuellen Politikversagen. Wir sind stolz auf unsere Institutionen und überzeugt, dass sie mindestens so gut wie alt sind. Das gilt ganz besonders für die Volksrechte, aber auch für den Föderalismus, die starke Stellung der Kantone in der Eidgenossenschaft. Eingeschränkt trifft das auch auf das Milizsystem zu, wonach nicht Berufspolitiker in unseren Parlamenten sitzen, sondern Leute, die einen bestimmten Teil ihres Lebens für die Politik aufbringen. Doch es gibt auch Kritik: Etwa wenn der Bundespräsident Hans-Rudolf Merz nach Tri­polis fliegt um zwei Schweizer aus den Zwängen der Libyer zu befreien, dann aber ohne sichtbare Erfolge zurückkehrt. Oder wenn die Schweiz wegen ihrer Steuerpolitik auf Schwarze Listen gesetzt wird, ohne es zu merken. Die Antworten, welche die Politikwissenschaft zur Güte des schweizerischen politischen Systems gibt, sind nicht eindeutig. Durchwegs betont wird, dass es sich um einen Spezialfall handelt, der aus seiner frühen Entstehung heraus verstanden werden muss. Gelobt wird die überwiegend friedliche Konfliktregelung durch breite Bürgerpartizipation in Entscheidungsverfahren auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene. Doch da beginnt auch die Kritik. Die Leistungsfähigkeit des Staates wird mitunter in Frage gestellt, weil es zu viele gibt, die mitreden, und wir vor allem auch zu viele Organisationen haben, die Entscheidungen blockieren oder ganz verhindern können. Das hinterlässt bisweilen den Eindruck einer staatlichen Unbeweglichkeit. Auch unter Politikwissenschaftern gilt der Bundesrat als jene Institution, die am klarsten reformbedürftig ist. Es fehlt an Führung. Es hat zu viele Veto-Player. Und es mangelt an politischer Voraussicht, kann man hören. Für die einen ist das aber eher eine Folge des Auswahlverfahrens, das die falschen Personen begünstigt, während andere eher die strukturelle Schwäche betonen. Systemanalysen haben gegenüber medialen Stimmungen auf jeden Fall den Vorteil, nicht eindimensionale Lösungsvorschläge zu entwickeln. Denn das ist es, was man an der öffentlichen Debatte über den Bundesrat durchaus kritisieren kann: Sobald ein Prob­lem auftaucht, wittert man eine tiefer liegende Ursache, die es zu beheben gilt. Tritt dann das nächste Problem auf, spielt sich gleiches ab, ohne dass man nach den Zusammenhängen fragt. 4 Ich will in der Folge das nicht wiederholen. Vielmehr will ich die Ansätze vorstellen, die eine systematische Verbesserung bringen können, weil sie sowohl die längerfristigen Stärken wie die politische Integration verschiedenartiger Kulturen als auch die kurzfristigen Schwächen wie die Handlungsfähigkeit unter politischem oder wirtschaftlichem Druck berücksichtigen. Ansätze oder Modelle der Reformdiskussion des Bundesrates Die Reformdiskussion unseres Regierungssystems kennt drei wichtige Richtungen: • • • Erstens geht es um die Institution des Bundesrates als Ganzes, zweitens geht es um die Wahl des Bundesrates und drittens geht es um die richtige parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrates. Lassen sie mich die wichtigsten Positionen, die dabei vertreten werden, zuerst kurz vorstellen und dann zuhanden der Diskussion bewerten. Der Bundesrat selber sieht einen Handlungsbedarf bei der eigenen Führung. Er hat das EJPD, das Justiz- und Polizeidepartement, jüngst damit beauftragt, die Staatsleitung zu überdenken. Dem Bundesrat schwebt vor, das Bundespräsidium zu stärken – beispielsweise durch eine zwei- oder vierjährige Amtsdauer für den jeweiligen Bundespräsidenten. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch, ob dem Bundespräsidenten vor allem die Führung des Regierungsgremiums im Innern obliegt oder ob er auch die Schweiz nach Aussen vertreten solle. Dabei gibt es offensichtlich unterschiedliche Auf­fassungen auch in der jetzigen Regierung. Entsprechend überlegt man bisweilen auch, dem Bundespräsidenten einen gestärkten Vizepräsidenten zur Seite zu stellen, der die Aussen- und Europapolitik verantworten würde, um den Bundespräsidenten davon zu entlasten. Bereits verhandelt und vom Bundesrat nicht begrüsst wurde, das jetzige Gremium mit sieben gleichberechtigten Mitgliedern in zwei Ebenen aufzuteilen, mit beispielsweise fünf BundesrätInnen als kollektive Staatsleitung und einer Mehrzahl von MinisterInnen oder StaatssekretärInnen, denen die Führung der Sachgeschäfte obliegen würde. Diese Variante der Reformdiskussion würde es erlauben, die Bundesräte von den zahlreichen Sachgeschäften ohne Tragweite zu entlasten, womit mehr Zeit frei würde, um die generellen Richtlinien der Politik zu diskutieren und festzulegen, während der Vollzug dieser Politiken der zweiten Regierungsebene überlassen würde. In diesem Modell wären die fünf Mitglieder des Bundesrates nach parteipolitischen Gesichtspunkten zusammenzusetzen, während die fachliche Eignung bei der Besetzung der Ministerposten im Vordergrund stehen würde. Die sprachregionale Ausgewogenheit und weitere Kriterien wie das Geschlecht könnten auf beiden Ebenen gemeinsam flexibel gehandhabt werden. In Diskussion ist schliesslich die Erhöhung der Zahl der Bundesräte, verbunden mit einer Neuaufteilung der Ämter und Departemente. Das ist im Bundesrat gar nicht beliebt, im Parlament jedoch schon. Denn das UVEK und das EDI gelten als sehr grosse Departemente. Zudem gibt es Aufgaben, die von zwei oder drei Departement wahrgenommen werden, ohne dass eine klare Arbeitsteilung besteht. Und schliesslich gibt es Vorstellungen, dass man auch ein Europadepartement schaffen sollte, denn die Regelung des Verhältnisses zwischen der Schweiz und der EU sind nicht alleine eine Aufgabe des Departe5 ments des Äusse­ren, tangieren sie doch in vielerlei Hinsicht auch die anderen Verwaltungsabteilungen. Was die Zahl der zu schaffenden Departemente betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Unter Politikwissenschaftern beispielsweise ist von 9, gelegentlich auch von 11 oder 13 Departementen die Rede, wie das in einem Kabinett im Ausland üblich ist. Damit sind wir auch gleich bei der Knacknuss dieser Reformdiskussion: Ohne einen Chef funktioniert das nicht. In der Regel ist das ein Ministerpräsident mit Weisungsbefugnissen. Und genau davor hat die Politik Angst. Damit sind wir fast nahtlos beim zweiten grossen Diskussionsfeld angelangt: Der Wahl der Regierung. Die jüngsten Bundesratswahlen haben gezeigt, dass Wiederwahlen von Bundesräten aus parteipolitischen oder persönlichen Überlegungen heraus nicht mehr gesichert sind. Es wurde auch sichtbar, dass auf die Zusammensetzung der Regierung mehrfach grundsätzliche Angriffe lanciert wurden. Das stellt die Frage, welche Verbesserungsmöglichkeiten es geben würde. Hierzu gibt es ebenfalls Reformvorschläge: Erstens wird seit längerem die Blockwahl des Bundesrates diskutiert. Anstatt unsere sieben Mitglieder des Bundesrates einzeln zu bestimmen, wäre es die Aufgabe der Bundesversammlung, eine Equipe zu wählen, welche von den Parteien gemeinsam vorgeschlagen würde, die einander respektieren und damit auch miteinander regieren wollen. Denkbar ist es, dass es sogar mehrere Siebener-Listen für den Bundesrat geben würde, wobei National- und Ständerat sich für eine dieser Listen entscheiden müssten. Sicher wäre das ein Vorteil, dass nicht persönliche Überlegungen die Bundesratswahlen bis zur letzten Minute bestimmen können. Es würde die Parteien zwingen, Farbe zu bekennen, wer mit wem Sachfragen lösen möchte, und welche die geeigneten Personen hierfür sind, die zusammen auch ein Team ergeben. Eine ganze andere Stossrichtung der Reform wäre es, das Parlament in Sachen Bundesratswahl ganz zu entmachten und die Bundesregierung via Volkswahl zu bestimmen. Faktisch haben wir das in den Kantonen. Für den Bundesrat wäre ein analoges Verfahren auch denkbar. Allerdings hätte man dabei die Schwierigkeit, die Sprachregionen angemessen zu vertreten, denn das würde wohl bedingen, dass die französisch- und italienischsprachige Schweiz zusammen zwei Sitze hätten, während fünf an die deutschsprachige Schweiz gingen. Es ist nicht ganz einfach, Wahlverfahren hierfür zu finden, welche die Minderheit schützen und für jedermann nachvollziehbare Resultate liefern. Sicherlich würde sich der Charakter von Bundesratswahlen so erheblich ändern, denn es wären regelmässige Wahlkämpfe für die Bestimmung von Mitgliedern der Bundesregierung zu erwarten, was den Einfluss von Medien vermehren und die Bedeutung von Persönlichkeiten für die Parteiführung vermehren würde. Diese Diskussion werden wir fast sicher führen, denn die SVP hat eine entsprechende Volksinitiative angekündigt. Wenden wir uns dem dritten Feld der Reformdiskussion zu. Denn hier geht es um die parteipolitische Zusammensetzung. Zwei recht grundsätzliche Überlegungen stehen sich hierbei gegenüber: Soll die Zahl der Regierungsparteien eher erhöht oder eher verringert werden? Ich lasse mal die Diskussion über die Regierungswürdigkeit der jetzigen BDP ausser Acht, denn das wird sich höchst wahrscheinlich 2011 oder bei einem Rücktritt von Bundesrätin Widmer-Schlumpf klären. Wer für mehr Parteien ist, macht das in der Regel mit dem Verweis, dass die Proportionalisierung der Bundesratszusammensetzung weiter als heute getrieben werden könnte – beispielsweise damit, dass die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrates direkt an die Zusammensetzung des Parlamentes gekoppelt würde. So gäbe es eine Formel, die WählerInnenstimmen bei den Nationalratswahlen oder Sitze in der Bundesversammlung umrechnen könnten und so die parteipolitische Zu6 sammensetzung des Bundesrates automatisch bestimmt würde. Der wichtigste Einwand hierzu ist, dass die Regierungszusammensetzung anderes als die Parlamentszusammensetzung nicht nur nach parteipolitischen Repräsentationsüberlegungen, sondern auch sachpolitisch begründet erfolgen sollte. Damit sind wir beim letzten Reformvorschlag angelangt, den ich hier präsentieren möchte. Die Überlegung dahinter ist, dass wir nicht mehr, sondern weniger Parteien im Bundesrat haben sollten. Es geht darum, die Problemlösungsfindung generell zu vereinfachen. Reduziert werden soll hierfür die Zahl der möglichen Veto-Player. So soll der Handlungsspielraum des Bundesrates erweitert werden. Naturgemäss stellen die politischen Pole die VetoSpieler in einer Behörde dar. Entsprechend geht es mit der Verringerung der Zahl Parteien im Bundesrat um die Einsitznahme von SVP- oder SVP-VertreterInnen. Eine handlungsfähigere Bundesregierung bestünde deshalb nur aus SVP-, FDP- und CVP-VertreterInnen, oder aber wäre mit PolitikerInnen von FDP, CVP und SP bestückt. Man nennt das in der Regel verringerte oder kleine Konkordanz. Seit 2003 spricht man viel von der arithmetischen Konkordanz. Die Zusammensetzung des Bundesrates soll sich nur nach der Parteistärke richten. Weitere Kriterien sollen nicht angewendet werden. Die Logik dahinter ist die der politischen Repräsentation in der Regierung. Das hat sicher viel mit Konkordanz zu tun, ist wohl aber eine zu einseitige Betrachtungsweise. Was für ein Parlament gut ist, braucht für eine Regierung nicht unbedingt das Richtige zu sein. Die radikalste Form dieser Auffassung ist die, den Bundesrat nach einer formalisierten Proporzregel zusammenzusetzen. Das würde zwar die Wahlen vereinfachen. Doch Wahlen sind kein Selbstzweck, eher ein Übersetzungsmechanismus. Deshalb stellt sich auch die Frage, ob daraus auch eine gute Regierung entsteht. Ich mache hier ein Fragezeichen. Alle hier vorgestellten Reformvorschläge sollten meines Erachtens auch dahingehend diskutiert werden, in welche Masse sie eine politisch kohärente Zusammensetzung des Bundesrates begünstigen, ohne dass dabei ein eigentlichen Regierungs- und Oppositionssystem entsteht. Schluss: Aufruf zum eigenen Handeln! Lassen Sie mich zu meinen Schlussüberlegungen kommen. Wir sind davon ausgegangen, dass Reformen des Regierungssystems der Schweiz durchaus diskussionswürdig sind, dass dabei aber die Konkordanz nicht über Bord geworfen werden sollte. Vielmehr ist unser künftiges Regierungssystem gefordert, sowohl auf die Eigenheiten der Schweiz und ihrer Kultur, als auch auf die Anforderungen des Umfeldes der Schweiz in politischer wie wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll Lösungen anzubieten. Deshalb müssen die Reformdiskussion meines Erachtens nicht einzeln beurteilt, sondern im Verbund diskutiert werden. Dabei geht es nicht nur darum, was im Bundesrat mehr Führung bringt, sondern auch darum, was institutionell sinnvoll ist, via Wahlrecht begünstigt werden sollte und den Entwicklungen im Parteiensystem Rechnung trägt. Die Antwort hierauf kann die Politikwissenschaft alleine nicht geben, denn sie ist letztlich eine Antwort darauf, was wichtig und im Streitfall wichtiger ist! Das ist für alle Wertfragen wichtig und die Eigenheit von Wertfragen ist, dass sie letztlich nur politisch geklärt werden können. Die Politikwissenschaft kann hier nur klärend vorbereiten. So kann man klar sagen, dass mehr Konkordanz und mehr Handlungsspielräume einander nicht zuträglich sind. Was 7 aber darüber hinaus sinnvoll ist, kann auch die beste Wissenschaft nicht entscheiden. Vielmehr ist es gerade die Aufgabe einer jeden Generation, die Werte neu zu definieren, die ihr wichtig sind, damit sie ihre Zukunft bestimmen. Das gehört auch zu den Aufgaben eines Jugendparlamentes wie dem Ihrigen, wozu ich Ihnen mehr Beteiligung als heute und viel Glück in der Entscheidung wünsche. Claude Longchamp 8