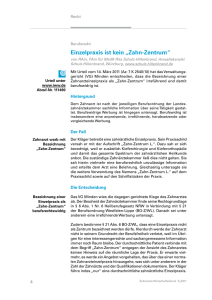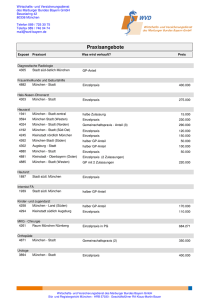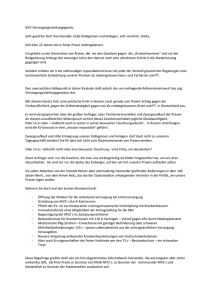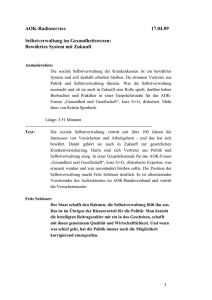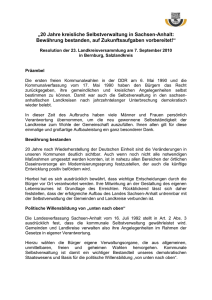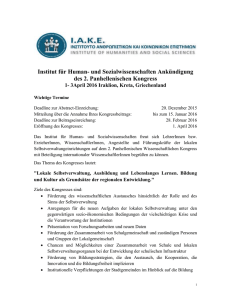Die Einzelpraxis ist de facto kein Auslaufmodell
Werbung

politik © (4) Brunner Das Podium: Moderator Egbert Maibach-Nagel, Thomas Drabinski, Kerstin Blaschke, Franz Knieps, Birgit Wöllert und Dirk Heinrich (v.li.) FVDZ-Presseseminar in Berlin „Die Einzelpraxis ist de facto kein Auslaufmodell“ Als CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorstellten, horchten Ärzte und Zahnärzte auf. Die Bundesregierung bekennt sich eindeutig zur Freiberuflichkeit. Doch eineinhalb Jahre später erhitzt das Versorgungsstärkungsgesetz die Gemüter, weil dadurch der Weg in Richtung Staatsmedizin führt. Ist die Einzelpraxis nun ein Auslaufmodell? Diese Frage haben Experten auf dem Presseseminar des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) kontrovers diskutiert. Einig waren sie sich aber darin, dass die Niederlassung wieder attraktiver werden muss. Die Formulierung im Koalitionsvertrag klingt vielversprechend. Die Große Koalition betont, dass Freiberuflichkeit ein „unverzichtbares Element für die flächendeckende ambulante Versorgung“ und ein „Garant für die Diagnose- und Therapiefreiheit und für die freie Arztwahl“ sei. Allerdings beißt sich dieser Passus mit den Plänen, die das Bundesgesundheitsministerium (BMG) aktuell vorlegt. Das neue Versorgungsstärkungsgesetz forciert nämlich unter anderem Medizinische Versorgungszentren (MVZ), den Aufkauf von Praxen in überversorg- 20 DFZ 03 ∙ 2015 ten Regionen, die Öff nung der Krankenhäuser für ambulante Behandlungen, mehr Selektivverträge und Terminservicestellen. Das wohlklingende Ziel lautet: eine flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung sicherzustellen. Gegen ein sozialistisches Versorgungsmodell Dass dieser Plan aufgeht, stellte die FVDZ-Bundesvorsitzende Kerstin Blaschke auf dem traditionellen Presseseminar des Verbandes in Berlin mit Nachdruck in Frage. „Der gesundheitspo- politik Im Gespräch: Kerstin Blaschke (li.) und Birgit Wöllert Im Fokus: Fachmedien interessierte das Thema besonders. Am Puls der Zeit: Journalisten aus ganz Deutschland wollten wissen, ob die Einzelpraxis überlebensfähig ist. litische Kurs geht in Richtung Staatsmedizin, ja sogar Sozialismus, und in solch einem System möchte ich nie wieder arbeiten“, sagte sie vor Journalisten mit Blick auf ihre Erfahrungen in der ehemaligen DDR. Die Einzelpraxis sei ein Erfolgsmodell und ein unverzichtbares Element im Gesundheitssystem. „Wir niedergelassenen, freiberuflichen Ärzte und Zahnärzte sind es, die die wohnortnahe Versorgung sichern. MVZ gehen dagegen zu Lasten der Versorgung, allein schon, weil die Wege für die Patienten immer länger werden“, betonte Blaschke. Für sie ist Freiberuflichkeit grundsätzlich nur dann gelebte Realität, wenn Ärzte und Zahnärzte vollständig Eigenverantwortung für die Patienten und Therapiefreiheit haben. Die Patienten hingegen müssten ihren Arzt und Zahnarzt jederzeit frei und unabhängig wählen dürfen. Doch die derzeit von der Politik gestellten Weichen bewirken Blaschkes Überzeugung nach das Gegenteil. „Man baut ein staatliches System auf und blutet die Freiberufl ichkeit nach und nach aus. Die bewährten und gut funktionierenden Versorgungsstrukturen stehen zur Disposition“, kritisierte die FVDZ-Bundesvorsitzende. „Warum lernt man nicht aus der Geschichte?“, fragte sie und stellte fest: „MVZ führen zu einer schlechteren medizinischen Versorgung.“ Statt den Freiberuflern das Leben schwer zu machen, indem man ihnen große Versorgungszentren vor die Nase setze und den unfairen Wettbewerb zwischen Einzelkämpfern und kommunalen Trägern massiv erhöhe, müsse die Politik vielmehr Anreize für die Selbstständigkeit schaffen. „Freiberufl iche Ärzte und Zahnärzte ersticken heute an zu viel Bürokratie, und die fi nanzielle Unsicherheit ist auch sehr groß.“ Solche schlechten Rahmenbedingungen führten dazu, dass viele junge Leute die Freiberufl ichkeit scheuten. Blaschke forderte die Politik in diesem Zusammenhang auf, entsprechende Konzepte vorzulegen. Nicht ins Kaufmann-Dasein drängen lassen Dem konnte Dr. Dirk Heinrich als Vertreter der Ärzteschaft nur zustimmen. Der Bundesvorsitzende des NAV-Virchowbundes bezeichnete die Einzelpraxis auch als unverzichtbar für die medizinische Versorgung. „Freiberuflichkeit ist in der Niederlassung am besten lebbar, allerdings ohne staatliche Eingriffe“, sagte er. Heinrich wies aber ebenfalls darauf hin, dass die Attraktivität der Niederlassung schwinde. Grund dafür sei unter anderem die Vergütung der Ärzte. In Hamburg, wo er praktiziert, rechne sich eine reine Kassenpraxis teilweise kaum noch. „Freiberuflichkeit gibt es nur, wenn das wirtschaft liche Überleben gesichert ist. Durch den wirtschaft lichen Druck werden Ärzte aber immer mehr in das Kaufmann-Dasein gedrängt.“ Die wirtschaft liche Existenzfähigkeit sei inzwischen oft wichtiger als die Frage, wo man gebraucht werde. Und das widerspreche der Freiberuflichkeit, die dringend geschützt werden müsse. Von der Politik zeigte sich der Vertreter der niedergelassenen Ärzte enttäuscht. „Anstatt Praxisnetze zu fördern, um zu zeigen, wie Niederlassung auch möglich ist, öff net die Politik die 03 ∙ 2015 DFZ 21 ▶ politik Krankenhäuser für ambulante Behandlungen und verschärft damit den Wettbewerb.“ Keine Antwort auf demografische Entwicklung Die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Mediziner untermauerte Dr. Thomas Drabinski. Der Leiter des Kieler Instituts für Mikrodaten-Analyse bescheinigte den Teilnehmern des Presseseminars, dass sich das deutsche Gesundheitssystem tiefgreifend verändern werde (siehe auch Interview Seite 23). Die derzeit geplanten Gesetze wie das Versorgungsstärkungsgesetz oder das E-Health-Gesetz hätten sehr markante Auswirkungen für die Heilberufe – hin zu noch mehr Kontrollen, Zentralisierungen und Eingriffen in die ambulante Versorgung. Drabinski fasste die Entwicklungen unter dem Schlagwort „Staatsmedizin“ zusammen. Die Freiberuflichkeit werde immer weiter eingeschränkt, erläuterte der Ökonom. Der deutsche Gesetzgeber orientiere sich sehr stark an internationalen Gesundheitssystemen, sagte Drabinski. Das habe zur Konsequenz, dass das hohe deutsche Niveau in der medizinischen Versorgung absinken werde. Drabinskis Ansicht nach sind in der Gesetzgebung noch viel zu viele Fragen offen. Zum Beispiel: Wie sieht der Gesetzgeber die Freiberuflichkeit? Wie die Selbstverwaltung? Und soll das duale Versicherungssystem mit GKV und PKV beibehalten werden? Am problematischsten sieht Drabinski aber einen ganz anderen Aspekt: „Kein Gesetz hat Antworten auf die demografische Entwicklung.“ Die nämlich erfordere den Ausbau der medizinischen Infrastruktur, weil die Gesellschaft immer älter werde. „Stattdessen steuert der Gesetzgeber ganz klar in die Welt der Wartelisten.“ Die Selbstverwaltung hat sich zu wenig gewehrt Bleibt noch die Frage: Was kann man tun gegen den Trend in die Staatsmedizin? Der Krankenversicherungsexperte und Vorstand des BKK-Dachverbandes Franz Knieps skizzierte eine Marschrichtung. Es gebe Handlungsbedarf auf allen Ebenen, betonte er. Sowohl seitens der Politik als auch bei den Wettbewerbern und der Selbstverwaltung. „Der Staat ist nicht nur der Gesetzgeber, auch in der Selbstverwaltung gibt es erheblichen Reformbedarf“, meinte Knieps, der unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt Abteilungsleiter im BMG war. Er zweifelte beispielsweise daran, dass sowohl die bisherige Bedarfsplanung als auch das Honorierungssystem in gesetzlicher und privater Krankenversicherung 22 DFZ 03 ∙ 2015 optimal sind. Auch gab er der Selbstverwaltung eine Mitschuld daran, dass Kassenärztliche Vereinigungen zum Aufkauf von Praxen in überversorgten Gegenden verpflichtet werden sollen. Hier sei einfach zu wenig getan worden. Aus seiner langjährigen Erfahrung wusste Knieps: „Wer auf den großen Wurf, also einen Systemwechsel, wartet, der wird von der Politik nicht ernst genommen.“ Auch bekomme man nicht immer das, was man fordert. „Das ist aber leider die Erwartung der Selbstverwaltung.“ Wer Einfluss auf die Politik nehmen wolle, müsse Konzepte vorlegen, die klar strukturiert seien, und aushalten, dass diese Konzepte auch verändert werden. Zum Thema Einzelpraxis hatte Knieps eine etwas andere Meinung als Blaschke und Heinrich. Er betrachtet die Freiberuflichkeit eher aus medizinisch-ethischer Sicht, und für ihn ist sie nicht identisch mit Selbstständigkeit. „Freiberuflichkeit ist nicht abhängig von der Art des Arbeitens“, sagte Knieps. „Wir brauchen beide Pfeiler, Praxen und Kliniken.“ Gleichwohl sind seiner Überzeugung nach Medizinische Versorgungszentren ohne ärztliche Leitung nicht denkbar. Nicht mehr allein das Versorgungsmodell der Zukunft MVZ als Alternative zur Einzelpraxis – das befürwortete erwartungsgemäß auch Birgit Wöllert, Obfrau der Fraktion DIE LINKE im Gesundheitsausschuss. „Die Niederlassung allein ist nicht mehr das Versorgungsmodell der Zukunft“, erklärte sie. „Regionale MVZ könnten eine Lösung sein.“ Auf jeden Fall müsste auf die persönlichen Bedürfnisse der Ärzte und Zahnärzte eingegangen werden, damit es nicht irgendwann einen Mangel an Medizinern gibt. „Wir brauchen zum Beispiel flexible Arbeitsverträge, um den Beruf attraktiv zu machen und die Versorgung sicherzustellen.“ Dass die jungen Leute heute mehr Wert auf eine gesunde Mischung aus Beruf und Privatleben legen, findet Wöllert vollkommen legitim. Darauf müsse die Politik reagieren. Was sie ja auch tue. „Tatsache ist, es gibt Konzepte, und wir können darüber streiten, ob es die richtigen sind.“ Dieses Angebot nahm die FVDZ-Bundesvorsitzende Kerstin Blaschke gerne an. „Die Einzelpraxis ist de facto kein Auslaufmodell. Aber wir müssen sie wieder attraktiver machen“, forderte sie. Die Zahnärzteschaft trage ihre Vorstellungen und Konzepte weiterhin an die Politik heran. „Wir werden das Feld nicht aufgeben.“ Melanie Fügner politik Interview mit Dr. Thomas Drabinski, Leiter des Institutes für Mikrodaten-Analyse in Kiel „Erosion am Fundament des Gesundheitssystems“ Ist die Einzelpraxis ein Auslaufmodell? Ketzerische Frage oder fast schon Realität – um dieses Thema ging es beim diesjährigen Presseseminar des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte. Dr. Thomas Drabinski, Leiter des Instituts für Mikrodaten-Analyse in Kiel spricht in diesem Zusammenhang von einem „tiefgreifenden Umwälzungsprozess“ und „zentralistischer Steuerung“. Im DFZ-Interview zeichnet Drabinski ein düsteres Bild für die Freiberuflichkeit. DFZ: Die aktuelle Gesetzgebung in Deutschland mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, dem E-Health-Gesetz, dem Präventionsgesetz und anderen mehr ordnen Sie unter dem Begriff „Staatsmedizin“ ein. Was verstehen Sie darunter? Drabinski: Staatsmedizin ist ein ordnungspolitischer Rahmen des Gesundheitssystems, bei dem der Staat einen maßgeblichen Einfluss auf medizinische Leistungserbringung, Versorgungsinfrastruktur und Behandlungsergebnis hat. Die Staatsmedizin wird durch die aktuelle Gesetzgebung massiv ausgebaut. Dies wird für die Patienten nachhaltige Veränderungen vor allem in Bezug auf Wartezeiten und Rationierungen mit sich bringen. Um die Rationierungsdiskussion vom Gesetzgeber fernzuhalten, sollen die Verknappungs- und Morbiditätslasten auf die medizinischen Leistungsanbieter überwälzt werden. DFZ: Welche Auswirkungen und Veränderungen wird das für die freiberufliche medizinische und zahnmedizinische Versorgung mit sich bringen? Drabinski: Freiberuflich tätige Ärzte und Zahnärzte – aber auch angestellte Ärzte und Zahnärzte – werden sich zukünftig in einer durch staatliche Gesundheitsbehörden überwachten Gesundheitsinfrastruktur behaupten müssen. Leitlinientreue, die Erfüllung staatlicher Qualitätspläne und eine strikte Bedarfsund Arbeitseinsatzplanung sollen die heutige Form der freiberuflichen und selbstständigen Versorgung ablösen und in eine Zentren-Struktur mit staatlich zertifizierten Heilberufsangestellten überführen. Ambulante Praxen und Zahnarztpraxen werden dann schwer verkäuflich sein, es wird kaum noch Neuniederlassungen geben, und damit beginnt die Erosion am Fundament des Gesundheitssystems. Kein Wunder also, dass es die aktuelle Gesetzgebung schwer hat, um Vertrauen bei den ambulant tätigen Leistungsanbietern zu werben. DFZ: Wie steht es um die Selbstverwaltung? Drabinski: Die Selbstverwaltung in ihrer heutigen Form und in ihren unterschiedlichsten Varianten wird bei konsequenter Umsetzung der Staatsmedizin überflüssig geworden sein. Denn dann hat die regionalpolitische Gesundheitsplanungsautorität die Aufgaben der Selbstverwaltung übernommen. Im Zeitraum bis dahin werden einzelne Selbstveraltungspartner noch von der Hoff nung getragen sein, die Inhalte der Staatsmedizin aufhalten oder mitgestalten zu können. In Wahrheit werden sie nur als Steigbügelhalter gebraucht, um den Übergangszeitraum zum Nutzen der Staatsmedizin-Akteure auszugestalten. DFZ: Wie sehen Sie die Zukunft der PKV und die der GKV – welche Veränderung wird es geben? Drabinski: Für die PKV hat der Gesetzgeber denselben Weg wie für die Selbstverwaltung vorgesehen: Die Gesundheitspolitik beziffert mittlerweile die Verweildauer des Systems auf 15 Jahre. Die GKV wird dann das System für alle Bürger sein, so wie es die Konzepte der Bürgerversicherung vorsehen. © Brunner DFZ: Herr Drabinski, als Volkswirt haben Sie das große Ganze der Gesundheitswirtschaft im Blick auf der Basis der Mikrodaten-Analyse. Welche Befürchtungen hegen Sie für den Gesundheitssektor? Drabinski: Wie die Daten zeigen, steht das Gesundheitssystem unmittelbar vor historischen Herausforderungen durch die demografische Veränderung. Meine Einschätzung ist, dass der Gesetzgeber zu wenig auf den Weg bringt. Und wenn er etwas tut, dann zu viel Falsches, um zur Lösung dieser Herausforderungen beizutragen. Zum Beispiel wurde der Gesundheitsfonds mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz umgesetzt, um den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zu intensivieren. Das Ergebnis ist ein Krankenkassen-Konzentrationsprozess mit dem vorgezeichneten Weg in die Einheitskasse. Kurzvita Dr. Thomas Drabinski studierte Volkswirtschaftslehre und Politik mit den Schwerpunkten Finanzwissenschaften, Sozialpolitik und Ökonometrie in Gießen, Wolverhampton und Kiel. Drabinski leitet das Institut für Mikodaten-Analyse (IfMDA) in Kiel und ist Lehrbeauftragter an der Universität Kiel für Gesundheitspolitik und Gesundheitökonomie. Seine aktuellen Forschungsprojekte beschäftigen sich vor allem mit der Finanzierung von GKV und PKV und den Auswirkungen der demografischen Veränderungen in Deutschland. 03 ∙ 2015 DFZ 23 ▶ politik DFZ: Gibt es jemanden, der von den aktuellen Reformen profitiert? Drabinski: Von den aktuellen Reformen profitieren nur Gesetzgebungsinstanzen und diejenigen Parteien, die die Bürgerversicherung propagieren. Alle anderen verlieren. Wir leben derzeit in der erstaunlichen Situation eines fatalen gesundheitspolitischen Paternalismus. DFZ: Wie sähe eine echte Reform des Gesundheitswesens in Deutschland aus, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen? Drabinski: Hierzu gibt es alle notwendigen Ausarbeitungen, die mit dem Begriff der reformierten Dualität beschrieben werden. Die Politik ist aber nicht an einer echten Reform interessiert. Sie will eben Einheitskasse und Staatsmedizin – und da passt keine Gesundheitsreform ins Konzept, die die Systeme verbessert. DFZ: Wagen Sie einen Blick in die Kristallkugel: Wie sieht die gesundheitliche Versorgung in zehn Jahren in Deutschland aus? Drabinski: Leider sehr viel schlechter als heute. Weniger ambulante Praxen, weniger Krankenhausbetten und wesentlich mehr staatliche Überwachung, Sanktionierung sowie Warte- und „Terminservice“-Listen. Dafür wird es aber auch einen sehr viel größeren Selbstzahlermarkt geben: Wer es sich leisten kann, wird – wie es zum Beispiel in Großbritannien gang und gäbe ist – einen Bogen um die zunehmend überlasteten staatsmedizinischen Einrichtungen machen und sich selbst die medizinische Versorgung einkaufen. Zumindest, wenn der Gesetzgeber diese Angebote nicht als illegitim definiert. Interview: Sabine Schmitt Interview mit Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes „Einzelpraxis bleibt wesentlicher Eckpfeiler“ Ist die Einzelpraxis ein Auslaufmodell? Ganz so dramatisch sieht der Vorstand des BKK-Dachverbandes Franz Knieps die Lage nicht – er warnt allerdings davor, dass die Einzelpraxis an Attraktivität verliert. DFZ: Herr Knieps, blutet die Einzelpraxis tatsächlich aus? Knieps: Nein, die Einzelpraxis bleibt wesentlicher Eckpfeiler der ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung. Allerdings werden andere Formen, wie die Praxisgemeinschaft, die Gemeinschaftspraxis und das medizinische Versorgungszentrum hinzutreten. Gerade junge Ärztinnen und Ärzte scheuen das Risiko einer Niederlassung und wollen – zumindest befristet – erst einmal als Angestellte anfangen. DFZ: Sie warnen davor, dass die Niederlassung in der Einzelpraxis an Attraktivität für junge Ärzte und Zahnärzte verliert. Warum hat die junge Generation weniger Lust, freiberuflich zu arbeiten? Knieps: Freiberuflich kann man auch als angestellter Arzt sein. Sie meinen wohl eher selbstständig. Die Selbstständigkeit ist ein Risiko, mit dem man umgehen lernen muss. Nicht nur die Finanzfragen müssen geregelt sein. Auch die Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Praxen und Institutionen des Gesundheitswesens will gelernt sein. DFZ: Welchen Beitrag können die aktuellen Gesetze und Gesetzesvorhaben auf eine Verbesserung der Situation leisten? Knieps: Den großen Wurf zur Lösung aller Probleme gibt es nicht. Von dieser Illusion haben sich Gesundheitspolitiker aller Couleur in Bund und Ländern verabschieden müssen. Vielmehr enthalten die aktuellen Gesetzesvorgaben eine Reihe von Details, die in die richtige Richtung führt. Sie enthalten aber auch symbolische Politik, die uns keinen Schritt weiterführt. DFZ: Gibt es Alternativen zu Überangebot einerseits und Unterversorgung andererseits? Knieps: In der Tat bestehen Über-, Unter- und Fehlversorgung nebeneinander. An diesem Befund des Sachverständigenrats, der auf Angaben der wichtigsten Institutionen des Gesundheitswesens beruht, hat sich auch nach zehn Jahren kaum etwas ver- 24 DFZ 03 ∙ 2015 ändert. Allerdings ist die Skepsis gewachsen, ob das Instrument der sektoralen Bedarfsplanung geeignet ist, diesen Problemen zu Leibe zu rücken. Offensichtlich ist die Lage komplizierter, und es müssen vielfältige Ansätze von der Aus- und Weiterbildung über die Finanzierung bis hin zur Institutionalisierung der Kooperationen geregelt werden. DFZ: Wie sehen Sie die Rolle der Selbstverwaltung? Knieps: Solange die Selbstverwaltung als Kampfplatz für Interessen- und Verteilungskonflikte gesehen wird, wird sie ihrem Gestaltungsauft rag nicht gerecht. Aus der Selbstverwaltung muss wieder mehr Innovation für Entwicklungen von Versorgungsstrukturen und Versorgungsprozessen kommen. Betrachtet man die Selbstverwaltung als Bollwerk gegen Veränderungen, darf man sich nicht wundern, wenn der Gesetzgeber bis ins Detail vorschreibt, wie er sich Versorgung vorstellt. DFZ: Sind medizinische Versorgungszentren, wie sie vor allem in den ländlichen Gebieten vorgesehen sind, eine Lösung, um die „Niederlassungsmuffel“ zu motivieren? Knieps: Medizinische Versorgungszentren sind erst einmal schlichte Betriebsformen der ambulanten Versorgung. Im MVZ können selbstständige und angestellte Mediziner tätig werden. MVZ lösen per se nicht die Probleme auf dem Lande. Sie können allerdings die Risiken eines Einstiegs in den Niederlassungen begrenzen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass eine Reihe angestellter Ärztinnen und Ärzte nach einer gewissen Zeit den Weg in die Selbstständigkeit finden. DFZ: Inwiefern spielt die ärztliche Honorierung bei der Entscheidung zur Niederlassung eine Rolle? Knieps: Die Entscheidung, eine Praxis zu kaufen oder eine neue zu gründen, ist eine Lebensentscheidung. Von daher müssen die ökonomischen Bedingungen so ausgestaltet sein, dass auch aus politik © Brunner finanzieller Perspektive eine solche Entscheidung attraktiv ist. Sonst besteht die Gefahr, dass sachfremde Erwägungen das ärztliche Handeln bestimmen. Das wäre nicht vereinbar mit Freiberuflichkeit – sowohl bei selbstständigen wie bei angestellten Ärzten und Zahnärzten. DFZ: Wie müsste die medizinische Infrastruktur optimalerweise aussehen? Knieps: Wenn ich diese Frage in drei Sätzen beantworten könnte, wäre ich Anwärter auf gleich zwei Nobelpreise, den für Medizin und den für Ökonomie. Die optimale Versorgung muss regional durch das Zusammenwirken vieler Beteiligter organisiert werden. Hier gibt es kein Optimum, das als Blaupause für die gesamte Republik taugen würde. Vielmehr müssen die örtlichen Verhältnisse zentral für Lösung von Versorgungsproblemen betrachtet werden. Der gesetzliche Rahmen muss so gestaltet werden, dass niemand eine Problemlösung blockieren kann und vielfältige Wege im Wettbewerb beschritten werden können. Kurzvita Franz Knieps leitet seit knapp zwei Jahren den BKK Dachverband. Der Jurist, Politik- und Literaturwissenschaftler weist jahrzehntelange Erfahrung im deutschen und internationalen Gesundheitswesen auf. Knieps war unter anderem als Geschäftsführer beim AOK Bundesverband tätig, bevor er unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) als Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung für sechs Jahre ins Bundesministerium für Gesundheit wechselte. Er gilt als einer ihrer wichtigsten Berater. Knieps arbeitete auch als Berater für Sozialpolitik und Gesundheitssystementwicklung für die World Health Organisation (WHO) und die Europäische Union. Interview: Sabine Schmitt Kieferorthopädie bei Erwachsenen Knochen ist wachsweich und passt sich an Kieferorthopädie bei Erwachsenen? Das war bis vor einigen Jahren gar kein Thema – doch mit immer besserer Zahnerhaltung bis ins hohe Alter werden kieferorthopädische Maßnahmen für Erwachsene immer notwendiger. es für den Patienten, den neuen Biss auch zu erhalten und dies zu trainieren. Bezahlt wird die Kieferorthopädie für Erwachsene in den meisten Fällen nicht von den Kassen, sondern ist eine reine Privatleistung. Radlanski hält das für falsch: „Kieferorthopädie ist Prophylaxe“, sagt er. Wandernde Zähne können zu Fehlfunktionen im Kiefergelenk und anderen Funktionsstörungen führen. Außerdem spielt ein gut erhaltener Knochen auch in der prothetischen Versorgung, sei es für Brücken oder Implantate, eine ausschlaggebende Rolle. „Bevor der Zahnarzt eine Brücke einarbeitet, sollte der Kieferorthopäde erstmal ‚aufräumen’“, meint der Uni-Professor. Für Parodontalbehandlungen gelte im Grunde dasselbe. Da die Zähne heute etwa drei Jahrzehnte länger im Mund blieben, als dies früher der Fall war, sei Kieferorthopädie für ihn lebensbegleitend. „Und es ist wunderbar, hinterher in strahlende Gesichter zu schauen, bei allen Patienten, gleich welchen Alters, denn ihnen wird das Leben erleichtert“, ist Radlanski überzeugt. sas Professor Dr. Dr. Ralf J. Radlanski © Fügner Über die Möglichkeiten und Auswirkungen auch in Hinblick auf prothetische Maßnahmen berichtete Professor Dr. Dr. Ralf J. Radlanski, Direktor der Abteilung für Experimentelle Zah-, Mund- und Kieferheilkunde/Orale Biologie an der Charité – Universitätsmedizin in Berlin beim diesjährigen Presseseminar des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ). „Es ist noch nicht so lange her, da haben sich Menschen mit Anfang Fünfzig auf ihre dritten Zähne gefreut“, sagte Radlanski. Viel länger seien Zähne trotz zahnärztlicher Bemühungen nicht zu retten gewesen. Die Fortschritte der modernen Zahn-, Mundund Kieferheilkunde hätten es jedoch ermöglicht, dass Zähne heute quasi lebenslang erhalten werden können. Doch trotz neuer Materialien und besseren Kenntnissen gebe es einen Fakt, an dem kein Zahnarzt vorbei komme: „Die Zähne schaukeln im Knochen vor sich hin“, hob Radlanski hervor. „Der Knochen ist wachsweich und passt sich an – und das geschieht auch schon bei wenig Druck.“ Nur wenn die Zähne gleichmäßig im Knochen verteilt stünden und funktionell gegeneinander abgestützt seien, sei ein langfristiger Erhalt möglich. Ergebnisse aus dieser Erkenntnis zeigte der Charité-Professor beispielhaft in Bildern. „Die moderne Kieferorthopädie macht sich diese ständige Umbauarbeit des Körpers und Instabilität des Knochengewebes zunutze“, erläuterte er. „Ein bisschen Physik und ein bisschen Feinmechanik – dafür gibt es keine Altersgrenze.“ Die Ergebnisse, die Radlanski den Teilnehmern des Presseseminars präsentierte, zeigten beeindruckende Veränderungen des Gebissstatus’ ebenso wie des Gesichtes. Etwa anderthalb Jahre dauert die Behandlung mit Verdrahtung oder Schiene – und dann heißt Charité – Universitätsmedizin Berlin 03 ∙ 2015 DFZ 25 © amstockphoto / iStock / thinkstock politik Biokompatibilität von Werkstoffen Unüberschaubar viele Bestandteile – langfristige Effekte Die Wissenschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten mit riesigen Schritten vorangegangen. Viele Bereiche wurden erforscht, andere neu entdeckt. Mit den modernen Materialien, die heute in der restaurativen Zahnmedizin eingesetzt werden und deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper beschäftigt sich Professor Dr. Werner Geurtsen an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Bislang gibt es keine Studien zu Auswirkungen und Wechselwirkungen von Kunststoffbestandteilen in den modernen Füllungsmaterialien“, erläuterte der Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde der MHH beim diesjährigen Presseseminar des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) in Berlin. „Obwohl die ersten Füllungswerkstoffe bereits Anfang der sechziger Jahre auf den Markt kamen, gibt es nach wie vor keine klinischen Studien.“ Eine Risikoabschätzung, auch bei geringer Abgabe der Substanzen im Körper, sei bislang kaum möglich. Im Gegensatz zu den relativ klar definierten metallischen Werkstoffen, mit denen früher restaurativ an Zähnen gearbeitet wurde, stellten Materialien auf Kunststoffbasis geradezu komplexe Gemische dar, deren Zusammensetzung unüberschaubar – und meist auch ein Betriebsgeheimnis der Hersteller – seien. Aus bis zu 60 unterschiedlichen Bestandteilen seien die modernen Füllungskunststoffe zusammengesetzt. Mögliche Folgen: Hypersensibilität und Allergien bis hin zu Mutagenität und Karzinogenität. „Es gibt zu wenig Informationen © Fügner Prof. Dr. Werner Geurtsen 26 Medizinische Hochschule Hannover (MHH) DFZ 03 ∙ 2015 über potenzielle Nebenwirkungen“, sagte Geurtsen. „Das kann vierzig Jahre dauern, bis so etwas zum Tragen kommt.“ Werkstoff mit vielen Unbekannten Unklar bleibe durch die mangelnde Kenntnis der Zusammensetzung der Werkstoffe auch, wie viel und welche Bestandteile letztlich tatsächlich durch den Speichel ausgespült werden können. Wenn man davon ausgehe, dass bis zu zwei Prozent des Gewichts einer Füllung im Laufe der Jahre abgegeben werden, dann könnten insgesamt etwa zehn Prozent des Kunststoffs über die Schleimhäute und den Magen des Patienten absorbiert werden. „Über die toxischen Reaktionen wissen wir bisher nicht viel“, betonte Geurtsen. Allergien gegen eines oder mehrere Kunststoffbestandteil seien allerdings das größte Problem der Werkstoffe mit den vielen Unbekannten. Fallbeobachtungen zeigten, dass die Kunststoffe lokale allergische Reaktionen verursachen könnten. Allerdings seien nicht nur Patienten betroffen, sondern in erhöhtem Maß auch das zahnärztliche Personal. Beispielsweise könnten sich erhebliche allergische Reaktionen nach Art einer Kontaktallergie an den Fingern zeigen. Studien aus den skandinavischen Ländern zeigten, dass es auch zu Allergien beim zahnärztlichen Personal durch flüchtigen Kunststoff in der Atemluft kommen kann. Reaktionen an Augen und Haut seien keine Seltenheit. Geurtsens Tipp: ungeschützten Kontakt mit den Werkstoffen vermeiden. Er fordert genaue gesetzliche Vorgaben und eine klare Deklaration der Inhaltsstoffe. Auch wenn es bisher keine Beweise für biologische Auswirkungen und Unverträglichkeiten gebe, so heiße das nicht, dass es sie nicht gebe. Wie in der Wissenschaft üblich, dauere es mitunter, bis Beweise erbracht sind. sas