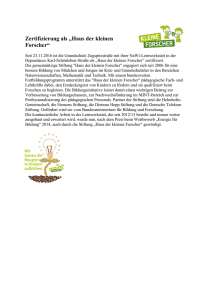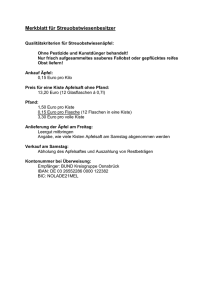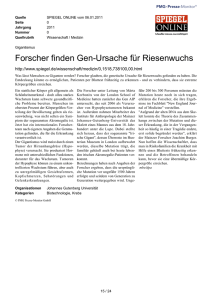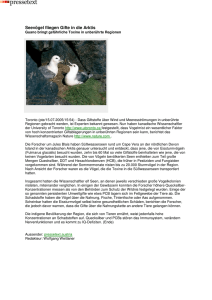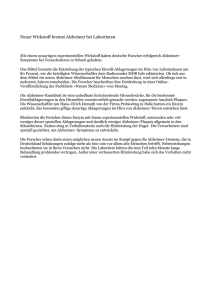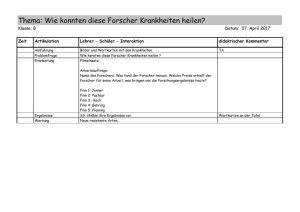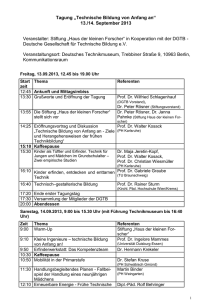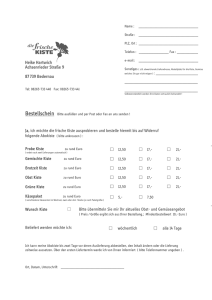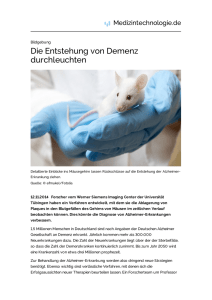Sechster Sinn für Fettiges
Werbung

Neuö Zürcör Zäitung 48 FORSCHUNG UND TECHNIK Mittwoch, 30. Juli 2014 V Nr. 174 Sechster Sinn für Fettiges Auch für den Fettgeschmack scheinen Menschen Rezeptoren auf der Zunge zu haben Wie nehmen wir Geschmäcker wahr? Darüber ist längst noch nicht alles bekannt. Nach gängiger Lehrmeinung erzeugen der Geruchs- und der Tastsinn den Fettgeschmack. Dies scheint jedoch nur die halbe Wahrheit zu sein. dagegen nicht fündig geworden. Dies ist Behrens’ Team nun aber gelungen. «Die Lipasen sind im Gesamtspeichel nicht nachweisbar, sondern werden offensichtlich lokal in der Nähe der Geschmacksknospen ausgeschüttet», sagt Koautor Thomas Hofmann von der Technischen Universität München. Daher seien sie erst jetzt entdeckt worden. Die Forscher wiesen die fettspaltenden Enzyme nun direkt auf der Zungenoberfläche nach. Dazu legten sie Probanden Filterplättchen auf die Zunge, die mit Triolein – dem Triglycerid der Ölsäure – getränkt waren. Nach spätestens zweieinhalb Minuten wurden die Plättchen wieder entfernt und analysiert. Auf den Filtern fand sich umso mehr freie Ölsäure, je länger sie auf der Zunge verblieben waren – die Lipasen hatten mehr Zeit, um das Fett zu zerlegen. Waren die Filter zusätzlich mit einem Lipase-Hemmstoff getränkt, verlief der Abbau deutlich langsamer. Weitere Untersuchungen zeigten, dass die Enzyme in direkter Nähe zu den Geschmacksknospen gebildet werden. Elke Maier Ob es an dem köstlichen Geschmack, dem unwiderstehlichen Duft oder der angenehmen Konsistenz liegt, dass wir Lust auf Fettiges haben, dürfte den meisten von uns egal sein – wir essen es einfach. Für Wissenschafter aber tut sich hier ein ergiebiges Forschungsfeld auf. Denn wie Schmecken funktioniert, ist längst noch nicht verstanden. Bis anhin steht noch nicht einmal fest, wie viele Geschmacksqualitäten wir wahrnehmen können. Als gesichert gelten fünf – süss, sauer, salzig, bitter sowie das herzhaft-fleischige Umami. Umstritten ist dagegen, ob es auch einen «sechsten Sinn» für fettig gibt. Nach gängiger Lehrmeinung sind für die Fettwahrnehmung vor allem der Geruchs- und der Tastsinn zuständig, die auf das Aroma und die Beschaffenheit fetthaltiger Nahrung ansprechen. Nun mehren sich aber die Hinweise, dass Menschen auch für Fette Geschmacksrezeptoren haben. Nach Molekülen angeln Am Geschmackssinn sind beim Menschen einige tausend Geschmacksknospen beteiligt. In Gruppen sitzen diese vor allem auf der Zunge. Sie bestehen jeweils aus mehreren länglichen Sinneszellen, die ähnlich angeordnet sind wie die Schnitze in einer Orange. Lange Zeit nahm man an, dass bestimmte Areale auf der Zunge für die einzelnen Geschmacksqualitäten zuständig sind – etwa die Zungenspitze für süss. Tatsächlich aber gibt es überall Knospen mit Sinneszellen für jeden Geschmack und lediglich geringe Unterschiede in der Empfindlichkeit. Die Geschmacksrezeptoren sind in die Wand der Sinneszellen eingebettet und angeln im Speichel nach vorbeitreibenden Geschmacksmolekülen. Dockt ein Molekül an den passenden Rezeptor Lipasen sorgen für Geschmack Aus evolutionsbiologischer Sicht essen wir gern fettige Kost, weil sie kalorienreich ist und uns für karge Zeiten rüstet. FRANK SORGE / CARO an, sendet die Zelle ein Signal aus, das über Nervenbahnen ans Gehirn weitergeleitet wird und dort das entsprechende Geschmackserlebnis erzeugt. Dazu trägt allerdings auch der Geruch bei. Der Geschmackssinn sorgt für Genuss, ist aber vor allem für die Qualitätskontrolle der Nahrung wichtig. Er ermöglicht, Essbares von Ungeniessbarem oder gar Giftigem zu unterscheiden. Toxische Pflanzen oder Verdorbenes schmecken oft bitter oder sauer. Süss und Umami stehen dagegen für Kohlenhydrate beziehungsweise Proteine und versprechen Energie. Sie verführen zum Essen. Dies war einmal ein evolutionärer Vorteil – als Nahrung noch eine knappe Ressource war. Daher scheint es naheliegend, dass Menschen auch einen Sinn für das besonders gehaltvolle Fett haben sollten. Bei Mäusen hatten Forscher um Philippe Besnard von der Université de Bourgogne in Dijon bereits im Jahr 2005 einen Geschmacksrezeptor für Fett beschrieben. Im Versuch verglichen sie das Fressverhalten normaler Mäuse mit dem von Artgenossen, denen der Rezeptor namens CD36 aufgrund einer Mutation fehlte. Dabei zeigte ausschliesslich die erste Gruppe eine Vorliebe für fettreiche Kost. Die mutierten Nager hingegen frassen gleich viel fetthaltiges und fettarmes Futter – sie schmeckten offenbar keinen Unterschied. Mittlerweile wurden bei Nagetieren verschiedene solcher Fett-Sensoren gefunden. Forscher unter der Leitung von Maik Behrens vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (Dife) begaben sich daraufhin beim Menschen auf die Suche. Sie fahndeten gezielt nach dem GPR120-Rezeptor, der von Mäusen bekannt war und zudem im menschlichen Magen-Darm- Trakt vorkommt. Dort ist er am Fettstoffwechsel beteiligt. Mithilfe molekularer Methoden identifizierten die Forscher GPR120 erstmals auch im Mund. Ausserdem fanden sie heraus, dass der Rezeptor auf langkettige Fettsäuren reagiert. In Geschmackstests waren das genau diejenigen Stoffe, die den typischen Fettgeschmack hervorriefen. Diese Ergebnisse wurden 2011 publiziert. Unklar war allerdings noch, wie die Fettsäuren aus der Nahrung freigesetzt werden. Denn bei Nahrungsfetten handelt es sich meist um Triglyceride. Sie bestehen aus einem Glycerinmolekül, an dem drei Fettsäuren hängen. Diese sperrigen Verbindungen können an die Rezeptoren nicht andocken. Daher sind Enzyme notwendig, um die Bindung zwischen dem Glycerin und seinen Fettsäureanhängseln aufzubrechen. Im Mäusespeichel kommen solche Lipasen reichlich vor; beim Menschen war man Eine Fettverkostung ergab, dass die Lipasen tatsächlich für das Geschmackserlebnis «fettig» erforderlich sind: Probierten die Versuchsteilnehmer Triolein zusammen mit dem Lipase-Hemmer, so nahmen sie den Geschmack schwächer wahr. Ausserdem gab es Personen, die für den Fettgeschmack empfindlicher waren als andere. Bei ihnen waren die fettspaltenden Enzyme besonders aktiv. Ob manche Menschen deswegen besonders viel Fett essen, weil sie den Geschmack erst bei höheren Konzentrationen registrieren, ist derzeit noch offen. «Denkbar wäre auch der umgekehrte Fall, nämlich dass der Geschmackssinn durch hohe Fettzufuhr mit der Zeit nachlässt», sagt Hofmann. Der endgültige Beweis für den sechsten Sinn steht ebenfalls noch aus. Um diesen zu erbringen, müssen die Forscher die Sinneszellen mit den Fettrezeptoren nachweisen und zeigen, dass deren Signale ans Gehirn weitergeleitet werden, wo sie das Geschmackserlebnis «fettig» hervorrufen. Diesen Nachweis hat man für die fünf anderen Geschmacksqualitäten bereits erbracht. Als Letztes im Jahr 2002 für Umami. Die Unschärfe unseres Gedächtnisses Wie das Gehirn aktualisiert und was das für Konsequenzen hat Eine Erinnerung wird bei jedem Abrufen für kurze Zeit instabil. Dadurch kann das Gedächtnis aktualisiert werden, ist gleichzeitig aber auch manipulierbar. Dies hat für Gerichtsverfahren und die Psychotherapie Konsequenzen. Johannes Gräff Ein Kind, das sich die Finger an einer heissen Herdplatte verbrennt, wird sich zeit seines Lebens an dieses Ereignis erinnern, so hoffen die Eltern. Aber was geschieht mit der Erinnerung, wenn das Kind beim nächsten Küchenbesuch beobachtet, dass seine Eltern die Herdplatte zwar berühren, sich aber nicht daran verbrennen, da diese nicht eingeschaltet ist? Eine bis zur Jahrtausendwende vorherrschende Theorie auf dem Gebiet der Gedächtnisforschung besagte, dass sich ein einmal geformtes Gedächtnis über die Zeit nicht mehr verändert, vorausgesetzt, seine Wichtigkeit ist gross. Weil es für das Kind existenziell wichtig ist zu lernen, sich nicht zu verbrennen, würde es sich gemäss dieser Theorie also immer daran erinnern, dass Herdplatten heiss sind. Im Jahr 2000 jedoch publizierte eine Forschergruppe um den Neurobiologen Joseph LeDoux von der New York Uni- versity eine seither vielzitierte Studie, die diese Theorie infrage stellt. Dafür benutzten die Forscher Ratten und eine Substanz, welche die für die Gedächtnisbildung wichtige Proteinsynthese blockiert. Erhielten die Ratten diese Substanz, unmittelbar nachdem sie sich an ein schmerzhaftes Erlebnis erinnert hatten – man setzte die Tiere in eine Kiste, in der sie einige Tage zuvor einen Stromschlag erfahren hatten –, verschwand die Angst vor der Kiste. Die Tiere entwickelten also kein nachhaltiges Angstgedächtnis bezüglich der Kiste. Wurde die gleiche Substanz jedoch ohne Wiedersehen der Kiste verabreicht, reagierten die Tiere weiterhin äusserst ängstlich auf diese. Aus diesen Beobachtungen schlossen die Forscher, dass sich ein einmal geformtes Gedächtnis durch dessen Hervorrufen, also durch den Vorgang des Sicherinnerns, verändern lässt. Da dieser Prozess auf ähnlichen neuronalen Vorgängen beruht wie die ursprüngliche Gedächtnisbildung, die in der Fachsprache Konsolidierung genannt wird, wurde er als Rekonsolidierung bezeichnet. Demnach erlaubt es die Rekonsolidierung, das ursprüngliche Gedächtnis mit aktuellen Informationen auf den neuesten Stand zu setzen. So lernt das Kind etwa, dass eine Platte nur heiss ist, wenn sie angeschaltet ist. In den Jahren nach dem Erscheinen dieser Studie entbrannte auf dem Gebiet der Gedächtnisforschung ein inten- siv geführter Streit zwischen Rekonsolidierungsbefürwortern und -gegnern. Denn einerseits war es mit LeDoux’ Versuchsanordnung nicht möglich, ausschliesslich diejenigen Nervenzellen zu manipulieren, die für die Gedächtnisbildung verantwortlich waren – es könnte sich bei dieser Beobachtung also um einen unspezifischen Effekt handeln. Andererseits könnte eine Aktualisierung des Gedächtnisses auch mit einer zweiten, neuen Gedächtnisspur erklärt werden: Diese würde durch die neuen Gegebenheiten hervorgerufen und existierte parallel zur ursprünglichen Gedächtnisspur. Erinnerung künstlich abrufen Einen ersten stichhaltigen Beweis für die Rekonsolidierungstheorie lieferte 2012 eine Arbeit des Hirnforschers Mark Mayford vom Scripps Institute in Kalifornien. Dazu entwickelten die Forscher genetisch modifizierte Mäuse, in denen bestimmte Nervenzellen, die bei der Bildung einer Erinnerung involviert sind, mit einer passenden Substanz zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiviert werden können. Auf diese Weise konnten die Forscher eine bestimmte Gedächtnisspur künstlich reaktivieren. Die Forscher trainierten die Mäuse dahingehend, eine Angsterinnerung an eine Kiste A zu entwickeln. Dabei wurde eine bestimmte Gruppe von Neuronen aktiviert und mit einem Re- zeptor markiert. Wurden die «A-Neuronen» danach künstlich reaktiviert, zeigten die Tiere tatsächlich eine typische Angstreaktion, selbst wenn die Kiste A nicht gegenwärtig war. Das System erlaubte es also, künstlich eine Erinnerung hervorzurufen. In einem weiteren Experiment zeigte man den Tieren dann eine ihnen unbekannte Kiste B, vor welcher sie keine Angst hatten. Aktivierte man nun aber gleichzeitig die «A-Neuronen» in der B-Kiste und testete danach die Angstreaktion der Tiere auf die ursprünglich angsteinflössende A-Kiste, reagierten sie weniger ängstlich als zuvor. Wurden die «A-Neuronen» in der B-Kiste hingegen nicht reaktiviert, veränderte sich die Angstreaktion der Tiere nicht. Die Reaktivierung der ursprünglichen Gedächtnisspur in der als sicher eingestuften B-Kiste ermöglichte es demnach, die ängstliche Erinnerung abzuwandeln. Diese Experimente demonstrieren, dass eine abgerufene Erinnerung von aussen manipuliert werden kann. Die gewonnene Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen: Wenn sich eine Erinnerung bei jedem Hervorrufen verändern lassen kann, wie zuverlässig sind dann noch Zeugenaussagen vor Gericht? Metaanalysen haben ergeben, dass falsche Zeugenaussagen mehr als 75 Prozent aller anhand von später erfolgten DNA Tests revidierten Verurteilungen zugrunde liegen. Könnte es also sein, dass sich die Erinnerungen von Zeugen durch das wiederholte Abrufen bei der Befragung beeinflussen lassen? In Anbetracht der Labilität der Erinnerung scheint ein gewisses Risiko zu bestehen. Therapeutischer Nutzen Bei der Behandlung von traumatischen Erinnerungen ist die Labilität dagegen ein Vorteil. Die erfolgreichste Behandlungsmethode ist die verhaltenstherapeutische Konfrontationstherapie. Dabei werden Patienten in einer sicheren Umgebung wiederholt mit dem AngstAuslöser konfrontiert. Seit langem war bekannt, dass ein erfolgreiches Sich-inErinnerung-Rufen dieses Auslösers ausschlaggebend für den Erfolg oder Nichterfolg einer Konfrontationstherapie ist – eine empirische Erkenntnis, die durch die neuesten Resultate der Gedächtnisforschung unterstützt wird. Der Grundsatz der Veränderlichkeit einer Erinnerung bedeutet letztlich aber auch, dass sich eine Erinnerung nie ganz in ihrer ursprünglichen Form fassen lässt, weil sie beim Versuch dabei zwangsweise durch die jeweiligen Umstände zum Zeitpunkt des Sicherinnerns beeinflusst wird. Somit könnte es sein, dass die grösste Errungenschaft unseres Gedächtnisses, nämlich die Fähigkeit zur sukzessiven Integration neuer Informationen, gleichsam auf seiner grössten Schwäche fusst: einer dem Gedächtnis inhärenten Unschärfe.