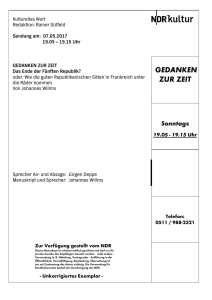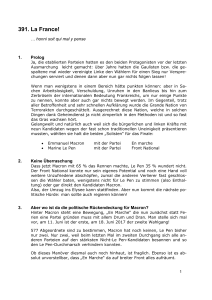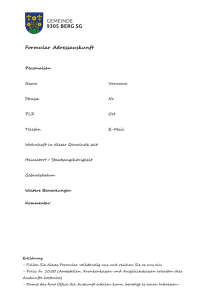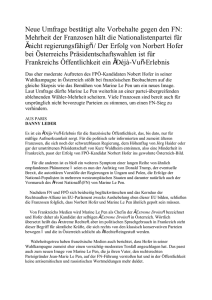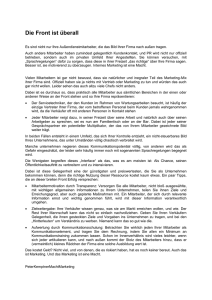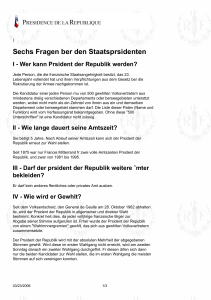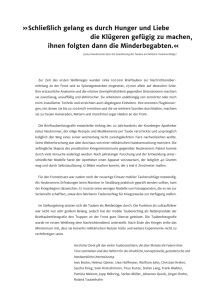Das Ende der Fünften Republik?
Werbung
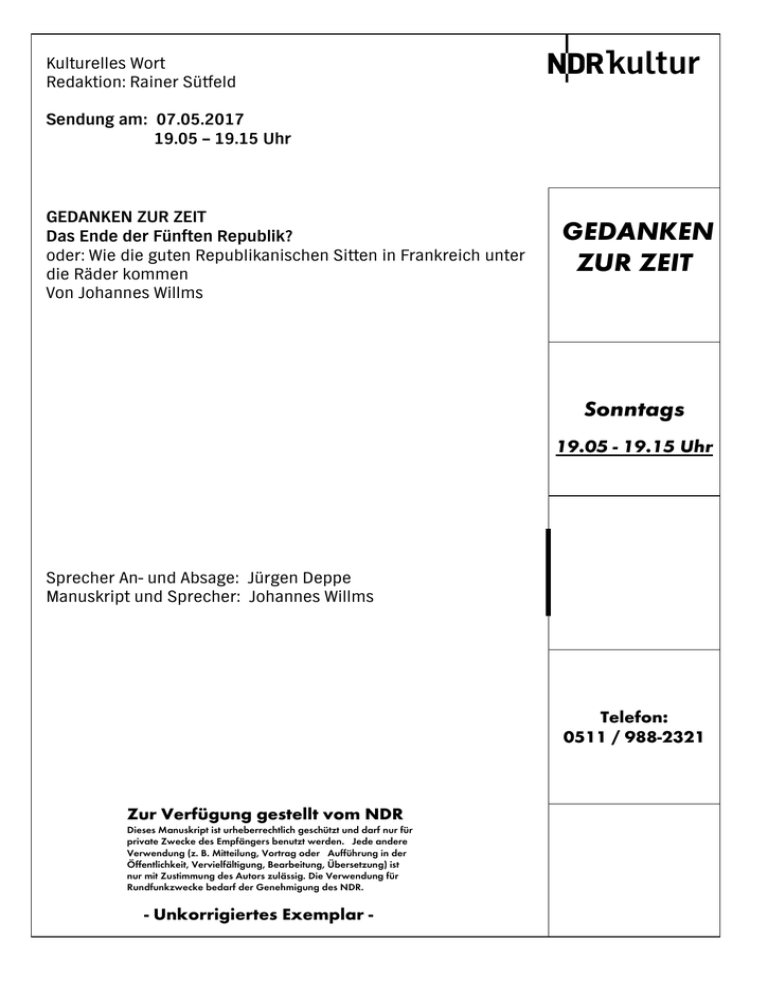
Kulturelles Wort Redaktion: Rainer Sütfeld ai Sendung am: 07.05.2017 19.05 – 19.15 Uhr GEDANKEN ZUR ZEIT Das Ende der Fünften Republik? oder: Wie die guten Republikanischen Sitten in Frankreich unter die Räder kommen Von Johannes Willms GEDANKEN ZUR ZEIT Sonntags 19.05 - 19.15 Uhr Sprecher An- und Absage: Jürgen Deppe Manuskript und Sprecher: Johannes Willms Telefon: 0511 / 988-2321 Zur Verfügung gestellt vom NDR Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für private Zwecke des Empfängers benutzt werden. Jede andere Verwendung (z. B. Mitteilung, Vortrag oder Aufführung in der Öffentlichkeit, Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung) ist nur mit Zustimmung des Autors zulässig. Die Verwendung für Rundfunkzwecke bedarf der Genehmigung des NDR. - Unkorrigiertes Exemplar - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, bei denen heute die Entscheidung zwischen den zwei Kandidaten fällt, die im ersten Wahlgang das beste Ergebnis erzielten, folgen am 11. und 18. Juni die Wahlen für die Gesetzgebende Versammlung. Diese wiederholten Urnengänge sind dem in Frankreich geltenden Mehrheitswahlrecht geschuldet. Danach erhält nur der Kandidat im ersten Wahlgang den Zuschlag, der mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinte. Da das eher selten der Fall ist, wird in der sich anschließenden Stichwahl der Sieger mit relativer Stimmenmehrheit ermittelt. Trotz gelegentlicher Überraschungen garantierte diese Praxis bislang politische Stabilität. Die scheint jetzt jedoch in Frage gestellt zu sein, denn die beiden Kandidaten, die im Stichwahlentscheid für das Amt des Staatspräsidenten stehen, gehören keiner der beiden großen politischen Familien an, die bislang als verlässliche Bleigarnitur den Bestand der Fünften Republik gewährleisteten. Der Kandidat der Sozialisten erlebte im ersten Wahlgang ein Debakel, das ihn weit abgeschlagen auf den fünften Platz verwies. Das war dem Umstand geschuldet, dass man sich mit Benoît Hamon auf einen Apparatschik verständigt hatte. Dieses Handicap wies den Kandidaten angesichts der riesigen Unpopularität des noch amtierenden sozialistischen Präsidenten François Hollande von vorneherein als chancenlos aus. Dagegen verpasste François Fillon, der Kandidat des konservativen Lagers mit rund 20 Prozent nur vergleichsweise knapp die Teilnahme an der Stichwahl, obwohl er bis Ende Januar als der mit Abstand aussichtsreichste Bewerber gegolten hatte. Was ihn um diese so gut wie sichere Aussicht brachte, war seine Entlarvung als abgefeimter Biedermann, gegen die er sich mit wütendem Ungeschick zur Wehr zu setzen suchte. Also mussten sich die Wähler zwischen zwei Kandidaten entscheiden, wie sie gegensätzlicher kaum denkbar sind: Dem 39jährigen Emmanuel Macron, einem wirtschaftsliberalen politischen newcomer, der seine Zuordnung zur Rechten oder Linken entschieden in Abrede stellt, auch wenn er zeitweilig als Wirtschaftsminister unter Präsident Hollande tätig war. Die politische Heimat Macrons ist eine von ihm gegründete Sammlungsbewegung mit dem Namen „En marche!“, was soviel bedeutet wie „unterwegs“ oder „vorwärts“. Diese erst im Aufbau begriffene und programmatisch noch weithin unbestimmte sozial-liberale Bewegung soll gleichwohl schon in allen 577 Wahlkreisen mit eigenen Kandidaten für die Parlamentswahlen vertreten sein. Mit Macron in Konkurrenz steht Marine Le Pen, die Chefin des rechtsradikalen Front National. Sie hat es mit Geschick verstanden, einige der widerwärtigsten Aspekte der von ihrem Vater gegründeten Partei zu übertünchen und als eine Protestbewegung gegen das politische Establishment der Fünften Republik aufzuziehen, dem sie den pauschalen Vorwurf macht, den Problemen Frankreichs taub und blind gegenüber zu stehen. Dementsprechend artikuliert und instrumentalisiert sie mit diabolischem Geschick die grassierenden Ängste der französischen Unter- und Mittelschichten vor Arbeitslosigkeit und Überfremdung. Hauptursache der fortschreitenden Krise Frankreichs sei die Globalisierung, die von der Europäischen Union und dem Euro gefördert werde. Gegen diese Symptome fortschreitenden Niedergangs schlägt Le Pen nationale Patentlösungen vor. Allein diese würden Gewähr bieten, die Gefahren zu bannen, dass das Land dauerhaft abgehängt werde und in Überfremdung versinke. Wie eingängig dieses krude politische Credo der Marine Le Pen ist, zeigt sich nicht nur daran, dass sie im ersten Präsidentschaftswahlgang das zweitbeste Ergebnis erzielte. Noch mehr gibt zu denken, dass einige Größen linker wie rechter Parteien sich im Blick auf die Stichwahl weigerten, gegen den Front National und für ihren Konkurrenten Macron Stellung zu nehmen. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen den bislang respektierten republikanischen Schulterschluss gegenüber der extremen Rechten. Darin scheint ein Kalkül auf, das für die weitere Zukunft der Fünften Republik nichts Gutes verheißt. So verblüffte etwa der Führer der extremen Linken Jean-Luc Mélenchon, der das viertbeste Ergebnis im ersten Wahlgang für die Präsidentschaft erzielte, zunächst durch beharrliches Schweigen. Dann sprach er sich gegen eine Stimmabgabe für Marine Le Pen aus, hütete sich aber, seine Anhänger zur Wahl von Macron aufzurufen. Deren Stimmenthaltung liefe aber dennoch auf ein Votum für den Front National hinaus. Ähnlich ist die Situation auf Seiten der Rechten. Nicht wenige führende Mitglieder der Partei „Die Republikaner“ versagten sich sogar lauthals der Forderung, Marine Le Pen die Stimme zu verweigern. Im einen wie im anderen Fall lässt sich das mit dem Schielen auf die Parlamentswahlen im Juni erklären, bei denen man die Ängste jener, die jetzt für den Front National stimmten, für die eigenen Belange nutzen möchte. Solche Absichten stehen im Einklang mit den Besonderheiten des Mehrheitswahlrechts wie mit dem spezifischen Charakter der politischen Parteien in Frankreich. Das Mehrheitswahlrecht erlaubt es den Parteien, vor der Stichwahl jeweils politische Zweckbündnisse zu schließen, um einem der beiden bestplatzierten Kandidaten den Sieg zu verschaffen. Diese befristeten Bündnisvereinbarungen lassen sich umso leichter bewerkstelligen, als die Parteien in Frankreich ihrem Wesen nach politische Wahlvereine sind, die einen vergleichsweise nur lose geknüpften Verbund verschiedener Grüppchen, Klüngel oder Flügel darstellen. Ihr Zusammenhalt wird durch eine recht schüttere Schnittmenge von Grundüberzeugungen gewährleistet, die sich jeweils um eine starke Figur auskristallisieren, die gern als „Tenor“, „Baron“ oder „Elefant“ bezeichnet wird. Bislang war es den Parteien selbstverständlich, jegliche Berührung mit dem rechtsradikalen Front National zu vermeiden. Diesem Tabu war es zuzuschreiben, dass die Partei Marine Le Pens in der augenblicklichen Nationalversammlung nur über zwei Sitze verfügt. Für die demnächst stattfindenden Wahlen der 577 Abgeordneten rechnet der Front National jedoch mit wenigstens 40 Mandaten, die ihm endlich den begehrten Status einer Fraktion verschafften. Die Aussichten, dass es dazu kommt, stehen nicht schlecht, denn zu verblüffend deutlich sind die Übereinstimmungen in der Kritik, die sowohl vom Front National wie insbesondere der linksradikalen Bewegung des Jean-Luc Mélonchon oder der rechten Partei der „Republikaner“ am „Ultraliberalismus“ geäußert wird, den angeblich Emmanuel Macron personifiziert. Damit kündigen sich Übereinstimmungen an, die sich sehr schnell nicht nur als Bündnisse für Stichwahlen beim Votum für die Nationalversammlung formalisieren lassen. Wie sehr die guten republikanischen Sitten in Frankreich unter die Räder gekommen sind, zeigen die Erfolge des Front National wie das spektakuläre Scheitern der beiden großen Flügelparteien bei den Präsidentschaftswahlen. Beide Entwicklungen machen Mitteilung von einer stürmischen Evolution des politischen Systems der Fünften Republik. Vor allem dessen unflexible, weil allzu zentralistische und geradezu monarchisch anmutende Struktur, erweist sich als zunehmend dysfunktional. Das gilt vor allem für deren Zuschnitt auf einen politisch schier allmächtigen Präsidenten, der, wenn er den großen Anforderungen seines Amtes nicht gewachsen ist, schnell als Versager gilt, dem alle Versuche, diesen Eindruck zu dementieren, ins Gegenteil ausschlagen. Die Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy oder François Hollande haben dafür zahlreiche Beispiele geliefert. Das gilt aber nicht weniger dafür, plausible Lösungen für die Probleme zu formulieren, die Frankreich hat und die sich dem Land angeblich mit den Folgen der dämonisierten Globalisierung stellen. Als Beleg dafür wird gern auf den ruinösen Zustand des „peripheren Frankreich“, also der ländlichen Gebiete abseits der boomenden Metropolen wie der kleineren Provinzstädte verwiesen, deren Blüte und geschäftiges Treiben einst den Charme Frankreichs ausmachte. Wer hier lebt, hat den Eindruck, von der Entwicklung abgehängt zu sein. Daraus nährt sich das dumpfe Gefühl, zu den Verlierern des Fortschritts zu gehören, das seinen Niederschlag in den hohen Wahlergebnissen findet, die vom Front National erzielt werden. Sehr fraglich jedoch ist, ob für diesen Niedergang des peripheren Frankreich tatsächlich die Globalisierung oder der Euro verantwortlich sind, die nicht nur von Marine Le Pen immer als Sündenböcke genannt werden. Ursächlich dafür dürfte vielmehr die traditionelle staatliche Engführung der französischen Wirtschaft sein, deren zentralisierte Steuerung aller Entscheidungsabläufe eine Signatur der Fünften Republik ist. Dieses System erweist sich auch einfach deshalb als reformunfähig, weil damit die Ersatzreligion des Vorsorgestaats verknüpft ist, an der die Franzosen hängen und die sie mit wütendem Widerstand verteidigen. Das macht sich Marine Le Pen mit Geschick zunutze, indem sie sich für viele glaubwürdig als Anwältin der Sorgen und Nöte des Volkes darstellt. Mit dem Erfolg, den der Front National damit erzielt, droht das bislang für die Fünfte Republik gültige politische Schema, das Frankreich in ein rechtes und ein linkes Lager einteilte, abgelöst zu werden durch einen unversöhnlichen Gegensatz: Den als „ultraliberal“ verunglimpften Reformern, die für eine energische Fortentwicklung der europäischen Einigung eintreten, stehen jene gegenüber, die auf der Rechten wie der Linken das künftige Heil des Landes mit strikt nationalen Lösungen der anstehenden Probleme identifizieren. Das verheißt weder für Frankreichs Fünfte Republik noch für Europa Gutes. Johannes Willms, Jahrgang 1948, Historiker und Publizist, lebt und arbeitet in München und Paris. Im Frühjahr 2017 erschien sein neues Buch: „Mirabeau oder Die Morgenröte der Revolution - Eine Biographie“.