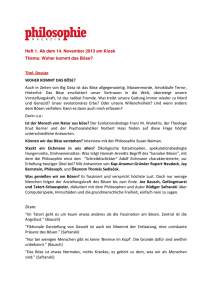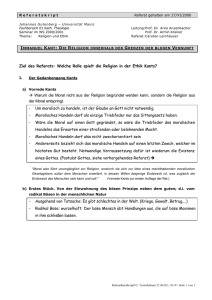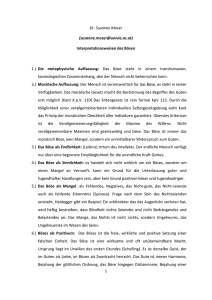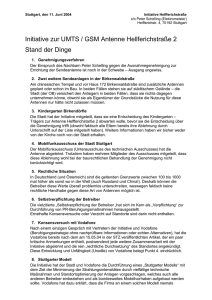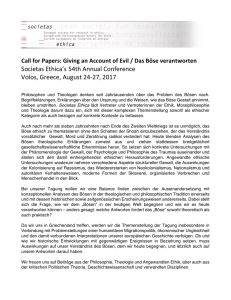Die Herkunft des Bösen bei Schelling
Werbung

1 Die Entzweiung des Urgrundes als Ursprung des Bösen bei Schelling mit einer einleitenden Übersicht über philosophische Positionen zum Bösen von Platon bis Schelling Beitrag zur 65. Philosophischen Wochenendtagung der Vennland-Akademie für philosophische Erwachsenenbildung vom 14. – 15. Januar 2012 zum Thema ‚Die Dimensionen des Bösen – Philosophische Betrachtungen’ von Dr. Hermann Wehr 2 Gliederung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Einleitung Grundlegende Positionen zur Erklärung des Bösen von Platon bis Schelling Schellings Entwicklung von der frühen Naturphilosophie bis zur Freiheitsschrift Begründung der Möglichkeit eines sinnvollen Diskurses über das Theodizeeproblem Der eigentliche Sinn von Freiheit: Die Möglichkeit zum Bösen Die Wirklichkeit des Bösen und seine Verwirklichung durch den Menschen Vom geschichtlichen Anfang zum geschichtlichen Ende des Bösen Einige kritische Anmerkungen Einleitung Der vorliegende Aufsatz hat das Ziel, Schellings Kerngedanken über die Herkunft des Bösen anhand seiner Schrift „Über das Wesen der menschlichen Freiheit“ darzulegen. Schelling entwickelt seine Überlegungen im Rückgriff auf platonisch-neuplatonische Denkmuster und auf eine christliche Metaphysik, sowie in Auseinandersetzung mit den philosophischen Positionen zum Theodizeeproblem der Rationalisten (Spinoza, Leibniz) und der Philosophie Kants. Er entwickelt seine „Freiheitsschrift“ aber auch in Auseinandersetzung mit seiner vorangegangenen, spekulativen Naturlehre und der Identitätsphilosophie. Um das Verständnis von Schellings Schrift und ihre Einordnung in die Genese des Theodizeeproblems zu erleichtern, wird der Interpretation der „Freiheitsschrift“ ein geschichtlicher Überblick über diejenigen Positionen zur Erklärung des Bösen vorangestellt, die besonders einflussreich auf Schellings Philosophie waren. Vorangestellt wird auch eine kurze Darstellung der Entwicklung von Schellings philosophischem Denken, ausgehend von seiner frühen Naturphilosophie, über die Identitätsphilosophie bis zu der Phase, die etwa mit der Freiheitsschrift beginnt. Folgendes sind die Grundgedanken von Schellings philosophischer Auseinandersetzung mit dem Bösen: Die Existenz des Bösen in der Welt ist an zwei grundlegende Voraussetzungen geknüpft, an ein gegenläufiges Prinzip zweier widerstreitender Kräfte, das die Bedingung der Möglichkeit des Bösen überhaupt darstellt, und zweitens an die menschliche Freiheit, durch die das Böse in der Welt erst wirklich wird. Jedes Sein trägt die beiden widerstreitenden Prinzipien logisch und zwangsläufig in sich, analog zur Unterscheidung von Existenz und Grund von Existenz von Existierendem, was in etwa der scholastischen Unterscheidung zwischen Existenz und Essenz (Wirklichkeit und 3 Möglichkeit oder Wesen von Sein) entspricht. Dieser Unterscheidung geht ein, allem kosmologischen Werden vorgelagertes Einheitsprinzip voraus, das Schelling als Ungrund bzw. Indifferenz in Gott bezeichnet, und das nicht weiter hinterfragt werden kann. Mit diesen Annahmen, einem Gegensatzprinzip von Kräften und der menschlichen Freiheit, will Schelling nun die Möglichkeit und die Wirklichkeit des Bösen in der Welt erklären, ohne dass Gott als ihr Schöpfer zugleich zum Urheber des Bösen wird. Das widerstreitende Kräftepaar identifiziert Schelling auch als Vernunft und Bewusstsein einerseits, und als unbewusster Drang und Wollen andererseits. Allem Geschehen liegt neben der vernünftigen auch eine triebhafte und unbewusste Struktur zugrunde, die bei der Frage nach dem Bösen berücksichtigt werden muss. Schon gar nicht kann die Welt aus einem reinen Bewusstsein erklärt werden, wie es die Ansicht Fichtes war. Wirklich wird das Böse aber erst durch eine freie Willensentscheidung des Menschen, und zwar eines jeden Menschen. Denn jeder Mensch hat Anteil am Sündenfall Adams. Er legt sich wie Adam in einer freien Grundsatzentscheidung, die durch nichts weiter bedingt ist, in seiner moralischen Disposition fest. Bei seiner Argumentation folgt Schelling dem Kantschen Dualismus, indem er strikt zwischen der „Welt der Gründe außerhalb der Zeit“, und der kausalen Welt der Ursachen und der zeitlichen Bedingungen unterscheidet, und die freie Grundsatzentscheidung als nicht der Kategorie ‚Zeit’ zugehörig betrachtet. Durch das Handeln gemäß der so selbst festgelegten, ureigenen Disposition bringt der Menschen das Gute und das Böse in die Welt. Niemand anderes als er selbst, und zwar jeder individuelle Mensch, ist dafür verantwortlich. Das Böse deutet Schelling als eine Selbstentzweiung, bei dem sich der Eigenwille des einzelnen Menschen über den Universalwillen, d.h. über die göttliche Ordnung und den göttlichen Willen erhebt. In der Spanne zwischen Eigenwille und Universalwille lebt der Mensch. Subjektivität und Individualität werden ihm zum grundsätzlichen Problem seines Daseins. Dem Verstand kommt die Aufgabe zu, das unvernünftige Wollen des Individuums in vernünftige, vom Urwillen vorgegebene Schranken zu weisen. Aber letztlich bedarf der Mensch der Gnade Gottes, denn er selbst kann sich nicht aus seiner selbst gewählten Veranlagung zum Bösen befreien. Am Anfang stand die Entzweiung der Einheit durch entgegengesetzt wirkende Kräfte. Damit kam auch der Dualismus von gut und böse in die menschliche Welt. Dieser ist notwendig zur Selbstoffenbarung Gottes, denn die Güte Gottes kann sich nur durch die Erlösung vom Bösen erweisen. Mit der Wiederherstellung der Einheit geht zugleich das Ende der Zeiten einher, das Böse wird es dann nicht mehr geben. Soweit Schellings geschichtliche 4 Vorstellung vom Bösen, die geprägt ist von Einflüssen des christlichen Offenbarungsglaubens, der Gnadenlehre und der Eschatologie. 2. Grundlegende Positionen zur Erklärung des Bösen von Platon bis Schelling 2.1 Platonische und neuplatonische Denkmuster Die Frage, wann und wie sich die Vorstellung von dem moralisch Guten und Schlechten in der Menschheitsgeschichte entwickelte, lässt sich wohl nie endgültig beantworten. Dass es eine zeitliche Entwicklung dieser Moralvorstellung gibt, wird zuweilen als Gegenargument gegen einen Universalitätsanspruch von Moral benutzt. Aber hier ist Vorsicht geboten. Was sich bei der Herangehensweise an die Frage von gut und böse ändert, ist die Ausgangsfrage: was wird als das eigentliche Problem angesehen, das „gelöst“ werden soll und was wird überhaupt als ‚böse’ verstanden.. Dies gilt sowohl für die Diskussionen zu einer gegebenen Zeit als auch für die Diskussionen über Zeiten hinweg. Beispiele für unterschiedliche Problemperspektiven können sein: Die kosmogenetische Entstehung der Übel in der Welt oder die Frage nach der Unzulänglichkeit der Schöpfung angesichts der Allmacht und Güte eines (theistisch aufgefassten) Schöpfergottes oder die Frage, wie man an einen persönlichen und gütigen Gott glauben kann angesichts großen persönlichen Leids (siehe Hiobs Problem) oder die Frage nach der Erklärung für das willentliche Tun des Bösen gegen die bessere Einsicht, oder die Verantwortung des Menschen für sein unrechtes Tun. Die nachfolgenden Beispiele für grundlegende Positionen zur Frage des Bösen zeigen jedenfalls, dass die Fragestellung selbst geschichtlichem Wandel unterworfen ist. Fest steht, dass sich Menschen schon in weit zurückliegenden Zeiten Gedanken über moralisches und unmoralisches Handeln machten. Eine erste grundlegende und nachhaltige Vorstellung von der Herkunft von gut und schlecht findet sich bei Platon. Gut ist, was vollkommen ist und was mit sich selbst identisch ist als ein Eines ohne Werden. Im Timaios lässt Platon den Demiurgen unter Rückgriff auf mythische Vorstellungen das Gewordene als Abbild dieses Einen und Zeitlosen in einem vorausgesetzten Stoff schaffen. Der Kosmos mit seinen nach Proportionen, in gestufter Folge aufgebauten Teilen wird als göttliches Kunstwerk verstanden, in dem sich die ewigen Ideen widerspiegeln (Timaios, 28a-34b). Diese Erklärung legt es dann nahe, das Böse als das weniger Vollkommene, als Vielfalt und Unordnung aufzufassen. So kommt die Auffassung von der Entstehung der kosmischen 5 Vielfalt als einer Verhinderung des Guten und Einen zustande, eine Sichtweise, wie sie auch für neuplatonische Denkmuster typisch ist mit weitreichenden Folgen für die nachfolgenden Jahrhunderte. Für Plotin ist das Eine Gott. Er ist der Urgrund des Seienden und die Ursache des Guten. Ähnlich wie Platon begreift Plotin den Weg zur Wahrheit als ein Emporsteigen von den niederen, sinnlich fassbaren Dingen zur höheren, geistigen Welt. Nach dieser Auffassung kommt dem Übel oder dem Bösen in der Welt – eine genaue Differenzierung zwischen den beiden Begriffen muss an dieser Stelle unterbleiben - ein unwahres Sein zu. Ganz im Sinne platonischen Denkens, wonach etwas desto mehr Sein hat, je wahrer es ist, befindet sich das Böse also im Zustand eines geringeren Seins. Es ist ein Zustand des Nicht-gemäß-seins oder des Nicht-sich-selbst-seins (vgl. Plotin, Enneaden I, Kap. 7,8). Ähnlich argumentiert auch noch gegen Ende des 5. Jahrhunderts der anonyme Autor des Corpus Dionysiacuum, Dionysius Areopagita (DA). „Das Gute stammt aus der einen und totalen Ursache, das Böse aber aus vielen und partialen Defekten“ (DA, De divinis nominibus, §30). Das Böse hat weder ein eigenes Seinsprinzip, noch befindet es sich in den existierenden Dingen. Böses ist das Resultat menschlicher Schwäche, ein versehentliches Abirren des wahren Strebens, bei dem das Böse irrtümlicherweise für das Gute gehalten wird (ebd., §31-35). 2.2 Die Herkunft des Bösen in der Erklärung der jüdisch-christlichen Schöpfungstheologie In der jüdisch-christlichen Theologie ändert sich die Frage nach der Herkunft des Bösen grundlegend. Gott wird als ein persönlicher Schöpfergott aufgefasst, in dessen Heilsplan Erlösung und Eschatologie vorgesehen sind. Erlöst werden soll vom Bösen, wie es im „Vater unser“ heißt. Aber wo kommt das Böse her, wenn Gott gut ist? Die Antwort des Paulus im Römerbrief lautet sinngemäß: Der Mensch ist ein Sünder, weil er sich nicht an das offenbarte Gesetz Gottes hält. Und weil er nicht recht handelt, steht er nicht in der Wahrheit des Gesetzes. Das Wahre ist nach platonischem Denken zugleich das Gute. Infolgedessen kann das Gute erkannt und eingesehen werden. Das offenbarte Gesetz ist die erkennbare Richtschnur für richtiges und gutes Handeln. Der Mensch kann jedoch die Einsicht in das Gesetz und damit den Gehorsam verweigern. Den Grund sieht Paulus vor allem im „sündigen Fleisch“, wodurch der Mensch zu schwach ist, dem Gesetz zu gehorchen („Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern was ich nicht will, das Böse, vollbringe ich“ (Röm., 7). Damit ist auch bei Paulus der Dualismus von Geist und Leib Ursache des 6 Bösen. Andererseits ist dessen Herkunft verknüpft mit der menschlichen Entscheidungsfähigkeit. Letztlich kann der Mensch aber nur durch die Gnade Gottes gerecht werden, so Paulus. Unter Bezugnahme auf Paulus erklärt Origenes den Zusammenhang anhand einer Analogie: So wie der Regen Früchte und Dornen hervorbringt, so bewirkt die gute Absicht Gottes wegen der Schlechtigkeit der Menschen Schlechtes und zwar bei denen, die der Wahrheit nicht gehorchen (vgl. Origenes, „Vier Bücher von den Prinzipien“, Kap. „antechusie“). Infolgedessen ist Gott nicht der unmittelbare Verursacher des Bösen. Dieses ist vielmehr das Ergebnis einer falschen Entscheidung des Menschen. Eine sowohl theologisch wie philosophisch maßgebliche Prägung erfuhr die Frage nach dem Bösen bei Augustinus. Er fragt nach der letztendlichen Ursache der Sünde des Menschen und entfaltet dabei eine facettenreiche, psychologische Betrachtung des Zusammenspiels von Bewusstsein, Denken und Wollen. In den ersten Jahren nach seiner Zuwendung zum Christentum dachte Augustinus noch sehr neuplatonisch-plotinisch, indem er gegen die Manichäer das Böse als Nichts, als Negation des Guten bezeichnete. Aber alle Versuche zur Beantwortung der Frage nach der letztendlichen Ursache des Bösen mündeten für Augustinus in einen Regress, so dass er schließlich folgerte: „Es ist also entweder der Wille selbst die erste Ursache des Sündigens, oder keine Sünde ist die erste Ursache des Sündigens“ (lib.arb. III). In De civitate Dei (Kap. XII) führt Augustinus aus, dass der böse Wille keinesfalls kausal durch eine „bewirkende Ursache in der Natur“ determiniert ist. „Denn der böse Wille entsteht nicht, wenn das Wesen, in dem es entsteht, es nicht wollte“ (ebd.). Menschliches Handeln kommt für Augustinus also durch eine bewusste, spontane und auf nichts anderes zurückführbare Willensentscheidung zustande. Warum sich der Mensch für das Böse entscheidet, erklärt er mit dem Prinzip des gespaltenen Willens (vgl. Confessiones, VIII). Da der Wille zugleich Verschiedenes wollen kann, kann ihm die Energie fehlen, sich nur auf das Gute zu richten. Bis etwa zum Jahr 396 vertrat Augustinus die Auffassung, der Mensch müsse nur seinen freien Willen richtig gebrauchen und würde dann das Richtige tun. Nach seiner sog. „gnadentheologischen Wende“ schränkte er die Fähigkeit des Menschen ein, aus sich selbst heraus das Gute zu wollen. Selbst wenn der Mensch will, so tut er doch oft das Gute nicht. Aber Augustinus lehnt die Erklärung des Paulus ab, der die Dominanz des Fleisches über den Geist für dieses Phänomen verantwortlich machte. Denn dann könne von einem Wollen gar nicht mehr die Rede sein, so Augustinus. Falsches Handeln aus Unwissenheit oder aus 7 einer fleischlichen Gewohnheit ist für ihn immer noch gewolltes, dem Menschen zuschreibbares Handeln. Selbstverschuldet, z.B. durch einen falschen Lebenswandel, hat der Mensch die Fähigkeit verloren, sich gegen das verkehrte Wollens zu wehren, selbst wenn er das Verkehrtsein einsieht (Beispiel: Suchtabhängigkeit). Theoretisches Wissen genügt nicht. Man muss auch können. Die Merkwürdigkeit, dass es die Möglichkeit der Negation im Willen gibt, hat Augustinus letztlich als ein Zeichen für die generelle Sündhaftigkeit des Menschen und als „Erbsünde“ interpretiert. Ins Rollen gebracht wurde sie durch den freiwilligen und wissentlichen „ersten Sündenfall“ (lib. arb. III). Der Mythos vom ersten Sündenfall wird in den nachfolgenden Jahrhunderten bei der Frage nach der Ursache des Bösen immer wieder eine Rolle spielen, so bei Kant und bei Schelling. Bei Augustinus kann er auch als metaphorischer Ausdruck für die Tatsache verstanden werden, dass die Erklärung für den Ursprung des Bösen irgendwann an einen Punkt anlangt, hinter den es kein Zurück gibt. Der Mensch ist letztlich ein Sünder. Er lebt in einem, nur durch die Gnade Gottes ermöglichten Freiheitsraum. 2.3 Die Erklärung des Bösen im Rahmen der reformatorischen und gegenreformatorischen Gnadenlehre Durch die lutherisch, reformatorische Neuinterpretation der Gnadenlehre und ihre starke Betonung der Christologie stellte sich die Frage nach dem Bösen in noch schärferer Form. Wenn alles Heil aus dem Glauben kommt, und jeder glauben muss, dass Christus von dem Bösen erlöste, dieser Glaube aber wiederum von der göttlichen Gnade abhängt, dann kann es keine Freiheit des Menschen zu Gott geben, die nicht selbst seine Gnade ist. Mit dem Verlust menschlicher Freiheit geht allerdings die Möglichkeit verloren, die Vorstellung eines gerechten Gottes auf der Basis einer philosophischen Ethik und unter Aufrechterhaltung des Erlösungsgedankens befriedigend zu entwickeln. So kommt z.B. nach Calvin der Mensch zu Fall, weil Gottes Vorsehung es so ordnet – aber er fällt durch eigene Schuld! Dass Gott den einen Menschen zum Heil führt, den anderen aber nicht, liegt im Ermessen Gottes und kann nicht weiter hinterfragt werden (vgl. J. Calvin, „Institutio“ in: Opera selecta) Gegenüber der protestantischen Theologie hielt die katholische Gnadenlehre an der Freiheit des Menschen zu Gott strikt fest (vgl. z.B. die Kurzfassung des Tridentinum, Konzil von Trient, 1545-1563). Sie folgte nicht der protestantischen Zuspitzung der Theologie auf ein „sola fide“ und ein „sola scriptura“. Zwar war die Erlösungstat Christi heilsnotwendig, aber die natürliche Einsicht des Menschen und die Befolgung kirchlich-institutionell als richtig 8 befundener Überlieferungen sind ebenfalls heilsrelevant. Der menschliche Freiheitsraum wird durch Gottes Gnade ermöglicht und zugleich durch die Zustimmungsleistung des Menschen verwirklicht. Der Mensch behält die Fähigkeit zur Verantwortung gegenüber Gott und zugleich zur moralisch-politischen Verantwortung in der Welt. Indem die katholische Theologie zwischen Vorhersagen und Vorherbestimmen unterschied, suchte sie Gott von der Verantwortung für das Böse zu entlasten, für das allein der Mensch verantwortlich ist. 2.4 Die Bedeutung des Theodizeeproblems im Rationalismus Im Spätmittelalter und in der italienischen Renaissance war eine Bewegung entstanden, die unter dem Namen „Theologia naturalis“ oder auch „Philosophia perennis“ bekannt wurde, und deren Ziel es war, durch Harmonisierung von Philosophie und Theologie zu einer Einheitswissenschaft zu gelangen. Denker wie Ficino, Pico Della Mirandola oder Steucho waren überzeugt, dass der Mensch vermöge der Gnade Gottes aus den geschaffenen Dingen auf die Ideen des Schöpfers als deren Archetypen zurück schließen könne und somit Einsicht in ewige Wahrheiten hätte. Im Rahmen einer solchen, gestuften Weltordnung, die vom notwendig Einen und Vollkommnen (=Gott) bis zum nicht Notwendigen und zeitlich Veränderlichen reicht, konnte die Frage „unde malum?“ angesichts der Vorsehung Gottes über das Phänomen der Kontingenz erklärt werden. Mit dem Aufkommen der mathematischen Physik im 17. Jahrhundert und ihren zunehmend erfolgreicheren, an mechanischen Modellen angelehnten Erklärungen und Vorhersagen von Naturerscheinungen, stellte sich die Frage nach dem Bösen auf eine neue Weise. Wenn die Erscheinungen in der Welt Gesetzmäßigkeiten folgen, die mit mathematisch-physikalischen Methoden ermittelt werden können, dann scheint der Raum für die göttliche und menschliche Freiheit und für das Kontingente immer kleiner zu werden. Spinoza ging beispielsweise davon aus, dass der menschliche Geist und seine Zustände vollständig erkannt und erklärt werden können. Da für ihn Körper und Geist ontologisch gesehen eine Entität bilden, die sich nur in unterschiedlicher Weise zeigt, bestand für Spinoza prinzipiell keine Differenz zwischen der Intelligibilität von Physischem und derjenigen von Psychischem. Dies war der Grundgedanke seiner „mechanistischen“ Psychologie. Der „ganze Mensch“ ist ein notwendiges Glied im rationalen Zusammenhang des Daseins, in dem nichts zufällig ist. Gott ist auch kein Schöpfer, der die Welt in einer freien Willensentscheidung als etwas von ihm Verschiedenes schafft. Jedoch ist Spinozas Gott insofern die Ursache der Dinge, als sich die Welt mit Notwendigkeit aus Gottes Natur 9 ergibt. Was sich aber seiner Natur nach verhält, das kann nicht als Fehler angerechnet werden. Also gibt es in der Natur nichts Fehlerhaftes und Böses. Das Gute und das Böse sind keine transzendentalen und ewigen Ideen. Mit gut und böse drücken wir nur unsere Urteile darüber aus, was uns zum Leben tatsächlich nützlich oder tatsächlich schädlich ist (vgl. Spinozas ‚Ethik in geometrischer Darstellung’, insbesondere Teil IV). Es war Leibniz, der vor dem Hintergrund einer mechanistischen Naturerklärung das Problemfeld intensiv und nachhaltig bearbeitete, dem er den bis heute bekannten Namen gab: Theodizee oder: „Versuche über die göttliche Gerechtigkeit, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Bösen“ (vgl. Überschrift von Leibnizens „Theodizee“). Gegen den Willkürgott Calvins setzt Leibniz einen Gott, der die „erste Ursache aller Dinge (§7) und die „überlegene Weisheit“ (§8) ist und der die beste aller möglichen Welten geschaffen hat. Das Böse wird damit zur notwendigen Eigenschaft der besten möglichen Schöpfung, die eben darum immer noch die bestmögliche sein kann. Aber auch Leibniz folgt noch traditionellem Denken, wenn er das Böse als „Beraubung des Seins“ auffasst und als Symptom dafür die Trägheit der natürlichen Körper heranzieht (§29,30). Und doch wählte Gott die ihm am meisten gefallende Existenzform (§110). Allerdings ist die Seele des Menschen spontan in ihren Handlungen. Deshalb ist jeder Mensch für sein Handeln verantwortlich, auch wenn in der Natur die Gesetze der Mechanik gelten (§§65ff). Diese Selbständigkeit in der Schöpfung ist für Leibniz gottgewollt, deren Zweck in der Harmonie des Ganzen und im relativen Glück des Einzelnen besteht (§§ 118 ff). Gott gibt dem Menschen einen freien Willen, damit er ihn richtig und zu seinem Glück anwenden kann. Denn Gott will nicht die Sünde. Auch bei Leibniz bleibt die menschliche Freiheit Voraussetzung für eine sinnvolle Erklärung der Gerechtigkeit Gottes. Sie garantiert die Selbstbestimmung des Einzelnen in einer Gesamtheit von prästabilierter Harmonie. Es liegt an den verworrenen sinnlichen Perzeptionen und der begrenzten Erkenntnisfähigkeit des Menschen, dass er die ihm gegebene Freiheit nur unvollkommen ausüben kann (vgl. z.B. §310). Sünde ist für Leibniz nicht Ausdruck für die Schlechtigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, wie z.B. bei Luther und Calvin. Das Malum resultiert nicht aus einem bösartigen Wollen, sondern aus einem falschen Gebrauch der Freiheit. Die Folge sind physische Übel, die Leibniz auch als Sündenstrafen interpretiert (vgl. Theodizee §241, Causa Dei §31). Durch das freie Handeln des Menschen verändert sich die Welt zu einer kontingent wirklichen, die aber immer im Rahmen einer von Gott vorgesehenen besten möglichen Welt bleibt. Und selbst wenn der 10 Mensch unverschuldet Übel erleidet, so gereicht ihm das letztlich immer noch zum bestmöglichen Glück. Die Vorstellung von der besten möglichen Welt des besten Schöpfers macht den Optimismus von Leibnizens Philosophie aus. Es blieb nicht aus, dass dieser Optimismus Kritiker und Spötter auf den Plan rief (vgl. Voltaire). Man kann ermessen, wie groß die Erschütterung bei den Anhängern dieses Denkens war, als sie Kunde vom fürchterlichen Erdbeben in Lissabon, 1755, nahmen, bei dem 30.000 Menschen starben, ohne dass man ihr Sterben mit einer Schuld in Zusammenhang bringen konnte. 2.5 Das Böse bei Kant Bei Kant ist es die menschliche Vernunft selbst, welche die Realität ordnet und beurteilt. Sie findet in der Realität aber keine von Gott zuvor hineingelegte, vernünftige Ordnung vor. Infolgedessen ist die Vernunft auch nicht mehr das Indiz Gottes wie bei den Denkern im Geiste der Philosophia perennis, sondern sein Kriterium, denn die Vernunft kann nicht durch etwas, was außerhalb der Vernunft ist, begründet werden. Aus diesem Grund scheitert für Kant aber auch jeder Denkversuch der Theodizee, bei dem die menschliche Vernunft sich anmaßend zum Tribunal macht: Der „Rechtshandel [Theodizee wird] vor den Gerichtshof der Vernunft anhängig gemacht“ (Kant, „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“). Kant reduziert das Theodizeeproblem kurzerhand zu einer religionsphilosophischen Glaubensangelegenheit. Ungeachtet dessen setzt sich Kant in seiner Schrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ mit der Frage des Bösen auseinander. Er schreibt der menschlichen Natur einen Hang zum Bösen zu und spricht von einem radikalen, angeborenen Bösen im Menschen. Den Grund sieht Kant aber nicht in der Sinnlichkeit und den daraus entspringenden natürlichen Neigungen, die dem Menschen nicht als etwas Böses angelastet werden können. Er sieht ihn auch nicht in einer boshaften Vernunft, weil sonst der Mensch einem teuflischen Wesen gleichkäme, und damit das Böse ein Sein bekäme (vgl. 29-35). Vielmehr erklärt Kant das Böse aus der Gegenüberstellung zweier Anlagen im Menschen, der Anlage zum moralischen Handeln und der Triebanlage. Beide gleichzeitig kann der Mensch nicht zur Maxime seines Handelns machen, er muss sich entscheiden. Ob er gut oder schlecht handelt, hängt nun davon ab, welchem der beiden Prinzipien er den Vorrang einräumt. Infolgedessen hängt bei Kant die Frage von Gut und Böse letztlich von der Vernunft ab. Das Böse entsteht dann, wenn der Mensch die Maximen umkehrt und seine 11 Selbstliebe und seine Neigungen der Befolgung des allgemeinen moralischen Gesetzes überordnet. Im Prinzip erkennt jeder Mensch aufgrund seiner Vernunftstruktur die Maximen des Sittengesetzes. Dass er ihr nicht folgt, ist für Kant gewissermaßen eine Ausnahme von der Regel. Das daraus resultierende Böse bezeichnet Kant deshalb als radikal Böses, „weil es den Grund aller Maximen verdirbt“ (36, 37). Den Hang zum Bösen im Menschen schreibt er einer „Verkehrtheit des Herzens“ zu, welche „aus der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, zur Befolgung seiner genommenen [moralischen] Grundsätze nicht stark genug zu sein“ (37), folgt. In der Natur der Gattung Mensch gibt es schlichtweg einen Hang zum Bösen. Dieses naturhaft Böse im Menschen bezeichnet Kant als eine angeborene Schuld, für die der Mensch letztlich doch Verantwortung trägt, da sie „aus Freiheit entsprungen sein muss“ (38). Wie Leibniz und viele andere vor ihm greift auch Kant auf den Mythos des ersten Sündenfalls zurück, den er im Lichte seiner ‚kritischen Theorie’ interpretiert, die zwischen der empirischen, kausalen Welt und der Verstandeswelt als der Welt der Gründe und der Freiheit unterscheidet. Infolgedessen differenziert er auch zwischen dem Vernunftund dem Zeitursprung des Bösen (39-44). Der Vernunftursprung bei der freien Entscheidung zur Verwirklichung des Bösen fällt nicht in die Kategorie ‚Zeit’ oder ‚Kausalität’. Die Urentscheidung zum Bösen beim „ersten Sündenfall“ ist das Synonym für diese, außerhalb jeder Zeit liegenden freien Entscheidung des Menschen. Als Menschen können wir uns diesen Vorgang jedoch nur als in der Zeit geschehen vorstellen. Infolgedessen fängt das Böse irgendwann in der Zeit an. Das heißt aber nicht, dass der erste Mensch, Adam, einen anerschaffenen Hang zum Bösen hatte. Vielmehr wird er schuldig aus dem Stand der Unschuld heraus, weil er sich kraft seiner Vernunft frei dazu entscheidet. Was bei dieser Vorstellung eines Geschehens in der Zeit Sündenfall genannt wird, geht auf die Nachfahren über als deren ererbter Hang zum Bösen. Was aber letztlich der Vernunftursprung des Hangs zum Bösen ist, das „bleibt uns unerforschlich“, so Kant (43). Schelling bemerkt in seiner ‚Freiheitsschrift’ zu Kants Erklärungsversuche des Bösen, dass Kant, nachdem er „sich zu einer transzendentalen, alles menschliche Sein bestimmenden Tat in der Theorie [gemeint ist Kants Kritik der reinen Vernunft ( KrV)] nicht erhoben hatte, durch bloße treue Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urteils in späteren Untersuchungen [gemeint ist Kants Religionsschrift] auf die Anerkennung eines [...] vorangehenden Grundes der menschlichen Handlungen, der doch selbst wieder ein Aktus der Freiheit sein müsse, geleitet wurde“ (388). Anders ausgedrückt, Schelling kritisiert, Kant hätte in der KrV die Freiheit zum Guten oder Bösen nur als transzendentale Idee definiert, 12 aber nicht als etwas im konkreten Sein tatsächlich Existierendes und für den Menschen Erkennbares angenommen, später jedoch, in seiner Religionsschrift, hätte er das Phänomen des Bösen in der konkreten, menschlichen Verhaltensweise zugegeben und auf eine freie Entscheidung zurückgeführt. Das ist widersprüchlich und zeigt für Schelling, dass Kants Erklärung des Bösen unvollständig ist. Wie in den nachfolgenden beiden Kapiteln gezeigt werden soll, wird Schelling versuchen, den Ursprung des Bösen aus zwei widerstreitenden Kräften abzuleiten. Diese werden sich als Bedingung der Möglichkeit des Bösen herausstellen. Sie gehen letztlich auf ein vom Menschen unabhängiges, dem kosmologischen Werden vorgelagertes Prinzip zurück, welches Schelling als Ungrund bzw. Indifferenz in Gott deutet. 3. Schellings Entwicklung von der frühen Naturphilosophie bis zur Freiheitsschrift Schelling war in seinen jungen Jahren zunächst der Denkweise Fichtes gefolgt. Dieser hatte den kantischen Ansatz, der für alles Erkennen einerseits reale Sinnesdaten voraussetzt, welche andererseits von dem erkennenden Subjekt geordnet („schematisiert“) und zu einem objektiven Gegenstand verknüpft werden, radikalisiert, indem er den Erkenntnisvorgang ausschließlich in einem absoluten Ich verortete. Das erste Prinzip der Erkenntnis kann nicht in etwas Gegebenem bestehen, sondern es muss in einem Bewusstsein vorliegen, welches das Gegebene im Zusammenhang mit erkennendem Handeln „setzt“. Erkenntnis ist also schöpferische Tätigkeit des ‚Ich’, das aber nicht das individuelle ‚Ich’, sondern ein durch sich selbst bedingtes, absolutes Ich ist. Das Ich ‚erschafft’ die Welt, um darin frei und sittlich zu handeln. Eine Unterscheidung zwischen Kants ‚Ding als Erscheinung’ und ‚Ding an sich’ gibt es in Fichtes Wissenschaftslehre nicht mehr. Schelling hat in seinen naturphilosophischen Schriften ab etwa 1795 Zweifel an dieser einseitigen Betrachtung der Welt als Objekt des selbstbewussten Subjekts geäußert. Zeigen nicht die Kräfte in der Natur, dass diese sehr wohl geordnet ist und nicht erst der Ordnung durch das Subjekt bedarf? Wenn die Natur als vernünftige Ordnung erkennbar ist, dann muss sie bereits eine Vernünftigkeit in sich tragen. Schelling wandelt die Vorstellung Fichtes vom absoluten Ich ab in eine Gleichsetzung von Ich und Natur als einer ursprünglichen Einheit. Er wendet sich damit gegen die Unbedingtheit des Denkens des reflektierenden Subjekts, das die Bedingungen seines Denkens weder selbst geschaffen noch objektiv vorgefunden hat. Nicht die empirisch gegebene Natur sondern die auf ihren letzten Ursprung 13 zurückgeführte Natur entspricht einem über alle Naturkausalität sich erhebendem, freien Ich. Die ursprüngliche Natur ist reine Produktivität, in der Subjekt und Objekt noch nicht geschieden sind. Der Übergang von der Natur als Produktivität zur Natur als Produkt erfolgt durch Entzweiung gegensätzlich wirkender Kräfte. Dieser Vorgang setzt sich fort in einem dialektischen Wechselspiel zwischen Indifferenz und Differenz. Er ist überall in der Natur sichtbar. Bei dem Vorgang handelt es sich aber nicht um eine Evolution im darwinistischen Sinn sondern um die Genese des Logos in der Natur. Die Natur ist ein atmender Organismus, durch den ein belebendes Prinzip wirkt und in dessen Teilen, ob organisch oder anorganisch, prinzipiell dieselben Kraftprinzipien tätig sind. Zwischen der Struktur des Bewusstseins und der Struktur der Kräfte in der Natur herrscht eine prästabilierte Harmonie. Infolgedessen kann der Mensch die ursprüngliche Struktur der Kräfte in der Natur erkennen. Die Suche nach Formen der Selbstorganisation in der Natur, die der Struktur des menschlichen Denkens entsprechen, bildet deshalb den Ausgang von Schellings Naturphilosophie in den Jahren zwischen 1795 und 1801. Mit der Schrift „Darstellung meines Systems der Philosophie“ von 1801 beginnt bei Schelling eine neue Phase, seine sog. Identitätsphilosophie. Schelling will die beiden Prinzipien, die Spontaneität des Ich und die Produktivität der Natur, noch konsequenter in einem höchsten Prinzip zusammenfassen. In diesem Prinzip, der „absoluten Vernunft“, fallen Subjektivität und Objektivität in einer „absoluten Indifferenz“ zusammen, die nicht weiter bestimmbar ist. Im Dialog „Bruno“ bezeichnet Schelling seine Identitätsphilosophie auch als Ideal-Realismus, bei dem die immer noch vorhandenen Einseitigkeiten der früheren naturphilosophischen Schriften, aber auch insbesondere die Einseitigkeit des Fichte’schen Denkens, überwunden sind. Was immer schon Einheit im Absoluten ist, entwickelt sich als Naturprozess in der Welt. Am Ende von „Bruno“ fasst Schelling diesen Vorgang auch als „Menschwerdung Gottes von Ewigkeit“ auf und als Geschichtsprozess, den Schelling unter dem Blickwinkel der Identitätsphilosophie als „Gottwerdung des Menschen“ im Sinne einer Rückkehr des abgefallenen Endlichen in seine ursprüngliche Einheit versteht (vgl. Manfred Durner, Einleitung zu Schellings „Bruno“, Meiner Verlag 2005). Nach 1806 vollzog Schelling jedoch eine erneute Wende im Denken. Diese ging nicht zu einem unerheblichen Teil auf den Einfluss der katholischen Theosophen Franz Baader und Jacob Böhme zurück, deren Denken eine große Faszination auf Schelling ausübte. Durch sie nahm Schelling im besonderen Maß christliches Gedankengut in seine Philosophie auf, das allerdings durchsetzt war von mystischen Vorstellungen und der Betonung der finsteren und dämonischen Kräfte als Gegenpol zum Idealen (vgl. auch Fuhrmans, Einleitung zu 14 Schellings Schrift ‚Über das Wesen der menschlichen Freiheit’, Reclam (1964)). Schelling kam zur Überzeugung, dass seine bisherige Philosophie noch zu sehr das „Ideale“ ins Auge gefasst hatte. Wie er bereits „seinen Bruno“ am Ende der gleichnamigen Schrift sagen lässt, gilt es jedoch, aus der Einheit das Entgegengesetzte zu entwickeln, aus dem Ewigen das zeitliche Werden des Realen. Zu diesem Realen gehören aber nicht nur die lichten Kräfte sondern auch das Finstere. Wie wäre das Böse in einer Welt voll expansiven Drangs sonst zu erklären? Außerdem ist bei seinen bisherigen Überlegungen ein Gegenstand ganz zu kurz gekommen: der Mensch. Es war Schelling jedoch zu diesem Zeitpunkt klar, dass sich die endliche Sinnenwelt nicht aus einem unendlichen Absoluten einfach ableiten lässt. „Mit einem Wort, vom Absoluten zum Wirklichen gibt es keinen stetigen Übergang, der Ursprung der Sinnenwelt ist nur als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit durch einen Sprung denkbar“ (Schelling, „Philosophie und Religion“ von 1804, S. 38). Es gibt keine „Leitung oder Brücke vom Unendlichen zum Endlichen“ (ebd.). Infolge dieses Bruchs interpretiert Schelling das Entstehen der endlichen Sinnenwelt als Abfall vom Absoluten, nicht als Schöpfung. Analog dazu versteht er die Freiheit des Menschen als einen „Abfall“ und greift dabei auf die Mythologie des „Sündenfalls“ zurück. Damit ist der Problemhorizont umrissen, der sich für Schelling darbot, als er 1809 mit seiner Freiheitsschrift einen philosophischen Neubeginn wagte, in dessen Zentrum die Fragen nach der Freiheit, der Ursache des Bösen und der geschichtlichen Entwicklung des Kosmos standen. 4. Begründung der Möglichkeit eines sinnvollen Diskurses über das Theodizeeproblem Schelling beginnt seine Schrift „Über das Wesen der menschlichen Freiheit“ (ÜdWmF) mit einer Methodendiskussion. Kann man überhaupt eine wissenschaftliche Untersuchung über Freiheit, über Gott und über das Theodiezeeproblem durchführen und wie hat das zu geschehen? Wenn Kant Recht hätte mit der Behauptung, die Fragen der Theodizee seien theologische Glaubensangelegenheiten, dann dürfte jede ernst gemeinte philosophische Untersuchung fehl gehen. Schelling wendet sich zunächst einer methodischen Schwierigkeit zu, die bei der Untersuchung der menschlichen Freiheit von Kritikern ins Feld geführt werden könnte. Sie bestände darin, dass Freiheit einerseits in einer Definition festgelegt werden soll, 15 andererseits aber als etwas Unbedingtes oder Spontanes gelten soll. Da eine Begriffsfindung nie losgelöst von einem schon existierenden Sinnzusammenhang erfolgen kann, ist dieser Auffassung nach die Ableitung des Begriffs der Freiheit aus einem Begriffssystem in sich ein Widerspruch, und jede auf Einheit und Ganzheit Anspruch erhebende Philosophie läuft auf die Leugnung der Freiheit hinaus (vgl. ÜdWmF, 336/337). Schellings Gegenargument lautet: Wenn Freiheit mit dem Systemgedanken prinzipiell im Widerspruch stehen soll, wie ist es dann möglich, dass die offensichtliche individuelle Freiheit in das Weltganze eingebettet ist, ohne dass diesem Ganzen ein System zugrunde liegen soll? Der Weltzusammenhang aber hat ein System und dessen Ursprung liegt in Gott (ebd.). Im Sinne Kants könnte nun eingewendet werden, dass die Vorstellungen über Gott, die menschliche Freiheit und das Weltganze nur als notwendige regulative Ideen verstanden werden können, ohne dass ihnen etwas an sich Vorhandenes entspricht. Schelling entgegnet, dass diese Behauptung je selbst nicht bewiesen werden kann. Denn die Frage nach der Erkennbarkeit des Systems kann nur dann gültig beantwortet werden, wenn das Prinzip der menschlichen Erkenntnis selbst erkannt ist, wovon nicht ernsthaft die Rede sein kann. Infolgedessen ist die Argumentationsweise Kants letztlich unbegründet (vgl.337). Wenn aber die Frage nach einer Erklärung der Freiheit im Rahmen einer gesamten Weltsicht als sinnlos abgetan würde, dann hätte auch die Philosophie als solche ihren Sinn und Wert verloren (ebd.). Bei der Frage nach der Erkennbarkeit eines vorgegeben Sinns in der Welt erinnert Schelling an ein Argument, das auf Platon bzw. Pythagoras zurückgeht: Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden. Dieses hält er für gar nicht sehr abwegig und folgert, dass der Mensch eine Erkenntnis Gottes deshalb beanspruchen könne, weil er „mit dem Gott in sich den Gott außer sich begreife“ (337). Eine Rede über Gott ist dem Menschen möglich, weil und sofern er selbst Teil des Lebens Gottes ist, oder, wie Schelling vom Menschen sagt, „ seine Tätigkeit selbst mit zum Leben Gottes gehöre“ (339). Dass Schelling gleich zu Beginn seiner Freiheitsschrift die Berechtigung für das Sprechen über Gott und das Weltganze mit schlüssigen Argumenten zu belegen sucht, hat seinen Grund auch darin, dass er später die Freiheit Gottes als Bedingung der Möglichkeit menschlicher Freiheit herausstellen wird. Bevor Schelling aber zur Neuformulierung des Freiheitsproblems übergeht, Argumentationskette, Freiheitsanspruch. nämlich untersucht die er ein weiteres Verträglichkeit des Glied seiner Pantheismus späteren mit dem 16 In seiner Naturphilosophie und in seiner Identitätsphilosophie hatte Schelling den Grundgedanken Spinozas aufgenommen, dass die existierenden Dinge nur verschiedene Ausdrucksformen für eine grundsätzliche und vorangehende Einheit in einem Absoluten darstellen. Würde es sich nun erweisen, dass Spinozas Behauptung von der Immanenz der Dinge in Gott eine menschliche Freiheit grundsätzlich ausschließen würde, dann könnte auch Schellings Indentitätsphilosophie in Argumentationsschwierigkeiten kommen. Schelling distanziert sich deshalb von der spinozistischen Immanenzauffassung mit folgender Argumentation: Wenn Immanenz als Identität aufgefasst wird, dann darf dies nicht als „Einerleiheit“ der Dinge in Gott oder als ihr ontologisches Verschwinden in Gott verstanden werden. Immanenz bedeutet vielmehr ein Verhältnis von Subjekt zu Prädikat im Urteil, und dieses wiederum bezeichnet ein Verhältnis von Grund (antecedens) zur Folge (consequens). Es geht also um eine begriffliche Abhängigkeit in einem Sinnzusammenhang, nicht aber um die Einheit eines mechanistisch gedachten Systems, bei dem alle Einzelteile streng kausal miteinander oder mit einer höheren ‚Steuereinheit’ verknüpft sind. Deshalb kann Schelling sagen: „Aber Abhängigkeit hebt Selbstständigkeit, hebt sogar Freiheit nicht auf“ (346). Wie auch immer die Art der Folgeentwicklung der Wesen aus Gott zu denken sei, nie könne die Folge ein bloß mechanisches Bewirken sein, wobei dem Bewirkten keine eigene Identität und Selbstständigkeit zukommt. Da nun die Folge der Dinge aus Gott das Ergebnis von Gottes Selbstoffenbarung sind, so die Deutung Schellings, muss auch dasjenige, worin und wodurch Gott sich offenbart, so sein wie er selbst, nämlich ein freies, aus sich selbst handelndes Wesen (vgl. 346/347). Die wichtige Schlussfolgerung Schellings lautet damit, dass die Freiheit des Menschen nicht einem richtig verstandenen Pantheismus widerspricht, bei dem der Mensch in einem Folgeverhältnis zu Gott steht. Der Grund, warum Spinozas Philosophie mit der menschlichen Freiheit nicht vereinbar ist, liegt vielmehr darin, dass er deterministisch denkt. „Der Fehler seines Systems liegt keineswegs darin, dass er die Dinge in Gott setzt, sondern darin, dass es Dinge sind – in dem abstrakten Begriff der Weltwesen, ja der unendlichen Substanz selber, die ihm eben auch ein Ding ist. [...] Er behandelt auch den Willen als eine Sache und beweist dann sehr natürlich, dass er in jedem Fall des Wirkens durch eine andere Sache bestimmt sein müsse“ (349). Die Unfähigkeit, Freiheit zu denken, teilt das System Spinozas mit allen anderen Systemen, die von einer rational, nach logischen Kausalverknüpfungen aufgebauten Welt ausgehen. Dazu zählt Schelling auch Leibnizens Philosophie. All diese Systeme verfehlen deshalb den eigentlichen Begriff von Freiheit, der erst durch das Aufkommen des Idealismus wirklich entdeckt wurde, wie Schelling anmerkt. 17 Mit dem Begriff des Idealismus hat Schelling die Philosophie Kants und Fichtes im Auge. Zunächst zollt er dem Idealismus Anerkennung dafür, dass er überhaupt einen Begriff der Freiheit zu Wege gebracht hat, aber – und damit setzt Schellings explizite Kritik ein – er beschreibt nur eine formelle Freiheit „und lässt uns, sobald wir in das Genauere und Bestimmtere eingehen wollen, in der Lehre der Freiheit dennoch ratlos“ (351). Den kantischen Dualismus zur Sprache bringend kritisiert Schelling, es sei merkwürdig, dass Kant den einzig möglichen positiven Begriff des ‚An-sich’ nicht auf die Dinge übertragen habe, nachdem er zunächst in der ‚Kritik der reinen Vernunft’ (KrV) die ‚Dinge an sich’ von den uns empirisch fassbaren Dingen nur negativ, als nicht abhängig von der Zeit unterschieden hatte und dann in der ‚Kritik der praktischen Vernunft’ (KpV) Zeitunabhängigkeit und Freiheit als korrelate Begriffe behandelt hatte (vgl. 351/352). Wenn Freiheit aber ein notwendiges regulatives Denkprinzip sein soll, dann muss hinter diesem Prinzip etwas Reales stehen. Und so nimmt seine Diskussion der Freiheit eine neue Richtung mit der Behauptung: „Der reale und lebendige Begriff [der Freiheit] aber ist, dass sie ein Vermögen des Guten und des Bösen sei“ (352). Damit macht nicht mehr der Gegensatz von Freiheit und Notwendigkeit das Problem menschlicher Freiheit aus, wie bei Kant, vielmehr ist es die Spannung zwischen der Möglichkeit zum Guten und zum Bösen, welche Schelling als den eigentlichen Zugang zum Verständnis von Freiheit ansieht. 5. Der eigentliche Sinn von Freiheit nach Schelling: Die Möglichkeit zum Bösen Mit der Frage nach der Möglichkeit zum Bösen ist Schelling nun mitten im Theodizeeproblem angelangt. Wenn alles auf einen absoluten Ursprung, auf Gott, zurückgeht, wie kann dann die Existenz des Bösen erklärt werden, ohne Gott dafür verantwortlich zu machen? Wenn Gott nicht als Urheber des Bösen in Frage kommt, dann muss die Freiheit als Vermögen zum Bösen „eine von Gott unabhängige Wurzel haben“ (354). Schelling verwirft die Theorien über die Herkunft des Bösen, die seiner Meinung nach auf einen Ursprung des Bösen in Gott hinauslaufen, weil sie der Vorstellung eines höchsten Wesens widersprechen. Selbst wenn das Böse als ein anfänglich Gutes betrachtet würde, hätte es noch immer seinen Ursprung in Gott. Eine schrittweise Abstufung vom Guten zum Bösen hin, wie sie z.B. Plotin diskutierte, ist für Schelling ebenfalls inakzeptabel, weil sie zum Pandämonismus und letztlich zur Aufhebung von Gut und Böse führt. Abgesehen von der Möglichkeit der Nicht- 18 Existenz des Bösen, womit allerdings der Gegenstand, der gerade zur Diskussion steht, auch aufgehoben wäre, bliebe dann noch die Vorstellung vom Bösen als einem dualen Gegenprinzip zu Gott. Damit würde aber die Freiheit selbst, die an sich gegen Gutes und Böses indifferent ist, zum ontologischen Grund des Bösen. Folglich müsste Freiheit eine von Gott unabhängige Wurzel haben, wenn man ausschließen wollte, dass von Gott ein Vermögen zum Bösen ausgehen soll. Aber hierdurch geriete man in einen Dualismus, in dem sowohl das Gute und als auch das Böse ursprüngliche Prinzipien seien. Diesen Dualismus lehnt Schelling ab als „ein System der Selbstzerreißung und der Verzweiflung der Vernunft“ (354). Das Theodizeeproblem ist nach Schelling jedenfalls nicht zu lösen, indem man Gott von der Welt und der Natur in der Art des Dualismus loslöst, um ihn vor dem Bösen der Welt und der Natur zu schützen: „Gott ist etwas Realeres als eine bloße moralische Weltordnung“ (356). Die einzige Möglichkeit, die Herkunft des Bösen zu erklären, ohne Gott für das Böse verantwortlich zu machen und ohne einem schlechten Dualismus zu verfallen, sieht Schelling in einer grundsätzlichen Unterscheidung zwischen der Existenz und dem Grund der Existenz eines Wesens (vgl. 357). Diese Unterscheidung muss für alles Seiende getroffen werden. Speziell für Gott aber gilt: „Da nichts vor oder außer Gott ist, so muss er den Grund seiner Existenz in sich selbst haben“. Dieser Grund ist die „Natur – in Gott; ein von ihm zwar unabtrennliches, aber doch unterschiedenes Wesen“ (358). Grund und Existenz sind nicht identisch, aber sie bedingen einander in dem Sinne, dass man nur von Grund sprechen kann, sofern etwas existiert, und von Existenz, sofern es einen Grund von Existenz gibt: „Gott hat in sich einen inneren Grund seiner Existenz, der insofern ihm als Existierenden vorangeht; aber ebenso ist Gott wieder das Prius des Grundes [...]“ (358). Schelling spricht von einem Zirkel, aus dem alles wird. Dieser Zirkel ist nicht mehr hintergehbar. Der ‚Grund’ ist insofern als transzendentaler Begriff aufzufassen, als Schelling durch ihn die Bedingung der Möglichkeit des Heraustretens und Werdens der Dinge aus Gott sieht. Die Dinge haben ihren Grund in dem, was in Gott nicht er Selbst ist, aber was Grund seiner Existenz ist (vgl. 359). Der Grund der Existenz Gottes ist damit auch der Grund der Existenz der Dinge. Diesen Grund beschreibt Schelling metaphorisch als „Sehnsucht, die das ewige Eine empfindet, sich selbst zu gebären“ (359). Die Basis des Existierens ist, so gesehen, nichts Statisches, sondern Aktivität in Form von Sehnsucht, Drang und Wille, oder, wie Schelling schon zuvor gesagt hatte: „Wollen ist Ursein“ (350). Der Grund strebt als zunächst noch unbewusster Wille nach Wirklichkeit. Vom unbewussten Willen geht Schelling zum Gegenprinzip über, zum Verstand: Aus dem Verstandlosen wird 19 der Verstand geboren, aus dem Dunkel entsteht die Realität der Kreatur, durch Selbstoffenbarung die geordnete Welt. In einem ersten Schritt „erzeugt sich in Gott selbst eine innere reflexive Vorstellung“, die das Ebenbild Gottes darstellt. Es ist praktisch „der in Gott gezeugte Gott selbst“ (360/361). Die weiteren Schritte der Offenbarung Gottes sieht Schelling in einer zunehmenden Ausdifferenzierung aufgrund der Wirkung des Verstandes, zunächst in der Natur, bis schließlich die Offenbarung im Menschen als der höchsten Ausdifferenzierung des Verstandes gipfelt. Entscheidend für die Freiheitsthematik ist, dass Schelling sich schon in Gott die Selbstoffenbarung aus dem Grund durch zwei widerstrebende Kräfte gekennzeichnet vorstellt. Während der Verstand bestrebt ist, den „Lebensblick“, die Ordnung freizulegen, ist die Sehnsucht bestrebt, dies zu verhindern, „damit immer ein Grund bleibe“ (vgl. 361). In jedem Naturwesen herrscht dieses doppelte Prinzip, das „dunkle Prinzip“ des Grundes, von Schelling auch als Sehnsucht oder Wille bezeichnet, und das Prinzip des Lichtes, also Verstand und Vernunft. Im Menschen ist das Doppelprinzip am weitesten ausgeprägt. „In ihm ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel“ (363). Die Unterscheidung zwischen Grund und Verstand gestattet es Schelling nun, von einem Eigenwillen (oder Partikularwillen) und einem Universalwillen im Menschen zu sprechen. Im Eigenwillen setzt sich das dunkle Prinzip des Grundes in Form von Sucht, Begierde, „blinder Wille“, Unordnung durch, während der Universalwille, der ebenfalls Wille des Menschen ist, die andere Seite der menschlichen Herkunft darstellt, nämlich Verstand und Ordnung (vgl. 365). Gegenüber seiner früheren ‚Identitätsphilosophie’, in der Schelling das geistige Ordnungsprinzip in der Natur hervorhob, betont er nun die andere, die ‚dunkle’ Seite. „Das Irrationale und Zufällige […] besonders der organischen [Wesen] […] beweist, dass Freiheit, Geist und Eigenwille mit im Spiel waren“ (376). Im Hinblick auf die Freiheitsproblematik ist die Konsequenz der Unterscheidung zwischen Grund und Existenz die folgende: Dadurch, dass der Mensch aus dem Grund entspringt, hat er ein dunkles Prinzip in sich, das jedoch relativ auf Gott unabhängig ist. Infolgedessen ist Gott nicht ‚verantwortlich’ für das dunkle Prinzip im Menschen. Andererseits existiert im Menschen auch das höhere Prinzip des Verstandes. Der entscheidende Unterschied zwischen Gott und Mensch besteht darin, dass die beiden Prinzipien in Gott eine unzertrennliche Einheit bilden, während diese Einheit im Menschen aufgehoben werden kann. Der Mensch als ein mit Selbstbewusstsein ausgestattetes Wesen kann sich gegen die Einheit entscheiden. Darin liegen Ursache und Bedingung der Möglichkeit, Gutes oder Böses zu tun (vgl. 363/364). 20 Das Böse deutet Schelling als eine Selbstentzweiung, indem sich der Eigenwille des Menschen über den Universalwillen - statt des Begriffs Universalwille gebraucht Schelling auch die Begriffe: Urwille, Verstand, Wille in göttlicher Art und Ordnung - erhebt. Dadurch wird das Verhältnis der Prinzipien umgekehrt, das Gleichgewicht der Kräfte geht verloren und der Mensch steht, bildlich gesprochen, nicht mehr im stabilen Zentrum, sondern an der instabilen Peripherie seines Daseins. Für Schelling ist dieser Vorgang analog dem Übergang von der Gesundheit zur Krankheit. Der Wille des Menschen kann das Band der Kräfte nicht mehr zusammenhalten, er ist gezwungen, aus der Unordnung - „aus dem empörten Heer der Begierden und Lüste“ – ein eigenes und absonderliches Leben zu formieren. Aber das ist kein „wahres“, d.h. den ursprünglich stabilen Verhältnissen entsprechendes, sondern ein „falsches Leben“, ein „Leben der Lüge“. Missbrauch der Freiheit führt also zur Krankheit, Heilung besteht in der „Wiederherstellung des Verhältnisses der Peripherie zum Zentrum“ (vgl. 365, 366). Schellings Freiheitsbegriff umfasst mehr als die Bedingung der Möglichkeit, moralisch zu handeln aus Einsicht in eine vernunftmäßig begründbare Notwendigkeit, wie noch bei Kant. Die Freiheit des Menschen äußert sich für Schelling als Möglichkeit der Verkehrung der Prinzipien von Eigenwille und Universalwille, als Entscheidung zur Unvernunft. In Gott und in der Natur gibt es die Trennung der Prinzipien nicht. Der Urgrund, bzw. der Wille, ist zwar nicht selbst das Böse, aber in der willentlichen Entscheidung des Menschen, die „göttliche Art und Ordnung“ als das Gute zu verkehren, liegt das Böse. Konsequenterweise lehnt Schelling alle Theorien ab, die das Böse nicht als einen Gegensatz zum Guten, z.B. als etwas weniger Vollkommenes ansehen (z.B. Augustinus, Leibniz), oder die das Böse mit der Sinneswelt in Verbindung bringen, wie z.B. Platon (vgl. 367 bis 372). Soweit hat Schelling also die Möglichkeit zum Bösen erklärt. Möglichkeit schließt aber Wirklichkeit noch nicht ein. Deshalb stellt er sich nun die Frage, wie die Wirklichkeit des Bösen zustande kommt. 6. Die Wirklichkeit des Bösen und seine Verwirklichung durch den Menschen Zunächst bemerkt Schelling, dass es zum Nachweis der Wirklichkeit des Bösen keiner langen Diskussion bedarf. Das Böse ist unleugbar wirklich (vgl. 373). Folglich muss es zur Offenbarung Gottes notwendig gewesen sein, sonst wäre es nicht in der Welt. Gott kann sich nur in seinem Gegenteil offenbaren, so die Erklärung Schellings. Gäbe es keine Trennung der Prinzipien im Menschen, dann könnte die Einheit der Prinzipien in Gott seine Allmacht 21 nicht erweisen, dann wäre der Mensch ja wie Gott (ebd.). Der Geist des Bösen existiert notwendig in der Welt, damit sich ihm der Geist der Liebe Gottes als höheres Ideal entgegenstellen kann. An dieser Stelle baut Schelling seine Version der Christologie in das Geschehen ein, indem er ein zweites Mal das höhere Licht des Geistes, gemeint ist Christus, emporsteigen lässt, um dem persönlichen und geistigen Bösen entgegenzutreten (vgl. 379, 380). Dieses anfänglich nicht vorhandene, aber in der Wirklichkeit offenkundige Böse in der menschlichen Natur erzeugt Chaos und Angst: „Die Angst des Lebens treibt ihn [den Menschen] aus dem Zentrum, in das er erschaffen wurde“ (381). Nun aber hat Schelling ein neues Problem aufgeworfen, bevor er der Frage nach der Verantwortlichkeit für die Wirklichkeit des Bösen einen Schritt näher gekommen ist. Wenn das Böse notwendig ist zur Selbstoffenbarung der Liebe Gottes, wie lässt sich dann noch die menschliche Freiheit begründen? Allgemeiner formuliert lautet die Frage bei Schelling, ob sich Freiheit und Notwendigkeit generell ausschließen? Schellings Strategie ist es, zunächst die Vereinbarkeit von Freiheit und (naturgesetzlicher) Notwendigkeit aufzuzeigen, um dann im nächsten Schritt aufzuzeigen, dass der Mensch selbst, vermöge seiner Willensfreiheit verantwortlich für die wirklich böse Handlung ist. Schelling widmet sich zunächst dem Problem von Freiheit und Notwendigkeit und unterscheidet zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte Freiheit als Wahlfreiheit aufgefasst werden, der kein bewusstes Wollen vorausgeht. Dann wären aber Handlungen etwas rein Zufälliges und Beliebiges, was gleichbedeutend damit ist, dass der Mensch vernunftlos handelt. Dies widerspricht aber der „notwendigen Einheit des Ganzen“ (383), denn das Weltganze ist nicht ohne Vernunft, wie Schelling schon in seinen naturphilosophischen Schriften gezeigt hat. Dieser Fall kann also ausgeschlossen werden. Als Gegenposition betrachtet Schelling den Determinismus, der davon ausgeht, dass alle Handlungen einer empirischen Notwendigkeit unterliegen, weil jede Handlung bestimmt ist durch Vorstellungen und Ursachen, die in der Vergangenheit liegen und die vom Handelnden nicht mehr beeinflusst werden können. Schelling kann sich für diesen Gedankengang zwar mehr erwärmen als für den zuvor dargelegten. Beide Auffassungen sind seiner Meinung nach jedoch insofern fehlerhaft, als sie nicht die innere, aus dem Wesen des Handelnden entspringende Notwendigkeit berücksichtigen (vgl. 383). Zwischen der Möglichkeit der Willensfreiheit und der Möglichkeit zum Wollen aufgrund von Wesensmerkmalen kann und darf es grundsätzlich keinen Widerspruch geben, weil es sonst eine Willensfreiheit gar nicht geben könnte. Um dies genauer aufzuzeigen, greift Schelling auf die Überlegung Kants zurück, dass Zeitlosigkeit und Unabhängigkeit von 22 Kausalzusammenhängen das formale Wesen der Freiheit ausmachen. Das bedeutet: „Die freie Handlung folgt unmittelbar aus dem Intelligiblen des Menschen“ (384). Da die freie Handlung eine gewollte und gewählte, keine beliebige ist, folgert Schelling: „Vom absolutUnbestimmten zum Bestimmten gibt es aber keinen Übergang“ (384). Infolgedessen resultieren die Gründe für die Handlungen nur aus dem freien Wesen selbst: „[Das freie Wesen] kann nur seiner eignen innern Natur gemäß handeln [...]; denn frei ist, was nur den Gesetzen seines eignen Wesens gemäß handelt und von nichts anderem weder in noch außer ihm bestimmt ist“ (384). Auf diese Weise bringt Schelling die Begriffe Freiheit und Notwendigkeit in einen Zusammenhang, bei dem sie sich nicht wechselseitig aufzuheben: „ [...] jene innere Notwendigkeit ist selber die Freiheit; das Wesen des Menschen ist wesentlich seine eigene Tat; Notwendigkeit und Freiheit stehen ineinander, als Ein Wesen, das nur von verschiedenen Seiten betrachtet als das eine oder andere erscheint, an sich Freiheit, formell Notwendigkeit ist“ (385). Der Mensch handelt selbstbestimmt, jedoch immer gemäß seinem eigenen Wesen. Zwischen seinem Wesen und seinen Handlungen gibt es einen Wechselbezug. Schelling zitiert Fichte, indem er sagt: „Das Ich [...] ist seine eigene Tat; Bewusstsein ist Selbstsetzen – aber das Ich ist [...] eben das Selbstsetzen selber“ (385). Zugleich weist er das Zirkularitätsproblem, das in Fichtes Philosophie steckt, zurück und schlägt seine eigene „Lösung“ vor, die darin besteht, dass Sein und Bewusstsein aus einem davorliegenden Urwollen hervorgehen: „Dieses Bewusstsein [...] ist nicht einmal das Erste und setzt wie alles bloße Erkennen das eigentliche Sein schon voraus. Dieses vor dem Erkennen vermutete Sein ist aber kein Sein, [...], es ist ein Ur- und Grundwollen, das sich selbst zu etwas macht und die Basis aller Wesenheit ist“ (385). Die Entzweiung der ursprünglichen Einheit in zwei entgegensetzte Prinzipien, in einen Partikularwillen und einen Universalwillen, macht erst die Willensentscheidung möglich. Diese ist aber immer eine freie. Mit dem kantischen Argument der Zeitunabhängigkeit freier Handlungen und unter Zuhilfenahme des biblischen Sündenfalls führt er dann weiter aus: „Der Mensch, wenn er auch in der Zeit geboren wird, ist doch in den Anfang der Schöpfung (das Zentrum) erschaffen. Die Tat, wodurch sein Leben in der Zeit bestimmt ist, gehört selbst nicht der Zeit, sondern der Ewigkeit an [...]“ (385). Die Grundentscheidung des Menschen, die letztlich sein Leben bestimmt, fällt außerhalb der Zeit und „daher mit der ersten Schöpfung (wenngleich als eine von ihr verschiedene Tat) zusammen“ (ebd.). Menschliche Entscheidungen zum Bösen gehen nicht zurück auf eine Vorherbestimmung des Menschen durch Gott, wie z.B. bei Calvin, und sie gehen auch nicht einher mit einem göttlichen Vorherwissen, wie z.B. bei Leibniz. In beiden Fällen wäre für Schelling der Mensch nicht frei, zugleich wäre Gott für die Taten des Menschen 23 verantwortlich. Der Mensch entscheidet in einer „Urentscheidung“ selbst über sein eigentliches Leben. Diese Tat, so Schelling weiter, geht dem Bewusstsein voraus, sie macht erst das Bewusstsein (vgl. 386). In der ursprünglichen Schöpfung, so Schelling, war der Mensch noch ein unentschiedenes Wesen. Durch seine „erste Tat“, gemeint ist der Sündenfall im Paradies, konstituiert er sich als derjenige, der er zu aller Zeit sein wird. Der Sündenfall ist damit Ermöglichung der Menschheitsgeschichte, mit dem Sündenfall wird die Wirklichkeit des Bösen neben dem Guten zu einer zwangsläufigen Begleiterscheinung menschlicher Selbstbestimmung im zeitlichen Dasein. Jeder Handlung liegt damit das Apriorische des menschlichen Wesens als Notwendigkeit zugrunde. Aber jeder Mensch hat Anteil an dieser ersten freiwilligen Tat Adams, so Schelling. Damit ist jeder Mensch letztlich selbst verantwortlich für seine moralische Grunddisposition, aus der sein Wollen und Tun entspringt. Denn die „eigene Tat“ der Selbstbestimmung geschah aus Freiheit. „In dem Bewusstsein, sofern es bloßes Selbsterfassen und nur idealistisch ist, kann jene freie Tat, die zur Notwendigkeit wird, freilich nicht vorkommen, da sie ihm, wie dem Wesen, vorangeht, es erst macht.; aber sie ist darum doch keine Tat, von der dem Menschen überall kein Bewusstsein geblieben; indem derjenige, welcher etwa, um eine unrechte Handlung zu entschuldigen, sagt: So bin ich nun einmal [...]“ (386). Wie der Anteil eines jeden Menschen am ersten Sündenfall genau zustande kommt, führt Schelling nur vage aus. Wahrscheinlich sind platonische Vorstellungen über die Präexistenz menschlichen Seins in sein Denken eingeflossen. Manche Interpreten verweisen auch auf den Einfluss christlicher Kirchenväter, die behaupteten, dass alle Menschen irgendwie in Adam gewesen sind (vgl. Anmerkung 15 von H. Fuhrmans in: Schelling, „Über das Wesen der menschlichen Freiheit“, Reclam 1964). Ein Übriges bewirkte wahrscheinlich Schellings Interpretation des kantischen Dualismus, die ihn die freie, außerhalb der Kategorie ‚Zeit’ stehende Willensentscheidung eines jeden Menschen mit Adams Entscheidung zur Sünde im Paradies „zusammenfallen lässt“. Schellings Freiheit besteht in der Möglichkeit, die Übereinstimmung des Eigenwillens mit dem vernünftigen und richtigen Wollen herzustellen oder zu zerstören. Als Folge einer Urentscheidung neigen Subjektivität und Individualität dazu, die naturbestimmte Ordnung zu verlassen. Statt seine Selbstheit zur Basis zu machen, sollte der Mensch besser die Rolle eines „Organs“ des Allgemeinwillens spielen und sich damit in eine Gesamtordnung einfügen (vgl. 389). Denn „[die] wahre Freiheit ist im Einklang mit einer heiligen Notwendigkeit, dergleichen wir in der wesentlichen Erkenntnis empfinden“ (391/392). Diese „heilige Notwendigkeit“ ist nicht vom Menschen her erklärbar, sie ist von Gott dem 24 Menschen vorgegeben. Andererseits sieht Schelling es als notwendig an, dass der Mensch als Mensch sein Selbst lebt, und dieses ist nun einmal bestimmt durch den Widerstreit von Wollen und Einsicht: „Die aktivierte Selbstheit ist notwendig zur Schärfe des Lebens; ohne sie wäre völliger Tod, ein Einschlummern des Guten; denn wo nicht Kampf ist, da ist nicht Leben“ (400). Aber der Mensch in seiner Endlichkeit kann seine eigenen Existenzbedingungen nie völlig in den Griff bekommen. „Der Mensch bekommt die Bedingungen nie in seine Gewalt, […] daher sich seine Persönlichkeit und Selbstheit nie zum vollkommenen Aktus erheben kann“ (399). Dies ist Schellings Erklärung der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Hilfe kann der Mensch bekommen, indem er den guten, helfenden Geist in sich handeln lässt. „Denn eben das in-sich-handeln-Lassen des guten oder bösen Prinzips ist die Folge der intelligiblen Tat“ (389). Aber letztlich ist eine Rückkehr in den Zustand völliger Abwesenheit des Bösen nur möglich, wenn der Mensch alle Eigenheiten ablegt (vgl. 381). Dieses aber ist gleichbedeutend mit der Auflösung seines endlichen Lebens, denn sein Leben lang steht der Mensch vor der Aufgabe, sein ichhaftes Wollen in Übereinstimmung mit dem gottgewollten und vernünftigen Wollen zu bringen. 7. Vom geschichtlichen Anfang zum geschichtlichen Ende des Bösen Schelling hatte die menschliche Freiheit als ein Vermögen zum Guten und zum Bösen definiert. Die Möglichkeit von Freiheit entspringt – so hatte Schelling gezeigt – aus einem Doppelprinzip, das schon in Gott angelegt ist. Die Verwirklichung des Bösen durch den Menschen resultiert aus einer freien ‚Urentscheidung’. Es ist der Egoismus des Menschen, der ihn sein Selbst über die vernünftige Ordnung stellen lässt. Das führt zu Chaos und letztlich zur Auflösung von Freiheit und Leben. Mit dem Abschluss des Abschnitts (393) scheint Schelling damit alles Wesentliche zum Thema Freiheit in dieser Schrift gesagt zu haben. Und doch ist er seinem eigenen Bekunden nach noch nicht zum höchsten Punkt seiner Untersuchung vorgedrungen. Die wesentlichen Fragen, um die es ihm noch geht, sind die folgenden: Wenn die Welt als Selbstoffenbarung Gottes zu verstehen ist, wie ist es dann mit der Freiheit Gottes bestellt? Wenn alle Wesen, einschließlich Gott, die aufgezeigte Doppelstruktur besitzen, woraus entspringt sie? Wenn schließlich alles Leben aus der Spannung dieser beiden Prinzipien hervorgeht, wie endet diese Spannung? Es ist offensichtlich, dass die Freiheitsdefinition des Menschen als Möglichkeit zum Bösen auf Gott nicht übertragen werden kann, ohne den Begriff ‚Gott’ aufzuheben. Aber vielleicht 25 ist Gott gar nicht frei? Gott war möglicherweise bei seiner Selbstoffenbarung einer blinden, bewusstlosen Notwendigkeit ausgesetzt, so fragt Schelling (vgl. 394). Vielleicht ist Gott auch nur als ein „logisches Abstraktum“ aufzufassen, beispielsweise als eine trans- zendentale Idee, wie bei Kant. Aber dann, so Schelling, müsste auch alles aus ihm mit logischer Notwendigkeit folgen, alles wäre rein rational erklärbar (vgl. 395). Schelling hatte aber in den vorausgegangenen Abschnitten Gott als die lebendige Einheit von Kräften definiert. Da nur eine Person als lebendiges Band von Geist und Trieb frei sein kann, so muss auch Gott als Person gesehen werden, und zwar als höchste Persönlichkeit. In Gott selbst herrschen schon ein bewusster und ein unbewusster Wille. Den letzteren vergleicht Schelling nun mit „einem schönen Drang einer werdenden Natur“ (395). Daraus aber folgt, dass die Natur als Schöpfung nicht aus bloß geometrischer Notwendigkeit entstanden sein kann, d.h. nicht aus ’reiner Vernunft’ ableitbar und nur durch Naturgesetze beschreibbar ist, wie Rationalisten behaupten. Schellings Schlussfolgerung ist vielmehr, dass die Schöpfung die Tat Gottes ist. Sie geschieht aus freiem Willen als Selbstoffenbarung Gottes (vgl. 395, 396). Die Freiheit Gottes besteht also nicht darin, dass er als der allmächtige Gott willkürlich handelt, sie besteht darin, dass er in der Schöpfung offenbar wird, wodurch die Schöpfung Sinn erhält. Bei Gott bedeuten Notwendigkeit und Freiheit das Wollen der Selbstoffenbarung als Bedingung der Möglichkeit der Schöpfung, die nicht Gott selbst ist, in der er sich aber fortlaufend zeigt. Folglich kann nach Schelling die Freiheit des Menschen auch nur aus der Freiheit Gottes verstanden und beurteilt werden. Die richtig verstandene Freiheit des Menschen aber ist „die höchste Entschiedenheit für das Rechte, ohne alle Wahl“ (392). Blicken wir noch einmal zum geschichtlichen Anfang zurück. Das Böse war von Schelling als eine Realität im Gegensatz zum Guten dargestellt worden. Ohne das reale Böse wäre der Freiheitsbegriff bloß formal und leblos. Schelling erinnert nun an die Forderung, dass „vor allem Grund und vor allem Existierenden […] ein Wesen sein“ (406) muss. Aber dieses Wesen kann nicht in der Identität von Gut und Böse bestehen, denn ‚gut’ kann nie dasselbe wie ‚böse’ sein. Vor allem Anfang gab es weder gut noch böse, es herrschte Prädikatlosigkeit, ein Zustand der Indifferenz. Diesen bezeichnet Schelling als „Ungrund“ (vgl. 407). Durch ein ‚vorprädikatives’ Wollen entsteht die Differenz und damit Leben und persönliche Existenz durch Teilung in die beiden gleich ewigen Anfänge, Wille und Verstand (vgl. 408). Schließlich endet alles, wie es angefangen hat. „Das Ende der Offenbarung ist […] die Ausstoßung des Bösen vom Guten, die Erklärung desselben als gänzlicher Unrealität“ (405). Das Böse wird vom Willen des Guten in Gott besiegt. Das Böse wird zum Unwesen, das 26 keine Realität mehr hat und nicht mehr sein soll (vgl. 409). Dies ist Schellings Variante der neuplatonischen Auffassung vom Bösen als dem Nicht-Realen, und zwar am Anfang und am Ende der Geschichte. Dabei hat er Grundgedanken der christlichen Eschatologie und Heilslehre in seine Betrachtungen aufgenommen. Entstehen und Vergehen des Bösen ist gebunden an die Offenbarung Gottes. So wie das Absterben der Eigenheit im endlichen Menschen die einzige Möglichkeit zur Rückgewinnung der ursprünglichen Einheit von Eigenwille und Urwille ist, so endet generell die Geschichte in dem Zustand, in dem „Gott Alles in Allem“ (404) ist. Denn wo Alles in Allem ist, gibt es keine Unterschiede und damit auch kein Gut und Böse mehr. Zu Beginn seiner Freiheitsschrift hatte Schelling postuliert, dass eine grundlegende Untersuchung der menschlichen Freiheit nur innerhalb eines philosophischen Gesamt- systems möglich ist. Diesen Systementwurf, in welchen die Freiheit zum Bösen und zum Guten eingebettet ist, hat er versucht darzulegen. Offensichtlich gibt es aber eine Grenze für diese Untersuchung: „In dem göttlichen Verstande ist ein System, aber Gott selbst ist kein System, sondern ein Leben“ (399). Dass wir über Freiheit, Welt und Gott sprechen können, geht auf etwas zurück, das nur Gott bekannt ist. Gott als der letzte Grund des Lebens kann aber nicht als System behandelt und wie etwas Mechanisches ergründet werden. Damit macht Schelling sehr bewusst auf die Grenzen des Gültigkeitsanspruchs seines eigenen Systementwurfs und seines Sprechens über Gott aufmerksam. 8. Einige kritische Anmerkungen Die Frage, warum ein Mensch Böses tut, ist so alt wie die Philosophie selbst. Handelt er wirklich frei und gegen die eigene Überzeugung vom eigentlich Guten? Üblicherweise werden die beiden Grundpositionen in Sachen Willensfreiheit als Kompatibilismus und Inkompatibilismus zu bezeichnet. Kompatibilisten sind der Meinung, dass Freiheit und Determinismus vereinbar sind. Für ihre Argumentation ziehen sie im Wesentlichen den Begriff der Handlungsfreiheit heran. Eine Handlung ist dann frei, wenn Handlung und Wille übereinstimmen. Inkompatibilisten halten den Determinismus mit der Willensfreiheit für unvereinbar. Für sie existieren nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist alles determiniert und folglich die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit eine Illusion oder die Determinismus-Behauptung ist falsch und der Mensch ist frei in Bezug auf die Steuerung seiner Handlungen. Schelling hat sich, ohne dass er selbst den Begriff benutzt hätte, zu einem Kompatibilismus spezifischer Prägung bekannt. Ein Mensch handelt frei, nicht weil er 27 einen beliebigen Entschluss fassen kann, sondern weil seine Entscheidung im Einklang mit seinem veranlagungsbedingten Wollen steht. Das Spezifische bei Schelling liegt darin, dass die Notwendigkeit als eine Veranlagung der handelnden Person vorgegeben, aber gleichwohl von dieser frei gewählt ist. Lägen seitens der handelnden Person prinzipiell keine eigenen Wünsche, Bedürfnisse oder Entscheidungen vor, dann könnte die Handlung nie zurückgebunden werden an den Akteur, sie wäre dann beliebig. Folglich könnte man auch nicht von einer Verantwortlichkeit des Handelnden für seine Tat sprechen. Freiheit gemäß dieser Interpretation hat Urheberschaft zur Bedingung und im Rahmen dieser Urheberschaft Autonomie. Dies wiederum ist äquivalent mit der Aussage, dass eine Handlung nur dann autonom ist, wenn sie nicht ausschließlich durch einen zeitlich vorangegangenen Vorgang bestimmt worden ist. Indem nun Schelling die kantische transzendentale Bedingung für freie Entscheidungen übernimmt und die Urentscheidung als eine außerhalb aller Zeit liegende Tat definiert, bringt er Kants Dualismus in seine Freiheitsargumentation hinein, der zu folgendem Dilemma führt: Die Entscheidung des denkbaren Ich, des Ich an-sich, ist für Kant nicht determiniert. Infolgedessen ist sie dem empirischen Ich, dem Ich, das wir handeln sehen, nicht zuschreibbar. Wäre die Entscheidung jedoch zuschreibbar, dann wäre sie zurückzuführen auf Faktoren, die außerhalb des zu denkenden Ich liegen. Infolgedessen wäre die Handlung nicht frei. Schelling hatte das Problem zunächst erkannt und gesagt, dass eine Freiheit, die nur einem geistigen Ich zugeschrieben wird, keine lebende, d.h. zuschreibbare Basis hat (vgl. z.B. 352). Indem er dann aber von Kant die Zeitlosigkeit (Nicht-Kausalität) als alleinige Bedingung für die Urentscheidung zur eigenen moralischen Disposition übernimmt, führt sein Konzept in das gleiche Dilemma. Damit verliert sein Lösungsvorschlag, das Böse und das Gute gemeinsam aus einem ursprünglichen Zustand noch nicht bestehenden Bewusstseins zunächst als Möglichkeit hervortreten, dann durch eine freie, auf nichts weiter zurückführbare Willensentscheidung in die Wirklichkeit überführen zu lassen, und gleichzeitig diesem Willensträger die Verantwortung zu übertragen, an Überzeugungskraft. Schelling gibt auch gar keine Gründe für die Urentscheidung seitens der handelnden Person an. Das Argument, dass Gott sich offenbaren musste in einer Welt, die das Gute und das Schlechte enthält, weil sich seine Güte nur am Gegenprinzip zum Guten, dem Bösen, erweisen kann, ist kein Handlungsgrund, für den die handelnde Person zur Rechenschaft gezogen werden kann. Es wird wahrscheinlich immer unverständlich bleiben, wie eine apriorische Wesensdisposition zu einer freien Tat führen soll, für die der konkrete Mensch verantwortlich gemacht werden kann. Auch hat Schelling den zweiten, logisch möglichen 28 Fall unerwähnt gelassen, der darin besteht, dass der Mensch sich in der freien Urtat für das Gute hätte entscheiden können. Dann gäbe es nämlich kein wirklich Böses. Diese Möglichkeit beweist, dass eine freie Entscheidung für sich genommen noch kein hinreichender Grund für das wirklich Böse sein kann. Dass wir alle persönliche Merkmale und Dispositionen qua Geburt (durch Gene), durch frühkindliche Einflüsse etc. besitzen, dürfte niemand in Frage stellen. Dass wir aber selbst restlos für unsere Veranlagungen verantwortlich sein sollen, entzieht sich einer rationalen Erklärung. Nicht die Verantwortlichkeit des Täters für die eigene Disposition, sondern seine Verantwortlichkeit für die Tat angesichts seiner Disposition, z.B. aufgrund einer krankhaften Neigung, stellt sich in der heutigen Rechtssprechung als das eigentliche Problem dar. Schellings Argumentation lässt sich aus einem zweiten Grund kritisieren. Wenn eine außerzeitliche, bzw. a-priorische Konstitutionsbestimmung des Menschen die konkrete Handlung in der Zeit bestimmt, so als ob man bei einer Handlung der Person X sagen würde: ‚Das war wieder mal ein typischer (aber immer gleicher) X’, dann spielt das konkrete Leben für die Persönlichkeitsformung dieser Person überhaupt keine Rolle mehr. Damit wird die Frage auch uninteressant, was den einzelnen Menschen zu einer konkreten Handlung treibt, und wie er aus möglichen Fehlern lernen kann. Jedenfalls hat Schelling nicht gezeigt, wie das A-priorische des Wesens in einen Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung im konkreten Leben gebracht werden kann. Moralphilosophische Aspekte, wie bei Kant, oder soziale Hintergründe für Handlungsmotive liegen nicht im Fokus seiner Freiheitsschrift. Problematisch ist schließlich die Art und Weise, in der Schelling das Böse in den Zusammenhang mit der menschlichen Selbstbestimmung bringt. Indem er sein Selbst lebt, riskiert der Mensch, die Einheit von Eigenwille und Universalwille zu zerstören. Dies treibt ihn zum Bösen. Subjektivität und Individualität werden zum Problem des menschlichen Daseins. Dem Verstand kommt die Aufgabe zu, das unvernünftige Wollen des Individuums in vernünftige, vom Urwillen vorgegebene Schranken zu weisen. Bei dieser Deutung menschlichen Daseins wird dem veranlagungsgemäßen Wollen des Menschen schließlich doch das Attribut des Negativen angehängt. Außerdem müsste der Verstand sowohl das unvernünftige und unbewusste Wollen als auch das Urwollen kennen, um beide zur Übereinstimmung zu bringen, er müsste eine unabhängige Instanz sein. Unser Verstehen hängt aber selbst von Faktoren und Umständen ab, die ihm möglicherweise unbekannt sind. Die Trennlinie zwischen den bewussten und den unbewussten Anteilen unseres Wollens und 29 Handelns kann ziemlich diffus sein. Der bewusste Wille ist vielleicht gar nicht so frei, wie es ihm vorkommt. Dass unsere Freiheit und die Fähigkeit zur Unterscheidung von Gut und Böse relativ auf ein bedingtes Verstehen sind, ist eine geradezu banale Erkenntnis. Die Redeweise von der Herstellung der Einheit von Eigenwille und Urwille erscheint jedenfalls als ein ziemlich einfaches Bild vor dem Hintergrund eines komplizierten Vorgangs des Entstehens von Verstehen, selbst wenn man davon ausgeht, dass Schelling bei seiner Konzeption des Urwillens von einer offenbarten, dem Menschen zugänglichen göttlichen Wahrheit ausging. Schellings Überlegungen zur Erklärung des Bösen enthalten jedoch im Kern eine sehr überzeugende Botschaft, die sich vielleicht so zusammenfassen lässt: Der Mensch lebt in einer bedingten Welt mit einer für ihn endlichen Dauer. Indem er handelt, legt er sich fest. Jeder Schritt, den er macht, jede Entscheidung, die er trifft, ist unaufhebbarer Teil seines Ich. Sein Handeln und sein Ich bedingen sich wechselseitig. Zwar kann der Mensch eine geschehene Handlung nicht mehr rückgängig machen, aber er kann seinen Absichten und seinen Handlungen eine neue Richtung geben - im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten und Fähigkeiten. Böse handelt der Mensch, wenn er nur sich selbst zum Maßstab macht, wenn er nur sein Wohlergehen im Auge hat ohne Rücksicht auf das Wohlergehen seiner Mit- und Umwelt oder auf deren Kosten. Die Neigung zum Egoismus ist ein zwangsläufiges Attribut seines Lebens- und Überlebensprinzips in einer für ihn endlichen Welt mit begrenzten Möglichkeiten und Chancen. Für diesen Hang steht die Metapher „Erbsünde“. Die Ich-Bezogenheit kann krankhafte Züge annehmen und zwischen zwei Extremen schwanken, der völligen Beherrschung des Anderen und der völligen Unterwerfung des Ich (Altruismus). Es ist die unabschließbare Aufgabe des Menschen, zwischen diesen Extremen die gute Balance zu finden.