Richard Schrodt - Universität Wien
Werbung

Richard Schrodt Tiefen und Untiefen im wissenschaftlichen Sprachgebrauch 1. „Wer überhaupt spricht oder schreibt, sollte sich verständlich ausdrücken. Das ist eine auf den ersten Blick einleuchtende Forderung. denn wozu äußert er sich, wenn er nicht verstanden werden will?“ (Luhmann 2005, 193) So einfach scheint unser Problem zu sein – doch so einfach ist es nicht. Luhmann schiebt an der gleichen Stelle einige „Bedenken und Fragen“ nach: „Sollte man alles, was gesagt wird, gleichermaßen unter die Knute der Verständlichkeit zwingen? Soll Verständlichkeit bedeuten: Verständlichkeit für jedermann? Verständlichkeit ohne Mühe? Verständlichkeit ohne jede Vorbereitung, ohne jeden Zeitaufwand des Nachdenkens und Entschlüsselns? Gibt es ein lineares Kontinuum, das von Unverständlichkeit zu Verständlichkeit führt und auf dem man mehr Verständlichkeit fordern kann? Oder gibt es auf diesem Wege vom Unverständlichen zum Verständlichen auch Abwege, etwa ins Missverständliche? Gilt vielleicht, dass das Unverständliche nur aufgelöst werden kann durch Steigerung von Verständlichkeit und Missverständlichkeit zugleich?“ Eines scheint sicher: Ohne Mühe, ohne Nachdenken und ohne Entschlüsselung (welche auch immer) kann man keine Wissenschaftssprache verstehen. Wer wissenschaftliche Texte verstehen will, muss sich in der Wissenschaft auskennen, und zwar bis zu jenem Grad von Komplexität, den das wissenschaftliche Thema mit sich bringt. Es ist die verantwortungsvolle Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus, wissenschaftliche Themen auch den Laien in einer alltagssprachlichen Form nahe zu bringen; das kann durch Reduktion von Komplexität, durch Anbindung an Alltagserfahrungen und Allgemeinkenntnisse, durch behutsamen Aufbau wissenschaftlicher Kompetenz geschehen. Innerhalb der Fachkommunikation sichert hingegen ein gemeinsames Unterstellungssystem, das auf gemeinsamen Wissensbeständen gründet, die Verständigung und die Verständlichkeit. Niemand wird erwarten, dass jeder etwa einen mathematischen Fachtext auf Anhieb versteht (es sei denn, der Text entspräche dem Niveau eines verbreiteten mathematischen Schulwissens). So gesehen besteht das Problem der Unverständlichkeit zunächst in einem Interferenzbereich zwischen Alltagswelt und Fachwelt: Fachsprachliche Texte können als alltagsweltliche Texte geradezu missverstanden werden. Dieses Problem ist bekannt und soll hier nicht weiter ausgeführt werden. Weniger bekannt, aber umso wichtiger, sind Probleme innerhalb der Wissenschaftssprache: Sie weisen nicht nur auf die Verschiedenheit wissenschaftlicher Methoden, Theorien und Schulen hin, sondern sie führen auch direkt zu Fragen der wissenschaftlichen Moral und Ethik. Die Frage, was wie gesagt werden kann, soll und darf, beantwortet sich in Rücksicht auf die geltenden wissenschaftlichen Gepflogenheiten, Meinungen, Schulen, kurz: auf die herrschenden wissenschaftlichen Machtverhältnisse und ihrem gesellschaftlichen Hintergrund. Daneben stellt sich aber auch die Frage, ob es auch so etwas wie ein Ethos der wissenschaftlichen Ausdrucksweise gibt, ein Ethos, mit dem die Wissenschaftssprache und ihre konkreten Ausformungen bewertet werden können und müssen. Beide Fragen müssen immer zusammen gestellt und beantwortet werden und genau darum soll es im Folgenden gehen. 2. Carnap gegen Heidegger Martin Heidegger hält 1929 in der Aula der Universität Freiburg i. Br. seine Antrittsvorlesung mit dem Titel „Was ist Metaphysik?“. In seinem Text stehen folgende Sätze: Erforscht werden soll das Seiende nur und sonst — nichts; das Seiende allein und weiter — nichts; das Seiende einzig und darüber hinaus — nichts. Wie steht es um dieses Nichts? — — Gibt es das Nichts nur, weil es das Nicht, d. h. die Verneinung gibt? Oder liegt es umgekehrt? Gibt es die Verneinung und das Nicht nur, weil es das Nichts gibt? — — Wir behaupten: Das Nichts ist ursprünglicher als das Nicht und die Verneinung. — — Wo suchen wir das Nichts? Wie finden wir das Nichts? — — Wir kennen das Nichts. — — Die Angst offenbart das Nichts. — — Wovor und warum wir uns ängsteten, war ‘eigentlich’ — nichts. In der Tat: das Nichts selbst — als solches — war da. — — Wie steht es um das Nichts? — — Das Nichts selbst nichtet. 1931 wird dieser Text von Rudolf Carnap in seinem bekannten Aufsatz „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ (Carnap 1975) als eine Ansammlung von Scheinsätzen dargestellt. Scheinsätze sind Sätze wie Cäsar ist eine Primzahl, also syntaktisch (grammatisch) richtige, aber sinnlose Sätze – oder, wie Carnap behauptet, sind es eigentlich überhaupt keine Sätze. „Die grammatische Syntax [ist], vom logischen Gesichtspunkt aus betrachtet, unzulänglich.“ Die Formen der unzulänglichen Sprache können durch eine logische Analyse so wiedergegeben werde, dass korrekte (sinnvolle) und nicht-korrekte (sinnlose) Wortreihen unterschieden werden können. Ein sinnvoller Satz ist etwa Draußen ist Regen, in der logischen Darstellung dr(Re). Ganz ähnlich könnte man den Satz Draußen ist nichts formulieren: dr(Ni). Das wäre aber falsch, denn die korrekte logische Formulierung für diesen Satz ist ~ (x) · dr(x), etwa „Es ist nicht der Fall, dass es etwas gibt, und das (= etwas) draußen ist.“ Eine normale, sinnvolle, Aussage besteht zB. aus einem Prädikat (Funktor, meist ein Verb) und seinen Argumenten (meist ein Nomen), also etwa in der Form nach Carnap (1931) verb(Nomen). So entsprechen dem Satz Wir kennen den Regen die Formel k(Re) oder genauer k(wir, Re) und dem Satz Der Regen regnet die Formel re(Re). Sinnlos sind aber Formeln wie k(Ni) und ni(Ni) für Wir kennen (suchen, finden …) das Nichts und Das Nichts nichtet. Die Negation wird in der logischen Formel durch einen Negationsoperator bezeichnet. Das Wort nichts kann nicht als Gegenstandsname verwendet werden. Ähnlich wird auch der existenzielle Gebrauch des Wortes sein abgelehnt: Das Existenzzeichen kann nicht wie ein Prädikat auf ein Gegenstandszeichen bezogen werden, sondern nur auf ein Prädikat selbst. Die Philosophie des Neopositivismus gilt heute als ein Teil Wissenschaftsgeschichte – die Problematik der Protokollsätze (Aufzeichnungen der Protokolle unmittelbarer Erlebnisinhalte) im Rahmen der wissenschaftlichen Aussagen, die Unvermeidbarkeit von metaphysischen (also nicht-verifizierbaren Aussagen) und wohl auch die verschiedenen Möglichkeiten, einen normalsprachlichen Satz logisch zu formalisieren, lassen das neopositivistische Konzept der logischen Syntax als Wissenschaftssprache fragwürdig erscheinen. Davon unberührt aber ist das neupositivistische Wissenschaftsethos, die sich am klarsten in Ludwig Wittgensteins „Tractatus“ (4.116) ausdrückt: Alles was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. Zu dieser Klarheit gehört es jedenfalls, mit den Kategorien einer natürlichen Sprache sorgfältig umzugehen und nicht alles, das sich substantivieren lässt, als realer Gegenstand in die wissenschaftliche Diskussion zu bringen. Das hat Hans Hahn (1930) am Beispiel des Satzes Ein hölzernes Eisen existiert nicht vorgeführt: Es wird behauptet, dass dieser Satz wahr sei. Wenn das so ist, dann wird vom Subjekt hölzernes Eisen in gültiger Weise ein Prädikat ausgesagt, nämlich dessen Nicht-Existenz. Wenn aber vom hölzernen Eisen eine gültige Aussage gemacht werden kann, dann muss es tatsächlich in irgendeiner Weise etwas „geben“, das ein hölzernes Eisen ist – und schon haben wir einen „unmöglichen Gegenstand“, über den sich trefflich philosophieren lässt. Wenn man hingegen diese Aussage in eine logische Formel übersetzt, ist dieser unmögliche Gegenstand weg: Eisen (x) · hölzern (x) = f, also „Die Aussage „x ist Eisen“ und „x ist hölzern“ ist für jeden Gegenstand falsch. Mit solchen fragwürdigen Nicht-ExistenzSätzen lässt sich tatsächlich ein ganzes Universum mit unmöglichen Entitäten bevölkern. Dass sich hinter dieser Formalisierung freilich ein reales Problem verbirgt, sei hier wenigstens angemerkt. 3. Popper gegen Habermas 1970 erschien in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ ein briefliches Interview von Karl Popper über den Stand der (deutschen) Philosophie. Es ging damals um den „Positivismusstreit“ und um die Publikation mit dem gleichen Titel, in der auch ein Beitrag Poppers gedruckt wurde. Dieser Text ist heute in Poppers Buch „Auf der Suche nach einer besseren Welt“ (2006) leicht zugänglich. Die philosophischen Gründe der Kontroverse sind hier nicht wichtig – es geht in unserem Zusammenhang um Wissenschaftssprache und Wissenschaftsethos. Dazu schreibt Popper (2006, 103): „Was ich oben […] die Sünde gegen den heiligen Geist genannt habe – die Anmaßung des dreiviertel Gebildeten –, das ist das Phrasendreschen, das Vorgeben einer Weisheit, die wir nicht besitzen. Das Kochrezept ist: Tautologien und Trivialitäten gewürzt mit paradoxem Unsinn. Ein anderes Kochrezept ist: Schreibe schwer verständlichen Schwulst und füge von Zeit zu Zeit Trivialitäten hinzu. Das schmeckt dem Leser, der geschmeichelt ist, in einem so ‚tiefen’ Buch Gedanken zu finden, die er schon selbst gedacht hat.“ Ich stelle die Formulierungen Habermas’ und die „Übersetzungen“ Poppers in einer Tabelle zusammen: Habermas Die gesellschaftliche Totalität führt kein Eigenleben oberhalb des von ihr Zusammengefassten, aus dem sie selbst besteht. Sie produziert und reproduziert sich durch ihre einzelnen Momente hindurch. So wenig jenes Ganze vom Leben, von der Kooperation und dem Antagonismus des Einzelnen abzusondern ist, so wenig kann irgendein Element auch bloß in seinem Funktionieren verstanden werden ohne Einsicht in das Ganze, das an der Bewegung des Einzelnen selbst sein Wesen hat. System und Einzelheit sind reziprok und nur in der Reziprozität zu verstehen. Adorno begreift die Gesellschaft in Kategorien, die ihre Herkunft aus der Logik Hegels nicht verleugnen. Er begreift Gesellschaft als Totalität in dem streng dialektischen Sinne, der es Popper Die Gesellschaft besteht aus den gesellschaftlichen Beziehungen. Die verschiedenen Beziehungen produzieren irgendwie die Gesellschaft. Unter diesen Beziehungen finden sich Kooperation und Antagonismus; und da (wie schon gesagt) die Gesellschaft aus diesen Beziehungen besteht, kann sie von ihnen nicht abgesondert werden; aber das Umgekehrte gilt auch: Keine der Beziehungen kann ohne die anderen verstanden werden. (Wiederholung des Vorhergehenden.) Adorno verwendet eine an Hegel erinnernde Ausdrucksweise. Er sagt daher (sic) nicht, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile; verbietet, das Ganze organisch aufzufassen nach dem Satz: Es ist mehr als die Summe seiner Teile; ebensowenig aber ist Totalität eine Klasse, die sich umfangslogisch bestimmen ließe durch ein Zusammennehmen aller unter ihr befassten Elemente. die Totalität der gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge ... Theorien sind Ordnungsschemata, die wir in einem syntaktisch verbindlichen Rahmen beliebig konstruieren. Sie erweisen sich für einen speziellen Gegenstandsbereich dann als brauchbar, wenn sich ihnen die reale Mannigfaltigkeit fügt. ebensowenig ist (sic) das Ganze eine Klasse von Elementen. wir alle stehen irgendwie untereinander in Beziehung ... Theorien sollten nicht ungrammatisch formuliert werden; ansonsten kannst du sagen, was du willst. Sie sind auf ein spezielles Gebiet dann anwendbar, wenn sie anwendbar sind. Poppers Text ist zweifellos in einer Situation der wissenschaftlichen Kontroverse entstanden und hat durchaus emotionelle Züge. Dennoch gehören seine Umformulierungen zu einer Ethik der Wissenschaftssprache, die durchaus dem neopositivistischen Ideal entspricht – und damit Wittgensteins Forderung nach einer klaren Sprache. Nur ist gerade dieses Beispiel besonders deutlich, weil sich in den Umformulierungen nichts anders als eine Menge von trivialen Aussagen zeigt – Aussagen, die zwar richtig sind, aber eben keinen Erkenntnisgewinn und Erkenntnisfortschritt bringen. Popper war zweifellos kein Neopositivist, aber seine Vorstellung von einer verbindlichen Wissenschaftssprache entspricht ebenso zweifellos der neopositivistischen Sprachethik und belegt damit deutlich ihre Geltung über den Neopositivismus hinaus. 4. Die Sprache der Postmoderne Was ist die Postmoderne? Der Aufsatz von Wolfgang Welsch (1988) „Postmoderne“ beginnt damit, dass dieser Begriff in vielerlei Hinsicht schillernd und umstritten ist: umstritten hinsichtlich seiner Legitimität („Reklamerummel profilierungssüchtiger Modepropheten“), umstritten hinsichtlich seines Anwendungsbereichs (Literaturwissenschaft, Architektur, Malerei, Soziologie, Philosophie, Theologie, bis hin zum postmodernen Reisen und postmodernen Patienten), umstritten hinsichtlich seiner zeitlichen Festlegung (50er-Jahre in den USA, ab 1975 in Europa, 1874 nach Toynbee, aber möglicherweise schon bei Homer und Aristoteles), umstritten hinsichtlich seiner Inhalte (neue Technologie, grün-ökologischalternativ, neuer Mythos, Pluralisierung und Fragmentierung, Absage an die Vernunft usw.). Da ist es vielleicht einfacher, vom Gegenbegriff der „Moderne“ auszugehen. Gemeint ist die Moderne der 60er-Jahre, die heute schon klassisch erscheint. Das was war diese „Moderne“? Auch in ihr gab es vielfältige Tendenzen und Motive (sie war aufklärerisch, humanistisch, utopisch, aber auch destruktiv, anarchistisch und totalitär). Es wäre leicht, wenn man mit Moderne die Aufklärung, mit Postmoderne die Gegenaufklärung verbinden könnte, doch das wäre nur ein Wiederaufguss des alten Gegensatzes Rationalismus – Irrationalismus. Immerhin scheint es so etwas wie eine „verbindliche Grundformel“ zu geben: „Postmodernes liegt dort vor, wo ein grundsätzlicher Pluralismus von Sprechern, Modellen, Verfahrensweisen praktiziert wird, und zwar nicht bloß in verschiedenen Werken nebeneinander, sondern in ein und demselben Werk, also interferentiell.“ (Welsch 1988, 15) Da zeigt sich dann doch, dass Gegenaufklärung und Irrationalismus begrifflich nicht so fern liegen. Es zeigt sich auch, dass dieser grundsätzliche Pluralismus für die Wissenschaftssprache ein ebenso grundsätzliches Problem ist, denn in der Wissenschaft – jedenfalls in einer Wissenschaft, die am Exaktheitsideal und am Verbindlichkeitsanspruch der Naturwissenschaft festhält – ist ein solcher Pluralismus fehl am Platz, gehören doch Intersubjektivität und feststehende Modelle und Verfahrensweisen zum unbestritten Bestand neuzeitlicher Wissenschaft. Andernfalls ginge es zu wie bei den mittelalterlichen Alchimisten, wo die Intersubjektivität nicht wichtig war: „Das ist eben dein Schwefel, bei meinem Schwefel geht das Experiment ganz anders aus.“ Kann es also überhaupt eine postmoderne Wissenschaftssprache geben? Immerhin gibt es genug postmoderne Texte, die sich wenigstens den Anschein von Wissenschaftlichkeit geben (und jedenfalls nicht der schönen Literatur angehören, wobei man gelegentlich im Zweifel sein könnte). Man könnte natürlich den Pluralismus selbst zur kanonischen Methode des Postmodernismus erheben, doch auch damit ist das Konzept einer Wissenschaftssprache, so wie es exemplarisch am Neopositivismus gezeigt wurde, nicht mehr erfüllbar. Beispiele postmoderner Sprache hat Klaus Laermann (1986) zusammengetragen. Eines davon ist der folgende Text: Die versuchsweise praktizierte Textgnosis (...) ersetzt die Konsumtionshypostasierung – Vorgabe der Nachträglichkeit der Sättigungsataraxie (‚voluptative’ Erschöpfung) als Subjektivitätsautonomie (das also war es/das also bin ich) durch die reproduktivproduktive Einlassung in den gebrochenen Produktionsgrund (Atopie der ‚Einbildungskraft’ o.a.) selber. Es handelt sich um einen Text über den Schriftsteller Franz Kafka. Zunächst ist es notwendig, sich über die verwendeten Fremdwörter zu informieren, also: Gnosis = Erkenntnis, Konsumption = Konsumtion = Wertverminderung, Wertvernichtung, Verbrauch, Auszehrung, Hypostasierung = Verselbstständigung, Personifizierung, Ataraxie = Gleichmut, Unerschütterlichkeit, voluptativ kennt mein Fremdwörterbuch nicht, nach der Wortbildung müsste es ungefähr „die Begierde betreffend“ bedeuten, Atopie kennt mein Fremdwörterbuch ebenfalls nicht; nach dem altgriechischen atopia könnte es „das Ungewöhnliche, die Seltsamkeit, Wunderlichkeit, der Widerspruch“ sein – mein Wörterbuch fügt noch „wohl auch Scheußlichkeit“ hinzu, es wird doch nicht die Scheußlichkeit der Einbildungskraft gemeint sein. Die Abkürzung o.a. bedeutet normalerweise „oben angeführt“ – hier passt „oder anderes“ besser. Es gibt frei schwebende Verständnispartikel, derart etwa, dass dem Ausleben einer Begierde Erschöpfung und Sättigung folgt, dass diese Erschöpfung und Sättigung ein (metaphorisch formuliert) persönlich-körperlicher Zustand ist, dass das zugleich auch eine Art von Auszehrung ist und dass das alles nicht richtig funktioniert, sodass es besser ist, den Text Kafkas versuchsweise dadurch zu erkennen, dass man auf seine Produktionsbedingungen Rücksicht nimmt. Das kann ja nie schaden. Aber vielleicht ist es auch ganz anders gemeint, denn so einfach wird es doch nicht gemeint sein. – Ein weiteres Beispiel postmoderner Wissenschaftssprache: Der Phallus Phi steckt hinter dem Phantasma, das eine notwendige imaginäre Formation des Begehrens ist. Der Phallus bedeutet das Pulsieren vom Objekt zum Subjekt und umgekehrt, die doppelte Bewegung des Symbols. Er bezeichnet den Ort des Lusterlebens und der Produktion bzw. des Verlustes. Er ist nicht mit dem einzigen Zug identisch zu setzen, obwohl er es auch sein kann. Die Dominanz des einzigen Zuges im Diskurs bedeutet die Verfügung über den Phallus als Usurpation. Eine oberflächlich pornografische Lesart liegt nahe: Der Phallus bewegt sich vom Objekt zum Subjekt und wieder zurück und ist der Ort des Lusterlebens. Dass die Sache nicht mit einem einzigen Zug erledigt ist, scheint auch verständlich zu sein. Aber es geht ja gar nicht um einen realen Phallus, sondern um den Phallus Phi, der noch dazu hinter einer („notwendig imaginären“) Erscheinung steht, nämlich dem Begehren. Das kann man nur im Hinblick auf die Philosophie von Jacques Lacan verstehen. Dort bedeutet der Phallus Begehren, aber eben nicht nur, sondern auch dessen transzendentes Zeichen. Der Zug des Phallus (ob einfach oder mehrfach) findet im Diskurs statt. Was unter „Diskurs“ gemeint ist, ist umstritten; die wissenschaftliche Literatur dazu ist kaum übersehbar. In diesem Zusammenhang scheint mir die Bedeutung als „machtbestimmte Rede“ naheliegend, also sagen wir gleich: Verfügung über das Rederecht. Der Titel des zitierten Werkes „Diskurs und Macht“ passt dazu recht gut. Dass zum Rederecht auch Macht gehört oder dass das Rederecht ein Teil oder eine Folge der Macht ist, scheint verständlich zu sein. Aber so einfach darf man es wohl doch nicht nehmen, denn eine solche Aussage ist auch ohne Bezug auf einen Phallus verständlich, und schon gar auf einen Phallus Phi, wo das Phi „irgendwie“ als Symbol verstanden werden muss. Fazit: auch eine „sympathische“, einfühlende Interpretation des Texts gelingt nicht ohne Einmündung in Trivialitäten. 5. Die Sprache der modernen Linguistik Die heutige Wissenschaft macht es und oft nicht leicht: Wissenschaftliche Erkenntnis wird zwar erklärungsmächtiger, aber dadurch immer komplexer. Von der klassischen Mechanik zur Quantentheorie, von Newtons Welt zu Einsteins Welt: Das ist ein Weg, auf dem es kein Zurück gibt. Auch in der modernen Sprachwissenschaft zeigen sich ähnliche Tendenzen, obwohl man hier manchmal am Fortschritt der Erklärungsmächtigkeit zweifeln könnte. Dazu nun ein letztes Beispiel, zwei Textausschnitte aus einem Buch über einen Bereich der neueren Sprachwissenschaft (Grewendorf 2002, S. 142f und 99): Die Beispiele in (52a) und (53a) zeigen, dass die jeweiligen Anaphern in ihrer Basisposition vom Matrixsubjekt bzw. Matrixobjekt nicht in Übereinstimmung mit Prinzip A der Bindungstheorie gebunden sind. An den Beispielen in (52b) und (53b) sieht man, dass diese Anaphern in der eingebetteten SpecCP-Position für die erforderliche Bindung durch das entsprechende Matrix-Antezedens zugänglich sind. Die Beispiele in (52c) und (53c) zeigen, dass die in der w-Phrase enthaltenen Anaphern das Matrixsubjekt bzw. Matrixobjekt als lizenziertes Antezedens haben können, obwohl sie weder in ihrer Oberflächenposition von diesem c-kommandiert sind noch in ihrer Basisposition von diesem korrekt gebunden sein können. Unter der Annahme, dass Prinzip A der Bindungstheorie in jedem Stadium einer Derivation erfüllt werden kann (Belletti/Rizzi 1988, Grewendorf/Sabel 1999), muss man, um (52c) und (53c) erklären zu können, annehmen, dass die vorangestellten w-Phrasen in (52c) und (53c) durch die intermediäre SpecCP-Position bewegt worden sind und dass die Anaphern (wie in (52b) und (53b)) in dieser Position Prinzip A erfüllt haben. Der Text ist für den Laien unverständlich. Aber er ist in Ordnung! Nur muss man wissen, was folgende Ausdrücke bedeuten: Anaphern, Basisposition, Matrixsubjekt, Matrixobjekt, Prinzip A der Bindungstheorie, eingebettete SpecCP-Position, Bindung, Antezedens, w-Phrase, lizenziert, c-kommandiert, Derivation, intermediäre SpecCP-Position, bewegen/Bewegung. Ich werde hier nicht versuchen, diese Ausdrücke zu erläutern. Das ist nicht notwendig, denn selbst wenn man diese Fachbegriffe nicht kennt, ist die Argumentationsfigur klar: Grundsatz: Anaphern müssen theoriegerecht gebunden sein. Einzelfall: Es gibt eine spezifische Form der Abweichung. Folgerung: Eine theoriekonforme Lösung muss gefunden werden. Ergebnis: Die theoriekonforme Lösung ist die Annahme einer intermediären SpecCPPosition. Die Sprache in diesem Textabschnitt ist klar, eindeutig und dem Umfang der Argumentation angepasst. Es wird Bezug auf Beispielssätze genommen (mit den eingeklammerten Zahlen) und es wird die relevante Fachliteratur zitiert. So soll Wissenschaftssprache sein. Aber es geht auch (im gleichen Werk) anders: Die Suche nach Erklärungsadäquatheit hat die Theoriekonstruktion des Prinzipien- und Parameteransatzes methodologisch dominiert. Zwar wurden andere Kriterien der Theorienbewertung wie z.B. Einfachheit, Eleganz und Natürlichkeit in der Prinzipienund Parametertheorie keinesfalls ignoriert, sie spielten jedoch gegenüber dem Kriterium der explanativen Adäquatheit lediglich eine untergeordnete Rolle. Diese Situation erfuhr mit der Formulierung des minimalistischen Programms eine entscheidende Änderung. Vor dem Hintergrund der Prämisse, dass Platons Problem mit dem Prinzipien- und Parameteransatz im Wesentlichen gelöst war, verlagerte sich das theoretische Interesse auf die Frage, welches der verschiedenen denkbaren Prinzipien- und Parametermodelle unter dem Gesichtspunkt konventioneller Theorienbewertung das adäquateste ist. Theoretische Adäquatheit ist daher im minimalistischen Programm nicht mehr nur eine Frage der explanativen Adäquatheit, sondern ganz entscheidend auch eine Frage anderer wissenschaftstheoretischer Adäquatheitskriterien wie z.B. Allgemeinheit, Einfachheit, Natürlichkeit und Eleganz (cf. Epstein/Hornstein 1999, Hornstein 2001). Auch hier werde ich nicht versuchen zu erklären, was der Prinzipien- und Parameteransatz (PP) und das minimalistische Programm (MP) ist. Platons Problem bezieht sich auf die Möglichkeit des Lernens überhaupt: Ein Mensch kann unmöglich suchen, was er nicht weiß, denn er weiß ja dann auch nicht, was er suchen soll (Menon 80e). Hier geht es um die Möglichkeit des Spracherwerbs, und wir vertrauen dem Autor, dass PP dieses Problem gelöst hat. Den Aufbau dieser Argumentation kann man ganz einfach rekonstruieren: Grundsätze: 1. Die Theorie des Prinzipien- und Paramenteransatzes (= PP) ist erklärungsadäquat. 2. Im minimalistischen Programm (=MP) ist PP enthalten. Forderung: MP muss mehr leisten können als (nur) PP. Folgerung: MP muss auch andere Adäquatheitskriterien erfüllen. So einfach ist das. Weil die Grundsätze schon vorher dargestellt wurden und an der Stelle der aktuellen Argumentation als bekannt vorauszusetzen sind, ist die gemeinte Aussage: „Wenn MP besser sein soll als PP, muss es auch andere Adäquatheitskriterien erfüllen.“ Von diesen anderen Adäquatheitskriterien werden Allgemeinheit, Einfachheit, Natürlichkeit und Eleganz beispielhaft genannt (und nicht begründet, sondern nur durch Autoritäten eingeführt). Der ganze Absatz reduziert sich auf eine sehr einfache Aussage. Man könnte versuchen, diese einfache Aussage wieder in den Linguistenjargon zu übersetzen, aber das scheint nicht so recht zu gelingen: „Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheim gegeben, wird für keinen Dienst auf Erden taugen …“ (nicht Platon, sondern Platen). Die wissenschaftssprachliche Problematik kann hier nicht einfach durch ein Schlagwort bezeichnet werden. Zweifellos ist es wichtig, überflüssige Information (Redundanz) zu vermeiden, doch es geht um mehr, um die genaue Darstellung der zugrunde liegenden oder ausgeführten Argumentation: Von welchen Gesetzen wird ausgegangen? Welche Prämissen sind noch wichtig? Wie ordnet sich der dargelegte Einzelfall in diese Gesetzlichkeiten ein? Nur so kann geprüft werden, ob die Folgerung den Kriterien der wissenschaftlichen Gemeinschaft entspricht. Das gilt für argumentative und explanative (erklärende) Texte. Für Beschreibungen (deskriptive Texte) gelten ähnliche Regeln, die ebenso in der wissenschaftlichen Gemeinschaft vereinbart sind oder konventionell gelten. Ein einheitliches Beschreibungsverfahren führt innerhalb einer funktionierenden Forschergemeinschaft auch zu einer weitgehend einheitlichen sprachlichen Darstellung. Dazu gehören zB. auch die Forderungen, dass man sich zu einem verbindlichen Instrumentarium verpflichtet (die Genauigkeit und der Beobachtungsbereich von Messgeräten muss eingehalten werden) und dass man die Kategorie der beobachteten Daten respektiert (und etwa Artefakte ausschließt). Mit dem Elektronenmikroskop sieht man etwas ganz Anderes als mit einem optischen Mikroskop, selbst wenn es sich um das gleiche Objekt handelt. Das alles entspricht einem geregelten Verfahren, das der wissenschaftlichen Öffentlichkeit sprachlich vermittelt wird (und auch sprachlich kritisiert werden kann). Wenn man diesen ganzen Komplex von Wissenschaftssprache und Wissenschaftlichkeit auf einen gemeinsamen, alle Faktoren umfassenden Begriff bringen will, dann bietet sich nur der Ausdruck „Wahrheit“ an. Darunter darf man natürlich nicht eine absolute Wahrheit verstehen, die außerhalb des menschlich Erkennbaren bestehen mag, sondern die Summe gemeinschaftlicher Forschungspraxis und wissenschaftlicher Erkenntnis, sei sie auch noch so unvollkommen und unvollständig. 6. Die Einheit der Wissenschaft und die Einheit der Wissenschaftssprache Zur Forderung nach Klarheit, Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Begriffe kommt also noch die Forderung nach wissenschaftlicher Wahrheit in dem hier eingeführten Sinn dazu. Harald Weinrich (1993) hat anhand des Aufbaus eines wissenschaftlichen Aufsatzes vier solcher Wahrheiten unterschieden: Referenzwahrheit (Übersicht über den Stand der Forschung), Protokollwahrheit (Verlauf und Einzelergebnisse der Forschungsarbeit), Dialogwahrheit (argumentative Wahrheit in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung) und Orientierungswahrheit (Ausblick auf künftige Forschungen im betreffenden Gebiet). Diese Wahrheiten versteht Weinrich als kommunikative Wahrheiten, also nicht als Verhältnis zwischen einem Menschen und einer Sache, sondern als sprachliche Aushandlungsschritte innerhalb einer Forschergemeinschaft (Weinrich 1993, 120). Es bleibt noch die Frage, ob es wesentliche Unterschiede zwischen den Wissenschaften gibt, die dem Konzept einer einheitlichen Wissenschaftssprache entgegenstehen – eine Frage, die man nicht in wenigen Zeilen beantworten kann. Schon aus dem oft heftig ausgetragenen Gegensatz zwischen Psychoanalyse und (behavioristischer) experimenteller Psychologie ergibt sich, dass unüberbrückbare wissenschaftliche Unterschiede auch zwischen benachbarten Wissensgebieten bestehen können. Weinrich (1993, 126) bekennt sich zu einer einheitlichen wissenschaftlichen Sprachkultur und erfüllt damit die Forderungen des neopositivistischen Wissenschaftskonzepts, vielleicht ohne es zu wollen. Nur geht es ihm nicht um eine Leitwissenschaft wie Physik, Mathematik oder Logik, sondern um eine Einheitlichkeit der Kommunikationspraxis, also um so etwas wie eine ideale wissenschaftliche Kommunikationsgemeinschaft – ein Gut, das man nicht bedenkenlos preisgeben sollte. So gesehen sind wissenschaftlicher Ethos und sprachlicher Ausdruck zwei Seiten eines Blattes, und die Ordnung der Sprache mit ihren Prinzipien Klarheit, Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Wahrheit ist der Ausdruck wissenschaftlicher Redlichkeit. 7. Bibliografischer Nachtrag Wegen des beschränkten Platzes konnte ich nur auf einige wenige Aspekte des Themas eingehen, deshalb hier einige weiterführende Literaturhinweise. Den Hintergrund der Kontroverse zwischen Carnap und Heidegger stellt Friedman (2004) dar. Die wissenschaftstheoretischen Hintergründe erläutert übersichtlich Zeidler (2000), die Philosophie des Neopositivismus beschreibt Haller (1993). Ein Plädoyer für Heidegger unternimmt Mittelstraß (2000, 17ff), einige (recht instruktive) Spottverse hat Gelfert (1999, 41) gedichtet. Sehr empfehlenswert sind die Zusammenstellung der Prinzipien einer optimalen Sprache für das Denken von Meixner (1988) und die Überlegungen zu den humanwissenschaftlichen Fachsprachen von Fricke (1986). Die Bibliografie von Kretzenbacher (1992) sollte aktualisiert werden. Literatur: Carnap Rudolf: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: Schleichert (1975), 149-171 (Original 1931) Fricke Harald: Zur gesellschaftlichen Funktion humanwissenschaftlicher Fachsprachen. In: Theo Bungarten [Hg]: Wissenschaftssprache und Gesellschaft. Hamburg: Edition Akademion 1986, 62-75 Friedman Michael: Carnap Cassirer Heidegger. Frankfurt/Main: S. Fischer 2004 Gelfert Hans-Dieter: Vor dem Ges(chwa)etz. In: Wolf-Dieter Narr, Joachim Stary [Hgg]: Lust und Last des wissenschaftlichen Schreibens. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1999, 36-43 Grewendorf Günther: Minimalistische Syntax. Tübingen: Francke 2002. Hahn Hans: Überflüssige Wesenheiten (Occams Rasiermesser). In: Schleichert (1975), 95116 (Original 1930) Haller Rudolf: Neopositivismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1993 Heidegger Martin: Was ist Metaphysik? Frankfurt/M.: Klostermann 1965 (9. Aufl., Original 1929) Kretzenbacher Heinz L: Wissenschaftssprache. Heidelberg: Groos 1992 Laermann Klaus: Lacancan und Derridada. Kursbuch 84, 1986, 34-43 Luhmann Niklas: Unverständliche Wissenschaft. In: Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 3. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005 (4. Aufl.), 193-201 Meixner Uwe: Optimale Sprache für das Denken. In: Jürgen Mittelstraß [Hg]: Kongreß Junge Wissenschaft und Kultur: Wohin geht die Sprache? Wirklichkeit – Kommunikation – Kompetenz. Essen: Hanns Martin Schleyer-Stiftung 1989 Mittelstraß Jürgen: Über philosophische Sprache. Bonn: Bouvier 2000 Popper Karl R.: Auf der Suche nach einer besseren Welt. München Zürich: Piper 2006 (14. Aufl.) Schleichert Hubert [Hg]: Logischer Empirismus – der Wiener Kreis. München: Fink 1975 Weinrich Harald: Wissenschaftssprache, Sprachkultur und die Einheit der Wissenschaft. In: Herbert Mainusch, Richard Toellner [Hgg]: Einheit der Wissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag 1993, 111-127; auch in: Heinz L. Kretzenbacher / Harald Weinrich [Hgg]. Linguistik der Wissenschaftssprache. Berlin New York: de Gruyter 1995, 155-174 Welsch Wolfgang: „Postmoderne“ [–] Genealogie und Bedeutung eines umstrittenen Begriffs. In: Peter Kemper [Hg]: „Postmoderne“ oder Der Kampf um die Zukunft. Frankfurt/Main: S. Fischer 1988, 9-36 Zeidler Kurt Walter: Prolegomena zur Wissenschaftstheorie. Würzburg: Königshausen & Neumann 2000

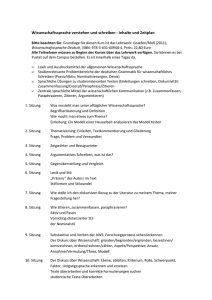
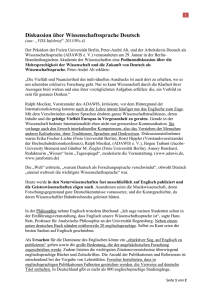
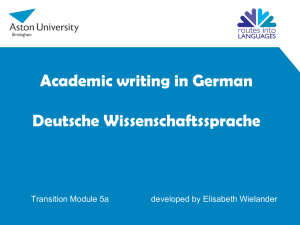
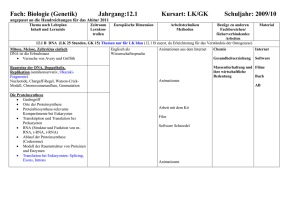
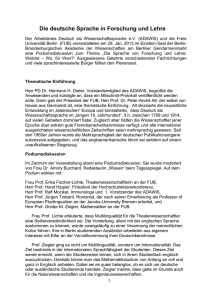
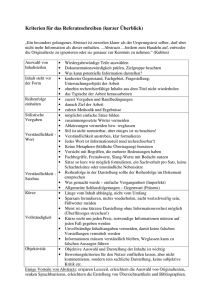

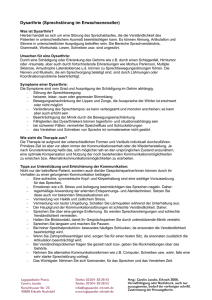
![CE_15_Adhärenz-Patientfaltblatt_Ö_44,1x2[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/006654039_1-e3539b5d45b0afb0b5169b05c3c6b1ad-300x300.png)

