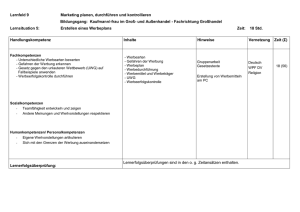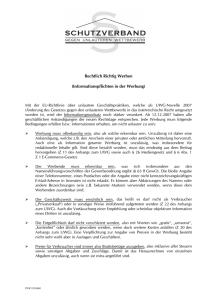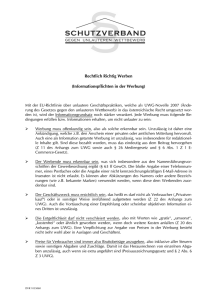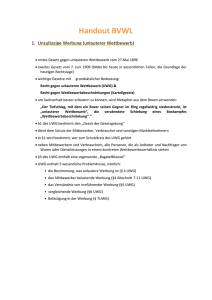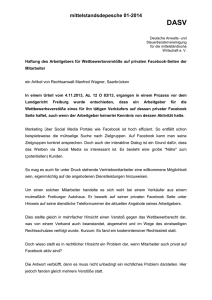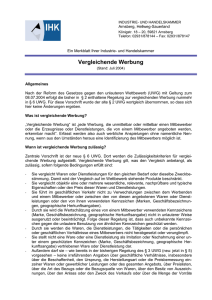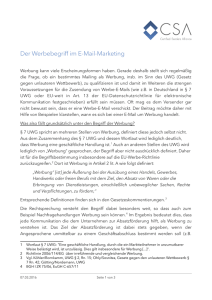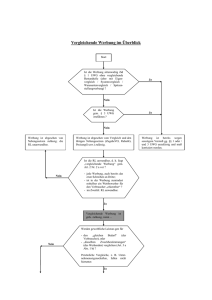Vorlesung als rtf-Datei - www2.inf.h
Werbung

B2B Marketing - Gewerblicher Rechtsschutz Zurück zur Übersichtsseite Vorlesung als rtf-Datei Zur Auswahl einzelner Teile des Skripts klicken Sie bitte links auf die runden Buttons. Prof. Dr. Sayeed Klewitz-Hommelsen Für Rückfragen sollten Sie im Betreff unbedingt das Schlüsselwort: b2b-marketing verwenden. Wesentliche Teile dieses Skriptums basieren auf einem Skript von Frau Prof. Dr. Fahrenhorst, das diese mir freundlicherweise für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. 1. Einführung 1.1 Überblick Überblick - Semester Welche Prozesse interessieren 1.2 Überblick über die Rechtsmaterie Handelsrecht Kartellrecht Unlauterer Wettbewerb Markenrecht Urheberrecht Patentrecht Sonstige Schutzgesetze Allgemeines (Kaufmann, Firma, Handeslregister, Prokura) Sonderregelungen für Kaufleute Firmenzusammenschlüsse Preisabsprachen Kooperationen die guten Sitten im Wettbewerb HGB Kartellgesetz (GWB) UWG Besondere Vorschriften im Wettbewerbsrecht (Domainnamenschutz) Schutz von persönlichen Schöpfungen Leistungsschutzrechte Allgemeines Entwicklungen bei der EU Gebrauchs- und Geschmacksmuster Halbleiterschutzgesetz Verbraucher-schutzre BGB (Fernabsatz, AGB) cht und Nebengesetze Verbraucherkreditgesetz MarkenG UrhG PatG (GebrMG) (GeschmacksMG) (HalbleiterschutzG) BGB VerbraucherkreditG 1.3 Welche Prozesse interessieren Zwei unterschiedliche Blickwinkel - Wirtschafts-/Wettbewerbsrecht als Handlungsrahmen für die eigene Tätigkeit eines Unternehmens Wirtschafts-/Wettbewerbsrecht als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Marketingstrategien Welches sind die Beteiligten an Wirtschaftsprozessen - 1.3.1 Einfaches Modell Kunde 1.3.2 Hersteller Lieferant Händler Modell mit Leistungsbeziehungen Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 1 Zahlung Kunde Hersteller Lieferant Händler Lieferung 1.3.3 Zahlung Bank Transport Lieferung Modell mit der Konkurrenz Zahlung Kunde Bank Zahlung Hersteller Lieferant Händler Lieferung Transport Lieferung Konkurrent 1.3.4 Die Rechtsgebiete 1.4 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Geschäftsverkehr Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird von der Rechtsprechung als sonstiges absolutes Recht im Sinne von §§ 823 BGB ff. anerkannt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird aus Art.1 und Art. 2 GG abgeleitet und schützt die Wertschätzung der Person. Die Achtung der Individualsphäre und des Ansehens einer Person in der Öffentlichkeit verbietet es, den einzelnen gegen seinen Willen zum Objekt der öffentlichen Zurschaustellung zu machen. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 2 1.4.1 Allgemeines Persönlichkeitsrecht Recht des einzelnen auf Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit Eingriffe bedürfen einer besonderen Berechtigung z.B. Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit Individualsphäre Beziehungen des Individuums zu seiner Umwelt Eingriff bei berechtigen Interessen zulässig Privatsphäre Häuslich privater Bereich, Privatleben Eingriff nur bei besonderen überwiegenden Interessen des Eingreifers zulässig Intimsphäre Gedanken u. Gefühlswelt, innerster Perönlichkeitsbereich Absoluter Schutz 1.4.2 Fall: Falscher Schufa Eintrag Fall 2 (NJW-RR 1988, 562): B nahm bei K ein Darlehen in Höhe von DM 30 000 auf. K war berechtigt, der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung (Schufa) Daten über die Aufnahme (Kreditbetrag, Laufzeit, Ratenhöhe) und Abwicklung des Kredits zur Speicherung zu übermitteln. In der Folgezeit leistete B Ratenzahlungen von insgesamt DM 45 000; er war allerdings drei Mal mit einer Monatsrate in Verzug geraten. Danach stellte B seine Zahlungen ein. K errechnete eine Restforderung in Höhe von DM 7100. Sie kündigte den Kredit fristlos und stellte den gesamten Saldo in Rechnung. Zugleich teilte sie der SCHUFA mit, dass aus dem dem B gewährten Kredit wegen einer Forderung in Höhe von DM 7100 die Kündigung erfolgt, Mahnbescheid beantragt, Vollstreckungsbescheid ergangen und Lohnpfändung aufgrund eines gerichtlichen Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses ergangen sei. Tatsächlich wurde der von der K beantragte Mahnbescheid erlassen und dem B zugestellt, der dagegen Widerspruch erhob. Zum Erlass des Vollstreckungsbescheids und einer Zwangsvollstreckung mit Pfändungs- und Überweisungsbeschluss kam es nicht. Es erfolgte auch keine Gehaltspfändung. Auf Grund der SCHUFA-Auskunft kündigte die B-Bank die Geschäftsverbindung mit B fristlos. Die D-Bank lehnte aufgrund der bei der SCHUFA eingeholten Auskünfte einen Kreditwunsch des B ab. B verlangte von der SCHUFA Löschung der unzutreffenden Angaben. Die Löschung erfolgte. B verlangt von K Schadensersatz wegen des ihm aufgrund der unrichtigen Mitteilung an die SCHUFA entstandenen finanziellen Schadens, insbesondere im Hinblick auf die Beauftragung der Anwalts Dr. L. zwecks Löschung der unrichtigen SCHUFA-Auskunft. Zu Recht ? 1.4.3 Lösungsansatz: Falscher Schufa Eintrag (Fahrenhorst) § 824 BGB der Wahrheit zuwider Tatsachen behauptet, die geeignet sind, den Kredit des B zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen. vorsätzlich oder fahrlässig Rechtsfolge: Schadensersatz Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 3 Negativmerkmale müssen: Inhaltlich richtig und unter strikter Beachtung der Interessen des Kunden sorgfältig vorgenommen werden. § 823 I Eine Beeinträchtigung der Ehre, die Schmerzensgeld rechtfertigt, liegt nicht vor. Die Kreditwürdigkeit ist betroffen, die Ehre (persönliche Wertschätzung durch Dritte, sein gesellschaftliches Ansehen) nicht. Die Nichterfüllung kann mehrere Gründe haben, wie z.B. Zahlungsunfähigkeit oder berechtigte Einwände. Anders ist es dann, wenn der Vorwurf der schlechten Zahlungsmoral oder des Betruges gemacht wird. Auch wird ein Schmerzensgeld dann gezahlt, wenn eine schwerwiegende Verletzung vorliegt und Genugtuung durch Gegendarstellung oder Widerruf nicht zu erreichen ist. Hier liegt keine schwerwiegende Verletzung vor. Nach Löschung der unrichtigen Angaben bestehen keine Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit. Deshalb keine Schmerzensgeldzahlung. 1.5 Verfahren bei Verstößen gegen das UWG und KartG Um das Wettbewerbsrecht richtig zu verstehen, kommt es darauf an, zu verstehen, dass diese Ansprüche ausserordentlich schnell durchgesetzt werden können. Wenige Tage bis zu wenigen Stunden können im Extremfall zwischen der Feststellung des Wettbewerbsverstoß und dem entsprechenden Urteil liegen. Es gibt im gewerblichen Rechtsschutz 4 wichtige Ansprüche: - - - Unterlassungsanspruch u.U. in der Sonderform des vorbeugenden Unterlassungsanspruchs Schadensersatzanspruch (hier ist insbesondere Verschulden erforderlich) Beseitigungsanspruch Auskunftsanspruch Außergerichtliches Verfahren z.B. Unterlassungsanspruch: Abmahnschreiben: Geltendmachung des Anspruchs und Aufforderung zur Unterlassung (wichtig konkrete und klare Handlung) Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung Aufforderung zur Übernahme der Anwaltskosten aus "Geschäftsführung ohne Auftrag". Es muss deutlich werden, dass sich der Verletzer ernsthaft unterwirft. Ohne Unterwerfungserklärung erfolgt normalerweise sofort der Eilantrag (Einstweilige Verfügung) bei Gericht. Gerichtliches Verfahren: Eilverfahren (kann sehr schnell gehen): örtliche Zuständigkeit (überall dort wo der Verstoß begangen wurde, bei Verstößen im WWW also überall) Muß sehr schnell beantragt werden, weil sonst wegen des Zeitablaufs die Dringlichkeit entfällt. ohne mündliche Verhandlung möglich, dann aber Möglichkeit zum Widerspruch und Durchführung der mündlichen Verhandlung. Schutzschrift zur Hinterlegung bei Gericht, als Möglichkeit sich gegen den Erlaß ohne mündliche Verhandlung zu verteidigen. U.U. Anschließendes Hauptsacheverfahren (normaler Prozess). Soweit Ansprüche nach §§ 1 und 3 UWG geltend gemacht werden, können nur bestimmte Anspruchsteller tätig werden (vgl. § 13 Abs. 2 UWG). » Siehe auch: : Anspruchsberechtigte nach § 13 UWG 1.6 Anspruchsgrundlagen § 1 UWG Generalklausel Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 4 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. § 3 UWG Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs über geschäftliche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung einzelner Waren oder gewerblicher Leistungen oder des gesamten Angebots, über Preislisten, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte irreführende Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden. Angaben über geschäftliche Verhältnisse im Sinne des Satzes 1 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung. 1.6.1 Die Generalklausel § 1 UWG § 1 UWG enthält die Generalklausel des Wettbewerbsrechts. Voraussetzungen: im geschäftlichen Verkehr: ist weit zu verstehen und grenzt gegen die rein private oder hoheitliche Betätigung ab. Gemeint ist jede Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks, gleich ob eigener oder fremder. Hoheitliches Handeln scheidet aus, wenn es in der Umsetzung von Rechtsnormen erfolgt. Anders, wenn der Staat in gleichordnung mit anderen Unternehmen im Markt agiert. Vereine, die um Mitglieder werben, handeln im geschäftlichen Verkehr, wenn Sie vergleichbare Leistungen wie private Anbieter offerieren. zum Zwecke des Wettbewerbs: objektiv: Geeignetheit zur Förderung eigenen oder fremden Wettbewerbs zum Nachteil eines anderen. Der Begriff wird weit verstanden. subjektiv: Kenntnis der wesentlichen Umstände, es muss sich nicht um die Hauptmotivation handeln. Subektive Seite wird in der Regel bei Vorliegen der objektiven Eignung vermutet. Sittenwidrigkeit: Interessenabwägung zwischen der inkriminierten Handlung und dem Schutz des Leistungswettbewerbs. Umfang im wesentlichen durch die Rechtsprechung bestimmt. Sittenwidrig handelt, wer gegen das Anstandsgefühl des verständigen und anständigen Durchschnittsgewerbetreibenden oder aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Auszugehen ist zunächst von dem Gewerbetreibenden, dann von der Allgemeinheit. Sind beide nicht deckungsgleich, so ist von der strengeren Auffassung auszugehen. Auf Verschulden im Sinne des BGB kommt es beim Anspruch auf Unterlassung nicht an. Kenntnis der entscheidenden Umstände genügt (Störerhaftung). Tatbestände sind entscheidend durch die Rechtsprechung geprägt. Wettbewerbsrecht ist dem amerikanischen Case law sehr ähnlich. 1.6.2 Anspruchsgrundlage nach § 1 UWG im Detail Handeln im geschäftlichen Verkehr Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs objketive: Handlung im Wettbewerb subjektive: Handlung im Wettbewerb streitig: ob konkretes Wettbewerbsverhältnis bestehen muss Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 5 Sittenwidrigkeit Wer kann klagen (Aktivlegitimation) Unterlassungsanspruch: unmittelbar Verletzter oder Verband nach § 13 Abs. 2 UWG Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr Möglicher Schaden muss ursächlich durch Wettbewerbsverstoß verursacht sein. Schadensersatzanspruch: nur der unmittelbar Verletzte Verschulden 1.6.3 Fall: Feuer Eis und Dynamit K ist ein Werbeunternehmen, das nach seinen Angaben mit Filmtheatern aufgrund sogenannter Werbeverwaltungsverträge zusammenarbeitet. Mit diesen wird ihr gegen Zahlung eines Anteils an den mit den werbenden Kunden vereinbarten Einschaltgebühren das alleinige ausschließliche Recht übertragen, sämtliche Werbevorführungen in den Filmtheatern zu vermitteln. Deren Inhaber sind gehalten, nur die von der K zugewiesenen Werbemittel vorzuführen. Außerdem schaltet K für Markenartikelfirmen Werbefilme in den Filmtheatern. B ist die Produzentin des Kinospielfilms "Feuer, Eis und Dynamit". Der Film erzählt die Geschichte eines exzentrischen Millionärs "Sir George", der sein angeschlagenes Finanzimperium durch einen vorgetäuschten Selbstmord sanieren will. Alleinerbe solle der Gewinner eines dreitätigen Wettkampfes in verschiedenen Sportarten sein. An diesem, den Filmablauf ganz überwiegend bestimmenden sogenannten "Megathon" nehmen die drei Kinder von "Sir George" als eine Mannschaft, aber auch seine Gläubiger teil. Die Gläubiger sind bekannte Markenartikelhersteller. Das Megathon muss von Mannschaften bewältigt werden. Jeweils drei Teilnehmer bilden eine Staffel. Die Firmenteams wurden von ihren Unternehmen entsprechend ausgerüstet und sind als solche an der Ausstattung mit ihren Produkten und Werbesymbolen eindeutig erkennbar. So nimmt z.B. die Milka-Kuh, ein Chiquita-Bananen-Boot und ein Paulaner-Bierfass am Rennen teil. Außerdem werden während des Megathons und in der Rahmenhandlung Markenartikel (beispielsweise Ski, Getränke) deutlich als solche erkennbar von den Darstellern benutzt bzw. verbraucht. Unstreitig haben die Markenartikelhersteller für ihre Megathon-Teilnahme im Film ein Entgelt gezahlt (so ist z.B. in einem Zeitungsartikel von $ 150 000 Startgeld die Rede) und sich damit an den Produktionskosten beteiligt. K beanstandet das Verhalten des B als wettbewerbswidrig und nimmt sie auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Sie hat beantragt, B zu verurteilen, es zu unterlassen, den Film "Feuer, Eis und Dynamit" in Filmtheatern innerhalb der regulären Vorstellungen zur Vorführung zu bringen sowie B zu verurteilen, ihr den durch den Einsatz des Film entstandenen Schaden zu ersetzen. Zu Recht ? 1.6.4 Lösungsansatz: Fall: Feuer Eis und Dynamit Das Merkmal "zum Zwecke des Wettbewerbs" ist hier erfüllt. Es liegt eine getarnte Werbung vor. Diese ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Film ein Kunstwerk ist. Hier erfolgt nicht nur eine satirisch-kritische Behandlung des Sport-Sponsoring. Denn es wurde Geld bezahlt. Die Werbung muss kenntlich gemacht werden. Schleichwerbung ist nicht erlaubt. Aber: Die Vorführung eines Films als Kunstwerk dient auch dessen kommunikativer Vermittlung. Auch bei getarnter Werbung ist der Film deshalb nicht gemäß §§ 1, 3 UWG zu verbieten, da der Schutz des Art. 5 III GG (Kunstfreiheit) vorgeht. Art. 5 III GG: Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 6 Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Selbst wenn § 1 UWG verletzt ist, so ist ein Verbot nicht zu rechtfertigen, da das GG vorgeht. Art. 5 GG steht nicht unter einem Gesetzesvorbehalt. Die Kunstfreiheit ist jedoch nicht absolut (Trompete darf auch nicht nachts im Wohngebiet gespielt werden). Deshalb ist die Vorführung nur mit der Auflage erlaubt, das Publikum vor der Vorführung des Film auf den besonderen Werbecharakter hinzuweisen. Diese Einschränkung berührt die künstlerische Gestaltung nicht. Sie ist nur am Rande des Wirkbereichs des Art. 5 GG. (Fahrenhost) 1.6.5 Fall: Altenheim Fall 3a (nach BGH, NJW-RR 1988, 99-100): K betreibt in Berlin ein Bestattungsinstitut. B unterhält dort ein Altersheim. B lässt, ohne Anordnungen der Hinterbliebenen abzuwarten, verstorbene Heimbewohner unverzüglich von dem Bestattungsunternehmen G abholen und in dessen Leichenhalle bringen. K musste daher in mehreren Fällen, in denen er von den Angehörigen mit der Bestattung beauftragt war, sich an die Firma G wenden, damit er ihren Auftrag durchführen konnte. K trägt vor, dass das Verhalten des B ein unlauterer Behinderungswettbewerb ist. Er verlangt, dass es B unterlässt, nach Versterben eines Bewohners seines Altersheims ein Bestattungsunternehmen mit der Abholung der Leiche zu beauftragen, ohne zuvor dem Bestattungspflichtigen Gelegenheit zu geben, den Überführungsauftrag einem Bestattungsinstitut seiner Wahl zu erteilen. Die Überführung des Verstorbenen in eine Leichenhalle der Firma G könnte bei dem Bestattungspflichtigen leicht zur Folge haben, dass dieser, ohne einen Vergleich der von unterschiedlichen Bestattungsunternehmen angebotenen Leistungen anzustellen, auch alles weitere der Firma G überlässt. B sei zuzumuten, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen und abzuwarten, ob diese für die fristgemäße Überführung in eine Leichenhalle sorgten. B macht geltend, dass er lediglich seiner Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 Berliner Bestattungsgesetz nachkomme, jede Leiche innerhalb von 36 Stunden nach Eintritt des Todes in eine Leichenhalle zu überführen. Diese Frist wäre aber häufig nicht einzuhalten, wenn zunächst eine Klärung abgewartet werden müsste, wer als Bestattungspflichtiger in Betracht kommt und wem ein entsprechender Auftrag zu erteilen ist. Da ihm langwierige telefonische Ermittlungen nicht zuzumuten seien, sei er dazu übergegangen, seinen betrieblichen Ablauf zu formalisieren und zunächst die Überführung in eine Leichenhalle durch die Firma G zu veranlassen. Liegt ein Verstoß gegen § 1 UWG vor ? 1.6.6 Lösungsansatz: Altenheim In objektiver Hinsicht wird die Firma G, wenn die auf Veranlassung des Altenheims verstorbene Heimbewohner unverzüglich in ihre Leichenhalle überführt, in eine für den Abschluss von Bestattungsverträgen vorteilhafte Position gebracht. Die Schaffung dieser Situation war nach der Lebenserfahrung objektiv geeignet, den Wettbewerb der Firma G zu fördern. Für diejenigen Angehörigen, die noch keinen Bestattungsauftrag erteilt hatten, lag es schon aus Gründen der Pietät nahe, eine weitere Verlegung des Leichnams zu vermeiden und das bereits einmal tätig gewordene Unternehmen auch mit der Bestattung selbst zu beauftragen. Soweit die Angehörigen bereits Bestattungsaufträge an dritte Unternehmen erteilt hatten, konnten diese, weil die Firma G bereits die erste Überführung getätigt hatte, nicht mehr vollständig abgerechnet werden. Eine Wettbewerbsförderungsabsicht in subjektiver Hinsicht liegt jedoch nicht vor, wenn vorrangig aus anderen Gründen gehandelt wird und die Wettbewerbsförderung nur die lediglich notwendige Folge dieses - anders motivierten Handelns - ist. Hier wollte das Altenheim in erster Linie die verstorbenen Heimbewohner möglichst rasch und "komplikationslos" in eine behördlich anerkannte Leichenhalle verbracht sehen, um selbst nicht durch Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Durchführung der Bestattung betroffen und belastet zu sein. Ihr Eigeninteresse war somit bestimmend. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 7 Deshalb liegt kein Verstoß gegen § 1 UWG vor. (Fahrenhorst) 1.6.7 Fall: Gourmetsführer Fall 3b (nach BGH, NJW-RR 1998, 250ff.): K betreibt das Restaurant H in I. G ist Verleger eines "Reiseführers für Gourmets". Im Reiseführer erschien folgende Darstellung des Restaurants des H. "Immerhin. Das Ambiente stimmt noch im schönen H. Sonst nichts mehr. Das Personal in Küche und Service hat seit dem Vorjahr gewechselt. Zum schlechten. Da kann auch der traumhafte Garten keinen Trost bieten. Was, in aller Welt, in den Eigentümer gefahren sein mag, dass er eine solche Talfahrt zugelassen hat, mögen andere ergründen. Uns verging bereits bei der ersten Begegnung Konfrontation wäre der passendere Ausdruck - mit dem Kellner die Freude an dem lauen Sommerabend. Solch eine Mischung aus Inkompetenz und Frechheit erlebt der Reisende sonst allenfalls, wenn die Autopanne im Gewitter ihn unter das Dach der letzten Kneipe hat flüchten lassen. Während wir uns noch darüber wunderten, wieso pro Tisch nur jeweils eine Menü- und eine Rest-Karte zugeteilt worden war, landete der "Service" bereits den zweiten Coup. Jeder erhielt, sauber abgemessen, ein Scheibchen Butter zum Brot - so war's früher mal bei der Kinderlandverschickung. Die anschließende Bestellung kam falsch in der Küche an. Und die Weinbestellung wurde zum Abenteuer. Erst wollte man uns als Ersatz für einen ausgetrunkenen italienischen Chardonnay einen Colli Siennesi eingießen - ungefragt. Der darauf bestellte 90er Sancerre war ein 91er. Die Flasche wurde weder gezeigt noch wurden wir darauf hingewiesen. Aber der Sommelier des H war mit seinem Latein noch keinesfalls am Ende. Weil die Flasche brühwarm aus dem Keller (oder sonst woher) kam, wurde sie ins Eis gepackt, geöffnet und dann wie wild gedreht. Als wir nach einer Entsetzens-Pause um sofortige Einstellung des Rotationsverfahrens baten, erhielten wir zur Antwort: "Ach, seit 1975 sind die französischen Weine doch sowieso nichts mehr wert!" und das Flaschendrehen ging weiter.... Es wunderte uns nicht, dass zur "Trilogie vom Hummer" (es war eher eine Trilogie des Leidens, denn das Tier war winzig, hart und geschmacklos) der bestellte Salat fehlte. Er kam dann später und triefte ebenso voll billigen Essigs wie der Salat, den es zu alten Jacobsmuscheln und ur-uralten Garnelen gab. Pfui Deibel !! Das gefüllte Kaninchen danach war einigermaßen akzeptabel. Die Nudeln dazu schmeckten aufgewärmt. Der Wein hatte sich jetzt zum Eis-Wein entwickelt, aber da er sowieso mausetot war, störte auch das nicht besonders. Wen wundert's jetzt noch, dass das Dessert, ein winziges Eiskügelchen auf einer bescheidenen Apfeltorte, knapp fünf Minuten nach dem Kaffee kam. Ob wir noch einmal wiederkommen werden, wissen wir nicht. Kürte unserer Guide einen "Absteiger des Jahres", der H wäre leider Spitzenkandidat". Dieser Bericht beruhte auf dem Besuch zweier Testesser des Verlages des G im Restaurant des H, darunter der Journalist J.B., ein Freund eines Wettbewerbers des H. Nach Erscheinen des Berichts gingen die Umsatzzahlen im H um 80 % zurück. K ist empört. Er kann beweisen, dass im Bericht folgende unrichtige Tatsachenbehauptungen aufgestellt wurden: Das Personal in Küche und Service habe seit dem Vorjahr zum schlechten gewechselt, für einen ausgetrunkenen italienischen Chardonnay habe man den Testern einen nicht bestellten Colli Sienesi eingießen wollen; der daraufhin bestellte 90er Sancerre sei ein 91er gewesen, die Flasche 91er sei brühwarm gekommen, ins Eis gepackt, geöffnet und dann wie wild gedreht worden, der Kellner habe den Testern dazu erklärt, "ach, seit 1975 sind die französischen Weine doch sowieso nichts mehr wert!" und das Flaschendrehen sei weitergegangen; der servierte Hummer sei winzig, hart und geschmacklos gewesen, der Salat habe von billigem Essig getrieft, es seien zu alte Jacobsmuscheln und ur-uralte Garnelen serviert worden. Liegt ein Verstoß des G gegen § 1 UWG vor ? 1.6.8 Lösungsansatz: Gourmetsführer Hierzu führt der BGH aus: Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 8 Negative Testberichte in Restaurantführern sind zwar objektiv geeignet, den Wettbewerb der Konkurrenten zum Nachteil der Betroffenen zu fördern. Hieraus kann jedoch nicht ohne weiteres auf das Vorliegen einer entsprechenden Absicht geschlossen werden. Bei Äußerungen der Presse, die sich im Rahmen ihres Aufgabenbereichs halten, die Öffentlichkeit über Vorgänge von allgemeiner Bedeutung zu unterrichten und zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen, ist eine Wettbewerbsabsicht allein aufgrund der objektiven wettbewerbsbezogenen Eignung noch nicht zu vermuten. Im Streitfall sind keine besonderen Umstände ersichtlich, aus denen auf eine Absicht geschlossen werden könnte, den Wettbewerb anderer Restaurantbetriebe zum Nachteil des K zu fördern. Soweit eine Absicht des G zur Förderung ihres eigenen Wettbewerbs im Verlagsgeschäft in Betracht kommen könnte, kann der K keine Ansprüche geltend machen, da er insoweit nicht betroffen ist. Ein Verstoß gegen § 1 UWG durch G liegt nicht vor. (Fahrenhorst) Möglicherweise kommt allerdings eine Haftung des G für das Verhalten seiner Testesser als Beauftragte nach § 13 Abs. 4 UWG oder eine Störerhaftung der G (§ 1004 BGB) durch die Mitwirkung an einem Wettbewerbsverstoß eines der Testesser in Betracht. Allerdings kommen hiernach nur Unterlassung- und nicht Schadensersatzansprüche in Betracht. 1.7 Literatur Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht: Gesetzestexte (zum Download): http://www.juris.de/produktion/juris/WebSite/juris/Angebot/juriskostenlos/ausgewaehlteGesetze/ausge waehlteGesetze.htm http://transpatent.com/gesetze/ Bücher: Berlit, Wolfgang: Das neue Markenrecht, Verlag C.H. Beck, München 2000 Dietz, Karlheinz: Werbung, Was ist erlaubt? Was ist verboten?, 3. Aufl., wrs-Verlag, Planegg 1997 Haberstrumpf, Helmut: Wettbewerbs- und Kartellrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, München 2000, ISBN 3-406-45097-6 Harke, Dietrich, Urheberrecht: Fragen und Antworten, 11 QOL 10 Hemmer/Wüst/Walz: Immaterialgüterrecht, Februar 2002, Hemmer/Wüst Verlagsgesellschaft, Marktheidenfeld 2002 Hemmer/Wüst/Walz: Wettbewerbs- und Kartellrecht, Februar 2002, 1. Aufl., Hemmer/Wüst Verlagsgesellschaft, Marktheidenfeld 2002 Ilzhöfer, Paten-, Marken- und Urhberrecht (Theis, Computerrecht) 2. UWG 2.1 Fallgruppen Grundsätzlich versucht ein Unternehmer, den Kunden zu bewegen ein eigenes Produkt/Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Der Versuch dieser Beeinflussung etwa durch Werbung ist grundsätzlich zulässig. Das Wettbewerbsrecht regel u.a. die Grenzen der Zulässigkeit dieser Beeinflussung. Kundenbezogene Unlauterbarkeit Kundenfang Gesetzesverletzung Zwang Übertriebenes Anlocken Gefühlsbetonte Werbung Belästigende Werbung Ausbeutung Ergänzender Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz Ausbeutung des guten Rufs eines anderen Unternehmens Behinderung Absatz-, Bezugs- Werbebehinderung Preisunterbietung Mitbewerber bezogene Unlauterbarkeit Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 9 Betriebsstörung Boykott Diskriminierung Missbrauch von Marktmacht vergleichende Werbung, soweit nicht durch § 2 erlaubt Vorsprung durch Rechtsbruch Gesetzesverletzung Vertragsverletzung Beteiligung am fremden Vertragsbruch (Ausspannen) Verletzung von Preis- und Vertriebsbedingungen Maktstörung Preisunterbietung Kostenloses verteilen von Waren Einsatz von Laienwerbern Allgemeinheitsbezogene Unlauterbarkeit (vgl. Hemmer/Wüst/Walz 2002, Rz. 50) Reglemäßig liegen meherer Fallgruppen gleichzeitig vor. Die Aufzählungen sind nicht Abgrenzungen. 2.1.1 Kundenbezogene Unlauterkeit 2.1.1.1 Irreführung und Täuschung Wahrheitsgrundsatz im Wettbewerbsrecht. Irreführung kann nach § 3 UWG aber auch ergänzend auch als Täuschung nach § 1 UWG unzulässig sein. Voraussetzungen nach § 3 UWG Handeln im Geschäftlichen Verkehr Angaben über Geschäftliche Verhältnisse Irreführung in Bezug auf relevante Verkehrskreise Bedeutung der Angabe Falsches Verständnis bei nicht unerheblichem Teil des angesprochenen Verkehrskreises Wettbewerbsrechtliche Relevanz Interessenabwägung 2.1.1.2 Zwang Unlauter sind sowohl der physische (Androhung von Gewalt, Androhung von unmittelbaren Nachteilen) als auch der psychische (Aufbau von Schuldgefühlen o. psychischen Zwangslagen) Zwang. z.B. Verkäufer bringt den Kunden in eine Notlage, aus der er sich nur durch den Vertragsschluß befreien kann. Die freie Entschleißung der Kunden darf nicht durch unsachliche Beeinflussung beeinträchtigt werden, indem z.B. auf den Kunden ein zu starker psychologischer Druck ausgeübt wird. z.B. Ansprechen in psychischen Extremsituationen, Einsatz von Autoritäten.. 2.1.1.3 Herabwürdigende Werbung Sittenwidrigkeit: Interessenabwägung zwischen der inkriminierten Handlung und dem Schutz des Leistungswettbewerbs. Umfang im wesentlichen durch die Rechtsprechung bestimmt. Sittenwidrig handelt, wer gegen das Anstandsgefühl des verständigen und anständigen Durchschnittsgewerbetreibenden oder aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Auszugehen ist zunächst von dem Gewerbetreibenden, dann von der Allgemeinheit. Sind beide nicht deckungsgleich, so ist von der strengeren Auffassung auszugehen. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 10 Fall: Busengrapscher K ist ein Verband, der die Interessen der Verbraucher durch Aufklärung und Beratung wahrnimmt. B stellt Spirituosen her und vertreibt diese, darunter Brombeer- und Schlehen-mit-Rum-Likör. Die 4 x 5 cm großen Etiketten auf den 10,5 cm hohen Fläschchen sind beim Brombeerlikör mit der Bezeichnung „Busengrapscher“ und beim andren Likör mit der Bezeichnung „Schlüpferstürmer“ versehen. K sieht in der Werbung eine Verletzung des Anstandsgefühls der angesprochenen Verkehrskreise und eine Beleidigung und Herabwürdigung der Frau. Er beantragt, die Werbung zu verbieten. Zu Recht ? Lösungsansatz: Busengrapscher Hier liegt ein Verstoß gegen § 1 UWG vor. Es wird auf die durch Alkohol hervorgerufene Enthemmung auf sexuellem Gebiet abgestellt und die Frau als jederzeit verfügbar dargestellt. Dies verstößt gegen die guten Sitten. 2.1.1.4 Übermäßiges Anlocken von Kunden, Wertreklame Auch darf der Kunde nicht durch eine Zusatzleistung in seiner Entschließungsfreiheit dadurch beeinträchtigt werden, dass er sich für das Produkt aus sachfremden Motiven (um das äußerst attraktive Zusatzprodukt zu bekommen) entscheidet. Dem Kunden werden beim Nichtabschluss des Vertrages drohende Nachteile in Aussicht gestellt. Eine derartige Werbung ist auch nach dem Wegfall des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung gemäß § 1 UWG verboten. Früher wurden diese Gesichtspunkte in der ZugabenVO und dem Rabattgesetz mit geschützt. Streitig unter diesem Gesichtspunkt z.B. das Powershopping (je mehr Kunden kaufen, desto günstiger wird der Preis). Wertreklame: Wertreklame kann unter zwei Gesichtspunkten rechtswidrig sein: übertriebenes Anlocken: Der Kunde wird durch die Zuwendung so starkt in seiner Aufmerksamkeit beinträchtigt, dass es zum Vertragsschluß, weil der Kunde die Zusatzleistung möchte. psychologischer Kaufzwang: Kunde wird moralisch unter Druck gesetz, einen Vertrag zu schließen, weil Zuwendung angenommen hat. Werbegeschenke: dürfen den Rahmen kleiner Aufmerksamkeiten nicht überschreiten. Abgabe von Originalware: zulässig bei Produkteinführung (Pröbchen), unzulässig bei Verstoß gegen Leistungswettbewerb etwa massenhafte Abgabe, Umfang Deckung des Bedarfs. Unentgeltliche Beförderung von oder zum Anbieter, Übernahme der Parkkosten: Indiz für die Rechtmäßigkeit kann die Höhe der Erstattung im Verhältnis zum Wert des Einkaufs sein. Geld zurück Garantie: Kann unzulässig sein, wenn das Gesetz längere Verpflichtungen nicht zuläßt. Einsatz aleatorischer Reize: Glücksspiele (soweit zulässig), Verlosungen zulässig, soweit nicht die Kaufentscheidung an die Teilnahme gekoppelt wird oder die Gewinnmitteilung wird vom Besuch im Laden abhängig gemacht. Kopplungs- und Vorspannangebote: Grundsätzlich zulässig - unternehmerische Freiheit. Problem Kunde kann nicht mehr preiswürdigkeit der Einzelleistung bewerten. offene Kopplung: Einzelpreis und Gesamtpreis der Leistung werden transparent. verdeckte Kopplung: Kunde erfährt nur Gesamtpreis besonders problematisch, wenn unterschiedliche Leistungen gekoppelt werden (z.B. Auto und Videokamera) Vorspannangebot: Ein Angebot wird zur Förderung des anderen anderen verwendet. Unzulässig bei brachenfremden Vorspannangeboten. (Zulässig etwa Internet-Software für Internetzugang). Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 11 z.B. Ski mit Bindung und Einstellung der Bindung. Fall: Neue Zeitung Ein Verleger V bringt eine Zeitung mit redaktionellem Teil auf den Markt, die vollständig werbefinanziert ist und deshalb kostenlos verteilt wird. Ein Etabliertes Blatt D hält diese Verteilung für wettbewerbswirdrig, weil hier eine Ware verschenkt wird, die normalerweise bezahlt wird und damit dem Leistungswettbewerb zuwider unlauter gehandelt wird. V meint sein Handeln sei außerdem durch Art. 5 GG gedeckt. Lösungsansatz: Neue Zeitung Anzeigenblätter: Anzeigenblätter finanzieren sich aus den Anzeigen - zulässig. Anzeigenblätter mit redaktionellem Teil: str. ob wegen Art. 5 GG Pressefreiheit zulässig oder als Abgabe von Orignalware zur Bedarfsdeckung rechtswidrig. Mit Blick auf das Internet und dem Werbefinanzierten TV dürfte man von Zulässigkeit ausgehen müssen. Auch etablierte Anbieter von Produkten müssen sich auf geänderte Marktumstände einstellen und können nicht über das Wettbewerbsrecht, andere Vertriebsformen behindern. Vgl. OLG Köln U. v. 19.05.2000 Az. 6 U 40/2000 http://www.olg-koeln.nrw.de/home/presse/archiv/urteile/2000/6u040-00.htm Fall: Schnäppchen-Börse Fall 28 (OLG Hamburg, GRUR-RR 2001, 113): Die Firma Tschibo bietet ihre Waren u.a. auch im Internet an. Auf ihrer Homepage werden die angebotenen Waren beschrieben. Der Kunde kann seine Bestellung online aufgeben. Die Firma Tschibo betreibt im Internet auch eine sogenannte "Schnäppchen-Börse". Hierbei wird eine begrenzte Zahl von Artikeln zu reduzierten Preisen angeboten. Die Auktion ist auf eine Woche begrenzt. Die angebotenen Artikel werden täglich weiter (zu einem höheren Prozentsatz als am Vortag) reduziert. Das tägliche Angebot nennt die einzelnen Artikel und jeweils dazu den ursprünglichen Preis, den Preis von gestern, den Tagespreis (jetzt zuschlagen) sowie die Ersparnis (Sie sparen) in Prozent. Hierzu heißt es: "Spekulieren sie auf die Top-Angebote der Woche ! Zugreifen - diese Preise gibt's nur hier im Internet und nirgendwo sonst ! Und das Beste: Jeden Tag reduzieren wir den Preis noch ein bisschen mehr ! Aber Achtung: Alle Artikel gibt es nur in begrenzter Menge und höchstens eine Woche lang ! Wer länger wartet, erhöht sein Risiko, dass der Artikel ausverkauft ist". Ist dieses Vorgehen zulässig ? Lösungsansatz: Schnäppchen-Börse Das Gericht nahm hier einen Verstoß gegen § 1 UWG an. Der Verbraucher befinde sich hier in einer spekulativen Situation, die an die Börse erinnert, wobei durch bloßes Zuwarten der Anreiz einer noch größeren Preisermäßigung zunimmt. Dadurch werde die Spiellust noch verstärkt, welche noch durch das Internet erhöht wird. Hier würde der durchschnittliche Verbraucher seine Kaufentscheidung nicht mehr sachlich begründen, sondern sich vom Spielcharakter des Angebots verleiten lassen, anstatt dieses Angebot mit dem der Konkurrenz zu vergleichen und kritisch zu überprüfen. Es handelt sich um eine zugkräftige Aktion, welche erhebliche Aufmerksamkeit erregt, so dass auch die Gefahr bestehe, dass Wettbewerber diese nachahmen. Das OLG München (GRUR-RR 2001, 112) hat hingegen eine Autoauktion für zulässig erklärt, bei der der Kaufvertrag nicht bei der Auktion, sondern frühestens nach Besichtigung des Autos abgeschlossen wurde Fall: Glücksspiel Fall 27 (BGH, NJW 1989, 3014): M unterhält in der Bundesrepublik Deutschland Schnellimbiss-Restaurants. Auf Handzetteln, die sie Anfang des Jahres 1986 verteilen ließ, kündigte sie an: "McBacon Glücks-Speck-Takel ! Jede Menge McBacon-Menüs zu gewinnen und außerdem 20 mal 5000 DM". Auf der Rückseite der Handzettel befand sich ein abtrennbarer Glücks-Coupon, auf dem in zehn Feldern verschiedene Zahlen und Symbole abgebildet waren. Dazu hieß es in der Erläuterung: "Vom 1. Februar bis 1. März sind 4 Wochen lang jede Menge McBacon-Menus zu gewinnen ! Jede Woche gewinnt ein neues Glück-Symbol bzw. eine Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 12 neue Glückszahl. Welche Zahl oder welches Symbol gewinnt, finden Sie an jedem M-Restaurant am Fenster ausgehängt....Stimmt eine Zahl oder ein Symbol überein, haben Sie schon gewonnen ! Ihren Coupon geben Sie im Restaurant ab, dafür gibt's ein heißes, leckeres McBacon Menu ! Und haben Sie diesmal kein Glück gehabt, vielleicht klappt's nächste Woche. Zur Schlussverlosung am 20. März verlosen wir 20 mal 5000 DM". Das als Gewinn angebotene "McBacon-Menu" bestand aus einem Brötchen mit Fleischmasse, Käse und etwas Speck (Doppelcheeseburger mit Speck), mit einer kleinen Tüte Pommes-Frites und einer kleinen Cola. Dieser Gewinn hatte einen Wert von 6 DM. Ist diese Art der Werbung zulässig ? Lösungsansatz: Glücksspiel Sie ist nicht nach § 1 UWG schlechthin unlauter. Es liegt jedoch ein Verstoß gegen § 1 UWG vor, wenn entweder die Teilnahme am Spiel überhaupt vom Kauf einer Ware abhängig gemacht wird oder auch nur die Spiellust des Publikums so angestachelt wird, dass der Kaufentschluss nicht mehr überwiegend wegen des sachlichen Interesses an der Ware, sondern wegen der sich bietenden Spielmöglichkeit, d.h. in der Hoffnung gefasst wird, einen der ausgesetzten Preise zu gewinnen = wenn ein psychologischer Kaufzwang besteht. D.h., es erfolgt eine Einflussnahme auf die Willensentscheidung des Umworbenen mit außerhalb der Sache liegenden Mitteln, Umständen und Auswirkungen in einem solchen Ausmaß, dass der Umworbene aufgrund dessen zumindest anstandshalber nicht umhin kann, auf das Angebot einzugehen. Es liegt auch Sittenwidrigkeit vor, wenn der Kunde ohne Prüfung der Güte und Gebrauchszweck eine Ware erwirbt, um beim Spiel mitzumachen. In Fällen, in denen zur Durchführung eines Gewinnspiels ein Geschäftslokal betreten werden muss, wird auf die Teilnehmer ein rechtlich unzulässiger Kaufzwang ausgeübt. Wer ein kleines Ladenlokal betritt, rechnet damit, in unmittelbaren Kontakt mit dem Verkaufspersonal zu kommen und weiß, dass dieses ihn zunächst als Kaufinteressenten ansieht. Diese Wertschätzung wird ihm nicht mehr entgegengebracht, wenn er nur ein Gratislos kauft. Es entsteht ein Gefühl der Peinlichkeit, Deshalb erfolgt der Kauf einer Kleinigkeit. Deshalb ist eine derartige Werbung verboten. Hier liegen diese Voraussetzungen aber nicht vor. Denn der Kontakt ist anonym. Man nimmt hier nur schnelle Mahlzeiten ein. Auch gibt es eine Auswahl aus dem Gesamtangebot. Zudem werden die Besucher vom Gewinn nicht satt. Deshalb liegt ein Verstoß gegen § 1 UWG nicht vor. Fall: Auto und Notebook im Supermarkt Die Supermarktkette EDEKA beabsichtigt im Paket ein Auto, zusammen mit jeweils anderen Produkten anzubieten: einen Motorroller, einen Notebook, einen Drucker oder eine Spiegelreflexkamera. Ein anderer Einzelhändler hät das für wettbewerbswidrig, weil hier in unzlässiger Weise unzusammenhängende Leistungen gekoppelt werden und für die Kunden der Wrt der Einzelleistungen nicht klar würde. Wie beurteilen Sie diesen Fall? Lösungsansatz: Auto und Notebook im Supermarkt Das Gericht geht davon aus, dass grundsätzlich die unternehmerische Freiheit, die Möglichkeit zur Koppelung von Leistungen gewährleistet. "Die Auffassung der Kl., die Werbung der Bekl. verstoße gegen § 1 UWG, weil ein unzulässiges verdecktes Koppelungsgeschäft vorliege, trifft weder unter dem Gesichtspunkt der mangelnden Preistransparenz noch unter demjenigen des fehlenden Gebrauchszusammenhangs der jeweiligen Verkaufspakete zu." Nach ständiger Rechtsprechung können "verdeckte Koppelungsgeschäfte jedoch dann wettbewerbswidrig sein, wenn die Einzelpreise nicht bekannt sind und der Käufer sie auch nicht in Erfahrung bringen kann, weil er keinerlei Anhaltspunkte für deren Berechnung hat und er daher die Preisgestaltung des Angebotes nicht mit Konkurrenzangeboten vergleichen kann. Allerdings ist Käufern, die einen Preisvergleich vorzunehmen wünschen, auch längeres Suchen nach Vergleichsobjekten zumutbar." Das Gericht geht davon aus, dass der Verbraucher hier sich die Einzelpreise der Leistungen alle einzeln verschaffen kann. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 13 Das Gericht hält auch die grundsätzliche Fremdheit der Produkte für nicht bedenklich, da es durchaus Verbraucher geben könne, die die Waren gerade in dieser Kombination erwerben möchten (zumindest zweifelhaftes Argument) (Im konkreten Verfahren hatte nicht ein Konkurrent geklagt sondern der Hersteller des Fahrzeuges. Erfolg hatte der Antrag nicht wegen der Kopplung sondern, weil zB. nicht deutlich gemacht worden war, dass der Supermarkt nur als Vertragsmittler auftrat, bzw. dass es sich beim angebotenen Drucker um ein Auslaufmodell handelte.) vgl. OLG Karlsruhe U.v. 14.08.2001, 4 U 541/2001, http://www.kanzlei-doehmer.de/uwg1_2.htm Fall: Powershopping OBERLANDESGERICHT KÖLN, Aktenzeichen: 6 U 204/00 vom 1. Juni 2001 (http://www.netlaw.de/urteile/olgk_04.htm) B. betreibt eine Website mit Powershopping. Dabei handelt es sich um ein Vertriebssystem, bei dem Kaufinteressenten gebündelt werden und der Preis für die zu erwerbende Ware von der Anzahl der gesammelten Nachfragenden abhängig ist: Je größer die Zahl der Kaufinteressenten ist, um so niedriger liegt der von diesen für die Ware zu zahlende Preis. Die einzelnen Kaufinteressenten beteiligen sich über das Internet an dem System und kennen sich untereinander nicht notwendig. B bietet diese in unterschiedlichen Ausgestaltungen auch von Wettbewerbern betriebene System in verschiedenen Versionen an. Der K. hält die spezielle "Angebotsvariante mit verschiedenen Preisstufen" für wettbewerbswidrig. Hierbei steht die betreffende Ware nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung und wird nur innerhalb eines festgelegten Zeitraumes angeboten. Es existieren mehrere von B. vorgegebene Preisstufen, denen jeweils eine ebenfalls vorgegebene Anzahl von erforderlichen Kaufinteressenten zugeordnet ist. Jeder Teilnehmer kann grundsätzlich frei wählen, in welcher Preisstufe er sich beteiligt, und es ist ausgeschlossen, dass er einen höheren Preis als den der gewählten Stufe bezahlen muss. Nach Ablauf des Angebotszeitraumes werden alle diejenigen Kaufinteressenten nicht berücksichtigt, die eine Preisstufe gewählt haben, deren notwendige Teilnehmerzahl nicht erreicht worden ist. Andererseits wird die Ware an alle anderen Teilnehmer zu dem Preis abgegeben, der der erreichten Preisstufe entspricht. Hat also jemand die (teuerste) Stufe 1 gewählt und beteiligen sich ausreichend Interessenten z.B. für die Stufe 3, so muss auch jener Erstgenannte nur den niedrigeren Preis der Stufe 3 bezahlen. Wird die vorgesehene Teilnehmerzahl einer Preisstufe ("notwendige Einkaufsgruppengröße") vor Ablauf der Laufzeit erreicht, so wird diese Preisstufe geschlossen. Andere Interessenten können sich dann auf dieser Preisstufe nicht mehr beteiligen. Andererseits kann der einzelne Teilnehmer, wenn auch schon seine erste Beteiligung verbindlich ist, noch während der Laufzeit in eine andere noch nicht geschlossene Preisstufe wechseln. Der jeweilige aktuelle Stand des Verfahrens ist jederzeit im Internet einsehbar. Insbesondere wird dort immer und ohne zeitliche Verzögerung nach einer weiteren Beteiligung angezeigt, wie viele Interessenten sich in den einzelnen Preisstufen bereits beteiligt haben. Fall: Powershopping Auszug aus dem Urteil: Ausgangspunkt der Beurteilung ist der Umstand, dass nicht das "Powershopping"-System als solches, sondern nur die hier angegriffene konkrete Ausgestaltung in Rede steht. Dabei handelt es sich um eine besondere Version, bei der auf die dargestellte Weise nicht nur die (Kauf-) Kraft der Interessenten gebündelt, sondern darüber hinaus durch die zeitliche Befristung einerseits und die zahlenmäßige Begrenzung der Teilnehmer in den einzelnen Preisstufen andererseits ein besonderes System geschaffen wird, das ein eigenes Gepräge mit eigenen wettbewerbsrechtlichen Aspekten aufweist. Dieses System ist unlauter, weil es die Teilnehmer durch das an bestimmte Kundenzahlen gebundene Versprechen ganz erheblicher Preisnachlässe von bis zu 50 % und die Eröffnung der Möglichkeit, auf die Höhe des Preises unter spekulativen Gesichtspunkten Einfluss zu nehmen, in nicht unerheblichem Maße davon abhält, ihre Kaufentscheidung allein nach der Preiswürdigkeit der Ware zu treffen. Nach gefestigter auch jüngerer höchstrichterlicher Rechtsprechung handelt unter dem Gesichtspunkt des übertriebenen Anlockens unlauter, wer durch das Überlassen von Waren bewirkt, dass der Umworbene "gleichsam magnetisch" angezogen und so davon abgehalten wird, sich mit den Angeboten seiner Mitbewerber zu befassen (vgl. z.B. BGH Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 14 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 GRUR 98,1037 f - "Schmuck-Set"; BGH GRUR 99,261,263 - "Handy-Endpreis" und BGH WRP 99,517,518 - "Am Telefon nicht süß sein?"). Bei dem übertriebenen Anlocken handelt es sich um eine Ausprägung der Wertreklame. Diese setzt voraus, dass die Werbe- oder Anlockwirkung nicht von der beworbenen Ware selbst oder ihrem Preis, sondern von einer dem Kunden daneben zusätzlich besonders preisgünstig oder ohne Entgelt überlassenen Ware ausgeht. Ein besonders günstiges Angebot für sich genommen ist daher dann nicht unlauter, wenn die Anlockwirkung nicht von einer neben der vertriebenen zusätzlich abgegeben Ware, sondern von dem Preis für die angebotene Ware selbst ausgeht (BGH a.a.O. "Handy-Endpreis" und "Am Telefon nicht süß sein?"). Ausgehend von diesen Grundsätzen rechtfertigt allein die Preisgestaltung der Beklagten im Rahmen des angegriffenen "Powershopping"-Systems den Unlauterkeitsvorwurf nicht. Die Beklagte stellt zwar den Erwerb der angebotenen Waren für einen Preis in Aussicht, der bis zu 50 % unter dem von einem einzelnen Kunden geforderten Preis liegt, die in dieser Preisreduzierung liegende erhebliche Anlockwirkung geht aber nicht von einer zusätzlich gewährten Ware, sondern von dem - allerdings variablen - Preis für die angebotene Ware selbst aus. Kann damit die - angesichts der Höhe der Preisreduzierung sogar erhebliche Anlockwirkung für sich genommen den Unlauterkeitsvorwurf nicht rechtfertigen, so ist es doch gerechtfertigt, die besondere und unter Umständen auch besonders günstige Preisgestaltung der Beklagten in die wettbewerbsrechtliche Gesamtbeurteilung mit einzubeziehen. Tut man dies, dann erweist sich der Klagevorwurf indes als berechtigt. 2.1.1.5 Gefühlsbetonte Werbung Ansprache der Gefühle ist grundsätzlich zulässig. Grenze: Gefühl soll Kunden von der Prüfung der Ware abhalten oder hat mit der Ware nichts mehr zu tun. Die Werbung mit dem Mitgefühl ist sittenwidrig, wenn sich der Unternehmer diese Gefühle der Umworbenen für eigene wirtschaftliche Zwecke planmäßig zu Nutze macht, ohne dass ein sachlicher Bezug zu der angebotenen Leistung besteht. Als wettbewerbswidrig wurde auch angesehen: - Das Angebot von Ware bei Glaubensgenossen mit der Werbung: ...damit bezeugt Ihr die Aufrichtigkeit Eures Glaubens:10 % erhält die Kirche. - Der Unternehmer U will Abonnenten einer Zeitschrift werben. Er setzt hierbei Menschen ein, die sprachlich schwer behindert sind. Diese Werber konnten sich nur dadurch verständlich machen, dass sie dem Kunden einen Zettel mit einem Werbetext überreichten. Hier steht der Wunsch, schwer angeschlagenen Menschen zu helfen, im Vordergrund. - Die Schokoladenfirma Rittersport warb für eine Sonderedition mit sieben Schokoladensorten, die 7 gefährdeten Tierarten gewidmet waren. Die Überschrift lautete: Choc for Life. Eine Initiative von Rittersport und WWF. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, als könne durch den Kauf der Schokolade das Umweltengagement der Firma Rittersport unmittelbar gefördert werden. Dadurch wird ein neben dem Produkt liegender, rein gefühlsbetonter Kaufanreiz geschaffen. - Sondergesetzlich geregelte Ausnahme ist die Blindenwerbung. Erzeugnisse von Blinden dürfen von Haus zu Haus vertrieben werden unter Hinweis auf ihre Herstellung von Blinden. Auch der Verkauf von mit dem Mund gemalten Karten ist zulässig. Fall: Angstwerbung Liegt in folgenden Fällen eine unlautere Werbung vor ? 1. "Ich kann heute noch nicht sagen, wie die Textilpreise in den nächsten Monaten aussehen werden. Ich würde mich aber, wäre ich ein Käufer, jetzt eindecken." 2. "Aufgrund der enormen Nachfrage und der damit verbundenen Lieferschwierigkeiten empfiehlt sich ihr baldiger Besuch". Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 15 3. "Eine völlige Neuorientierung unseres Geldsystems ist bereits beschlossene Sache. Viele Vermögen und Sparguthaben werden wieder über Nacht vernichtet. Auch Ihr Geld ist in Gefahr. Denn das neue Geld ist bereits gedruckt. Geldbrief dagegen zeigt Ihnen, wie Sie Geld und Vermögen dem Strudel der kommenden Ereignisse entreißen und Ihre Habe retten können". 4. "Kaufen Sie Sachwerte...tun Sie etwas. Ihr Geld tut nämlich schon lange was. Es läuft weg". 5. "Erkältung und grippale Infekte überrollen Berlin - sofort besorgen". 6. "Kaufen Sie noch schnell Heizöl, solange es noch welches gibt. Wer weiß, wie lange die Straße von Hormuz noch befahrbar ist. Dann ist es aus". 7. "Damit Mensch und Umwelt eine Chance haben". Lösungsansatz: Angstwerbung 1. unzulässig 2. zulässig 3. unzulässig 4. zulässig 5. unzulässig (Werbung für Klosterfrau Melissengeist) 6. Unzulässig 7. Unzulässig (wurde bei der Werbung für Reinigungs- und Pflegemittel verwendet. Hier wird die unterschwellige Angst der Verbraucher vor einer weiteren Zerstörung der Umwelt geschürt; Umweltappell) Fall: Scheitern Fall 21 (OLG Köln, NJWE-WettbR-1997, 222): B versandte im August 1996 Werbeschreiben, mit denen er für sein „Handbuch für Selbständige und Unternehmer“ warb. Diese Sendungen befanden sich in Briefumschlägen mit Adresssichtfenstern, deren Vorderseite wie folgt beschriftet war: „Warnung ! Fast 50 % aller Selbständigen in Leipzig scheitern mit ihren neu gegründeten Unternehmen in den ersten drei kritischen Jahren. Sind SIE der nächste ?“ Auf der Rückseite befand sich folgender Text: „Sie können es jetzt ganz einfach vermeiden, der Nächste zu sein....(!) Denn jetzt gibt es für Sie eine neue Möglichkeit, wie Sie jederzeit über die richtigen Informationen und die notwendige Unterstützung verfügen, die gerade Sie jetzt in Ihrer kritischen Phase als Gründer brauchen....“ Liegt ein Verstoß gegen das UWG vor ? Lösungsansatz: Scheitern Hier liegt ein Verstoß gegen § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Angstwerbung vor. Der Empfänger wird durch den Text verängstigt und eingeschüchtert und veranlasst, sich dem Angebot des B in der Annahme zuzuwenden, so einen Ausweg aus der bedrohlichen Lage zu finden. Damit schafft B eine Situation, in der der Empfänger des Werbeschreibens seine Entscheidung über das Angebot nicht mehr sachlich, sondern - wenn auch teilweise unterschwellig - aus Verängstigung trifft. Es liegt deshalb eine sittenwidrige Angstwerbung vor. Der Unlauterkeitsvorwurf ist auch deshalb begründet, weil die Gefahr besteht, dass Unbefugte den Umschlag sehen und annehmen, dass der Empfänger bereits zu dem Kreis derer gehört, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Dies liegt zumindest hinsichtlich der Mitarbeiter des Betriebsinhabers nahe, die im Übrigen keineswegs immer über die wirtschaftliche Situation ihres Arbeitgebers informiert sind. Fall: Schockwerbung Fall 22 (BGH, NJW 1995, 2490; NJW 1995, 2492 etc.): Das Wollwarenunternehmen Benetton wirbt für seine Produkte mit sogenannten Schockplakaten: So werden ein Priester und eine Nonne dargestellt, die sich küssen, ein gerade geborenes Kind, eine ölverschmierte Ente, schwer arbeitende Kinder der Dritten Welt beim Hausbau etc. Der Bezug zu den Bennetton-Produkten ist nur durch den Schriftzug „United Colors of Bennetton“ erkennbar. Ist diese Art der Werbung zulässig ? Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 16 Lösungsansatz: Schockwerbung Der BGH hielt diese Art von Werbung für unzulässig, da sie mit dem Produkt selbst nichts zu tun hat. Die Werbung löse bei nicht unwesentlichen Teilen der Bevölkerung Ohnmacht und Mitleid aus. Sie soll den Betrachter lediglich schockieren. Bennetton nutzt die mit den Abbildungen vom Elend der Welt ausgelösten Wirkungen für ihre eigenen kommerziellen Interessen aus. Dies ist nach Auffassung des BGH sittenwidrig. Eine solcherart gefühlsbetonte Werbung ist nicht nur sittenwidrig, wenn sie unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit dem Waren- oder Dienstleistungsangebot des werbenden Unternehmens steht, sondern auch dann, wenn sie im wesentlichen nur zur Steigerung des Ansehens des Unternehmens bei den Verbrauchern eingesetzt wird. Zwar kann auch ein Gewerbetreibender zu den die Gesellschaft berührenden Ereignissen Stellung nehmen, und zwar unabhängig davon, ob dies zur Wahrung seiner eigenen geschäftlichen Interessen notwendig ist. Die Tatsache, dass ein Gewerbetreibender im Wettbewerb zu anderen steht, nimmt ihm nicht das Recht, sich zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen zu äußern. Anders ist es jedoch dann, wenn die Äußerung des Gewerbetreibenden zur öffentlichen Auseinandersetzung nichts beiträgt, sondern darauf abzielt, beim Verbraucher eine mit dem werbenden Unternehmen solidarische Gefühlslage zu schaffen, die der Steigerung des Ansehens des solchermaßen werbenden Unternehmens dient und damit letztlich zu kommerziellen Zwecken eingesetzt wird. Insbesondere die Werbung mit dem Aufdruck H.I.V. positiv missachtet auch die Würde des infizierten Menschen, indem AIDS-Kranke als „abgestempelt“ und damit aus der menschlichen Gesellschaft ausgegrenzt darstellt. Hier wird dem Betrachter nahegelegt, dass AIDS-Kranke wie ein geschlachtetes Tier behandelt werden (vgl. auch OLG Frankfurt, NJW-RR 1994, 945; OLG Frankfurt a.M., NJW-RR 1994, 733). Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr in seiner Entscheidung vom 12. Dezember 2000 (NJW 2001, 591) der Rechtsprechung des BGH unter Berufung auf die Pressefreiheit eine Absage erteilt. Einschränkungen der Freiheit der Meinungsäußerung bedürfen grundsätzlich einer Rechtfertigung durch hinreichend gewichtige Belange des Gemeinwohls oder schutzwürdige Belange Dritter. Dass Mitgefühl mit schwerem Leid zu Werbezwecken ausgenutzt wird, rechtfertigt einen Anspruch auf Unterlassung im Hinblick auf Art. 5 I GG nicht. Denn Gemeinwohlbelange und schutzwürdige Interessen Dritter werden nicht berührt. Ein Werbung, die inhumane Zustände und Umweltverschmutzung anprangert, fördert nicht Verrohungs- und Abstufungstendenzen. Belange anderer Wettbewerber sind ebenfalls nicht betroffen. Die produktunabhängige Imagewerbung hat sich eingebürgert, ohne dass der Leistungswettbewerb dadurch erkennbar gelitten hat. Andererseits wird die Meinungsfreiheit in schwerwiegender Weise beeinträchtigt. Auch das bloße Anprangern eines Missstandes wird – ohne dass dies zur Auseinandersetzung mit dem aufgezeigten Elend etwas beiträgt – durch Art. 5 GG geschützt. Im Hinblick auf die H.I.V.-Anzeige gilt zwar, dass eine Bildwerbung unzulässig ist, die die Würde der abgebildeten Person verletzt. Hier steht aber keinesfalls fest, dass die Anzeige als grob anstößig und die Menschenwürde verletzend anzusehen ist. Mindestens ebenso naheliegend ist die Deutung, dass auf einen kritikwürdigen Zustand – die Ausgrenzung H.I.V.-Infizierter – hingewiesen werden soll. Bei mehrdeutigen Äußerungen müssen die Gerichte sich im Bewusstsein der Mehrdeutigkeit mit den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten auseinander setzen und für die gefundene Lösung nachvollziehbare Gründe angeben. Fall: Migefühl Fall 23 (BGH, GUR 1987, 537ff.): M betreibt ein Schnellimbiss Restaurant. Er warb in einer Tageszeitung für eine „Spendenaktion zugunsten des deutschen Kinderhilfswerks“ mit der folgenden Anzeige: „McHappy-Tag ist Spendentag. Jeder X-Hamburger nur 2.- DM. Spendenaktion zugunsten des Deutschen Kinderhilfswerks. Bringen Sie viel Appetit mit. Denn der Erlös von jedem Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 17 verkauften X-Hamburger an diesem Tag wird voll als Spende an das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. weitergegeben“. Angekündigt wurden hierzu auch Clown-Vorstellungen. Ist eine derartige Werbung zulässig ? Lösungsansatz: Migefühl Es widerspricht den guten Sitten, wenn ein im Eigeninteresse handelndes gewerbliches Unternehmen zielbewusst an die Hilfsbereitschaft appelliert, ohne dass die gebotene Leistung hierzu einen Anlass gibt. Mit der streitigen Aktion wird ein Gewinnstreben verfolgt. Es handelt sich um eine Werbemaßnahme, die auf das Restaurant aufmerksam machen soll. Nicht nur der Umsatz der Hamburger, sondern auch andere Produkte sollen gefördert werden. Erwünscht ist eine Umsatzsteigerung auf längere Sicht. Wenn dieser Tag ein Verlustgeschäft ist, so spielt dies keine Rolle. Jede Gefühlswerbung ist unzulässig, die nicht im sachlichen Zusammenhang mit dem Gegenstand des Angebots steht, d.h. sachgerecht ist. 2.1.1.6 Belästigende Werbung Unternehmerische Freiheit garantiert: die Kunden über das Leistungsangebot zu informieren. Kunde hat das Recht Werbung in die Wohnung abzulehen, weil ihn dies seinem Eigentumsrecht, Recht auf Schutz der Persönlichkeit beeinträchtigen kann. Wettbewerbswidrig ist Werbung dann, wenn systematisch entgegen dem ausdrücklichen Wunsch des Kunden Werbung zugestellt wird (z.B. trotz Aufkleber wird überall Werbung eingeworfen, einmaliger Verstoß begründet noch keine Ansprüche). Hausbesuche sind grundsätzlich zulässig (Rspr.). Gezieltes Ansprechen ist unzlässig, es sei denn die äußeren Umstände legen dies Nahe (Messe). Telefaxwerbung: Grundsätzliche kein Einverständnis in diese Werbeform, also unzulässig (Kosten für den Empfänger und Blockade seines Gerätes). Emailwerbung: Grundsätzlich zur Zeit noch unzulässig. Zukünftig (Umsetzung E-Commerce RiLi, wird die Werbung zulässig sein, wenn Sie deutlich als solche im Betreff gekennzeichnet ist). Für Endverbraucher sind dann Robinsonlisten zu führen. SMS Werbung: Aus den gleichen Gründen unzulässig, da mögliche wichtige Nachrichten dadruch verloren gehen können; außerdem besondere Belästigung des Empfängers (Auffassung streitig). Fall: Faxwerbung K betreibt ein Wohnungsbaugeschäft. B beschäftigt sich mit Finanz- und Wirtschaftsdiensten und bietet auch Finanzierungsberatungen an. Er übersandte K ein Telefax, in dem er seine Dienste als Finanzierungsberater für Käufer von Immobilien der K und zugleich Zusammenarbeit mit K anbot. K verlangt von B Unterlassung weiterer Schreiben. B hält derartige Schreiben für zulässig. Zu Recht ? Lösungsansatz: Faxwerbung Auch jemand, der ein Fax hat, ist nicht damit einverstanden, dass Werbeschreiben jeder Art eintreffen. Telefax-Werbung blockiert den Anschluss und es entstehen Kosten für die Farbe und das Papier. Hinzu kommt der Zeitaufwand, denn die Werbung muss aussortiert werden. Fax und Gewerbe: Es kommt auf die Sicht des verständigen und redlichen Durchschnittsgewerbetreibenden des betreffenden Gewerbezweiges an. Wenn nicht das Einverständnis des Empfängers aufgrund seines Verhaltens oder besonderer Umstände (Eilbedürftigkeit) vermutet werden kann, so ist die Telefax-Werbung unzulässig. Wenn sich ein Fax auf den Beruf bezieht, so liegt evtl. ein Einverständnis vor. Es muss aber auf jeden Fall ein Bedürfnis bestehen, die Werbeschreiben mit Telefax zu übermitteln. Die Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 18 Angelegenheit muss eilbedürftig sein. Sonst genügt die normale Post. Auch dann, wenn das Fax außerhalb der Geschäftszeit und nur ganz kurz blockiert wird, ist die Werbung nicht erlaubt. Durch derartige Faxe wird der Betriebsablauf erheblich gestört. Man darf jetzt nicht nur das einzige Fax sehen. Wenn man das einzelne Fax zulässt, dann hat dies eine Verwilderung der Sitten zur Folge. Man wird praktisch überschwemmt. Denn auch wenn ein einzelnes Schreiben nicht schadet, wenn man Werbung mittels Telefax erlaubt, dann erfolgt eine Ausweitung mit der Folge einer stetig wachsenden Blockierung der Anlagen. Folge ist eine Verwilderung der Sitten. Das Faxgerät wird so für wichtige Faxe blockiert. Die Angestellten müssen die Faxe kontrollieren. Es entstehen Stromkosten, Wartungskosten, evtl. ein Papierstau, Personal muss für die Überwachung des Faxgeräts abgestellt werden. Für wichtige Dinge ist man nicht mehr erreichbar. Ähnliche Überlegungen gelten auch für den Bereich der Email. Die entsprechende E-Commerce Richtlinie der EU ist bis jetzt in Deuschland noch nicht umgesetz. Fall: Telefonwerbung Max Müller lebt in Bonn. Er verklagt den Verleger einer Tageszeitung, V, auf Unterlassung. V hat die amerikanische Firma M. vertraglich verpflichtet, für die von ihm vertriebene Zeitung telefonisch Abonnementen zu werben. Dies geschieht in der Weise, dass ein Mitarbeiter der amerikanischen Firma in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr bei Privatleuten anruft, sich mit seinem Namen vorstellt und mitteilt, dass er im Auftrage des V anrufe, er erklärt dem Angerufenen, dass er dessen Telefonnummer aus dem Telefonbuch entnommen habe und gern wisse, ob der Angerufene bereits Leser oder Bezieher der von V vertriebenen Tageszeitung sei; wird diese Frage bejaht, so wird lediglich nach der Meinung über diese Zeitung gefragt, verneint der Angerufene die Frage, so wird ihm empfohlen, eine Tageszeitung zu lesen und ein kostenloses Probeabonnement der Zeitung des V angeboten. Beabsichtigt der Angerufene nach Lieferung des Probeabonnements, die Zeitung weiter zu lesen, kann er sie entgeltlich abonnieren. Gibt der Angerufene zu erkennen, dass er mit dem Anruf nicht einverstanden ist oder dass er aus einem anderen Grund das Gespräch nicht fortsetzen möchte, wird dieses höflich abgebrochen. Die Anrufer sind Kräfte, die die amerikanische Firma eigens für diesen Zweck durch Zeitungsinserat angeworben und anschließend auch geschult hat. Max Müller wurde von einem Mitarbeiter angerufen. Er sieht in dieser Werbung einen Verstoß gegen die guten Sitten und begehrt Unterlassung. V trägt vor, dass die Belästigung der Verbraucher durch andere Werbemethoden viel grösser sei, wenn man z.B. an die Postwurfsendungen oder das Fernsehen denkt. Wer sich einen Fernsprechanschluss zulege, öffne sich und sein Heim damit der großen Welt mit allen Folgen. Wer hat recht ? Lösungsansatz: Telefonwerbung § 1 UWG will auch die Allgemeinheit vor Auswüchsen des Wettbewerbs bewahren. Er schützt nicht nur die Mitbewerber vor unlauterem Wettbewerb. Es ist zu unterscheiden: Unerbetene Telefonwerbung bei Privatpersonen ist grundsätzlich ist verboten (vgl. Fernabsatz-§§ 309 ff. BGB) Man kann sich einem telefonischen Kontakt - anders als einem Vertreterbesuch - nicht entziehen. Man nimmt das Gespräch entgegen, da man mit dem Anruf einer Person rechnet, mit der man in Beziehung steht. Anders ist es jedoch dann, wenn der Anschlussinhaber vorweg ausdrücklich oder stillschweigend sein Einverständnis mit telefonischen Anrufen erklärt hat. Auch Anrufe im geschäftlichen Bereich sind nicht ohne weiteres zulässig (BGH, BB 1991. 1140). Denn die Apparate werden auch hier dadurch zeitweilig blockiert und die Mitarbeiter von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten. Es kommt auf den Grad des Interesses an, das der Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 19 Gewerbetreibende an dem Anruf hat. Ein bloßer allgemeiner Sachbezug genügt nicht. Es muss ein konkreter, aus dem Interessenbereich den Angerufenen herzuleitender Grund vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn: Der Angerufenen zuvor sein ausdrückliches oder stillschweigendes Einverständnis erklärt hat. Aufgrund konkreter tatsächlicher Umstände ein sachliches Interesse des Geschäftsmannes erwartet werden kann. Dies ist z.B. bei dem Bestehen eines Geschäftsverbindung der Fall. Abzustellen ist auch darauf, ob jemand gerade telefonisch angesprochen werden wollte oder ob auch ein Schreiben genügt hätte. 2.1.2 Mitbewerberbezogene Unlauterbarkeit Ausbeutung: Zur Förderung des eigenen Wettbewerbs werden Leistungen anderer genutzt. 2.1.2.1 Ergänzender, wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz Grundsatz: Es gehen die spezialgesetzlichen Schutzvorschriften vor: Urheberrecht Patentrecht Markenrecht Soweit dieser Schutz nicht greift, gilt grundsätzlich: wettbewerbsrechtliche Nachahmungsfreiheit. Wettbewerbswidrig wird dies durch besondere weitere Umstände: besondere wettbewerbliche Eigenart der Leistung konkrete Ausgestaltung oder einzelne Merkmale sind geeignet, auf die betriebliche Herkunft oder besondere Gütevorstellung hervorzurufen. Art der Nachahmung unmittelbare Übernahme (technische Vervielfältigung des Originals) sklavische Nachahmung (geringe Abweichungs zum Original) nachschaffende Übernahme (Vorbild noch erkennbar) Besondere unlautere Umstände vermeidbare Herkunftstäuschung (Wettbewerber tut nichts Verwechselung zu vermeiden) wettbewerbswidrige Rufausbeutung (Wettbewerber hängt sich an den guten Ruf des anderen Produkts) Behinderung (gezieltes Nachahmen aller Produkte) Erschleichen und Vertrauensbruch (Kenntnisse über anderes Produkt sind rechtswidrig erlangt). Einschieben in fremde Serie (Lego, Möbel) (Herstellung von Ersatzteilen für andere Produkte ist grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig) Ausnahmsweise: Ersparnis von Mühen und Kosten Fall: Busreisen OLG Stuttgart, NJW-RR 1987, 425): A, ein Reiseunternehmen, bietet seit Jahren Radwanderreisen ins Elsass an. In ihrem Katalog hebt A hervor, dass die Reisen abseits der großen Straßen stattfinden, dass die Reisen insbesondere auch kulinarisch gehobenen Ansprüchen gerecht werden, dass auf die Reisen spezielle Begleitbusse mit Fahrradanhängern mitgeschickt würden und dass die zur Verfügung gestellten Touren-Fahrräder mit besonderen Eigenschaften ausgestattet seien. B veranstaltet ebenfalls Radwanderreisen ins Elsass. In ihrem Katalog bietet B eine Radwanderreise an, die mit geringen Abweichungen der von A angebotenen Reise entspricht. A hat B zur Unterlassung aufgefordert. A weigert sich. Zu Recht ? Lösungsansatz: Busreisen Bei der Ausnutzung fremder Leistungen unterscheidet man zwei Fallgruppen: - Die unmittelbare Leistungsübernahme - Die Nachahmung Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 20 Bei der unmittelbaren Leistungsübernahme wird die fremde Leistung ausgebeutet, ohne dass eine ins Gewicht fallende eigene Leistung erbracht wird (z.B. Übernahme der Fotos eines fremden Werbeprospekts, die wortwörtliche Übernahme der AGBs des Konkurrenten). Hier nehmen die Gerichte eher einen Verstoß gegen § 1 UWG an als bei der Nachahmung. Bei der Nachahmung wird eine eigene Leistung des Nachschaffens erbracht (z.B. eine Figur wird von Hand nachgeschnitzt). Hier liegt die Nachahmung einer fremden Leistung vor. Diese stellt nur selten einen Verstoß gegen § 1 UWG dar. Es besteht grundsätzlich Nachahmungsfreiheit. Nicht gestattet ist jedoch die Herkunftstäuschung. Hier nimmt der Umworbene zu Unrecht an, dass die nachgeahmte Leistung aus demselben Unternehmen stammt wie das Originalprodukt (Verwechselungsgefahr). Voraussetzung ist eine wettbewerbliche Eigenart des Originalprodukts (keine Massenprodukte). Dem Nachahmer wird vorgeworfen, dass er nicht genug unternommen hat, um Verwechselungen mit dem Originalprodukt zu vermeiden. Hier liegt nur eine geringe wettbewerbsrechtliche Eigenart vor. Die Informationen über die beste Route sind allgemein bekannt. Für das Elsass bieten sich von vorneherein bestimmte Orte und Streckenführungen an. Die Tour richtet sich nach der Tagesleistung der Teilnehmer und den hervorgehobenen Sehenswürdigkeiten. Auch der kulinarische Fahrplan, die Bereitstellung eines KFZ und die Ausgestaltung der Fahrräder selbst bieten sich an. Deshalb ist das Verhalten nicht gemäß § 1 UWG verboten. (Fahrenhorst) Fall: Rolls Roys BGHZ 86, 90: K ist Herstellerin der Automobile der Marke Rolls Royce. B betreibt eine Werbeagentur. Sie hat in einer Illustrierten eine ganzseitige, farbige Werbeanzeige für den amerikanischen Whiskey „Jim Beam“ veröffentlicht. Darin ist im Rahmen einer gestellte Szene auch die Vorderansicht eines Rolls Royce einschließlich der Kühlerpartie abgebildet. Auf den Kotflügeln des Fahrzeugs sitzen zwei in texanischem Stil gekleidete Männer beim Kartenspiel. Drei weitere Personen stehen daneben. Im Vordergrund ist hervorgehoben eine Flasche des Whiskeys mit zwei gefüllten Gläsern dargestellt. K hält die besagte Werbung für unzulässig. Zu Recht ? Lösungsansatz: Rolls Roys Hier ist das Produkt der Konkurrenz wegen seiner Exklusivität besonders geschätzt. Die Ausbeutung von dessen Ruf zur Absatzsteigerung der eigenen Ware ist als sittenwidrig zu beurteilen. In der Rechtsprechung ist wiederholt anerkannt worden, dass wettbewerbswidrig handelt, wer die Qualität seiner Waren oder Dienstleistungen mit denen geschätzter Konkurrenzerzeugnisse in Beziehung setzt, um den guten Ruf der Waren oder Leistungen des Mitbewerbers auszunutzen. 2.1.2.2 Anlehnung Werbender versucht seine Produkte in die Nähe anderer bekannter Produkte zu bringen, um an dem guten Ruf des anderen zu partizipieren: Versuch die Wertvorstellungen des anderen Produktes auf das eigene zu übertragen Schaffung von besonderen Assoziationen zum Originalprodukt Fall: Spielzeugautos BGHZ 126, 208: K betreibt einen Rennstall der sogenannten Formel 1. Die von ihr konstruierten Rennwagen nehmen seit 1967 an Grand-Prix-Rennen teil, und zwar seit 1985 in einer Form- und Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 21 Farbgebung, die nur geringe Abweichungen aufweist. Die Wagen der Klägerin gewannen zahlreiche Titel. B stellt Spielzeugautos her. Sie verkauft unter ihrer Marke „Carrera“ eine Autobahn, auf der elektrisch angetriebene Modelle von Formel 1-Rennwagen, aber auch von Serienfahrzeugen, fahren. Zu diesen Modellen gehört ein detailgetreu nachgebildeter Rennwagen der K. K sieht darin eine sittenwidrige Rufausbeutung. Zu Recht ? Lösungsansatz: Spielzeugautos § 1 UWG ist hier nicht verletzt. Es liegt keine Behinderung der K durch Beeinträchtigung ihres Rufs vor. Es ist üblich, Spielzeugmodelle von Waren herzustellen, die es in der Wirklichkeit gibt. Hier ergibt sich der Zusammenhang mit dem Originalprodukt ausschließlich aufgrund der Nachbildung als Spielzeugmodell zwangsläufig und beiläufig. Jedenfalls solange die Nachahmung ohne ausdrückliche Nennung des Namens des Inhabers und ohne anderweitige werbende Herausstellung des Originalfahrzeugs, seines Rufs und/oder seines Vorbildcharakters für den Spielzeugwagen zur Förderung des Absatzes dieses Produkts geschieht, liegt kein Verstoß gegen § 1 UWG vor. Fall: Werberkonzept BGH, NJW-RR 1997, 741: K ist ein Energieversorgungsunternehmen, das Erdgas vertreibt. Die K wirbt seit 1987 für den Energieträger Erdgas mit dem Slogan: „Wärme fürs Leben“ im Rahmen einer Anzeigenserie. Die Anzeigen enthalten häufig ein familienbezogenes Bildmotiv, z.B. eine junge Mutter mit einem Kind auf dem Arm. B ist ein von der Mineralölindustrie und dem Brennstoffhandel getragener Verein, mit dem seine Mitglieder den Zweck verfolgen, mit dem seine Mitglieder den Zweck verfolgen, die Ölheizung zu fördern und die Akzeptanz des Heizöls als Brennstoff zu steigern. Er wirbt seit 1990 mit Anzeigen für eine moderne Ölheizung. Dabei verwendet er ebenfalls den Slogan: „Wärme fürs Leben“ mit einem Bildmotiv, das einen Vater oder eine Mutter mit einem Kleinkind zeigt. K behauptet, sie habe das Werbekonzept mit dem von der B identisch übernommenen Werbeslogan mit großem finanziellen Aufwand entwickeln lassen und damit einen erheblichen Bekanntheitsgrad von deutlich über 40 % erreicht. K hat beantragt, B zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in ihrem Versorgungsgebiet mit dem Slogan „Wärme fürs Leben“ zu werben. Wird K Erfolg haben ? P.S.: Eine Meinungsumfrage aus dem Jahre 1990 hat ergeben, dass 36,7 % der Befragten den Text „Wärme fürs Leben“ schon einmal in der Werbung gesehen oder gehört, 14 % verbinden ihn im weitesten Sinne mit dem Thema Erdgas, 3,6 % mit dem Thema Erdöl. Lösungsansatz: Werbekonzept Voraussetzung für einen Erfolg der Klage ist die wettbewerbsrechtliche Eigenart des Werbespruchs. Dies besagt, dass die Ausgestaltung des Erzeugnisses geeignet sein muss, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen oder besondere Gütevorstellungen zu wecken. Eine Bekanntheit muss nicht vorliegen. Auch ein neu eingeführtes Erzeugnis muss Schutz genießen können. Der Spruch "Wärme fürs Leben" hat von Haus aus nur eine geringe wettbewerbliche Eigenart. Es handelt sich um eine beschreibende Angabe, die Wärmequelle für das menschliche Leben. Die Angabe ist auch wenig spezifisch. Sie spricht nicht das Erdgas an, sondern die Wärmequelle insgesamt. Es handelt sich um eine recht banale Aussage. Jedoch zeichnet sich der erfolgreiche Wärmeslogan oft durch eine Banalität aus. Deshalb kann dem Slogan trotz seiner Banalität die Qualität nicht abgesprochen werden. Er eignet sich dazu, als Leitmotiv positive Assoziierungen zu wecken und das Leistungsangebot der werbenden Versorgungsunternehmen mit herauszustellenden positiven Eigenschaften zu verknüpfen. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 22 Der Slogan genießt deshalb Schutz, wenn er einen gewissen Bekanntheitsgrad genießt. Dies ist der Fall. 2.1.2.3 Behinderung Im Grundsatz sind Handlungen im Leistungswettbewerb, die dem Konkurrenten Kunden abnehmen sollen erlaubt und entsprechen dem Modell des Leistungswettbewerbs. Unzulässigkeit kann sich deshalb nur aus besonderen Umständen ergeben. Fallgruppen: Absatzbehinderung Kundenabfangen: z.B. Vereilen von Handzetteln im oder unmittelbar vor dem Geschäftslokal des Konkurrenten. Sonderproblem: Generische Internet Domains (vgl. Fall) Werbebehinderung Fremde Werbung kann nachgemacht werden oder lächerlich gemacht werden (McDonald Clown kauft heimlich bei Burger King) oder gezielt vereitelt werden (z.B. Überkleben/Zerstören von Plakaten) Bezugsbehinderung Verhinderung, dass der Konkurrent für ihn wichtige Güter erhält (z.B. Aufkaufen von Rohstoffen über den eigenen Bedarf hinaus oder das gezielte überbieten des Konkurrenten beim Wareneinkauf) Fall: Mitwohnzentrale BGH vom 17.05.2001 http://www.iprecht.de/Home/Urteile/EDV-U/inter/MitwohnzentraleBGH/bgh-mitwohnzentral e.html Eine Mitwohnzentrale H. läßt sich den Domain-Namen mitwohnzentrale.de eintragen. Andere Mitbewerber aus anderen Städten halten dies für eine Behinderung ihrer Tätigkeit, weil auf diesem Wege alle Interessenten im Internet auf die Seiten der Mitwohnzentrale H. gelenkt würden. Es sei außerdem irreführend, weil der Eindruck erweckt würde, es handele sich um "DIE" Mitwohnzentrale. Ist die Nutzung von Gattungsbezeichnungen im Wettbewerb als wettbewerbswidrig zu klassifizieren? Lösungsansatz: Mitwohnzentrale Zu Unrecht hat das Berufungsgericht in der Verwendung der Gattungsbezeichnung "Mitwohnzentrale" als Domain-Name eine wettbewerbswidrige Behinderung nach § 1 UWG gesehen. a. Voraussetzung eines Behinderungswettbewerbs nach § 1 UWG ist stets eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber. Da eine solche Beeinträchtigung jedem Wettbewerb eigen ist, muß freilich noch ein weiteres Merkmal hinzutreten, damit von einer wettbewerbswidrigen Beeinträchtigung und - eine allgemeine Marktbehinderung oder Marktstörung steht im Streitfall nicht zur Debatte - von einer unzulässigen individuellen Behinderung gesprochen werden kann: Wettbewerbswidrig ist die Beeinträchtigung im allgemeinen dann, wenn gezielt der Zweck verfolgt wird, den Mitbewerber an seiner Entfaltung zu hindern und ihn dadurch zu verdrängen. Ist eine solche Zweckrichtung nicht festzustellen, muß die Behinderung doch derart sein, daß der beeinträchtigte Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann (Brandner/Bergmann in Großkomm.UWG, § 1 Rdn. A 3). Dies läßt sich nur aufgrund einer Gesamtwürdigung der Einzelumstände unter Abwägung der widerstreitenden Interessen der Wettbewerber beurteilen (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., § 1 UWG Rdn. 208; Köhler in Köhler/Piper, UWG, 2. Aufl., § 1 Rdn. 285), wobei sich die Bewertung an den von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen orientieren muß. b. Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine unlautere Absatzbehinderung des Klägers durch ein "Abfangen" potentieller Kunden gesehen. Kunden, denen keine bestimmten Anbieter bekannt seien und die sich im Internet das Leistungsangebot von Mitwohnzentralen erschließen wollten, gelangten zufällig auf die Homepage der Beklagten und stellten sodann die Suche nach anderen Anbietern ohne weiteren Leistungsvergleich ein; die Beklagten machten sich solches Kundenverhalten auf Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 23 unlautere Weise zunutze. Dieser Beurteilung kann nicht in allen Punkten beigetreten werden. aa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings dagegen, daß das Berufungsgericht von einem bestimmten Suchverhalten der Nutzer ausgegangen ist. Das Berufungsgericht hat unter Berufung auf die eigene Sachkunde der Senatsmitglieder angenommen, daß sich ein Teil der Nutzer bei der Suche nach Informationen und interessanten Angeboten im Internet nicht der sogenannten Suchmaschinen bedient, sondern den Zugang durch eine Direkteingabe der Internet-Adresse versucht. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Annahme des Berufungsgerichts wird im übrigen auch dadurch gestützt, daß an generischen Begriffen als Domain-Namen ein reges Interesse besteht, wie der Rechtsprechung der Instanzgerichte und dem Schrifttum entnommen werden kann. Dabei ist allgemein anerkannt, daß wegen des vom Berufungsgericht festgestellten Suchverhaltens der Einsatz von Gattungsbezeichnungen als Internet-Adressen zu einer gewissen Kanalisierung der Kundenströme führen kann (vgl. Kur, CR 1996, 325, 328, 330; Viefhues, MMR 2000, 334, 339; Bettinger, CR 1997, 273, 274). bb) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts haben sich die Beklagten jedoch den Vorteil, der sich aus dem Einsatz der Gattungsbezeichnung "Mitwohnzentrale" als Domain-Name ergibt, nicht in unlauterer Weise zunutze gemacht. (1) Führt die Verwendung eines beschreibenden Begriffs als Domain- Name zu einer gewissen Kanalisierung, kann dies, bezogen auf den Streitfall, zweierlei Gründe haben: Einerseits ist es denkbar - und hiervon ist das Berufungsgericht ausgegangen -, daß sich ein Teil der Nutzer aus Bequemlichkeit mit dem gefundenen Angebot zufrieden gibt und keine Veranlassung hat, seine Suche nach weiteren Anbietern fortzusetzen. Andererseits mögen sich aber Nutzer auch deshalb von einer weiteren Suche abhalten lassen, weil sie meinen, die gefundene Website verschaffe ihnen Zugang zum gesamten Angebot. Dieser zweite Gesichtspunkt mag bei vielen als Domain-Name verwendeten Gattungsbegriffen keine Rolle spielen, weil der Verkehr - etwa bei "http:// www.rechtsanwaelte.de" (vgl. LG München I NJW 2001, 2100), "http:// www.autovermietung.com" (vgl. OLG München CR 2001, 463) oder "http:// www.sauna.de" (vgl. OLG Hamm WRP 2001, 740) - von vornherein erkennt, daß die gefundene Homepage eines Anbieters nicht das gesamte Angebot repräsentiert (vgl. Auch Renck, WRP 2000, 264, 267). Bei anderen Gattungsbezeichnungen kann sich dagegen der Eindruck einer Alleinstellung ergeben. Bei der hier in Rede stehenden Bezeichnung "Mitwohnzentrale" mag eine derartige Irreführungsgefahr naheliegen, sie muß jedoch im Rahmen der Prüfung des § 1 UWG außer Betracht bleiben. Denn der Gefahr der Irreführung können die Beklagten auch auf andere Weise als durch die beantragte Unterlassung entgegenwirken - etwa dadurch, daß sie auf ihrer Homepage einen Hinweis darauf anbringen, daß es außer dem Beklagten zu 2 den Kläger als weiteren Verband von Mitwohnzentralen gibt (dazu unten unter II.5.). (2) Teilweise wird das Unlautere in der Verwendung eines Gattungsbegriffs als Domain-Name in einer unsachlichen Beeinflussung des Internet-Nutzers gesehen (vgl. Ubber, WRP 1997, 497, 510). Der Internet-Nutzer bedarf indessen - von der Gefahr einer Irreführung abgesehen - nicht des Schutzes gegen die Verwendung beschreibender Begriffe. Der Senat geht in seiner neueren Rechtsprechung zu den §§ 1 und 3 UWG von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers aus, der das fragliche Werbeverhalten mit einer der Situation angemessenen Aufmerksamkeit verfolgt (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 167/97, GRUR 2000, 619, 621 = WRP 2000, 517 Orient-Teppichmuster; Urt. v. 17.2.2000 - I ZR 239/97, GRUR 2000, 820, 821 = WRP 2000, 724 - Space Fidelity Peep-Show; vgl. Auch Hoeren, EwiR 2000, 193). Erscheint einem solchen Internet-Nutzer - wie es das Berufungsgericht anschaulich geschildert hat - die Verwendung einer Suchmaschine lästig und gibt er statt dessen direkt einen Gattungsbegriff als Internet-Adresse ein, ist er sich im allgemeinen über die Nachteile dieser Suchmethode im klaren. Er ist sich bewußt, daß es auf Zufälle ankommen kann (etwa auf die Schreibweise mit oder ohne Binde- oder Unterstreichungsstrich), ob er auf diese Weise das gesuchte Angebot findet. Lädt der fragliche Gattungsbegriff (wie in den oben angeführten Beispielsfällen "http://www.rechtsanwaelte.de", "http:// www.autovermietung.com" oder "http://www.sauna.de") ferner nicht zur Annahme einer Alleinstellung des auf diese Weise gefundenen Anbieters ein, erkennt der Internet-Nutzer auch, daß er mit dieser Suchmethode kein vollständiges Bild des Internet-Angebots erhält. Verzichtet er aus Bequemlichkeit auf eine weitere Suche, liegt darin keine unsachliche Beeinflussung (vgl. Sosnitza, K&R 2001, 111, 113; Ernst, MMR 2001, 181, 182). Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 24 (3) Die vom Berufungsgericht gezogene Parallele zur Fallgruppe des unlauteren Abfangens (potentieller) Kunden des Mitbewerbers besteht im Streitfall nicht. Wie bei der Behinderung im allgemeinen liegen auch beim sogenannten Abfangen von Kunden wettbewerbskonformes und wettbewerbsfeindliches Verhalten nahe beieinander. Denn es kann einem An bieter nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß er sich auch um die potentiellen Kunden seines Mitbewerbers bemüht. Nach der Rechtsprechung liegt ein unlauteres Abfangen von Kunden daher nur dann vor, wenn sich der Werbende gewissermaßen zwischen den Mitbewerber und dessen Kunden stellt, um diesem eine Änderung des Kaufentschlusses aufzudrängen (BGH, Urt. v. 30.10.1962 - I ZR 128/61, GRUR 1963, 197, 200 f. = WRP 1963, 50 - Zahnprothesen-Pflegemittel; Urt. v. 27.2.1986 I ZR 210/83, GRUR 1986, 547, 548 = WRP 1986, 379 " Handzettelwerbung; Urt. v. 15.1.1987 - I ZR 215/84, GRUR 1987, 532, 533 = WRP 1987, 606 - Zollabfertigung; Köhler in Köhler/Piper aaO § 1 Rdn. 290). Bei der Verwendung einer Gattungsbezeichnung als Domain-Name kann nicht von einer entsprechenden Situation ausgegangen werden. Denn das beanstandete Verhalten ist allein auf den eigenen Vorteil gerichtet, ohne daß auf bereits dem Wettbewerber zuzurechnende Kunden in unlauterer Weise eingewirkt würde (vgl. Sosnitza, K&R 2000, 209, 214; ders., K&R 2001, 111, 113). Es geht - wie das Landgericht Hamburg in der Entscheidung "lastminute.de" zutreffend betont hat (CR 1999, 617, 618) - nicht um ein Ablenken, sondern um ein Hinlenken von Kunden. (4) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts läßt sich die Unlauterkeit im Streitfall auch nicht mit einem Freihaltebedürfnis an der Gattungsbezeichnung "Mitwohnzentrale" begründen (vgl. Auch OLG Frankfurt GRUR 1997, 481 = WRP 1997, 341 wirtschaft-online.de; Bettinger, CR 1997, 273, 274; Ernst, BB 1997, 1057, 1061; anders Kur, CR 1996, 325, 328). Der vom Berufungsgericht herangezogene markenrechtliche Grundsatz, wonach beschreibende Angaben freizuhalten sind (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), dient dazu, die Entstehung von Ausschließlichkeitsrechten an produktbezogenen Angaben zu vermeiden (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rdn. 52). Im Streitfall besteht indessen keine Gefahr, daß die Möglichkeiten des Klägers, die von ihm bzw. Seinen Mitgliedern angebotenen Dienstleistungen mit dem Begriff "Mitwohnzentrale" zu beschreiben, dadurch beschnitten werden, daß die Beklagten diesen Begriff als Domain-Name verwenden. Denn mit der Registrierung eines beschreibenden Begriffs als Domain-Bezeichnung werden keinerlei Rechte gegenüber Dritten begründet. Die Monopolisierung einer Gattungsbezeichnung, von der in der Diskussion immer wieder die Rede ist (vgl. LG München I NJW 2001, 2100 - rechtsanwaelte.de; LG Köln MMR 2001, 55, 56 - zwangsversteigerungen.de; Bettinger, CR 2000, 618, 619; a.A. Sosnitza, K&R 2001, 111, 113), kann den Beklagten ebensowenig zum Vorwurf gemacht werden wie eine unlautere Aneignung von Gemeingut (vgl. Viefhues, MMR 2000, 334, 339; ders. In Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 6 Rdn. 219). Auch dem Kläger geht es nicht darum, daß der Begriff "Mitwohnzentrale" in dem Sinne freigehalten wird, daß er von anderen als Domain-Name verwendet werden kann. Es liegt vielmehr in der Logik des geltend gemachten Anspruchs, daß der fragliche Begriff von niemandem als Domain-Bezeichnung verwendet werden soll. Würde diesem Begehren entsprochen, wäre die Suchfunktion zerstört, die der Gattungsbezeichnung als Domain-Namen gerade nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zukommen kann: Die Internet-Nutzer, die einen Gattungsbegriff direkt als Internet-Adresse eingeben in der Hoffnung, auf diese Weise ein sie interessierendes Angebot zu finden, würden enttäuscht und auf den vom Berufungsgericht als beschwerlich geschilderten Weg der Suchmaschinen verwiesen (vgl. Dazu Sosnitza, K&R 2000, 209, 212 u. 216; ders., K&R 2001, 111, 113; ferner Härting, BB 2001, 491, 492, der davon spricht, Gattungsbezeichnungen als Domain-Namen seien benutzerfreundlich). (5) Der Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses könnte allenfalls in einer abgewandelten Form eine Rolle spielen: Beruft sich im Markenrecht ein Wettbewerber des Anmelders auf ein Freihaltebedürfnis, geht es ihm in der Regel nicht nur darum, das angemeldete Zeichen für den allgemeinen und damit auch für seinen Gebrauch freizuhalten. Dem Anmelder als Konkurrenten soll darüber hinaus kein Vorteil daraus erwachsen, daß er Ausschließlichkeitsrechte an einem Gattungsbegriff erwirbt und sich damit einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern verschafft (vgl. Hierzu auch unten unter II.2.). Es sind indessen keine rechtlichen Gesichtspunkte zu erkennen, weswegen der den Beklagten durch die Registrierung von "Mitwohnzentrale" zuteilgewordene Vorteil unlauter oder generell zu mißbilligen wäre. Anders als die Vergabestellen in anderen Ländern (vgl. Etwa Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 25 zu den Niederlanden Sosnitza, K&R 2000, 209, 216; Bettinger, CR 2000, 618, 619) kennt die für die Registrierung von Domain-Namen mit dem Top-Level-Domain ".de" zuständige Einrichtung DENIC eG keine Beschränkung der Registrierbarkeit generischer Begriffe. Damit sind die Wettbewerber hinsichtlich der Registrierung von Gattungsbegriffen allein dem Gerechtigkeitsprinzip der Priorität unterworfen, wenn sich eine Unlauterkeit nicht aus anderen Gesichtspunkten herleiten läßt. Der Vorteil, der demjenigen gegenüber seinen Wettbewerbern zukommt, der als erster um die Registrierung eines beschreibenden Domain-Namens nachsucht, kann nicht als unlauter angesehen werden. 2.Das beanstandete Verhalten der Beklagten ist auch unter anderen Gesichtspunkten nicht wettbewerbswidrig nach § 1 UWG. ....... Fall: Konul von Zypern LG Frankfurt a.M., BB 1969, 559: Der Inhaber eines Möbelversandhauses ließ seinem wichtigsten Konkurrenten durch einen Dritten die Würde des Konsuls von Zypern gegen Zahlung eines hohen Geldbetrages anbieten. Der Konkurrent fiel auf den Schwindel herein. Die Fotos von der Verleihungszeremonie erschienen anschließend in einem Bildbericht der Hauszeitschrift des Veranlassers über den Vorfall, die nicht nur an Mitarbeiter, sondern auch an Dritte verteilt wurde, mit der weiteren Folge, dass fast die gesamte Presse, darunter eine große Illustrierte, den Bericht übernahm. Liegt ein Verstoß gegen § 1 UWG vor ? Lösungsansatz: Konsul von Zypern Der Hinweis auf persönliche Eigenschaften oder Verhältnisse des Konkurrenten behindert diesen mit Mitteln, die außerhalb der Leistung liegen und dem freien Leistungswettbewerb daher auch dann wesensfremd sind, wenn der Hinweis an sich zutrifft. Dabei ist es gleichgültig, ob man auf persönliche Dinge aus dem geschäftlichen Bereich oder privaten Bereich Bezug nimmt. Eine Aufklärung über persönliche Verhältnisse liegt auch kaum jemals im Interesse des Kunden. Ein Verstoß gegen § 1 UWG liegt daher vor. Preisunterbietung Grundsatz: Preisbildung ist wesentliches Merkmal des Leistungswettbewerbs. Verkauf unter Einstandspreis ist zulässig, wenn rational begründet (z.B. Werbemaßnahme). Ausnahmsweise, in besonderen Fällen wettbewerbswidrig. Preisunterbietung durch Rechtsbruch Preisunterbietung geschieht durch den Verstoß von Verträgen oder Gesetzen (z.B. Abschreibung von Waren, die eigentlich unter Preis verkauft werden) Preisunterbietung erfolgt mit dem Ziel, den Marktpartner auszuschalten (z.B. systematisches und dauerhaftes Anbieten unter Einstandspreis); Sonderregelung im GWB für marktbeherrschende Unternehmen (§§ 19, 20 GWB). Fall: Aldi BKartA, NJWE-WettbR 2000, 310: Die 1960 gegründete ALDI-Gruppe besteht aus zwei rechtlich und organisatorisch getrennten Firmen, ALDI-Nord und ALDI-Süd. Einkauf und Verkauf beider ALDI-Unternehmen erfolgen getrennt. ALDI-Nord ist ein Hard-Discounter, der allerdings sein Angebot in den vergangenen Jahren auch um die Produktbereiche Obst und Gemüse, höherwertige Artikel aus dem Food-Bereich (Champagner, Weine aus Übersee usw.) und Non-Food Aktionsartikel erweitert hat. Das Image von ALDI besteht insbesondere darin, die niedrigsten Preise zu haben, zugleich jedoch Produkte von hoher Qualität zu bieten. Aldi Nord ist lediglich im nördlichen Teil Deutschlands, etwa bis zu einer Linie von Essen - Gummersbach - Siegen Dillenburg - Marburg - Hünfeld sowie in allen neuen Bundesländern. Seit Mitte Mai 2000 hat Wal-Mart unter der Bezeichnung "Smart-Price" ein Niedrigpreisprogramm an sämtlichen 95 Standorten in Deutschland durchgeführt. Bei den unter diesem Label geführten Produkten handelt es sich um Eigenmarken. Daneben hatte Wal-Mart eine Preisschiene unter der Bezeichnung "Great Value". Sowohl die Smart Preise als auch die Great Value Preise haben den bis dahin gültigen ALDI-Preise für die entsprechenden Produkte unterboten. Sie sind jedoch teilweise von geringerer Qualität. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 26 Diese Niedrigpreisaktion wurde in der Presse kommentiert. Zudem hat jedenfalls eine Wal-Mart-Filiale Handzettel verteilt, auf denen die abgesenkten Preise von sechs Produkten (u.a. Milch, Margarine und Zucker) herausgestellt waren und die mit dem Slogan enden: "Warum für diese Produkte zu Aldi gehen ? Wir sind günstiger !!!" Zugleich wurde die Smart Price Aktion im Fernsehen beworben. ALDI-Nord beantwortete diese Preissenkung von Wal-Mart mit Preissenkungen an allen Standorten. Dabei wurden die Wal-Mart Preise unterboten und die Produkte unter Einstandspreis verkauft. Das Bundeskartellamt hat der ALDI-Nord Gruppe untersagt, ihre Produkte unter dem Einstandspreis zu verkaufen. Zu Recht ? Lösung: Aldi Der Verkauf unter dem Einstandspreis verstößt gegen § 20 IV 2 GWB. Denn es handelt sich um eine unzulässige Behinderung, Aldi-Nord verfügt mit über 2100 Standorten in räumlicher und sachlicher Hinsicht über eine gegenüber kleineren und mittleren Unternehmen überlegene Marktmacht. Hard-Discounter (Aldi) und Vollsortimenter gehören zu demselben sachlichen Markt. Hard-Discounter haben nur eine eingeschränkte Sortimentstiefe. Der Vollsortimenter unterscheidet sich durch das Angebot von Zweit- und Drittmarken. Die Tatsache, dass ALDI auf das Angebot eines Vollsortimenters reagiert, zeigt, dass beide demselben Markt zuzurechnen sind. Auf allen räumlich relevanten Märkten sind kleine und mittlere Unternehmen in Form von selbstständigen Spar- und Edeka-Einzelhändlern tätig. Die Einzelhändler sind nach Art und Größe sehr verschieden und tragen das volkswirtschaftliche Risiko für den Betrieb der Ladengeschäfte. Darüber hinaus sind weitere selbstständige Einzelhändler tätig, die keiner Handelsgruppe angeschlossen sind. Gegenüber diesen Unternehmen besitzt ALDI-Nord überlegene Marktmacht. Die Marktmacht eines Unternehmens richtet sich nach Unternehmensgröße, Ressourcen und Markanteilen. ALDI gehört zu den 5 größten Anbietern im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die flächendeckende Präsenz in Verbindung mit einem hohen Warenumsatz ermöglicht es ALDI-Nord, außergewöhnlich gute Lieferkonditionen auszuhandeln. ALDIs Finanzkraft in Verbindung mit hervorragenden Lieferkonditionen und einem überregionalen eng geknüpften Vertriebsnetz eröffnet ALDI Nord unternehmerische Spielräume bei der Preis- und Produktgestaltung, die den selbstständigen Einzelhändlern nicht offen steht. Dadurch können Verlustpreis-Strategien bei einzelnen Produkten abgefangen bzw. länger „durchgehalten“ werden. ALDI behindert diese kleineren und mittleren Unternehmen unbillig, indem Waren nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis angeboten werden. Dies ist auch nicht sachlich gerechtfertigt. Zwar ist die Behinderung gering, da ALDI nur ein begrenztes Produktsortiment hat und keine Markennamen führt. Jedoch führt das Unterbieten von Wettbewerberpreisen zu einem allgemeinen Absinken der Preise im Lebensmitteleinzelhandel. Dadurch wird auch der Preisspielraum der kleinen und mittleren Unternehmen eingeschränkt und ihre Möglichkeiten, kostendeckende Preise zu erzielen, beeinträchtigt. Die Ladenlokale von Wettbewerbern sind häufig auf engem Raum angesiedelt, weil dies die Attraktivität einer Einkaufsgegend erhöht. Eine konkrete Behinderungsabsicht muss nicht nachgewiesen werden. Der Verkauf unter Einstandspreis ist per se eine unbillige Behinderung. Auch die niedrigen Preise von Wal-Mart rechtfertigen das Vorgehen nicht, denn ALDI hat die Preise von Wal-Mart noch unterboten. Allenfalls die Anpassung an vorhandene Wettbewerbspreise ist als sachlich gerechtfertigte Marktreaktion zu rechtfertigen. Etwas anders gilt auch nicht für Discounter. Der Preis ist nicht das einzige Wettbewerbsinstrument, das ALDI offen steht. Wettbewerb ist auch auf den Gebieten Service (Öffnungszeiten usw.) und Qualität möglich. Gerade in bezug auf Qualität hat ALDI ein besonders gutes Image erlangt. Das Unterbieten von Wettbewerber-Preisen würde eine Preisspirale nach unten auslösen. Darüber hinaus hat ALDI-Nord in rund 170 Märkten mit Preissenkungen reagiert, in deren Umkreis sich kein Wal-Mart Standort befindet. Die Preisreaktion ist deshalb auch räumlich nicht angemessen und eine Überreaktion. Deshalb ist ALDI Nord der Verkauf unter Einstandspreis nach § 32 GWB zu untersagen. Es handelt sich um Produkte des täglichen Bedarfs, die beim Verbraucher einen hohen Signalwert für die Preisgünstigkeit eines Händlers haben. Ein erhebliches, das gesamte klassische Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels umfassende Nachfragevolumen wird Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 27 von kleineren und mittleren Wettbewerbern abgezogen. Dadurch wird die Existenz kleiner und mittlerer Unternehmen gefährdet. GWB GWB § 19 Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (1) Die mißbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist verboten. (2) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen 1. ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder 2. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat; hierbei sind insbesondere sein Marktanteil, seine Finanzkraft, sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, Verflechtungen mit anderen Unternehmen, rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen, der tatsächliche oder potentielle Wettbewerb durch innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansässige Unternehmen, die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder gewerbliche Leistungen umzustellen, sowie die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen, zu berücksichtigen. Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ein wesentlicher Wettbewerb nicht besteht und soweit sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen. (3) Es wird vermutet, daß ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens einem Drittel hat. Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie 1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 vom Hundert erreichen, oder 2. aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen, es sei denn, die Unternehmen weisen nach, daß die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten lassen oder die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewerbern keine überragende Marktstellung hat. (4) Ein Mißbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen 1. die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen in einer für den Wettbewerb auf dem Markt erheblichen Weise ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt; 2. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu berücksichtigen; 3. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als sie das marktbeherrschende Unternehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, es sei denn, daß der Unterschied sachlich gerechtfertigt ist; 4. sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen angemessenes Entgelt Zugang zu den eigenen Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn es dem anderen Unternehmen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ohne die Mitbenutzung nicht möglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt als Wettbewerber des marktbeherrschenden Unternehmens tätig zu werden; dies gilt nicht, wenn das marktbeherrschende Unternehmen nachweist, daß die Mitbenutzung aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. GWB § 20 Diskriminierungsverbot, Verbot unbilliger Behinderung (1) Marktbeherrschende Unternehmen, Vereinigungen von Unternehmen im Sinne der §§ 2 bis 8, 28 Abs. 1 sowie § 29 und Unternehmen, die Preise nach den §§ 15, 28 Abs. 2, § 29 Abs. 2 und § 30 Abs. 1 binden, dürfen ein anderes Unternehmen in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, weder Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 28 unmittelbar noch mittelbar unbillig behindern oder gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandeln. (2) Absatz 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen kleine oder mittlere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, daß ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf andere Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen. Es wird vermutet, daß ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen von einem Nachfrager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser Nachfrager bei ihm zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonstigen Leistungsentgelten regelmäßig besondere Vergünstigungen erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden. (3) Marktbeherrschende Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 dürfen ihre Marktstellung nicht dazu ausnutzen, andere Unternehmen im Geschäftsverkehr zu veranlassen, ihnen ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorzugsbedingungen zu gewähren. Satz 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen Unternehmen. (4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis anbietet, es sei denn, dies ist sachlich gerechtfertigt. (5) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein, daß ein Unternehmen seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 4 ausgenutzt hat, so obliegt es diesem Unternehmen, den Anschein zu widerlegen und solche anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich aufzuklären, deren Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach § 33 nicht möglich, dem in Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich und zumutbar ist. (6) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften dürfen die Aufnahme eines Unternehmens nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen würde. » Siehe auch: : Diskriminierung Betriebsstörung Behinderung des fremden Betriebes kann wettbewerbswidrig sein. Behinderung durch Abmahnungen (insbesondere wegen angeblichen Kennzeichenverletzungen) kann wettbewerbswidrig sein. Behinderung druch Kennzeichenerwerb (Eintragung von Marken, die anderes Unternehmen für eigene Produkte verwendet) Sonderfall: Domain-Anmeldung zur Behinderung Störung des Betriebsfriedens (Aufstacheln fremder Arbeitnehmer, Aufforderung zum Vertragsbruch in Bezug auf den Dritten, zur Spionage vgl. §§ 17 ff. GWB etc.) Boykottaufruf Boykott: Aufrufer fordert Dritten auf den Boykottierten zu boykottieren. Grundsätzlich wettbewerbswidrig, da Verstoß gegen den Leistungswettbewerb. Ausnahmsweise rechtmäßig, wenn Boykottaufruf Ausdruck der Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG ist (allerdings dann Interessenabwägung notwendig). Diskriminierung Ungleichbehandlung von Vertragspartnern ist grundsätzlich zulässig (Leistungswettbewerb). grundsätzlich zulässig Wahl des Absatzsystems (keine Verpflichtung zur Einhaltung von Absatzstufen, kein Zwang mit bestimmten Partnern zu kontrahieren) Kontrahierungszwang kann sich aus § 20 GWB ergeben. Ausnahmsweise kann dies unlauter sein: Diskriminierer ist Marktbeherrschend (-> § 14 GWB, § 20 GWB) Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 29 » Siehe auch: : GWB 2.1.3 Vergleichende Werbung Neufassung des § 2 UWG Vergleichende Werbung ist nunmehr grundsätzlich erlaubt. Vortrag - sachliche Vortrag - unsachlich Tatsachen - richtig -> zulässig -> unzulässig Tatsachen - unrichitg -> unzulässig -> unzulässig Unterscheiden muss man zwischen einem Systemvergleich, Vergleich von Warenarten und dem konkreten Produktvergleich. Auch Systemvergleiche oder Warenartenvergleiche müssen aber sachlich richtig sein. § 2 UWG (neu ab 2000) (1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht. (2) Vergleichende Werbung verstößt gegen die guten Sitten im Sinne von § 1, wenn der Vergleich sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht; Vergleich muss sich auf Waren / Dienstleistungen für den gleichen Bedarf/Zweck beziehen, z.B. unzulässig etwa der Vergleich eines Notebook mit einem Desktoprechner. Waren mit Ursprungsbezeichnungen müssen sich auf den gleichen Ursprung beziehen nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist; Vergleich muss sich objektiv, wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis beziehen. Das bedeutet, dass die Eigenschaft für eine nicht unerhebliche Anzahl von Verbrauchern der Kaufentschluss beeinflusst werden kann, z.B. unzulässig wäre etwa Vergleich der Gehäusefarbe einer eingebauten Festplatte. im geschäftlichen Verkehr zu Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt; es genügt die abstrakte Verwechslungsgefahr. die Wertschätzung des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt; keine Ausnutzung der Marke des anderen (vgl. die Ausführungen zur Rufausbeutung oben). die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder nicht herabsetzend oder verunglipfend (siehe oben § 1 UWG). Da Vergleich regelmäßig Nachteilig für den Mitbewerber sein wird, müssen besondere Umstände hinzutreten. eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt. Ware/Dienstleistung nicht als Imitation darstellen (also das Verbot von sich selbst zu behaupten, ein Nachbau oder eine Imitation eines Originals zu sein). (3) Bezieht sich der Vergleich auf ein Angebot mit einem besonderen Preis oder anderen besonderen Bedingungen, so sind der Zeitpunkt des Endes des Angebots und, wenn dieses noch nicht gilt, der Zeitpunkt des Beginns des Angebots eindeutig anzugeben. Gilt das Angebot nur so lange, wie die Waren oder Dienstleistungen verfügbar sind, so ist darauf hinzuweisen. vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. Februar 1998, I ZR 221/95 Keine vergleichende Werbung: bei Sprüchen ohne Bezug auf bestimmte Mitbewerber vor. Beispiele: "In Asbach Uralt ist der Geist des Weines"; "von höchster Reinheit"; "Das beste Persil, das es je gab"; X wächst besser denn je"; "Nie gab es besseres Sunil". Vergleich mit der eigenen Leistungen werden gezogen: Erlaubt sind auch Sprüche wie: "Prüfe hier, prüfe da, kaufe dann bei C & A"; "hoffentlich Allianz versichert". Derartige Appelle (Werbeimperative) stellen keine erkennbare Bezugnahme auf bestimmte Konkurrenten dar. Es liegt aber vergleichende Werbung vor, wenn die Aufforderung einen bestimmten Mitbewerber erkennbar macht. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 30 Eine vergleichende Werbung ist nur dann herabsetzend oder verunglimpfend, wenn über die mit jedem Werbevergleich verbundenen (negativen) Wirkungen für den Mitbewerber hinaus besondere Umstände hinzutreten, die den Vergleich in unangemessener Weise abfällig, abwertend oder unsachlich erscheinen lassen. Nur eine unnötige Herabsetzung oder unsachliche pauschale Abwertung von Mitkonkurrenten und ihrer Waren machen deshalb einen Vergleich unlauter. Kränkende, aggressive, gehässige, ironische, der Lächerlichkeit preisgebende Angaben, wie: ....wir bieten keine Lockangebote (wie viele Möbelfirmen, die Ihnen später unbedingt etwas Teures verkaufen wollen) ....Zahnpasta - atemberaubend frisch, hat einen aufregenden Geschmack, gibt dem Mund Sexappeal....dagegen ist alles andere bloß eben Zahnpasta. ....Unsere preiswertester Kaffee schmeckt besser als bei vielen das beste vom besten. 2.1.3.1 Fall: Tennischläger BGHZ 138, 55: K ist eine deutsche Vertriebsgesellschaft einer bekannten amerikanischen Sportartikelherstellerin mit den Schwerpunkten Golf und Tennis. Sie stellt Tennischläger aus Graphite-Fiberglas (Composite-Rackets) her. B unterbreitete zwei Mitarbeitern der K, die zu Testzwecken an sie herangetreten waren, Angebote, denen folgendes Schreiben beigefügt war: "Sie wollen wissen, warum es sich lohnt, Kunde bei P-Tennis zu werden ? Jedes P. Racket besteht aus Werkstoffen der neuesten High-Tech Linie (wie z.B. HI-Modulus Graphit, Ceramic und Kevlar) und verkörpert das zur Zeit Mögliche in der Racket-Technologie. Billige Composite Rackets (Graphite-Fiberglas) muten wir Ihnen nicht zu. Spezielle Saiten-Testpakete liegen für Sie bereit (s. beiliegendes Datenblatt) - Jedes Racket erhalten Sie einmalig zum besonders attraktiven Testpreis von 110,-- DM ..." K hat die in dem Schreiben enthaltene Aussage "Billige Composite Rackets (Graphite-Fiberglas) muten wir Ihnen nicht zu" als herabsetzende vergleichende Werbung beanstandet und den B. abgemahnt. K begehrt Unterlassung und Schadenersatz. Zu Recht ? 2.1.3.2 Lösungsansatz: Tennisschläger K trägt - zu Recht vor - dass es bei Billigschlägern der Kategorie "Composite-Rackets (Graphite-Fiberglas) auch hochwertige Erzeugnisse gebe, d.h. einen Graphit-Werkstoff, der etwas Besonders ist (neueste High-Tech Linie). Es handelt sich um einen Fall der vergleichenden Werbung, denn in der Werbung werden bestimmte Mitbewerber und die von ihnen angebotenen Waren hinreichend erkennbar macht. Denn der Werbevergleich bezieht sich auf Anbieter von Composite-Rackets, die von B produziert werden. Es erscheint nach der Lebenserfahrung nicht naheliegend, dass der Verbraucher die Werbung dahingehend verstehen, es gebe auch hochwertige Schläger aus Graphit und Fiberglas. Die Werbung enthält deshalb die negative Aussage, dass die Composite-Rackets technisch überholt und minderwertig sind. Dies ist jedoch unzutreffend. Denn in dieser Gattung gibt es auch hochwertige Schläger. Diese pauschale Herabsetzung ist unlauter im Sinne des § 1 UWG (§ 2 II Nr. 5 UWG). 2.1.3.3 Fall: Colavergleich NJW 1987, 438: B stellt P-Cola her und vertreibt diese colahaltige Limonade. B hat einen Werbefilm herstellen lassen, der in Filmtheatern vorgeführt wird und dessen Ausstrahlung im Fernsehen vorgesehen ist. Mit diesem Film wird für P-Cola geworben. Gezeigt wird der P-Test, bei dem eine jugendliche Testperson einen Geschmacksvergleich mit zwei weiteren nicht namentlich genannten Cola-Limonaden durchführt. Dazu heißt es: „Martin steht nicht allein, es gibt noch viele andere, die nicht wissen, wie gut P-Cola schmeckt, denn jeder hat seinen anderen Geschmack und jedes Cola schmeckt anders“. Die Konkurrenzfirma C klagt auf Unterlassung dieser Werbung. Zu Recht ? Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 31 2.1.3.4 Lösungsansatz: Colavergleich Bei der vergleichenden Werbung kommt es auf die konkrete Erkennbarkeit des Mitbewerbers an. Hier ist aufgrund des Marktes für Cola-Getränke der Mitwerber klar zu erkennen. So kommen die Zuschauer wegen der überragenden Marktstellung von Coca Cola zu dem Ergebnis, eines der Getränke sei Coca-Cola. Diese Werbung ist zulässig. Es handelt sich nicht um eine Herabsetzung von C. Die Werbung beinhaltet die Aufforderung, die eigene Ware und die Konkurrenzware zu vergleichen. Dies ist nicht wettbewerbswidrig. Denn eine kritisierende Aussage wird nicht gemacht. Abgestellt wird auf die Subjektivität des Geschmacksempfindens. Die Werbung übermittelt die Botschaft, dass Cola Getränke unterschiedlich schmecken. Wenn Cola Trinker verschiedene Getränke selbst probieren, entwickeln sie unterschiedliche Präferenzen. Die Verbraucher versteht dies nicht als objektiven Warentest. Eine vergleichende Werbung liegt nicht vor, wenn es an der konkreten Bezugnahme auf einen oder mehrere Mitbewerber fehlt. Gibt es nur wenige Konkurrenten, so ist eine Bezugnahme eher anzunehmen als bei vielen Mitbewerbern. 2.1.3.5 Fall: Modeschmuck BGH, GRUR Int. 1999, Heft 5, 453: P.L. und B stehen beim Vertrieb von Modeschmuck untereinander in Wettbewerb. B vertreibt ihren Modeschmuck unter Mitarbeit von etwa 10 000 Beratern, wobei der Schmuck unter Gewinnbeteiligung der Berater veräußert wird. Die Berater sind selbstständige Unternehmer. B warb eine Beraterin mit folgendem Schreiben an: "Diese Chance bietet sich Ihnen heute mit einer anderen Produktpalette an ! Es handelt sich dabei um hochwertigen Designer-Modeschmuck zu akzeptablen Preisen. Vergleichen Sie einmal mit dem Katalog von ‚P.L.'!" P.L. beanstandete diese Aussage als unzulässige vergleichende Werbung. Zu Recht ? 2.1.3.6 Lösungsansatz: Modeschmuck Hier werden Erzeugnisse in Beziehung zu den Produkten des Wettbewerbers gebracht. Es liegt deshalb eine vergleichende Werbung vor. Die Aussage ist auch nicht irreführend, da sie wahr ist. Es werden auch Waren für den gleichen Bedarf oder die gleiche Zweckbestimmung verglichen. Denn es ist ein weites Verständnis der Vergleichbarkeit zugrund zu legen. Ein Werbevergleich ist grundsätzlich auch bei nichtidentischen Produkten zulässig, sofern diese Produkte funktionsidentisch sind und aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher als Substitutionsprodukte in Betracht kommen. Ein Vergleich muss sich auch nicht auf konkrete Waren beziehen, sondern es genügt, dass er sich - wie hier - auf die Warengattung "hochwertiger Designer-Modeschmuck" insgesamt bezieht. Der Bereich des Modeschmucks ist hinreichend überschaubar und vom echten Schmuck abgegrenzt. Es stimmt allerdings, dass ein Vergleich - zu dem auch der Preis gehört - bei einem auf die ganze Warengattung bezogenen Vergleich erschwert ist. Jedoch kann auch hier der Warenvergleich auf seine sachliche Berechtigung hin überprüft werden. Es ist nicht erforderlich, dass ein solcher Vergleich ohne weiteres und jeglichen Aufwand möglich ist. Es ist hier jedenfalls zumutbar, die im Katalog der Klägerin enthaltenen Artikel hinsichtlich ihrer Preisangaben mit ähnlichen Artikeln der Beklagten zu vergleichen. Der Preisvergleich ist auch nicht pauschal herabsetzend (vgl. § 2 II Nr. 5 UWG). Schon die Gleichsetzung von Herabsetzung und Verunglimpfung macht deutlich, dass nicht jede herabsetzende Wirkung, die einem kritischen Werbevergleich immanent ist, ausreicht. Denn Werbung macht nur Sinn, wenn das werbende Unternehmen seine Produkte anpreisend herausstellt. Ein Preisvergleich, der die eigenen Produkte als preisgünstiger herausstellt, geht zu Lasten derjenigen Mitbewerber, die ihre Produkte teurer anbieten. Deshalb sehen die angesprochenen Personen allein noch keine Herabsetzung oder Verunglimpfung der teueren Mitbewerber. Es müssen deshalb weitere Umstände hinzutreten, die den Vergleich unzulässig machen. Solche Umstände sind hier nicht ersichtlich. Hier ist der Preisvergleich nicht als gezielte Abwertung der Klägerin zu werten, sondern es soll der Eindruck vermittelt werden, dass es interessant ist, für die Beklagte zu arbeiten, weil deren Produkte im Vergleich zu anderen Anbietern vergleichbaren Schmucks preislich günstiger sind. Durch diese Zielsetzung wird der Vergleich neutralisiert und aus der Sphäre der Herabsetzung gerückt. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 32 2.1.3.7 Fall: Partnervermittlung OLG Stuttgart, WPR 1992, 132: B betreibt ein Bekanntschafts- und Partnervermittlungsinstitut. Sie gab in einer Zeitschrift ein Inserat auf, in dem sie auf die Warnungen vor unseriösen Instituten und langatmigen Anzeigen durch die Stiftung Warentest und die Verbrauchzentralen hinwies und anschließend hervorhob, dass sie als langjähriges Verbandsinstitut eine korrekte und seriöse Arbeitsweise garantiere. So heißt es: „Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen warnen vor unseriösen Instituten und vor langatmigen, traumhaften Anzeigen. Als langjähriges Verbandsinstitut ist bei uns eine korrekte und seriöse Arbeitsweise garantiert“. Liegt ein Verstoß gegen das UWG vor ? 2.1.3.8 Lösungsansatz: Partnervermittlung § 1 UWG: Hier will B nicht nur auf die eigene Seriosität und Korrektheit hinweisen. sondern sich selbst im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern anpreisen, vor deren Anzeigen die Stiftung Warentest wegen deren langatmigen und traumhaften Anzeigen warnt. Hier wird aber nicht auf bestimmte individualisierte Mitbewerber Bezug genommen, sondern nur auf die derjenigen Mitbewerber, welche die von der Stiftung Warentest behauptete Kritik erfahren haben. Dann ist die Werbung nur unlauter, wenn sie unwahr ist und wenn sie eine unnötige Herabsetzung oder eine unsachliche pauschale Abwertung der Mitkonkurrenten und ihrer Dienstleistungen enthielte. Dies ist hier aber nicht so. Was die Stiftung Warentest sagt, stimmt. Unseriöse Institute sind nicht selten anzutreffen. Die Anzahl der schwarzen Schafe ist hier höher als in anderen Branchen. § 1 UWG ist nicht verletzt 2.1.3.9 Fall: Sommerblazer WRP 1991, 268: Im Rundfunkprogramm Bayern 3 wurde folgender Werbespot der K + L.R. gesendet: „Also als Frau von Format hat man's ja nicht immer leicht. Neulich suchte ich Sommerblazer. Beim - Geräusch - hatten sie nur Gestreiftes bis Größe 42. Beim - Geräusch - gab's grosse Größen zu üppigen Preisen. Danach hatte ich's dicke und ging zu K + L.R. - und was fand ich: meinen Sommerblazer zu Superpreisen. Also nächstes Mal spar ich mir den - Geräusch - und geh gleich zu K + L.R.“ „Also ich wollt' mal was für die Karriere tun und mir einen ganz edlen Business-Anzug kaufen. Ich also hin zum - Geräusch -. Also da standen meine Aktien schlecht. Schließlich krieg ich einen ganz heißen Tipp: K + L.R. Ich nichts wie hin und da hing er dann: Englisch, edel, elegant, aber nur halb so teuer. Also nächstes Mal gehe ich nicht erst zum - Geräusch - oder - Geräusch -, sondern gleich zu K + L.R.“ Verstößt dieser Vergleich gegen § 1 UWG ? 2.1.3.10 Lösungsansatz: Sommerblazer Zwar werden die Konkurrenten nicht namentlich erwähnt. Sie sind jedoch erkennbar, denn bei begrenzten Einkaufsmöglichkeiten wird gezielt die Konkurrenz angesprochen. Es liegt ein pauschal herabsetzender Vergleich vor. Eine pauschal herabsetzende Werbung ist unzulässig. Unzulässig ist insbesondere, wenn der Vergleich nicht nur die eigene Leistung herausstellt, sondern im wesentlichen die Leistung der Mitbewerber in nicht nachprüfbarer Weise pauschal und schlagwortartig abgewertet wird. Dies ist hier der Fall. 1. Spot: Der Begriff: „Frau von Format“ wendet sich an stattliche Damen, die nicht ohne weiteres die gängigen Größen tragen können. Trotz des Formats wollen sie schlank wirken. Es handelt sich um eine ernstzunehmende Käuferschicht. Hier ist die Auswahl geringer und Preise sind höher als bei gängigen Größen. Beim ersten Konkurrenten: Auswahl nach Musterung und Größe unzureichend. Beim zweiten: Es stört der Preis. Beim K stimmen Auswahl und Preis. Deshalb nicht woanders kaufen. Gleich zu K. 2 Spot: Anzug beim Konkurrenten teuer. Beim anderen auch. Beim K: gut und nur halb so teuer. Deshalb gleich zu K. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 33 Die Konkurrenten werden dadurch abqualifiziert. Es wird die gesamte Konkurrenz herabgesetzt, denn diese ist nicht erkennbar, also austauschbar. Jeder Hörer denkt aufgrund seiner individuellen Erfahrungen an einen bestimmten Konkurrenten. Dies ist eine gegen § 1 II Nr. 5 UWG verstoßende unzulässige Herabsetzung der Konkurrenten. 2.1.3.11 Fall: Listenpreis B verbreitet einen Werbeprospekt mit folgendem Inhalt: "Alle Uhren und Goldwaren mit fabrikempfohlenen Einzelhandelspreisen: 40 % können Sie sparen, wenn Sie bei uns kaufen. Beweis: Prüfen Sie unsere umseitige Preisliste". Liegt ein Verstoß gegen das UWG vor, wenn sich andere Händler ganz überwiegend an die fabrikempfohlenen Einzelhandelspreise halten ? 2.1.3.12 Lösungsansatz: Listenpreis Der Preisvergleich ist wahr. Er ist auf identische Erzeugnisse des gleichen Herstellers gerichtet. Es liegt im Wesen eines Preisvergleichs, der die eigenen Erzeugnisse als preisgünstiger herausstellt, dass er zu Lasten derjenigen Mitbewerber geht, die ihre Produkte teurer anbieten. Das weiß der Verkehr, der aus der täglichen Werbung an unterschiedliche Preise für vergleichbare Erzeugnisse gewöhnt ist. Er sieht in einem Preisvergleich allein noch keine Herabsetzung oder Verunglimpfung der teueren Mitbewerber, sondern empfindet ihn als Ausdruck eines funktionierenden Preiswettbewerbs. Es müssen deshalb besondere Umstände hinzutreten, die den Vergleich in unangemessener Weise abfällig, abwertend oder unsachlich erscheinen lassen. Dies ist hier nicht der Fall. Kein Verstoß gegen § 1 UWG gegeben. Der Preisvergleich ist auch nicht irreführend i.S.d. § 3 UWG. Wer ein Erzeugnisse billiger anbietet als die Mitbewerber, muss das Publikum darauf aufmerksam machen können = nützlicher Vergleich. 2.1.3.13 Fall: Trinkwasser OLG München, NJW-E-WettbR 2000, 177: K ist als Fachverband der Deutschen Mineralbrunnen im Vereinsregister eingetragen. B ist die Betreiberin der Stadtwerke M und versorgt die Bevölkerung der Stadt M sowie 20 weitere angrenzende Gemeinden u.a. mit Trinkwasser. Die Stadtwerke M starteten eine Plakataktion. Die Bilder von der Größe 5 mal 3 m gaben einen aus einer Flasche hervorgehenden Wasserhahn wider, der in ein Trinkglas tropft und daneben den Text: "Hängen Sie noch an der Flasche ? Wir liefern Ihnen. Frisches Quellwasser direkt ins Haus, den Kasten für 1,7 Pfennige. Zapfen Sie selbst ! Trinkwasser aus dem Voralpenland, natürlich frisch und unbehandelt". Ist diese Werbung zulässig ? 2.1.3.14 Lösungsansatz: Trinkwasser Als vergleichende Werbung ist jede Werbung anzusehen, die unmittelbar oder mittelbar (zumindest) einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht. Hier stehen Trinkwasser und Mineralwasser miteinander im Wettbewerb. Vergleichende ist grundsätzlich als zulässig anzusehen, wenn sie die Waren der betroffenen Mitbewerber nicht herabsetzt. Jedoch liegt hier ein herabsetzender Vergleich vor. Dies ergibt sich aus der Bemerkung: "Hängen Sie noch an der Flasche ?" in Verbindung mit dem abgebildeten Etikett des Wasserhahns, welches sich sehr stark an die üblicherweise für Mineralwasserflaschen verwendeten Etiketten anlehnt und die Aussage der Stadtwerke, ihr Trinkwasser sei "natürlich frisch und unbehandelt". Es liegt ein Fall der vergleichenden Werbung vor, denn die Mitbewerber - die Mineralwasserproduzenten - und ihre Waren sind hinreichend erkennbar. Auch ist der Vergleich herabsetzend, denn die Formulierung "an der Flasche hängen" wird im allgemeinen für Alkoholabhängigkeit benutzt. Zwar ist Mineralwasser keine suchtfördernde Wirkung zuzuschreiben, jedoch ist die Verknüpfung mit dem Begriff "Abhängigkeit" als insgesamt negativ zu werten. Es mag schon sein, dass es sich um ein ironisch-plakatives Wortspiel handelt, jedoch ändert dies nichts daran, dass der in solchen Wortspielen liegende feine Witz die Grenze zur Unsachlichkeit nicht überschreiten und das Konkurrenzangebot im Vergleich mit dem eigenen Angebot nicht als minderwertig herausstellen darf. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 34 Auch das Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit schützt die Stadtwerke nicht. Denn das Plakat wird jedenfalls auch zur Werbung eingesetzt. Art. 5 I GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 2.1.3.15 Fall: Bundesbahn OLG Frankfurt a.M., GUR-RR 2001, 221: L und B sind Wettbewerber im Bereich der innerdeutschen Personenbeförderung. L ist ein Flugverkehrsunternehmen, B ein Schienenverkehrsunternehmen, die Deutsche Bahn AG. L wendet sich gegen die Werbung der B, die ein kreisendes Flugzeug zeigt und den Text enthält: "Deutschlands Manager machen zu viele Überstunden". In der rechten unteren Ecke ist das Firmenlogo der Bahn abgedruckt. Ist die Werbung zulässig ? 2.1.3.16 Lösungsansatz: Bundesbahn Es handelt sich um einen Systemvergleich zwischen den Verkehrsmitteln Flugzeug und Bahn, nicht um einen Produkt- und Dienstleistungsvergleich. Deshalb beurteilt sich der Sachverhalt gemäß § 1 UWG und nicht gemäß § 2 UWG n.F. Ein solcher Vergleich ist unzulässig, wenn er gegen das Sachlichkeitsgebot verstößt. Dieser liegt vor, wenn zu den mit jedem Werbevergleich verbundenen (negativen) Wirkungen für die Konkurrenz besondere Umstände hinzutreten, die den Vergleich in unangemessener Weise abfällig, abwertend oder unsachlich erscheinen lassen. Hier liegt eine pauschale Herabsetzung des Flugverkehrs vor. Die Wettbewerbssituation der L wird beeinträchtigt. Die Aussage ist so zu verstehen, dass man beim Benutzen eines Flugzeuges nicht damit rechnen kann, pünktlich und termingerecht am Zielort anzukommen. Dieser Nachteil wird plakativ angeprangert. Es ist jedoch unzulässig, nur die Nachteile des anderen zu erwähnen, die eigenen aber zu verschweigen. Auch die Bahn fährt regelmäßig Verspätungen ein. Es kommt nicht darauf an, dass bekannt ist, dass es auch bei der Bahn zu Verspätungen kommt. Es kommt auch nicht darauf an, ob Verspätungen im Flugverkehr quantitativ gravierender sind als beim Bahnverkehr. Schließlich ist für die rechtliche Beurteilung auch unmaßgeblich, dass die Werbeaussage humorvoll-ironische Züge trägt. Die Werbung ist deshalb wettbewerbswidrig. 2.1.4 Allgemeinheitsbezogene Unlauterbarkeit Vorsprung durch Rechtsbruch Gesetzesverletzung Vertragsverletzung Beteiligung am fremden Vertragsbruch (Ausspannen) Verletzung von Preis- und Vertriebsbedingungen Maktstörung Preisunterbietung Kostenloses verteilen von Waren Einsatz von Laienwerbern 2.1.4.1 Gesetzesverletzung Sittlich fundierte Normen Vorschriften die wertende Grundregeln unserer Gesellschaft unmittelbar regeln z.B. Grundrechte, Straftatbestände, § 138 Abs. 2 BGB, §§ 1,2,17 TierSchG Schlicht wettbewerbsbezogene Normen Vorschriften die dem Schutz von Individualinteressen (z.B. Gesundheitsschutz) oder unmittelbar dem Schutz des Wettbewerbs oder anderen sittlich motivierten Zielen dienen Neutrale Normen alle anderen Vorschriften, insbesondere wenn sie lediglich ordnenden Character haben. Verstoß nur ausnahmsweise, wenn die Verletzungshandlung bewußt, Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 35 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 gezielt den Rechtsbruch nutzt objektiv und subjektiv den Rechtsbruch zu wettbewerbsvorteilen ausnutzt. Fall: Who is who K und B betreiben jeweils eine Website mit Veranstaltungsinformationen. K hat sämtliche nach dem Mediendienstestaatsvertrag, dem Teledienstegesetz und dem Datenschutzgesetz erforderlichen Angaben gemacht, B hat lediglich seinen Namen ohne weitere Angaben auf der Rechtsform, zu Vertretungen zur Adresse auf seinen Seiten. K behauptet, diese Seiten von K rechtswidrig und er müsse diese Seite entfern. Lösungsansatz zu who is hwo B verstößt gegen die Vorschriften des BDSG, TDDSG und §§ 312a ff BGB nach dem eine Regel mit Veröffentlichungspflicht bestehen. Diese Vorschriften sind nicht grundlegend werdtend. Vorschriften ordnen im Interesse der zu schützenden Interessen des Verbrauchers Offenbarungspflichten des Herstellers. Sie dienen dem Schutz des Verbrauchers. (Anderes gilt für die allgemein ordnenenden Vorschriften im Datenschutzrecht beispielsweise. => hier Wettbewerbswidrigkeit. 2.1.4.2 Vertragsbruch Beteiligung am fremden Vertragsbruch Verleiten zum Vertragsbruch Ausnutzen fremden Vertragsbruchs, 2.1.4.3 Verletzung von Preis- und Vertriebsbindungssystemen Grundsatz: vertikale Preisbindungssysteme sind nach § 14 GWB unzulässig (Ausnahme z.B. Buchhandel). Verletzung der Preisbindung durch Aussenseiter. zulässige Preisbindung Verleiten des Anbieters zum Vertragsbruch Schleichbezug Preisgebundene Waren werden auf rechtswidrigem, betrügerischem Weg besorgt Ausnutzen fremden Vertragsbruchs Bezug preisgebundener Waren ohne dass der Bezieher den Rechtsbruch provziert hat Vertriebsbindungssysteme - Verletzung durch Aussenseiter Schleichbezug und Verleiten zum Vertragsbruch Ausnutzen fremden Vertragsbruchs hier bedarf es weiterer unlauterer Umstände: z.B. unterbieten der Preise der gebundenen Händler Lückenlosigkeit des Vertriebssystem Entfernen von Herstellernummern wettbewerbswidrig wegen Irreführung, Behinderung 2.1.4.4 Marktstörung Anwendung des UWG ist neben dem GWB möglich. Voraussetzungen: Gefährdung des Wettbewerbs Markt muss in räumlicher, sächlicher und zeitlicher Hinsicht einheitlich betroffen sein Ursächlichkeit des Verhaltens für den Bestand des Wettbewerbs Interessenabwägung Wettbewerbswidrig der Widerspruch zum Leistungswettbewerb Freiheit der Marktteilnehmer Vergleich der Leistungen miteinander Leistungen können sich frei entwickeln Abnehmer können frei Wählen Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 36 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 Einzelfälle: Preisunterbietung kann auch hier wettbewerbswidrig sein Verteilen von Originalware Einsatz von Laienwerbern 2.2 Irreführende Werbung § 3 UWG §3 Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs über geschäftliche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung einzelner Waren oder gewerblicher Leistungen oder des gesamten Angebots, über Preislisten, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte irreführende Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden. § 3 UWG sieht vor - Handeln im geschäftlichen Verkehr - zu Wettbewerbszwecken - Angaben über geschäftliche Verhältnisse - Irreführung - Eignung zur Beeinflussung der Kunden - Interessenabwägung Angaben - geschäftliche Verhältnisse ist weit aufzufassen alles was für das Unternehmen, Produkte bedeutsam ist - alle Aussagen (nicht reine Werturteile, oder nichtssagende Anpreisungen) (Vgl. zur falschen Alleinstellungsbehauptung OLG Düsseldorf Az.: 2 U 74/00 U. v. 18.01.2001 "größte Programmzeitschrift" eine zulässige Behauptung wurde hier gesehen LG Düsseldorf Az.: 12 O 507/99 U.v. 2.12.1999 "beste Telefongesellschaft") Irreführung - Entscheidend Eindruck des flüchtigen, ungezwungenen Betrachters. - es genügt, dass nicht jeder die Werbung gleich versteht - auch objektiv Richtiges kann irreführend sein - ca. 10 % - 15 % falsches Verständnis genügen (bei Gesundheitswerbung genügen sogar nur 5 % - 6 %. vgl. dazu die Pressemitteilung des BGH zur Entscheidung "Mitwohnzentrale" unter dem Gesichtspunkt der Irreführung http://www.uni-karlsruhe.de/~BGH/PressemitteilungenBGH/PM2001/PM_042_2001.ht m Eignung zur Beeinflussung der Kunden Ergibt sich regelmäßig aus der Irreführung. Werden keine Verbraucherinteressen oder solche von Wettbewerbern betroffen, muss sie festgestellt werden. Interessenabwägung Ausnahmsweise, wenn keine anderen Interessen verletzt sind, können Interessen des Unternehmens an (ausnahmsweise Irreführung zulässig, z.B. bei Verwendung gesetzlicher, aber irreführender Begriffe). 2.2.1 Fall: Größe Programmzeitschrift Der Internetdiensteanbieter webtimer.de (W) betreibt im Internet einen Informationsdienst, der unter anderem über Veranstaltungen im Internet und "Chats" mit bekannten Persönlichkeiten informiert und 1999 gestartet wurde. Ein anderer Anbieter beginnt Anfang 2000 www.teXXas.de (T). Er wirbt sofort im Internet mit der Aussage, sie sei die "größte Programmzeitschrift für das Internet im Internet". Dagegen wendet sich webtimer.de, weil sie meint, unmittelbar mit dem Start könne man nicht der größte im Netz sein. texxas.de wendet dagegen ein, man werde von einem der größten Vermarkter im Internet vermarktet und deshalb dürfe man mit dieser Aussage werben. Kann W von T verlangen, dass die Werbeaussage zu unterlassen? (Vgl. OLG Düsseldorf Az.: 2 U 74/00 U. v. 18.01.2001) Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 37 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 2.2.2 Angaben Unterscheidung: nicht nachprüfbare Wertäußerung nachprüfbare Tatsachenbehauptungen 2.2.3 Fall: Omnibusfahrt BGH, GRUR 1988, Heft 2: K veranstaltet Omnibusfahrten, in deren Verlauf die Teilnehmer Gelegenheit haben, eine Verkaufsveranstaltung zu besuchen. K bot nach Maßgabe eines von ihr ausgegebenen Prospekts eine 7-tägige Fahrt nach Lloret de Mar in Spanien an, auf der die Teilnehmer in insgesamt acht Orten zusteigen können sollten und deren Preis sich je Teilnehmer auf DM 249,50 belaufen sollte. Der Prospekt der K war wie folgt gestaltet: In der oberen Hälfte der dritten Prospektseite setzte sich die Reiseverlaufsbeschreibung im gleichen Druckbild wie die der beiden ersten Tage auf Seite 2 des Prospektes bis zum 7. Tag der Reise fort. Die untere Hälfte der ersten drei Prospektseiten sowie die ganze vierte Seite enthielten im wesentlichen Farbfotos des Zielgebietes mit beschreibenden Angaben. Verstößt eine derartige Verkaufsfahrt gegen das UWG ? 2.2.4 Lösungsansatz: Omnibusfahrt Auch mehrtägige Reisen verbunden mit einer Verkaufsveranstaltung verstoßen grundsätzlich nicht gegen das UWG. Hier ist die Anlockwirkung jedoch noch größer als bei eintägigen Fahrten. Es besteht eine größere Einflussmöglichkeit auf die Käufer. Auch ist die Zusammensetzung anders als bei Ein-Tages-Fahrten: Hier fahren überwiegend Hausfrauen und Ältere mit. Zudem besteht Freiwilligkeit der Teilnahme an der Verkaufsveranstaltung. Der potentielle Teilnehmer ist eindeutig über den Zweck der Reise aufzuklären. An Form und Inhalt dieser Unterrichtung sind strenge Maßstäbe zu stellen. Notwendig ist ein eindeutiger, unmissverständlicher und insbesondere auch für die flüchtigen Betrachter unübersehbarer Hinweis darauf, dass es sich um eine mit einer Verkaufsveranstaltung verbundene Reise handelt. Nicht nur die vorteilhaften Seiten der Reise dürfen blickfangmäßig herausgestellt werden, sondern auch deren Pferdefuß muss erwähnt werden, so durch die Größe der Buchstaben bzw. Fettdruck, Farbgebung, Gestaltung und räumliche Anordnung. Große Überschrift: 7 Tage Reise. F- Omnibusfahrt. Verkaufszweck nur erheblich kleiner. Die Teilnahmemöglichkeit an einer interessanten Werbeveranstaltung ist unauffällig angegeben. Deshalb: Es liegt ein Verstoß gegen §§ 1 und 3 UWG vor. 2.2.5 Herkunftstäuschung 2.2.5.1 Fall: Sekt 1811 BGH 36, 255: K stellt Sekt her. B stellt ebenfalls Sekt her. Beide stehen im Wettbewerb. K stellt seit 1826 Sekt her und bezeichnet sich in ihrer Werbung als die älteste deutsche Sektkellerei. B, die 1811 gegründet wurde, hat zunächst nur den Weinhandel betrieben, dann auch die Sektherstellung. Seit über 40 Jahren ist sie nur noch Sektkellerei-Unternehmen. B hebt in ihrer Werbung für Sekt das Jahr 1811 hervor. Außerdem verwendet sie ein Sektflaschenetikett, das in der Mitte ein Männerbildnis zeigt und darunter eine Inschrift mit den Lebensdaten ihres Gründers trägt: X.Y. 1773 - 1847 K erblickt in der Bezugnahme auf das Jahr 1811 und in der Wiedergabe des Gründerbildnisses mit den Lebensdaten einen Gesetzesverstoß. Sie beantragt deshalb, B zu verbieten, die Altersangabe "Seit 1811" zu verwenden oder durch die Verwendung der Angabe 1773-1847 den Eindruck zu erwecken, als ob sie die gewerbsmäßige Sektherstellung bereits vor oder seit Gründung ihres Unternehmens als Weinhandlung betreibe. Außerdem verlangt K von B Schadensersatz. Zu Recht ? 2.2.5.2 Lösungsansatz: Sekt 1811 A) Verstoß gegen § 3 UWG 1. Geschäftlicher Verkehr: Es genügt jede Tätigkeit, die irgendwie der Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks dient, auch wenn dieser ein fremder ist. Diese liegt hier vor. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 38 2. Zum Zwecke des Wettbewerbs: Es geht um den Schutz der Mitbewerber, aber auch den Schutz der Allgemeinheit vor aufdringlicher oder irreführender Werbung. 3. Irreführende Angaben über geschäftliche Verhältnisse: Angaben: Nachprüfbare Tatsachenbehauptung. Nicht: "Haribo macht Kinder froh. Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Keiner wäscht reiner". Es genügt eine objektive Irreführung. Die Gefahr einer Irreführung reicht aus. Es ist egal, ob diese zugleich als ein Verstoß gegen die guten Sitten zu werten ist. Hier liegt eine Irreführung über Eigenschaften des Werbenden vor. Man darf zwar auf das Gründungsjahr seines Unternehmens hinweisen, wenn diese Angabe wahr ist. Jedoch dann nicht, wenn das Publikum mit diesem Hinweis bestimmte Vorstellungen verbindet. Es kommt nicht darauf an, ob die Werbeangabe richtig oder falsch ist. Es kommt darauf an, dass sie das Publikum falsch versteht. Hier ist die Werbung untersagt, denn es entsteht ein falscher Eindruck. Die Altersangabe ist von großer Bedeutung. Ein langjährig eingeführtes Unternehmen hat einen Vorteil. Denn es besteht eine Gütevorstellung des Verbrauchers bei alten Unternehmen. 4. Verschulden: Darauf kommt es nicht an. Es genügt die objektive Irreführung. Rechtsfolge: Unterlassung der Angaben Evtl. Schadensersatz, wenn Umsatzeinbußen die Folge sind. B) Verletzung des § 14 UWG Wer zu Zwecken des Wettbewerbs über das Erwerbsgeschäft eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiter des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen. Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu schädigen (= Nachteile für die Ausübung der Erwerbstätigkeit. Schädigen = Beeinträchtigen, umfasst alles, was unter § 3 UWG fällt und Eignung zur Schädigung) und nicht erweislich wahr sind. (muss der Verbreiter beweisen). Rechtsfolge: Schadensersatz Hier gilt: Abgebildet wird das Bildnis des Gründers. Dieses ist erweislich wahr, denn dieser ist der Gründer der Firma. Hier werden nicht unwahre Tatsachen über das Unternehmen eines anderen behauptet. Hier behauptet der Konkurrent etwas über das eigene Unternehmen. Zwar indirekt auch über das fremde. Dies fällt jedoch nicht unter § 14 UWG. § 14 betrifft Fälle mit Behauptungen wie: Er fällt bald in Konkurs; beschäftigt nur Niedriglohngruppen (Anschwärzung) C) Verletzung des § 1 UWG 1. Geschäftlicher Verkehr: Alles, was mit dem Erwerb und der Berufsausübung des einzelnen zusammenhängt, was sich also nicht im rein privaten Bereich abspielt: Hier ist dieses Merkmal erfüllt. 2. Zu Zwecken des Wettbewerbs: 2.1. Jedes geschäftliche Handeln geschieht zu Zwecken des Wettbewerbs, soweit es objektiv geeignet ist, die eigene Wettbewerbslage in irgendeiner Form zu beeinflussen und subjektiv die Absicht der Förderung eigenen oder fremden Wettbewerbs nicht völlig hinter anderen Beweggründen zurücktritt. Dies ist hier der Fall. (Es gilt die Vermutung zugunsten des Wettbewerbs, wenn beide Firmen zueinander in Wettbewerb stehen). 3. Eine gegen die guten Sitten verstoßende Handlung (wahre Tatsachenbehauptungen und negative Werturteile): Abgestellt wird auf das Anstandsgefühl des durchschnittlichen Gewerbetreibenden bzw. der beteiligten Verkehrskreise. Die Werbung ist hier sittenwidrig. Rechtsfolgen: Unterlassung und Schadensersatz 2.2.5.3 Fall: Klosterbräu OLG Nürnberg, GRUR-RR 2001, 61: K betreibt eine Brauerei, die unter anderem ein Weizenbier herstellt und unter der Bezeichnung “G Mariehilfberger Fastenbier Weizenbock“ in den Verkehr bringt. Der Sitz der K liegt in der Nähe des Mariahilfberges in N. Auf diesem Berg befindet sich die Wallfahrtskirche „Mariahilfberg“, ein Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 39 Karmelitenkloster, das die Wallfahrtskirche seelsorgerisch betreut. Die Etiketten der K zeigen die Wallfahrtskirche und Teile des Karmelitenklosters. B betreibt ebenfalls eine Brauerei. Sie stellt unter anderem die Biersorten Pilsener, Dinkel und Spezial her, die sie mit dem Zusatz Kloster bezeichnet. Die von B verwendeten Etiketten enthalten ferner ein Emblem mit der Abbildung und Bezeichnung der etwa 30 km von der Braustätte entfernt liegenden Benediktinerabtei P. Die Benediktinerabtei P ist ein noch heute betriebenes Kloster, das von 1461 ab bis Anfang der 60er Jahre dieses Jahrhunderts Bier gebraut hat. K verklagt B auf Unterlassung. Sie hält die Bezeichnung „Kloster“ für die von B vertriebenen Biere für irreführend. Zur Begründung trägt sie vor, dass der Verkehr von einem „Kloster“-Bier erwarte, dass es in einer klostereigenen Braustätte gebraut werde, womit regelmäßig traditionell geprägt besondere Gütevorstellungen verbunden würden. Diese Gütevorstellungen rührten zum einen aus der Erwartung her, es werde ein traditionell bewährtes Brauverfahren angewandt, das in der Hand von Ordensleuten liege, die bei einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs hohes Ansehen genössen. Die Bezeichnung weise ferner auf den Ort der Braustätte hin, dessen Gegebenheiten, verwendetes Wasser, Luftqualität und Umgebung, den Geschmack und die Qualität des Bieres ganz erheblich beeinflussen würden. Der Verbraucher erwarte jedenfalls, dass das Bier in unmittelbarer Nähe zu der bezeichneten Klosterbraustätte und vor allem unter der ausschließlichen Verantwortung von Klosterangehörigen gebraut werde. In dieser Erwartung werde der Verkehr getäuscht, wenn das Bier in einer 30 km vom Kloster entfernten Braustätte gebraut werde. Daran ändere auch der Hinweis der B nichts, sie beziehe von der Abtei B Braugetreide, sei ihr vertraglich verpflichtet, das Kloster-Bier ausschließlich nach der Rezeptur des Klosters, das mit einem 10%tigen Kommanditanteil an der B wirtschaftlich beteiligt ist, zu brauen. Diese Rezeptur sei erst anlässlich der Zusammenarbeit der B mit dem Kloster erstellt worden und vorher in der Klosterbrauerei nie benutzt worden. Wer hat recht ? B hat Widerklage erhoben und u.a. die Meinung vertreten, dass die K ihrerseits bei der Vermarktung ihres Mariahilfberger Fastenbieres den Verkehr irreführe. Diese Bezeichnung in Verbindung mit der Abbildung des auf dem Mariahilfberg in N befindlichen Karmelitenklosters rufe beim Verkehr den Eindruck hervor, als seien Ordensleute in irgendeiner Form bei der Herstellung dieses Biers beteiligt, Dies sei in Wahrheit aber nicht der Fall. 2.2.5.4 Lösungsansatz: Klosterbräu 1. Klage der K Hier nahm das Gericht eine Irreführung an. Dem Durchschnittsbesucher sei bekannt, dass die Kunst des Brauens jahrhundertelang in Klöstern gepflegt wurde und die damit befassten Ordensleute besondere Erfahrungen und Kenntnisse gewannen, die innerhalb des Klosters tradiert und weitergegeben wurden. B betreibt keine Klosterbrauerei und arbeitet auch nicht im Lohnbrauverfahren für eine Klosterbrauerei. Allerdings wisse der durchschnittlich informierte Verbraucher, dass auch die noch existierenden Klöster über den Schwund von Angehörigen klagen und die Zahl von Klöstern und Ordensleuten zurückgeht. Er wisse deshalb, dass nicht alle früheren Aufgaben und Betätigungsfelder weiterhin noch durch Mönche wahrgenommen werden, sondern dass auch Klosterbetriebe entweder Laienangestellte beschäftigen oder Fremdbetriebe beauftragen müssen. Deshalb liegt keine Täuschung des durchschnittlichen Verbrauchers vor, wenn er weiß, dass Biere außerhalb von Klostermauern und nicht ausschließlich von Ordensleuten hergestellt werden. Auf der anderen Seite sei dem Durchschnittsverbraucher aber auch bekannt, dass die Kunst des Bierbrauens jahrhundertelang in Klöstern gepflegt wurde, und die damit befassten Ordensleute besondere Kenntnisse und Erfahrungen gewannen, die über Jahrhunderte weitergegeben wurde. Deshalb steht der Begriff "Kloster" für uralte Traditionen, da es Klosterneugründungen so gut wie gar nicht mehr gibt. Der durchschnittliche Verbraucher wird deshalb in der Anwendung von speziellem Klosterwissen einen Vorzug erblicken, der ein Klosterbier von anderen industriell oder in Privatbrauereien hergestellten Bieren unterscheidet. Hier werde das Bier jedoch nicht aufgrund traditioneller Rezepte der früheren Klosterbrauerei gebraut, sondern aufgrund neu erarbeiteter Rezepte, die in Zusammenarbeit zwischen B und der Brauerei entstanden sind. Deshalb liege eine Irreführung vor. 2. Zur Widerklage Auch hier liegt eine Irreführung vor. Denn der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass Bezüge zu der auf dem Maria Hilfberg befindlichen Kloster - durch Zusammenarbeit oder durch Übergabe von Wissen - bestehen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 40 2.2.6 Irreführung Ermittlung des einschlägigen, angesprochenen Verkehrskreises Missverständnis bei einer relevanten Gruppe des Verkehrskreises 10 - 20 % genügen reglemäßig BGH geht vom flüchtigen, oberflächlichen Verbraucher aus Ausgehend vom fast "debilen" Verbraucher wurde verschiedentlich kritisiert EuGH geht vom vom Leitbild des durchschnittlich informierten, verständigen, aufmerksamen Verbraucher aus. Wettbewerbliche Relevanz: Irreführung muss geeignet sein Verbraucher zu falscher Entscheidung zu veranlassen. 2.2.6.1 Fall: Pilze mit Heilkraft OLG Köln, GRUR-RR 2001, 64: A warb in einer Zeitschrift für den Verkauf von Shiitake-Pilzen in diversen Lebensmittelmärkten wie folgt: Abwehrtraining aus Fernost - soll gesundheitsfördernde Fähigkeiten besitzen, den Cholesterinspiegel senken, Viren bekämpfen, das Immunsystem stärken--- in China und Japan gilt Shiitake deshalb schon seit Jahrhunderten als Lebenselixier mit sagenumworbener Heilkraft - Seine Wirkung entfaltet Shiitake am besten, wenn er frisch bereitet wird - Er enthält den Stoff Lentinan, der das Immunsystem auf Trab bringen und den Körper vor vielen Krankheiten schützen soll. Ist diese Werbung wettbewerbsrechtlich zu beanstanden ? P.S.: Der Pilz besitzt die beschriebenen Inhaltsstoffe und ihm werden die in der Werbung herausgestellten Wirkungen zugeschrieben. Es gibt in der Fachliteratur keine einzige Stimme, die dem Shiitake-Pilz eine gesundheitsfördernde Fähigkeit abspricht oder die besagt, sein Genuss sei nicht geeignet, den Cholesterinspiegel zu senken, Viren zu bekämpfen oder das Immunsystem zu stärken. Das Lentinan ist zur Prophylaxe bei Virenerkrankungen geeignet. 2.2.6.2 Lösungshinweise: Pilze mit Heilkraft Hier wird mit vorsichtigen Formulierungen (soll, gilt) zum Ausdruck gebracht, dem Pilz würden die beschriebenen Fähigkeiten nachgesagt. Es ist ein Unterschied, ob einem Lebensmittel unumstößlich und schlagwortartig eine bestimmte gesundheitsfördernde Wirkung zugesprochen wird, oder ob nur argumentiert wird, dem Produkt würden solche Fähigkeiten nachgesagt. Auch wird der Bezug zu asiatischen Ländern und deren Gebräuchen hergestellt. Denn der Verkehr weiß, dass sich nicht nur die Essgewohnheiten in asiatischen Ländern deutlich von den Gewohnheiten unterscheiden, die er als Europäer kennt, sondern dass sich die dort vorherrschenden Vorstellungen, wie der menschliche Körper durch die Aufnahme von Nahrung gesund und fit gehalten werden kann, von der hier herrschenden Auffassung breiter Bevölkerungskreise deutlich unterscheiden. Z.B. wird in Asien immer noch das Horn von Rhinozerossen als potenzsteigernde Wundermedizin begriffen, die die Essgewohnheiten beeinflussende Vorstellung, der Verzehr bestimmter Meeressäugetiere wie Delfine oder bestimmter Kriechtiere wie Eidechsen, Schlangen etc. sei gesundheitsfördernd, hat im Vorstellungsbild mancher Asiaten sicher einen anderen Stellenwert, als es bei einem Europäer der Fall ist. Der Verbraucher weiß, dass sich die diesbezüglichen Vorstellungen der Menschen in "Fernost" von den unsrigen unterschieden. Vor diesem Hintergrund wird der Aussage "In China und Japan gilt Shiitake als Lebenselixier mit sagenumworbener Heilkraft" schon keine ernsthafte Bedeutung beigemessen und geglaubt, den Pilzen komme eine bestimmte Wirkung zu. Auch die Aussage "Abwehrtraining aus Fernost" wird vom Verbraucher nicht in dieser Weise verstanden. Die Aussage über gesundheitsfördernde Wirkungen wird jedoch nicht als nichtssagende Anpreisung verstanden, sondern der Verbraucher glaubt, dass er durch den Genuss des Pilzes tatsächlich etwas für die Gesundheit tun kann. Es ist jedoch nicht hinreihend glaubhaft gemacht, dass diese Vorstellung unrichtig ist. 2.2.6.3 Fall:Sondernummer OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 2000, 107: B ist die deutsche Tochtergesellschaft eines der weltweit führenden Anbieter von Computern und Druckern. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 41 K ist ein eingetragener Verein i.S. des § 13 II Nr. 2 UWG. Er verlangt von B Unterlassung einer bestimmten Werbung. B hatte in Zeitungsanzeigen sowie im Internet mit der gebührenpflichtigen Sondernummer 0180-5 geworben. Unter dieser Nummer können Verbraucher anrufen, wenn sie die von der B beworbenen Produkte bestellen wollen oder aber weitere Informationen benötigen. Ein Hinweis darauf, dass ein Anruf unter der angegebenen Servicenummer gebührenpflichtig ist, fehlt dort ebenso wie eine exakte Angabe der Gebührenhöhe je Zeiteinheit. Tatsächlich kann der Anrufer bei Wahl einer 0180-5-Nummer lediglich 30 Sekunden für eine Tarifeinheit (0,12 DM) telefonieren. Dieser Preis gilt rund um die Uhr. K behauptet, die Werbung ist irreführend. Denn die angegebenen 0180-Nummer vor dem Bindestrich erwecke durch ihre Nähe zu den gebührenfreien 0130-Nummern bei einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise bereits die Vorstellung, er könne kostenlos dort anrufen. Jedenfalls rechne der Verbraucher nicht, dass es sich bei der beworbenen „Infoline“ um die teuerste aller von der Deutschen Telekom angebotenen 0180-Nummern handele und der Tarif um ein Vielfaches über dem Tarif der Telekom für Ortsund Nahgespräche liege. Hat K recht ? 2.2.6.4 Lösungshinweise: Sondernummer Hier liegt eine Irreführung vor. Denn der durchschnittliche Verbraucher wird in aller Regel wegen der Ähnlichkeit mit den 0130er-Nummern nicht wissen, dass ein Anruf unter der angegebenen 0180-5 Telefonnummer gebührenpflichtig ist. Selbst bei Kenntnis von einer Gebührenpflicht wird der Verbraucher nicht wissen, dass die 0180-5-Nummern kostspieliger als die mit 0180 beginnenden Nummern sind. Allein diese Vorstellung über die Gebührenhöhe führt zur Irreführung. 2.2.7 Beschaffenheitstäuschung 2.2.7.1 Fall:TÜV Zertifikat BGH, GRUR 1991, 554: B vertreibt Brillen an Augenoptiker. Im Jahre 1984 erteilte B dem Technischen Überwachungsverein Hessen (TÜV) einen Prüfungsauftrag für einen Teil ihrer Brillenfassungen zur Erlangung des TÜV-Prüfzeichens. Zur Durchführung dieses Auftrags entwickelte der TÜV Hessen nach Fühlungnahme mit anderen Technischen Überwachungsvereinen ein eigenes Prüfsystem aus Qualitätsanforderungen und Prüfungsmethoden für Brillenfassungen aus Metall. Auf dieser Grundlage prüfte er auftragsgemäß u.a. die Brillenfassungen der Kollektion „Charme“ der B. Er kam zu dem Ergebnis, dass diese Brillenfassungen die gestellten Prüfungsanforderungen erfüllten und erlaubte der B, das TÜV-Prüfzeichen im geschäftlichen Verkehr für die Brillenfassungen der Kollektion Charme zu verwenden. B stellte daraufhin Augenoptikern für den Verkauf Werbematerial zur Verfügung, in dem das TÜV-Prüfzeichen herausgestellt wird. In einem Werbeblatt wird das Prüfzeichen abgebildet unter der Überschrift: Dieser Meisterbetrieb führt TÜV-geprüfte Brillengestelle der Kollektion Charme (Prüfzeichen B-1021 TÜV Hessen). Unter der Überschrift: „Dieses Zeichen steht für....“ folgt eine Erläuterung der einzelnen Prüfkriterien, wie z.B. Sicherheit, Korrosionsschutz. Als Ergebnis heißt es: „Brillenfassungen von Charme erfüllen die vom TÜV-Hessen gestellten Prüfungsanforderungen“. Augenoptiker, die von der B dieses Werbematerial erhalten hatten, warben in Zeitungsanzeigen mit dem Hinweis auf das „TÜV-Zertifikat“. Liegt ein Verstoß der B gegen § 3 UWG vor ? P.S.: Nach einer Meinungsumfrage haben 57,7 % der Brillenträger (53,9 % aller Befragten) angenommen, Brillenfassungen mit TÜV-Prüfzeichen weisen im Vergleich zu anderen Brillenfassungen eine „etwas bessere“ (30,4 % bzw. 28,8 %) oder eine wesentlich bessere (27,3 % bzw. 25,1 %) Qualität auf. Dies ist jedoch unstreitig nicht der Fall. 2.2.7.2 Lösungshinweise:TÜV Zertifikat Hier liegt ein Verstoß gegen § 3 UWG vor, weil B Werbemittel den Augenoptikern zur Verfügung gestellt hat, um deren Werbung mit dem TÜV-Prüfzeichen zu ermöglichen. Es werden unrichtige Vorstellungen erweckt, welche Tätigkeit der TÜV in diesem Fall ausgeübt hat und welche Qualität TÜV-geprüfte Brillenfassungen im Vergleich zu anderen Brillenfassungen haben. Die Verwendung des TÜV Zeichens ist daher geeignet, Fehlvorstellungen über die Qualität der so bezeichneten Brillenfassungen hervorzurufen. Hier liegt nur ein Privatauftrag vor, nicht - wie beim TÜV - eine hoheitliche Kontrolle. Es bestehen keine zwingenden Prüfvorschriften. Dies ist genauso wie die Werbung mit einem bezahlten Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 42 wissenschaftlichen Privatgutachten zu verstehen. Es wird jedoch der Anschein erweckt, dass das Gutachten eines unabhängigen Wissenschaftlers vorliegt. Der Verbraucher glaubt deshalb, dass eine bessere oder etwas bessere Qualität der Brillen als normal vorliegt. Er zieht diese Brille vor. Deshalb: Es liegt ein Verstoß gegen § 3 UWG vor. 2.2.7.3 Fall:Auszeichnung OLG Hamburg, GRUR 1991, 470: B verkauft die Kaffeesorten "Milde Natur" und "Vitana". Für diese beiden Kaffeesorten wirbt B in der Tageszeitung "BILD" mit einer großformatigen Anzeige, in der jeweils eine der für sie verwendeten Packungen abgebildet und die mit der Angabe: "Zwei Angebote mit Auszeichnung !" überschrieben war. Neben anderem befand sich in der Anzeige noch bei der Packung der Kaffeesorte: "Milde Natur" ein aufkleberartiger Aufdruck, der ein südamerikanisches Motiv und die Bezeichnung "Café de Colombia" enthielt, und bei der Packung der Kaffeesorte "Vitana" ein entsprechend gestalteter Hinweis darauf, dass die B "Offizieller Lieferant der Olympiamannschaft der Bundesrepublik Deutschland 1992" sei. K, ein Wettbewerber von B, sieht in der Bezeichnung: "Zwei Angebote mit Auszeichnung" eine irreführende Werbung gemäß § 3 UWG, da sie den irreführenden Eindruck erwecke, die beworbenen Kaffeesorten seien von einer besonderen, neutralen Institution im Hinblick auf ihre Qualität geprüft und ausgezeichnet worden. Liegt ein Verstoß gegen § 3 UWG vor ? 2.2.7.4 Lösungshinweise:Auszeichnung Dieser ist gegeben. Es besteht in der Tat der Eindruck, dass eine unabhängige Stelle die Belobigung und Anerkennung ausgesprochen hat. Jedenfalls ein nicht unbeachtlicher Teil der Leute wird diese Deutung vornehmen und eine erfolgreich durchlaufene neutrale Prüfung vermuten. Auch Waren des täglichen Bedarfs werden heute getestet. 2.2.7.5 Fall:Naschen erlaubt KG, WRP 1991, 314: B wirbt für ihr Süßwarenprodukt CRACKY MOUNTAINS mit der Angabe: „Naschen erlaubt“. B bezeichnet ihr Erzeugnis als Müsli-Praline und als „Knusper-Müsli in weißer Schokolade“. Die Klägerin K, ein Verein, der satzungsmäßig Verbraucherinteressen durch Aufklärung und Beratung wahrnimmt, behauptet, die beanstandete Werbung erwecke den Eindruck, dass der Verzehr dieses Produkts der B im Gegensatz zu anderen Süßigkeiten nicht zu einer Gewichtszunahme oder zur Kariesbildung führe, zumindest werde die Vorstellung hervorgerufen, es handele sich um ein erheblich zuckerreduziertes Erzeugnis. Es sei irreführend, wenn mit der Werbeaussage gesundheitliche Vorzüge besonders herausgestellt, andererseits mit dem Verzehr verbundene gesundheitliche Gefährdungen verschwiegen würden. Er hat darin auch einen Eingriff in eine gesundheitsbewusste Erziehung gesehen. B wendet ein, bei der Werbung handele es sich lediglich um eine humorvolle Wendung, durch die beim Verbraucher keinerlei Vorstellungen über die Merkmale ihres Erzeugnisses geweckt würden. Ist diese Werbung nach dem UWG verboten ? 2.2.7.6 Lösungshinweise:Naschen erlaubt K ist nach § 13 II Nr. 3 UWG klagebefugt. 1. Irreführende Werbung, § 3 UWG: B gibt kund, dass ihr Produkt Naschware ist. Insoweit liegt keine Irreführung vor. Aber: Die Werbung ruft einen unrichtigen Eindruck beim Verbraucher hervor, nämlich den Eindruck, dass das Produkt gesundheitlich unbedenklich ist. B fügt zwei Begriffe zusammen: Naschen ist der Genuss von etwas Leckerem. Man darf aber eigentlich nicht naschen. Dies ist gesundheitsgefährdend, wenn nicht schädlich. Wenn schon Naschen, dann nur heimlich, da es verboten ist. Dem setzt die B den Begriff „erlaubt“ entgegen. Naschen ist zwar nicht generell gestattet, hier aber doch. Daraus zieht der Verbraucher den Schluss, dass keine der sonst üblichen Gefährdungen vorliegen, da es sich um eine besondere Ware handelt. Diese hat aber keine deutlich geringeren Gesundheitsgefährdungen, sie ist nicht frei von Zucker etc. Es werden unangebrachte positive Vorstellungen hervorgerufen. Deshalb liegt eine Täuschung über die Beschaffenheit des Produkts vor. 2.§ 1 UWG: Sittenwidrigkeit ? Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 43 Auch Kinder und Jugendliche sind angesprochen .Das Verbot der Eltern des Naschens von Süßigkeiten wird als unrichtig hingestellt. Diese Werbung greift deshalb in die Gesundheitserziehung ein. Das Gericht hat offen gelassen, ob dies gegen die guten Sitten verstößt. und damit § 1 UWG verletzt ist, da auch jeden Fall § 3 UWG verletzt ist. 2.2.7.7 Fall:natürliches Öl OLG Nürnberg, GRUR 1989, 128: B wirbt für seine Hautcreme mit dem Begriff "natürlich" und "ein Naturerlebnis für Ihre Haut. Sie ist jedoch zu mehr als die Hälfte aus synthetisch hergestellten Wirkstoffen hergestellt. Ist eine derartige Werbung zulässig ? 2.2.7.8 Lösungshinweise:natürliches Öl Das Gericht stellte zunächst fest, dass die Mitglieder des Senats Hautöl nur in geringen Mengen verbrauchen. Trotzdem benötigen sie keine Verbraucherumfrage. Sie können selbst entscheiden. Ein Verbraucher erwartet von einem natürlichem Hautpflegeöl, dass dies seinen Vorstellungen von völliger Chemiefreiheit entspricht. Hier besteht die Creme zu 30 % aus dem Naturprodukt Kokosfett. Dieses wird jedoch gehärtet. Dadurch entsteht ein synthetisches Produkt. Das Paraffinöl wird aus Erdöl durch die Reinigung gewonnen und zwar mittels katalytischer Hydrierung. Es ist nicht natürlich. So verbleiben im Paraffinöl außer natürlichen Stoffen auch die durch diese chemische Synthese entstandenen Produkte. Nur etwa 10 % der Bestandteile sind von der chemischen Veränderung allerdings betroffen. Durch diese teilweise Veränderung entsteht ein nicht mehr natürlicher Wirkstoff. Deshalb liegt eine irreführende Werbung vor. 2.2.7.9 Fall:Schafschurwolle BGH, GRUR 1991, 850: B stellt Bettwaren her und vertreibt sie. B versieht seit 1952 mit Schafschurwolle gefüllte Bettwaren mit der Bezeichnung Rheumalind. B verwendet außerdem eine Reihe anderer Bezeichnungen mit dem Bestandteil -lind, so z.B. Kuschellind für Bettwaren, die mit Federn und Traumalind für solche, die mit Polyesterfasern gefüllt sind. K, eine Konkurrentin von B, hält die Bezeichnung Rheumalind für irreführend. Denn der Verbraucher verstehe eine derartige Bezeichnung in der Weise, dass rheumatischen Erkrankungen vorgebeugt werde oder diese gelindert oder geheilt werden. Dies treffe aber auf Schafschurwolle nicht zu. Liegt ein Verstoß gegen § 3 UWG vor ? 2.2.7.10 Lösungshinweise:Schafschurwolle Der Verbraucher glaubt aufgrund des Namens, dass das Produkt gut gegen Rheuma ist. Man nahm dies auch bis Anfang der 80er Jahre an. Jedoch jetzt nicht mehr. B muss beweisen, dass das Produkt tatsächlich diese Wirkung entfaltet. Dies ist nicht nachgewiesen. 2.2.7.11 Fall:Recycling-Leder OLG Hamburg, GRUR 1991, 240: B stellt Werbeartikel her, wie z.B. Schreibmappen, Taschenkalender etc. und vertreibt diese. In ihrer Werbung heißt es: Produkte aus Recycling-Leder = wiedergewonnene Natur. Ferner heißt es: Durch die Zusammensetzung von 90 Teilen biologisch zerlegter Lederfasern, 8 Teilen pflanzlicher Bindemittel und 2 % Farbe entsteht ein Material, welches zu 98 % aus der Natur kommt. K, ein Verband zur Förderung der Verbraucherinteressen, beanstandet den Begriff Recycling-Leder als irreführend. Er erwecke den unzutreffenden Eindruck, dass der so bezeichnete Stoff, zu dessen Herstellung Lederabfälle verwendet und zermahlen würden, dieselbe Qualität und dieselbe Struktur wie Leder besitze. Tatsächlich sei aber durch die Zerlegung die für Leder typische besondere Faserverwobenheit aufgehoben, die die Qualität des Leders ausmache. Außerdem handele es sich entgegen den Erwartungen des Verkehrs nicht um Material, das vorher schon in der Natur vorgekommen sei und lediglich im Recycling-Weg wie in der Natur vorhanden wieder hergestellt werde. Zudem werde insgesamt ein Anteil von 10 % aus Stoffen Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 44 verwendet, die kein Leder seien. Es handele sich um ein Produkt aus zerkleinerten Lederfasern, pflanzlichen Bindemitteln und Farbe. K beantragt Unterlassung der Werbung. Zu Recht ? 2.2.7.12 Lösungshinweise:Recycling-Leder § 13 II Nr. 2 UWG: K ist klagebefugt. Ist § 3 UWG verletzt ? Das Material ist aus zerkleinerten Lederfasern, pflanzlichen Bindemitteln und Farbe, jedoch nicht Leder. Der Verkehr erwartet von RL in irriger Weise, dass es sich um Stoff handelt, der in einem Verfahren der Wiederverwendung aus Leder gewonnen worden ist und der wegen seiner Struktur wie der Ausgangstoff Leder ist, jedoch von minderer Qualität. Ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs erwartet, dass gebrauchte Ledererzeugnisse ohne Veränderung der Lederstrukturen in einem besonderen Aufbereitungsverfahren zur Beseitigung von Benutzungsspuren erneut verwendbar gemacht werden. Bei Leder ist es vorstellbar (anders Papier), dass gebrauchtes Leder nach erneuter Aufbereitung unzerstört erneut verwendbar gemacht wird. Das glaubt man auch dann, wenn Preisunterschiede bestehen und das Gütezeichen "echt Leder" fehlt. Deshalb liegt hier eine irreführende Werbung vor. 2.3 Anspruchsberechtigte nach § 13 UWG Ansprüche nach §§ 1 und 3 können nur von den Berechtigten nach § 13 Abs. 2 UWG gestellt werden. Verbraucher sind grundsätzlich nicht berechtigt. Vier Gruppen kommen in Betracht: Gewerbetreibende o Abieter von Waren und gewerbliche Leistungen gleicher Art oder verwandter Art o sachlich und räumlich der gleiche Markt o wesentliche Wettbewerbsbeeinträchtigung Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen o rechtsfähig o erhebliche Mitgliederanzahl o Abieter von Waren und gewerbliche Leistungen gleicher Art oder verwandter Art o sachlich und räumlich der gleiche Markt o personell, sachlich und finanziell zur Rechtsverfolgung in der Lage o wesentliche Wettbewerbsbeeinträchtigung Qualifizierte Einrichtungen zum Schutz von Verbraucherinteressen o § 4 UnterlassungsklagenG (Eintragung beim Bundesverwaltungsamt) o Berührung wesentlicher Belange der Verbraucher Industrie- und Handelskammern o ohne weitere Eintschränkung Die rechtsmißbräuchliche Geltendmachung ist ausdrücklich untersagt. » Siehe auch: : Verfahren bei Verstößen gegen das UWG und KartG 3. Kartellrecht 3.1 Überblick Überblick über das Kartellrecht Horizontale und vertikale Kartelle (§§ 1 ff und 14 ff GWB) Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen Wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen Ausschreibungsverfahren der öffentlichen Hand Literatur: Alpmann/Schmidt Kartell und Wettbewerbsrecht, ISBN 3-89476-282-9 Geuting, Markus: Wettbewerbsrecht, ISBM 3-89476-264-0 Vorwort im Gessetzestext WettbewerbsR, Beck Texte im dtv, ISBN 3 423 05009 8 Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 45 3.1.1 Fall: Microsoft Bericht über MS Urteil aus ZD-Net Urteil USA vs. Microsoft Corporation, April 2000 als PDF Datei 3.2 Grundtatbestand § 1 KartG In §§ 1, 14, 19 ff. KartG enthalten grundsätzliche Verbote, die jeweils dann in weiteren Vorschriften modifiziert werden. Gesetz verbietet in § 1 KartG bestimmte Kartelle und Verhaltensweisen, läßt jedoch in §§ 2 - 8 KartG über gesetzliche Ausnahmen und Ausnahmegenehmigungen bestimmte Kartelle wieder zu. Unternehmen: weiter Begriff - - Vereinbarungen oder Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder abgestimmtes Verhalten (gemeinsames Wollen eines Verhaltens) Verhinderung, Einschränkung, Verfälschung des Wettbewerbs (zwischen Unternehmen) Bewirken: tatsächliche Beeinflussung findet statt Bezwecken: Absicht ohne dass konkreter Erfolg notwendig ist. Wettbewerb: Markt in räumlicher, zeitlicher, sachlicher Dimension (aus der Sicht des Kunden oder des Lieferanten ist die Ware austauschbar). Nichtvorliegen einer der gesetzlichen Ausnahmen. 3.3 Normen, Typen und Konditionenkartelle, § 2 KartG Einheitliche Anwendung von Normen und Typen - Einheitliche Anwendung von Zahlungs- Liefer oder Geschäftsbedingungen Kein Bezug zu Preisen oder Preisbestandteilen z.B. AGB für alle Netzwerkinstalltionsbetriebe nicht: Empfehlung für bestimmte Stundensätze Anmeldung bei der Kartellbehörde nach § 9 KartG 3.4 Spezialisierungskartelle, § 3 KartG Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch Spezialisierung - Keine Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellung z.B. A vertreibt Hardware und B vertreibt die zugehörige Software 3.5 Mittelstandskartelle, § 4 KartG Anders als § 3 Zwischenbetriebliche Zusammenarbeit Keine wesentliche Martbeeinträchtigung Ziel: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU z.B. gemeinsame Nutzung teurer Meßeinrichtungen oder gemeinsame Vertriebsorganisation oder gemeinsamer Einkauf Ohne Bezugszwang über den Einzelfall hinaus 3.6 Rationalisierungskartelle, § 5 KartG Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge 3.7 Strukturkrisenkartelle, § 6 KartG Nachhaltiger Nachfragerückgang => Vereinbarung für Erzeugung, Herstellung , Bearbeitung oder Vertrieb Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 46 3.8 Sonstige Kartelle, § 7 KartG Verbesserung Entwicklung, Erzeugung, Verteilung, Rücknahme, Entsorgung - Nicht auf andere Weise erreichbar Verbraucherbeteiligung Keine Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellung 3.9 Ministererlaubnis, § 8 KartG Überwiegende Gründe der Geminwirtschaft und Gemeinwohl sonst Verbot Bei Verstoß Schadensersatz iVm 32 KartG Verbotsverfügung durch die Kartellbehörden 31 KartG 3.10 Verträge zwischen sonstigen Beteiligten - Verträge in vertikalen Austauschbeziehungen § 14 KartG Vereinbarungen über Preisgestaltung oder Geschäftsbedingungen z.B. Verbot Linux teurer als MS-Windows zu verkaufen Ausnahme: § 15 KartG Verlagserzeugnisse § 16 KartG Mißbrauchsaufsicht bei Ausschließlichkeitsverträgen z.B. Wer M bezieht, darf keine andere Software vertreiben. § 17 KartG Lizenzverträge und § 18 KartG Erweiterung auf andere geschützte und nicht geschützte Rechte z.B. Verbot einen Rechner alternativ mit BS anzubieten. 3.10.1 Fall: "Marktgesetze" Softwarehersteller M verlangt von seinen Partnern, wenn Sie sein BS installieren wollen, das alle PC’s damit angeboten werden müssen. Alternativen sind erlaubt, aber eben jeder Rechner muß mit diesem BS offeriert werden. 3.10.2 Lösungsansatz: Marktgesetze A) Beide Beteiligte sind hier Unternehmen. B) relevanter Markt C) Verbot nach § 16 käme hier in Betracht. hier wird die Freiheit beschränkt, die Waren an Dritte abzugeben bzw. nicht abzugeben außerdem, wird er Händler darin beschränkt, wie er die Hardware (andere Waren) an Dritte abzugeben hat. Zwar kann der Händler grundsätzlich auch PCs mit anderen Betriebssystemen anbieten, faktisch wird er jedoch darin gehindert, weil er jeweils auch das Betriebssystem von M anbieten muss. D) wesentliche Marktbeeinträchtigung, diese liegt hier vor. Verbot aus § 19 GWB A) beide sind Unternehmen + B) Marktbeherrschendes Unternehmen (vermutet ab 1/3 Marktanteil), § 20 Abs. 3 S. 1 GWB. + C) Kein Wettbewerb mehr durch Wettbewerbshandlungen (hier Bezugseinschränkung) + 3.11 Marktbeherrschende Unternehmen/ Wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen § 19 Generalklausel Verbot von Ausnutzung marktbeherrschender Stellung Marktbeherschung 1/3 Martkanteil Überragender Marktanteil (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 2 kartG) Keine Behinderung anderer ohne sachlichen Grund Keine besonderen Geschäftsbedingung (aufgezwungene) Keine überhöhten Preise Zugang zu Netzen zu angemessenen Preisen § 20 Diskriminierungsverbot Gleichbehandlungsgebot bei Marktbeherrschung keine Vorzugsbedingung Kein Behindung durch Angebot unter Einstandspreis Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 47 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 § 21 Boykottverbot § 22 Empfehlungsverbot: Ausnahme unverbindliche Preisempfehlung § 23 Verbot der Umgehung der Kartell-Bestimmungen durch gleichförmiges Verhalten Preisbindungen Unverbindliche Preisempfehlungen sind zulässig (Erwartung, dass der Preis auch tatsächlich verlangt wird!) § 30 § 1 und § 14 gelten nicht für Verwertungsgesellschaften § 31 DFB Paragraph § 1 gilt nicht für die Verwertung von Sportereignissen 3.11.1 Fall: Streit auf dem Grün ABC Grafik Software hat eine Grafik-Engine entwickelt, die auf dem Markt konkurrenzlos ist. Man erreicht nach 2 Jahren einen Marktanteil von 70% weltweit. Weil sich D mit dem C auf dem Golfplatz um die Schlagreihenfolge gestritten hat, will ABC... dem D die Lizenz für die Software nicht anbieten. 3.11.2 Lösungsansatz: Streit auf dem Grün Verbot nach § 19 GWB 3.12 Besonderer Schadensersatzanspruch nach § 33 KartG § 33 enthält einen besonderen Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch Verstoß gegen das KartellR Schutz der Norm (des KartG) diente auch dem Verletzte => Unterlassungsverpflichtung Kommt Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) hinzu => Schadensersatz Geltendmachung kann auch durch einen Wettbewerbsverein erfolgen 3.13 Was war wichtig? Kartellgesetz regelt: unzulässige Absprachen Mißbrauch einer markbeherrschenden Stellung Zusammenschlußkontrolle öffentliches Vergabewesen Grundsatz: Kartelle sind verboten. Das Gesetz oder der Staat kann Ausnahmen zulassen. Es gibt horizontale und vertikale Kartelle. Der Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist verboten. Es gibt besondere Schadensersatzansprüche bei Verstoß gegen drittschützende Kartellbestimmungen. 3.14 Übung 3.14.1 Fall: Frauenpower Herr Terrier ist Inhaber der Fa. QuickPC und Herr Bull ist Inhaber der Kette PC-Profi-Siegburg mit 3 Ladengeschäften. QuickPC hat einen Marktanteil beim PC Handel im Raum Siegburg von 25 % und PC-Profi-Siegburg von 30 %. Da beide beim Direktimport aus Fernost die gleichen Probleme haben, schließt man sich in einer gemeinsamen Einkaufs-OHG zusammen. Damit können größere Mengen geordert werden, was sich auf die Einkaufspreise erheblich auswirkt. Der kleine Laden der FH-Studentinnen ComputerFürFrauen, der nur 3 % Marktanteil hat, spürt die Preisreduzierung bei T und B sehr deutlich und möchte den beiden anderen die Kooperation untersagen. Geht das? 4. Marken- und Urheberrecht 4.1 Markenrecht Das Markengesetz schützt unterschiedliche Gegenstände: Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 48 - Eingetragene Marken z.B. Produktnamen Geschäftliche Bezeichnungen Werktitel hier kommen auch Namen von Computerspielen in Betracht geografische Herkunftsangaben Spielen insbesondere bei landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln ein Rolle z.B. Burgunder Wein, aber auch Spielzeug aus dem Erzgebirge. Vielleicht zukünftig auch Software aus dem Silicon Rhein Valley Insbesondere Domainnamen können als Marke angemeldet werden oder geschäftliche Bezeichnung Schutz erlangen. Beim Vorliegen von Marke oder geschützter geschäftlicher Bezeichnung gewäht das Markenrecht: §§ 14 Abs. 5 und 6, 15 Abs. 5 und 6 MarkenG Unterlassungsansprüche Schadensersatzansprüche Anspruch auf Vernichtung von Gegenständen § 18 MarkenG Anspruch auf Auskunft, § 19 Markengesetz - 4.1.1 Überblick gewerbliche Schutzrechte Norm Gegenstand PatentG Technische Erfindungen Gebrauchs-musterG Technische Erfindungen Halbleiter-SchutzG Topgraphie eines Chips Schriftzeichen-gesetz Ästhetische Darstellung von Schriften Markengesetz Eingetragene Marke oder Geschäftliche Bezeichnung oder Geographische Herkunftsangabe Schutzvoraus-setzungen Förmliche Anmeldung, DPA Förmliche Anmeldung, DPA Förmliche Anmeldung, DPA Förmliche Anmeldung, DPA Förmliche Anmeldung, DPA Nein Nein Urheber-rechtsschutz Geistige Leistung sonstige Leistung (z.B. Datenbank) Geschmacks-musterge Ästhetische Darstellung setz 4.1.2 Nein Nein Förmliche Anmeldung, DPA Überblick Marken Schutz nach dem Markengesetz Marken Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen Eingetragene Zeichen 4.1.3 Zeichenbenutzung + Verkehrsgeltung Geschäftliche Bezeichnungen Notorisch bekannte Marken Unternehmenskennzeichen Namen, Firma o. bes. Geschäftsbezeich. Werktitel Namen bes. Bezeichnungen Druck, Film, Video, Comp Voraussetzung für die Entstehung Markenfähigkeit des Zeichens (§ 3 MarkenG): Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 49 Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen (z.B. kann auch ein Domainname sein.) Ausnahme: Form durch die Ware selbst Form durch die technische Wirkung Form, die den wesentlichen Wert verleiht. 3 Alternativen: Eintragung ins Markenregister beim Patentamt Nutzung im geschäftlichen Verkehr mit Verkehrsgeltung Notorisch bekannte Marken. 4.1.4 Eintragungshindernisse für Marken Die Eintragung einer Marke ist gehindert: Es handelt sich um eine notorisch bekannte Marke (§ 10 MarkenG). Verstoß gegen § 8 MarkenG: z.B. - Marken ohne jegliche Unterscheidungskraft -Bezeichnungen der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung - allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, Ausnahme, wenn Verkehrsdurchsetzung (ganze BRD) vor Eintragung - das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft zu täuschen - die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen. 4.1.5 Schutzdauer und Wegfall des Schutzes Die eingetragene Marke schützt für 10 Jahre. Durch Zahlung einer Verlängerungsgebühr kann der Schutz jeweils 10 Jahre verlängert werden. Der Markenschutz entfällt: Nichtzahlung der Gebühr Nichtbenutzung (§§ 49, 26 MarkenG) Nichtigkeitsgründe nach §§ 50, 51 MarkenG 4.1.6 Markenschutz durch Verkehrsgeltung Benutzung eines Zeichens und Erreichung von Verkehrsgeltung Es gibt keine pauschalen Sätze für die Bekanntheit. Hängt auch von dem Unterscheidungskraft der Marke ab. (Verkehrsgeltung anerkannt: bereits ab 20 %, abgelehnt auch noch bei 50 %). 4.1.7 Schutzanspruch für Marken, § 14 MarkenG Marke verleiht dem Inhaber das ausschließliche Recht über die Verwendung der Marke zu bestimmen. Inhaber kann untersagen (§ 14 Abs. 2 MarkenG): identische Marke für identische Gegenstände (Nr. 1) Ausnutzen oder Beeinträchtigen von gleichen oder ähnlichen Zeichen bei gleichen oder ähnlichen Gegenständen bei Verwechselungsgefahr oder Verwechselungsgefahr im weiteren Sinne (z.B. Vermutung von nicht bestehenden Unternehmensverbindungen), (Nr. 2) Verwendung von gleichen oder ähnlichen Zeichen für andere Gegenstände, wenn bekannte Innlandsmarke Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 50 Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung (z.B. Verwässerungsgefahr) Bei Vorsatz und Fahrlässigkeit kommt ein Schadensersatzanspruch nach Abs. 6 hinzu. Anspruch gegen den Geschäftsinhaber auch, wenn die Handlung durch Mitarbeiter oder Beauftragten begangen wird. 4.1.8 Schutz geschäftlicher Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen: Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr - als Name, - als Firma oder - als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens - Geschäftsabzeichen mit spezifischer Verkehrsgeltung benutzt werden Werktitel: Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken z.B. Computer-, Videospielen 4.1.9 Schutzanspruch für geschäftliche Bezeichnungen, § 15 MarkenG Die Geschäftliche Bezeichnung verleiht dem Inhaber das ausschließliche Recht über deren Verwendung zu bestimmen. Inhaber kann untersagen (§ 15 Abs. 4 MarkenG): Verwendung von gleichen oder ähnlichen Bezeichnungen bei Verwechselungsgefahr (Abs. 2) Ausnutzen oder Beeinträchtigen von gleichen oder ähnlichen Bezeichnungen ohne Verwechselungsgefahr, wenn bekannte Innlandsbezeichnung Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung Bei Vorsatz und Fahrlässigkeit kommt ein Schadensersatzanspruch nach Abs. 5 hinzu. Anspruch gegen den Geschäftsinhaber auch, wenn die Handlung durch Mitarbeiter oder Beauftragten begangen wird. 4.1.10 Vernichtungs- und Auskunftsanspruch Anspruch auf Vernichtung von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen (z.B. Dampfwalze fährt über die gesammelten MS-Windows Raubkopien) Umfassender Anspruch über Herkunft, Vertriebswege, Namen und Anschrift von Herstellern, Lieferanten, Vorbesitzern, gewerblichen Abnehmern, Auftraggebern, Mengen (hergestellt, ausgeliefert, erhalten, bestellt). Anspruch ist u.U. im Eilverfahren durchsetzbar. 4.1.11 Schutz von Internet-Domainnamen Bei der Eintragung einer Marke kann die Verwendung im Internet mit eingeschlossen werden. 4.1.11.1 Schutz der second level Domainnamen Beim Domainnamen kommt es für die Frage der Kennzeichnung bzw. Verletzung Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 51 anderer Kennzeichen auf die second level Domain an. Nationale und andere zugelassene Kürzel sind nicht relevant. Offen ist das für die neuen Top Level Domains wie ORG oder NET. Für die Abwehr von unberechtigten Nutzungen bzw. die Ansprüche auf Untersagung einer Nutzung von Domainnamen, die nach dem Markengesetz oder dem UWG geschützt sind kommt es auf die tatsächliche Nutzung an. Teilweise wird bereits in dem Registrierungsantrag eine Nutzung des fremden Namens, der Marke oder des geschäftlichen Zeichens gesehen. Das Verlangen von Geld für die Herausgabe ist jedoch mit Sicherheit eine solche Nutzung. z.B. Registrierung einer Domain mir Verkaufsabsicht unter Voranstellung der Silbe "My", LG München I , Urteil vom 06.03.2000, 7 HK O 2775/00 http://www.jurpc.de/rechtspr/20000133.htm Bieten weder Markenrecht oder Urheberrecht eine Berechtigung zur Herausgabe einer Domain sich auch aus dem allgemeinen Namensrecht ergeben. 4.1.11.2 Schutz nach dem Markenrecht Domains sind nicht per se auch Marken. Es gibt für Domains keine Vorschrift wie § 8 MarkenG. Die Frage ist ob beispielsweise freihaltebedürftige Namen wie Gattungsbezeichnungen Verwendung finden dürfen. Problem: Gattungsbezeichnungen heute gilt: Gattungsbezeichnungen sind zulässig. Es darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, es gäbe keine anderen Anbieter (vgl. z.B. www.infobroker.de) 4.2 Urheberrechtsgesetz 4.2.1 Überblick Urheberrecht allgemein Schutz von Datenbankwerken und Datenbanken Schutz von Programmen 4.2.2 Überblick über das Urheberrecht Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Urheberrechtsgesetz Persönlich geistige Schöpfungen und verwandte Schutzrechte (z.B. Datenbanken) Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz Persönlich geistige Schöpfungen z.B. (nicht abschließend) Sprachwerke, wie: Schriftwerke, Reden Computerprogramme Werke der Musik verwandte Schutzrechte Leistungsschutzrechte Datenbankwerke = elektr. abfragbare Sammelwerke systematisch u. methodische pers.geistige Schöpfung durch Ausw./Anord. Datenbank = elektr. abfragbare Sammlung syst. u. meth. Anordnung d.Elem. Herstellg/Verwaltg. wesentl. Investition Das Recht entsteht originär durch den Schöpfungsakt. Es bedarf keiner förmlichen Anmeldung und grundsätzlich keiner Kennzeichnung. Beifügung eines Copyright Vermerks erleichtert die Beweisführung. Vgl. § 10 UrhG Das Urheberrecht gewährt ein absolutes Recht gegen jedermann. Das Recht ist vererblich (§ 28 Abs. 1 UrhG) - aber zeitlich beschränkt (bis 70 Jahre nach dem Tod, § 64 UrhG). Durch die Pariser Verandsübereinkunft PVÜ gilt das Recht international: Grundsatz der Inländerbehandlung. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar (nur durch Erbschaft) wohl aber die Nutzungsrechte. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 52 4.2.3 Rechte des Urhebers Urheberrecht schützt den Urheber (§ 11 UrhG) - in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk (Urheberpersönlichkeitsrecht) und - in der Nutzung des Werkes (Verwertungsrechte) Urheberpersönlichkeitsrecht umfasst: - Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG) Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) Recht zur Untersagung von Entstellung eines Werkes (§ 14 UrhG) Verwertungserchte in körperlicher Form (§ 15 UrhG) - Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG) Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG) Verwerungsrechte in unkörperlicher Form (Recht zur öffentlichen Wiedergabe) - Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG) Senderecht (§ 20 UrhG) Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG) Recht der Wiedergabe von Funksendungen (§ 22 UrhG) Grenze ist die freie Benutzung. Dort wird das Urheberrecht eines anderen nicht mehr tangiert. 4.2.4 Gewährung von Nutzungsrechten Durch eine Lizenz gewährt der Urheber einem Dritten bestimmte Nutzungen seines Werkes. Das Nutzungsrecht wird in der Regel immer nur für eine bestimmte Nutzungsart gewährt. Neue Nutzungsarten bedürfen der ausdrücklichen Erlaubnis. z.B. Nutzungsrecht für die Ausstrahlung im Fernsehen, gewährt nicht das Recht zur Aussendung über das Internet. vgl. LG München U.v. 10.03.1999, Az. 21 0 15039/98, http://www.netlaw.de/urteile/lgm_13.htm 4.2.5 Datenbankwerke Sammelwerke: - Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung darstellen (§ 4 Abs. 1 UrhG) Datenbankwerke sind Sammelwerke: - deren Elemente systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind Schutz wird genau wie für andere Urhberrechte gewährt. § 55a Benutzung eines Datenbankwerkes Vervielfältigungsstücke -> offline-Nutzung Zugänglich durch Vertrag -> online-Nutzung ggf. muss eine Vereinbarung über das Vervielfältigungsrecht und das Weiterverbreitungsrecht abgeschlossen werden (sofern der Information Broker selbständig ist). vgl. z.B. http://www.fiz-karlsruhe.de/KeepShar/index.html § 63 Quellenangabe Verpflichtung zur Quellenangabe 4.2.6 Datenbanken Datenbanken sind: Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet sind Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 53 einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich erfordern bei Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition Geschützt werden: Vervielfältigung Verbreitung öffentlich Wiedergabe von wesentlichen Teilen sowie wiederholte und systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe nach Art und Umfang unwesentlichen Teile soweit darin normale Auswertung überschritten wird. Erlaubt ist (§ 87c UrhG): Vervielfältigung eines wesentlichen Teils der DB zum wissenschaftlichen Gebrauch oder im Unterricht (soweit notwendig) und nicht gewerblich. Untersagt ist: - - 4.2.7 - Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Gleich steht die wiederholte und systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank sofern diese Handlungen einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen. Bei Datenbanken ist darf die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank nicht untersagt werden. Schutzdauer: 15 Jahre (§ 87d UrhG) Computerprogramme Computerprogramme werden nach §§ 69a ff. geschützt. Computerprogramm: Programme jeder Gestalt einschließlich des Entwurfsmaterials Individuelle Werke eigener geistiger Schöpfung Keine qualitativen oder ästhetischen Anforderungen oder andere Voraussetzungen Ideen und Grundsätze eines Programms sind nicht geschützt. Anwendung der Vorschriften für Sprachwerke ergänzend zu den §§ 69a ff. Arbeitnehmer sind zwar Urheber i.S.d. Urheberrechts, verlieren aber die Verwertungsrechte automatisch an den Arbeitgeber (§ 69b UrhG). 4.2.8 Rechte des Urhebers § 69c UrhG regelt die Befugnisse des Urhebers. - Jede Form von Vervielfältigung - Jede Form der Übersetzung oder Überarbeitung - Verbreitungsrecht, Ausnahme: Nach Veräußerung, verliert der Urheber das Verbreitungrecht für dieses Stück. Ausnahme (§ 69d UhrG): Ohne vertragliche Regelung bedarf der bestimmungsgemäße Einsatz eines Programms nicht der Zustimmung des Urhbers. Herstellung einer Sicherungskopie ist erlaubt (kann nicht verboten werden, § 69g Abs. 2 UrhG). Untersuchung des Funktionierens eines Programms. Dekompilierung zur Herstellung der Interoparabilität mit anderen Programmen (wenn der Linzenzinhaber diese Informationen nicht gibt), § 69e UrhG. Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 54 4.2.9 Grenzen des Urheberrechts § 45 Rechtspflege und öffentliche Sicherheit § 46 Sammlungen für Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch § 47 Schulfunksendungen § 48 Öffentliche Reden § 49 Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare § 50 Bild- und Tonberichterstattung § 51 Zitate § 52 Ausnahmsweise bei öffentliche Wiedergabe § 53 Vervielfältigung zum privaten und sonstigen Gebrauch - zulässig ist die Herstellung einzelner Vervielfältigungsstücke (Anzahl durch die Rechtsprechung ca. 7) - zum privaten Gebrauch: Benutzung in durch private Sphäre verbundene natürliche Personen. Deshalb ist es unzulässig privat Hergestellte Vervielfältigungsstücke von Musikwerken (mp3) im Internet an eine Vielzahl von Benutzern anzubieten. § 55a UrhG s.o. § 63 Quellenangabe Verpflichtung zur Quellenangabe, wenn die Vervielfältigung oder Veröfftentlichung aufgrund einer der Einschränkungen des Urheberrechtes erfolgt. Der Infobroker, der idR berechtigt und entgeltlich Informationen erwirbt, ist demnach nicht zur Quellenangabe verpflichtet; es sei denn, die entsprechende Vereinbarung mit dem Datenbankbetreiber verpflichtet dazu. 4.2.10 Shareware / Freeware / Public Domain Das Urheberrecht kann als Persönlichkeitsrecht nicht aufgegeben werden. Der Urhber kann für sein Werk bestimmte Nutzungsarten gestatten. Nutzung ist dann nur in diesem Rahmen zulässig. vgl. OLG Düsseldorf U.v. 26.07.1995, NJW-RR, 1996, S. 555 (Shareware) Public Domain entstammt der US-Rechtsraum. Gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. PD bedeutet, dass das Urheberrecht bei der Allgemeinheit liegt. GPL (general public license) der Free Software Foundation vgl. http://org.gnu.de/philosophy/license-list.html und http://www.gnu.de/gpl-ger.html in deutscher Sprache. GPL - Deutsch - lokal Grundsatz: freie Kopierbarkeit und freie Vervielfältigung, freie Bearbeitung Es muss jeweils der Sourcecode mitgeliefert werden. Darauf aufbauende Software muss wieder unter GPL gestellt werden. Deutlicher Hinweis auf die Urheber (Lizenzinhaber). 4.2.11 Schutzansprüche des Urhebers Verwertungsverbot nach § 96 UrhG. Keine Verbreitung rechtswidrig hergestellter Vervielfältigungsstücke. Widerrechtliche Verletzung eines nach dem Urheberrechtsgesetz geschützen Rechtes führt zu einem Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch und bei Verschulden Schadensersatzanspruch (§ 97 UrhG) Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung von rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücken (§ 98 UrhG) Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung von Vervielfältigungsgeräten (§ 99 UrhG) Anspruch auf Beseitigung, Unterlassung, Vernichtung (§§ 97-99) besteht auch gegen das Unternehmen, wenn die Tat von Arbeitnehmer ober Beauftragten begangen wird (§ 100 UrhG). Jedoch: kein Schadensersatz. Handelt der Verletzte ohne Verschulden kann er statt der vorstehenden Ansprüche den Urheber auch in Geld entschädigen. 4.2.12 Übung Beispiele der rechtlichen Vertragsgestaltung großer DB-Anbieter Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 55 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 http://www.dimdi.de/de/db/recherche.htm http://www.hoppenstedt.de/ DAtenbankanbieter http://www.munzinger.de/lpBin/lpExt.dll http://www.bfai.com/ http://194.55.223.215/index.php (Crditform) 4.2.12.1 Eletronisches Pressearchiv http://www.jura.uni-sb.de/jurpc/rechtspr/19990026.htm 4.2.12.2 Kidnet LG Köln Geschäftsnummer: 28 0 527/98 Urteil vom 25. August 1999 http://www.netlaw.de/urteile/lgk_14.htm 4.2.12.3 Anzeigen Sammlung LG Köln 28 0 431/98 Urteil vom 2. Dezember 1998 http://www.netlaw.de/urteile/lgk_15.htm 5. Ordnungsrechtlicher Rahmen 5.1 Unterscheidungen 5.1.1 Netzradio Student A hört davon, dass die FH Bonn-Rhein-Sieg ein Studentisches Radioprogramm starten möchte. Er hält diese Idee für unsinnig und möchte einfach über seinen Webserver sein eigenes Webradio anbieten. Daneben gibts die Möglichkeit unmittelbar mit dem Moderator zu chatten. Außerdem gibt es dort aktuelle Infos zum Studium und Referate zum Download. Studentin B meint, dafür müsse er erst eine Lizenz bei der Landesmedienanstalt beantragen. 5.1.2 Teledienste - Mediendienste Teledienst (§ 2 Teledienstegesetz): elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, die für eine individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten wie Zeichen, Bilder oder Töne bestimmt sind und denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt (Teledienste). (Zuständigkeit des Bundes) 5.1.3 Mediendienste Mediendienst (§ 2 Mediendienste Staatsvertrag): an die Allgemeinheit gerichteter Informations- und Kommunikationsdienst (Mediendienste) in Text, Ton oder Bild, die unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters verbreitet werden. (Zuständigkeit der Länder) Unberührt bleiben Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages Bestimmungen des Teledienstegesetzes (in der in einem Bundesgesetz erstmalig beschlossenen Fassung) Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes Bereich der Besteuerung unberührt. 5.1.4 Rundfunk Rundfunk (§ Rundfunkstaatsvertrag): für die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen 56 WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 in Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters. Der Begriff schließt Darbietungen ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind. 5.2 Teledienste 5.2.1 Teledienste 5.2.1.1 Gegenstand Teledienste (§ 2 Abs. 1 TDG) alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, die für eine individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten wie Zeichen, Bilder oder Töne bestimmt sind und denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt Beispiele für Teledienste: 1. Angebote im Bereich der Individualkommunikation (zum Beispiel Telebanking, Datenaustausch), 2. Angebote zur Information oder Kommunikation, soweit nicht die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht (Datendienste, zum Beispiel Verkehrs-, Wetter-, Umwelt- und Börsendaten, Verbreitung von Informationen über Waren undDienstleistungsangebote), 3. Angebote zur Nutzung des Internets oder weiterer Netze, 4. Angebote zur Nutzung von Telespielen, 5. Angebote von Waren und Dienstleistungen in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit. 5.2.1.2 Zugangsfreiheit Teledienste sind zulassungs- und anmeldefrei (§ 5) Im Unterschied sind Rundfunkt und bestimmte Telekommunikationsdienstleistungen anzeige- und z.T. lizenzpflichtig. 5.2.2 Fall: Auslandsserver Unternehmer C. Lever findet das Medien- und Telediensterecht in Deutschland unmöglich. Er kommt deshalb auf den Gedanken seinen Server ins (europäische) Ausland zu verlegen. Entgeht er damit der entsprechenden Kontrolle, wenn sein Unternehmen normal in Deutschland verbleibt. Wie wäre der Fall, wenn C. Lever seinen Betriebssitz wirklich in nach Dänemark verlegt und von dort Pornographie im Internet offen anbietet. Könnte eine deutsche Behörde gegen dieses Internetangebot vorgehen? 5.2.3 Kommerzielle Kommunikation, § 3 TDG „kommerzielle Kommunikation“ jede Form der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sonstigen Organisation oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk oder einen freien Beruf ausübt; die folgenden Angaben stellen als solche keine Form der kommerziellen Kommunikation dar: a) Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens oder der Organisation oder Person ermöglichen, wie insbesondere ein Domain-Name oder eine Adresse der elektronischen Post; b) Angaben in bezug auf Waren und Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisation oder Person, die unabhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung gemacht werden; 5.2.4 Herkunftslandprinzip, § 4 TDG § 4 TDG regelt das Herkunftslandprinzip 1. Für deutsche Unternehmen, die Teledienste geschäftsmäßig in anderen EU Staaten anbieten, gilt weiterhin deutsches Recht. (§ 4 Abs. 1 TDG) Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 57 2. 3. 4. Mögliche Ausnahmen von diesem Grundsatz (§ 4 Abs. 2 TDG) - Freie Rechtswahl durch die Beteiligten - Verbraucherverträge (-> Fernabsatz §§ 312 a BGB und §§ 29 und 29a EGBGB, dort gilt das Recht des Verbraucherlandes) - Geschäfte über Immobiliarrechte (Grundstückskaufverträge etc.) Mögliche Ausnahmen von diesem Grundsatz (§ 4 Abs. 3 TDG) - Notare und andere hoheitliche tätige Berufe - Vertretung von Mandanten vor Gericht - die Zulässigkeit von Werbe-Emails - Gewinnspiele mit geldwertem Einsatz - Anforderung von Verteildiensten - das Urheberrecht und andere gewerbliche Schutzrechte - die Ausgabe von elektronischem Geld - Vereinbarungen die dem Kartellrecht unterliegen - Versicherungsverträge - Datenschutzrecht Unternehmen aus anderen EU Staaten werden nicht eingeschränkt (§ 4 Abs. 2 TDG). - Ausnahmen zum Schutz (§ 4 Abs. 5 TDG) - der öffentlichen Ordnung - der öffentlichen Sicherung - der öffentlichen Gesundheit - der Interessen der Verbraucher 5.2.5 Informationspflichten, § 6 TDG Geschäftsmäßige Telediensteanbieter müssen folgende Angaben leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar ständig verfügbar zu halten: 1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich den Vertretungsberechtigten, 2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post, 3. soweit der Teledienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, 4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer, 5. soweit der Teledienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 3-jährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25), die zuletzt durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 S. 31) geändert worden ist, angeboten oder erbracht wird, Angaben über a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind, 6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a des Umsatzsteuergesetzes besitzen, die Angabe dieser Nummer. Weitergehende Informationspflichten insbesondere nach dem Fernabsatzgesetz, dem Fernunterrichtsschutzgesetz, dem Teilzeit-Wohnrechtegesetz oder dem Preisangaben- und Preisklauselgesetz und der Preisangabenverordnung, dem Versicherungsaufsichtsgesetz sowie nach handelsrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften ist mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro bedroht (§ 12 TDG). Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 58 5.2.6 Besondere Hinweispflichten, § 7 TDG Anbieter von Telediensten haben bei der kommerziellen Kommunikation folgende Hinweise zu geben: 1. Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche zu erkennen sein. 2. Die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muss klar identifizierbar sein. 3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkennbar sein, und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden. 4. Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnahmebedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden. Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bleiben unberührt. 5.2.7 Fall: Eigener Webserver Student A. betreibt in seiner Wohnung über seine DSL-Flatrate einen Linuxserver als Webserver. Über entsprechende dynamische DNS Einträge erzeugt er den Eindruck eines normalen Webservers. Um einen Teil der Kosten zu decken schaltet der A. Werbung auf seinen Seiten. Da er aus seinem letzten Job noch drei große Festplatten (300 GB) hat, läuft auf seinem Server auch ein attraktives Movie-Forum, in dem Freunde sich über aktuelle Filme unterhalten können und zur Unterstreichung Ihrer Meinungsäußerungen auch die Filme als Anlage beifügen können. So können alle qualifiziert mitdiskutieren. A liest nur unregelmäßig mit – er muss ja an der FH studieren. Eines Tages erreicht Ihn das Schreiben eines Anwaltes, in dem dieser im vorwirft a) Er habe seinen Webserver nicht ausreichend gekennzeichnet und droht ihm eine Anzeige bei der zuständigen Behörde an. b) Er vertrete den Rechteinhaber des Films Solar Wars II und verlange sofortige Löschung aller Kopien dieses Films von seinem Server. 5.2.8 Verantwortlichkeiten 5.2.8.1 Mögliche Verantwortlichkeiten Aus Verträgen Leistung, Gewährleistung, Schadensersatz etc. Außerhalb von Verträgen, Zivilrechtliche Schadensersatz und Unterlassung Aus dem Wettbewerbsrecht Aus dem Urheberrecht Öffentlich-rechtliche aus dem Datenschutzrecht Sperr- u. Kennzeichnungspflichten aus MDStV oder TDG Strafrechtliche z.B.: Volksverhetzung (§ 130 StGB) Gewaltdarstellung (§ 131 StGB) Pornographie (§ 184 StGB) 5.2.8.2 Eigene Inhalte - volle Verantwortlichkeit § 8 Abs. 1 TDG 5.2.8.3 Fremde Inahlte § 9 Abs. 2 TDG Diensteanbieter müssen übermittelte Informationen nicht überwachen und nicht aktiv nach rechtswidrigen Inhalten forschen. Durchleiten von Informationen Für durchgeleitete Informationen sind Diensteanbieter grundsätzlich nicht verantwortlich (§ 9 TDG) wenn: Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 59 sie die Übermittlung nicht veranlaßt haben und sie die Adressaten der Information nicht ausgewählt haben sie die übermittelten Informationen nicht auswählt oder verändert haben. Verantwortlichkeit aber: Wenn Diensteanbieter mit Nutzer zur Begehung rechtswidriger Handlungen zusammenwirken. Die kurzfristige Zwischenspeicherung zum Transport im Netzwerk schadet nicht. (§ 9 Abs. 2 TDG). Kurzfristige Zwischenspeicherung Keine Verantwortlichkeiten für die kurzzeitige Zwischenspeicherung (Proxy-Server) die allein dem Zweck dient, die Übermittlung der fremden Information an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, es sei denn: 1. die Informationen werden nicht verändert, 2. sie die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen beachten, 3. sie die Regeln für die Aktualisierung der Information, die in weithin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, beachtet werden, 4. sie die erlaubte Anwendung von Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die in weithin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen und 5. sie unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift gespeicherte Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon erhalten haben, dass die Informationen am ursprünglichen Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurden oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde oder ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat. § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Speicherung von Inhalten für Dritte § 11 TDG: Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder 2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. 5.3 Datenschutz 5.3.1 Überblick Der Datenschutz für Teledienste ist im Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) Mediendienste im Mediendienstestaatsvertrag (MDStV) geregelt. Diese Regelungen gehen dem BDSG vor; das BDSG gilt ergänzend. So z.B.: Grundsatz der Datensparsamkeit Grundsatz des Systemdatenschutzes Das TDDSG/MDStV enthält zahlreiche Sonderregelungen des Datenschutzes. 5.3.2 Beispielsfall: Vertriebsbeauftragter Das Versicherungsunternehmen V rüstet alle Außendienstmitarbeiter mit Notebooks mit Anbindung über die Handys an das zentrale Firmennetz an. Vertreter Kaiser geht zum Kunden, tippt alle Daten für eine neue KFZ-Vollkaskoversicherung für Herrn Carlos Rash ein und fragt nach Übermittlung der Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 60 Daten an die Zentrale nach, ob die Versicherung geschlossen werden kann. Von der Zentrale kommt unverzüglich die Meldung, das man mit Herrn C. Rash, wegen registrierter Vorunfälle keinen Vertrag machen möchte. Jetzt wird C. Rash wach und beschwert sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz wegen der Übermittlung der Daten an die Zentrale. Wie muss dieser entscheiden? 5.3.3 Grundlegende Regelungen Die Vorschriften gelten für alle Tele- und Mediendienste (§ 1 ff. TDDSG und § 16 ff. MDStV) (nachfolgend wird nur auf die Vorschriften des Teledienstegesetzes Bezug genommen. Die Übermittlung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder zwischen Unternehmen/Verwaltungen zur Steuerung von Arbeits- oder Geschäftsprozessen, werden nicht erfaßt. Die Begriffe von Nutzer und Diensteanbieter sind fast identisch mit dem TDG (Ausnahme Nutzer, können nur natürliche Personen sein). Grundsatz: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. (§ 3 Abs. 1 TDDSG) Gesetzliche Erlaubnis Einwilligung Keine Abhängigkeit von Telediensten, von der Einwilligung in die Datenverarbeitung (§ 3 Abs. 4 TDDSG). Aber: Möglichkeit, Einwilligung vereinfacht (elektronisch) zu erteilen. 5.3.4 Bestandsdaten - Nutzungsdaten Bestandsdaten und Nutzungsdaten von Nutzern werden unterschieden: Bestandsdaten (§ 5 TDDSG) Daten über die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung des Vertragsverhältnisses Erhebung, Verarbeitung, Nutzung ohne Einwilligung (gesetzliche Erlaubnis) Nutzungsdaten (§ 6 TDDSG) Daten um die Inanspruchnahme des Dienstes oder seine Abrechnung Erhebung, Verarbeitung, Nutzung ohne Einwilligung (gesetzliche Erlaubnis) Typische Nutzungsdaten sind: Identifikationsmerkmale Beginn und Ende der Nutzung Angaben über die Art des Teledienstes. Daten verschiedener Dienste dürfen für die Abrechnung zusammengefaßt werden. 5.3.5 Pflichten des Diensteanbieters Diensteanbieter trifft eine Reihe von Verpflichtungen: Umfassende Hinweispflichten (§ 4 Abs. 1 TDDSG) dieser Hinweis muss jederzeit abrufbar sein die elektronische Einwilligung muss durch - eindeutige, bewusste Handlung erfolgen - protokolliert werden - für den Nutzer jederzeit abrufbar sein - Hinweis auf das Recht zum jederzeitigen Widerruf der Einwilligung (Abs. 3) Technische und organisatorische Anforderungen: - jederzeitige Abbruchsmöglichkeit - sofortige Löschung der Nutzungsdaten (Ausnahme Abrechnung) - Nutzung in geschützter Umgebung (z.B. ssl) - keine Zusammenführung von Nutzungsprofilen mit Nutzerangaben Die Weitervermittlung zu einem anderen Diensteanbieter ist anzuzeigen. 5.3.6 Bußgeldbescheid Der Shop around the clock GmbH betreib ein Shopping Portal. Dabei kooperiert man mit zahlreichen Subunternehmern. Satc GmbH bildet dabei Nutzungsprofile seiner Kunden. Die Daten werden in soweit anonymisiert, dass statt des echten Namens lediglich eine zufällige Zahlenkombination eingetragen wird. Diese Daten gibt die Satc GmbH auch an ihre Geschäftspartner weiter. Als die DirectMailGmbH, ein Geschäftspartner von Satc GmbH, die Daten auswertet, möchte diese von einer genau bezeichneten Anzahl von Nutzern die Namen und Anschriften zu den Zufallsnummern erfahren. Diese werden von Satc GmbH gegen Entgelt weitergeben. Hans Arglos beschwert sich, als Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 61 er zahlreiche Direktmailings erhält bei Landesdatenschutzbeauftragten. Dieser ermittelt den vorstehenden Sachverhalt. Kann er ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro verhängen? 5.3.7 Datenauswertung Für Werbung und Markforschung, bedarfsgerechte Angebotsgestaltung dürfen pseudonyme Nutzungsprofile erstellt werden. Dagegen steht dem Nutzer ein Widerspruchsrecht zu. Darüber ist der Nutzer zu belehren (§ 6 Abs. 3 TDDSG). Beim Outsourcing des Rechnungswesens oder Inkasso können die Nutzungsdaten übermittelt werden. Nutzungsdaten sind an sonsten nach Nutzungsende zu löschen. Ausnahme: Verdacht auf Dienstmißbrauch (§ 6 Abs. 8 TDDSG) 5.3.8 Bußgeldvorschriften Das neue TDDSG enthält zahlreiche Bußgeldvorschriften. Bußgeld bis 50.000 Euro. Z.B.: unzulässige Dienstkopplung mit Einwilligung Mangelhafte Unterrichtung Unzulänglichkeiten bei der elektronischen Einwilligung Datenschutzanforderungen nach § 4 Abs. 4 TDDSG Überschreitung der Erlaubnisse nach den §§ 5 und 6 TDDSG Zusammenführung von Profilen mit Pseudonymen. 5.4 Exkurs: Datensicherheit 5.4.1 Ziele der Sicherheit Integrität Authentizität Vertraulichkeit Verfügbarkeit Verlässlichkeit 5.4.2 Schutz des lokalen Windwos Rechners Bei Windwos Rechnern: - Keine Freigabedienste verwenden Keine passwortfreien Ressourcen Im lokalen Netz kein TCP/IP sondern (IPX oder NetBui) Minimal: - Eigenen Proxyserver einrichten (z.B. Jana Server http://www.jana-server.ocm.de/Deutsch/FrameSet.htm) Persönliche Firewall einrichten (z.B. ZoneAlarm von http://www.zonelabs.com/default.htm) Ständiger Virenscan (z.B. AntiVir http://www.antivir.de/) - 6. Zusammenfassung Prof. Dr. Klewitz-Hommelsen WS 02 / V 1.3 - Stand: 06.01.2003 62