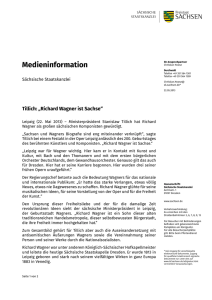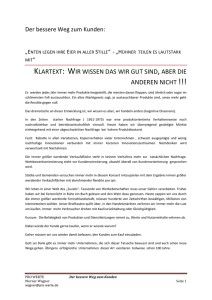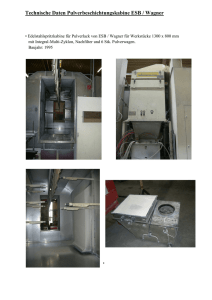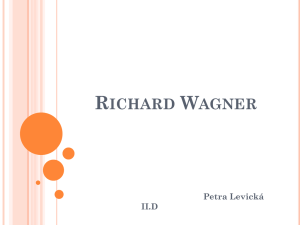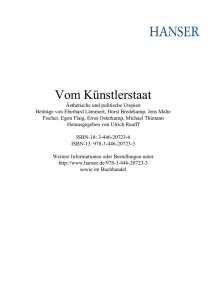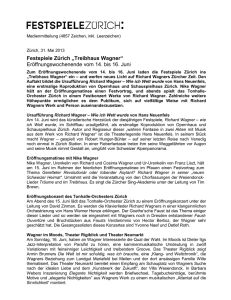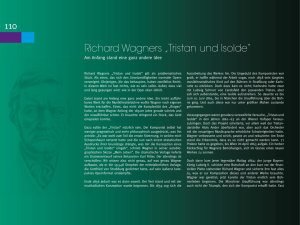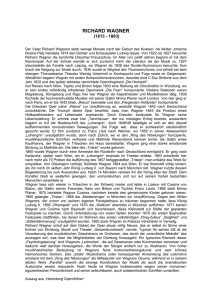RWVL Journal 1 / 2017 - Richard-Wagner
Werbung

Journal des Richard-WagnerVerbandes Leipzig Aktuelles aus der Geburtsstadt des Meisters 1/2017 Verantwortung für Leipzig: Ein Haus für Richard Wagner W as habe ich mit Richard Wagner und einem Richard-Wagner-Haus zu tun? Als ich 2004 nach Leipzig kam, war ich freudig überrascht, davon zu hören, dass der große Komponist Richard Wagner hier geboren worden ist, das Geburtshaus zwar nicht mehr steht, aber der Ort eindeutig zu lokalisieren sei. Bei den ersten Stadtbesichtigungen, vor allem aber immer, wenn ich etwas im Museum der bildenden Künste zu tun hatte, kam ich an diesem Platz vorbei. Ich wunderte mich, dass man von diesem Wissen so wenig Gebrauch machte, doch man sagte mir, dass spätestens nach Abriss der Altbausubstanz und Neubau der Höfe am Brühl dem Geburtsort und damit dem Komponisten das entsprechende Andenken gegeben wird. Was aber geschah? Außer der kleinen, kaum erkennbaren Gedenktafel am neuen Gebäudekomplex nichts Wahrnehmbares!! Warum hat die Stadt, die sichtbar Bachs, Mendelssohns, Schumanns und Griegs gedenkt, keine angemessene Erinnerungsstätte für Richard Wagner? Ja, habe ich mich belehren lassen, es gibt in der Alten Nikolaischule einen Raum, von dem aber nur wenige, selbst Einheimische etwas wissen. Liegt es vielleicht auch daran, dass Wagner eine schillernde Persönlichkeit gewesen ist, die auch im Politischen anstößige Äußerungen gemacht hat? Deshalb geht es nicht darum, ihm einseitig zu huldigen, nein, man muss sich mit der Person und seinen Aussagen, vor allem aber auch seinem Werk ganzheitlich auseinandersetzen. Viele Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Leipzig, um die Geburtsstadt dieses weltberühmten Komponisten zu erleben; zunächst mit den musikalischen Darbietungen unserer Oper. Dann fragen sie aber zu Recht: „ Und wo können wir etwas über die Person Wagner in ihrer Tiefe und Breite erfahren?“ Die Antwort: „Hier nicht“, und dementsprechend ist auch der städtische Ansatz bezüglich einer Erinnerungsstätte. Dieses Verhalten halte ich für grundfalsch. Wir sollten Richard ist Leipziger … für die Gäste, aber auch uns Einheimische neben dem Genuss der Werke in unserer Oper eine Begegnungsstätte schaffen, die Raum für Diskussionen und Zeit zum Verweilen bietet. Einen Ort, wo wissenschaftliche Diskurse geführt werden können, eine Bibliothek mit den hunderten von Büchern über Wagner und seine Werke und eine multimediale Landschaft existiert. Ähnlich und in vielen Bereichen vorbildlich ist hier das Mendelssohn-Haus. Nun kann man sagen, ihr habt doch einen Wagner-Verband, warum kümmert der sich nicht um solch eine Einrichtung? Aber: Genau das versucht diese Gemeinschaft seit Jahren, bisher leider noch vergeblich. Jetzt wird in den verschiedenen Medien von vielen Personen das Wort ergriffen, die das Gebäude des Naturkundemuseums zur Nutzung für ein RichardWagner-Haus vorschlagen. Es liegt ideal gegenüber dem Richard-Wagner-Platz und der Richard-Wagner-Straße, wo sein Geburtshaus und das Alte Theater als Inspirations- und Aufführungsort erster Kompositionen standen. Ich unterstütze diese Idee, zumal das Haus aus Wagners Zeit stammt und das Gebäude schon immer museal genutzt wurde. Eine Präsenzbibliothek auch zu Journal 1/2017 Forschungszwecken könnte angelegt werden, ein Kammermusiksaal sollte für Konzerte, Aufführungen und die Proben junger Musiker dienen. Die Tradition der Wagner-Aufführungen in Leipzig sollte Darstellung finden. Interaktiv, wie in den anderen Komponistenhäusern, sollten die Musikwerke Wagners auch als Klangerlebnis angelegt sein. Hier ist vielleicht auch das Kennenlernen der Grundlagen des Dirigierens vorstellbar. War er nicht einer der Ersten, die sich mit einem Taktstock den Musikern zuwandten und zur Beendigung von Geschwätz (!) das Licht löschen ließen? Gastronomie würde die praktische Seite abrunden. Sinnvoll wäre auch die Geschäftsstelle des Wagner-Verbandes im Gebäude, um tatsächlich vor Ort zu sein. Mit diesem Richard-Wagner-Haus und der internationalen Ausstrahlung Wagners wird ein neuer Anziehungspunkt entstehen und ein neues Motto für die Stadt spruchreif: „Wagner – ein Leipziger bespielt die Welt“. Die Handels- und Messestadt wusste früher, was ihr und ihren Bürgern zugute kam. Undenkbar, wenn man diese Chance nicht nutzen und bürgerschaftliches Engagement weiter verpuffen lassen würde. Harald Fugger, Brigadegeneral a. D. Gedenken zum 134. Todestag von Richard Wagner Dankkonzert der Bayreuth-­ Stipendiaten 2016 Unser Verband beging Richard Wagners Todestag in diesem Jahr mit einem Kulturwochenende. Den Auftakt gab am 10. Februar 2017 das, mittlerweile zehnte, Konzert der Bayreuth-Stipendiaten im Kammermusiksaal der Musikhochschule, vorbereitet von unserem Verbandsmitglied Prof. Carola Guber. Stefan Schönknecht vom Künstlerischen Betriebsbüro der Hochschule hatte wie gewohnt pünktlich Plakate und Programme drucken lassen. Nach der Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden Thomas Krakow bot Philipp Rauch (Trompete) von der Musikschule „Johann Sebastian Bach“, begleitet von Vita Gajevska, den zahlreich erschienenen Zuhörern Auszüge aus Opern Richard Wagners in der Bearbeitung für sein Instrument und Klavier. Vita Gajevska begleitete auch Anika Petzsch (Sopran) von unserer Hochschule auf ihrem Ausflug in die Romantik mit Lizsts Kompositionen zu Goethes „Freudvoll und leidvoll“, Heines „Die Loreley“ und Wagners „Gretchen am Spinnrade“ aus den „Sieben Kompositionen zu Goethes Faust“. Musikschüler Elija La Bonté (Violine) bot danach den 1. Satz Allegro aus dem Violinkonzert Nr. 4 D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, wiederum begleitet von Vita Gajevska. Nach dem „Werbeblock“, den der Vorsitzende für weitere Informationen nutzte, trat Ricardo Llamas Márquez (Bassbariton) in der Klavierbegleitung von Filipe Pinto mit Giuseppe Verdis Arie des Filippo II. „Ella giammai m’amò“ aus „Don Carlo“ auf. Ihm folgte Anne Petzsch (Sopran) mit den gefühlvoll vorgetragenen „Wesendonck-Liedern“„Der Engel“ und „Träume“ von Richard Wagner. Vita Gajevska begleitete sie wie auch Elija La Bontè und Anika Paulick bei „Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen“ aus „Neun deutsche Arien“ von Georg Friedrich Händel. Das fulminante Ende boten Ricardo Llamas Márquez und Filipe Pinto mit Wotans Abschied „Leb wohl, du kühnes herrliches Kind“ aus „Walküre“ von Richard Wagner. Ein großer, ein begeisternder Abend, den das Publikum mit lang anhaltendem Applaus quittierte. Der Dank gilt allen, die an der Vorbereitung und Durchführung dieses schönen Abends beteiligt waren. Er gilt aber auch jenen, die diese wunderbare Leistung einer Spende für die weitere Stipendiatenarbeit wert hielten. tk vorjährige Bayreuth-Stipendiatin unseres Verbandes, eingeleitet wurde. Der bekannte Schauspieler Friedhelm Eberle begeisterte mit der Lesung „Immer wi(e)der Richard Wagner“, bei der die Zuhörer eine Sprachkultur erleben konnten, die heute oftmals auf den Bühnen oder im Film vermisst wird. Augenzwinkernd ließ er im ersten Teil George Bernhard Shaw, Thomas Mann und Eduard Hanslick ebenso zu Wort kommen wie auch Karl Marx. Vor der Kaffeepause, in der die von Verbandsmitgliedern gebackenen leckeren Kuchen regen Zuspruch fanden, informierte Prof. Dr. Schneider, einer der Initiatoren der Notenspur, über den Erfolg dieser Initiative und darüber, dass sich Leipzig damit um das Europäische Kulturerbe-Siegel bewirbt. Thomas Krakow erinnerte u. a. nochmals daran, dass Wagner, obwohl Sohn der Stadt, noch keine institutionelle Heimat in Leipzig hat. Im zweiten Teil las Friedhelm Eberle Romain Rollands Eindrücke von einer Bayreuther „Walküre“-Aufführung sowie Passagen aus Ernst von Piddes strafrechtlicher Analyse handelnder Personen im „Ring des Nibelungen“, was wieder Schmunzeln bei den Zuhörern hervorrief, ebenso wie Friedrich Nietzsches Überlegungen über den Erlösungsmythos bei Wagner, wo immer irgendwer erlöst werden will, sowie den zum Besten gegebenen Wagner-Glossen. Zum Abschluss brachte Bayreuth-Stipendiatin Anne Petzsch zwei „Wesendonck-Lieder“ sowie Arie und Rezitativ der Leila aus den „Perlenfischern“ von Georges Bizet zu Gehör. Beide Stipendiaten wurden von Vita Gajevska am Klavier begleitet. Allen Künstlern wurde viel Applaus gespendet, und die Zuhörer waren sich einig, schöne Stunden mit Richard Wagner erlebt zu haben. kh Den bereits zum fünften Mal vergebenen Preis des Lortzing-Wettbewerbs des Lions Clubs Leipzig gewann 2017 die Sopranistin Henrike Hennoch von der Musikhochschule. Sie trug mit Verve Franz Lachners „Auf den Flügeln des Gesangs“ und Gustav Mahlers „Wir genießen die himmlischen Freuden“, arrangiert von Arnon Zimra, in der Begleitung von Shelly Ezra an der Klarinette und Katharina Schlenker am Klavier vor. Im Spiegel von Freunden, Verehrern und Zeitgenossen In der neunten Auflage des Leipziger Notenspur-Salons war am 12. Februar Richard Wagner (Andrew York) höchstselbst in der Aula der Alten Nikolaischule anwesend, nebst erster Gattin Minna (Madlen Römer). In seinem Gefolge hatten sich weitere kostümierte Gäste eingefunden und natürlich Künstler, die Salonatmosphäre zauberten. Ehrenfried Wagner rief mit seinem Horn zur Eröffnung, die Vorsitzender Thomas Krakow vornahm. Der Meister führte anschließend durch das abwechslungsreiche Programm, das mit Liedern von Franz Liszt und Richard Wagner, vorgetragen von Anika Paulick, Hat gut lachen Christa Asperger Salonnièren Christine Grüneisen, Sigrun Becker Souveräner Auftritt Friedhelm Eberle, Thomas Krakow Seiten 2 / 3 Berichte Beseelt-gefühlvoll Vita Gajevska, Anne Petzsch Spannungsbogen zwischen ­Emotion und ­Reflexion Dr. Christian Geltinger Karriere im Blick Musikschüler Elija La Bonté Leb wohl, du kühnes herrliches Kind Durch Trompetenklänge des Musikers und Komponisten Ehrenfried Wagner und ein Hornquartett der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ mit „Wach auf, es nahet gen den Tag“ aus den „Meistersingern“ und dem Pilgerchor aus „Tannhäuser“ auf den 134. Todestag Richard Wagners am 13. Februar eingestimmt, durften die rund 30 Teilnehmer der Kranzniederlegung an der Wagner-Büste hinter dem Opernhaus eine beeindruckende, sehr persönlich gehaltene Rede von Dr. Christian Geltinger erleben. „Man kann nicht über Musik sprechen, man kann nur darüber sprechen, was Musik in einem auslöst“, zitierte der Chefdramaturg der Oper Leipzig den Wagner-Interpreten Daniel Barenboim, und schilderte seine Erlebnisse als Volontär an der Bayerischen Staatsoper vor 15 Jahren, als er sich zum ersten Mal mit dem „Ring des Nibelungen“ beschäftigte und der Produktionsdramaturgin Nike Wagner assistierte. Bei der Arbeit an der „Walküre‘“ starb sein Vater. Wotans Abschied von Brünnhilde ließ ihn wie einen Richard ist Leipziger … Talentierter Nachwuchs Stipendiaten, Preisträgerin, Begleiter Schlosshund weinen, und noch jahrelang, wenn die Zeilen erklangen „Leb wohl, du kühnes herrliches Kind“ und „Der Augen leuchtendes Paar“, übermannten ihn die Emotionen. Offenbar gelingt es der Musik Richard Wagners, unmittelbar existenzielle Erfahrungen des menschlichen Daseins aufzurufen, wie Trennung, Tod, das Abschiednehmen von einem geliebten Menschen. Dabei entwickelt Wagner eine Suggestivkraft, die direkt an den Emotionen ansetzt und die Urinstinkte des Menschen hervorzurufen scheint. Bei der Beschäftigung mit Wotans Abschied Jahre später stellte Geltinger fest, dass sich sein Verhältnis dazu elementar verändert hatte. Sah er noch einen liebenden Vater, der Abschied nimmt von seinem Kind? Oder eher einen Mann, der Abschied nimmt von seiner Macht? Hatte die Droge Richard Wagner ihre Wirkung verloren, der Rausch der Emotionen nachgelassen? Oder sich sogar seine Empathiefähigkeit, seine Sensibilität abgenutzt? Im Gegenteil, er lernte aus dieser Erfahrung sehr viel Journal 1/2017 Bläst die Wagner-Fanfare Musikschüler Philipp Rauch über die Wirkungsweise der Musik Richard Wagners. Beide Aspekte spielen bei der Rezeption seiner Musik eine entscheidende Rolle: die existenzielle Erfahrung und die kritische Distanz und Reflexion. Musik hat die Kraft, uns mit unseren Emotionen in Verbindung zu bringen, es kann aber auch existenziell gefährlich werden, wenn wir mit unseren Emotionen allein gelassen werden und zu manipulierbaren Wesen ohne eigenen Willen werden. Deshalb bedarf es immer auch der Reflexion. Insbesondere darin sieht Christian Geltinger die Aufgabe derjenigen, die das Werk Richard Wagners in die Zukunft weiter tragen, und unterstrich abschließend die „Verantwortung, durch ein ausgewogenes Verhältnis von Emotion und Reflexion die Musik von jeglicher ideologischer Vereinnahmung, vor jeglicher Beanspruchung einer vermeintlichen Deutungshoheit zu schützen, damit sie das bleibt, was sie ist: lebendige Musik, die in der Auseinandersetzung mit uns und der Welt einem ständigen Wandel ausgesetzt ist.“ pu Mein lieber Schwan à la Lyon Feuerzauber, ­Chefpatissier Annäherung Hector Berlioz, Leipziger Wagner-Jünger Wagneraffin Pascal Bouteldja, Hartmut Haenchen, Thomas Krakow Bei Partnern und Freunden in „Frankreichs Bayreuth“ Lyon B ereits 2016 hatten die Freunde vom Cercle Richard Wagner Lyon für die Feier ihres 35. Gründungstages zur Reise in die drittgrößte Stadt Frankreichs geworben. Lyon ist seit 36 Jahren Leipzigs Partnerstadt. Deshalb machten sich 38 Teilnehmer auf den Weg, um vom 24. bis 28. März 2017 zu gratulieren und an Rhone und Saône mitzufeiern. Stil haben die Franzosen in der Stadt von Geschmackspapst Paul Bocuse und Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement derer, die kulturelle Bildung und Genuss als Bereicherung des menschlichen Daseins betrachten. Anlässlich des Besuchs aus Leipzig lud die Großgemeinde Grand Lyon zum Empfang in das barocke Rathaus, bei dem die Vizepräsidentin für Kultur Myriam Picot die lebendigen Beziehungen zwischen beiden Städten würdigte. Lyons Verbandsvorsitzender Pascal Bouteldja sang ein Loblied auf die Entwicklung des Leipziger Richard-Wagner-Verbandes und Leipzigs als Wagner-Stadt und würdigte seine Vorgängerin Chantal Perrier und deren Mann Henri. Leipzigs Verbandsvorsitzender Thomas Krakow warb in seiner Rede für einen Besuch der Leipziger Richard-­ Wagner-Festtage 2018. Zur Überraschung aller erschien Maestro Hartmut Haenchen, der sich mit seiner bravourösen „Parsifal“Einstudierung bei den Bayreuther Festspielen 2016 in die höchsten Sphären des Wagner-Himmels dirigierte, als Chef des Lyoner Opernorchesters, aber auch als Dresdner und Sachse zu diesem Empfang. In seinem Grußwort erinnerte er an sein letztes Dirigat in Leipzig: „Tristan und Isolde“ am 1. April 2002. Mit der Bayreuther Inszenierung des „Tristan“ von Heiner Müller und der Dresdner „Elektra“-Inszenierung von Ruth Berghaus unter Haenchens Stabführung wusste die Oper Lyon an den beiden Folgetagen das Publikum zu faszinieren und wahre Begeisterungsstürme auszulösen. Vor Beginn referierte Christian Merlin, Musikkritiker des „Figaro“, zu dem Thema „Wagner und die unendliche Melodie“, dem sich ein kleines Konzert Wagnerscher Lieder anschloss. Nach der „Elektra“ lud der Lyoner Verband zur Jubiläumsfeier. Das Goethe-Institut Lyon unterstützt den lokalen Verband vielfältig, und Direktor Joachim Umlauf gab an diesem Abend den Dolmetscher. Mit ihm wie mit vielen Seiten 4 / 5 f­ ranzösischen Vorsitzenden hatte Thomas Krakow gute Gespräche. Pascal Bouteldja würdigte neben der Freude über die Anwesenheit fast aller französischer WagnerVerbände und belgischer Teilnehmer wiederum die Leistungen des Leipziger Partnerverbandes und verwies auf dessen große Teilnehmerzahl wie schon 2016 in Paris. Als Ausdruck seiner Wertschätzung überreichte er Krakow ein Buch zur Rezeption Wagners in Frankreich sowie einen Originalbrief des Leipziger Theaterdirektors Angelo Neumann von 1877, der dem „Ring des Nibelungen“ in Leipzig zu seinem umjubelten Durchbruch verhalf. Eine Stadtführung, exzellentes Essen und Ausflüge zum Geburtshaus des Komponisten Hector Berlioz in La CôteSaint-André sowie in das Mittelalterdorf Pérouges rundeten den Besuch ab. Dank gilt der R&V Touristik, Büro Leipzig, allen Reiseteilnehmern und den französischen Gastgebern, insbesondere der Stadt Lyon und Pascal Bouteldja. Petrus sorgte gerade am letzten Tag dafür, dass Lyon bei uns allen für eines steht: Leben wie Gott in Frankreich. tk Verbandsreisen AUF DEN SPUREN DER FAMILIE WAGNER Buchpräsentation bei den Bayreuther Festspielen: Dienstag, 1. August 2017, 11 Uhr, Markgrafen-Buchhandlung Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung 5: Die Ruhestätten der Familie Wagner auf dem Alten Johannisfriedhof zu Leipzig von Ursula Oehme Richard-Wagner-Verband Leipzig (Hg.) ISBN 978-3-86729-174-3 Broschur, 14,8 × 21 cm 144 Seiten mit 71 Abbildungen Ladenpreis: 16,80 € Erhältlich im Buchhandel, über den Richard-Wagner-Verband Leipzig oder über den Verlag auf www.sax-verlag.de »[...] Ursula Oehme hat ein in jedem Sinne schönes Buch geschrieben, das beweist, dass der Tod auch Unsterbliches zu provozieren vermag.« wagnerspectrum Die Geschichte der Bayreuther Festspiele E s gibt wohl keinen Komponisten auf dieser Welt, über dessen Person, sein Leben und seine Werke so viel geschrieben wurde wie über Richard Wagner. Und über die wechselvolle Geschichte der Bayreuther Festspiele, dem Lebenswerk Richard Wagners, schien alles gesagt zu sein, was der Wagner-Enthusiast und Bayreuth-Besucher wissen möchte. Doch das jetzt vorgelegte zweibändige Werk über die Geschichte der Bayreuther Festspiele von 1850 bis 2000 sprengt alles, was bisher an Literatur auf den Markt gekommen ist. Fast acht Kilogramm schwer, knapp 1300 Seiten und über 1000 Abbildungen machen dieses enzyklopädische Werk nicht nur zu einem Standardwerk über Richard Wagner und seine Bayreuther Festspiele, sondern es ist selbst ein Gesamtkunstwerk. Das ist kein normales Buch, das man in die Hand nimmt. Schon das Gewicht alleine lässt ahnen, welch unfassbare Fülle an Daten, Fakten und Hintergründen hier verarbeitet ist. Der Autor, Oswald Georg Bauer, war von 1974 bis 1985 wissenschaftlich-künstlerischer Mitarbeiter des Festspielleiters Wolfgang Wagner, seit 1976 auch Leiter des Pressebüros und von 1986 bis 2008 freier Mitarbeiter Wolfgang Wagners. Von der ersten Idee, dem ersten Quellenstudium bis hin zur Veröffentlichung zu den Bayreuther Festspielen 2016 ist mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen. Band I (1850–1950) bildet das Hauptwerk und ist dabei nicht nur die chronologische Aneinanderreihung von gesammelten Daten und Fakten über die Entstehung und Wandlung der Bayreuther Festspiele, sondern gleichzeitig auch ein Zeitdokument deutscher Theatergeschichte, Kultur und Politik. Richard Wagner erwähnte seine Festspielidee erstmalig 1850, und erst 26 Jahre später konnte er sie verwirklichen. Dieser schwierigen Schaffensperiode in Wagners Leben, seiner konfliktbeladenen Beziehung zu König Ludwig II., der als Gönner ein Festspielhaus in München wollte, bis hin zum Scheitern dieses Projekts und den teils chaotischen Verhandlungen über den Bau des Festspielhauses in Bayreuth widmen sich allein die ersten 50 Seiten. Sie sind aber wichtig für das Verständnis des Gesamtkunstwerks von Richard Wagner. Mit der zyklischen Uraufführung des „Ring des Nibelungen“ 1876 hatte Wagner den vorläufigen Höhepunkt seines Schaffens erreicht. Sein Monumentalwerk, von ihm nicht nur komponiert und geschrieben, sondern auch selbst inszeniert, in seinem eigenen Theater, das hat es vorher nicht gegeben, und nach Wagner bis heute und wohl auch in Zukunft nicht mehr. Mit Akribie und Präzision werden alle Details der Vorbereitung, der Proben und der Uraufführung beschrieben, mit genauen Angaben zu Bühnenbildern, Kostümen, Bühnentechnik und natürlich zur Musik und den Sängern der Uraufführung. Dabei entsteht durch Bauers Schreibstil und seine Detailverliebtheit ein derart plastisches Bild, dass der geneigte Leser wie ein stummer Zuschauer am Bühnenrand steht und dabei den großen Meister beobachtet, wie er mit höchstem körperlichem Einsatz den Sängern seine Intentionen zu vermitteln versucht. Insgesamt 21 Kapitel in Band I beschreiben chronologisch und detailliert die Festspiele von 1876 bis 1944 sowie die Zeit nach dem Krieg bis 1950. Der Uraufführung des „Parsifal“ 1882 in Bayreuth widmet Bauer wieder ein umfangreiches Kapitel. Viele Illustrationen bereichern und veranschaulichen die Angaben und verdichten den Gesamteindruck. Nach dem Tod Richard Wagners 1883 übernimmt seine Witwe Cosima die Leitung der Festspiele und baut den Bayreuther Spielplan systematisch auf. Mit Band II (1951–2000), der Entstaubung der Festspiele durch Wieland Wagner und dem Beginn einer neuen Zeitrechnung in Bayreuth ändert sich auch der Stil Bauers. Aus dem Chronisten und Theaterwissenschaftler wird im Laufe der Zeit der mitbeteiligte Zeitzeuge und intime Kenner der Bayreuther Szene, der vieles vor und hinter den Kulissen selbst erlebt hat und aus einem eigenen Fundus an Erfahrungen und Kenntnissen schöpfen kann, ohne dabei die akribische Arbeit eines Theaterwissenschaftlers zu vernachlässigen. Im Juli 1951 konnten die Bayreuther Festspiele nach siebenjähriger Pause wieder aufgenommen werden. Die Brüder Wieland und Wolfgang Wagner waren gleichberechtigt als Festspielleiter und Regisseure. Mit Wieland Wagners Neuinszenierung des „Parsifal“ begann die Epoche von Neu- Seiten 6 / 7 Oswald Georg Bauer: Die Geschichte der Bayreuther Festspiele, Band I: 1850–1950 und Band II: 1951–2000, Deutscher Kunstverlag München 2016, Kassette, 1292 S., ISBN 978-3-422-07343-2, 128,00 Euro Bayreuth. Sie war vor allem von Wielands revolutionären Neudeutungen der Wagnerschen Werke geprägt, die weltweit zum Vorbild wurden. Diesem Neubeginn von Bayreuth widmet Bauer ein ausführliches Kapitel und beschreibt neben den Mühen und Schwierigkeiten der Nachkriegsjahre den neuen Stil der Brüder Wagner, alles Politische vom Grünen Hügel fern zu halten. „Hier gilt’s der Kunst“ ist quasi das Motto des Neuanfangs. Die Festspiele der 1950er Jahre entwickeln sich zu einem Mekka des Wagnerschen Schaffens, alle namhaften Wagner-Sänger und -Sängerinnen der damaligen Zeit versammeln sich in Bayreuth, das vielleicht in künstlerischer Hinsicht seinem Zenit entgegen strebt. Nach Wieland Wagners viel zu frühem Tod im Jahre 1966 mit nur 49 Jahren übernahm sein Bruder Wolfgang die alleinige Leitung der Festspiele, die er bis zu seinem Abschied am Ende der Festspiele 2008 über 50 Jahre innehatte. Es war Wolfgang Wagner, der die Festspiele für neue Regisseure und neue Gedanken öffnete, ohne dabei auf eigene Inszenierungen zu verzichten. An diesem enzyklopädischen Standardwerk über die Geschichte der Bayreuther Festspiele, über das große Schaffen Richard Wagners, über 150 Jahre deutscher Theatergeschichte, Politik, Kultur und gesellschaftlichen Diskurs kommt kein Wagnerianer vorbei. Für den Liebhaber ist es ein Muss, für den Neugierigen eine aufregende Entdeckungsreise in die große Welt Richard Wagners. ah Berichte Weibes Wonne und Wert – Richard Wagners Theorie-Theater W as Jochen Hörisch und Klaus Arp mit ihrem streitbaren Buch leisten, ist gar nicht theoretisch-trocken. „Weibes Wonne und Wert”, Zitat aus der schwarzen Komödie „Rheingold“ (Loge!) provoziert als Buchtitel und läuft durch fast alle zwölf Kapitel. Diese, Leitmotive genannt, werden von jeweils einem meist kürzeren Kommentar abgerundet. Im Anhang sind insgesamt 90 teils längere Notenbeispiele aufgeführt. Hörisch und Arp beleuchten theoretische und praktische Kernprobleme von Wagners Werk in allen denkbaren Facetten. Ein tief auslotendes Buch mit hohem Erkenntnisgewinn und höchstem Lesevergnügen! Die Autoren erkunden die Brief-, Buch- und Operntexte Wagners. Er war ein genialer, beziehungsreicher Formulierer, wo es ihm darauf ankam. Behauptungen über einen Dilettantismus Wagnerscher Sprache bzw. seiner Operntexte werden faktisch ad absurdum geführt. Man muss nur lesen und Vorurteile ignorieren können. Wagners Musikdramen – immer auch große Erkenntnisdramen, deren Kerneinsichten bis heute aktuell sind. Erstaunlich auch die Komplexität der vielen Querverbindungen zur europäischen Kultur- und Geistesgeschichte, die Hörisch und Arp belegen: Shakespeare, Goethe und Thomas Mann, aber auch zahlreiche Autoren der „zweiten Reihe”. Erotik spielt eine dominante Rolle. Nie vor Wagner wurde im Musikalischen derart diffizil, direkt und überwältigend über Weibes Wonne und Wert diskutiert und musiziert. Die Person Richard Wagner wird von den Autoren durchaus kritisch gesehen, besonders sein (auch zeitbedingtes) Verhältnis zum Judentum, sein Hang zum Luxus bei fehlenden Mitteln. Aber ein geniales Multitalent ohne Irrtümer? Kritikpunkte am Buch? Eventuell die zahllosen Fußnoten, die ein flüssiges Lesen erschweren. Frühwerke Wagners vor „Rienzi“ werden ausgeblendet und ebenfalls die prominente ostdeutsche Wagner-Pflege (Herz´ „Ring“ Ostern 1976 in Leipzig). Trotzdem ist das Buch uneingeschränkt zu empfehlen, es entfacht Lust auf Richard Wagners Opern! eb Jochen Hörisch: Weibes Wonne und Wert – Richard Wagners Theorie-Theater. Mit musikanalytischen Erläuterungen von Klaus Arp, Die andere Bibliothek Berlin 2015, 501 S., ISBN 978-3-8477-0366-2, 42,00 Euro Lieblingsplätze und 100 Gründe, stolz auf Leipzig zu sein S ie häufen sich wieder, die Liebeserklärungen an eine der schönsten, wunderbarsten und mit einer einzigartigen Historie und kulturellen Vielfalt ausgestatteten Städte Deutschlands, Sachsens Metropole Leipzig. „Mein Leipzig lob‘ ich mir …“, wusste schon Goethe als leichtlebiger Studiosus die Stadt zu preisen. Und deren Reiz bemerkt man vor allem bei unabhängigen Publikationen, gemacht von einheimischen Kennern, die nicht nur Fakten, sondern auch Lebensgefühl vermitteln können. Rüschord Wachnor“. Guter informativer Text, seriöses Fotomotiv und – wo hat es das schon einmal gegeben, ein Verweis auf Existenz, Geschichte und Inhalte des seit 1909 existierenden Richard-WagnerVerbandes. Geschichte unterhaltsam, leicht und objektiv vermittelt (14,90 Euro). Bereits im Herbst 2016 erschien im Wartberg-Verlag das Buch von Rainer Küster und Maritta Angotti „Leipzig – einfach Spitze! 100 Gründe, stolz auf diese Stadt zu sein“. Unter Rubriken wie Spritzig, (Preis) Verdächtig, Einfach märchenhaft oder Kleckern und Klotzen findet man das Große und das Kleine, vor allem aber das MerkWürdige, ohne all das ein Stadtbild und -gefühl nicht komplett wäre. Für WagnerFreunde interessant unter Echt sächsisch der Beitrag „Ein waschechter Sachse – Gar nicht objektiv, und das aber gewollt, sind die „Lieblingsplätze zum Entdecken“ von Marlis (Text) und Volkmar Heinz (Fotos), erschienen bei Gmeiner. Die beiden Vollblutjournalisten zeigen und beschreiben ihre Lieblingsplätze, die nicht immer an den Trampelpfaden der Alltagszivilisation liegen müssen. Man erfährt, was Leipzig wirklich ausmacht, Fakten und Hintergründe, die so nur auffädelt, wer diese Richard ist Leipziger … Anzeige Journal 1/2017 Stadt wirklich lebt und liebt. Gegliedert nach Himmelsrichtungen und auf Stadtplanausschnitten gut durchnummeriert, geht es mal nach ganz oben (Uni-Riese) oder ganz unten (Moritzbastei). Auch die unbedingt nicht zu verpassenden Nahziele, wie Altenburg, Machern, Merseburg (!) und Torgau, die zu Leipzigs Entwicklungsgeschichte beitrugen, sind ein Gewinn. Und natürlich die Fakten und Orte zu Richard Wagner. Besonders wertvoll: Bei der Betonung des überaus satten Stadtgrüns bekommt man eine sachliche Erklärung des Richard-Wagner-Hains, ideologiefrei. Also doch ganz viel Objektivität (14,99 Euro). Beide Bücher sind für Einheimische wie Besucher absolut empfehlenswert . tk „Das Rheingold“ in der Musikhochschule I n einer von Prof. Matthias Oldag erarbeiteten Studiofassung des „Rheingold“ von Richard Wagner für zwei Klaviere hatten die besten Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs „Operngesang“ die Möglichkeit, neue Erfahrungen der Opernpraxis zu sammeln und die Erfolge ihres künstlerischen Reifeprozesses zu demonstrieren. Und dies taten sie mit sichtlichem Vergnügen am 27., 28., 29. und 30. Januar 2017 im Großen Probensaal, der „Black Box” der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy” am Dittrichring 21. Reduziert auf das Wesentliche, eine knappe, fast krimihafte Handlung in reichlich 90 Minuten, erlebten die Zuschauer im vollbesetzten Saal spannendes Musiktheater mit durchaus aktuellem Bezug. Nach der Einspielung des Vorspiels vom Band ersetzten zwei Flügel am Rande der Spielfläche das Orchester. Das Rheingold strahlte aus der Vertiefung des Rheins auf der Bühne. Ansonsten bedurfte es keiner weiterer Kulissen, zumal die Akteure nicht nur die Bühne, sondern zeitweise den ganzen Raum bespielten. Bewundernswert und begeisternd das Kultinszenierungen O per im Kino? Die Inszenierungen der MET in New York haben auch in Leipzig eine große Fangemeinde, und Aufführungen von Wagner-Opern sind immer besonders gut besucht. Inzwischen hat die Oper London nachgezogen und bietet ebenfalls Übertragungen an. Auch das Wagner-Repertoire der Oper Leipzig kann sich nunmehr sehen lassen und wird in der nächsten Spielzeit durch einen „Tannhäuser“ ergänzt. Warum also eine weitere Veranstaltung? Die Idee ist, einerseits Opern zu zeigen, die aktuell nicht in Leipzig auf dem Programm stehen, und zum anderen Inszenierungen, die das Prädikat „Kult“ verdienen. Diese Inszenierungen gemeinsam auf der großen Leinwand genießen zu können, stellt noch einmal einen Mehrwert dar. Zudem ist es natürlich immer hohe Engagement und die Leidenschaft der jungen Sängerdarsteller, die – höchst ambitioniert – manchmal physisch wohl bis an ihre Grenzen gehend, für ein turbulentes und intensives Bühnengeschehen sorgten. Eine besondere Freude war es, unter den jungen Künstlern zwei unserer Bayreuth-Stipendiaten 2016 zu erleben: Anika Paulick als Freia und Ricardo Llamas Marquez als Alberich, die hier nochmals bewiesen, ihre Stipendien zu Recht verdient zu haben. Ebenso dabei waren bereits neue Stipendiaten, die im August dieses Jahres Bayreuth besuchen werden: Philipp Jekal als Wotan sowie Nele Kovalenkaite als Floßhilde. Am Ende jubelnder Beifall für alle Beteiligten. Und für unsere Verbandsmitglieder die Empfehlung, sich auch einmal von einer der nächsten Studioinszenierungen begeistern zu lassen. ca Engagement und Leidenschaft Stipendiaten Philipp Jekal als Wotan, Anika Paulick als Freia auch die Intention des Wagner-Verbandes, Zuschauer, die den Weg in die „richtige“ Oper nicht finden, über ein solches Format anzusprechen. So fanden sich am Sonntagnachmittag des 13. Novembers 2016 in den Passage Kinos etwa 50 Zuschauer ein, um die Oper „Tannhäuser“ zu genießen. Ausgewählt hatten wir eine Aufnahme von 2008 aus dem Festspielhaus Baden-Baden. Regie führte Nikolaus Lehnhoff, der im Laufe der Jahre in Baden-Baden einige Wagner-Opern beeindruckend in Szene setzte. Eine helixartige Wendeltreppe wurde über die drei Akte durch Umbauten und Lichteffekte zu einem suggestiven Bild. Solche ästhetischen Lösungen lassen den Wunsch nach altbewährten Konzepten verblassen. Die Qualität der Sänger stand bei dieser Aufführung im Vordergrund – Waltraud Meier als Venus ist hier mit 52 Jahren immer noch auf der Höhe ihres Könnens zu erleben. Der junge Philippe Jordan überzeugte am Pult. Alles gute Gründe, diese Aufnahme als Kultinszenierung zu präsentieren. Die Reaktionen der Zuschauer bestätigten das. Der Kauf der Blu-ray oder DVD kann uneingeschränkt empfohlen werden. sl Seiten 8 / 9 Bayreuth-Stipendiaten RICHARD WAGNER SPIELE 2017 Open-Air-Theater mit Dresdner Schauspielern, Sängern und der Nordböhmischen Philharmonie Teplice EIN STÜCK VOM HIMMEL ODER WENN ICH ERST EWIG BIN rd-wagner-sp a h iel ric . e w DI O Ei ne e .d ww von Johannes Gärtner A Pro ERC dukti C n on vo Foto: Matthias Creutziger Richard-Wagner-Stätten Graupa | 1., 2. und 7. Juli, 20 Uhr Schloss Děčín | 8. und 14. Juli, 20 Uhr WAGNER SALON jeweils vor den Veranstaltungen Man wird nicht zufällig in der Villa Wahnfried geboren Zum 100. Geburtstag von Wieland Wagner am 5. Januar 2017 U nter dem Motto „Man wird nicht zufällig in der Villa Wahnfried geboren“, machte Eberhard Pöhner am 18. Januar, dem ersten Vortragsabend des Jahres 2017 in der Leipziger Stadtbibliothek, die ganze Ambivalenz des Künstlerlebens von Wieland Wagner deutlich. Es war ein gelungener Auftakt der traditionellen Vortrags- und Gesprächsreihe des RichardWagner-Verbandes Leipzig, musikalisch begleitet von Schülern der Musikschule „Johann Sebastian Bach“, die sich mit ihrem anspruchsvollen kleinen Programm an keine Geringeren als ­Niccolò Paganini, Astor Piazolla und Francisco Tárrega heran­ wagten. Leitung der Bayreuther Festspiele übernahm. Mit Geistesgrößen wie Theodor W. Adorno, Ernst Bloch oder Hans Mayer stand der gefeierte Opernregisseur Wieland Wagner in regem geistigen Austausch. Als Opernregisseur war Wieland Wagner innovativ, scheute Brüche mit Bayreuther Traditionen ebenso wenig wie bewusste Provokation. Sein Bayreuther Inszenierungsstil wurde bis in die 1970er Jahre hinein vielfach kopiertes Modell für Inszenierungen vieler Opernregisseure. Nach seinem frühen Tod 1966 wurden rekonstruierte Inszenierungen von Wieland Wagner in der Metropolitan Opera New York, der San Francisco Opera, dem Sydney Opera House und im japanischen Osaka gezeigt. Eberhard Pöhner, trotz Und so wollte Eberhard Pöhner klirrender Kälte angereist an diesem Abend seinem aus Mering, hätte wohl kaum aufmerksamen Publikum die Glückwünsche zum 60. Geburtstag von Eberhard Pöhners Vater 1961 geeigneter sein können für Einsicht vermitteln, „dass man Konrad Pöhner, Wieland Wagner diesen Abend, war doch sein Wieland Wagner und seiner Leben über viele Jahre eng Geschichte, seiner zutiefst huverbunden mit der Familie Wagner und ­Wurzeln zusammen? Nike Wagner, Wiemanitären Gesinnung wie seiner LebensWieland für den früh vaterlosen Eberhard lands Tochter, beschreibt ihren Vater in leistung einfach nicht gerecht werde, wenn ein väterlicher Freund. (Konrad Pöhner, seinen jungen Jahren als „unpolitischen, man ihn auf seine Haltung im Nationalsein Vater, war von 1964 bis 1970 Finanzmi- introvertierten Kunstmaler“, fasziniert sozialismus reduziere“. Über seine Arbeit nister des Freistaates Bayern.) Und so ging vom Theater der Antike. Der Bühnenbildhabe sich Wieland Wagner „aus seiner entes dem Psychoanalytiker Eberhard Pöhner ner Wieland Wagner aber konnte sich die setzlichen inneren Lage halbwegs befreit“. vor allem um den Menschen Wieland WagSzenerie einer „Meistersinger“-Aufführung ner (1917–1966), den erstgeborenen Sohn im Dritten Reich nicht ohne SS-Standarte Dazwischen lagen persönliche Erlebvon Winifred und Siegfried Wagner. Wie und Fahne der Hitlerjugend vorstellen. nisse aus einer mehrmonatigen Tätigkeit konnte dieser den „ungeheuren Spannungs- Doch zu den „schwer begreiflichen MerkWieland Wagners im KZ-Außenlager bogen bewältigen zwischen einer Welt, die würdigkeiten oder Widersprüchlichkeiten Bayreuth, wo viele Häftlinge aus dem KZ von Adolf Hitler, seiner Mutter Winifred dieser Zeit“, wie Eberhard Pöhner erzählt, Flossenbürg zur Zwangsarbeit eingesetzt und einer Cosima Wagner geprägt war, aber gehört eben auch, dass die Pöhners mit waren. Beginn eines Umdenkens? Wieland auch von einer ganz anderen, durchaus ihren jüdischen Wurzeln und die Wagners Wagner, so Eberhard Pöhner, habe sich nie freien Kunstwelt wie der eines Malers und nicht nur beruflich, sondern auch privat öffentlich dazu geäußert. wk Bühnenbildners Werner Gilles, Mitglied eng miteinander verbunden waren und des Weimarer Bauhauses und Stipendiat Winifred Wagner den späteren Schwager der Villa Massimo in Rom, dessen Werk im Wielands vor der Deportation rettete. Nach Dritten Reich als ,entartetet‘ verfemt war?“ dem Ende des Zweiten Weltkriegs wiedeBilder jenes Werner Gilles inspirierten Wie- rum war es sein „innerstes Anliegen, dass land Wagner 1962 bei der Vorbereitung für Wagners Bayreuth wie ein Phönix aus der Richard Wagners „Tristan und Isolde“. Und braunen Trümmer- und Menschenasche wie passen eigentlich der Antisemitismus auffliegen möge“, so Nike Wagner über den Den Menschen Wieland im Hause Wagner und die Freundschaft Bayreuther Neubeginn 1951, dem Jahr, in Wagner im Blick zur Familie Pöhner mit ihren jüdischen dem Wieland Wagner die künstlerische Eberhard Pöhner Seiten 10 / 11 Berichte Regietheater: Fluch oder Segen? U nter diesem Motto stand die Podiumsdiskussion, zu der der RichardWagner-Verband Leipzig am 15. März 2017 in die Stadtbibliothek geladen hatte. Im Podium: Sängerin und Hochschullehrerin Prof. Marie-Louise Gilles, Regisseur Michael Heinicke, der Kulturjournalist und passionierte Operngänger Rolf Richter, eingesprungen für den erkrankten Werner P. Seiferth, und Moderator Dieter David Scholz. Der Saal war mit etwa 80 Personen gut gefüllt. Zum Zitat des Altmeisters Joachim Herz, das Seiferth in die Runde geschickt hatte, gab es allgemeine Zustimmung: „Musiktheater versucht, das Geschehen auf der Bühne so zu gestalten, dass aus ihm organisch und mit Notwendigkeit die Musik erwächst, die der Komponist dafür komponiert hat. Somit ist Musiktheater das Gegenteil von Regietheater, wo die Ideen des Regisseurs dem Stoff der Vorlage neue Aspekte abgewinnen.“ Anfänglich schien es, als stimmten Podium und Zuhörerschaft darin überein, dass das Regietheater mehr Fluch, denn Segen sei! Michael Heinicke indes mit seiner langjährigen Regiepraxis wehrte sich dagegen, mit der Verteufelung des Begriffs Regietheater seinen Berufsstand zu diffamieren, denn jedes Stück brauche natürlich einen Regisseur. Doch wenn dieser „sein Inneres nach außen kehren“ wolle, habe das nichts mit Kunst zu tun, sondern sei Unsinn. Prof. Gilles forderte dazu auf, sich zu wehren gegen einen Missbrauch der Oper für aktuelle Tagesfragen. Die Oper als Zaubertheater, in der große Gefühle und archaische Probleme verhandelt werden, funktioniert für Rolf Richter heute oft nicht mehr, gefeiert werde alles, egal, ob gut oder schlecht. Seine Konsequenz? Wegbleiben! Das tut auch Werner P. Seiferth, nachdem für ihn gerade in Leipzig von zur Mühlens „Fliegender Kontroverse Sichtweisen im Podium Prof. MarieLouise Gilles, Dieter David Scholz, Michael Heinicke, Rolf Richter Holländer“, Konwitschnys Hamburger „Lohengrin“ oder Biganzolis „Meistersinger“ „Oper zum Abgewöhnen“ boten. Doch es gab auch positive Stimmen aus dem Publikum zu Modernisierungen und behutsamen Aktualisierungen von Opernaufführungen, denn „wenn man immer das Gleiche zu sehen bekommt, geht ja keiner mehr hin.“ Einig war man sich jedoch, dass Richard Wagner mit seinem „Kinder, schafft Neues“ vor allem eins gemeint hat: Schreibt Euch gefälligst selbst neue Stücke (und verhunzt nicht meine!). wk Richard Wagners „Das Judenthum in der Musik“ kritisch hinterfragt D er Richard-Wagner-Verband Leipzig hatte im Rahmen der Leipziger Buchmesse – gemeinsam mit dem Sax-Verlag – am 23. März 2017 zur Vorstellung von Dr. Frank Pionteks Buch, Band 6 der „­L eipziger Beiträge zur Wagner-Forschung“, in den Festsaal des Alten Rathauses geladen. Der Autor aus Bayreuth, Herausgeber Thomas Krakow und Moderator Rolf Richter bestritten den Abend. Pionteks wichtigstes Anliegen: den „schwierigen Fall“ Richard Wagner sozialhistorisch, musikgeschichtlich und psychologisch nachvollziehbar zu machen. Richard Wagners Traktat „Das Juden­ thum in der Musik“, den er 1850 in der Schweiz verfasste und unter Pseudonym veröffentlichte, blieb damals ohne großes Echo. Gerade einmal drei Rezensionen sind nachweisbar. Über 100 waren es, als Wagner die verschärfte Schrift 1869 ein zweites Mal publizierte. Franz Liszt beispielsweise war entsetzt. Weshalb Richard ist Leipziger … beging Wagner „künstlerischen Vatermord“ an seinem Gönner und Unterstützer der Pariser Jahre, Giacomo Meyerbeer? Mendelssohn gar sprach er aufgrund seiner „Rasse“ ab, ein guter Musiker zu sein! Woher nahm Wagner seinen wachsenden Antijudaismus und Antisemitismus? Diese Seite seines Werkes bestimmt allzuoft das Gesamtbild, das gegenwärtig von Richard Wagner vorherrscht. Was Pionteks Arbeit für die „Leipziger Beiträge“ darüber hinaus motiviert: Wagners Schrift ist, wenngleich in der Schweiz geschrieben, auch ein Leipziger Produkt. Alle Drucke liefen über die Leipziger Maschinen. Viele Personen, die mit dem Text und seiner Vor- und Wirkungsgeschichte zusammenhängen, waren auf ihre Weise Leipziger oder mit der Stadt verbunden, allen voran Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy, gefolgt von Dichtern, Publizisten, Musikprofessoren und Verlegern, die am Rande des „Juden­ Journal 1/2017 Diskurs über den „schwierigen Fall“ Wagner Thomas Krakow, Frank Piontek, Rolf Richter thums in der Musik“ und in der Wagnerschen Lebens- und Werkgeschichte eine Rolle spielten. Das Credo von Frank Pionteks kritischem, überaus lesbarem Buch: weder Wagner „reinzuwaschen“, noch ihn zu verteufeln, sondern beides auszuhalten, „die Gewalt der Musik und die Gewalttätigkeit der Ideologie“ (Jens Malte Fischer), weil das Eine ohne das Andere nicht zu haben sei. Oder um es mit Leonard Bernstein zu sagen: „Ich hasse Wagner, aber ich hasse ihn auf Knien!“ wk Frank Piontek: Richard Wagners „Das Judenthum in der Musik“. Text, Kommentar und Wirkungsgeschichte, Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung 6, hrsg. vom Richard-Wagner-Verband Leipzig, Sax-Verlag Markkleeberg 2017, 178 S., ISBN 978-3-86729-190-3, 16,80 Euro Erhältlich in der Geschäftsstelle des Richard-Wagner-Verbandes. Stiftungsbrief Richard Wagner, Leipzig und die ­Musikautomaten Gemeinsam mit dem Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig hat die Richard-Wagner-Siftung Leipzig eine Musik-CD mit Werken Richard Wagners auf selbstspielenden Instrumenten erstellt und beim Label Querstand der Kamprad-Verlagsgruppe Altenburg veröffentlicht. Mit Nachdruck initiiert wurde diese Idee von Dr. Eckhard Budde aus Kühlungsborn, Mitglied im Richard-Wagner-Verband Leipzig, der mit anderen begeisterten Verbandsmitgliedern vor nicht langer Zeit die herausragende Ausstellung zur Leipziger Musikautomatenproduktion von Kuratorin Dr. Birgit Heise präsentiert bekam. Er reiste extra zur Vorstellung am 9. März 2017 an, die auch etliche Mitglieder des Wagner-Verbandes und des Förderkreises des Museums für Musikinstrumente besuchten. Museumsdirektor Prof. Dr. Josef Focht, Thomas Krakow als Vorstandsvorsitzender der RichardWagner-Stiftung Leipzig und Verlagsgeschäftsführer Klaus-Jürgen Kamprad führten in das Projekt ein. Inhaltlich stellten Dr. Birgit Heise und Kim Grote, die leidenschaftlich wie plastisch von der Einmaligkeit des Projekts zu überzeugen wussten und die Texte des Booklets verfasst hatten, die CD dem Publikum und der Presse vor. Man musste sich dabei immer vergegenwärtigen, dass in der Hochzeit der Produktionsphase zwischen 1880 und 1930 diese Automatenindustrie in Leipzig zum zweitgrößten Arbeitgeber wurde. Richard Wagners Werke wurden so verbreitet, dass sie zum musikalischen Allgemeingut, manche Melodien zu „Gassenhauern“ wurden. Zur Untermalung wurde in der authentischen Umgebung diese Musik an Originalinstrumenten zu Gehör gebracht. Verleger Kamprad lud im Anschluss zu einem Empfang, der kommunikativ genutzt wurde. Finanziert wurde die CD von der Richard-Wagner-Stiftung Leipzig, dem Förderkreis des Museums für Musikinstrumente Ein Leipziger baut das Festspielhaus in Bayreuth Nicht nur Richard, auch Otto ist Leipziger. Die Rede ist von Otto Brückwald, der nur deshalb im Gedächtnis zumindest weniger Wagner-Freunde blieb, weil er das Festspielhaus entwarf. Grund genug für die herausgebende Richard-Wagner-Stiftung, zusammen mit dem Autor und dem Verleger der neuen, übrigens auch ersten – umfangreichen wie reich bebilderten – Biografie des Architekten auf der Leipziger Buchmesse aufzutreten. Am 23. März 2017 trafen sich also Thomas Strobel, der Verleger Klaus-Jürgen Kamprad, Thomas Krakow und Johann-Michael Möller (der ehemalige Hörfunkdirektor des MDR) im Musikcafé, um in einer konzentrierten halben Stunde über Brückwald und sein Werk zu sprechen. Für ihn sei das, sagt Kamprad, eine Ehrensache, denn als in Altenburg sitzender Verleger sei es naheliegend, ein Buch über den Altenburger Baumeister zu machen, der den Wagnerianern, wie Krakow Biografie über Brückwald vorgestellt Klaus-Jürgen Kamprad, Michael Möller, Thomas ­Strobel, Thomas Krakow bekennt, nicht als einer der wichtigen Architekten des 19. Jahrhunderts bekannt sein dürfte. Möller charakterisierte diesen fast vergessenen Architekten als einen Mann, „der für Leipzig und weit darüber hinaus eine große Bedeutung hatte“, ja: er gehöre in die Liga der Schinkels, Sempers und Klenzes. Spiritus rector Dr. Birgit Heise und durch zwei erhebliche Einzelspenden von Dr. Birgit Heise und Thomas Krakow. Aber auch anderen Partnern ist zu danken, wie man im liebevoll gestalteten Booklet lesen kann. Die CD ist über die Geschäftsstelle des RichardWagner-Verbandes Leipzig zu beziehen. Sie wird außerdem am 12. August, 11 Uhr zu den diesjährigen Bayreuther Festspielen im Kammermusiksaal der Klavierbaufirma Steingraeber & Söhne präsentiert. tk gesehen hat, bevor er Bayreuth entwarf. Brückwald brachte als Schüler von Carl Ferdinand Langhans viel mit: er besaß, basierend auf der grundlegenden Schalltheorie seines Lehrers, die nötige wissenschaftlich-technische Kompetenz, um das einzigartige Festspielhaus zu erfinden. In Leipzig ist das Neue Theater am Augustusplatz 1943 zerstört worden, doch besitzen wir noch den Bau der heutigen Volkshochschule in der Löhrstraße (wo der Wagner-Verband einmal seine Vorträge veranstaltete), das Haus der Edition Peters Talstraße 10 (mit der Grieg-Gedenkstätte) und einige Wohn- und Geschäftshäuser. „Dies Buch ist vielleicht der Anfang einer Wiedergutmachung“, sagt Möller am Schluss. Schön, wenn es so wäre. fp Thomas Strobel: Otto Brückwald – Ein vergessener Künstler und Architekt, auf Initiative des RichardWagner-Verbandes Leipzig hrsg. von der RichardWagner-Stiftung Leipzig in Zusammenarbeit mit der Leipzig Stiftung, E. Reinhold Verlag Altenburg, ISBN 978-3-95755-031-6, 49,80 Euro. Brückwalds Bayreuther Werk ist auch deshalb bemerkenswert, weil er nicht, wie traditionell angenommen, die Pläne Gottfried Sempers ein- Seiten 12 / 13 Stiftungsbrief © Bild: Wartburg-Stiftung Richard Wagners Musik auf selbstspielenden Instrumenten CD-NEUERSCHEINUNG … da hörte ich MEINEN Tannhäuser auf einem LEIERKASTEN PRÄSENTATION bei den Bayreuther Festspielen: 12. AUGUST 2017, 11 UHR, Steingraeber & Söhne Zu beziehen in der Geschäftsstelle des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig www.wagner-verband-leipzig.de Richard Wagner, Leipzig und Musik sind schon immer untrennbar miteinander verbunden, wovon Leipzig auch wirtschaftlich profitierte. Zwischen 1880 und 1930 boomte hier die Produktion selbstspielender Instrumente und Musikautomaten, war zeitweise der zweitgrößte Arbeitgeber. Und der vielgespielte Richard Wagner wurde zum musikalischen Allgemeingut. Das zweitgrößte Musikinstrumentenmuseum Europas hat diese Schätze bewahrt und macht sie nun mit der Richard-Wagner-Stiftung Leipzig zugänglich: Tannhäuser, Lohengrin, Rienzi, Parsifal, das Siegfried-Idyll, Die Walküre und Die Meistersinger von Nürnberg. In Kooperation mit querstand – dem Klassiklabel der Verlagsgruppe Kamprad www.richard-wagner-stiftung-leipzig.de · mfm.uni-leipzig.de Herrmann Häse macht ernst im Liebethaler Grund A m 11. März 2017 gaben der Tourismusverband Sächsische Schweiz, die Gemeinde Lohmen sowie der Investor Hermann Häse den bislang gesperrten Teil des Malerweges Elbsandsteingebirge an der Lochmühle in Lohmen wieder frei und zugleich den Startschuss für das an diesem Standort geplante ­Hotelprojekt. Besucheransturm Bürger, Künstler, Politiker Visionär Herrmann Häse, Projekt Lochmühle Im wildromantischen Liebethaler Grund und im Gasthof Lochmühle erhielt Richard Wagner 1846 die Inspiration zum „­L ohengrin“. „Das ist eine gute Nachricht für den Tourismus in der Region“, sagt Klaus Brähmig MdB, Vorsitzender des Tourismusverbandes. „Ich freue mich sehr, dass die Lochmühle nach 25 Jahren aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt wird, und wünsche dem Vorhaben gutes Gelingen. Unser Verband unterstützt Herrmann Häses Idee der Walhall-Lochmühle seit Jahren.“ „Alles, was der Wiederbelebung dieses historischen Wagner-Ortes in Zuverlässige Partner E in gemeinnütziger Verein wie unserer, in dem die Arbeit weitestgehend ehrenamtlich geleistet wird, ist mehr denn je auf Zuverlässigkeit angewiesen. Denn sobald ein Glied in der Kette aussteigt, und das machen auch Ehrenamtler zuweilen, erhöht sich der Druck auf die anderen umso mehr. Gut, dass man dann Partner um sich weiß, die zuverlässig ihre Zusagen einhalten und Verständnis für die Probleme und Besonderheiten des Anderen haben. So ein uns unterstützendes Unternehmen ist die Firma Urban & Urban Werbeunternehmen. Vor zwölf Jahren traf ich Ralf Urban erstmals, da wir beide Mitglieder der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft zur Förderung des Stadtgeschichtlichen Museums sind. In dem Jahr hatte sein Unternehmen Sachsen nutzt, ist zu begrüßen“, so Thomas Krakow für den Richard-Wagner-Verband Leipzig. Der Dresdner Unternehmer Hermann Häse will ein ambitioniertes Hotelprojekt an diesem Standort realisieren. Das historische Gebäude, das seit 1990 leer stand und verfiel, wurde bereits gesichert. Ewa 250 Menschen, darunter Dresdner Wagnerianer, Künstler und Prominente aus Politik, Kirche und Gesellschaft, wie der Kabarettist Tom Pauls, hatten sich zu diesem Anlass unterhalb des mit 12,50 Metern weltweit größten Denkmals für Richard Wagner eingefunden. tk im Neubau Böttchergäßchen die Sonderausstellung „Wagners Heimkehr“ als Ausstellungsbauer betreut. Selbst das von Ursula Oehme in das Museum eingeladene Bayreuther Festspielleiterehepaar Wolfgang und Gudrun Wagner war begeistert von Inhalt, Form und solider baulicher und gestalterischer Umsetzung. Ralf Urban und ich hatten ein Gesprächsthema, das sich längst auf den im Unternehmen Mitverantwortung tragenden Sohn Hendrik Unternehmer mit Herz Hendrik Urban, Ralf Urban Urban übertragen hat. Große Ausstellungen zur TerrakottaWerbeprofis. Man stelle sich einfach nur Armee oder dem Inka-Gold standen für die vor die Fassade unseres Richard-WagnerLeistungsfähigkeit der Firma, aber auch Ladens in der Nikolaistraße 42. Im Namen die Beklebung des Veolia-Notenspurzuges des ganzen Verbandes sage ich an dieser 2012, dessen Tradition als einziger VeranStelle danke für zehn Jahre zuverlässtalter unser Verband bis heute fortsetzt. sige Unterstützung, oftmals nur für die Auch bei der Ausgestaltung des Foyers der berühmte Spendenquittung … ! Die Firma Richard-Wagner-Aula in der Alten Nikolaisetzt fort, was einmal die Bürgerstadt schule traf ich Ralf Urban wieder. Überall ­L eipzig auszeichnete. tk in unserer Stadt und darüber hinaus findet www.urban-urban.com man Spuren dieser Ausstellungsbauer und Seiten 14 / 15 Vermischtes Keine Richard- Wagner-Schule in Leipzig? W agner und Schule, was für ein schwieriges Verhältnis. Mit Richard hat es angefangen: Schon an Dresdens Kreuzschule ist er aufgefallen, 1828 wieder in Leipzig, wurde er an der Nikolaischule sogar zurückversetzt. Was für eine Ehrverletzung! Da tröstete ihn sicherlich die Einschätzung seines Onkels Adolph, die Schule pflege ja nur ihren „Pedantismus“, also ihre trockene und lebensfremde Kleingeistigkeit. So wurde es nichts mit Richards Abitur an der Nikolaischule, an der Thomasschule aber auch nicht. Er sei „… in jeder Hinsicht ein Schwächling“, so der Direktor. Bei Wagner verfing das aber nicht, wir wissen heute alle, was aus diesem „Schwächling“ geworden ist. Und alle seine Werke verfolgen auch pädagogische Absichten! Was ist der lieblose Mensch getrieben im „Holländer“! Was ist Sex wert, wenn ihm die wirkliche, echte Liebe fehlt im „Tannhäuser“. Wir Menschen brauchen Vertrauen wie Lohengrin. Ein Weltengeschehen aus Machtgerangel, Lug und Trug, angetrieben vom Geld, muss in den Untergang führen, sagt der „Ring“. Ihr jungen Leute, verachtet in eurer Modernität die alten Meister nicht – singen die Meistersinger. Über allem stehe die Liebe, seid aus Mitleid wissend, menschlich, meinen „Tristan“ und „Parsifal“… Pädagogischer und aktueller geht es nicht! Das hatte auch die Stadt Leipzig einst so gesehen, bis zum großen Schulsterben der Jahrtausendwende gab es eine RIWA. Nun, bei wieder steigenden Schülerzahlen und mit neuen Schulen, wäre wieder an eine RIWA zu denken. Aber falsch gedacht. Das Verhältnis Wagner und Schule bleibt weiter schwierig. Fremdelte einst Wagner mit der Schule, tut dies nun die Schule mit Wagner. Denn seit 1968 ist er ins Rampenlicht geraten. Und wen ich beleuchte, wirft Schatten. Allein um den geht es unserem Zeitgeist – auch wenn der irrt. Was besonders unser Vorstandsmitglied Christa Asperger zu spüren bekam, die sich intensiv um eine neue RIWA be- Wagner nicht favorisiert Neues Gymnasium in der Telemannstraße mühte. Zuletzt saßen wir, ich dabei, vor einem Gremium des neuen Gymnasiums in der Telemannstraße, um für Wagner ein Wort einzulegen. Eine mehrseitige Entscheidungshilfe war von uns ausgeteilt worden, wir bekamen Raum für erläuternde Worte und gingen. In der Zeitung war später zu lesen, dass die Schule Wagner nicht favorisiere, die „Gesamtpersönlichkeit“ müsse passen. Gesamtpersönlichkeit? Oder doch nur jener zeitgeistbestimmte Aspekt? Sein Onkel Adolph würde sagen: „Da hast du ihn wieder, den Pedantismus der Schule.“ ho Ein erfolgreiches Jahr 2016 A m 22. Februar 2017 fand die Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung unseres Verbandes im Ratskeller statt, an der 92 Mitglieder teilnahmen. Vorsitzender Thomas Krakow resümierte im Bericht des Vorstands ein erfolgreiches Jahr vor allem in der Entwicklung der Mitgliederzahl und der überregionalen Ausstrahlung der eigenen Aktivitäten, was auch Schatzmeister Stefan Lochner im Kassenbericht untermauerte. Die Kassenprüferinnen Barbara Thrul und Hannelore Müller bestätigten dem Vorstand ein gutes Wirtschaften. Beide Berichte wurden durch die Mitgliederversammlung angenommen und sowohl der Vorstand als auch die Kassenprüfer entlastet. Ehrenmitglied Sigrid Kehl wie auch Verbandsmitglied Herrmann Häse dankten dem Vorstand ausdrücklich für den Umfang und die inhaltliche Tiefe der Arbeit und des Programms. Dem Antrag des Vorstands zu den zeitgemäßen Änderun- Richard ist Leipziger … gen in der Satzung wurde nach kurzer intensiver Diskussion mit überwiegender Mehrheit Dank für geleistete Arbeit Vorstandsmitglieder, Josef Hauer (r.) zugestimmt. Die Versammlung war bei einer Ablehnung und zwei Enthaltunzuverlässigen Helfer Mario Todte, der im gen der Meinung, die beiden vorliegenden Rahmen des Jahresberichts ausgesproAnträge zur Beitragsordnung auf einen wei- chen wurde, dankten einige Mitglieder im teren Antrag hin zu verschmelzen und so Namen aller dem Vorstand für die geleistete eine neue und sinnvolle Beitragsordnung zu Arbeit mit Blumen und Präsenten. Die Vorbeschließen. Erstmals seit 24 Jahren werstandsmitglieder waren gerührt. In seinem den damit die Mitgliedsbeiträge verändert Ausblick auf das kommende Jahr setzte und um eine Zielgruppe ergänzt sowie den Vorsitzender Krakow unterschiedliche Akwirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst. zente, verwies aber explizit auf die im Jahre Etliche Mitglieder hatten bereits im Vorfeld 2018 anstehenden Vorstandswahlen. Dabei wegen nicht möglicher Teilnahme dem Vorermutigte er die Mitglieder eindringlich, zu stand ihre Voten mitgeteilt, die bis auf eine überlegen, wie sie sich in die VorstandsarAusnahme damit konform gingen. Neben beit einbringen können. tk dem Dank des Vorstands an Geschäftsstellenmitarbeiter Josef Hauer und den immer Journal 1/2017 Verschiedenes Veranstaltungen Mi 19.04.2017,19:00 Uhr Stadtbibliothek Leipzig, Veranstaltungs­ raum „Huldreich Groß“ 4. OG, ­Wilhelm-Leuschner-Platz 10, 04107 Leipzig Liebesverbot! Sex und Antisex in Wagners Dramen Vortrag und Gespräch mit Henrik N ­ ebelong, Kopenhagen Mi 17.05.2017, 19:00 Uhr Stadtbibliothek Leipzig, Veranstaltungsraum „Huldreich Groß“ Die Leipziger Dreilindenoper (1944–1960) – eine Liebeserklärung Vortrag und Gespräch mit Werner P. Seiferth, Werneuchen (OT Hirschfelde) So 21.05. 2017, 15:00 Uhr Gohliser Schlößchen, Menckestraße 23, 04155 Leipzig Lovestory ohne Happy End – Richard ­Wagner und Mathilde Wesendonck mit Sibylle Kuhne, Ursula Oehme und Stephan König (Klavier) Karten: 15,50 Euro/13,00 Euro ermäßigt Di 27.06.2017, 19:30 Uhr Stadtbibliothek Leipzig, Veranstaltungsraum Oberlichtsaal Eröffnung: „Wagner-Welten, ernst und heiter“ mit Prof. Martin Geck, Vittorio Alfieri, Daniel Werner. Das Wagner-Jazz-Trio mit Wim Wollner (Sax), Hans Wanning (­P iano), Ingo Senst (Kontrabass). Verleihung der Bayreuth-Stipendien Mi 28.06.2017, 8:00 bis 15:00 Uhr Treffpunkt: Busparkplatz Hbf. Ostseite Wagner-Verband auf Tour in Sachsen Wagner-Dörfer und die Geburtsstadt des Freundes und Musikers Theodor Uhlig Karten: 38 Euro 28.06., 29.06., 01.07., 02.07.2017, 17:00 Uhr Oper Leipzig, Augustusplatz 12, 04109 Leipzig Der Ring des Nibelungen Bühnenfestspiel von Richard Wagner Fr 30.06.2017, 8:00 bis 17:30 Uhr Treffpunkt: Busparkplatz Hbf. Ostseite Wagner-Verband auf Tour in Sachsen Lohengrin im Liebethaler Grund und die (Sächsische) Schweiz Karten: 45 Euro Sa 01.07.2017, 10:30 Uhr GRASSI Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, Johannisplatz 5–11, 04103 Leipzig Wagnertuba, Ritterbratsche, Amboss: Richard Wagners Sonderwünsche an die Instrumentenbauer Karten: 10 Euro/ermäßigt 7 Euro Verbandsreisen unter 0341/33736636 oder 9605656. www.gohliser-schloss.de Mo 22.05.2017, 14:30 Uhr Gedenktafel, Brühl 3, 04109 Leipzig Happy Birthday, Richard! Musikalisches Ständchen zum 204. Geburtstag Richard Wagners mit Schülern der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“. Danach: Café Wagner, RichardWagner-Platz 1, Wagners Geburtstagskaffeetafel. 27.06. — 02.07.2017 „Hast Du Töne, Richard!“ Richard-Wagner-Festtage Leipzig 2017 (Auswahl) 25.—28. Mai 2017 Thüringen Auf den Spuren Richard Wagners, der Schwarzburger Fürsten und des Porzellans in Thüringen Besonderheiten im kulturellen und grünen Herzen Deutschlands, inklusive Aufführung „Tannhäuser“ im Festsaal der Wartburg 14.-22.06.2017 Opernfestival Budapest „Der Ring des Nibelungen“ und „Parsifal“ Informationen zu den Verbandsreisen: www.wagner-verband-leipzig.de oder in der Geschäftsstelle: Telefon 0341 30868933 [email protected] Seite 16 Jubiläen Die herzlichsten Grüße und Glückwünsche des Vorstands galten unseren Mitgliedern Prof. Carola Guber zum 50. Geburtstag; Dr. Fritz Anetsberger und Bernd Hanisch zum 70. Geburtstag; Heidemarie Brendel, Dr. Christiane Meine Vd. De Martinez, Dr. Walter Hasselkus, Gerhard Richter und Ingetraut Schürk zum 75. Geburtstag; Bärbel Franz und Annelies Reiche zum 80. Geburtstag sowie Orla Wujanz zum 85. Geburtstag. Katharina Wagner ­inszeniert in Leipzig Was Richard Wagner nicht vergönnt war, wird seiner Urenkelin zuteil. Katharina Wagner, Künstlerische Leiterin der Bayreuther Festspiele, inszeniert in der Katharina Wagner kommenden Spielzeit an der Leipziger Oper einen neuen „Tannhäuser“, der auf ihrer Produktion in Las Palmas, Gran Canaria, basiert. P ­ remiere ist am 17. März 2018. Impressum © Richard-Wagner-Verband Leipzig e. V. Richard-Wagner-Straße 7, 04109 Leipzig Vorsitzender Thomas Krakow [email protected] www.wagner-verband-leipzig.de www.facebook.com/Richard.Wagner.Verband Telefon +49 (0)341 30 86 89 33 Fax +49 (0)341 30 86 89 35 Redaktion Thomas Krakow (v.i.S.d.P.), Ursula Oehme, Christa Asperger, Josef Hauer Texte Christa Asperger (ca), Dr. Eckhard Budde (eb), Harald Fugger, Prof. Dr. Karla Henschel (kh), Dr. Andreas Hölscher (ah), Winifred König (wk), Thomas Krakow (tk), Stefan Lochner (sl), Harald Otto (ho), Dr. Frank Piontek (fp), Peter Uhrbach (pu) Fotografien Siegfried Duryn, Marko Förster, Volkmar Heinz, Gabine Heinze, Armin Kühne, Stefan Lochner, Michelle Matuszczak, Enrico Nawrath, Chantal Perrier, Andrei Petrov, Presse Foto Lammel Bayreuth, Privat, Michael Ranft, Urban & Urban, Marion Wenzel, Esther Widmer, Ariane Wiegand-Striewe Redaktionsschluss 31.03.2017 Gestaltung manja-schiemann.de Druck Merkur GmbH Leipzig Verschiedenes/Impressum