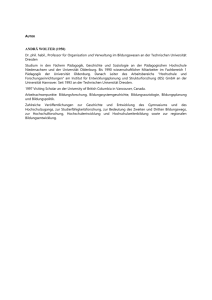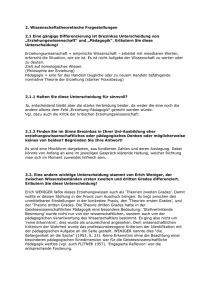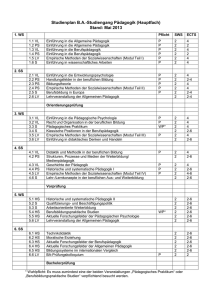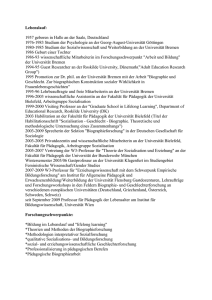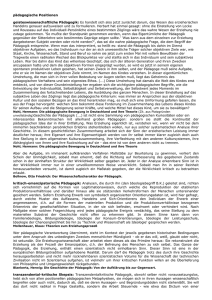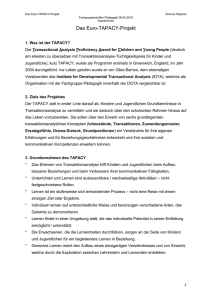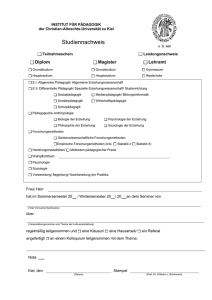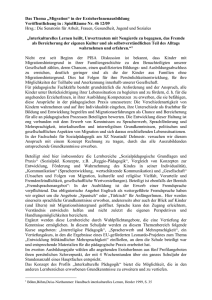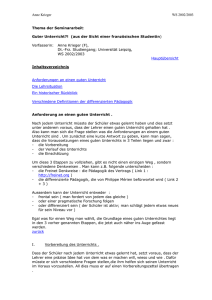Themen Instrumentalpädagogik
Werbung

Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts: Die Seminarthemen in der Übersicht Thema 1 Grundprinzipien des Lehrens und Lernens oder: Was die systemische Pädagogik im Instrumentalunterricht leisten kann Thema 2 Methodische Grundfragen im Instrumentalunterricht oder: Einzel- und Gruppenunterricht unter der methodischen Lupe Thema 3 Neue Unterrichtsformen auf soliden pädagogischen Fundamenten oder: Von der Unterweisung und Belehrung zur Schülerbeteiligung Thema 4 Das Verstehen von und Denken in Musik oder: Entwicklungspsychologische Aspekte des Musikverstehens Thema 5 Das Üben lernen als Weg und autonomes Üben als Ziel oder: Methodik, Psychologie und Pädagogik rund um das Thema „Üben“ Thema 6 Didaktische Aspekte: Die Legitimation der musikalischen Bildung oder: Es führen viele Wege nach Rom aber wo liegt Rom? Thema 7 Motivation: Die Psychologie der Freude und die Philosophie des Sinns oder: Den Menschen stärken, die Sachen klären (Hartmut von Hentig) Thema 8 Die Persönlichkeit des Lehrers oder: Warum es so schwer ist, sich (oder andere) zu ändern Thema 9 Kommunikation und Interaktion: eine Beziehungsdidaktik oder: Eine ermutigende Gesprächskultur und tragfähige Beziehungen Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 1 Grundprinzipien des Lehrens und Lernens oder: Was die systemische Pädagogik im Instrumentalunterricht leisten kann Es sind vor allem drei Fragen, die Erziehende und Pädagogen bewegen. Die erste lautet: Sind wir als Lehrer gut genug? Das ist die pragmatische Seite von Erziehung und Bildung. Aus ihr resultieren Reformen, neue Curricula, neue Lehrstile und neue Übemethoden, bis sich recht bald zeigt, dass unsere Unterrichtsinhalte verpuffen und es trotz saurer Mühen kaum vorwärts geht. Gerade bei den viel beschworenen Reformen werden immer nur Maßnahmen zur Verbesserung bereits getroffener Maßnahmen eingeführt. Von Comenius über Rousseau bis Pestalozzi, von Freinet über Wagenschein bis Hentig: Die pädagogischen Grundprinzipien sind zweifelsfrei geklärt, dazu müssen wir nicht länger auf eine Absicherung durch die Hirn- und Genforschung warten. Die wirklich seriösen Hirnforscher bestätigen ohne Abstriche, dass ihre zukünftigen Forschungsergebnisse lediglich aufzeigen werden, warum die „gute“ Pädagogik zurecht diesen Titel tragen darf und warum die „schwarze“ Pädagogik nicht taugt. Mit anderen Worten: Was wir dringend aufwerten sollten, das ist die Pädagogik an sich. Wir benötigen pädagogische und psychologische Denkübungen, um die zahlreichen Mythen, die aus der Hirnforschung in die Pädagogik hineinströmen, entlarven zu können. Seichte populärwissenschaftliche Abhandlungen und ein schlechter Journalismus verbreiten täglich falsche Vorstellungen vom Lehren und Lernen. Lernen ist ein aktiver Prozess der Bedeutungserzeugung oder Bedeutungskonstruktion. Dieser Prozess läuft in den einzelnen Gehirnen unterschiedlicher ab, als wir alle wahrhaben wollen. Dazu gesellen sich extreme Unterschiede in spezifischen Lernfähigkeiten und diese treffen auf unterschiedliche Lernstile und Lernbereitschaften. Die Vielfalt unter Kindern ist daher für jedes Entwicklungsmerkmal so groß, dass jegliche Normvorstellungen in Familie und Schule den Kindern nicht gerecht werden können. An diesem Punkt setzt die systemische Pädagogik an. Sie verknüpft die Reformpädagogik mit den neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Im pädagogischen Alltag werden viele der reformpädagogischen Grundaussagen immer noch stur ignoriert. Mischt sich dann auch noch die Politik ein (und dies wird besonders deutlich an den jüngsten Forderungen, dass wir im internationalen Vergleich in unseren Bildungssystemen schneller werden müssten), dann bilden sich kuriose Formen, die mit vielem zu tun haben, nur eben nicht mit den wirklich tragfähigen pädagogischen Grundprinzipien des Lehrens und Lernens. Sie verweisen schon seit Jahrhunderten auf die Langsamkeit des Lernens und darauf, dass nichts, was wirklich bleiben soll, schnell kommt. Die zweite Frage lautet: Sind wir gut genug zu unseren Kindern? Hier mutiert die traditionelle Musikpädagogik zu einem merkwürdigen Konstrukt. Vielfach erleben unsere Schüler beim Durchlaufen der instrumentaltechnischen Ausbildung die Musikschule als einen Paternosteraufzug in der musikalischen Bildung: Nur die Etagennummern ändern sich, nur die Schwierigkeitsgrade der Literatur steigen, aber die Erfahrungsräume, wie Musikschule in unterschiedlichen Altersstufen erlebt werden könnte, die ändern sich meist nicht: Musikschule bis zur Pubertät, Musikschule in der Pubertät und Musikschule nach der Pubertät - immer das gleiche Lied. Wir kennen uns aus mit Bach, Mozart und Beethoven, aber die grundlegenden pädagogischen Fragen bleiben meist unterbelichtet. Die Klassiker der Pädagogik sollten uns beunruhigen, zu Veränderungen treiben, geradezu aushebelnde Wirkung haben. Stattdessen fragen wir uns viel zu leichtfertig, wie wir die Musikschule verändern könnten, damit wir uns als Lehrer in ihr wohlfühlen; aber wo bleiben die Bedürfnisse unserer Kinder? Spätestens jetzt drängt sich die dritte Frage auf: Sind wir nicht zu gut zu unseren Kindern? Bei der Beantwortung dieser Frage macht Bernhard Bueb mit seinem Bestseller „Lob der Disziplin“ quasi über Nacht Schluss mit Rousseau und Hentig. Dass sich derartige Bücher millionenfach verkaufen ist unter dem Aspekt der pädagogischen Grundprinzipien ein Skandalon. Wenn derartig autoritäre Erziehungsparolen wieder auf offene Ohren stoßen, dann zeichnet dies ein erschreckendes Bild unserer aktuellen pädagogischen Landschaft. Und nicht wenige setzen in der Zunft der Instrumentalpädagogik gerade beim aktuellen Thema „Umgang mit Übeproblemen“ auf eine härtere Gangart im buebschen Sinne. Wollen wir dieser autoritätsgläubigen Verlegenheit entrinnen, so sind Denkübungen angebracht, die uns einerseits zurückführen zu den Grundaussagen der Reformpädagogik, andererseits aber auch weiterführen zum systemischen Blick in Lehr- und Lernprozessen. Anhand der hier aufgeworfenen Fragen wird deutlich, dass es sich auch in der Instrumentalpädagogik lohnt, die Zeit- und Grundfragen der Pädagogik zu beleuchten. Denn wir können die Plagen und Widrigkeiten unserer gegenwärtigen Musikausbildung nicht mit den gleichen Denkweisen lösen, mit denen wir sie verursacht haben. Für eine gelingende und ganzheitliche musikalische Bildung wird daher ein „neu denken“ zur Pflichtaufgabe der Lehrenden. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Um was geht es in der Pädagogik, was ist Pädagogik und was kann sie leisten? Wie gestalten sich die elementaren Grundprinzipien von Lehren und Lernen? Warum geht eine gute Pädagogik nie in einer Methode auf? Welches sind die wirklichen Pflichten eines Lehrers? Welche zentralen Aussagen der modernen Hirnforschung sind pädagogisch relevant? Welche Mythen aus der Gen- und Hirnforschung belasten die Pädagogik? Was kann die systemische Pädagogik für den Instrumentalunterricht leisten? Wie definieren sich die Schlüsselbegriffe einer systemisch orientierten Pädagogik? Welchen Einfluss nimmt das Systemische auf die Kommunikation im Unterricht? Warum ist Lernen immer ein reflexiver Prozess (ich lerne, also bin ich)? Weshalb kann ein lebendes System nicht gegen seine eigene Logik geführt werden? Warum kann Erziehung nur zu den Bedingungen des Gegenübers gelingen? Welche Bedeutung hat die Selbstorganisation in der Pädagogik? Warum sind Differenzen und bewusste Störungen wichtige pädagogische Prinzipien? Welchen Stellenwert hat die eigene Arbeit an den rigiden Wahrnehmungsstrukturen? Warum müssen Lehrkräfte mit ihrer eigenen inneren Logik in Kontakt kommen? Um was geht es bei der Beobachtung der Beobachtung? Wieso bedarf es in einer zeitgemäßen Pädagogik der Tugend der Gelassenheit? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 2 Methodische Grundfragen im Instrumentalunterricht oder: Einzel- und Gruppenunterricht unter der methodischen Lupe Seminare und Fortbildungen stoßen hauptsächlich dann auf ein positives Echo, wenn methodische Fragen mit möglichst vielen Rezepten und Tipps geklärt werden. Überhaupt steht im Instrumentalunterricht die Methodik im Vordergrund; pädagogische Fragen bleiben meist unterbelichtet. Dabei wird leicht übersehen, dass eine gute Pädagogik nie in einer Methode aufgeht, denn die Person des Lehrers muss ins Spiel kommen, ja, sie ist sein stärkstes Mittel. Durch die Lastigkeit methodischer Denkübungen anvanciert das Verb „vermitteln“ zum Lieblingsverb der Lehrer, während das Hauptverb der Pädagogik, etwas wahrhaft „erfahrbar“ zu machen, ein Schattendasein führt. Hinzu kommt, dass das einseitige Verlangen nach klaren methodischen Tipps und Kniffen, die Dialektik verdrängt, die jedem pädagogischen Wirken innewohnt: Erziehung ist nun mal eine Gratwanderung zwischen nicht endenden Gegensätzen. Diese Verschiedenheiten bedingen sich aber gegenseitig und erst ihre gelungene Synthese begründet die wahre Pädagogik. Es muss daher immer auch das Ziel von methodischen Überlegungen sein, sich die Gegensätzlichkeiten bewusst zu machen, um nicht vor ihnen zu kapitulieren oder an ihnen zu scheitern. Bei der methodischen Analyse und der Frage „Was ist guter Unterricht?“, erlebt man immer wieder, dass sich die Unterrichtsplanung auf die Auswahl von Stücken beschränkt, dass in der Unterrichtsdurchführung eher der Zufall regiert und die Auswertung von Unterricht darin besteht, was in willkürlicher Auswahl irgendwie wahrgenommen wird. Die Hinführung zur Selbständigkeit kann sicherlich als zentrales Lernfeld eines guten Unterrichts angesehen werden. Doch auch hier treffen wir auf die pädagogische Dialektik, denn es ist ein Trugschluss zu glauben, man müsse nur Autonomie einräumen, dann würden die Schüler die angestrebte Selbstorganisation schon lernen. Man erzieht nicht alleine durch die Gewährung von Selbstbestimmung zu verantwortlichem Handeln, und mehr Freiheit führt nicht automatisch zu einer höheren Motivation. Jede Art von Freiarbeit, so wichtig diese Unterrichtsformen in der modernen Pädagogik auch sind, braucht eine exakt ausgearbeitete Vorlage, die die Wegstrecke zur Selbständigkeit führend begleitet. Im guten Unterricht wird dieses Führen intensiv vorbereitet. Unsere Schüler haben ein Recht auf eine professionell vorbereitete Umgebung. Erst dann baut sich im Schüler ein gestärktes Selbstkonzept auf, das ihn Schritt für Schritt auf dem Weg zum selbständigen Üben und Musizieren begleitet. Nur durch das bewusste Fördern der Selbststeuerung werden beim Schüler Kontrollüberzeugungen geweckt, die ihn dann zur intrinsischen Motivation führen. Das wären die Prozesse, die methodisch im Unterricht ihren Platz finden sollten. Dies gelingt aber nicht über eine pure Rezeptologie. Eine gelingende Methodik kann sich auch heute noch am methodischen Dreischritt von Johann Heinrich Pestalozzi orientieren: wecken - üben - reflektieren. Beim „Wecken“ spiegelt sich wieder, dass insbesondere das Anfangen eine eigene methodische Kunst darstellt. Schablonenhafte Unterrichtseinstiege „wecken“ nun mal wenig Interesse. Das Verlassen der Macht der Gewohnheit ist gerade bei Stundenanfängen eine methodische Grundforderung. Bevor aber Neues an den Anfang gestellt werden kann, sind Reviere zu bilden, Regeln zu setzen und Rituale einzuhalten; ohne diese methodischen Bausteine wird Gruppenunterricht nur selten funktionieren. Die Phase des „Übens“ stellt die methodische Kernkompetenz im Instrumentalunterricht dar. Zwei Ebenen sind hier miteinander zu verbinden: Das Üben der instrumentaltechnischen Fertigkeiten und das Verstehen von und Denken in Musik. Gerade hier zeigt es sich, ob im Alltag ein breites Methodenrepertoire zur Verfügung steht, oder ob unterrichtsmethodische Monokulturen das tägliche Tun charakterisieren. Das „Reflektieren“ beleuchtet die Lehrerrolle aus ungewohnter Perspektive. Hier wird das Sichzurücknehmen zur zentralen Forderung eines Unterrichts, der in erster Linie Denkprozesse beim Schüler auslösen will, und die Förderung der Selbständigkeit über alle Lernfelder stellt. An dieser kommunikativen Kompetenz wird eine professionelle Methodik am deutlichsten sichtbar. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Wie wird aus einem „Vermittlungsunterricht“ ein „Erfahrungsunterricht“? Das Fördern der Selbststeuerung, welche Methoden sind dafür unabdingbar? Mit welcher Methodik kann die Hinführung zum selbständigen Üben gelingen? Welche Bedeutung hat der methodische Dreischritt für die Instrumentalpädagogik? Welche methodischen Aspekte haben im Gruppenunterricht besondere Bedeutung? Warum haben Lernmaterialien im Gruppenunterricht eine wichtige Bedeutung? Wie sollten Lernmaterialien für selbstinitiiertes Lernen beschaffen sein? Wie wirkt sich die Qualität des Sprechens auf einen gelingenden Unterricht aus? Gibt es so etwas wie die methodischen Kardinalfehler des Instrumentalunterrichts? Wie sehen die Merkmale eines „guten“ Unterrichts aus? Welche Lernfelder gehören zu einem ganzheitlichen Instrumentalunterricht? Warum sind manche Lernfelder vom Aussterben bedroht? Welche methodischen Aspekte kennzeichnen die einzelnen Lernfelder? Warum verstellt die eigene Fachdidaktik den Blick auf die Vielfalt möglicher Inhalte? Warum führen traditionelle Unterrichtsformen zu einer Verkürzung der Inhalte? Warum behindert die traditionelle Lehrerrolle die Förderung der Selbstorganisation? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 3 Neue Unterrichtsformen auf soliden pädagogischen Fundamenten oder: Von der Unterweisung und Belehrung zur Schülerbeteiligung Das gesamte Bildungssystem steht im neuen Jahrzehnt vor gravierenden Veränderungen. Die Instrumentalpädagogik kann sich diesem Wandel nicht verschließen, denn die Musikschulen leiden an den gleichen pädagogischen Mängeln, die auch die Regelschulen offenbaren: Sie haben sich zu reinen Unterrichtsschulen entwickelt, der Belehrungsgedanke dominiert. Wollen wir daran wirklich etwas ändern, dann muss uns zunächst bewusst werden, dass sich unser pädagogisches Denken verändern sollte, denn wir können die Plagen und Widrigkeiten unserer traditionellen Schulsysteme nicht mit den gleichen Denkformen beseitigen, mit denen wir sie verursacht haben. Beim Prozess des neu Denkens spielt die Erweiterung der traditionellen Erfahrungsräume eine große Rolle. Es geht darum, der ausschließlichen Unterweisung und Belehrung die Beteiligung an die Seite zu stellen. Neue Unterrichtsformen und Strukturen können helfen, die starren Belehrungseinrichtungen aus ihrer pädagogischen Sackgasse herauszuführen. Die Lehr- und Lernforschung verweist schon seit geraumer Zeit darauf, dass die intensivsten Lernprozesse autodidaktischer Natur sind. Zudem sind Bildungsprozesse generell reflexiv, es heißt immer „sich bilden“ und nicht „jemanden bilden“. In den belehrenden Erfahrungsräumen wird dies den weitaus meisten Schülern nicht deutlich. Sie erleben das Üben und Lernen eher als Last. Damit Kinder und Jugendliche spüren, dass ihnen Üben und Lernen tatsächlich nützt, sind zwei zentrale Anliegen erfahrbar zu machen: Zum einen muss die Schule als Ort erlebt werden, an dem die Bemühungen beim Üben und Lernen Unterstützung finden. Zum anderen müssen sie die nützliche Erfahrung machen, tatsächlich nützlich zu sein (Hartmut von Hentig). Ob wir Menschen für die modernen Gesellschaften gut genug gerüstet sind, dies hängt im Wesentlichen davon ab, wie wirksam die junge Generation Kompetenzen in ihren Selbststeuerungsprozessen aufbauen kann. Diese Schlüsselqualifikation gilt in allen Lebensbereichen als zentrales Element einer gelingenden Bildung. Das Paradoxe an der gesamten Schulsituation ist aber, dass zur gezielten Förderung der Selbststeuerungskompetenzen nur unzureichende Erfahrungsräume existieren. Nie waren die Fähigkeiten zur Selbstorganisation so wichtig wie heute, gleichsam fließen sie nur rudimentär in die Bildungsprozesse ein. Das ist das größte Skandalon bildungspolitischen Versagens. Das Abdrucken dieser Schlüsselqualifikationen in den Präambeln der Lehr- und Bildungspläne, das unaufhörliche Beweihräuchern in politischen Sonntagsreden, dies genügt bei Weitem nicht. Das Gute wollen ist eines, die Randbedingungen so festzulegen, dass es sich einstellt, ein anderes. Soll mit (oder neben) der musikalischen Bildung ein Ansteigen der Selbstorganisation gefördert werden, soll auch an einer Musikschule die Stärkung der Autonomie und das Anbahnen von Kontrollüberzeugungen für möglichst alle erfahrbar werden, so sind neue Unterrichtsstrukturen unumgänglich. In diesem Veränderungsprozess liegen für Musikschulen große Chancen, sie dürfen pädagogischer werden: Aus bloßer Ausbildung wird eine allumfassende menschliche Bildung, bei der es immer auch um ein Wissen gehen muss, wozu man überhaupt da ist. Ohne Musik und Kunst wird diese Bildungsabsicht den Menschen nicht erreichen, ohne das Ästhetische werden Fragen nach dem Sinn immer frucht- los bleiben. Mit diesem erweiterten Bildungsauftrag könnte es gelingen, die Musikschulen von den freiwilligen Förderleistungen in den gesetzlich garantierten Bildungsauftrag zu integrieren. Wir sollten die Möglichkeiten, die diesem Wandel innewohnen, sehr ernst nehmen. Bei der Beantwortung der Frage, was an einer Musikschule erfahren werden sollte, lassen sich pädagogische und strukturelle Notwendigkeiten postulieren. Als erste pädagogische Notwendigkeit ist es wichtig, die individuelle Förderung auch weiterhin als zentrales Gut zu deklarieren. Wer im Instrumentalunterricht die individuelle Förderung nicht ausreichend in Szene setzt, oder wer durch Schulgesetze dazu verpflichtet wird, das Erlernen eines Instrumentes ausschließlich über gruppale Prozesse ins Feld zu führen, handelt pädagogisch nicht professionell. In der gegenwärtigen Situation, in der vielerorts aufgrund finanzieller Nöte dem Gruppenunterricht das Wort geredet wird, scheint eine Renaissance der individuellen Förderung angemahnt. Im Gegenzug müssen sich auch Lehrkräfte eine mangelnde Professionalität vorwerfen lassen, die das Musizieren und Üben in der Gruppe nicht gezielt fordern und fördern. Musikalische Ausbildung braucht eben beides, das Individuelle und die Gruppe. Dieser flexible Umgang mit beiden Aktionsformen schließt den angesprochenen Veränderungsprozess jedoch nicht ab: Wer Selbsttätigkeit fördern will, muss Selbsttätigkeit anbieten. Somit ist die dritte Säule der Notwendigkeiten formuliert: die Schülerselbsttätigkeit. Hier liegt der entscheidende Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von Musikschulen, so werden Unterrichtsschulen zu Orten der aktiven Schülerbeteiligung. Jeder Musikschüler sollte neben der individuellen Förderung und dem Üben in der Gruppe - am Unterrichtstag selbst - auch Momente erfahren, in denen ihm selbständiges Arbeiten, freies Üben und selbstinitiiertes Musizieren begegnen. An dieser Stelle treten die strukturellen Notwendigkeiten in den Vordergrund: Wir benötigen ein Lernen in erweiterten Zeiten und in diversen Räumen. Anstatt weiterzudenken und nach Wegen zu suchen, wie die strukturellen Notwendigkeiten Schritt für Schritt verbessert werden könnten, beenden viele Lehrkräfte ihre Bemühungen um neue Strukturen und verweisen auf das Utopische derartiger Visionen. Wer aber den „Sokratischen Eid“ ernst nimmt, den Hartmut von Hentig in seinem pädagogischen Lebenswerk aufstellt, stiehlt sich aus den Bemühungen um Strukturreformen nicht einfach heraus. Er weiß, dass er aus seinem pädagogischen Auftrag heraus, eine Zivilcourage entwickeln muss, um für bessere Verhältnisse durchaus auch zu kämpfen. Zwei Schlussbemerkungen scheinen angebracht. Zum einen sollte die Aussage von oben wiederholt werden: Das Gute wollen ist eines, die Randbedingungen so festzulegen, dass es sich einstellt, ein anderes. Uns Erwachsenen kommt die Rolle zu, die Erfahrungsräume so zu schaffen und so zu strukturieren, dass wir möglichst selten pädagogische Dünnbrettbohrerei betreiben müssen. Das ins Feld führen erweiterter Unterrichtsformen und das unermüdliche Eintreten für die nötigen finanziellen Rahmenbedingungen, das ist Erwachsenenpflicht. Wir dürfen diesen Prozess den jungen Generationen nicht aufbürden, auch dann nicht, wenn er uns zermürbt. Ansonsten wäre den mannigfaltigen Lebenslügen von uns Erwachsenen lediglich ein weiterer Punkt hinzuzufügen. Zum anderen versickern viele Reformbemühungen an der Bequemlichkeit etlicher Lehrerinnen und Lehrer. Nicht wenige werden von der Grundfrage geleitet, wie wir die Musikschule in der traditionellen Form erhalten können, damit man sich mit so wenig wie möglich an Aufwand in ihr wohlfühlen kann. Dann landen wir wieder beim monotonen Erfahrungsraum der 30 minütlichen „Einzelhaft“ pro Schüler und Woche. Unter der pädagogischen Lupe wäre dies aber ein Armutszeugnis. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Warum haben die Begriffe „Einzelunterricht“ und „Gruppenunterricht“ ausgedient? Was kennzeichnet die neuen pädagogischen und strukturellen Notwendigkeiten? Der Unterrichtsalltag in neuen Strukturen, wie sieht er aus? Was haben neue Unterrichtsformen mit einer gelingenden Lehrermotivation zu tun? Warum benötigen wir auch weiterhin die individuelle Förderung? Warum können wir auf das Arbeiten und Üben in Gruppen nicht verzichten? Wie können wir die Schülerselbsttätigkeit in den Unterrichtsalltag integrieren? Wie erhalten wir - trotz finanziell schwieriger Zeiten - längere Unterrichtseinheiten? Wie kann die Sackgasse des vereinsamten Übens verlassen werden? Welche Motivationen werden durch das Üben in der Gruppe geweckt? Wie können wirksame Kontrollüberzeugungen zum Üben angebahnt werden? Warum unterstützen neue Unterrichtsformen das Ansteigen der Selbstorganisation? Mit welchen Strukturen kann eine Musikschule einem erweiterten Bildungsauftrag Wie verhilft uns der „Sokratische Eid“ von Hartmut von Hentig zu mehr Zivilcourage? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 4 Das Verstehen von und Denken in Musik oder: Entwicklungspsychologische Aspekte des Musikverstehens Wir geben uns gerne dem bequemen Trugschluss hin, dass sich eine grundlegende musikalische Kompetenz und Bildung zur Musik schon einstellen wird, wenn die Schüler nur genügend Üben und lange genug Unterricht haben. Das Beherrschen der instrumentaltechnischen Fertigkeiten steht im traditionellen Instrumentalunterricht zentral im Mittelpunkt. Das Verstehen von und Denken in Musik bleibt dabei oft auf der Strecke - es wird zumindest nur selten nach entwicklungspsychologischen Aspekten und als eigenständiges Lernfeld in den Alltagsunterricht aufgenommen. Das Nachsehen haben dann diejenigen Schülerinnen und Schüler, denen wir ein mangelndes Talent zum Musizieren unterstellen. Dabei begründet sich eine gute Pädagogik nicht über die Schülerdefizite, sondern sie stellt die Potenziale in den Mittelpunkt, die uneingeschränkt angenommen werden müssen. Denn alle Kinder sind dazu in der Lage, die Sprache der Musik zu lernen, nicht nur die besonders Begabten. Für das bewusste und zielgerichtete Unterrichten der musikalischen Syntax und deren Verstehensprozesse, bedarf es einiger Kenntnisse, die nur wenig mit der Fachdidaktik des eigenen Instrumentes zu tun haben. Die Hirnforschung hat schon mehrfach offengelegt, dass nicht was, sondern wie wir gelernt und geübt haben ausschlaggebend dafür ist, was und wie wir hörend erkennen. Ist es nicht bedenklich, dass beim Musizieren häufig die Augen den Fingern sagen, welchen Griff sie ausführen müssen, und die Finger dann dem Ohr mitteilen, wie es klingt? Müsste es nicht umgekehrt sein, dass die Augen beim Lesen des Notentextes dem Ohr sagen, was klingen soll, und das Ohr dann die Fingerbewegungen steuert? Spätestens seit dem Schock, den die internationalen Vergleichsstudien TIMSS und PISA ausgelöst haben, rückt die Bedeutung des ersten Lebensjahrzehnts für die musikalische Bildung wieder in den Mittelpunkt der pädagogischen Diskussion. Aufgrund von seichten populärwissenschaftlichen Abhandlungen und schlechtem Journalismus kommt es bei der Thematik der frühkindlichen Bildung zu gravierenden Fehleinschätzungen und unzähligen Mythen. Angeblich sollte die musikalische Bildung früher beginnen, weil Kinder in den ersten Lebensjahren mehr, besser und einfacher Lernen. Diese Annahmen sind falsch. Kinder ziehen gerade aus der Beschränktheit ihres Aufnahmevermögens den größten Nutzen, es geht dabei um die Konzentration auf das Wesentliche. Beim Lernen der Muttersprache geschieht diese Begrenzung völlig natürlich und daher auch mit faszinierender Effizienz. Bei der Entdeckung der frühen Jahre darf es nicht darum gehen, noch mehr zu lernen, sondern in den Fokus unserer Bemühungen sollte ein anderes Lernen rücken, es muss gerade bei den Aspekten zur Musik anders gelernt werden, damit Lernen wirklich bildet. In den ersten Jahren sollte es uns darum gehen, Grundlagen zu schaffen, für ein späteres sinnstiftendes und verstehendes Lernen im gesamten musikkulturellen Kontext. Diese Vorläuferfähigkeiten sind der Schlüssel zum Können. Und dieses Wissen ist wichtiger als Intelligenz. Fehlende und mangelhaft ausgebildete Vorläuferfähigkeiten können nicht durch überdurchschnittliche Intelligenz kompensiert werden, während der umgekehrte Fall durchaus möglich ist. Die Vorläuferfähigkeiten müssen im Feld der Musik zur Audiation führen. Audiieren meint das Denken in Musik. Hierbei handelt es sich nicht um ein privilegiertes Lernen, um Aspekte des Verstehens also, deren Grundlagen im Gehirn bereits angelegt sind, sondern es geht um nicht-privilegiertes Lernen, um das Ausbilden von komplexen Dynamiken, die ein wirksames Verstehen von Musik ermöglichen. Martin Wagenschein, der große Pädagoge der Naturwissenschaften, hat uns für die wahren Verständnisprozesse im physikalischen und mathematischen Bereich aufgezeigt, dass wirksames Verstehen auf ursprünglichem Verstehen beruhen muss. Auch beim Verstehen von und Denken in Musik rückt das ursprüngliche Verstehen in den Mittelpunkt der pädagogisch-methodischen Bemühungen. Die traditionelle Musikpädagogik ist vielerorts meilenweit vom Vorrang des Verstehens entfernt, allzu leichtfertig beschränkt man sich auf ein mechanistisches Lehren von technischen Abläufen und vernachlässigt das nicht-privilegierte Lernen zum Denken in Musik. Am deutlichsten treten die Kardinalfehler des traditionellen Instrumentalunterrichts dort hervor, wo die Lernwege vom Zeichen zum Klang verlaufen. In dieselbe Richtung verweist die Tendenz, dass die Grammatik der Musik durch die Vermittlung der dahinterstehenden Prinzipien gelehrt wird: Zuerst die Bewusstmachung der Regel, danach folgen die Übungen zur Konditionierung der Regelwerke. Der entwicklungspsychologisch sinnvolle Weg verläuft methodisch aber umgekehrt: erfahren, erkennen, benennen. In eine andere Richtung verweist der Kardinalfehler, dass die Fortschritte im Erfahren der musikalischen Syntax an die Fortschritte auf dem Instrument gekoppelt sind: Das instrumentaltechnische Können bestimmt das Niveau im Umgang mit den Parametern der Musik. Generell lehren wir im traditionellen Stil eher die Technik des Musikmachens anstatt die Sprache der Musik. Wenn wir die Bedeutung der frühen Jahre wirklich entdecken wollen, dann sollten wir radikal neu denken und keine Musikerziehung betreiben. Das pädagogische Fundament bedarf eines Wandels zur Erziehung von Kindern durch Musik. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Unterrichten wir instrumentaltechnische Fertigkeiten oder auch Musik? Was heißt Musik verstehen und als was kann Musik verstanden werden? Wie entwickelt sich dieses Verstehen in den jeweiligen Altersstufen? Wie kann dieser Verstehensweg methodisch und didaktisch angelegt werden? Welche Aussagen der modernen Hirnforschung sind pädagogisch relevant? Was sind pädagogische Fehlauffassungen bei der Entdeckung der frühen Jahre? Was sind musikalische Vorläuferfähigkeiten und wie sind sie zu etablieren? Was ist privilegiertes und nicht-privilegiertes Lernen? Wie entwickelt sich das musikalische Vokabular zum Verstehen von Musik? Was sind die tragenden Aspekte des Audiationslernens? Wie sehen audiationsfördernde Methoden aus? Was ist unterscheidendes Musiklernen und was ist schlussfolgerndes Musiklernen? Welche Mythen aus der Gen- und Hirnforschung belasten die Pädagogik? Wie steht es um die musikalischen Begabungen, wie viel ist tatsächlich angeboren? Wo liegen die Kardinalfehler im traditionellen Instrumentalunterricht? Warum bedarf es eines Wandels zur Erziehung der Kinder durch Musik? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 5 Das Üben lernen als Weg und autonomes Üben als Ziel oder: Methodik, Psychologie und Pädagogik rund um das Thema „Üben“ Ganzheitliches Üben verknüpft zwei Ebenen: Das Verstehen von und Denken in Musik (vgl. Thema 4: Das Audiationslernen) sowie die Ausbildung der instrumentaltechnischen Fertigkeiten. Es geht um den kreativen Umgang mit den Übeinhalten. Ziel ist es, ein Methodenrepertoire aufzubauen, um der stupiden Wiederholung entgegenzuwirken. Zu häufig treffen wir in der täglichen Übepraxis auf das Übeprinzip Gewissen beruhigen. Dabei geht es den Schülern lediglich um ein Absitzen der vereinbarten Übezeit, damit sie dann anschließend den zugesprochenen Freiheiten nachgehen können. Übeinhalte werden dabei zu wenig und oft unwirksam wiederholt und gespielt wird meist nur das, was man ohnehin bereits beherrscht. Auftretende Schwierigkeiten lässt man bei diesem Übeprinzip ohne Bedenken links liegen. Das zweite Übemethode, das Prinzip Hoffnung, verläuft in entgegengesetzter Richtung: Wiederhole die Übeinhalte so lange, bis sie endlich sitzen. Dieses Prinzip findet bis weit in die Musikhochschulen hinein seine Anwendung. Mit kreativ-forschendem Üben hat auch dieses Handeln wenig zu tun. Auf dem Weg zum selbständigen und autonomen Üben sind drei Teilaspekte zu beleuchten: Die Übeorganisation, die Orientierungsphase und das eigentliche Üben. Im ersten Bereich geht es um das Planen des Übens. Hier hat uns die Reformpädagogik, insbesondere die Pädagogik von Célestin Freinet, einiges mit auf den Weg gegeben. Kinder haben nicht nur ein großes Interesse an einer individuellen Planung ihrer Übeinhalte, sondern auch ein Bedürfnis, ihre eigenen Arbeitsleistungen zu dokumentieren. Wollen wir die reformpädagogischen Ansätze auf das instrumentale Üben übertragen, dann haben die traditionellen Vokabelhefte ausgedient, denn das einseitige Auflisten der Übeinhalte wird wesentlich erweitert. Reformpädagogische Übepläne eröffnen zusätzliche Räume für die Ziel- und Methodenbeschreibung. Bei dieser erweiterten Art der Übeplanung geht es um keine formale Disziplin, sondern um die wesentliche Disziplin der Arbeit. Durch planvolles Arbeiten wird der Grundstock zur Verantwortung und Selbständigkeit gelegt. In der Orientierungsphase rückt das Auslösen der Übehandlung in den Mittelpunkt. Dies ist die entscheidende Phase zum Üben. Dabei geht es nicht um das Thema, mit welchen Strategien oder Methoden sinnvoll geübt wird, sondern um die Frage, ob überhaupt mit dem Üben angefangen wird und um die schwierige Abschirmung gegen Reize, die stärker wirken, als das Üben auf dem Instrument. Hier haben die Lehrer und die Eltern gleichwertige Zuständigkeitsbereiche und diese müssen zusammenwirken. Die Lehrerseite trägt die pädagogische Verantwortung für die Erfahrungsräume in denen die Selbstwirksamkeit der Schüler gefördert wird, denn Schüler handeln nicht, wenn sie erwarten, dass sie nichts bewirken können. Der Selbstwirksamkeit steht die erlernte Hilflosigkeit gegenüber. Diese antriebslose Grundhaltung erhält ihren Nährboden insbesondere durch eine entmutigende Kommunikation und eine nicht tragfähige Beziehungsebene. Auf der Seite der Eltern steht die Qualität der Zuwendung im Vordergrund. Ist die elterliche Anteilnahme an den Lernprozessen groß genug und finden sich genügend Ermutigungen in das Üben einzusteigen, dann ist der Schritt zum eigentlichen Üben ein kleiner. Die Eltern tragen eine große Verantwortung im Umgang mit den täglichen Motivkonflikten ihrer Kinder, die zwischen den vielfältigen Umweltreizen und der Verpflichtung zum regelmäßigen Üben auftreten können. Zwar liegen die Ressourcen, die ein Mensch zur Erlangung seiner Ziele benötigt, ausschließlich in ihm selbst (vgl. Thema 1: Die systemische Pädagogik), doch beim Aufbau dieser wichtigen Kontrollüberzeugungen benötigen die Kinder die Unterstützung ihrer Eltern. Die Wirkung dieser Kontrollüberzeugungen ist die zentrale Stellschraube zur Übemotivation, bestimmt sie doch maßgeblich mit, ob die Übehandlung überhaupt ausgewählt wird und wie viel Anstrengung in das Üben investiert wird. Die interessierte Anteilnahme und kooperative Unterstützung auf dem Weg zum selbständigen Üben entlässt die Elternseite nicht in die Passivität. Die Erziehenden kommt nicht umhin, verpflichtendes Üben einzufordern. Es ist aber viel zu einfach, dies im Sinne des Verkaufsschlagers „Lob der Disziplin“ von Bernhard Bueb umzusetzen. Die systemische Pädagogik kann helfen, dieses Spannungsfeld in Gelassenheit aber nicht in Gleichgültigkeit anzugehen. Die dritte Ebene betrifft das eigentliche Üben. Methodisch geht es um den Kernsatz, dass aus der bloßen Wiederholung noch kein intelligentes Üben entsteht. Mannigfaltige Übestrategien können Schülern erfahrbar gemacht werden. Allerdings treffen wir hier auf eine Gratwanderung, denn oft weisen die Vorstellungen der Lehrer eine große Diskrepanz zu den Übewegen der Schüler auf. Aus Lehrersicht geht es um ein Anwenden von klar geregelten und differenzierten Übestrategien, nur so wäre Üben auch tatsächlich effizient. Schülern helfen diese Techniken aber nicht so ohne weiteres weiter und nicht selten bleiben sie wirkungslos. Dies gilt vor allem dann, wenn die Übemethoden nicht dem Entwicklungsstand der Schüler entsprechen. Am deutlichsten wird diese Diskrepanz zwischen den Lehrer- und Schülervorstellungen am Beispiel des Durchspielens. Auf der Lehrerseite wird es vielfach verpönt, während es die meisten Schüler als lustvoll erleben. Die Übemethoden, die man selbst als junger Musikschüler mit größter Freude praktizierte, sind nicht identisch mit den Techniken, die uns später an der Musikhochschule zur Macht der Gewohnheit wurden. Ist man dann als Erwachsener im Lehralltag der Musikschule angekommen, dann vergisst man die eigene Übebiographie nur allzu schnell. Vielfach wird die Erwachsenensicht auf die Zeitspanne des gesamten Lernweges projiziert. Dies ist keine pädagogische Meisterleistung. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Das Üben planen: Wie helfen uns die Erkenntnisse aus der Reformpädagogik? Das Üben auslösen: Welche psychologischen Zusammenhänge sind zu beachten? Das Üben aufrecht erhalten: Welche Strategien unterstützen die Übehandlung? Der Umgang mit Übeproblemen: Welches Lehrerverhalten scheint angebracht? Der Umgang mit Motivkonflikten: Wie sieht eine gelingende Elternarbeit aus? Wie können Kontrollüberzeugungen erfahrbar werden? Welchen Einfluss hat das Unbewusste auf das Auslösen der Übehandlung? Wie kann auf die unbewusste Ebene Einfluss genommen werden? Das Üben in der Pubertät: Reine Utopie oder gibt es gangbare Wege? Unterricht ist mehr als das Abfragen der Hausaufgaben, wie wird er zum Ereignis? Strategien zum Üben - warum brauchen wir einen gefüllten Methodenkoffer? Und schließlich die Frage: Wie füllen wir unseren Methodenkoffer? Sei kreativ! Warum muss dieser „geschundene“ Begriff neu gedacht werden? Wo brauchen wir die Hirnforschung wirklich und wo nützt sie uns nur herzlich wenig? Das Üben im Ensemble, eine neue Unterrichtsform mit ungeahntem Potenzial? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 6 Didaktische Aspekte: Die Legitimation der musikalischen Bildung oder: Es führen viele Wege nach Rom aber wo liegt Rom? Die Instrumentalpädagogik steht derzeit mit dem Rücken zur Wand. Unter massivem Druck muss sie ihre Tätigkeit in bisher ungewohntem Ausmaß legitimieren. Nicht erst seit der Bastian-Studie werden zur Legitimierung hauptsächlich die Transferleistungen herangezogen. Mit der Transferargumentation werden die positiven Auswirkungen des aktiven Musizierens auf alle Seiten der Persönlichkeit und in sämtliche Lebensbereiche hervorgehoben. Immer weniger geht es um die Tätigkeit an sich, sondern ihren Nutzen für andere Zwecke. Das Musizieren wird in den Dienst genommen, instrumentalisiert für Lern- und Erziehungsziele aller Art: Durch Instrumentalunterricht besser in Mathematik und „wer auf die Trommel schlägt, schlägt nicht seine Mitmenschen“. Credo: Musizieren bessere angeblich den Menschen. Diese Argumentationen verfehlen ihren Gegenstand, den Unterricht in Musik. In erster Linie haben Musikschulen keine außermusikalische, sondern eine höchst musikalische Aufgabe: Die Erfahrung von Musik als Entfaltung der jedem Menschen eigenen, individuellen Musikalität. Was an einer Musikschule richtig oder falsch, gut oder weniger gut gemacht wird, bemisst sich an deren Sinn und Zweck. Was also sind die Bestrebungen einer Musikschule, wo liegen die grundlegenden Ziele des Instrumentalunterrichts? Es geht um eine nachhaltige Begegnung mit Kunst und um die Befähigung zu einem lebendigen und persönlich authentischen Musizieren. Wir sind derzeit oft meilenweit davon entfernt, die Tätigkeit des Musizierens als ästhetisches Handeln zu bestimmen. Das Ästhetische kann als ein anthropologisches Grundbedürfnis des Menschen vorausgesetzt werden. Daher lässt sich ein Recht auf ästhetische Bildung postulieren. An vielen Musikschulen werden zur Zeit Konzeptionen und Leitbilder entworfen. Diese didaktischen Überlegungen dürfen nicht fehlen, wenn wir in eine sichere Zukunft steuern wollen. In den Diskussionen um ganzheitliche Bildung hat die Zunft der Instrumentalpädagogik ein wichtiges Wort mitzureden. Nur sollten wir diese Streitgespräche tiefgründig führen und uns nicht im politisch oberflächlichen Alltagsgeschwätz einreihen. Ein lethargisches Verharren in der Oase der glückseligen Musiker und Künstler stärkt die Instrumentalpädagogik keineswegs. Um drohenden Schließungen von Musikschulen etwas entgegenzusetzen, sollten wir alle gemeinsam an den Veränderungen arbeiten, die für jeden von uns an der Basis beginnen. Auf bildungspolitische Revolutionen von oben zu warten, das gleicht einem apathischen Zusehen, wie das Schiff „musikalische Bildung“ allmählich untergeht. Wer sich didaktischen Frage stellt, kommt um das Thema „Was soll Musik?“ nicht herum. Das Leben unter der akustischen Glocke hat den normalen Hörsinn längst degenerieren lassen. Zuhören und das Verstehen von Musik ist ein geistiger Prozess, also nichts für den blind gewordenen Hörer. Längst hat sich das Hören vom Denken abgespaltet. Die bloße Aufnahme von Musik wird zur suchtartigen Sache, die wichtiger wird als ihre Verarbeitung. In der zeittypischen akustischen Landschaft flacht alles ab nur eines nicht: die Lautstärke. Der Anteil an fremdbestimmter Musik wächst unkontrolliert an. Die Zeit und Muße zur selbstbestimmten Musik nimmt kontinuierlich ab. Dabei hat die Musik kontinuierlich ihre Eigenständigkeit verloren, sie wurde zu einem Pleonasmus zum Bild. Das Musikhören zu Bildern verflacht zu einem einseitigen Musikhören in Bildern. Hinzu kommt, dass die Musik den tragischen Verlust einer lebendigen Gegenwartskultur erlebt. Die Vorliebe für Altbekanntes führt zu einer Kluft zwischen Altem und Neuem, längst haben wir die neugierige Haltung des Zuhörens verlernt. Das aktive Musikhören wird zurückgedrängt zu einer drastischen Verkürzung auf den passiven Musikkonsum. Daher verlieren wir den lebendigen Wechselbezug zwischen Mensch und Musik. All diese Erfahrungsräume führen zu einem musikalischen Analphabetismus. Musik bräuchte man angeblich nicht zu verstehen, sie soll einfach nur schön sein. Wir sind nicht mehr dazu in der Lage, das zu Hören, was durch die Musik gesagt werden könnte. Es gibt also Gründe genug, sich mit den vielfältigen didaktischen Fragestellungen in der Instrumental- und Musikpädagogik auseinanderzusetzen. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Was ist ganzheitliche Bildung und was leistet die Musikpädagogik wirklich? Betreiben wir an unserer Musikschule Bildung oder Ausbildung? Wohin steuert eine Musikschule, wenn der Ausbildungsgedanke triumphiert? Didaktische Professionalität oder warum muss Musikschule sein? Was sind die Bestrebungen einer Musikschule, wie sieht deren Leitbild aus? Welches sind die grundlegenden Ziele des Instrumentalunterrichts? Was ist eine ästhetische Bildung? Welche Rolle spielt die Kunst und wie sollten wir ihr begegnen? Die drastische Verschmutzung der akustischen Erfahrungsräume: Was hat dies mit Instrumentalunterricht und Musikpädagogik zu tun? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 7 Motivation: Die Psychologie der Freude und die Philosophie des Sinns oder: Den Menschen stärken, die Sachen klären (Hartmut von Hentig) Die Beschäftigung mit motivationalen Aspekten führt uns zu der Grundfrage, wo die Stellschrauben der menschlichen Motivation liegen. Drei Wissenschaften klären die Zusammenhänge: Die Biologie (u.a. auch die Hirnund Genforschung) liefert Überlegungen zum Thema „Das Prinzip Menschlichkeit“. Die Psychologie klärt die Zusammenhänge, wie für uns Menschen tiefe Zufriedenheit und Freude erfahrbar werden kann. Die Philosophie erörtert zwei Komplexe, die eng miteinander in Beziehung stehen. Zum einen geht es um den Bezug zu einem gelingenden und bejahenswerten Leben, zum anderen um die wichtige Frage nach dem Sinn. Pädagogisch gipfelt das Motivationsthema in einer neuen Bildungs- und Erziehungskultur. Da wird zu zeigen sein, dass die alte Gehorsamskultur in Schulen und Familien längst ausgedient hat. Die wirklichen Alternativen setzen auf einen Erziehungsstil, der zur Verantwortung führt. Dabei sind die wichtigen Zusammenhänge des Lernens durch Erfahrung sehr genau zu beleuchten. Wer die komplexen Zusammenhänge der menschlichen Motivation verstehen will, muss sich von den einfachen und populistischen Ratgebern trennen. Wollen wir die Sachen wirklich klären, dann sind tiefergehende Denkübungen von Nöten. Als Lohn dieser Mühen erwartet uns nichts geringeres als eine enorme Stärkung des Menschen, geht es doch gerade auch beim Thema Motivation immer wieder um ein Wissen, wozu man überhaupt da ist. Biologische Fragestellungen treten in ein spannendes Forschungsfeld: Sind die motivationalen Antriebsfedern über den „Kampf ums Dasein“ (Konkurrenz) bestimmt, oder führt auch in der Biologie die Kooperation die Regie? Diese Überlegungen müssen heute so weit führen, dass man dabei die Rolle der Gene unter die Lupe nimmt. Sind sie die allentscheidenden Akteure, die aus „egoistischen“ Zügen unser menschliches Tun steuern, oder sind auch die Gene auf Beziehungen und Kooperationen angewiesen? Psychologisch können wir ähnliche Zusammenhänge entdecken. Die Psychologie der Freude führt die Schüler- und die Lehrerseite zusammen, denn es geht um das Entwickeln und Fördern einer eigenen Lernkultur beim Üben und Unterrichten. Die Qualität der Freude, die aus eigener Anstrengung kommt, ist immer höher als das passive Erlebnis, denn Freude ist eine Überwindungsprämie. Sie ist eng verknüpft mit Eigenleistung und Selbstüberwindung. Aber die diesem Erfolgsglück vorangehenden Phasen des Übens stellen unter der motivationalen Betrachtungsweise oft eine Durststrecke dar. Um Kinder und Jugendliche auf diesen Wegen der Unlust zu unseren Bildungszielen zu motivieren, bedarf es der positiven zwischenmenschlichen Beziehungen und einer durch sie ausgelösten Resonanz. Sie sorgt dafür, dass zwischen uns Erwachsenen und unseren Schülern die natürliche Neugier und Begeisterung übertragen wird. Nicht das gebetsmühlenhafte Pochen auf Disziplin stimuliert die Motivationssysteme unserer Schüler, sondern ihre Begleitung durch verlässliche Beziehungen und persönliche Zuwendung. Mittels dieser sozialen Resonanz zwischen Erwachsenen und Schülern werden Erfahrungsräume im pädagogischen Sinne stimmig. Die neuzeitlichen Erkenntnissen aus der Neurobiologie und Genforschung legen unmissverständlich klar, dass die Stellschrauben zur menschlichen Motivation nicht das bedingungslose Akzeptieren der Lehrerautorität oder das angepriesene „Lob der Disziplin“ sind, sondern die gelingenden zwischenmenschlichen Beziehungen. Im pädagogischen Alltag haben viele Motivationsprobleme ihren Ursprung in einer nur mangelhaft ausgebildeten Beziehungskompetenz und Beziehungsgestaltung. In unserer Wohlstands- und Verwöhnungsgesellschaft werden - nicht erst seit dem TIMSS- und PISA-Schock - die Stimmen immer lauter, die eine „härtere“ Gangart anmahnen: Fordern statt Verwöhnen und ein Recht auf Disziplin. Doch der pädagogisch Denkende erkennt, dass wir es mit den Lebensproblemen aufnehmen müssen, bevor wir Lern- und Übeprobleme lösen können. Vorrangiges Ziel muss auch in der Pädagogik des Instrumentalunterrichts sein, die jungen Menschen zu stärken, gleichgültig auf welchem instrumentaltechnischen Niveau sie sich befinden, gleichgültig auch, wie viel an musikalischem Begabungspotential sie mitbringen. Ferner ist dem Pädagogen bewusst, dass die Forderung nach Disziplin nur dann Sinn macht, wenn sie in Selbstdisziplin aus Einsicht mündet. Die motivationalen Überlegungen dürfen nicht auf das rein instrumentale Üben reduziert werden, sondern die Aspekte des Übens müssen für Pädagogen auf das „Üben am Beruf“ ausgedehnt werden. Wie halte ich die Freude am Lehrberuf aufrecht, vor allem nach langjährigem pädagogischen Wirken und wie steht es um die Motivation zur „Institution Musikschule“? Provokant gefragt: Würde mit einem höheren Gehalt auch automatisch die Motivation zum Lehrberuf anwachsen? Dann gilt es zu hinterfragen, welche motivationalen Auswirkungen gelingende Beziehungen innerhalb des Lehrerkollegiums haben? Provokant gefragt: Passt das typische „Einzelkämpfertum“ eigentlich zum Lehrberuf? Letztlich münden aber alle Motivationsgedanken bei der Frage nach dem Sinn. Die Sinnfrage obliegt nur uns Menschen, denn sie ist der Ausdruck unserer geistigen Dimension, also das, was den Menschen erst zum Menschen macht. Dabei ist Sinn die gelebte Antwort auf die Frage „Wozu leben?“. Der Schlüssel zum Sinn liegt somit in der Öffnung zum Leben hin. Pädagogisch ist die Frage nach dem Sinn vor allem darum interessant, weil Sinn nicht vermittelt oder einfach jemandem gegeben werden kann, denn dies würde lediglich auf ein wirkungsloses Moralisieren hinauslaufen. Sinn kann auch nicht direkt erzeugt werden. Unsinn als absurdes Theater der Gegenwart schon. Sinn muss von jedem Einzelnen gefunden und immer wieder neu entdeckt werden. Hartmut von Hentig hat mit seinem Werk „Die Menschen stärken, die Sachen klären“ die Zusammenhänge pädagogisch auf den Punkt gebracht. Er beschreibt die Schwierigkeiten, eine Gesellschaft aufzuklären, die sich für aufgeklärt hält. Dabei stellt er die Frage, ob Vernunft lehrbar ist. Wer sich in den nächsten Jahrzehnten mit menschlicher Motivation auseinandersetzt, kommt nicht umhin, die Grundzüge dieses pädagogischen Ansatzes zu studieren. Sie führen uns zur Umkehrung des Prinzips der Aufwärtsentwicklung, nämlich zur Bescheidung. Die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten und somit das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel. Darum sind wir dazu angehalten die Abwärtsentwicklung neu zu denken. Entschleunigung statt Beschleunigung, gründliches Denken statt bloße Information, Weniger statt Mehr. All dies wären Übungen in praktischer Vernunft. Sie muss letztlich das Fundament der menschlichen Motivation bilden. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Warum kann eine autoritäre Erziehung die Motivationsprobleme nicht lösen? Warum kann das Moralisieren und Predigen die Motivation nicht steigern? Welche Motivationen gelten für das Handeln aus biologischer Sicht? Wie sieht die soziologische Betrachtung der menschlichen Motivation aus? Welche psychologischen Faktoren motivieren zum Handeln? Was kann die Philosophie zu motivationalen Fragen beisteuern? Was ist „Funktionslust“ und wie können wir diesen Lustgewinn erfahren? Welche Motivationsprinzipien gelten in der Konsum- und Wohlstandsgesellschaft? Wie sieht die motivationale Fragestellung für unsere Bedürfnisse aus? Was kann die systemische Pädagogik zum Motivationsthema beisteuern? Warum sind Motivationsfragen letztlich immer Fragen nach dem Sinn? Die Menschen stärken, die Sachen klären - was hat das mit Motivation zu tun? Musik & Pädagogik Michael Stecher Im Schindwasen 8 79379 Müllheim - Britzingen Pädagogik des Instrumentalunterrichts Thema 8 Die Persönlichkeit des Lehrers oder: Warum es so schwer ist, sich (oder andere) zu ändern In der Pädagogik wird stets betont, dass die Person des Lehrers (des Dirigenten) ins Spiel kommen muss, ja, sie ist gleichsam das stärkste Mittel für die wahrhaft gelingenden Lehr- und Lernbeziehungen. Sollen im Probengeschehen nachhaltige Änderungen zum Tragen kommen, so sind diese immer auch an Veränderungen der beteiligten Personen gebunden. Nun wird aber auf allen Forschungsebenen deutlich, dass es ein sehr schwieriges Unterfangen ist, in oder an uns Menschen Veränderungsprozesse in Gang zu bringen. Offenbar existieren starke Muster in denen wir gehalten sind. Und trotz vieler Ratgeber von ausgewiesenen Experten bis zu dreisten Scharlatanen versuchen wir (mehr oder weniger erfolglos) auf eine andere Spur zu kommen. Vieles von den Ratschlägen und den Expertenhinweisen funktioniert einfach deshalb nicht, weil es kein „kognitives Problem“ ist, denn wir wissen sehr wohl, was wir verändern könnten, sollten oder müssten, das Problem ist aber: Es geht nicht! Was sind diese „Bremsklötze“, an was kommen wir nur sehr schwer heran? Es sind unsere Haltungen, Vorstellungen und Einstellungen, unsere Überzeugungen und Wertungen; sie sind offenbar relativ änderungsresistent. Wenn sich wirklich etwas ändern soll, was tatsächlich von bleibendem Wert ist, dann gilt es zu fragen, welche Instanz sich in uns „fügen“ sollte, damit tragfähige Veränderungen möglich werden. Die neuzeitlichen Neurowissenschaften verweisen darauf, dass sich das unbewusste Selbst auf der unteren und mittleren limbischen Ebene verändern muss, damit sich unsere Primärkonstruktionen und routinemäßigen Wahrnehmungen verändern. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass wir diese subcortikalen Bereiche im Wesentlichen nur nichtrational und nie durch Moralisieren erreichen. Um es unmissverständlich offenzulegen: Es ist mittlerweile durch natur- und geisteswissenschaftliche Erkenntnisse belegt, dass eine lineare Disziplinierungs-, Moralisierungs- und Belehrungspädagogik nicht taugt, um uns Menschen in unserer Persönlichkeitstypologie nachhaltig zu verändern. Nachhaltig meint, dass uns unsere Bildung so „im Griff hat“, dass wir uns von ihr tatsächlich auch leiten lassen, erst dann besitzt Bildung ihren Wert. Im Zuge derartiger Überlegungen stoßen wir auf einen der größten Mythen der Hirnforschung. Selbst wenn gebetsmühlenhaft betont wird, dass das menschliche Gehirn zeitlebens form- und veränderbar sei, uns also als neuroplastizites Organ begegnet, dann gilt dies - trotz dieser optimistischen Beteuerungen - nicht für alle Bereiche des menschlichen Daseins. Gerade aus unseren emotional konditionierten Primärkonstruktionen kommen wir nicht so ohne weiteres heraus, vielleicht sogar zeitlebens nie! Wer leichtfertig derartige Mythen verbreitet handelt populärwissenschaftlich oder er betreibt einen schlechten Journalismus. Seriöse Hirnforscher verweisen immer deutlicher darauf, dass sie auf die hier skizzierten Fragestellungen noch nicht ausreichend abgesicherte Ergebnisse vorlegen können, und dass dies vielleicht auch nie verlässlich möglich sein wird. Das liegt an der vielschichtigen Komplexität des menschlichen Gehirns. Die leidtragenden sind die Pädagogen, die auf die einfache Veränderbarkeit des Menschen setzen, um dann im alltäglichen Lehrbetrieb immer wieder an ihren eigenen Ansprüchen zu scheitern. Dass diese Ansprüche falsch erhoben sind, dies wird leider zu oft verkannt. Kein Pädagoge kann Veränderungserfolge garantieren und gleichsam ist er aber doch dafür verantwortlich. Das ist nun mal die paradoxe Struktur der pädagogischen Aufgabe. Wer sich Denkübungen über die menschliche Persönlichkeit und deren Veränderbarkeit auferlegt, der kommt ohne die Erkenntnisse der systemischen Pädagogik zu keinem fruchtbaren Ergebnis. Die systemisch-komplexe Wechselwirkung der persönlichkeitsbildenden Faktoren beendet die alte Kontroverse zwischen „Anlage“ und „Umwelt“ ebenso, wie diejenige zwischen „Individualität“ und „Sozialität“. Was aber noch wichtiger erscheint ist die Offenlegung, dass die systemische Beschreibung dem immer noch vorherrschenden „Erziehungsoptimismus“ widerspricht. Zwei Aspekte sollten ausführlich klargelegt werden: Zum einen geht es um eine neue Bewusstheit über das menschliche Verhalten mit einer klaren Konturführung, in welchen Bereichen Menschen kaum (oder nur sehr schwer) veränderbar sind. Dieses Wissen um die Unwirksamkeitstoleranzen kann so genutzt werden, dass es zur Grundhaltung einer neuen pädagogischen Gelassenheit führt. Zum anderen brauchen Führungspersonen Denkanstöße, wie sie lernen können, mit den eigenen Defiziten umzugehen. Das systemische Denken kann hilfreich sein, wenn es im Alltagshandeln darum geht, die suboptimalen Erstreaktionen durch optimierte Zweitreaktionen zu ersetzen. Die Kompetenz die wir dafür benötigen, das wäre erstens die Fähigkeit, Vertrautes aufzugeben, und zweitens der Humor und der Optimismus, um die eigene Stimme des ständigen Bescheidwissens verstummen zu lassen. Jeder Mensch besitzt zweifelsohne verschiedene Merkmale, die seine Persönlichkeit kennzeichnen und bestimmen. Wenn die Forschung recht behält und davon auszugehen ist, dass der erwachsene Mensch in seinen Primärkonstruktionen und seinen Persönlichkeitsmerkmalen nur äußerst schwer zu verändern ist, dann führen diese Erkenntnisse zu einer wichtigen Frage: Welche Persönlichkeitsmerkmale sind in pädagogischen Führungsrollen (Dirigent oder Lehrer) unverzichtbar, damit Lehr-und Lernprozesse gelingen können? Die systemische Pädagogik verweist auf eine klare Messlatte, die für das professionell-pädagogische Handeln anzusetzen ist. Führungspersönlichkeiten können nur dort Wirkungen beim Gegenüber entfalten, wo ihr Agieren und Reagieren beim anderen Resonanz erzielt. Wer aufgrund seiner Typologie oder Persönlichkeit und aufgrund seiner fest eingespurten emotionalen Konditionierung nur unzureichende Resonanzfähigkeiten besitzt, der sollte sich gründlich überlegen, ob pädagogische Wirkungsfelder für sein Wesen und für sein „In-der-Welt-sein“ die richtigen Aufenthaltsorte sind. Wenn in den Studiengängen an Musikhochschulen primär nur die künstlerische Kompetenz als Einstieg und Eignung für die Musikberufe herangezogen wird, dann wird sich in den pädagogischen Feldern so schnell kaum etwas zum Besseren wenden. Die entscheidenden Persönlichkeitsmerkmale wie Empathie oder Resonanzfähigkeit sind im pädagogischen Alltag oftmals wichtiger als das hochspezialisierte instrumentaltechnische Können. Leider werden diese menschlichen Kompetenzen nur unzureichend berücksichtigt. Auf folgende Fragen werden in diesem Themenblock Antworten gegeben: Warum ist es so schwer, sich oder andere auf eine neue Spur zu bekommen? Wie steht es um die verschiedenen Bereiche der Veränderbarkeit beim Menschen? Anhand welcher Einzelmerkmale wird heute die menschliche Persönlichkeit definiert? Welches sind die tragenden Determinanten der Persönlichkeit? Wie und wann bilden sich die verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit aus? Was versteht man unter der emotionalen Konditionierung? Wie kann man seine Primärkonstruktionen entdecken und eventuell verändern? Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitreaktionen? Welche Rolle spielen die Gene bei der Entwicklung einer Persönlichkeit? Inwiefern kommt die genetische und die individuelle Hirnentwicklung zum Tragen? Welchen Einfluss hat die Intelligenz auf die Ausformung einer Persönlichkeit? Warum macht Lernen intelligent und warum sind Begabungen zu fördern? Moralisieren und Predigen verändert den Menschen nicht, aber warum ist das so? Wie kann man „Resonanzfähigkeiten“ trainieren und wo liegen die Grenzen?