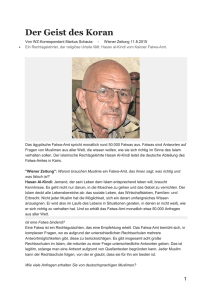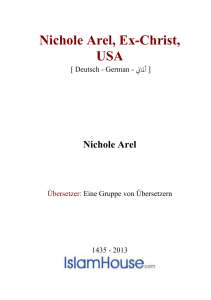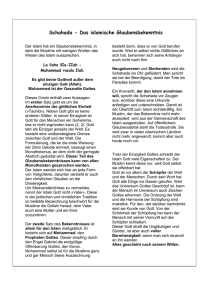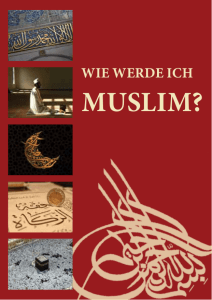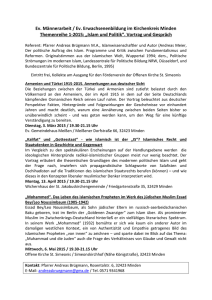Salmans Kopf - Schauspiel Stuttgart
Werbung

Salmans Kopf Brüder Presnjakow Hintergrundmaterial für den Unterricht Uraufführung > 22. September 2012 Spielzeit 2012/2013 1 Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Salman Rushdie steckt in einer Schreibblockade. Seine zum Liefern von szenischen Skizzen verdonnerte Familie hat wohl am meisten unter diesem Kreativitätsloch zu leiden. Als er selbst die Geschichte um Liza Minelli, einen unsichtbaren Hund und eine bethlehemisch anmutende Geburt in einer Flughafenhalle nur mit Zorn auf seine uninspirierte Famile quittiert, fasst diese einen Entschluss: Das Familienoberhaupt muss weg! Und dazu noch möglichst geldbringend. Die Lösung liegt klar auf der Hand: Salmans Kopf soll im Internet versteigert werden! Aber einen vermögenden Käufer zu finden, scheint schwieriger als gedacht... SALMANS KOPF ist eine Uraufführung des Autorenpaares Wladimir und Oleg Presnjakow. Die Brüder stammen aus Jekaterinenburg im Ural und sind spätestens seit ihrem Stück Terrorismus (Europäischer Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts 2003) auch im deutschsprachigen Theater bekannt. Mit SALMANS KOPF haben die Presnjakows eine schräge Komödie geschrieben, in der sie mit allen Mitteln des Theaters spielen. Sie machen dabei vor keinem Tabu Halt, »Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig« heißt es mit einem Augenzwinkern auf der Seite ihres Verlages. Gemeint sind Ähnlichkeiten mit dem indischbritischen Starautor Salman Rushdie, dessen Roman Die satanischen Verse den iranischen Staatschef Khmoeini 1989 dazu veranlasste, die Fatwa über ihn auszusprechen, weil er sich darin abschätzig gegenüber dem Islam und dem Propheten geäußert habe. Rushdie musste untertauchen und bekam vom britischen Staat dauerhaft Polizeischutz, was dem Erfolg seines Romans und weiterer Bücher keinen Abbruch tat. Wer Salman Rushdie bisher nur durch seine Kurzgeschichte Good Advice Is Rarer Than Rubies (Bestandteil der Pflichlektüre in Englisch) begegnet ist, soll hier die Möglichkeit erhalten, das dramatische Potenzial rund um den Autor zu entdecken. Wir wünschen eine spannende Auseinandersetzung mit diesem Material und ein anregendes Theatererlebnis! Daniela Urban Theaterpädagogik SCHAUSPIELSTUTTGART [email protected] FON > 0711.2032-234 FAX > 0711.2032-595 Silke Klose Schul- und Gruppenreferat SCHAUSPIELSTUTTGART [email protected] FON > 0711.2032-526 FAX > 0711.2032-595 2 INHALTSVERZEICHNIS SALMANS KOPF > Zur Inszenierung ..................................................................................................4 BRÜDER PRESNJAKOW > Die Autoren .........................................................................................5 SALMANS KOPF > Inhaltliche Zusammenfassung.............................................................................6 SALMANS KOPF > Realität und Fiktion .............................................................................................7 SALMAN RUSHDIE > Hintergründe – „Im Mauseloch der Angst“ ....................................... 8 HERE WE GO AGAIN > Excerpts from “From Fatwa to Jihad” by Kenan Malik ..................... 10 SALMAN RUSHDIE > Interview - „Vielleicht sind Sie weiser als ich“ .................................. 18 WHY THEY STILL DON’T HATE US > About the 'us' versus 'them' worldview................... 26 3 SALMANS KOPF > Zur Inszenierung Salman Rushdie hat ein Problem: Er steckt in einer Schreibblockade. Alle seine Themen erscheinen ihm ausgelutscht, nichtig und irrelevant. Am meisten, so scheint es, leidet seine Familie unter diesem Kreativitätsloch. Nicht genug, dass das Familienoberhaupt sie dazu missbraucht, ihm szenische Skizzen zu entwerfen, er weiß die Versuche nicht einmal zu würdigen. Im Gegenteil – selbst die Geschichte um Liza Minelli, einen unsichtbaren Hund und eine bethlehemisch anmutende Geburt in einer Flughafenhalle quittiert er mit Zorn auf seine scheinbar so uninspirierte Familie. Doch die hat seine dirigierende Art nun endgültig satt. Leider ist er als Ernährer trotzdem nicht verzichtbar. Doch wie kann man mit einem schreibblockierten, ehemaligen Promi-Autor noch Geld machen? Der Familie scheint die Lösung klar auf der Hand zu liegen: mit dem Nachklang seiner Berühmtheit. Salmans Kopf soll im Internet versteigert werden! Das muss doch Geld bringen. Fehlt nur noch ein Käufer, der bereit dazu ist, eine Million für Salman Rushdies Kopf hinzublättern und das erweist sich als schwieriger als gedacht... Besetzung: Salman Liza Sohn Boyfriend Teenager Nimrod Michail Natascha Sebastian Kowski Anna Windmüller Matthias Kelle Jan Jaroszek Fridolin Y. Sandmeyer Bijan Zamani Sebastian Röhrle Eléna Weiß Regie Bühne Kostüme Musik Dramaturgie Catja Baumann Jelena Nagorni Maike Storf Murat Parlak Katrin Spira Uraufführung 22. September 2012| NORD Regie > Catja Baumann Die Uraufführung der grotesken Farce SALMANS KOPF inszeniert Catja Baumann, die in den Spielzeiten 2010/2011 und 2011/2012 künstlerische Leiterin des NORD war. Am SCHAUSPIEL STUTTGART führte sie ebenfalls in LA LÍNEA, ROMEO UND JULIA, DIE DUNKLE UNERMESSLICHKEIT DES TODES und FRÜHLINGS ERWACHEN Regie. 4 BRÜDER PRESNJAKOW > Die Autoren Die Brüder Presnjakow kommen aus Jekaterinburg im Ural, sind beide promovierte Philologen und haben mehrere Jahre an der Universität ihrer Heimatstadt unterrichtet Oleg (Jahrgang 1969) Literaturwissenschaft, Wladimir (Jahrgang 1974) Psychologie. Sie haben noch während des Studiums ein kleines Theater gegründet, in dem sie sich als Autoren, Regisseure und Schauspieler ausprobieren konnten, seit Ende der neunziger Jahre schreiben sie zusammen Theaterstücke. Bereits ihre ersten Stücke fanden große Beachtung. EUROPA ASIEN (Deutsche Erstaufführung 26.11.2004 am Staatstheater Cottbus) wurde 2001 beim Moskauer Festival für junge Dramatik „Ljubimowk“ als bestes Stück ausgezeichnet. Den wirklichen Durchbruch erzielte das Autorenduo mit dem Stück TERRORISMUS, das in der Inszenierung von Starregisseur Kirill Serebrennikow am Moskauer Künstlertheater im November 2002 uraufgeführt wurde und seitdem auch international Erfolge feiert (mit Inszenierungen u.a. in London, Lissabon, Stockholm und einer Einladung zu den Wiener Festwochen 2004). Beim Heidelberger Stückemarkt 2003 erhielt TERRORISMUS (Deutsche Erstaufführung 16.4.2004 am Maxim Gorki Theater Berlin) den Europäischen Autorenpreis. Im August 2003 hatte ihr Stück OPFER VOM DIENST seine Uraufführung am Traverse Theatre in Edinburgh (Deutsche Erstaufführung 7.5.2004 am Hessischen Staatstheater Wiesbaden). Es folgten die Stücke FUSSBODENBELAG (Deutsche Erstaufführung 21.5.2005 am Theater Aachen), VOR DER SINTFLUT (Deutsche Erstaufführung 28.3.2008 am Staatstheater Stuttgart) und SALMANS KOPF (Uraufführung 22.09.2012 ebenfalls am Staatstheater Stuttgart). In Russland zählt das Autorenduo heute zu den bekanntesten Dramatikern ihrer Generation, ihre Stücke werden weiter mit großem Erfolg gespielt. Mit dem Roman TÖTET DEN SCHIEDSRICHTER (2007) gaben die Brüder ihr Prosadebüt. Die deutsche Hörspielfassung nach diesem Roman (Bearbeitung Gabi Bigott/Andrea Czesienski) wurde bereits mehrfach gesendet und mit Preisen geehrt. „Sie sind aufgetaucht wie Teufel aus der Tabakdose, haben genervt mit ihren Flüchen und ihrer spöttischen Haltung zur Geschichte und deren heiligen Kühen, mit ihrer Leidenschaft, „eine Realität zu erfinden“, in der das Alltägliche mit seinen riesigen Geschwüren erscheint.“ (Dina Goder, Die Wochenzeitung, 18. 12. 02) 5 SALMANS KOPF > Inhaltliche Zusammenfassung Salman ist Schriftsteller – nicht mehr jung, aber prominent. „Papa, du bist doch ein Dings, ein Kulturerbe“ schmeichelt ihm sein jüngster Sohn etwas unbeholfen und will den Vater damit endlich aus der Reserve locken. Salman hat nämlich ein echtes Problem: Er steckt in einer Schreibblockade. Alle Themen erscheinen ihm als schon dagewesen, nichtig oder irrelevant - er ist auf der Suche nach einer genialen Story, einem Clou, mit dem er noch einmal provozieren könnte, um damit vielleicht endlich den Nobelpreis abzuräumen. Dann, so erträumt er sich, wäre alles wie früher: „Leibwächter! Geld! Nutten! Hi de ho!“ Etwas verklärt blickt Salman auf die eigene Vergangenheit: Früher schaute die ganze Welt auf ihn, seine Bücher und sein Schicksal. Immerhin hatte er mit einem Roman den iranischen Staat so sehr provoziert, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde und er vom britischen Personenschutz bewacht - untertauchen musste. Doch all das ist wirklich lange her, kaum jemand interessiert sich mehr für Salman. Auf dem Spiel steht nun der lieb gewonnene und inzwischen unverzichtbare PromiLebensstandard. Denn ein Schriftsteller, der nichts schreibt, bringt kein Geld mehr nach Hause. Fast noch mehr als Salman selbst, leidet seine Familie unter seinem Kreativitätsloch. Nicht genug, dass das Familienoberhaupt sie dazu missbraucht, ihm szenische Skizzen zu entwerfen, er weiß die Versuche nicht einmal zu würdigen: „Habt ihr nicht ein Thema für mich, für das man heute verflucht werden kann?“ Nachdem auch der showreife Auftritt von Liza Minelli, ein unsichtbarer Hund und eine bethlehemisch anmutende Geburt in einer Flughafenhalle am Gate nach Israel von Salman nur mit Zorn auf seine uninspirierte Familie quittiert wird, hat diese seine dirigierende Art endgültig satt. Leider ist er als Ernährer trotzdem nicht verzichtbar. Doch wie kann man mit einem schreibblockierten, ehemaligen Promi-Autor noch Geld machen? Der Familie scheint die Lösung klar auf der Hand: Mit dem Nachklang seiner Berühmtheit. Salmans Kopf spuckt keine Ideen mehr aus, dann soll er im Internet versteigert werden! Das muss doch Geld bringen. Fehlt nur noch ein Käufer, der bereit dazu ist, dafür eine Million hin zu blättern. Aber wie kommt man ran, an Salmans Kopf? Klar, runter muss er. Irgendwie. Allerdings traut sich niemand in der Familie so richtig zu, selbst Hand anzulegen. Wenn schon keine moralischen Zweifel, dann doch wenigstens welche die eigenen Enthauptungskünste betreffend. Hier kommt Fleischer Nimrod ins Spiel, der nicht nur Schlacht-Erfahrung, sondern auch gleich mal die selbstkonstruierte Guillotine mitbringt. Bleibt nur noch ein Problem: Wie kommt der Kopf zum Käufer? Luftpost? Als „Wursttorte“ getarnt? Alles viel zu verdächtig! 6 „Dann muss der Käufer eben zum Kopf kommen!“, denkt sich der russische Oligarch Michail und schneit gleich mal bei den Rushdies rein. Der braucht nämlich dringend ein extravagantes Geburtstagsgeschenk für einen guten Freund und hält den Kopf des Starautors für eine adäquate Lösung. Da lässt er auch gerne ein Milliönchen springen. Es kommt also zum Showdown: Der zappelnde Salman wird unter die Guillotine geschnallt, die Familie samt Fleischer drapiert sich mit Partyhütchen und Luftschlangen drum herum und stimmt ein Ständchen an. Der dirigierende Oligarch filmt fleißig mit, schließlich soll das Enthauptungs-Video ja gleich via Smartphone ans Geburtstagskind gesendet werden. Die Guillotine wird betätigt, das Beil fällt und Salman schreit. Und schreit. Und schreit? Ist der Kopf nicht ab? War alles nur Show? Nur um die Genialität des Familienoberhaupts zu erwecken, so tief in die Trickkiste greifen? Für die Erleuchtung im Moment des Todes? Oder so ähnlich. Ob es wohl geklappt hat? SALMANS KOPF > Realität und Fiktion „Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.“ Gemeint sind Ähnlichkeiten mit dem indisch-britischen Starautor Salman Rushdie, dessen Roman „Die satanischen Verse“ den iranischen Staatschef Khomeini 1989 dazu veranlasste, die Fatwa über ihn auszusprechen, weil er sich abschätzig gegenüber dem Islam und dem Propheten geäußert habe. Rushdie musste untertauchen und bekam vom britischen Staat dauerhaft Polizeischutz, was dem Erfolg seines Romans und weiterer Bücher keinen Abbruch tat. Die Presnjakows haben Spaß daran, von der Geschichte Rushdies ausgehend den bewussten Tabubruch zu begehen, zu dekonstruieren und virtuos und überraschend mit einem Spiel im Spiel zu jonglieren. Die groteske Farce setzt auf hintergründigen Humor und arbeitet mit Zitaten der aktuellen Literatur-, Theater- und Filmwelt. Dabei werden Erwartungen aufgebaut, für einen Moment absolut ernsthaft erfüllt, um dann wieder gebrochen zu werden und neue Realitäten und Erwartungen zu erschaffen. Das jeweilige Spiel ist im Moment, in dem es stattfindet, immer absolut ernst zu nehmen ebenso wie die Codes, die es nennt. Ob Facebook oder Dante, Dostojewski oder Liza Minelli - alles erscheint gleich wichtig, beziehungsweise nimmt sich wichtig. So wird auch die Selbstreferentialität des Kulturbetriebs aufs Korn genommen und die Frage gestellt, was Kultur eigentlich wertvoll macht. 7 SALMAN RUSHDIE > Hintergründe - „Im Mauseloch der Angst“ Das Attentat auf den Zeichner Kurt Westergaard war nicht der erste Versuch, eine tödliche Fatwa zu vollstrecken. Im Fall von Salman Rushdie vor gut 20 Jahren war der Protest laut. Heute gehen westliche Dichter und Denker in Deckung, wenn es um den Schutz "religiöser Gefühle" geht. Im Jahr 1988 erschien Salman Rushdies Roman "Die Satanischen Verse" in der amerikanischen Originalausgabe. Worauf der iranische Staats- und Revolutionsführer, Ajatollah Chomeini, eine "Fatwa" gegen Rushdie erklärte und ein hohes Kopfgeld für dessen Ermordung auslobte. Es kam zu mehreren Anschlägen auf die Übersetzer und Verleger des Romans, wobei der japanische Übersetzer Hitoshi Igarashi ums Leben kam. Millionen von Muslimen in aller Welt, die das Buch nicht gelesen und den Namen Rushdie noch nie gehört hatten, wollten das Todesurteil gegen den Autor vollstreckt sehen, um mit seinem Blut die beschmutzte Ehre des Propheten wieder reinzuwaschen. In dieser Atmosphäre traute sich kein deutscher Verlag, Rushdies Buch zu publizieren. Worauf einige Schriftsteller, unter ihnen Günter Grass, die Initiative ergriffen, damit Rushdies Roman in Deutschland erscheinen konnte - in einem Verlag, der ausschließlich zu diesem Zweck gegründet wurde. Er hieß „ARTIKEL 19“ - wie der Paragraf der UnoDeklaration, der das Recht auf Meinungsfreiheit garantiert - und war ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem Dutzende von Verlagen, Organisationen und Einzelpersonen beteiligt waren, darunter Bertelsmann, Fischer, Hoffmann & Campe, Suhrkamp und Wagenbach, der Verband deutscher Schriftsteller und das PEN-Zentrum der Bundesrepublik, Norbert Blüm und Oskar Lafontaine, Hans Magnus Enzensberger und Klaus Staeck, Frank Schirrmacher und Roger Willemsen. Es war die breiteste Koalition, die je in der Bundesrepublik zustande gekommen war. 17 Jahre später, nachdem die dänische Tageszeitung "Jyllands-Posten" auf einer Seite ein Dutzend MohammedKarikaturen veröffentlicht hatte, kam es in der islamischen Welt zu ähnlichen Reaktionen: Millionen Muslime und Muslima zwischen London und Jakarta, die keine der Karikaturen gesehen oder auch nur den Namen der Zeitung je gehört hatten, demonstrierten gegen die Beleidigung des Propheten und verlangten die Bestrafung der Übeltäter: mit dem Tode. Osama bin Laden ging so weit, die Auslieferung der Zeichner zu verlangen, um sie von einem islamischen Gericht aburteilen zu lassen. 8 Doch anders als im Falle von Rushdie solidarisierte sich diesmal kaum jemand mit den bedrohten dänischen Karikaturisten. Im Gegenteil. Günter Grass, der die ARTIKEL-19Aktion angestoßen hatte, äußerte sein Verständnis für die verletzten Gefühle der Muslime und die daraus resultierenden gewalttätigen Reaktionen; diese seien, so Grass, eine "fundamentalistische Antwort auf eine fundamentalistische Tat", womit er eine Äquidistanz zwischen den zwölf Karikaturen und den Mordaufrufen auf die Karikaturisten herstellte. Bei der Gelegenheit wurde Grass auch grundsätzlich: "Wir haben das Recht verloren, unter dem Dach auf freie Meinungsäußerung Schutz zu suchen." Der damalige britische Innenminister Jack Straw nannte die Veröffentlichung der Karikaturen "unnötig, unsensibel, respektlos und falsch". Der "Vorwärts", das Organ der SPD, verteidigte die Meinungsfreiheit im Allgemeinen, meinte aber, in diesem speziellen Fall würden die Dänen die Freiheit "missbrauchen, nicht im rechtlichen, aber im politischen-moralischen Sinne". Fritz Kuhn, 1955 geboren, hatte ein Déjà-vu: "Mich haben sie (die Karikaturen) an die antijüdischen Zeichnungen in der Hitler-Zeit vor 1939 erinnert." Womit der damalige Fraktionschef der Grünen bewies, dass er entweder ein sensationelles pränatales Gedächtnis oder noch keine einzige antisemitische Karikatur aus dem "Stürmer" gesehen hat. Es war, als würden Blinde über Kunst, Taube über Musik und Eunuchen über Sex diskutieren - vom Hörensagen, denn abgesehen von "taz", "Welt" und "Zeit" waren alle deutschen Zeitungen und Magazine der Empfehlung von Claudia Roth gefolgt "Deeskalation beginnt zu Hause" - und hatten auf einen Abdruck der Karikaturen vorsorglich verzichtet. So wie es auch der Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter geraten hatte: "Der Westen sollte alle Provokationen unterlassen, die Gefühle von Erniedrigung und Demütigung hervorrufen...“ Wären die Mohammed-Karikaturen flächendeckend in der deutschen Presse nachgedruckt worden, hätten die Zeitungsleser sich selbst ein Bild machen können, wie exzessiv harmlos die zwölf Zeichnungen waren und wie bizarr und gegenstandslos die ganze Debatte, statt die Beurteilung "Experten" zu überlassen, die jede Kritik am Papst und der Kirche, jede blasphemische Kunstaktion im Namen der Meinungsfreiheit verteidigen, im Falle der Mohammed-Karikaturen allerdings plötzlich der Ansicht waren, man müsse auf religiöse Gefühle anderer Menschen Rücksicht nehmen. Das freilich war nur eine Ausrede, eine Art Mauseloch der Angst. Denn zwischen der Rushdie-Affäre und dem Karikaturen-Debakel war einiges passiert: 9/11, die Anschläge von London, Madrid, Bali, Jakarta, Djerba, die von manchen Kommentatoren ebenfalls als Ausdruck der Erniedrigung und Demütigung der islamischen Welt durch den Westen interpretiert wurden. Vor dieser Drohkulisse schien es vernünftiger und vor allem sicherer, "Respekt" vor religiösen Gefühlen zu bekunden als auf dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu bestehen. Und es waren nur wenige, die aus der Reihe tanzten, der britische Komiker Rowan Atkinson ("Mr. Bean") erklärte, "das Recht zu beleidigen" sei "sehr viel wichtiger, als das Recht, nicht beleidigt zu werden", die aus Somalia stammende und damals in Holland lebende säkulare Muslimin Ayaan Hirsi Ali schrieb ein Manifest, das mit den Worten begann: "I am here to defend the right to offend." 9 Aber das waren Ausnahmen. Sogar der damalige französische Präsident, Jacques Chirac, vergaß vorübergehend, dass er die "Grande Nation" vertritt, zu der auch Sartre, Voltaire und Victor Hugo gehören, und dekretierte, dass "alles, was den Glauben anderer, zumal den religiösen Glauben, beleidigen könnte, vermieden werden muss". So begann die geforderte "Deeskalation" nicht nur "zu Hause", sie endete auch vor der eigenen Haustür. Denn die andere Seite denkt nicht daran zu deeskalieren. Die Fatwa gegen Salman Rushdie ist immer noch in Kraft, der Mordanschlag gegen Kurt Westergaard war nicht der erste Versuch, ein Todesurteil zu vollstrecken, dem keine Straftat zugrunde liegt. Der Islam mag in der Theorie eine "Religion des Friedens" sein, die Praxis sieht anders aus. Mitten in Berlin lebt eine deutsch-türkische Rechtsanwältin, die vor kurzem abtauchen musste, weil sie mit Morddrohungen überzogen wurde, nachdem sie ein Buch veröffentlicht hatte. Es enthält keine einzige Mohammed-Karikatur, allein der Titel ist eine Provokation, die ans Eingemachte geht: "Der Islam braucht eine sexuelle Revolution". (Henryk M. Broder für Spiegel Online, 02.01.2010) HERE WE GO AGAIN > Excerpts from “From Fatwa to Jihad” by Kenan Malik One thing should be clear. The violence across the Muslim world in response to an American anti-Islamic film has nothing to do with that film. Yes, The Innocence of Muslims is a risibly crude diatribe against Islam. But this obscure film that barely anyone had seen till last week is no more the source of the current violence than God is the source of the Qur’an. The details of the rioting in Benghazi that killed the US ambassador and sparked the current crisis still remain unclear. What is clear, however, is that the violence is being driven less by religious fury than by political calculation. In Libya, Egypt and elsewhere, the crisis is being fostered by hardline Islamists in an attempt to seize the political initiative in a period of transition and turmoil. The film is almost incidental to this process. The real struggle is not between Muslims and non-Muslims, but between different shades of Islamists, between hardline factions and more mainstream ones. The insurrections that transformed much the Arab world over the past year have created a new terrain for the battle between Muslim factions for political supremacy. But the struggle itself is nothing new. The same tensions fuelled the confrontations over The Satanic Verses and the Danish cartoons. I have long argued that both were primarily political rather than religious conflicts. I am publishing here two edited extracts from my book From Fatwa to Jihad: The Rushdie Affair and its Legacy which describes the development of both conflicts. 10 FROM THE BAN TO THE BOOK BURNING TO THE FATWA (From Fatwa to Jihad, pp1-7, 17-19) On 5 October, barely a week after it had been published in Britain, the Indian Ministry of Finance placed The Satanic Verses on its list of proscribed books. The ban, the ministry proclaimed, ‘did not detract from the literary and artistic merit of Rushdie’s work.’ To which Rushdie sardonically replied, ‘Thanks for the good review’ – while also wondering what the world might make of the fact ‘that it is the Finance Ministry that gets to decide what Indian readers may or may not read.’ The ministry was acting on orders from Prime Minister Gandhi who had been alerted to the issue by MP Syed Shahabuddin, a member of the opposition Janata Party, and a self-proclaimed champion of India’s 150-million strong Muslim community. ‘The very title’ of Rushdie’s book, Shahabuddin complained in an article in The Times of India, was ‘suggestively derogatory’… Like virtually all of Rushdie’s opponents, Shahabuddin had not actually read The Satanic Verses. ‘I do not have to wade through a filthy drain to know what filth is’, he retorted. He had been alerted to the novel’s significance by Jamaat-i-Islami activists. Jamaat-i-Islami is an Islamist organisation founded in India in 1941 by Sayyid Abu’l Ala Maududi, one of the heroes of the modern jihadist movement. Rushdie had already taken aim at the Jamaat in his previous novel, Shame. Its response was the campaign against The Satanic Verses. It organised protests and petitioned Indian MPs. With a general election due in November, the result of which was too close to call, no politician was willing to alienate an important Islamic organisation. A ban on The Satanic Verses was inevitable, whether or not anyone had read the book, and whatever its ‘literary and artistic merit’. The Jamaat had a network of organisations in Britain, funded by the Saudi government… The Saudis encouraged a number of Jamaat-influenced organisations in Britain to set up the UK Action Committee on Islamic Affairs (UKACIA) to co-ordinate the campaign against what one UKACIA circular described as ‘the most offensive, filthy and abusive book ever written by any hostile enemy of Islam’. But however overwrought the language, the Jamaati and the Saudis wanted to keep the anti-Rushdie campaign low-key. The Saudis’ style was that of backroom manoeuvrings rather than street protests. They hoped that a combination of diplomatic pressure and financial muscle could suppress The Satanic Verses, just as it had managed to ensure that Death of a Princess, a 1980 TV documentary hostile to the Saudis, was never reshown on British TV. This time the campaign had little success. Penguin refused to withdraw the book and the British government refused to ban it. 11 Even Muslim states seemed barely interested. Few responded to the Saudi campaign or banned the novel. In November Pakistan and South Africa followed India’s lead in proscribing the book and soon after Saudi Arabia, Egypt, Bangladesh, Malaysia and Sudan did so too. But in the majority of Muslim countries, including virtually all Arab states, The Satanic Verses continued to be freely available, even after the Organization of Islamic Conference had, in November, called for a ban. In December – almost three months after the publication of the novel – came the first major street protest in Britain. Seven thousand Muslims marched through Bolton… The demonstration was organised not by the Jamaati but by a rival Islamic faction, the Deobandis. The Jamaati possessed money and political influence, thanks to the Saudi connection, but little support on the ground. The majority of British Muslims were Barelwis, a Sufi-influenced tradition founded in India by Ahmad Raza Khan. Most mosques were run by the Deobandis, another movement founded in nineteenth century British India, with the aim of cleansing Islam and which placed particular stress on Qur’anic study and law… Conflict between the Jamaatis, the Barelwis and the Deobandis was a feature of British Islam, and helped fuel the Rushdie controversy. The Bolton protest was an impressive call to arms. Almost 7000 protestors from across Britain marched through a town with a total Muslim population of around 10,000. As in Bradford, they carried a copy of The Satanic Verses that they torched – the first time The Satanic Verses had been burnt in anger in Britain. Yet, almost no one took any notice. Whatever the grievances of British Muslims about The Satanic Verses, these had not yet registered on the national radar. The Bradford protest the following month was different, partly because Bradford itself was different… By the 1980s, this small northern town had become the heartbeat of Britain’s Muslim communities. The creation of the Bradford Council of Mosques in 1981, and the close relationship between the mosques – around half of which were controlled by the Deobandis – and Bradford City Council, had provided the town’s imams with considerable political clout. Bradford’s heart also beat strongly to a secular pulse. […] The demonstrators videoed the protest and despatched the images to media outlets across the world. The flames that incinerated The Satanic Verses were fanned into an international controversy. In response to the Deobandi demonstrations the Jamaati organised its own street protests – not in Britain but in Pakistan. Pakistan had already banned the novel. But the Islamic Democratic Alliance, of which the Jamaat-i-Islami was an influential part, had recently lost an election to Benazir Bhutto’s Pakistan People’s Party. ‘Was the agitation really against the book which has not been read in Pakistan, is not for sale in Pakistan’, Bhutto wondered, or ‘was it a protest by those people who lost the election… to try and destabilize the process of democracy?’ 12 The Jamaati organised an anti-Rushdie demonstration on 12 February, targeting neither the British embassy nor the offices of Penguin books, but the American Cultural Centre in Islamabad. An angry Jamaati-led mob, 2000-strong according to some reports, 10,000strong according to others, tried to storm the Centre shouting ‘Allahu Akhbar’ and ‘American Dogs’. They pulled down the Stars and Stripes flying on top of the building and burnt it, along with an effigy of Salman Rushdie. Eyewitness described the police repeatedly firing into the crowd with semi-automatic rifles and pump-action shotguns. By the end of the day at least five people had been killed and more than a hundred injured – the first fatalities of the Rushdie affair. Yet even now fury about The Satanic Verses appeared confined largely to Muslims in the Indian subcontinent and in Britain. Critics of Rushdie have insistently argued that the blasphemies in his novel caused mortal offence to all Muslims. ‘The life of the Prophet Mohammad’, the liberal Muslim writer Ziauddin Sardar has observed, ‘is the source of Muslim identity.’ Because ‘the Prophet and his personality define Islam’, so every Muslim relates to him directly and personally.’ That is why Sardar had ‘felt that every word, every jibe, every obscenity in The Satanic Verses was directed at me – personally.’ Every Muslim would have felt the same, Sardar insisted. ‘Just as people threatened with physical genocide react to defend themselves, Muslims en masse would protest against this annihilation of their cultural identity.’ Leaving aside the question of whether the blasphemies in The Satanic Verses are really more offensive than, say, the attempt to compare the publication of a novel with the Final Solution, Sardar’s claim that all Muslims would see such blasphemies as the ‘annihilation of their cultural identity’ was not borne out by events. The novel had little impact on Muslims in other European countries. There was barely a squeak of protest in either country when the novel was published there. In America there was an organised letter campaign aimed at Viking Penguin, and bomb threats against its offices, but no mass protests as in Britain, India or Pakistan. Arabs and Turks, too, seemed as unmoved by Rushdie’s blasphemies as did their European and American brethren. Even within the Islamic Republic of Iran there appeared to be little concern. Unlike the governments of India, Pakistan, Saudi Arabia and South Africa, Teheran’s revolutionary mullahs had felt no need to ban the book. In December 1988, Kayhan Farangi, a leading Iranian literary journal, published a review. The Satanic Verses, it suggested, ‘contains a number of false interpretations about Islam and gives wrong portrayals of the Qur’an and the Prophet Muhammad. It also draws a caricature-like and distorted image of Islamic principles which lacks even the slightest artistic credentials.’ Though highly critical of the novel, there was no intimation that the ‘distorted images’ amounted to blasphemy or that Rushdie’s ‘moral degradation’ constituted apostasy. Nor was there any suggestion that The Satanic Verses was, as the Jamaati-inspired UK Action Committee had put it, ‘the most offensive, filthy and abusive book ever written by any hostile enemy of Islam’. Kayhan Farangi acknowledged Rushdie’s insistence ‘that his book is nothing more than a work of imagination which tries to investigate the birth of a major religion from the point of view of a secular individual.’ It acknowledged, too, Rushdie’s fear that the campaign against the novel in the subcontinent was driven by politics rather than theology. 13 […] The fatwa transformed the Rushdie affair from a dispute largely confined to Britain and the subcontinent (albeit with considerable Saudi involvement) into a global conflict with historic repercussions, from a quarrel about blasphemy and free speech into a matter of terror and geopolitics. According to one story, the Ayatollah Khomeini was watching the evening news on TV when he saw the Islamabad demonstrations and the killing of the protestors. So moved was he by the deaths that he immediately called for his secretary and dictated the fatwa. In reality, the fatwa was less an emotional response to the Islamabad killings than a political tactic to respond to inter-Islamic strife both inside and outside Iran… The 1979 revolution, which had overthrown the Shah and established an Islamic republic, had made Tehran the capital of Muslim radicalism, and Ayatollah Khomeini its spiritual leader. Yet Tehran’s attempts, in the following decade, to broaden the Islamic revolution had made little headway. It had failed to destabilise the deeply conservative Saudi regime or to loosen the Saudi grip on the direction of Islam worldwide. It had also been forced, in 1988, to abandon ingloriously its bitter and bloody eightyear war against Iraq, and with it its hopes of bringing down Saddam Hussein… Inside Iran, Khomeini was facing increased opposition from reformers such as the speaker of the parliament, Ali Hashemi Rafsanjani, who had condemned the ‘shortsightedness’ of Iranian foreign policy for ‘making enemies without reason’ and was pushing for improved relations with the West. The fatwa turned the tables on Khomeini’s Islamic enemies. His bold action seemed to contrast with the spinelessness of the Saudis and allowed him to appeal over the heads of his opponents to the disappointed and deprived multitudes, offering them a new moral and religious struggle to restore their pride. Today Inayat Bunglawala is a prominent British Muslim leader. In 1989 he was a student at London’s Queen Mary College. He was distressed by The Satanic Verses and frustrated by the Saudi campaign that ‘did not seem to be getting anywhere’. Then came the fatwa. ‘I felt a thrill’, he remembers. ‘It was incredibly uplifting. The fatwa meant that as British Muslims we did not have to regard ourselves just as a small, vulnerable minority; we were part of a truly global and powerful movement. After the fatwa we could say, “If we are not treated with respect, then we have friends capable of forcing you to respect us”.’ The fatwa sowed confusion and division among supporters of the Saudi regime. A number of militants who had taken part in the Afghan jihad against the Soviet Union and who had been within Riyadh’s orbit now pledged allegiance to Teheran – among them the Egyptian Sheik Omar Abdel Rahman, who is currently serving a life sentence in America for planning to bomb the World Trade Centre in New York in 1993. Inside Iran, the fatwa stopped in its tracks attempts to improve relations with the West. The reformers were forced to denounce Rushdie, Rafsanjani describing the publication of The Satanic Verses as ‘an organized and planned’ plot involving the intelligence services of Britain, France, Germany, the United States – and certain ‘Zionist publishers’. 14 The fatwa helped transform the very geography of Islam. Under traditional Islamic law, no fatwa could be valid outside those areas in which sharia law applied. Muslims may have emigrated to Britain or converted in India, but a fatwa could have no validity there because these states were not under Islamic authority. With his four-paragraph pronouncement, the Ayatollah had transcended the traditional frontiers of Islam and placed the whole world under his jurisdiction. At the same time he helped relocate the confrontation between the Islam and the West, which until then had been played out largely to the Middle East and South Asia, into the heart of Western Europe. For the West, Islam was now a domestic issue. HOW THE DANISH CARTOONS LAUNCHED A GLOBAL CONTROVERSY (From Fatwa to Jihad, pp142-145, 147-149) In 2005 Kåre Bluitgen was writing a children’s book on Islam, The Qur’an and the Life of the Prophet Mohammed, which he hoped would bring greater understanding of the religion to a new generation of Danes. He looked for an illustrator. The first three he approached refused to take on the job, the fourth would do so only on condition of anonymity. All were worried that they would end up like Theo van Gogh, the Dutch film-maker ritually murdered on the streets of Amsterdam by a Muslim incensed by his anti-Islamic films. Many Muslims, they reminded Bluitgen, considered it blasphemous to portray Mohammed in the flesh… The leftwing newspaper Politiken ran a story about Bluitgen’s fruitless search, under the headline ‘Dyb angst for kritik af islam’ (‘Profound anxiety about criticism of Islam’). In response, Flemming Rose, the culture editor of Politiken’s rightwing rival Jyllands-Posten, asked the nation’s most renowned cartoonists to draw pictures of Mohammed. Rose said he wanted to see ‘how deep this self-censorship lies in the Danish public’. He approached forty cartoonists, 12 of whom accepted the challenge. Their caricatures were published in Jyllands-Posten on 30 September 2005, under the headline ‘Muhammeds ansigt’ (‘The face of Muhammed’). The most controversial of the cartoons showed the Prophet wearing a turban in the form of a bomb. In another, dumbfounded suicide bombers are turned away from the gates of paradise with the words, ‘Stop. Stop. We have run out of virgins.’ ‘The modern secular society’, Rose wrote in a commentary to the cartoons, ‘is rejected by some Muslims. They demand a special position, insisting on special consideration of their own religious feelings. It is incompatible with contemporary democracy and freedom of speech, where you must be ready to put up with insults, mockery and ridicule.’ That is why, he added, ‘Jyllands-Posten has invited members of the Danish editorial cartoonists union to draw Mohammed as they see him.’ And so began the infamous Danish cartoons controversy. Except that it didn’t – at least not straight away. The publication of the cartoons caused no immediate reactions, even in Denmark. About a week later, not having created the furore they had hoped for, journalists contacted a number of imams for their response. The cartoons had simply not registered with Muslim leaders, but once the journalists had pointed them out, they quickly recognised the opportunity provided not just by the caricatures themselves but also by the sensitivity of Danish journalists and politicians to their publication. 15 Among the first contacted was Ahmed Abu Laban, infamous for his controversial views on Osama bin Laden (whom he called a ‘businessman and freedom fighter’) and 9/11 (‘I mourn dry tears for the victims’, was Laban’s response). Described by the Danish press as a ‘spiritual leader’, he was in fact a mechanical engineer by trade, and an Islamist by inclination. Having been expelled from both Egypt and the United Arab Emirates because of his Islamist views, he had sought refuge in Denmark in 1984. There he became leader of the Islamic Society of Denmark, an organisation closely linked to the Muslim Brotherhood. […] Abu Laban seized upon the cartoons to transform himself into a spokesman for Denmark’s 180,000 Muslims, demanding an apology not just from the newspaper but from the Danish Prime Minister, too, and organising a demonstration outside the offices of Jyllands-Posten. Yet however hard the imams pushed, they could not provoke major outrage either in Denmark or abroad. Three days after the Copenhagen demonstration, the Egyptian newspaper Al Fagr republished the cartoons. It was accompanied by a critical commentary, but the newspaper made no attempt to blank out Mohammed’s face. (When the British liberal magazine Prospect republished one of the cartoons to illustrate an essay I had written about the affair, the Prophet’s face was left blank, so as not to cause offence.) Neither the Egyptian government nor the country’s religious authorities raised any objections to Al Fagr’s full-frontal photos. In the very week in which Al Fagr had republished the cartoons without official censure, the Egyptian ambassador to Denmark joined nine other Muslim diplomats to request a meeting with the Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen, and to demand that he distance himself from the caricatures. Rasmussen refused to meet the ambassadors, claiming that to do so would infringe the freedom of the press. At the beginning of December 2005, the Organisation of Islamic Conference (OIC) held a summit in Mecca. A group of Danish imams compiled a forty-page dossier about the cartoons to circulate to the delegates. The dossier consisted of the original 12 cartoons, pictures from another Danish newspaper, Weekendavisen, that were ‘even more offending’ (they were in fact parodies of the pompousness of the Jyllands-Posten caricatures), hate-mail sent to Danish Muslims, and letters from Muslim organisations explaining the case for censorship. Also in the dossier were three other pictures that had nothing to do with Jyllands-Posten but at least one of which was reported on the BBC as having been published in the Danish paper. It showed a man with a pig mask, and was widely taken to be an offensive depiction of Muhammed himself. In fact it was a photo taken at a traditional pig-squealing contest in France; there was no connection to Islam. The imams later claimed that it had been sent to Muslims taking part in an online debate about the cartoons and was included as an illustration of the ‘Islamaphobia’ under which Danish Muslims lived. The OIC summit condemned the cartoons and demanded that the United Nations take action against Denmark. Two weeks later a second delegation of Danish imams toured various Middle Eastern, Near Eastern and North African countries. At the end of January, Saudi Arabia recalled its ambassador from Denmark and launched a consumer boycott of Danish goods. In response a swathe of European newspapers – including France Soir, Germany’s Die Welt, Die Zeit, Tagesspiegel and Berliner Zeitung, Italy’s La Stampa, El Periodico in Spain and the Dutch paper Volkskrant – republished the cartoons in ‘solidarity’ with Jyllands-Posten. 16 It was only now – more than four months after the cartoons had been originally published, more than four months of effort to create a controversy – that the issue became more than a minor diplomatic kerfuffle. The republication of the cartoons sparked off protests in India, Pakistan, Indonesia, Egypt, Libya, Syria, Iran, Nigeria, Palestine, Afghanistan and elsewhere, leaving more than 250 dead, many killed when police fired into crowds. At least a hundred died as Muslim and Christian mobs clashed in Nigeria. Danish embassies in Damascus, Beirut and Teheran were torched… Like the Rushdie affair, the controversy over the Danish cartoons was driven not by theology but by politics. The Islamic art historian (and member of the Jordanian royal family) Wijdan Ali has shown that, far from Islam having always forbidden representations of the Prophet, it was perfectly common to portray him until comparatively recently. The prohibition against such depictions only emerged in the 17th century. Even over the past 400 years, a number of Islamic, especially Shiite, traditions have accepted the pictorial representation of Muhammed. The Edinburgh University Library in Scotland, the Bibliotheque National in Paris, New York’s Metropolitan Museum of Art and the Topkapi Palace Museum, Istanbul, all contain dozens of Persian, Ottoman and Afghan manuscripts depicting the Prophet. A 17th-century mural on the Iman Zahdah Chah Zaid Mosque in Isfahan in Iran shows a veiled figure of Mohammed; through the veil, his facial features are clearly visible. Even today, few Muslims have a problem in seeing the Prophet’s face. The Iranian newspaper Hamshahri, which, in response to the Jyllands-Posten caricatures, launched a competition for cartoons about the Holocaust ran, at the very time it was campaigning against the Danish cartoons, a photo of a mural from a contemporary Iranian building that depicted Mohammed on his Night Voyage. When Al Fagr republished the cartoons, it did not think it necessary to blank out Muhammed’s face, and faced no opprobrium for not doing so. The paper might have been critical of Jyllands-Posten but it certainly was not obsessed with the idea that the Prophet must remain unseen – and neither were Egypt’s religious and political authorities. It took several months of dedicated, and often hysterical, campaigning to generate an international storm. Pandaemonium | September 14, 2012 by Kenan Malik 17 SALMAN RUSHDIE > Interview - „Vielleicht sind Sie weiser als ich“ „ich bin die summe all dessen, was vor mir geschah, all dessen, was unter meinen augen getan wurde, all dessen, was mir angetan wurde. ich bin jeder mensch und jedes ding, dessen dasein das meine beeinflusste oder von meinem beeinflusst wurde. ich bin alles, was geschieht, nachdem ich nicht mehr bin, und was nicht geschähe, wenn ich nicht gekommen wäre“ > Salman Rushdie Herr Rushdie, Sie sind der berühmteste lebende Schriftsteller der Welt. Nein, nur mein Name ist berühmt, weil er mit gewissen Ereignissen in Verbindung gebracht wird, und jeder glaubt, mich zu kennen, auch wenn er kein einziges Buch von mir gelesen hat. Schmeichelt Ihnen das? Im Gegenteil! Es ist, als wäre etwas berühmt, das ich nicht bin. In den Jahren, als ich unter der Todesdrohung der Fatwa lebte, kam es mir vor, als schrieben andere meine Lebensgeschichte. Jeder Taxifahrer hatte eine Meinung über mich. Es gab Tausende Stimmen, gegen die ich nicht ankam mit meiner Stimme. Wie ist es heute? Es kommt immer noch vor, dass ich, wenn ich einen Raum voller Menschen betrete, die ich zuvor nie getroffen habe, in den Gesichtern lesen kann, dass alle von mir eine Vorstellung haben, die nichts zu tun hat mit dem, der ich tatsächlich bin. Ich muss dann zuerst den Salman Rushdie, für den sie mich halten, wegwischen, damit sie begreifen, wer tatsächlich vor ihnen steht. Aber so geht es doch jedem Star. Das stimmt. Aber in meinem Fall kam etwas Ärgerliches hinzu, nämlich die Frage, ob ich ein guter Mensch sei oder ein schlechter. Es gab lange Zeit eine Menge Leute – ich meine nicht Muslime –, die mir extrem feindselig gegenüberstanden. Man gab Ihnen die Schuld an Ihrem Unglück. Man sagte, Sie hätten mit Ihrem Roman „Die satanischen Verse“ das, was Ihnen danach widerfuhr, selbst heraufbeschworen. Ja, und das passiert einer Madonna zum Beispiel nicht. Über die wird viel Klatsch geschrieben, harmloses Geschwätz. Damit könnte ich umgehen. Aber in meinem Fall war es anders. Ich wurde nicht als normale Berühmtheit behandelt, sondern einerseits idealisiert, andererseits als eine Art Dämon verdammt. Weder das eine noch das andere entsprach der Person, als die ich mich fühlte. Sie sind zu einem Symbol für etwas geworden, das Samuel Huntington den „Kampf der Kulturen“ nannte. Ja, aber das langweilt mich. Sie werden sich damit abfinden müssen, so wie sich Marilyn Monroe mit ihrem Image als Sexsymbol abfinden musste. Ich wäre lieber ein Sexsymbol. 18 Nun waren Sie im Zusammenhang mit dem Streit um die dänischen Karikaturen wieder in aller Munde. Kaum ein Bericht verzichtete auf den Vergleich Ihres Falls mit dem der bedrohten Karikaturisten. Das ist legitim. Aber es wird sich legen. Der Streit um diese Zeichnungen ist eine Posse. In Zukunft wird man sich, wenn wieder so etwas passiert, sowohl an die Karikaturen als auch an mich erinnern. Also bin ich nicht mehr der Einzige. Fanden Sie die Zeichnungen gelungen? Die meisten nicht. Wäre ich der verantwortliche Redaktor gewesen, hätte ich nur eine veröffentlicht, die ganz lustig ist, nämlich die, wo Mohammed zu den Selbstmordattentätern sagt, sie sollten aufhören zu töten, die als Belohnung versprochenen Jungfrauen im Paradies seien ausgegangen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Von denen, die auf die Straße gingen, haben die meisten die Karikaturen gar nicht gesehen, sondern wurden instruiert, sich beleidigt zu fühlen. Es ging nicht um Religion, sondern um Macht. Warum haben Sie, obwohl Sie betonen, dass Sie ausschließlich Ihrer Literatur wegen geschätzt werden wollen, im März ein Manifest unterschrieben, das Sie erneut in die Schlagzeilen brachte? Da ging es um mehr, nämlich um den Protest gegen eine totalitäre Ideologie, die sich einer religiösen Sprache bedient. Wir, die Unterzeichner, teilen die Sorge, dass die westlichen Antworten auf dieses Phänomen zu beschwichtigend ausfallen. Hätte ich das nicht unterschrieben, hätte ich mich als Feigling gefühlt. Das Merkwürdige ist, dass jetzt sogar viele islamische Führer finden, es sei ein Fehler gewesen, wie man mit mir nach den „Satanischen Versen“ verfuhr, ein taktischer Fehler, weil es nicht funktionierte. Ein Mullah sagte, hätte man Sie damals getötet, hätte es nie diese Karikaturen gegeben. Ja, man darf sich diesen Leuten gegenüber nicht versöhnlich verhalten, weil sie sich dadurch ermutigt fühlen. Obwohl die Regierung des Iran 1998 die Fatwa gegen Sie für beendet erklärte, wird sie jedes Jahr von islamischen Geistlichen wiederholt. Das bedeutet nichts. Es ist ein Ritual. Fakt ist, dass das seit acht Jahren keine Auswirkungen mehr auf mein Leben hat. Unlängst fand in Teheran ein sogenannter Kongress der Selbstmordattentäter statt, wo gelehrt wurde, wie man solche Attentate begeht. Ich weiß. Eine Studentin sagte in einem Interview, eines der Ziele sei die Ermordung des Schriftstellers Salman Rushdie. Ich kenne das Zitat. Aber das ist nur noch Rhetorik, also kein wirkliches Mordkonzept, sondern Teil eines Todeskults. Den Leuten dort wird gesagt, das Leben sei unwichtig, interessant werde es erst nach dem Tod. Der radikale Islam hat sich in eine Kirche des Todes verwandelt. Der Wahlspruch lautet: «Wer das Leben mehr liebt als den Tod, ist unser Feind.» Genau. Das ist die scheußlichste Philosophie, die man sich vorstellen kann. 19 Die Attentäter werden indoktriniert. Ja, aber das entschuldigt sie nicht. Man sagt ihnen, das Paradies ist das Ziel, die Welt ist ein Jammertal. Aber letztlich liegt die Entscheidung bei ihnen. Jeder Mensch ist selbst verantwortlich für seine Taten. Auch wenn er arm und ungebildet ist? Ja. Denn nicht Armut und Unwissenheit führen zu Unmoral. Sonst wäre die Welt voller Teufel. Sie können es in Indien sehen, wo vor allem die Armen aus den Dörfern gegen Ungerechtigkeit und Korruption votieren. Moralische Integrität hängt nicht vom Bildungsstand ab. Die meisten Terroristen kommen aus der gebildeten Mittelschicht. Ist Ihre Wohnadresse noch immer geheim? Nein. Ich habe zwar noch gelegentlich Kontakt zum britischen Geheimdienst, also die haben das nicht vergessen. Aber ich bewege mich frei und kann tun, was ich will. In New York fahre ich jeden Tag mit der UBahn, weil man so schwer ein Taxi findet. Trotzdem ist bis heute ein Kopfgeld auf Ihre Beseitigung ausgesetzt. Gut, aber erstens ist das Geld nicht vorhanden, und zweitens könnte der Mörder das gar nicht kassieren. Denn wohin soll er gehen, nachdem er mich umgebracht hat? Würde ich Sie jetzt erschießen, könnte ich nicht entkommen, klar. Man würde Sie verhaften. Der Mordaufruf war nur so lange gefährlich, solange er vom iranischen Staat ausging. Es wird eine Menge Lärm gemacht, aber in der Mitte des Lärms steht ein kleiner Chihuahua und bellt in ein Megafon. Die Fatwa an sich war nie die Gefahr, sondern die Tatsache, dass die iranische Regierung den Mord befahl. Die Briten haben mich nicht deshalb beschützt, weil manche Muslime nicht mochten, was ich geschrieben hatte, sondern weil ich britischer Staatsbürger bin und weil der Mordauftrag ein staatlicher Angriff auf die Souveränität Großbritanniens war. Die meisten Muslime, sagten Sie, hatten gar kein Problem mit Ihrem Buch. Ja, das können Sie bei meinen Lesungen sehen. Meine größten Fans sind Muslime, zumindest haben sie muslimische Namen. Ob sie strenggläubig sind, weiß ich nicht. Ich habe auch einen muslimischen Namen und bin trotzdem nicht religiös. [...] Wissen Sie, wie Sie sich unter dem Naziregime verhalten hätten? Ich hoffe, ich weiß es. Aber ich denke über diese Frage nicht nach. Einer der wertvollsten Ratschläge, die ich, als ich in Cambridge Geschichte studierte, von einem Professor bekam, war, dass die Frage „Was wäre, wenn?“ sinnlos ist. Es ist schwer genug, mit den Problemen, denen wir tatsächlich gegenüberstehen, fertig zu werden. Die Frage, wie ich mich als Deutscher unter den Nazis verhalten hätte, ist eine unnütze Frage. Denn ich bin kein Deutscher, und ich lebe jetzt. Wenn Sie mich vor 1989 gefragt hätten, wie ich mit der Todesgefahr, in die ich dann geriet, umgehen würde, wäre die Antwort nicht optimistisch ausgefallen. Als die Fatwa über Sie verhängt wurde, sagten Sie, Sie fühlten sich als toter Mann. Ich hätte nicht darauf gewettet, das unbeschädigt zu überstehen. 20 Zwei Jahre später, in einem Interview für den Guardian, entschuldigten Sie sich für Ihr Buch und erklärten, Sie seien zum Islam zurückgekehrt. Das war ein Fehler. Mehr will ich darüber jetzt nicht mehr sagen. Sie müssen nicht. Es gab damals starken politischen Druck von allen Seiten. Die britische Regierung und viele andere meinten, ich sollte etwas tun, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Jeder hatte eine Antwort, wie ich mich verhalten sollte. Ich möchte den Menschen sehen, der in so einer Situation keinen Fehler macht. Wenn man Ihren Roman „Die satanischen Verse“ heute liest, kommt es einem vor, als hätten Sie Ihr Schicksal vorausgesehen. Es gibt vielleicht Stellen, die diesen Eindruck erwecken. Im Nachhinein ist man immer klüger. Über seinen ungefügigen Schreiber Salman verhängt Mohammed, der im Buch Mahound heißt, das Todesurteil. Ja, es gibt Passagen... „Deine Gotteslästerung, Salman“, sagt Mahound, „wird dir nicht vergeben.“ Ich stimme Ihnen zu, dass es heute so aussehen könnte, als hätte ich vorausgesehen, was dann geschah. Aber ich habe es nicht vorausgesehen. Vielleicht war das naiv. Vielleicht. Ich habe, bevor der Roman erschien, das Manuskript zwei, drei Freunden gezeigt, die fanden, dass es darin einige riskante Passagen gab. Wir diskutierten darüber und kamen zu dem Schluss, dass ich sie nicht herausnehmen sollte. Denn wenn man als Schriftsteller nicht ohne Angst schreiben kann, sollte man gar nicht schreiben. Ich habe eine sehr hohe Auffassung von Literatur und von Kunst. Sie ist das Höchste, das Menschen hervorbringen können, und man kann dieser Berufung nur gerecht werden, wenn man den Mut und die Frechheit hat, sich nicht selbst zu zensieren. [...] Die Fundamentalisten sagen, durch die Gotteslästerung werden ihre Seelen getötet. Ich habe niemandes Seele getötet. Botho Strauss, der deutsche Schriftsteller... ...Ich kenne ihn... ...meint, die Verletzung sakraler Gefühle sollte ebenso strafbar sein wie die Verletzung der persönlichen Ehre. Was heißt das? Hier muss man genau unterscheiden zwischen einer Meinungsäußerung und einer Verleumdung. In freien Gesellschaften ist es mein gutes Recht, meine Meinung über eine Religion oder eine Person zu äußern. Wenn ich sage, Sie sind ein Idiot, müssen Sie das ertragen. Wenn ich aber sage, Sie sind ein Mörder, obwohl Sie keiner sind, können Sie gegen mich strafrechtlich vorgehen. Es gab in England einen berühmten Fall, da hatte eine Zeitung über die Schauspielerin Charlotte Cornwell, die Schwester des Schriftstellers John le Carré, geschrieben, sie habe einen großen Arsch. Sie klagte gegen die Zeitung, und sie verlor. Denn über die Größe eines Arsches kann es verschiedene Ansichten geben. Haben Sie gelesen, was Ihr Freund Günter Grass zum Karikaturenstreit sagte? Nein. 21 Er fühlte sich an antisemitische Zeichnungen in dem nationalsozialistischen Hetzblatt „Der Stürmer“ erinnert und nannte die Karikaturen eine „bewusste und geplante Provokation einer rechten dänischen Zeitung“. Die islamischen Proteste seien eine „fundamentalistische Antwort auf eine fundamentalistische Tat“. Darin stimme ich nicht mit ihm überein, denn die politische Ausrichtung der Zeitung ist in diesem Fall ohne Bedeutung. Es ist eine rechte Zeitung, ja, und vielleicht wurden die Karikaturen tatsächlich veröffentlicht, um die Muslime zu ärgern. Aber es ist eine Sache, jemanden zu ärgern, und eine andere, Bomben zu werfen. Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit... Ja, aber... Bitte lassen Sie mich meinen Gedanken zu Ende führen. Wer wird hier interviewt? Sie oder ich? Sie betrachten den Fall vom Standpunkt eines aufgeklärten Europäers aus. Sie müssten vielleicht versuchen, sich in einen Muslim hineinzuversetzen, für den Mohammed eine Art Vater ist. Das ändert nichts. Wenn jemand meinen Vater beleidigt, würde ich trotzdem nicht dessen Haus niederbrennen. Wenn Sie nicht mögen, was in einem Buch über Ihre Religion geschrieben steht, können Sie das Buch wegwerfen oder ein eigenes Buch dagegen schreiben. Aber wenn Sie den Autor mit dem Tode bedrohen, überschreiten Sie eine Grenze. Dagegen wehre ich mich. Im Kampf um die Meinungsfreiheit zu kapitulieren, wäre der größte Fehler. Auch ich habe schon sehr unangenehme Karikaturen über mich in Zeitungen sehen müssen. Sie pochen auf Ihr „Recht, beleidigt zu werden“, wie Sie es einmal nannten. Ja, und ich werde ununterbrochen beleidigt. Jedes Mal, wenn Tony Blair den Mund aufmacht, beleidigt mich das. Weil Sie seine Irak-Politik missbilligen? Unter anderem. [...] Gut, sprechen wir über die Liebe! In Ordnung. Sie sagen, dass muslimische Männer zur Liebe nicht fähig sind, weil sie nur in den Kategorien von Ehre und Schande denken und die Frau nicht als gleichwertig betrachten. Ich sage das nicht über alle Muslime. Im Koran heißt es: „Die Weiber sind euer Acker. Geht auf euren Acker, wie und wann immer ihr wollt...“ Bitte verschonen Sie mich mit diesem Zeug! Ich kenne es. 22 Wie beurteilen Sie den Koran als Literat? Das ist schwierig, weil ich nicht Arabisch kann. Ich lese Übersetzungen. Leute, die Arabisch sprechen, sagen, es gebe darin sehr poetische Stellen. Goethe hat ihn ein Buch endloser Tautologien genannt. Literarisch bereitet die Bibel zweifellos mehr Vergnügen. Der Koran besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, den Erzählungen über das Leben des Propheten, der Beschreibung der paradiesischen Freuden für die Gläubigen, der Höllenstrafen für die Ungläubigen und, drittens, den Regeln, nach denen man leben soll. Über die machen Sie sich in den „Satanischen Versen“ besonders lustig. „Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften“, heißt es da, „Vorschriften über alles und jedes, wenn ein Mann einen Furz ließ, sollte er sein Gesicht in den Wind richten, eine Vorschrift, mit welcher Hand man seinen Hintern säubern durfte...“ Über diese Stelle haben sich die Mullahs besonders geärgert. Den Gläubigen wurde gesagt, Zitat, „wie viel sie essen durften, wie tief sie schlafen sollten und welche Stellungen beim Geschlechtsverkehr die göttliche Billigung erhalten hatten...“ Ja, so steht es im Koran. Ich habe nichts erfunden. Am interessantesten finden Sie die Höllenbeschreibungen. Ja, die sind selbstverständlich das Spannendste. Wie auch bei Dante. Richtig. Nur ist Dante besser. Für einen Dichter ist das Paradies der langweiligere Ort, schlechte Musik, öde Mode, man trägt Nachthemden, betet die ganze Zeit oder zupft auf der Harfe. Wer will schon dorthin? In der Hölle ist es viel aufregender, etwas überheizt, aber eine tolle Party. Sie lachen. Ja, ich sehe das mit Humor, und ich glaube, dass der Kampf, den wir gerade erleben, auch ein Kampf zwischen jenen ist, die einen Sinn für das Komische haben, und jenen, die keinen haben. Ayatollah Chomeini sagte: „Es gibt keinen Humor, es gibt kein Gelächter und keinen Spaß im Islam.“ Das sagte er, weil der Humor eine Gefahr für die Mächtigen ist. Er ist subversiv, denn er ist seinem Wesen nach immer respektlos. Wahrscheinlich hat mich mein Humor gerettet. Sie meinen, in den Jahren Ihrer Verfolgung. Ja. Können Sie rückblickend in dieser katastrophalsten Erfahrung Ihres Lebens auch etwas erkennen, das Sie bereichert hat? Ich habe eine Menge Geld verdient, also für meine Karriere war die Fatwa extrem vorteilhaft. Ist es das, was Sie hören wollen? 23 Nein, ich meine das eher im geistigen Sinne. Ich verstehe, und ich kann Ihre Frage bejahen. Ich bin von Natur ein satirischer Autor, aber die Satire ist immer nur gegen etwas gerichtet. Ich wusste schon immer, wogegen ich kämpfte, aber als diese Bedrohung über mir schwebte, genügte das nicht mehr. Ich musste, damit ich ihr standhalte, auch wissen, wofür ich kämpfe. Ich musste mich entscheiden, für welche Werte ich mit meinem Leben einstehen will. Es gibt heute zwei Lager. In dem einen ist alles versammelt, das ich ablehne, Voreingenommenheit, Bigotterie, Obskurantismus, Tyrannei, Gewalt, Unterdrückung, im anderen alles, wofür ich stehe: Freiheit, Liebe, Humor, Kunst und so weiter. Sie wissen heute, was das Richtige und was das Falsche ist. Sie nicht? Ich bin mir nicht sicher. Das heißt, Sie können nicht kämpfen. Genau! Ich sehe den Lauf der Geschichte und resigniere. Ich weiß nicht, was gut und was böse ist. In Goethes „Faust“ sagt der Teufel: „Ich bin ein Teil von jener Kraft...“ „...die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“ Sie kennen das Zitat. Ja, und im philosophischen Sinne stimmt es natürlich. Sie können das Gute nicht wollen, ohne dass es das Böse gibt, weil Sie es nur durch sein Gegenteil definieren können. Darüber wurde eine Menge Literatur geschrieben. Der chinesische Philosoph Laotse sagt: „Was du vernichten willst, das musst du erst richtig aufblühen lassen.“ Ja, aber das ist ein sehr mystischer Gedanke, mit dem Sie im praktischen Leben nicht weiterkommen, es sei denn, Sie sind Fatalist. Das bin ich. Das hat vielleicht mit meiner Biografie zu tun. Die Zeit, an die sich die Deutschen am liebsten erinnern, ist die des Wiederaufbaus in den fünfziger Jahren, den sie, um es zynisch zu sagen, dem Krieg verdankten. So kann ich nicht denken. Denn das würde bedeuten, ich bin dankbar für das Unglück, weil ich es überwinden kann. Ich bin dankbar für die Bombardierung von Dresden, denn sie ermöglicht mir, die Stadt wieder aufzubauen. Ich bin dankbar für den Holocaust, denn er gestattet mir das Gefühl der Entrüstung... Wenn Sie so denken, gehören Sie, fürchte ich, zu den Verdammten. Es ist eine Tragödie, tut mir leid. Ja, das ist es. Das logische Ende eines solchen Gedankens ist ein kultureller Relativismus, den ich für eine der größten Gefahren halte, die den Westen heute bedrohen. Denn wenn wir nicht mehr wissen, wofür wir kämpfen, wenn wir angesichts der Feuerzeichen, die uns umgeben, keine moralischen Entscheidungen treffen, gehen wir unter. Ich halte Sie ja nicht ab von Ihrem Kampf, im Gegenteil, ich beneide Sie. Nur anschließen kann ich mich nicht. Ich denke zu viel. Vielleicht sind Sie weiser als ich. Wie haben Sie sich Ihren Optimismus bewahren können? Ich bin kein Optimist. Ich brauche nur so viel Optimismus, dass ich in der Lage bin, Bücher zu schreiben. Denn das können Sie nicht, wenn Sie nicht davon überzeugt sind, damit etwas in der Welt zu erreichen. Ich brauche den Optimismus nur als Brennstoff für meine Kunst. 24 Genügt es Ihnen nicht, zu sagen, Sie schreiben zu Ihrem Vergnügen? Doch, selbstverständlich. Ich tue es zunächst nur für mich. Aber ich will auch wirken. Sie wollen mit Ihrem Schreiben die Welt verändern. Nein, denn die Welt verändert sich durch alles, was geschieht, ganz von selbst. Das Schreiben ist meine Art, auf der Welt zu sein, meine Obsession, wenn Sie so wollen. Ich bin wie der Kapitän Ahab in Melvilles „Moby Dick“. Ich jage den weißen Wal. Aber ich bin mir dessen nicht bewusst. Man verliert, während man schreibt, über sich die Kontrolle. Ich denke dann auch nicht an den kommerziellen Erfolg. Denn sonst würde ich schreiben wie Dan Brown, dessen einziges Ziel es ist, eine hohe Auflage zu haben... Aber wir wollten doch über die Liebe sprechen. [...] Haben Sie Angst vor dem Alter? Nein, außer wenn es mit physischem oder geistigem Verfall verbunden ist. Ich werde nächstes Jahr sechzig. Ich fühle mich nicht so alt, aber es erschreckt mich, wie schnell die Jahre vergehen. Der Vorteil des Alters ist, dass man nichts Überflüssiges mehr tut. Ich will die Zeit nützen, die mir noch bleibt. Am wichtigsten sind mir die Arbeit und die Familie. Ich habe zwei Söhne aus früheren Ehen, ich habe eine reizende Frau, und ich will Bücher schreiben. Ich werde, bevor ich nur noch sabbernd in einem Stuhl sitzen kann, meine Zeit nicht mit Dingen vergeuden, die ich nicht wirklich möchte. Bestimmt werde ich keine so langen Interviews mehr wie das mit Ihnen führen. Weltwoche, Interview mit André Müller vom 26.04.2006 25 WHY THEY STILL DON’T HATE US > About the 'us' versus 'them' worldview I knew the title to my second book would be Why They Don't Hate Us before the last embers of what had been the World Trade Center had cooled. Life in New York City was just beginning to reanimate after two weeks in which everything seemed frozen in time. The only thing that seemed to move was the ash and dust from the wreckage of the World Trade Center which daily covered New York City with a fresh coat of death. Walking through the bowels of the Times Square subway station I passed a Hudson News stand and caught sight of the just published September 28, 2001, issue of Newsweek, with the title "Why They Hate Us: The Roots of Islamic Rage" emblazoned across it over an image of a young boy dressed in traditional garb holding a toy AK-47. The absurdity of the title - as if the world could so neatly be divided into a "we" and a "they" each, playing our respective roles in some preordained clash of civilizations - provided the perfect foil to summarize the main argument of my research on the impact of globalization in the Middle East during the last two years. The similarity between that cover and the much-debated cover of last week's issue of Newsweek, with the title "Muslim Rage" boldly written over an image of screaming Muslim men, is striking. So is the fact that in each case Newsweek had a well-known nominally Muslim writer with little public connection to their faith - Ayaan Hirsi Ali in fact is a selfdescribed atheist - explain what the "West" must do to win, or at least cope with the irrational masses about whom they claim authority to speak. Whether in 2001 or 2012, the need to generalize about almost one-fourth of humanity, and the benefits of doing is, are evident from the opening sentences of the two articles. Muslims or Arabs? In the piercing aftermath of 9/11, Fareed Zakaria pointed out that "there are billions of poor and weak and oppressed people around the world. They don't turn planes into bombs. They don't blow themselves up to kill thousands of civilians... There is something stronger at work here than deprivation and jealousy. Something that can move men to kill but also to die". He went on to argue that the rage that motivated the 9/11 terrorists came "out of a culture that reinforces their hostility, distrust and hatred of the West - and of America in particular". Zakaria did not blame Islam per se; his scorn was focused on its Arab heartland. He declared that while countries like Indonesia were dutifully following the West's advice on economic and political reform the Arab world was a cesspool of anti-American fury and suicide bombings. His misreading of his Pakistan as a relatively moderate country compared with Egypt or Syria remains as shocking as it is telling. "By the late 1980s," he argued, "while the rest of the world was watching old regimes from Moscow to Prague to Seoul to Johannesburg crack, the Arabs were stuck with their ageing dictators and corrupt kings." Apparently the fact that all of these regimes were, as he pointed out, brutal dictatorships with long histories of torturing their peoples, apparently had little to do with their alleged "choice". Instead, it's "disillusionment with the West" and a "lack of ideas" that is "at the heart of the problem". 26 These views, according to the author, have "paralyzed Arab civilization", and led a region "that had once yearned for modernity" to "reject it dramatically". Venality and carelessness, in spades Zakaria admitted that the United States had been too cozy with the region's ubiquitous strong-men. But "America has not been venal in the Arab world", he explained, " only careless". His ignorance - willful or not; the reader can decide which is worse - of American policies and their motivations in the Middle East is as astonishing today as it was on September 12, 2001. But it was absolutely crucial that America at worst be "careless" rather than "venal". If it turned out that decades of support for some of the most oppressive regimes in the world was the result of deliberate policies, what would that say about "us"? Declaring himself part of the "we" against whom the Arab world is waging war, Zakaria stated that "we", "cannot offer the Arab world support for its solution [to the Palestinian problem] - the extinction of the state... Similarly, we cannot abandon our policy of containing Saddam Hussein. He is building weapons of mass destruction". We might mention that the declared policy of the majority of Arab states in 2001 was to support the Oslo peace process while Saddam Hussein was not building WMDs. But the facts don't really matter compared with the powerful perception Zakaria's attitude helped to generate and sustain in the next decade. That "they" are fundamentally incompatible and unable to live among "us" is too self-evidently true to be challenged by mere facts. Ayaan Hirsi Ali, the Somali-born Dutch political activist and former Parliamentarian, similarly defines herself as part of the "we" against whom irrational Islam is rearing its ugly head. "Once again the streets of the Arab world are burning with false outrage. But we must hold our heads up high," she begins her article by declaring. Like Zakaria a decade before, Ali sees little need to explain who "they" are. "Islam’s rage reared its ugly head again last week", and thus it is Muslims as a collective who are responsible. Ali argues that the murder of the Ambassador and members of his entourage was the result of a "raging mob" who under the watch of a "negligent or complicit" government. That the murders were the result of a well-planned attack by a terrorist group in a region that the government has yet to be able to bring under its control (in good measure thanks to all the weaponry released by the US-sponsored insurgency against Gaddafi) is irrelevant. Islam is nothing less or more than an anti-Western and anti-modern mob. Whether in Libya or in Egypt, it's clear that Muslims are making a "free choice" to "reject freedom as the West understands it" in favour of governments that "stand for ideals diametrically opposed to those upheld by the United States". Never mind that the "values" of the United States includes supporting corrupt and brutal dictatorships and occupations, launching wars of aggression based on lies, violating its own constitutional principles to detain indefinitely, torture and even murder suspected enemies (including its own citizens). Or that a small but politically powerful percentage of American citizens seem as determined to incite violence in the Muslim world as their counterparts there seem determined to launch violence against Westerners. If Islam is defined by the rage of a small part of its adherents, the West is defined by the abstract liberal ideals that never have to be actualized in practice to remain the standard against which others - but not the West - are measured. 27 Disaggregating us and them Neither Zakaria in 2001 nor Ali today can offer any real advice for how "we" can deal with "them", for four reasons. First, many of their facts were and remain wrong that their larger arguments aren't very useful. The problem is actually more damaging to Ali because, unlike Zakaria, she has a very powerful personal story of suffering at the hands of an oppressive, violent and patriarchal culture in her native Somalia that deserves to be heard. Sadly, it is undermined by broad generalizations and inaccurate claims she makes. Second, both authors completely leave out the history and ongoing realities of Western/US support for violent and even murderous regimes across the region, which lies at the foundation of much of the quite understandable anger and rage of Muslims against the US or European governments. It is not the only reason for it, and it doesn't excuse terrorism against civilians, whether Muslims or so-called "infidels", or the widespread religiously grounded prejudices or oppression across the Arab/Muslim world. But the rage for which they are attempting to account simply cannot be understood, never mind addressed, without placing such policies at the centre for any analysis. Similarly, both authors make scant mention of the quite long history and ongoing reality of "irrational" rage among "Western" Christians or Jews against Islam which, aside from its role in the present video scandal, has had at least as profound an impact on the policies of the American or Israeli governments towards Muslims as Islamic rage has had on the policies of most Arab/Muslim governments towards the US or Israel. Third, both Zakaria and Ali, and their colleagues (both fellow Muslims like Fouad Ajami and Irshad Manji and the broader mainstream and conservative punditocracy), generalize from the most extreme segments of Arab/Muslim societies to Arab/Muslim "civilization" as a whole. The simple fact is that the vast majority of Muslims have not been engaged in an irrational hatred of the West or unwillingness to engage with the basic tenets of modernity. As with their counterparts in Western countries and globally, they are just trying to survive and build a better life for their children. No matter how reprehensible is the behaviour of violent protesters during the most recent protests, they comprise only the smallest percentage of the world's Muslims, and their actions in fact have produced a wide backlash against them, from citizens attacking extremist headquarters in Benghazi to progressive Muslims writing detailed rebuttals to the ideologies underlying such actions. Moreover, no matter how unacceptable the ongoing oppression of women or minorities in the Muslim world is, such actions are neither unique to the Muslim world, nor are they the primary source of the rage these articles seek to explain. Fourth, all the "rage" writers completely ignore the long history of interaction and support between people in the "West" and "Muslim" world - from interfaith jam sessions in medieval al-Andalus to kings and sultans, beys and deys, allying against common enemies on both sides of the religious divide in the unceasing great power games of the early modern era, to tens of thousands of European migrants building multi-ethnic, religious and linguistic communities in 19th century Alexandria or Tunis (in which former Christian slaves could rise to high government positions), to anarchist-inspired activist collectives conspiring together against authoritarian capitalist elites in early 20th - and now 21st century Cairo, Madrid and Wall Street. 28 Of course, such collaborations also have had their much darker side, in the cozy relationships between Western and Arab/Muslim governments. Whether it's freedom fighters morphing into terrorists (a la Osama bin Laden), or terrorists becoming freedom fighters (as we've seen occur just last week with the Obama administration's decision to remove the MEK from the list of terrorist organizations), such policies are at the root of the broader distortions in the relationships between the Muslim majority world and the West that most "rage" writers fail to explain. Maybe they do hate us? If the Arab uprisings of the last two years have taught us anything, it is that there is no such thing as one Arab personality or culture. Just as the US is seemingly evenly divided between two broad trends that can scarcely be considered part of the same identity, most every Arab/Muslim country is riven by overlapping class, ethnic, sectarian, tribal, national and other conflicts. The one generality that increasingly unites people across the globe, however, is the clear lack of solidarity between the wealthiest members of all societies and their poorer compatriots. Whether it's the richest 1.5 per cent in the United States, 5 per cent in Pakistan or 10 per cent in Egypt or Morocco, contemporary neoliberal, globalized capitalism is uniting the interests of elites against the rest of their societies - and as a result, the interests of the rest of us together in opposition, like never before. This was clear to anyone lucky enough to be in Tunis or Cairo during their initial uprisings, or Milwaukee, Lower Manhattan and Madrid no longer thereafter. When you look at the incredible damage being wrought by energy, mining, agribusiness, food processing, weapons, and so many other industries on the planet, from global warming to rain forest destruction to the poisoning of large swaths of the land and sea, it's hard not to believe that they - the political and economic elites who manage the world today and control most of its resources and wealth - really do hate the rest of us. Or at the very least, they couldn't care less. The German philosopher, Peter Sloterdijk, has argued that rage has long been a root force shaping societies. The problem is that it's always been far too easy for those with power to misdirect the rage of others away from them and towards whatever social forces might challenge their control. But if rage all too often produces nihilistic anger and violence, it also can produce heroism and courage. The trick is to figure out how to channel and control the rage - not with anger, but with a positive vision of a future that address and transcends the dynamics that lie beneath it. This is precisely what the Arab uprisings, and soon after, the global Occupy movement, have begun to do. If the rage that increasingly swirls around all our societies can be channeled and directed against those who truly threaten our collective future, the sooner we might be able slow, if not stop, the inexorable march towards ecological disaster and a new feudal age. (Aljazeera, Artikel von Mark LaVine vom 26.09.2012) 29