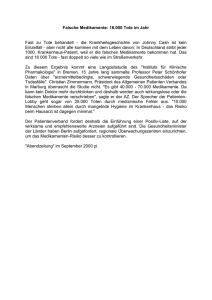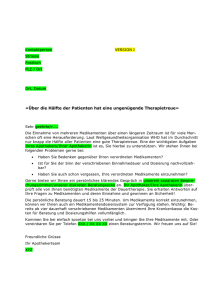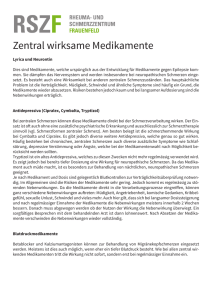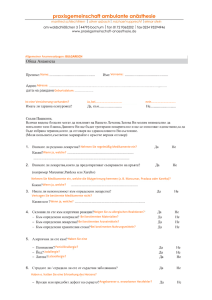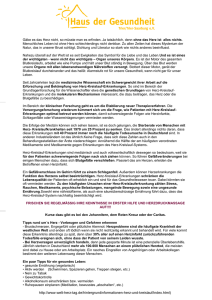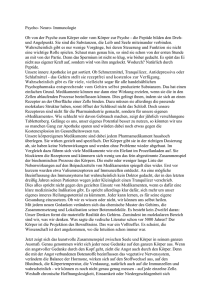Suchtreport 2005 - Stiftung Bündner Suchthilfe
Werbung

SUCHTREPORT 2003 J A H R E S B E R I C H T S T I F T U N G B Ü N D N E R S U C 2 0 10 4 H T H I L F E Inhalt 2 Vorwort von Regierungsrat Martin Schmid 5 Vorwort des Präsidenten 7 «Den Placebo-Effekt nicht vorenthalten» 9 Stetig steigender Medikamentengebrauch 12 Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker 15 Medikamente mit Abhängigkeitspotenzial 17 «Mir geht es sehr gut» 21 Pillen per Internet 24 Wann liegt Medikamentenmissbrauch vor? 27 Jahresbericht des Präsidenten 31 Jahresabschluss per 31. Dezember 2004 32 Revisorenbericht über das Geschäftsjahr 2004 33 Schlusswort des Präsidenten 34 Mitglieder des Stiftungsrates 34 3 Vorwort von Regierungsrat Martin Schmid Auch Doping ist Medikamentenmissbrauch Es freut mich, mit dem Vorwort zum zweiten Suchtreport der suchthilfe.gr ein Thema aufgreifen zu können, das bisher in unserer Gesellschaft zu wenig Beachtung findet. Hatte sich der erste Suchtreport noch den Alcopops gewidmet, thematisiert das aktuelle Heft den Medikamentenmissbrauch. Und dieses Thema ist ungleich komplizierter und vielfältiger in seinen Erscheinungsformen. Denn die Frage lautet, wie sich überhaupt der Medikamentenmissbrauch und die -sucht zeigen. Auch wenn die potentiellen Risikogruppen bekannt sind, zeigt sich, dass es in unserer Leistungsgesellschaft bereits bei Kindern und Jugendlichen zu Medikamentenmissbrauch kommt. Um im Schulalltag und bei sportlichen Aktivitäten körperliche und geistige Höchstleistungen zu erbringen und um im harten Wettbewerb bestehen zu können, erscheint es auch schon bei Schülern gerade recht und billig, diese Leistung durch «die eine oder andere Pille» zu fördern. Auch aus dem Sport kommen immer wieder neue Meldungen, wonach das Doping zu einem ernsthaften Problem geworden ist. Missbräuche treten aber nicht nur bei Spitzenathleten auf. Ein neues und seit einigen Jahren zunehmend besorgniserregendes Phänomen ist nämlich der dopende Freizeit- und Breitensportler. Unglücklicherweise haben – so scheint es zumindest – die bekannt gewordenen Doping-Skandale der letzten Olympischen Spiele und im Bereiche des Radsports keine Abschreckung, sondern eher noch einen Werbeeffekt für bestimmte leistungsfördernde, aber gesundheitsschädigende Substanzen gehabt. In den USA hat bspw. der Anabolikakonsum eine derart grosse Ausbreitung erreicht, dass der Konsum und Verkauf von Steroiden heute rechtlich gleich wie der Konsum und Verkauf harter Drogen behandelt wird. Gegen einen gesunden sportlichen Ehrgeiz ist mit Sicherheit nichts einzuwenden. Nur so kann ein Individuum überhaupt Höchstleistungen erzielen. Wenn aber der sportliche Eifer in einen ungesunden Fanatismus überschlägt, ist Vorsicht und Einhalt geboten. Die Auflehnung gegen das Doping ist ein Kampf um die Fairness 4 5 im Sport und steht für eine gesunde Zukunft unserer Kinder. Kinder haben ein Recht auf gesundheitsfördernde Betreuung und Umgebung in Sportgruppen und Fitnessbetrieben. Deshalb haben die sportlichen Organisationen eine grosse Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern und ihren Mitarbeitern wahrzunehmen und auf die entsprechenden Gefahren hinzuweisen. Es freut mich, dass die Stiftung Bündner Suchthilfe mit dem vorliegenden zweiten Suchtreport ihre Zielsetzung weiterverfolgt, das Thema Sucht im Alltag zu thematisieren. Weil der Medikamentenmissbrauch fast immer heimlich verläuft, hoffe ich trotzdem, dass dieser Suchtreport nicht still in der Schublade verschwindet, sondern zu einer offenen Diskussion zu diesem Thema führt. Martin Schmid, Regierungsrat Vorsteher des Justiz-, Polizei und Sanitätsdepartements Graubünden Vorwort des Präsidenten Vor einem Jahr hat die Stiftung Bündner Suchthilfe den ersten Suchtreport vorgelegt. Sie verfolgt damit das Ziel, an Stelle eines üblichen Jahresberichtes Aspekte der Suchtproblematik zu beschreiben und gesellschaftlich relevante Entwicklungen aufzuzeigen. Der erste Suchtreport widmete sich dem Thema Alcopops. Er war auf die spezifische Konsumentengruppe der Jugendlichen ausgerichtet, enthielt aber auch wichtige Informationen für Eltern, Lehrpersonen und weitere Interessierte. Ganz anders das diesjährige Thema: Medikamente und Medikamentenabhängigkeit. Medikamente sind für viele Menschen in den Industrienationen alltägliche Begleiter. Menschen aus allen Altersschichten nutzen sie. Medikamente werden gebraucht als Heilmittel, Lifestyle- und Aufputschmittel. Sie lindern Schmerzen, wirken psychisch stabilisierend, sind oftmals notwendig und vielfach auch nicht. Die Stiftung Bündner Suchthilfe legt aktuelle Informationen zum Gebrauch und Konsum, zur Produktion und Werbung, zu Wirkungen und Suchtpotentialen von Medikamenten vor. Seit ihrer Gründung engagiert sie sich für Menschen, die aufgrund ihrer Sucht nicht in der Lage sind, ein autonomes Leben zu führen. Diese Stiftung kann mit ihrem Engagement gesellschaftliche Entwicklungen nicht aufhalten. Sie übernimmt aber die Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen und sie will – im Sinne der Prävention – einen Diskussionsbeitrag leisten über scheinbar normale Lebens- und Konsumgewohnheiten. Über Risiken und Nebenwirkungen informiert Sie für einmal nicht nur ihr Arzt oder Apotheker; auch wir tun es, wenn auch etwas anders als der Werbeslogan es meint. Medikamente heilen und helfen. Medikamente beruhigen und lindern. Medikamente schaffen Arbeitsplätze und Umsätze. Medikamente machen auch süchtig. Der vorliegende Suchtreport informiert aus verschiedenen Blickwinkeln zu dieser Thematik. Viel Interesse beim Lesen! Chur, im März 2005 Andrea Mauro Ferroni Präsident Stiftung Bündner Suchthilfe 6 7 «Den Placebo-Effekt nicht vorenthalten» Bild Wenn Patienten mit Beschwerden zum Arzt kommen, so wünschen sie sich nichts sehnlicher, als die sofortige Heilung. Je nach Symptom kann der Arzt mit dem richtigen Einsatz von Medikamenten diesem Wunsch auch entsprechen. Doch reichen Medikamente oftmals nicht aus, um die Ursache einer Krankheit zu beseitigen. Das Beziehungsverhältnis zwischen Arzt und Patient wird heute sehr stark von der hohen Patientenautonomie sowie von den Werten und Grundhaltungen der Gesellschaft geprägt. Dies hat zur Folge, dass anstrengende oder unbequeme Therapievorschläge bei den Patienten meist auf Widerstand stossen. Die immer schnellere Bedürfnisbefriedigung, die gesellschaftliche Leistungsorientierung sowie der Spardruck der Krankenkassen setzen Arzt und Patienten vermehrt unter Druck. Zudem führt der Patientenwunsch nach sofortiger Symptomfreiheit oft zum Verzicht einer sorgfältigen Abwägung für oder gegen eine medikamentöse Therapie. Placebo Effekt nicht vorenthalten «Seitens der Patienten besteht der dringende Wunsch, etwas verschrieben zu bekommen»: so lautet der Grundtenor einer kleinen Umfrage unter Allgemeinmedizinern. «Wenn ich deutlich weniger Medikamente verschreiben würde, könnte ich meinen Laden gleich dichtmachen», gibt ein praktizierender Arzt unumwunden zu. Ein anderer Allgemeinpraktiker ergänzt: «Der Placebo Effekt eines Medikamentes beträgt rund 30 Prozent. Warum sollte ich meine Patienten um diesen Heilungs-Effekt bringen, indem ich auf die Verschreibung eines Medikamentes verzichte?» Dennoch wäre es falsch, daraus abzuleiten, dass Mediziner grundsätzlich zu viel und zu oft verschreiben. Denn es gibt auch eine grosse Patientengruppe, welche eine sehr kritische Haltung gegenüber Medikamenten haben: «Diese Tatsache kann dann im umgekehrten Fall dazu führen, dass eine dringend angezeigte medikamentöse Therapie vom Patienten ignoriert wird und zu weiteren Komplikationen führt», ergänzt ein Arzt.* Die Daten der Gesundheitsbefragung (2002) zeigen, dass 19 Prozent der über 15 Jährigen in der Schweiz innerhalb einer Woche 8 9 mindestens einmal ein Schmerz-, ein Schlaf- oder ein Beruhigungsmittel einnehmen. Bei mehr als einem Drittel der Einnehmenden wird für die Untersuchungswoche ein täglicher Gebrauch beobachtet, insgesamt bei 7 Prozent der Bevölkerung. Auffällig ist, dass Frauen wesentlich mehr Medikamente mit Missbrauchpotential einnehmen als Männer. In über 90 Prozent der Fälle wurden die Medikamente vom Arzt verschrieben. Funktionieren Frauen anders? In einer Studie wurde die Verschreibungspraxis von Ärzten untersucht (Maffli & Efionayi-Mäder, 1996). Diese Studie zeigt, dass Frauen viel häufiger Psychopharmaka verschrieben bekommen, als Männer. Dies vor allem, wenn sie Symptome zeigen, die Anlass für intensivere diagnostische Untersuchungen sind. Bei depressiven Patientinnen und Patienten verschreiben männliche Mediziner bei einer von drei Frauen Antidepressiva, bei Männern aber nur in einem von elf Fällen. Ärztinnen machen diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen in ihrer Verschreibungspraxis nicht. Diese Feststellung lässt vermuten, dass die Vorstellung von Gesundheit je nach Geschlecht unterschiedlich ist. «Gesundheit» wäre in diesem Sinne ein «soziales Konstrukt». Gefahr von Abhängigkeiten Kliniker unterscheiden zwischen aufdeckenden und zudeckenden Behandlungen. «Aufdeckend» sind Psychotherapien im engeren Sinn mit dem Ziel, die Patienten in intensiven Gesprächen zu einem besseren Verständnis ihrer Situation und zur Lösung ihrer Probleme zu führen. «Verstehen» heisst unter anderem, bisher verborgene Zusammenhänge in der eigenen Lebensgeschichte zu erfassen und verdrängte Erinnerungen wachzurufen. Das kann sehr schmerzvoll sein. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass gefundene Lösungen nicht immer leicht umsetzbar sind oder sich als unrealisierbar erweisen. Es ist nachvollziehbar, dass manche Patienten vor dem Aufwand einer solchen aufdeckenden Psychotherapie zurückschrecken und gar nichts anderes wollen als eine rasch wirksame medikamentöse Behandlung, welche die Symptome und vor allem auch deren Ursachen einfach «zudeckt» und sie – ganz im Sinne der Erwartung der Gesellschaft – möglichst schnell wieder 10 «funktionstüchtig» macht. Die Wurzeln der Störung oder Krankheit bleiben so unbehandelt. Der Arzt, der die medikamentöse Behandlung eingesetzt hat mit der Absicht, den Patienten von seinem akuten Leiden zu befreien und so einer psychotherapeutischen Bearbeitung der Probleme zugänglich zu machen, wird von diesen Patienten dazu gedrängt, die rezeptpflichtigen Medikamente immer weiter zu verschreiben. Wenn er dann merkt, dass ein Patient in die Abhängigkeit rutscht und daraufhin versucht, mit ihm nach Alternativen zur rein medikamentösen Behandlung zu suchen, stösst er oft auf entschiedenen Widerstand des Patienten. Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass es am besten wäre, Medikamente mit Abhängigkeitspotenzial aus dem Markt zu nehmen. Damit würde man aber letztlich die Falschen bestrafen, nämlich nicht die Minderheit der Abhängigen, die einfach auf den Schwarzmarkt ausweichen würden, sondern die Mehrheit der Leidtragenden, die von solchen Medikamenten profitieren. Pillen statt Politik Schliesslich hat eine weitere gesellschaftliche Tatsache Folgen für die Arzt-Patientenbeziehung: Heute sitzen immer mehr Menschen im Wartezimmer, die Opfer der anhaltenden Rezession geworden sind: «Leiden und Problembereiche, die vorher eine politische Lösung oder eine Intervention innerhalb der Arbeitswelt nach sich gezogen hätte, werden nunmehr dem Arzt zugewiesen (...) Der wird dadurch praktisch gezwungen, die Not des Patienten in Begriffen von Krankheit und Invalidität neu zu interpretieren», schreibt Louis Jeantet. (Forum Louis Jeantet, 1998: 126) *Die Folgen dieser Patientenautonomie lassen sich auch in Zahlen ausdrücken: Schätzungen gehen davon aus, dass 40 Prozent der Verschreibungen nicht richtig befolgt werden. Im Rahmen der «Self Care» Kampagne der Apotheken wurden in 675 Apotheken über 200 000 Medikamentenpackungen eingesammelt, wovon ein Viertel nicht einmal geöffnet war. Man schätzt die Kosten für fortgeworfene Medikamente auf rund 130 Millionen Franken pro Jahr. Quellen Medikamentenmissbrauch in der Schweiz. Aktuelle Daten – Orientierung für die Praxis. Herausgegeben von Etienne Maffli. Schweizerische Fachstelle für Alkohol und anderen Drogenprobleme (SFA), 2000. Ingrid Reubi: «Sucht auf Rezept». in der Zeitschrift: abhängigkeiten 2 / 04 11 Stetig steigender Medikamentengebrauch Im Durchschnitt schluckt jede Schweizerin und jeder Schweizer pro Jahr für über 700 Franken Arzneimittel. Statistiken zeigen, dass der Medikamentenkonsum in der Schweizer Bevölkerung stetig zugenommen hat. Die Gesamtkosten für Medikamente haben seit 1980 stetig zugenommen. Dieser Anstieg ist zum Teil auf eine Verteuerung der eingesetzten Medikamente zurückzuführen, zu einem grösseren Teil aber auf einen Mehrverbrauch durch die Schweizer Bevölkerung. Heute stellen die Mehrausgaben für Medikamente eine grosse Herausforderung bei der Finanzierung des schweizerischen Gesundheitssystems dar. Im Jahre 2001 hat jede Schweizerin und jeder Schweizer jährlich rund 700 Franken für Medikamente ausgegeben. Das Verhältnis der Verkäufe von dämpfend/beruhigend und anregend wirkenden Arzneimitteln hat sich im Verlauf der Jahre zunehmend ausgeglichen. Auffällig ist der deutliche Umsatzanstieg bei den Antidepressiva, Stimulantien und Schlankmachern: Langfristiger Gebrauch (während mindestens eines Jahres) von Medikamenten % Quelle: SFA (1999). Gebrauch von Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial in der Schweiz. Schmerzmittel Schlafmittel Beruhigungsmittel Anregungsmittel Abführmittel Hustenmittel mindestens eines davon 9.9 9 6 5.0 4.5 3.9 3 2.5 Dies sind Medikamente für Krankheiten, die stark durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen begünstigt bzw. mit verursacht werden. Medikamente mit Missbrauchspotenzial machen einen Grossteil des gesamten Arzneimittelumsatzes aus. Einige Zahlen sollen dies verdeutlichen: Im Jahre 2003 sind in der Schweiz verkauft worden: • Schmerzmittel: • Schlafmittel • Abführmittel • Hustensedativa • Beruhigungsmittel • Schlankmacher 22,30 Mio. Packungen 4,56 Mio. Packungen 4,25 Mio. Packungen 3,78 Mio. Packungen 3,10 Mio. Packungen 0,30 Mio. Packungen Diese Medikamentengruppen stellen einen Anteil von rund 20 Prozent aller umgesetzten Medikamentenpackungen im Jahre 2003 dar und die entsprechende Umsatzsumme beträgt knapp 1 Milliarde Franken (Quelle: Pharma Information, Basel). Um die eigentliche Problemlage des Medikamentenmissbrauchs in der Schweiz einzuschätzen, werden Informationen über das Einnahmeverhalten benötigt. Denn richtig eingesetzt, tragen die genannten Arzneimittelgruppen zu einer erheblichen Besserung der Gesundheit bzw. der Lebensqualität bei. Die aktuellen Daten zum Einnahmeverhalten in der Bevölkerung stammen aus einer Studie der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenproblem (SFA), Lausanne, aus dem Jahre 1999. Da die jährlich erhobenen Umsatzzahlen sich in der Zwischenzeit jedoch nicht wesentlich verändert haben, kann man davon ausgehen, dass die Befunde im Allgemeinen heute noch ihre Gültigkeit haben. Eine Ausnahme bildet allerdings die deutliche Zunahme des Umsatzes von Psychostimulantien, die sich zum grossen Teil auf den boomenden Einsatz von Methylphenidat (Ritalin) bei hyperaktiven Kindern zurückführen lässt. 2.1 1.3 1.4 1.3 0.6 0.1 0 Männer (n = 1 430) 12 0.3 0.7 0.2 Frauen (n = 1 556) 13 Medikamentengebrauch in der Bevölkerung In der Medikamentenstudie der SFA wird der Anteil der Medikamentenabhängigen in der erwachsenen Wohnbevölkerung der Schweiz auf rund 1 Prozent geschätzt. Hochgerechnet entspricht dies 60 000 Personen. Eine weitaus grössere Gruppe von Personen, deren Anteil auf 2.5 Prozent der erwachsenen Allgemeinbevölkerung geschätzt wird, weist jedoch einen auffälligen Langzeitgebrauch (über ein Jahr hinaus) von Medikamenten der Benzodiazepin-Gruppe (Schlaf- und Beruhigungsmittel) auf. Diese Präparate sind für ihr ausgeprägtes Suchtpotential bekannt. Etwa zehn Prozent der Frauen und fünf Prozent der Männer nehmen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr entweder ein Schmerz, Schlaf, Beruhigungs, Anregungs, Abführ- oder Hustenmittel ein. Entwicklung des Gesamtumsatzes bei Medikamenten in der Schweiz seit 1993 Quellen: Berechnungen der SFA auf Basis von: Pharma Information, Basel. Bundesamt für Statistik (2002). Statistische Jahrbücher der Schweiz der entsprechenden Jahre. in Mio. Franken in Franken Medikamentenverkäufe Medikamentenverkäufe zu konstanten Preisen* 1993 3 569 3 789 512 513 1994 3 704 3 899 528 524 1995 3 923 4 057 554 572 1996 4 099 4 204 577 592 1997 4 274 4 361 601 613 1998 4 446 4 537 623 585 1999 4 739 4 797 661 669 2000 5 053 5 038 701 699 2001 5 280 5 212 732 723 Je Einwohner Je Einwohner zu konstanten Preisen* *Konstante Preise beziehen sich auf Mai 2000. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Damit Medikamente sinnvoll und wirksam als Heilmittel eingesetzt werden können, braucht es neben den Ärzten und Apothekern auch informierte Patienten. Das Problem ist nur, dass heute immer mehr Informationen über neue Medikamente gepaart mit gezielten Marketingmassnahmen der Hersteller an die Öffentlichkeit gelangen. Die Grenze zwischen Werbung und Information wird dadurch fliessend. Über die Lifestyle-Drogen Viagra und Xenical wurde in Europa längst geredet und geschrieben, bevor diese Mittel überhaupt die Marktzulassung hatten. Fast jedes Kind weiss heute, dass Papi nur die blaue Pille braucht, wenn’s nicht mehr klappt. Und Mami muss nur zu Xenical greifen und das Fett verschwindet wie von selbst. Problem erkannt, Problem gelöst. Sicherlich ist diese Darstellung etwas überzeichnet, allerdings ist es erstaunlich, welchen Stellenwert die sogenannten Lifestyle-Drogen heute in den westlichen Industrienationen einnehmen. Allerdings passen diese Medikamente auch in unsere Gesellschaft, in der Leistungsschwäche, Impotenz und schlechte Stimmungslagen unerwünscht sind. Die Vorbereitung zur Markteinführung der oben genannten Produkte haben ausgewählte Journalisten übernommen, denen die jeweiligen Informationen über die neuen Superpräparate zur Verfügung gestellt wurden. Nach der Markteinführung von Viagra konnte Pfizer in ganzseitigen Inseraten die Männer einladen, sich anonym über eine Hotline beraten zu lassen. Dort wurde abgeklärt, ob sich für sie der Gang zum Arzt lohnt, um Viagra verschrieben zu bekommen. Gesundheitsmarkt boomt (Quelle: Zahlen & Fakten Herausgegeben von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme (SFA), Lausanne, 2004.) 14 Seitens der Öffentlichkeit besteht ein grosses Interesse an neuen Medikamenten, welche die Lebensqualität und die körperliche Gesundheit verbessern. Der Gesundheitsmarkt boomt. Heute gibt es zahlreiche Magazine, die sich ausschliesslich mit Themen rund um die Gesundheit beschäftigen und Dr. Samuel Stutz ist mit seiner «Sprechstunde» präsent. Finanziert werden diese Magazine 15 neben dem Kioskverkauf und durch Abonnemente auch durch Pharma-Werbung. Kein Wunder, dass im Ratgeber «Meine Gesundheit» nur Heilmittel von Herstellern berücksichtigt werden, die für die Platzierung ihrer Produkte etwas bezahlen (Puls Tip, 8/96). Deshalb sind heute auch einseitige Berichterstattungen über einzelne Präparate durchaus an der Tagesordnung. Die Chefredaktoren ziehen sich mit dem gleichen Hinweis aus der Verantwortung, wie die Pharmaindustrie: «Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker». Darüber hinaus gewinnen die Pharmaunternehmen durch Sponsoring neuen Einfluss auf Patientenorganisationen oder Hotlines zu den verschiedensten Themen. Schliesslich nutzen Pharmaunternehmen heute ihre Bilanzpressekonferenzen auch gerne dazu, mit Blick auf die eigenen Aktienkurse ausführlich Werbung für die Medikamente zu machen, die sich noch «in der Pipeline» befinden, die also noch vor der Marktzulassung stehen. Keine Studien vorhanden Seit Ende der 90er Jahre in der Schweiz die Medikamentenwerbung stark liberalisiert wurde, ist der Bruttowerbeaufwand für Pharma-Produkte um rund ein Drittel gestiegen. Auch wenn es in der Schweiz noch keine unabhängigen Studien darüber gibt, welche Wirkungen die Pharmawerbung erzielt, kann dennoch angenommen werden, dass sich die Werbung für die Unternehmen lohnt. Dass die Medikamentenwerbung auch in der Schweiz einen Einfluss bis in die Arztpraxis hat, wird kaum bestritten. Allerdings gilt hier zwischen den verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Präparaten zu unterscheiden. Werbung darf momentan nur für letztere Präparate gemacht werden. Werbebotschaften für Medikamente enthalten aber ebenso wie Waschmittel- oder Autowerbung grotesk verkürzende und banalisierende Darstellungen von an sich komplexen Realitäten. Kopfschmerz oder Antriebsschwäche werden so weit banalisiert, dass der Griff zur Pille als einzige Möglichkeit erscheint, das Problem zu lösen. Und wenn für Aspirin mit dem Slogan geworben wird: «Für weniger Schmerz auf dieser Welt» – so wird damit ein allgemeines gesellschaftliches Anliegen ins Feld geführt, dem wohl niemand widersprechen möchte. 16 Medikamente mit Abhängigkeitspotenzial Die Mediziner sagen «dosis sola facit venenum» («Nur die Dosis macht das Gift»). Während grundsätzlich alle Arzneimittel im Übermass schaden, besteht bei einigen Medikamenten zusätzlich das Risiko abhängig zu werden. Ein erhöhtes Abhängigkeitspotential geht von Medikamenten aus, welche «psychoaktive» Substanzen beinhalten, welche also die Psyche beeinflussen (Stimmungen, Gefühle, Antrieb) oder von schmerzstillenden Substanzen (Psychopharmaka). Die wichtigsten Arzneimittel mit einem Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial sind Schlaf- und Beruhigungsmittel (Tranquilizer), Schmerzmittel (Analgetika) und Stimulanzien. Die wichtigsten Gruppen werden hier kurz vorgestellt: Schlafmittel und Beruhigungsmittel (Tranquilizer) Die meisten Schlaf- und Beruhigungsmittel gehören zur Familie der Benzodiazepine. Das wohl bekannteste Medikament dieser Gruppe ist das Valium. Weitere in der Schweiz häufig verkaufte Präparate sind: • Schlaf- und Beruhigungsmittel: Dalmadorm, Dormicum, Halcion, Loretam, Mogadan, Noctamid, Normison, Rohypnol, Semnium. • Tranquilizer: Auxiolit, Demetrin, Lexotanil, Lorasifar, Paceum, Seresta, Solatran, Stesolid, Temesta, Tranxilium, Urbanyl, Valium, Xanax. Ein etwas geringeres Abhängigkeitsrisiko wird bei Medikamenten mit den Wirkstoffen Zolpidem (z.B. Stilnox) und Zaleplon (z.B. Sonata) angenommen. Diese sind zwar chemisch nicht mit den Benzodiazepinen verwandt, zeigen aber im Körper ganz ähnliche Wirkmechanismen. Da auch für Mittel mit diesen Wirkstoffen zumindest einige Missbrauchsfälle bekannt wurden sowie vor allem Berichte über teilweise schwere Nebenwirkungen vorliegen (z.B. Gedächtnislücken, visuelle Halluzinationen), können sie nicht als ungefährliche Alternative zu Benzodiazepinen betrachtet werden. 17 Analgetika (Schmerzmittel) Schmerzmittel werden in zentral und peripher wirkende Mittel unterschieden. Zu den zentralwirkenden, d.h. am zentralen Nervensystem ansetzenden Analgetika gehören vor allem die Opiate, deren bekanntester Vertreter das Morphin ist. Derartige Medikamente werden zur Behandlung besonders schwerer Schmerzzustände eingesetzt. Hierunter fallen z.B. Krebserkrankungen oder chronische Schmerzen, die mit anderen Mitteln nicht mehr wirksam behandelt werden können. Medikamente aus dieser Gruppe fallen unter das so genannte Betäubungsmittelgesetz, d.h. dass die Verschreibung staatlich kontrolliert wird. Auch Codein, welches in einigen Schmerzmitteln, aber auch z.B. in Hustenmitteln enthalten ist, ist ein Opiatabkömmling und dementsprechend verschreibungspflichtig. Ein Missbrauch dieser Arzneimittel ist speziell unter Abhängigen illegaler Drogen verbreitet. Kombinationsanalgetika Als „Einstiegsdroge“ für Schmerzmittelabhängige gelten dagegen vor allem die frei verkäuflichen, koffeinhaltigen Kombinationsanalgetika (z.B. Thomapyrin, Vivimed etc.), die gerade von Menschen mit Migräne oder anderen chronischen Schmerzbeschwerden bei Bedarf konsumiert werden. Eine relativ grosse Anzahl von Kopfschmerzpatienten entwickelt unter zu häufiger Einnahme von Schmerz- und/oder Migränemitteln einen so genannten „medikamenteninduzierten Kopfschmerz“. Es handelt sich dabei meist um einen dumpf-drückenden Dauerkopfschmerz. Diesen versuchen die Betroffenen wiederum durch die Einnahme weiterer Tabletten zu bekämpfen, wodurch ein Teufelskreis entsteht. Anregungsmittel und anregende Appetitzügler (Stimulanzien) Weitere Medikamente mit einem hohen Suchtpotenzial sind die so genannten Stimulanzien, die allgemein eher unter den Begriffen Appetitzügler oder Schlankheitsmittel bekannt sind. Unter Handelsnamen wie z.B. Recatol, usw. bekannt, wirken sie antriebssteigernd und dämpfen zugleich das Hungergefühl. Der Missbrauch solcher Mittel steht in engem Zusammenhang mit Ess-Störungen wie Magersucht (Anorexie) oder Ess-Brech-Sucht (Bulimie), an denen überwiegend Frauen leiden. Die Arzneimittel enthalten Wirk- 18 stoffe aus der Gruppe der Amphetamine. Aufgrund ihrer euphorisierenden und leistungssteigernden Wirkung besitzen sie ein hohes Suchtpotenzial. Die Nebenwirkungen können Herzrasen, Angst, Schlafstörungen und starke Stimmungsschwankungen umfassen. Nach langfristigem Missbrauch kann es zu Zuständen der Erschöpfung oder Übererregung kommen. Weiterhin sind Herz-Kreislaufprobleme und Ängste bis hin zu Halluzinationen und Wahnvorstellungen möglich. Antidepressiva und Neuroleptika Es gibt aber auch viele Psychopharmaka, bei denen kein Suchtpotenzial festgestellt wurde. Dazu gehören die sehr häufig eingesetzten Antidepressiva und Neuroleptika. Ebenfalls zu den psychoaktiven Medikamenten zählen Antidepressiva und Neuroleptika. Antidepressiva werden zur Behandlung depressiver Beschwerden wie Niedergeschlagenheit, Leeregefühl und Hoffnungslosigkeit, negativem Selbstwertgefühl, Antriebsmangel oder ängstlicher Übererregung eingesetzt. Alle Antidepressiva dienen der Stimmungsaufhellung. Einige haben zusätzlich beruhigend-dämpfenden, andere einen aktivierenden Effekt. Ihre Wirkung basiert darauf, dass sie das Angebot an sogenannten Transmittern, die zu einer normalen Hirnfunktion nötig sind, erhöhen. Sie entsprechen also einer Art Substitution, wie das Insulin. Die Verordnung von Antidepressiva hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, teilweise als Ersatzverschreibung für Benzodiazepine. Hier sind vor allem die so genannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) zu nennen (z.B. Fluctine mit dem Wirkstoff Fluoxe, in USA als Prozac bekannt). Sie besitzen ein anderes Nebenwirkungsspektrum als die herkömmlichen Antidepressiva (z.b. die Trizyklika Anafranil und Surmontil). Obwohl Antidepressiva nicht abhängig machen sollen, werden dennoch in der Literatur Toleranzentwicklungen sowie Absetzsymptome beschrieben. Ausserdem wird zunehmend vor der Verschreibung an Kinder und Jugendliche sowie an alte Menschen gewarnt, wegen der Gefahr auftretender Suizidimpulse als Folge der medikamentös erwirkten Antriebssteigerung. Denn diese erfolgt meist schneller als der Ausstieg aus der Verzweiflung über die als hoffnungslos und düster erlebte Lebenslage. Deshalb kann nicht genug betont werden, dass sich eine Behandlung de- 19 pressiver Menschen, vor allem wenn es sich um schwere Depressionen handelt, nicht auf die medikamentöse Therapie beschränken darf, sondern durch eine eingehende Psychotherapie zur Aufarbeitung der Hintergründe und lebenssituativen Begleitumstände der Depression ergänzt werden muss. Neuroleptika (z.B. Chlorazin, Dapotum, Melleril, Nozinam, Prazine, Trilafon, Chlopixal, Fluanxol, Trixal, Dipiperon, Haldol, Semap, Leponex, Zypresa, Entumin, Seroguel, Dogmatil, Risperdal, Ability, Distraneurin) werden vor allem in der Behandlung von Psychosen – insbesondere Schizophrenien – eingesetzt. Sie wirken vor allem dämpfend, ausgleichend, beruhigend und antriebsmindernd. Zu ihren Nebenwirkungen zählen die Beeinträchtigung der Kontaktfähigkeit, eine Steigerung der Muskelspannung sowie bei Neuroleptika der alten Generation zu Störungen der Bewegungsabläufe (Zittern, Bewegungsunruhe, Wippen, Grimassieren), so genannte parkinsonartige Spätdyskinesien. Diese treten vor allem nach langfristigem Gebrauch auf und können auch nach dem Absetzen des Medikaments bestehen bleiben. In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Neuroleptika entwickelt worden, die zwar auch nicht nebenwirkungsfrei sind, die aber doch meist ein günstigeres Wirkungs- Nebenwirkungsprofil aufweisen. «Mir geht es sehr gut» Annie M. (Name verändert), 68 Jahre, verwitwet, vier Kinder, alleinstehend, Hausfrau, lebt von der Rente ihres Mannes und ist seit vielen Jahren von Benzodiazepin-präparaten im Sinne einer sogenannten low-dose dependence (Niedrigdosierung) abhängig. Wann sind Sie zum ersten Mal mit Psychopharmaka in Berührung gekommen? Das ist schon sehr lange her. Ein knappes Jahr nach der Geburt unseres zweiten Sohnes hatte ich eine Fehlgeburt, die mich sehr mitgenommen hat. Ich fühlte mich damals völlig überlastet und auch alleingelassen in meiner neuen Rolle mit den beiden Kleinkindern. Mein Mann hatte weder Zeit für mich, noch für seine wachsende Familie, weil er sich beruflich etablieren musste. Auch das Thema der Fehlgeburt konnte ich nicht mit ihm besprechen. Es war Mitte der sechziger Jahre, als mir mein damaliger Gynäkologe das erste Mal Valium verschrieben hatte. Über welchen Zeitraum haben Sie dieses Medikament dann eingenommen? Ich habe Valium in verschiedenen Dosierungen über einen Zeitraum von mindestens fünf bis sechs Jahren eingenommen. Weil ich in den folgenden Jahren vermehrt an Schlafstörungen litt, habe ich über einen kurzen Zeitraum zusätzlich Contergarn bekommen, was ein zwar wirksames aber auch, wie sich später herausstellen sollte verheerendes Schlafmittel war. Glücklicherweise habe ich keine geschädigten Kinder geboren. Warum haben Sie weiterhin Medikamente eingenommen? (Quelle: «Nicht mehr alles schlucken …!» Frauen. Medikamente. Selbsthilfe. Ein Handbuch. Herausgegeben von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Hamm) 20 Nun, nachdem auch unser 4. Kind als Nesthäkchen geboren war, kam für mich der erwünschte Wiedereinstieg ins Berufsleben nicht mehr in Frage. Als gelernte Grafikerin konnte ich meine Begabung nur noch hobbymässig und auf Sparflamme ausüben. Weil aus 21 finanzieller Sicht auch keine Notwendigkeit bestand, dass ich arbeiten gehe, rückte die sogenannte Selbstverwirklichung immer weiter in den Hintergrund. Obwohl ich gesunde Kinder, einen mich liebenden Ehemann hatte und wir in einem eigenen Haus wohnten, war ich ganz tief in mir drinnen unglücklich und sehr traurig. An meiner Situation konnte ich aufgrund meines Pflichtbewusstseins und meiner Verantwortung gegenüber den Kindern nichts ändern. Aber meine leicht negative Grundstimmung konnte ich mit den Medikamenten weitgehend ausschalten. Hatten Sie nicht Angst, dass Sie sich auch in ihrer Persönlichkeit verändern würden? Wissen Sie, das ganze Leben verändert einen. Ich denke, da kommt es nicht so sehr auf die Medikamente an, die ich im übrigen sehr gut dosieren kann. Ausserdem bewältige ich bis heute meinen Alltag sehr gut, habe meinen Familien- und Freundeskreis und denke nicht, dass ich mich stark verändert habe. Wie sind Sie denn an Ihre Medikamente gekommen? Dann haben Sie Medikamente nicht wegen gesundheitlicher Probleme genommen? Ich würde sagen beides. Immer, wenn ich die Tabletten absetzen wollte, weil ich nicht davon abhängig werden wollte, wurde ich meistens sehr krank. Ich litt oft an starken Grippeanfällen, die tagelang anhielten, hatte starkes Kopfweh und konnte kaum noch schlafen. Zudem spielte mein Kreislauf völlig verrückt. Diese Beschwerden waren schnell verschwunden, wenn ich wieder meine langjährige Tagesdosis einnahm. Natürlich über meinen Hausarzt, der mir bis heute die Rezepte anstandslos ausstellt. Das ist eine stillschweigende Übereinkunft. Ich hole die Rezepte regelmässig ab, zu einer Untersuchung gehe ich aber nur, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Und meine Apothekerin kennt mich auch schon seit langem. Wie lange ist Ihr Hausarzt Ihr Hausarzt? Seit über 30 Jahren und ich bin sehr zufrieden mit ihm, weil er Wichtiges von Unwichtigem zu trennen weiss und mir sehr gut zuhören kann. Welche Medikamente nehmen Sie heute? Seit den Wechseljahren nehme ich kein Valium mehr, aber ein von der Wirkung ähnliches Präparat. Neben dieser täglichen kleinen Pille nehme ich noch ein spezielles Hormonpräparat. Zudem nehme ich öfter Kopfschmerzmittel und manchmal auch ein Schlafmittel. Also nichts Spezielles. Würden Sie sich heute als gesund bezeichnen? Aber sicher, auch wenn es mit zunehmendem Alter immer öfter mal zwickt, geht es mir sehr gut, dank der Medikamente. Interview Sebastian Kirsch 22 23 Pillen per Internet Wirkungslose und verunreinigte Arzneimittel, gefälschte Präparate, nicht zugelassene Wirkstoffe: Mit der Verbreitung des Internets erhält in der Schweiz ein illegaler Wirtschaftszweig Aufschwung, gegen den die Behörden weitgehend machtlos sind. In der Schweiz ist der Handel mit Arzneimitteln via Internet verboten. Doch Medikamente, die nicht zu der Gruppe der Betäubungsmittel und der psychotropen Stoffe gehören, dürfen in Kleinstmengen dennoch legal in die Schweiz eingeführt werden. Das ist auf eine missverständliche Bestimmung im Heilmittelgesetz zurückzuführen: Diese soll sicherstellen, dass Touristen und Geschäftsleute bei ihrer Einreise eigene Arzneimittel ohne grossen Formularkrieg einführen können – eine Formulierung, die sich Geschäftemacher zunutze machen. Für die Behörden stellt sich aber nicht in erster Linie ein gesetzliches Problem. Die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Geschäfte, mit welchen weltweit Millionen umgesetzt werden, sind begrenzt, weil das Internet nicht überblickbar und schon gar nicht kontrollierbar ist. Weil überdies weit über 90 Prozent der Postsendungen aus dem Ausland unbesehen und ungeöffnet zum Empfänger kommen, wird der überwiegende Teil der Lieferungen gar nie entdeckt. Selbst eine Vervielfachung der Zollkontrollen änderte daran nichts. Schätzungen des Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic gehen davon aus, dass im vergangenen Jahr rund 40’000 Medikamentensendungen in die Schweiz gelangten, die via Internet bestellt wurden. Aber gerade diese Art von Einkauf kann gravierende «Nebenwirkungen» haben. Das Institut in Bern hat zahlreiche Medikamente aus dem Internet bestellt und überprüft. Das Ergebnis ist alarmierend. Nur drei von 17 Arzneimitteln konnten mit einem kalkulierbaren gesundheitlichen Risiko eingenommen wer- 24 den. Es handelte sich dabei um Originalpräparate eines bekannten Herstellers in Originalverpackung mit ausführlichem Beipackzettel. Mehr als 80 Prozent aber waren mangelhaft. Von der losen Verpackung über den fehlenden oder unverständlichen Beipackzettel bis hin zu Angaben, die nicht mit dem Inhalt übereinstimmten oder gar verunreinigte Substanzen fand die Kontrollstelle. Auch die Qualität der Medikamente lässt zu wünschen übrig. Zum Beispiel zerbröselten Tabletten, sobald sie aus dem Blister herausgedrückt wurden. Die deutsche Ärzteschaft stellte gar noch gravierendere Verstösse fest. Ein Medikament, das als Antidepressivum verkauft wurde entpuppte sich zum Beispiel als Mittel gegen epileptische Anfälle und Herzrhythmusstörungen. Verbotene Substanzen Nach Einschätzung von Swissmedic sind rund ein Fünftel der via Internet bestellten und eingeführten Medikamente verbotene Importe von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen für den Eigengebrauch. Das Internet ist für den Erwerb auch deshalb interessant, weil über die dubiosen Kanäle Produkte angepriesen werden, die in der Schweiz gar nicht zu haben sind – etwa das bei Vielfliegern beliebte Schlafmittel Melatonin. Besonders beliebt sind aber auch potenzsteigernde Mittel, die auf diese Weise anonym und ohne den oft als peinlich empfundenen Arztbesuch erworben werden können. Doch «viele der im Internet angebotenen Medikamente sind in der Schweiz verboten, überteuert, qualitativ schlecht oder gar verfälscht», warnt Swissmedic in einem Merkblatt. Der deutsche Ärzteverband brachte die Mahnung in Anspielung auf die mit dieser Form des Handels verbundenen Risiken auf die eingängige Kurzformel «Exitus statt Koitus». Für nachgemachte, umgepackte, unterdosierte oder abgelaufene Arzneimittel sind die Schweiz und andere westliche Länder besonders attraktiv. Vor allem Aids-Medikamente werden von den Herstellern in Drittweltländern teilweise zu einem Bruchteil des in Europa zu bezahlenden Preises abgegeben – was solche Produkte für Teilfälschungen interessant macht. So befanden sich unter den von den Schweizer Behörden beschlagnahmten Aids-Medikamenten für andere Län- 25 der bestimmte Originale, die umgepackt worden waren. Die Gewinnmargen mit diesen illegal verschickten Medikamenten sind riesig, vergleichbar mit jenen aus dem Drogenhandel. Die Pharmaindustrie verliert in der Folge viel Geld – Schätzungen gehen von rund zwei Milliarden Franken pro Jahr aus. Laut einem Bericht der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) vom Februar 2004 haben die Fälle von Medikamentenfälschungen in den USA seit 2001 sprunghaft zugenommen. Vor zwei Jahren stiessen auch Schweizer Zollbeamte auf eine Sendung von 22’000 gefälschten Viagra-Tabletten. Im vergangenen Jahr konfiszierten die Behörden eine Lieferung mit illegalen AidsMedikamenten. Vor diesem Hintergrund dürfte der Internethandel mit Medikamenten für die Industrieländer auf Jahre hinaus eine Herausforderung darstellen. Wann liegt Medikamentenmissbrauch vor? Medikamentenmissbrauch ist ein in allen sozialen Schichten weit verbreitetes Problem mit sehr hoher Dunkelziffer, weil die Grenzen zwischen therapeutischer Anwendung, riskantem Gebrauch und Missbrauch fliessend sind. Ebenso fliessend ist der Übergang zwischen Missbrauch und Abhängigkeit. Wie bereits vorher erwähnt, haben Medikamente neben ihren erwünschten Wirkungen auch immer Nebenwirkungen. Bei längerer Einnahme kann eine dieser Nebenwirkungen in Form von einer Abhängigkeit zum Ausdruck kommen. Ein Missbrauchsrisiko besteht vor allem bei Medikamenten mit: • • • • • stimulierender, beruhigender und schmerzstillender Wirkung sowie bei Medikamenten, die leichtfertig verschrieben und / oder die mit einer aufdringlichen Werbestrategie propagiert werden. Definition nach WHO Von Medikamentenmissbrauch spricht man in der Regel, wenn Medikamente ohne entsprechende Indikation, in einer die Verschreibung übersteigenden Dosierung oder länger als notwendig eingenommen werden. Bei einer Abhängigkeit bzw. Sucht kommen noch weitere Kriterien hinzu, welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1957 folgendermassen definiert hat: Sucht ist ein Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge – gekennzeichnet durch vier Kriterien: • Unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und Beschaffung des Mittels • Tendenz zur Dosissteigerung (Toleranzerhöhung) • Psychische und meist physische Abhängigkeit von der Wirkung der Droge • Schädlichkeit für den Einzelnen und / oder die Gesellschaft. Quelle: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic; Bern 26 27 Abhängigkeit hat eine psychische und eine körperliche Seite. Psychische Abhängigkeit ist das zwingende Verlangen, das Medikament einzunehmen um seine psychischen Wirkungen zu erleben. Körperliche Abhängigkeit ist verbunden mit Toleranzentwicklung. Durch Anpassungsvorgänge im Körper werden zunehmend grössere Mengen vertragen bzw. ist zur Erreichung der erwünschten Wirkung eine Dosissteigerung notwendig. Ausserdem treten beim Absetzen der Substanz Entzugserscheinungen auf. Wie oben bereits erwähnt kann die Abgrenzung zwischen Abhängigkeit und Missbrauch im Einzelfall schwierig sein. Beim Gebrauch von rezeptpflichtigen Medikamenten ist, im Unterschied zum Konsum anderer psychotroper Substanzen (Tabak, Alkohol, illegale Drogen) zu beachten, dass über die medizinische Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme immer der Arzt oder die Ärztin entscheidet. Im Gegensatz zu den freiverkäuflichen, nicht rezeptpflichtigen Substanzen müsste dadurch ein Schutz vor Missbrauch und Abhängigkeitsentwicklungen gewährleistet sein. Dennoch gibt es einige Lücken, so können z. B. mehrere Ärzte zur Verschreibung des gleichen, psychisch wirksamen Medikamentes aufgesucht werden. Dieses Verhalten ist als deutliches Warnzeichen für eine entstehende oder bestehende Abhängigkeit zu werten. Der folgende Test kann eine kleine Orientierung zur Einschätzung des Risikos einer Medikamentenabhängigkeit bieten: Kurzfragebogen zum Medikamentengebrauch Die folgenden Aussagen beschreiben eine Reihe von Gewohnheiten und Schwierigkeiten, die sich bei der häufigen Einnahme von Medikamenten einstellen können. Der Fragebogen hilft, riskante Formen des Medikamentengebrauchs – bei Ihnen selbst oder auch im Familien- und Freundeskreis – zu erkennen und einzuschätzen. Die Aussagen beziehen sich nur auf Medikamente, die eingenommen werden, um • die Stimmung zu verbessern, • besser schlafen zu können, • leistungsfähiger zu sein, • Schmerzen zu lindern oder • ruhiger zu werden. Prüfen Sie bei jeder Aussage, ob diese auf Sie zutrifft oder nicht und kreuzen Sie dann das entsprechende Kästchen an. Bitte nehmen Sie zu allen Aussagen Stellung, lassen Sie keine davon aus. Trifft zu Trifft nicht zu 1. Ohne Medikamente kann ich schlechter einschlafen. 2. Ich habe mir sicherheitshalber schon einmal einen kleinen Tablettenvorrat angelegt. 3. Zeitweilig möchte ich mich von allem zurückziehen. 4. Es gibt Situationen, die schaffe ich ohne Medikamente nicht. 5. Andere glauben, dass ich Probleme mit Medikamenten habe. 6. Die Wirkung meiner Medikamente ist nicht mehr so wie am Anfang. 7. Weil ich Schmerzen habe, nehme ich oft Medikamente. 8. In Zeiten erhöhter Medikamenteneinnahme habe ich weniger gegessen. 9. Ich fühle mich ohne Medikamente nicht wohl. 10. Manchmal war ich selbst erstaunt, wie viele Tabletten ich an einem Tag eingenommen habe. 11. Mit Medikamenten fühle ich mich oft leistungsfähiger. Wenn bei Ihnen vier oder mehr Aussagen zutreffen, sollten Sie erwägen, mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker über das Thema Medikamentengebrauch zu sprechen. (Quelle: Watzl, Rist, Höcker & Miehle, 1991) 28 29 Jahresbericht des Präsidenten Jahresberichte berichten. Soviel ist klar. Und worüber? Über das was im vergangenen Jahr getan wurde. Ganz einfach! Was also gibt’s Neues in der Stiftung Bündner Suchthilfe? Schnell gesagt: Die Homepage ist neu. Sie finden im world wide web Wichtiges und Neues zur Stiftung Bündner Suchthilfe – auch darüber, was im vergangenen Jahr geleistet wurde: www.suchthilfe.gr.ch. Im Jahr 2004 hat die Stiftung • die neue Homepage erstellt • das Erscheinungsbild für den Präventionswettbewerb neu gestaltet: suchthilfe.grandprix • den ersten Suchtreport vorgelegt Neben Neuem hat die Stiftung auch Bewährtes fortgeführt. Sie unterstützt den Verein Überlebenshilfe Graubünden genauso wie andere gesundheitsfördernde und präventive Projekte. Wenn in ganz Italien das Rauchen in Bars und Ristoranti verboten wird, wenn der Gemeinderat in Chur eine Debatte über ein solches Verbot führt (und knapp ablehnt), wenn die Promillegrenze für Autofahrer von 0.8‰ auf 0.5‰ gesenkt wird, wenn auch das Fahren unter Medikamenten- und Drogeneinfluss schärfer kontrolliert wird, dann wird das Wissen und Reden um Risiken, Schäden und Gefahren der Suchtmittel in Taten umgesetzt. Auch das sind Entwicklungen des vergangenen Jahres. Erfreulich daran ist, dass die schwerwiegenden gesundheitlichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen vom Suchtmittelkonsum ernst genommen werden. Solche Massnahmen schützen vor allem unbeteiligte Dritte und setzen sie nicht willkürlich negativen Wirkungen aus. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen im Stiftungsrat für offene und kritische Diskussionen und zielorientiertes kollegiales Arbeiten. Andrea Mauro Ferroni Präsident Stiftung Bündner Suchthilfe 30 31 Jahresabschluss per 31. Dezember 2004 Bilanz in % 31.12.2004 31.12.2003 1.9% 4.8% 3.9% 0.2% 1.9% 22’360.68 55’927.20 44’935.10 2’592.95 22’228.20 6’989.69 67’823.50 49’635.95 2’695.15 6’915.70 42.4% 27.1% 17.8% 492’500.00 314’274.00 206’963.00 500’000.00 314’274.00 206’963.00 100.0% 1’161’781.13 1’155’296.99 0.0% 21.9% 78.1% 0.00 254’299.54 907’481.59 0.00 253’034.54 902’262.45 100.0% 1’161’781.13 1’155’296.99 Budget 2004 31.12.2004 31.12.2003 4000 Aufwand 4010 Sitzungen, Revisionen, Allg. Kosten 3’500.00 4011 Drucksachen, Kopien, Porti 10’100.00 4015 Bank- und Postcheckspesen, Komm. 700.00 4020 Beiträge Arbeitsgruppen 0.00 4025 Beiträge Aktionen 15’000.00 4040 Sozialleistungen Arbeitgeber 0.00 4810 Suchtpräv./Gesundheitsförderung 12’000.00 4990 Uebrige Aufwendungen 10’000.00 Total Aufwand 51’300.00 9890 Jahresergebnis Legat Trägerverein -10’750.00 9990 Jahresergebnis Stiftung 3’450.00 3’500.00 7’952.05 619.01 0.00 13’443.60 0.00 0.00 13’549.90 39’064.56 1’265.00 5’219.14 3’750.00 1’299.60 539.55 0.00 10’072.90 0.00 20’947.45 0.00 36’609.50 -19’414.90 1’804.25 Gesamt-Total 45’548.70 18’998.85 1000 1010 1013 1021 1070 1090 1100 1101 1100 1500 Aktiven – Umlaufvermögen GKB Chur, CK 302.942.500 CK Kto.Krt. GKB Chur, CA 302.942.501 CA Capito UBS Chur, Q0-816.757.1 SK Debitoren: Eidg. Verrechn-Steuer Transitorische Aktiven Aktiven – Anlagevermögen Darlehen an Verein für Ueberlebenshilfe Wertpapiere bei der GKB Chur Wertpapiere bei der UBS AG, Chur Total Aktiven 2000 2090 2800 2900 Passiven Transitorische Passiven Legat Trägerverein Suchtprävention GR Eigenkapital Total Passiven Erfolgsrechung 6000 6010 6020 6030 6050 6830 6850 6890 6990 Total Ertrag 32 44’000.00 Ertrag Spenden und Sponsorenbeiträge 1’000.00 Zweckbest. gemeinnützige Beiträge 20’000.00 Zinsertrag Stiftung 21’750.00 Wertberichtigungen Stiftung 0.00 Zinsertrag Legat Trägerverein 1’250.00 Wertberichtigungen Legat Trägerverein 0.00 Übrige Erträge Legat Trägerverein 0.00 Übrige Erträge Stiftung 0.00 44’000.00 2’983.80 20’000.00 21’299.90 0.00 1’265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17’466.30 0.00 1’532.55 0.00 0.00 0.00 45’548.70 18’998.85 An den Stiftungsrat der Bündner Suchthilfe 7000 Chur 22. Februar 2004 Revisorenbericht über das Geschäftsjahr 2004 Sehr geehrte Damen und Herren Die Jahresrechnung der Stiftung Bündner Suchthilfe für das Jahr 2004 haben wir geprüft und festgestellt, dass • die Buchhaltung sauber geführt wurde • die Buchungsbelege vorhanden sind • die Buchhaltung mit den Belegen übereinstimmt • das Anlagevermögen gemäss den angewandten Anlagevorschriften (Niederstwertprinzip) bilanziert ist • Aktiven und Passiven einen Saldo von CHF 1’161’781.13 aufweisen • der Reingewinn für das Jahr 2004 CHF 6’484.14 beträgt und dieser wie folgt verrechnet wurde: als positive Ergebnisse mit CHF 5’219.14 zugunsten des Eigenkapitals und CHF 1’265.00 zugunsten des Legats Trägerverein Suchtprävention Graubünden. Wir beantragen, dem Kassier für seine geleisteten Arbeiten Décharge zu erteilen. Die Revisoren: sig. Urs Steinbacher, UBS AG sig. Werner Simmen, Graubündner Kantonalbank 33 Schlusswort des Präsidenten «Sucht beginnt im Alltag. Prävention auch». Die Stiftung Bündner Suchthilfe trägt dieser Tatsache Rechnung, indem sie Projekte der Suchtprävention in allen Lebensbereichen der Menschen unterstützt: In der Welt der Kinder und Jugendlichen genauso, wie in jener der Familie, der Arbeit und der Freizeit. Die Stiftung hilft aber auch Menschen mit Suchtproblemen im Kanton und unterstützt konkrete Angebote im Bereich der Behandlung und der Überlebenshilfe. Damit engagiert sie sich für diejenigen, die durch ihre Abhängigkeit von Suchtmitteln kein normales Leben mehr führen können. Die Stiftung tut dies mit ihren eigenen Geldmitteln. Sie ist aber immer auch auf Spenden angewiesen. Spenden von Menschen, die gewillt sind, die Stiftung zu unterstützen und die es beispielsweise sinnvoll finden, das Bewusstsein um die Gefahren von Suchtmitteln wach zu halten. Für den Stiftungsrat Andrea Mauro Ferroni, Präsident Mitglieder des Stiftungsrates Andrea Mauro Ferroni*, Präsident Erika Fetz*, Vizepräsidentin Thomas Günter* Hans Joss Marlies Lötscher Dr. Hans Ulrich Nänni Silvia Scharplatz Hans Senti-Pfister*, Finanzen Dr. Urs Wülser Hanspeter Joos* Dr. Reto Parpan Alle mit einem * = Arbeitsausschuss 34 35 Stiftung Bündner Suchthilfe Gürtelstrasse 89 · 7001 Chur 36 Telefon 081 257 26 50 Telefax 081 257 21 48