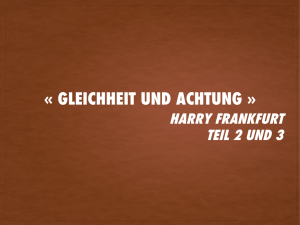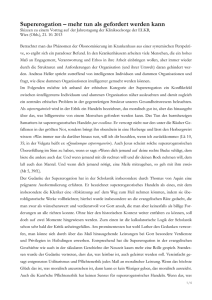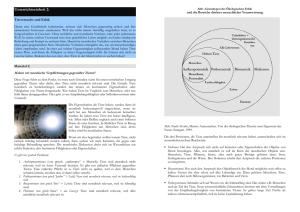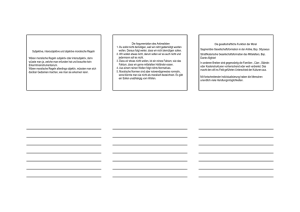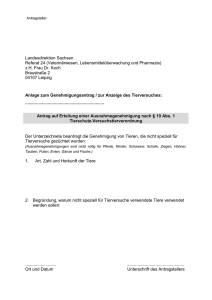Ethik der Tierversuche
Werbung

Ethik der Tierversuche Auf der Suche nach einem neuen Paradigma Prof. Dr. Klaus Peter Rippe Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Interdisziplinäres Zentrum Medizin-Ethik-Recht Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Lilie 2 Prof. Dr. Hans Lilie (Hrsg.), Schriftenreihe Medizin-Ethik-Recht, Band 37, 2012 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: ISSN 1862-1619 ISBN 978-3-86829-461-3 Schutzgebühr Euro 5 Interdisziplinäres Zentrum Medizin-Ethik-Recht (MER) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Universitätsplatz 5 D- 06108 Halle (Saale) [email protected] www.mer.jura.uni-halle.de Tel. ++ 49(0)345-55 23 142 3 Gliederung Einführung .................................................................................................................. 4 1. Wen es herauszufordern gilt: Das heutige ethische Paradigma ............................. 6 2. Sollte man bei diesem Paradigma bleiben? ........................................................14 3. Könnte man dies nicht alles regelutilitaristisch begründen? ................................18 4. Die Herausforderer..............................................................................................22 Literatur .....................................................................................................................35 4 Einführung Es ist sinnvoll, eine weite von einer engen Definition des Begriffs Tierversuch zu unterscheiden. Als Tierversuche gelten im weiten Sinne alle Experimente, in denen Tiere als Forschungsobjekt genutzt werden, und dies unabhängig davon, ob die Tiere belastet werden oder nicht. Ein wissenschaftlicher Fütterungsversuch an Blaumeisen stellt somit einen Tierversuch dar, und dies auch dann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass die Tiere auf Grund des Versuchs leiden, Stress haben oder in sonstiger Weise belastet werden. Im engen Sinne bezeichnen wir aber allein jene wissenschaftliche Tätigkeit als Tierversuche, in denen tierisches Leid erzeugt oder bewusst in Kauf genommen wird, um einen Erkenntnisgewinn zu ermöglichen. Auf Grund modellhafter Eingriffe am Tier sollen in solchen belastenden Tierversuchen Aufschlüsse über Funktionen, Erkrankungen und Therapieoptionen von Organismen, insbesondere des menschlichen Organismus, erlangt werden. Die Belastung kann in einer gezielten Schädigung bestehen, sei es beispielsweise, dass dem Tier potentiell giftige Stoffe injiziert werden, operative Eingriffe vorgenommen oder Verletzungen herbeigeführt werden. Sie kann aber auch darin bestehen, dass Erkrankungen und Schädigungen unbehandelt bleiben. Zudem ist die Herstellung transgener Tiere oder Weiterzucht natürlicher Mutanten zu nennen, wo in Kauf genommen wird, dass Tiere in ihren Fähigkeiten und Funktionen beeinträchtigt sind, erkranken oder in anderer Weise leiden. Die ethische Diskussion bezieht sich ausschließlich auf belastende Tierversuche, und auch hier werde ich mich auf diese konzentrieren. Denn Tierversuche im engen Sinne des Begriffs stellen seit Entwicklung dieser wissenschaftlichen Methode eine moralische Herausforderung dar: Was bei anderen Nutzungsnormen die Abweichung von der gebotenen Norm ist, die vorsätzliche Zufügung von Leiden, wird in solchen Versuchen zur Norm. Man wird einwenden, dass auch Landwirte von je her Schweine kastrieren und Kühe enthornen und so doch auch Tieren bewusst Leid zufügen, ohne gegen weit verbreitete moralische Auffassungen zu verstoßen. Aber solche Handlungen sind Ausnahmefälle in der Landwirtschaft, während Tierversuche den Regelfall der Labortätigkeit von Wissenschaftlern darstellen. Wenn man ferner einwendet, dass ein zu ideales Bild der Landwirtschaft gezeichnet wird und Tiere doch auch hier in der Regel leiden, so muss man betonen: Es geht hier um moralische 5 Normen, also um gesellschaftliche Vorstellungen, wie Landwirte handeln sollen, nicht um die landwirtschaftliche Wirklichkeit, anders gesagt: es geht um Verhaltenserwartungen, nicht um konkretes Verhalten. Leiden Tiere in der Landwirtschaft, haben wir in der Regel ein Auseinanderklaffen von Normen und Wirklichkeit; leiden sie in der Forschung, geschieht dies in der Regel im Einklang mit dem, was man von guten Wissenschaftlern erwartet. Dies ist Ausgangspunkt der ethischen Diskussion um Tierversuche. Halten Tierversuchsgegner Tierversuche prinzipiell für unmoralisch, so sind Befürworter nicht nur der Ansicht, dass sie moralisch zulässig sind, sie halten sie sogar für moralisch geboten. Tiere würden hier für weit löblichere Zwecke genutzt als in Landwirtschaft oder Haustierhaltung. Frühere Tierversuche hätten ermöglicht, dass etliche Krankheiten des Menschen effizient behandelt werden können, und genauso sei zu erwarten, dass Tierversuche auch in Zukunft wesentlich dazu beitragen werden, das Leid von Menschen zu reduzieren und deren Leben zu verlängern. Der durch die Versuche mögliche Nutzen rechtfertige Tierversuche nicht nur, angesichts des bestehenden menschlichen Leids sei es eine moralische Pflicht, diese Praxis fortzuführen. Trotz der Entschiedenheit der Positionen sind sich Befürworter und Gegner nicht immer bewusst, auf welche ethische Position sie sich stützen, geschweige, dass sie wissen, auf welche Voraussetzungen diese aufbaut. Angesichts dessen verfolgt dieser Aufsatz zwei Ziele. Zum einen geht es in einer Auslegeordnung darum, welche ethischen Positionen heute ernsthaft vertreten werden können. Dabei stelle ich einer das deutschsprachige Recht wohl prägenden ethischen Ansicht mögliche Alternativen gegenüber. Der Begriff "ethisch" bezieht sich dabei auf die Wissenschaft von der Moral; den Begriff der "Moral" gebrauche ich für jene Verhaltenserwartungen und Überzeugungen, die Personen vortheoretisch über das Richtige und Falsche haben. Bisher war also nur von Moral die Rede, ethische Fragen wurden noch nicht behandelt. Zum anderen werde ich untersuchen, welche Position als Paradigma gewählt werden sollte. Ich werde Schwierigkeiten aufzeigen, welche die heutige paradigmatische Position hat, und die These vertreten, dass wir uns von dieser Position verabschieden sollten. Im Folgenden werde ich stets voraussetzen, dass die Forschenden ihre wissenschaftlichen Hausaufgaben gemacht haben. Sie haben ein sinnvolles Forschungsde- 6 sign, das statistisch durchdacht ist bzw. sie haben sich von einem Statistiker beraten lassen. Zudem arbeiten sie methodisch sorgfältig und exakt. Ich spreche also nur von wissenschaftlich angemessenen Versuchen und lasse jene außen vor, die bereits auf dieser Ebene abzulehnen sind. 1. Wen es herauszufordern gilt: Das heutige ethische Paradigma Es wäre übertrieben, wollte man behaupten, eines der deutschsprachigen Tierschutzgesetze sei eine vollkommen kohärente Wiedergabe einer spezifischen ethischen Position. Dagegen spricht zum einen, dass bei der Ausformulierung rechtlicher Normen unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Interessen mitwirken und es politisch oft nur darum gehen kann, mehrheitsfähige Kompromissformeln zu finden. Zum anderen sind sich jene Personen, welche in einem Gesetzgebungsverfahren mitwirken, nicht immer bewusst, welche ethische Position ihr eigenes Denken prägt. Wenn man die deutschsprachigen Gesetze1 betrachtet, ist aber doch auffällig, dass hier eine spezifische Sprache gewählt wird, die auf eine einzige ethische Theorie hinweist. Auch wenn es falsch wäre, von einer Eins-zu-eins-Übertragung einer ethischen Theorie ins Recht zu sprechen, kann man doch von einem vorherrschenden Paradigma sprechen. Ob dieses bewusst gewählt wurde oder ob die zufällige Ausbildung oder Prägung von beteiligten Experten eine Rolle spielte, soll hier nicht interessieren. 1.1 Allgemeine Zuordnung Tieren ungerechtfertigt Leiden, Schmerz, Angst und andere Belastungen zuzufügen, ist nach diesen Gesetzen generell verboten. Es bedarf stets einer Begründung, um Handlungen dieses Typs vorzunehmen. Im deutschen und österreichischen Tierschutzgesetz dehnt sich diese Betrachtung auch auf die Tötung von Tieren aus. Hier 1 Ob auch Tierschutzgesetze anderer Länder von dem hier beschriebenen ethischen Denkansatz geprägt sind, kann an dieser Stelle nicht untersucht werden. Eine Erweiterung des Blicks wäre sicher sinnvoll, sprengte aber den Umfang dieses Aufsatzes. 7 wird davon gesprochen, dass es einen vernünftigen Grund braucht, dies zu tun. Einzig das Schweizer Recht kennt keinen Lebensschutz für Tiere.2 Es charakterisiert den Tierversuch im engen Sinne, dass Tieren Leid, Schmerz, Angst oder andere Belastungen zugefügt werden, um an Hand dessen etwas zu lernen. Die Leidzufügung ist Mittel für einen guten Zweck. Dies kann ein Erkenntnisgewinn sein, es mögen auch neue Therapieoptionen eröffnet werden oder wie bei toxikologischen oder ökotoxikologischen Untersuchungen Gefahren und Risiken ermittelt werden. Aber dies ändert nichts daran, dass die Handlung selbst dadurch charakterisiert ist, dass Tieren intentional ein Schaden zugefügt wird oder dieser intentional in Kauf genommen wird. Das Tierschutzrecht geht in allen deutschsprachigen Ländern davon aus, dass Tierversuche durchgeführt werden dürfen, wenn sie in einer Güterabwägung gerechtfertigt werden können. Wir bewegen uns mit dieser Formulierung in einem deontologischen Paradigma. Als deontologisch bezeichnet man ethische Theorien, gemäß denen Handlungen eines bestimmten Typs unabhängig von den jeweiligen Handlungsfolgen richtig oder falsch sind. Im Gegensatz zu regelkonsequentialistischen Theorien fußen die so formulierten Pflichten nicht auf Überlegungen, dass sie für alle Betroffenen den größten Nutzen bringen. Vielmehr werden spezifische Handlungstypen unabhängig von den daraus erwachsenden typischen Handlungsfolgen für gut oder schlecht gehalten. Einige deontologische Theorien formulieren unbedingte Unterlassungspflichten. Das heißt: Handlungen eines bestimmten Typs dürfen für keinen auch noch so guten Zweck durchgeführt werden. Daneben werden aber stets sogenannte prima facie-Pflichten formuliert. Andere deontologische Theorien, wie etwa jene von W.T. Ross, gehen sogar davon aus, dass nur prima facie-Normen bestehen. Damit bezieht man sich auf Handlungstypen, die allgemein moralisch richtig oder falsch sind, bei denen aber 2 In der Botschaft zur Revision des Schweizer Tierschutzgesetzes heißt es klar und eindeutig: „Das Gesetz schützt die Würde und das Wohlergehen des Tieres, nicht aber sein Leben. Das Töten von Tieren, beispielsweise bei der Schlachtung ist wie bisher erlaubt, sofern die Rahmenbedingungen des Tierschutzgesetzes eingehalten werden.“ (Botschaft des Bundesrats zur Revision des Tierschutzgesetzes vom 9. September 2002 (BBI 2003 657) , S. 18) In Deutschland erfolgte die Ausdehnung der Schutzziele 1972. Albert Lorz, ein Kommentator des Tierschutzgesetzes, schreibt hierzu: „Ein bemerkenswerter gesetzgeberischer Fortschritt liegt in der erweiterten Schutzrichtung. Sie umfasst nunmehr auch das Leben des Tieres. Dem steht nicht entgegen, dass der Mensch bei einer Minderheit von Tierarten im Interesse der eigenen Existenz, namentlich zur Nahrungsgewinnung und Schädlingsbekämpfung, Tiere tötet oder töten muss oder dass er dies zur Ernährung von Tieren tut.“ Lorz, Die Entwicklung des deutschen Tierschutzrechts, S. 137. 8 möglich ist, dass sie von anderen moralischen Geboten oder Verboten übertrumpft werden. Beim Gebot, Tieren kein Leid zuzufügen, handelt es sich gemäß der deutschsprachigen Tierschutzgesetze um eine prima facie-Norm, keine unbedingte Unterlassungspflicht. Eine Handlung dieses Typs darf gewählt werden, wenn es für das eigene Überleben notwendig ist oder wenn überwiegende moralische Gründe dieses Tun rechtfertigen. Die modernen Tierschutzgesetze gehen dabei nicht davon aus, dass Tierschutz letztlich Menschenschutz ist, es also um die Bekämpfung moralischer Verrohung geht. Nicht um der Menschen, sondern um der Tiere willen, dürfen Tiere nicht gequält werden. Auch wenn empfindungsfähige Tiere damit als moralische Objekte angesehen werden, sind sie im Vergleich zum Menschen doch moralische Objekte zweiter Klasse. Die Tötung des Tiers kann durch einen vernünftigen Grund gerechtfertigt werden, nicht aber jene des Menschen.3 Dass Tieren nicht ungerechtfertigt Leiden zugefügt werden soll, schließt nicht aus, dass Tiere für menschliche Zwecke genutzt werden dürfen. Menschen in ähnlicher Weise zu nutzen, also ohne Einwilligung als Blindenführer, Wächter, Nahrungsquelle oder für Forschungszwecke einzusetzen, wäre prinzipiell moralisch falsch. Das deutschsprachige Tierschutzrecht geht von einer moralischen Hierarchie der Lebewesen aus, in der Menschen und Tiere gänzlich unterschiedliche Stellungen einnehmen. Gegenüber Nutz-, Heim- und Versuchstieren haben die Halter zudem eine besondere Verantwortung. Sie haben eine Fürsorgepflicht ihnen gegenüber und haben sie, sofern es nicht anderen schutzwürdigen Interessen, sprich Pflichten, widerspricht, vor Leid und Schmerz zu schützen. Das bisher Gesagte reicht bereits aus, den allgemein gewählten Ton des Tierschutzgesetzes noch spezifischer einer philosophischen Grundposition zuzuordnen. Auch wenn viele andere deutschsprachige Gesetze eine kantianische Sprache sprechen, so müssen wir die Quelle hier an anderem Ort suchen. Denn für Kant war das Tier eine Sache, und allein die mögliche Verrohung der Täter begründet indirekt einen Tierschutz. Auch wenn im Umgang mit Tieren nur prima facie-Normen bestehen, so 3 Eine Ausnahme stellt der finale Rettungsschuss zu, die intentionale Tötung eines Menschen, um andere zu retten. 9 gibt es im deutschsprachigen Recht doch auch unbedingte Unterlassungspflichten. Wir bewegen uns also auch nicht im Rahmen der Deontologiekonzeption von Ross. Wir haben hier eine natur- oder wie man auch sagt vernunftrechtliche Position vor uns, die innerhalb der Stoa4, insbesondere von Cicero, entwickelt und dann im Christentum weitergetragen wurde.5 1.2 Rechtfertigende Gründe? Immer dann, wenn Menschen Tieren intentional Leid zufügen, bedarf es gemäß der deutschsprachigen Tierschutzgesetze einer Rechtfertigung. Ebenso ist die Tötung, so das deutsche und österreichische Recht, nur erlaubt, wenn ein vernünftiger Grund für die Tötung vorliegt. Welche rechtfertigenden Gründe sind hier aber angesprochen? Und was macht einen Grund zu einem vernünftigen Grund? Liegt den Tierschutzgesetzen die oben genannte Deontologie zugrunde, können diese Fragen wie folgt beantwortet werden: Es reicht nicht aus, dass der Handelnde irgendeinen Grund nennt. Nicht-moralische Gründe reichen nicht, eine Prima facie-Pflicht zu vernachlässigen. Das ästhetische Interesse an einem bestimmten Aussehen ist zum Beispiel kein Grund, der das Kupieren von Hunden rechtfertigt. Auch der Verweis auf das Eigeninteresse reicht nicht. Nehmen wir einen Rechtsfall aus der Landwirtschaft. Ein Bauer hat eine Kuh erfolglos medikamentös behandeln lassen. Die Kuh siecht nur mehr dahin und leidet. Der Landwirt wartet nun mehrere Tage ab, in der Hoffnung, dass das Fleisch doch freigegeben wird. Wir haben hier eine strafbare Handlung vor uns. Finanzielles Eigeninteresse ist kein Grund, Tiere leiden zu lassen. Klar ist ferner, dass Freude kein rechtfertigender Grund ist. Dies wäre sogar eine besonders verurteilte Form der ungerechtfertigten Leidzufügung: sadistische Handlungen am Tier. Die Rechtfertigung kann nur auf zweierlei Art erfolgen. Entweder ist die spezifische Nutzung für den Selbsterhalt des Menschen notwendig oder es gibt moralische 4 Ziel menschliche Lebens ist ein Leben in Einklang mit der Natur. In der Natur entfaltet sich die Vernunft, so dass ein Leben in Einklang mit der Natur zugleich ein vernünftiges Leben ist. 5 Sie spiegelt sich mit kleineren oder größeren Nuancen ebenso im Katholischen Katechismus wie in der evangelisch geprägten Theorie Albert Schweitzers, welche die Ehrfurcht vor dem Leben einfordert. Es würde hier zu weit gehen, auf alle Spielarten einzugehen. Eine kurze und prägnate Formulierung dieser Position findet sich in Spaemann, Tierschutz und Menschenwürde. 10 Gründe, welche die Handlung rechtfertigen Die Tötung von Tieren für den menschlichen Fleischkonsum wäre nach dieser Position nur zu rechtfertigen, wenn dadurch die Ernährungssicherheit sichergestellt wird. Die Freude am Fleischessen wäre kein rechtfertigender Grund. Die Enthornung von Kühen wäre, um ein anderes Beispiel zu nennen, nicht durch betriebswirtschaftliche Gründe rechtfertigbar, sondern nur durch Sicherheit für Menschen. Allenfalls rechtfertigten diese Übergangsfristen, um eine Umstellung auf andere Haltungsformen vornehmen zu können. Es braucht kaum gesagt zu werden, dass diese Überlegungen nicht dem entsprechen, wie heute das Recht durchgesetzt wird. Gerade bei den Rechtfertigungsgründen sieht man auf Gesetzesebene eine Aufweichung gegenüber der deontologischen ethischen Hintergrundstheorie. Denn sehr oft reichen wirtschaftliche Überlegungen aus, den Tierschutz einzuschränken. Natürlich werden solche betriebswirtschaftlichen Gründe im politischen Kontext als volkswirtschaftliche vorgebracht. Aber auch die größere Wohlfahrt vieler reicht nicht aus, etwas zu tun, was moralisch unzulässig ist. 6 Wenn tausend Bauern tausend oder hunderttausend Kühe leiden lassen, um höhere Einkommen zu erzielen, wäre dies von einer deontologischen Position genauso wenig erlaubt, wie wenn ein Bauer wegen des eigenen Profits eine oder hundert Kühe leiden lässt. Erst wenn tierisches Leid auf das notwendige Minimum reduziert wurde, dürfen betriebs- und volkswirtschaftliche Überlegungen ins Spiel kommen. Wieso wird dann aber die heutige Form der Landwirtschaft rechtlich gebilligt? Man geht wohl davon aus, dass die landwirtschaftliche Praxis so geregelt ist, dass die betroffenen Tiere nur so wenig leiden wie notwendig. Der Begriff des Notwendigen hat sich dabei wie auch in anderen wirtschaftlichen Kontexten auf betriebswirtschaftlich Notwendiges ausgedehnt.7 Diese begriffliche Ausdehnung unterhöhlt freilich den moralischen Kern des Tierschutzgesetzes. Auch Vertreter des hier angesprochenen ethischen Paradigmas werden vielen Formen der heutigen Massentierhaltung kritisch gegenüber- 6 Auch dieser Punkt findet sich klar vorgetragen bei Robert Spaemann. Dieser schreibt: „Solche Schmerzzufügung bzw. artwidrige Tierhaltung kann nicht gegenüber irgend einem anderen Nutzen des Menschen als dem der Vermeidung gleichwertiger Schmerzen oder der Lebensrettung aufgerechnet werden. Wirtschaftliche Vor- und Nachteile dürfen hier gar nicht in Anschlag gebracht werden (....).“ (Spaemann, Tierschutz und Menschenwürde, S. 78). Diese fänden wie wissenschaftliche Interessen „ihre Grenzen an den allgemeinen Normen der Sittlichkeit und Menschenwürde.“ (ebd.). 7 Vgl. zu diesem Punkt allg. Rippe, Ethik in der Wirtschaft, S. 158-160. 11 stehen und somit der Ansicht sein, dass das Tierschutzgesetz in der Praxis strikter umgesetzt werden sollte.8 Nimmt man das bisher Gesagte, gibt es auf normativer Ebene keinen relevanten Unterschied zwischen den Anforderungen an die landwirtschaftliche und wissenschaftliche Nutzung von Tieren. Die Zufügung tierischen Leids muss unerlässlich sein und sie muss auf das Minimum reduziert werden, das zur Erreichung des gebotenen Ziels möglich ist. Unerlässlich heißt dabei, dass der Versuch notwendig ist, um ein moralisch gebotenes Ziel zu erreichen. Dies wäre der Fall, wenn auf dessen Grundlage Therapien von Erkrankungen möglich scheinen, das Leid von Nutztieren reduziert werden kann oder Gefahren für Mensch und Tier erkannt werden können. Was ist aber mit Erkenntnisgewinn? Forschende rechtfertigen ihre Versuche selten damit, dass sie Erkenntnisse um der Erkenntnis willen gewinnen wollen. Sie betonen fast immer, dass damit Krankheiten therapiert oder sogar präventiv verhindert werden. Dies gilt selbst für Tierversuchsanträge der Pharmazeutischen Industrie. Sie rechtfertigen Tierversuche nicht mit Profit, Wettbewerbsvorteilen, ja nicht einmal mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Einzig die Bekämpfung von Krankheiten und gesundheitlichen Risiken wird aufgeführt. Forschungskreise wie Industrie bewegen sich damit innerhalb des hier beschriebenen deontologischen Paradigmas. Denn die intentionale Zufügung von Leid wäre nicht gerechtfertigt, wenn man auf Profite, die eigene Karriere oder auf die Befriedigung der Wissbegierde verwiese. Man mag einwenden, dass letzteres doch ein Rechtfertigungsgrund sei. Erkenntnisgewinn sei ein intrinsischer Wert. Wir müssen jedoch vorsichtig sein. Wäre Erkenntnis von intrinsischem Wert, müsste auch trivialen Wahrheiten ein intrinsischer Wert zukommen. Aber würde man wirklich sagen, dass es intrinsisch wertvoll sei, die genaue Anzahl der Grashalme des Wembley Stadions zu kennen? Zudem ist nicht alles, was intrinsisch wertvoll ist, in dem Sinne ein moralischer Wert, dass Personen verpflichtet sind, ihn zu verwirklichen. Musik zu hören ist nach Ansicht vieler intrinsisch wertvoll. Aber selbst jene, die das sagen, behaupten nicht, jede Person sei moralisch verpflichtet, Musik zu hören, und sie fordern auch nicht, dass man Personen moralisch kritisieren sollte, die keine Musik hören. 8 Ich klammere hier Fragen der Heimtierhaltung aus. Wenn Heimtierhalter ihre Tiere fahrlässig leiden lassen und etwa Katzen in Wohnungen halten, so bestünde vom Kern des Tierschutzgesetzes eigentlich Handlungsbedarf. 12 Wir hätten große Schwierigkeiten, dies ethisch zu begründen9. – Selbst wenn Erkenntnisgewinn intrinsischen Wert hat, spielte dieser für die Rechtfertigung von Tierversuchen zumindest vom ethischen Geist der Tierschutzgesetze her 10 keine Rolle. Er stünde auf einer Ebene mit ästhetische Interessen oder Freude, die ja beide auch oft genannte Kandidaten für intrinsische Werte sind. Aber niemand würde sagen, dass Freude oder ein ästhetisches Interesse an einem spezifischen Aussehen es rechtfertigen würde, einen Hund zu kupieren. Insgesamt ist es also plausibler, Erkenntnisgewinn insofern als Rechtfertigungsgrund zu sehen, als Erkenntnisgewinn im Kontext von Tierversuchen ein wichtiges Mittel ist, um moralisch wertvolle Ziele zu erreichen. Ungeklärt ist bisher die Gewichtung der einzelnen Güter. Hier werden zwei Positionen vertreten. Die erste spricht Verpflichtungen gegenüber Menschen einen lexikographischen Vorrang zu. Die zweite bestreitet diesen Vorrang und fordert eine Güterabwägung im Einzelfall. Im ersten Fall haben die moralisch schützenswerten Interessen des Menschen prinzipiell Vorrang. Strebt der Versuch einen Erkenntnisgewinn an, geht es um Umweltschutz oder zielt er auf einen medizinischen Nutzen, haben die hier gegenüber Menschen11 verwirklichten moralischen Pflichten Vorrang. Tierschutz hat dagegen als moralisches Gebot wiederum stets Vorrang vor nicht-moralischen Interessen wie etwa dem Interesse an Kosmetika, an Tabakprodukten oder dem Test von Waffen. Im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Nutzung und Heimtierhaltung folgt auch die Praxis der Tierversuchsbewilligung hier eindeutig dem beschriebenen deontologischen Paradigma. Ist ein Erkenntnisgewinn zu erwarten, der moralisch schützenswerte Interessen des Menschen realisieren könnte, ist der Versuch unerlässlich. Dann ist nurmehr sicherzustellen, dass die Belastung auf Seiten der Tiere auf das unerlässliche Maß beschränkt wird. Wie hoch diese „unerlässliche“ Belastung auf Seiten der Tiere ist, 9 Vgl. hierzu auch Hofmann, Wahrheit und Wissen. 10 Die deutsche Rechtssprechung (so etwa das Bremer Verwaltungsgericht in seinem Primatenurteil vom 28.5.2010) spricht der reinen Grundlagenforschung einen „kulturellen Eigenwert“ (S.23) zu und nimmt es mit hoher Gewichtigkeit in die Güterabwägung auf. Vgl. Verwaltungsgericht der Freien Hansestaat Bremen, 5. Kammer, Urteil vom 28.5.2010, AZ: 5 K 1274/09. 11 Nicht die Interessen der nicht-menschlichen Umwelt dürfen also im Zentrum stehen, sondern Interessen des Menschen in Bezug auf seine Umwelt. 13 spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass sie so wenig wie möglich belastet werden. Ebenso muss nicht geprüft werden, wie der Nutzen des Menschen im Einzelfall zu gewichten ist. Diese lexikographische Auffassung wurde auch von den Vätern der sogenannten 3-R Grundsätze vertreten. Ist ein Tierversuch wissenschaftlich sinnvoll, darf er durchgeführt werden, sofern die drei Grundsätze "Refine - Reduce - Replace" beachtet werden. Er darf dann durchgeführt werden, wenn man alle Möglichkeiten genutzt hat, tierisches Leid zu minimieren (Refine) und man zudem alles getan hat, um das angestrebte Versuchsziel mit der geringst möglichen Zahl von Tieren und den am wenigsten komplexen Tieren zu erreichen (Reduce). Schließlich muss geprüft werden, ob das spezifische Erkenntnisziel nicht doch durch eine alternative Methode zu erreichen ist (Replace). Unantastbar ist in einem solcherart konzipierten 3 R-Modell, dass der Erkenntniswert angestrebt werden muss, sofern Pflichten gegenüber Menschen dies erfordern. Vertritt man hingegen die zweite, eine Güterabwägung fordernde Position, muss man stets die Möglichkeit einräumen, dass in einem einzelnen Versuch die erwartete Belastung der Tiere moralisch stärker zu gewichten ist als der erwartete Erkenntnisgewinn oder sonstige (moralisch relevante) Nutzen für den Menschen. Es ist denkbar, dass ein Tierversuch im Verhältnis zu diesem Nutzen mit zu großen Belastungen auf Tierseite verbunden ist und aus diesem Grund auf den Erkenntnisgewinn verzichtet werden muss. Wenn von "Güterabwägung" die Rede ist, bedeutet dies nicht, dass die konfligierenden Pflichten auf irgendeinen Grundwert reduziert werden und so vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Werteinheit exakt abgewogen werden könnten. Das Bild der Waage zu ernst zu nehmen, führt in die Irre. Wir haben vielmehr grobe Vorrangswahlen, die nachvollziehbar sein müssen, aber stets in einem gewissen Ermessensspielraum erfolgen. Dass hier eher an die Urteilskraft appelliert wird und weniger ein exaktes Verfahren angesprochen ist, betrifft freilich nicht nur Güterabwägungen im Tierversuch, sondern allgemein Güterabwägungen. Auch bei der Abwägung zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechten gibt es keine Wertskala, auf die alle einbezogenen Rechte reduziert werden könnten. Wenn wir die deutschsprachigen Tierschutzgesetze nehmen, ist im Schweizer Gesetz klar, dass keine lexikographische Position vertreten wird. Oder genauer: Nach Rechtsauffassung des Schweizer Bundesgerichts liegt keine lexikographische Ord- 14 nung vor.12 Ob dies auch im deutschen Recht so ist, bedarf noch letztinstanzlicher Klärung.13 Bevor die Frage einer lexikographischen Ordnung ethisch diskutiert werden sollte, ist jedoch zu prüfen, ob man überhaupt das allgemeine naturrechtliche Paradigma beibehalten sollte. 2. Sollte man bei diesem Paradigma bleiben? Es ist eine Unsitte, dass ethische Positionen und Theorien danach betrachtet werden, ob einem die Ergebnisse zusagen. Nicht die Sicherheit des Fundaments interessiert, sondern allein, ob sich daraus Schlüsse ableiten lassen, welche den eigenen Vorurteilen entsprechen oder den eigenen momentanen Interessen entgegenkommen. Im ersten Fall bedürfte es keiner Ethik, die private moralische Überzeugung entscheidet, was richtig ist. Die Frage ist dann nur, wieso man sich der Richtigkeit der eigenen Position so sicher sein kann. Dass man es so gelernt hat, ist mit gutem Grund in keinem Lebensbereich Richtschnur des Richtigen. Wäre dies der Fall, müsste man ja auch bei anderen Gemeinplätzen bleiben, die man in der Erziehung aufnahm. Ebenso wenig kann man sich darauf berufen, dass alle anderen dasselbe denken. Denn die Richtigkeit einer Position hängt ja nie davon ab, wie viele sie für richtig befinden. Im zweiten Falle, also der Beurteilung auf Grund momentaner Interessen, würde Moral selbst aufgehoben und zum nützlichen Instrument, kurzfristige Interessen durchzusetzen. In beiden Fällen muss eine Ethik, die nach Begründungen 12 In einem der beiden Bundesgerichtsentscheide zu Zürcher Primatenversuchen heißt es: "Die Vorschriften über Tierversuche sind Ausdruck sowohl der Forschungsfreiheit (Art. 20 BV) als auch des Verfassungsinteresses des Tierschutzes (Art. 80 Abs. 2 lit. b BV). Dabei ist eine generell-abstrakte Regelung über die abgewogenen Interessen auf Gesetzes- und grundsätzlich auch auf Verordnungsstufe unterblieben, da für die Beurteilung des Einzelfalles spezifisches Fachwissen notwendig ist (vgl. Botschaft Volksinitiative, BBl 1989 I 1021 Ziff. 42). Deshalb wurde der Verwaltung die Aufgabe übertragen, diese Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei hat weder die Forschungsfreiheit noch der Tierschutz Vorrang. Vielmehr sind beide gleichrangig.“ (BGE 135 II 384) 13 Im deutschen Recht hängt dies nicht zuletzt an der Frage, wie das relativ neue Staatsziel des Tierschutzes gegenüber anderen Gütern zu gewichten ist. Diese rechtssystematische Frage kann hier nicht interessieren. Hier geht es zunächst nur um die Beschreibung einer ethischen Position, welche die Tierschutzgesetze prägt. Vgl. zu der deutschen Rechtssprechung, welcher dem Schweizer Bundesgericht teilweise diametral entgegensteht, das Bremer Primatenurteil vom 28.5.2010. 15 fragt, als gefährlich angesehen werden. Denn stets könnten deren Ergebnisse bestehende Dogmen oder das Durchsetzen kurzfristiger Interessen gefährden. Im Folgenden gehe ich von der Voraussetzung aus, dass es möglich ist, vortheoretische Überzeugungen moralphilosophisch in Frage zu stellen und zu korrigieren. Es soll daher nicht interessieren, ob die heutige Rechtspraxis einem selbst gefällt oder nicht. Es geht auch nicht darum, ob es einem zusagen würde, wenn das geltende Recht gemäß seinem ethischen Geist entschieden durchgesetzt würde. Vielmehr befasse ich mich ausschließlich mit der ethischen Position, die sich im Gesetz, so jedenfalls mein Verständnis, hauptsächlich widerspiegelt. Diese muss wie alle anderen ethischen Positionen begründete Antworten auf drei Fragenkomplexe geben: i. Aus welchem Grund müssen wir überhaupt moralische Verpflichtungen anerkennen? ii. Gegenüber welchen Wesen haben wir moralische Pflichten? iii. Welche moralischen Pflichten bestehen? Es fehlt hier der Raum, die Antworten auf diese drei Fragen detailliert wiederzugeben. Auf einen skizzenhaften Überblick ist aber nicht zu verzichten. Nehmen wir den ersten Fragenkomplex kann er entweder theologisch oder philosophisch beantwortet werden. Die theologische Antwort leitet moralische Verpflichtungen aus dem "Wissen" der Existenz Gottes und der Kenntnis von dessen Willen ab. Etwas ist geboten, weil Gott so will. Die philosophische Antwort verweist darauf, dass in der Natur eine normative Ordnung verwirklicht ist und der Mensch mittels seiner Vernunft erkennen kann, wie etwas von Natur her sein soll. Verdeutlichen wir diese Begründungsform an einem Beispiel: Da es von Natur her so ist, dass Mann und Frau zusammen eine Familie gründen und sich in der Natur eine vernünftige Ordnung ausdrückt, dürfen nur Frauen und Männer heiraten. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften dürfen von der Gesellschaft nicht anerkannt werden. Auch der zweite Fragenkomplex wird mit Verweis auf eine spezifische Schöpfungstheologie oder eine spezifische Metaphysik beantwortet. In ersterer wird dem Menschen zwar ein Nutzungsrecht der geschaffenen Natur eingeräumt, aber er hat zu beachten, dass die Welt so wie sie geschaffen wurde, gut ist. Es besteht eine Pflicht 16 zur Wahrung der Schöpfung und zur Achtung der Mitgeschöpflichkeit von Tieren, Pflanzen und anderen Naturentitäten. Moralisches Objekt sind damit sowohl Gott wie alles von ihm Geschaffene. Das Tier hätte auf Grund seiner Mitgeschöpflichkeit den Status eines moralischen Objekts. In der metaphysischen Position hat der Mensch die vernünftige Ordnung der Welt zu achten. Er hat Widernatürliches zu unterlassen und eine Pflicht zu einem Leben gemäß der eigenen Natur. Genauso wie der Mensch seiner eigenen Natur gemäß leben muss, so entfaltet sich in jedem Lebewesen ein eigenes "telos". Obwohl der Mensch auf Grund seiner spezifischen, den anderen Wesen überlegenen Natur andere nutzen darf, so hat er doch zu achten, dass sich auch in diesen eine vernünftige Ordnung zeigt. Bezüglich des dritten Fragenkomplexes wird philosophisch folgende Antwort gegeben: Es ist natürlich und damit vernünftig, dass Menschen Tiere gebrauchen und nutzen. Sie haben dabei jedoch zu beachten, dass auch diese eigene natürliche Bedürfnisse haben. Dem Recht, Tiere zu nutzen, steht so eine Pflicht gegenüber, dafür Sorge zu tragen, dass die natürlichen Bedürfnisse der Nutztiere befriedigt werden. Ausnahmsweise mag es auf Grund vorrangiger Pflichten gegenüber Menschen notwendig sein, Tiere leiden zu lassen. Tieren willkürlich oder aus Profitsucht Leid zuzufügen, widerspräche aber der natürlichen Grundordnung. Zudem handelte der Mensch damit gegen seine eigene Natur. Das Paradigma ist drei Einwänden ausgesetzt.14 Erstens: Welchen Begründungsweg man auch einschlägt, ist er äußerst brüchig. Stützt man sich auf religiöse Gründe, haben die Aussagen keine intersubjektive Verbindlichkeit. Dass A fest darauf vertraut, dass eine Göttin ihm aufgegeben hat, x zu tun, ist für einen Anders- und Nichtgläubigen kein Grund, ebenfalls x zu tun. Die normativen Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenlebens sollten eine stärkere Basis haben als religiöse Speisetabus.15 Stützt man sich jedoch auf das philosophische Vernunftrecht, bewegt man sich im Rahmen einer spezifischen Metaphysik. 14 Vgl. hierzu ausführlicher Rippe, Ethik im außerhumanen Bereich, Kap. 1 und 2. 15 In einem Kommentar zum deutschen Tierschutzgesetz (Kluge, Tierschutzgesetz, S. 90) wird beschrieben, dass man statt auf die Mitgeschöpflichkeit auf die gemeinsame Evolutionsgeschichte verweisen könne. Allerdings greift dies zu kurz. Erstere Auffassung enthält Wertannahmen, die Evolutionstheorie bewegt sich auf deskriptiver Ebene. Es kann daher keine evolutionstheoretische Begründung dafür geben, dass man auf Grund gemeinsamer Vorfahren in der Kreidezeit oder im Jura irgendwelche Pflichten gegenüber den Verwandten hat. Eine solche „Sollens“-Aussage sprengt die naturwissenschaftliche Theorie. 17 Dass sich in der Natur eine vernünftige Ordnung ausdrückt, wird behauptet, aber nicht begründet. Zweitens: Fraglich ist zudem die naturphilosophische Hintergrundstheorie. Das gängige Paradigma trennt prinzipiell zwischen Mensch und Tier. Dem Mensch kommen gewisse Gattungseigenschaften zu, welche den Menschen qualitativ über das Tier stellen. Auch wenn sich die Eigenschaften im Einzelfall auf Grund einer Erkrankung nicht ausbilden, so hat doch jeder Mensch die relevanten Anlagen und ist auf Grund dieser Gattungseigenschaften höher zu achten als ein Tier. Wir haben hier - lassen wir die Wertannahme einmal außen vor - eine Naturphilosophie, die einerseits von klaren prinzipiellen Artgrenzen ausgeht und zudem annimmt, dass in jedem Wesen jene Eigenschaften angelegt sind, die seine Gattung ausmachen. Wir können diese Position ohne Schwierigkeit philosophiegeschichtlich einordnen: Dies sind Grundzüge der aristotelischen Naturphilosophie. Die Frage ist nur, ob wir heute diese Annahmen teilen sollten. Was wir heute von der Natur wissen, spricht gegen die Annahme von Gattungseigenschaften. Auch wenn wir alle Genome von Individuen einer Art als Genom dieser Art erkennen können, so gibt es doch stets individuelle Unterschiede. Stets entfaltet sich ein individuelles Genom. Arten sind in dem Sinne Klassifikationsbegriffe des Menschen, nicht etwas, was in der Natur real besteht. Zudem gibt es auch keine prinzipiellen Artgrenzen, wie das Vernunftrecht annimmt. Drittens stehen wir vor dem moralphilosophischen Problem, wieso die Artzugehörigkeit moralisch relevant sein soll. Warum soll der moralische Status davon abhängen, als wessen Kind man geboren ist, und nicht davon, welche Eigenschaften man selbst moralisch hat? Geht man von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen aus, besteht keine Schwierigkeit, dies anzunehmen. Denn diese Gottesebenbildlichkeit wird von Kind auf Kindeskind vererbt. Aber wenn man die moralische Sonderstellung des Menschen nicht aus individuellen Glaubensannahmen ableiten will, sieht dies anders aus. Dann kann man sich nur auf kognitive Eigenschaften beziehen, welche den Menschen vom Tier unterscheiden, seien dies Sprache, Selbstbewusstsein, "Willensfreiheit" oder Zukunftsbezug. Aber egal, welche man auch nimmt, so steht man vor dem Problem, wieso diese kognitiven Fähigkeiten einen höheren moralischen Status begründen sollen. Wir müssen sogar sagen, diese Frage stellt sich insbesondere in dem hier gewählten Paradigma. Denn in diesem geht es nicht um hypothetische Verträge oder reziproke Pflichten, die Vertragsfähigkeit voraussetzen. Vielmehr sollen 18 gegenüber Wesen, die diese kognitiven Fähigkeiten haben, besondere Verpflichtungen bestehen, die bis zu absoluten Unterlassungspflichten reichen. Dies zu begründen ist das Problem. Und dieses Problem vergrößert sich, so ja der zweite Punkt, noch dadurch, dass nicht nur jene, die über diese kognitiven Fähigkeiten verfügen, einen höheren moralischen Status haben, sondern alle Wesen einer spezifischer Gattung. Die derzeitige Diskussion um Primatenversuche ist ein gutes Zeichen dafür, welche Schwierigkeiten das Recht hat, heute an dem Paradigma festzuhalten. Würden sich Richter auf den Gedanken der Gottesebenbildlichkeit beziehen, bestünde kein Unterschied, ob man Primatenversuche oder Rattenversuche durchführt. Denn trotz aller Unterschiede steht der Primat der Ratte näher als dem Menschen. Letztere sind auf Grund ihrer Mitgeschöpflichkeit moralisch zu beachten, aber allein dem Menschen kommt auf Grund der Gottesebenbildlichkeit absolute Würde zu. Ein Primat steht bezüglich seines moralischen Status sogar einer Kakerlake näher als dem Menschen. Denn die große Trennlinie ist jene zwischen Mensch und Tier. Sobald sich das Recht nicht mehr im Rahmen einer spezifischen religiösen Lehre bewegt, muss es sich auf kognitive Fähigkeiten beziehen. Haben bestimmte Primatenarten hohe kognitive Fähigkeiten, so rücken sie dann auch moralisch in eine Mittelposition zwischen Menschen und anderen Tieren. Relevant wäre nicht die Verwandtschaft zum Menschen, sondern allein ihre kognitiven Fähigkeiten. Die drei Einwände erschüttern das Fundament einer naturrechtlichen Position so stark, dass es falsch wäre, an diesem Paradigma festzuhalten. 3. Könnte man dies nicht alles regelutilitaristisch begründen? Man könnte gegen das bisher Gesagte einwenden, dass das Tierschutzgesetz durchaus auch eine regelutilitaristische Basis haben könnte und die drei Einwände damit das ethische Fundament des heutigen Tierschutzrechts verfehlen. Als Regelutilitarismus bezeichnet man eine Theorie, wonach moralische Normen dann moralisch begründet sind, wenn ihre Implementierung das Wohl aller Betroffenen stärker fördert als andere denkbaren Normen. Worin dies Wohl besteht, werde ich unten etwas ausführlicher behandeln. Im Folgenden übernehme ich der Einfachheit der Darstellung halber die Sprache des Präferenzutilitarismus. Das Wohl besteht demnach darin, dass Präferenzen erfüllt werden. 19 Vielleicht wird man sagen, eine solche Grundlage läge recht nahe. Da utilitaristisch das Interesse jedes Wesens zu berücksichtigen ist, welches überhaupt Interessen hat, ist klar, dass auch Interessen von Tieren zählen. Ob es sich um die Präferenz eines Menschen, Bären oder Salamander handelt, spielt keine Rolle. Es scheint – wohlgemerkt nur mit Blick auf die Frage, welches ethische Paradigma die Tierschutzgesetzgebung hauptsächlich widerspiegelt – ein Vorteil einer solch regelutilitaristischen Zugangsweise, dass Interessen gegen Interessen aufgewogen werden. Auch das Interesse, Fleisch zu essen oder wirtschaftlich erfolgreich zu sein, muss in die moralische Kalkulation einbezogen werden. Es geht also nicht wie bei obiger Position um Pflichtenkollisionen, sondern um Interessenabwägungen.16 Dies gelte auch für die Güterabwägung bei Tierversuchen, in denen auch private und wirtschaftliche Interessen auf die Waagschale kämen.17 Tierversuche sind ein Beispiel für solche Handlungstypen, in denen der Regelutilitarist keine allgemeine Norm, sondern Einzelfallentscheidungen einfordern wird. Denn klare Fälle, wo die Chancen für die Nutznießer des Versuchs die Risiken für die Tiere überwiegen, werden andere entgegenstehen, wo das voraussehbare Leid der Tiere im Kalkül den möglichen Nutzen für Mensch und Tier überwiegt. Insgesamt würde das Wohl aller Betroffenen also bestmöglich gefördert, wenn ein Verfahren eingeführt wird, in dem eine sorgfältige Einzelfallprüfung vorgenommen wird. Hier müssten die Interessen aller möglichen Nutznießer, seien es Menschen oder Tiere, sowie die Auswirkungen auf die Versuchstiere berücksichtigt werden. Die Verwirklichung der Präferenz, Erkenntnisse zu erzielen, spräche genauso wie jene der Kranken, Therapieangebote zu erhalten, für den Versuch. Gegen den Versuch spräche das Leid der Versuchstiere. Würde ein einzelner Versuch wahrscheinlich weitere nach sich ziehen, müsste auch das Leid der dadurch betroffenen Tiere ins Kalkül einbezogen werden. Es wäre zu einfach zu sagen, dass ein Versuch utilitaristisch dann zu rechfertigen ist, wenn die Summe des tierischen Leids kleiner ist als die Summe der möglichen Vorteile der Nutznießer. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings auch die Wahrscheinlichkeit, mit der Präferenzen erfüllt bzw. frustriert werden. In der Regel wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Versuchstiere leiden, weit höher sein als die Wahrscheinlichkeit, dass Leid von Kranken durch diesen Versuch gelindert wird. Wä16 Genau genommen führt der Utilitarist ein Kalkül durch. Aber man kann dies Kalkül natürlich bildlich als Interessenabwägung ausdrücken. 17 Dies geschieht etwa bei Smith and Boyd, Lives in the Balance, S. 141f. 20 re das Leid der krebskranken Ratte und das des krebskranken Menschen gleich, flösse das Leid der Ratte doch stärker in das Kalkül ein. In zwei wichtigen Hinsichten könnte das Tierschutzrecht, insbesondere aber die Regelung der Tierversuche, also regelutilitaristisch abgestützt werden: Tieren Leid zuzufügen wäre nur dann gerechtfertigt, wenn dies durch eine summarisch gewichtigere Interessenbefriedigung anderer aufgewogen würde. Zudem würden Regelutilitaristen auch Kommissionen fordern, welche sorgfältige Einzelfallentscheidungen treffen. Wir haben allerdings auf der anderen Seite große Schwierigkeiten, Regelutilitarismus und Tierschutzgesetzgebung auf einen Nenner zu bringen. Wichtiger Grundsatz jeder utilitaristischen Theorie ist der Gedanke der gleichen Interessenberücksichtigung. Gleiche Interessen müssen gleich bewertet werden. Ist das Leid einer Ratte, die als Krebsmodell dient und an Krebs erkrankt, genauso groß wie das eines Menschen, der an Krebs erkrankt ist, ist das Leid beider gleich zu gewichten. Damit würde ein Regelutilitarismus weit restriktivere Tierschutzgesetze fordern als sie derzeit implementiert sind. Nehmen wir nur Fleischkonsum. Die Präferenz des Menschen, Fleisch zu essen, wäre damit ebenso Bestandteil eines utilitaristischen Kalküls wie die Präferenz der Tiere, nicht leiden zu müssen. Da weit mehr Schweine betroffen sind als Menschen und man davon ausgehen muss, dass die Präferenzen des Schweins, nicht zu leiden, die Freude am Kotelett überwiegt, wäre Fleischkonsum genauso unmoralisch wie die landwirtschaftliche „Fleischproduktion“. Es bedürfte also Normen, diese zu verbieten. Es ist aber kaum zu bezweifeln, dass im Tierschutzgesetz eine Vorrangsstellung des Menschen angenommen wird (fraglich ist nur, ob es sich um einen lexikographischen Vorrang handelt). Soll eine Vorrangsstellung regelutilitaristisch begründet werden, müsste der Regelutilitarist zeigen, dass Interessen von Menschen in der Regel gewichtiger sind als jene von Tieren. Erst dann wären Normen zu rechtfertigen, die menschliche Interessen weit besser schützen als jene von Tieren. Ein Regelutilitarist könnte die These vertreten, dass Menschen auf Grund ihrer kognitiven Fähigkeiten bereits am Gedanken an mögliches Unglück wie beispielsweise eine mögliche Krebserkrankung leiden. Zudem würden sie durch das Leid anderer stärker affiziert.18 18 Dieser Gedanke wird etwa von Dieter Birnbacher vertreten in: Gibt es überzeugende Gründe für eine axiologische Sonderstellung des Menschen?, sowie zur Kritik Rippe, Kann es eine naturalistische Begründung für die moralische Sonderstellung des Menschen geben? 21 Die Frage ist nur, wie überzeugend diese These ist: Denn man muss auch berücksichtigen, dass höhere kognitive Fähigkeiten auch leidmindernd wirken können. Das Wissen, dass man aus einer momentanen Gefangenschaft befreit wird, beruhigt. Dass eine Korrelation zwischen kognitiven Fähigkeiten und Gewicht des Leids kaum plausibel ist, zeigt sich schon, wenn man den Blick allein auf Menschen richtet. Hier sind wir keineswegs der Ansicht, dass das Leiden eines Kleinstkindes in der Regel schwächer sei als das eines erwachsenen Menschen. Unsere Gesetze halten Kleinstkinder wohl mit Recht für besonders schützenswert. Es ist schon schwer genug zu begründen, warum die Interessen von rationalen, über Selbstbewusstsein und Zukunftsbezug verfügenden Wesen höheres Gewicht haben sollen als jene von Wesen, die geringere kognitive Fähigkeiten haben. Noch schwieriger ist es, angemessene Gründe anzugeben, dass die Interessen aller Menschen, egal welche Fähigkeiten sie haben, mehr Gewicht haben. Denn es gibt Menschen, die noch nicht, nicht mehr oder nie über die höheren Fähigkeiten verfügen, die eben genannt wurden. Regelutilitaristen könnten sich vielleicht darauf berufen, dass Menschen in der Regel über die genannten kognitiven Fähigkeiten verfügen und so auf Praxisebene eine Norm geboten sei, welche alle Menschen schützt. Auch dann bliebe jedoch fraglich, warum man beim Menschen stehen bleibt. Haben auch andere Wesen die genannten Eigenschaften, müssten ja andere Praxisnormen geboten sein. Aber wir brauchen dies nicht weiter auszuführen, denn dies ist nicht die einzige Schwierigkeit, das heutige Tierschutzrecht utilitaristisch abzuleiten. Auch folgende zwei Überlegungen sind zu nennen: Erstens: In konsequentialistischen Theorien ist das moralische Subjekt aufgefordert, einen unparteiischen Standpunkt einzunehmen, in dem es sich soweit dies möglich ist, die Auswirkungen auf alle Betroffenen (einschließlich künftige Generationen) überlegen muss. Die deutschsprachigen Tierschutzgesetze sind nun aber nicht so konstruiert, als ob auch Fernwirkungen der Tiernutzung in den Blick genommen worden wäre. Dies mag an früher mangelndem Wissen liegen. Aus regelutilitaristischer Sicht wäre ein Einbezug von Fernwirkungen jedoch spätestens bei den jüngeren Gesetzesüberarbeitungen notwendig gewesen, denn dort waren Abholzungen des Regenwalds und andere Probleme mit weitgehenden langfristigen Effekten längst bekannt. Aber hier wurden die Gesetze keineswegs regelutilitaristisch überarbeitet. 22 Zweitens muss man regelutilitaristisch nicht nur berücksichtigen, was anderen Betroffenen schadet, sondern auch, was ihnen nutzt. Läge dem Tierschutzgesetz ein Regelutilitarismus zugrunde, müssten darin Verbesserungsmöglichkeiten der tierischen Lebensqualität weit stärker in den Blick kommen. Zudem müssten auch Hilfspflichten formuliert werden. Aber den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung kennt das Tierschutzrecht nicht. Der Hauptgrund, warum ich eine solche regelutilitaristische Begründung bezweifle, ist freilich, dass hier eine ethische Theorie so umgeformt werden müsste, dass sie den geltenden moralischen Intuitionen entspricht. Dabei ist eines zu beachten: Wichtige Prämisse des klassischen Utilitarismus ist, dass moralische Urteile eine rationale Basis haben müssen. Der Verweis auf Tradition und allgemeine Überzeugungen genügt dem hier gewählten Standard nicht. Denn vorher sollten wir wissen, dass tradierte Auffassungen richtig sind, und wie können wir ausschließen, dass geteilte Meinungen nicht doch falsch sind? Sicher können wir nach den Utilitaristen aber sein, was für eine Person selbst gut ist: Dies ist, so der klassische Utilitarismus, Freude, und was schlecht ist: Leid. Genauso wie diese beiden Kriterien einziger Maßstab rationalen individuellen Handelns sein sollten, so seien sie auch die einzig denkbare Ausgangsbasis für soziale Regelungen. Eine Anpassung des Utilitarismus an moralische Intuitionen ist in diesem Konzept falsch. Denn man wechselte wieder zu tradierten Auffassungen und allgemeinen Überzeugungen, von deren Unsicherheit man ja eigentlich ausgegangen war. Genauso falsch wäre dann jeder Versuch, den Utilitarismus durch Zusatzannahmen so weit zu bringen, dass seine Ergebnisse dem Geist des Tierschutzgesetzes entsprechen. Damit verleugnete man jene Radikalität, welche diese ethische Position auszeichnet. Deswegen ist es vorzuziehen, die bestehende Tierschutzgesetzgebung weiterhin als Ausdruck der oben beschriebenen deontologischen Position zu verstehen. Aber bei dieser darf man meiner Meinung nach nicht stehen bleiben. Was wäre aber die Alternative? 4. Die Herausforderer Sucht man eine Alternative zum bisherigen Paradigma kann man entweder zu einer wohl überlegten konsequentialistischen Position überwechseln oder man kann alter- 23 native deontologische Konzepte vorlegen. Dabei sollte von vorne herein darauf geachtet werden, dass gewisse Schwächen vermieden werden. a) Die Position sollte auf eine Weise begründet werden können, die von jeder Person überprüft werden kann. Der Verweis auf religiöse Überzeugungen reicht nicht aus, um andere dazu aufzufordern, dass sie etwas tun oder unterlassen sollen. b) Es gelten die üblichen Argumentationsregeln. Das heißt, um zwei Beispiele zu nennen: Der Verweis darauf, dass sich eine Auffassung historisch durchgesetzt hat, hat keine Begründungsfunktion. Sonst beginge man einen historischen Fehlschluss. Dass (fast) alle Menschen eine Auffassung teilen, heißt nicht, dass sie wahr ist. Denn die Wahrheit einer Aussage ist unabhängig davon, von wie vielen sie für wahr gehalten wird. c) Annahmen über die Natur inklusive naturphilosophischer Überlegungen müssen im Einklang mit dem stehen, was wir heute über die Natur wissen. d) Sollen Gattungsgrenzen moralisch relevant sein, bedarf es einer eigenen moraltheoretischen Begründung. Ohne diese sind sie moralisch irrelevant. e) Moralische Intuitionen haben keine Begründungsfunktion. Nehmen wir diese Voraussetzungen, müssen die möglichen Alternativen wie folgt formuliert werden: 4.1 Ein wohl verstandener Konsequentialismus Nach konsequentialistischer Sicht wäre jene Handlung moralisch richtig, welche die bestmöglichen Folgen für alle Betroffenen hat. Um zu beurteilen, wann etwas für eine Person als positive oder negative Folge zu beurteilen ist, bedarf es einer Werttheorie. Dies könnte wie bei Bentham ein Hedonismus sein, ein qualitativer Hedonismus wie ihn Mill vertrat oder eine Präferenztheorie wie sie von Peter Singer vertreten wird. Denkbar ist zudem ein Wertrealismus, der unterschiedliche Dinge als objektiv wertvoll ansieht. Wählt man den Wertrealismus, so leiten sich moralische Pflichten daraus ab, dass es für jeden wünschenswert ist, wenn bestimmte Weltzustände verwirklicht werden. Die Rede von Weltzustand bezieht sich dabei sowohl auf die Existenz spezifischer zwi- 24 schenmenschlicher Beziehungen wie Freundschaft, auf das Erlangen von Wissen oder auf Bewusstseinszustände. Wichtig ist, dass es niemals allein um etwas geht, das für die Person selbst wünschenswert ist, die in einer solchen Beziehung lebt, die etwas weiß oder etwas empfindet. Vielmehr ist es "an sich" gut. Eine Welt voller persönlicher Beziehungen wäre für eine Person auch dann wünschenswert, wenn sie selbst, aus welchen Gründen auch immer, niemals solche haben kann. Dasselbe gelte für Freude. Die Freude des anderen zu verwirklichen ist im selben Sinne und im gleichen Maße wünschenswert wie die eigene Freude. Dass man hier nicht davon spricht, was für eine Person gut ist, sondern was an sich gut ist, stellt zugleich das Problem dieser Theorie dar. Denn was macht etwa einen Weltzustand zu einem wünschenswerten Weltzustand? Und wieso soll man moralisch verpflichtet sein, diesen Weltzustand anzustreben? Soll es möglich sein, das moralisch Gute wahrnehmen zu können, bedürfen Menschen entweder eines besonderen Sinnes, der neben den herkömmlichen Sinnen besteht, oder aber es gibt etwas an den wünschenswerten Weltzuständen, eine Eigenschaft, die sie zu wünschenswerten Dingen macht und uns zum Handeln verpflichtet. In beiden Fällen wird die Existenz einer Entität postuliert und damit der Grundsatz der ontologischen Sparsamkeit verletzt, wonach Existenzannahmen nicht einfach postuliert werden dürfen, sondern der Begründung bedürfen. Wählt man einen Glücks- oder Präferenzutilitarismus, verzichtet man auf die Annahme von objektiven Werten. Es geht darum, dass Freude bzw. Wunscherfüllung für das betreffende Wesen gut sind und Leid bzw. Nicht-Erfüllung von Wünschen schlecht. Will man eine angemessene Form des Konsequentialismus formulieren, ist es sinnvoll, einen Hedonismus zu wählen, und dies aus folgendem Grund. Wenn es darum geht, was für eine Person gut oder schlecht ist, muss eine Antwort auf die Frage gegeben werden, warum etwas für die Person gut oder schlecht ist. Ein Hedonismus kann hier darauf verweisen, wie wir Leid und Freude erleben. Leiden wird in sich als schlecht erlebt, Freude als in sich gut. Bei der Wunscherfüllung kann man jedoch stets fragen, warum es schlecht sein soll, dass sich ein Wunsch nicht erfüllt. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Wunscherfüllungstheorie auf Weltzustände bezieht, nicht auf Bewusstseinszustände. Etwas soll nach dieser Theorie für eine Person gut sein, auch dann, wenn sie nie von der Erfüllung eines Wunsches erfährt, ja, zu diesem Zeitpunkt nicht einmal lebt. Aber wie soll etwas für jemand gut sein, wenn dieser bei Eintreten des Ereignisses längst tot ist? 25 Der Vorteil einer hedonistischen Zugangsweise ist zudem, dass dadurch Epizykel vermieden werden. Nehmen wir nur die Präferenz, nicht zu leiden. Es ist doch eine eigentümliche Betrachtungsweise, dass Leiden deshalb schlecht sein soll, weil hier eine Präferenz, nicht zu leiden, unterdrückt wird, und nicht etwa deshalb, weil es schlecht ist zu leiden. Eine solche Zusatzüberlegung, dass Personen erst eine Präferenz gegenüber Leid entwickeln müssen, um sagen zu können, dass es schlecht für sie ist, ist schlicht überflüssig. Leid ist für jemanden schlecht, weil er dies genau so erfährt. Schließlich wäre es doch seltsam, bei einem leidenden Neugeborenen erst fragen zu müssen, ob es bereits die Präferenz entwickelt hat, nicht zu leiden. Es reicht doch eine Antwort darauf, ob es leidet oder nicht. Zudem verwundert es, wenn der Wunsch, nicht zu leiden, auf einer Ebene stehen soll mit anderen Präferenzfrustrationen, etwa jenen, dass die eigene Lieblingsmannschaft nicht Meister wird. Gleiches Leid muss nach utilitaristischen Maßstäben gleich behandelt werden und gleiche Freude gleich. Daraus folgt kein Gebot, alle Wesen gleich zu behandeln. Denn ein und dieselbe Handlung kann bei unterschiedlichen Wesen unterschiedliche Emotionen verursachen. Einzelhaltung ist für sozial lebende Tiere schlecht, nicht aber für solche, die eher auf Grund zu großer Nähe zu anderen leiden. Lernt ein Rhesusaffe, dass seine Zeit im Primatenstuhl stets begrenzt ist, so leidet er an dieser Fixierung weniger als es ein Tier täte, das dies nicht lernte. Aber jedes Leid, das Tieren zugefügt wird, fließt in das Kalkül ein und zählt dort gleich wie menschliches Leid. Eine Anwendung dieser Utilitarismus führt nicht notwendig zu einem Verbot aller Tierversuche. Tierversuche wären moralisch geboten, wenn sie insgesamt dazu beitragen würden, dass - betrachtet auf alle Betroffenen - die bestmögliche Freud-LeidBilanz erreicht wird. Ob jedoch viele Versuche in einem Kalkül befürwortet werden, wäre zu bezweifeln. Die Schwäche der utilitaristischen Theorie ist nur, dass sie von einer dogmatischen Annahme ausgeht. Moralische Urteile sind hier durch Universalisierbarkeit gekennzeichnet, sie werden aus einer unparteiischen Perspektive gefällt, in der alle Betroffenen moralisch gleich zu berücksichtigen sind. Ein Skeptiker wird stets fragen können, warum er einen solchen unparteiischen Standpunkt einnehmen soll. Der Verweis auf ein Merkmal unserer moralischen Sprache wird ihn nicht überzeugen. Denn auch sprachliche Intuitionen spiegeln tradierte Überzeugungen wider. Aber diese garantieren keine Wahrheit. 26 Solange diese Begründungslücke besteht, gibt es keinen Grund, eine utilitaristische Theorie zu wählen. Denn wie bei allen anderen ethischen Theorien ist sie nur so überzeugend wie ihr Fundament. 4.2 Deontologische Optionen Deontologische Theorien zeichnen sich dadurch aus, dass die Frage, was moralisch richtig ist, nicht allein auf Grund der Handlungsfolgen zu entscheiden ist. Einige Deontologien enthalten absolute Unterlassungspflichten, also Handlungstypen, die um keines noch so guten Zweckes willen ergriffen werden dürfen. Andere beziehen sich auf moralische Rechte, welche grundlegende Interessen auf solche Art schützen, dass sie nicht gegen Gemeinwohlüberlegungen abzuwägen sind. Würden Tiere moralische Rechte in diesem Sinne haben, verböte sich, sie leiden zu lassen, um anderen zu helfen. Wir müssen hier zunächst jene Wege ausklammern, auf denen solche deontologischen Beschränkungen nicht begründet werden können. Zu einfach ist es erstens, Grundbegriffe aus unserer konventionellen Moral, die sich auf Menschen beziehen, auf eine Weise zu interpretieren, dass dies auch die Berücksichtigung nicht-menschlicher Interessen erzwingt. So wird zum Beispiel der Begriff der Autonomie so gedeutet, dass darunter auch Wahlhandlungen von Tieren fallen, also auch Vorlieben des Hundes Fidos als Ausdruck seiner Autonomie gelten.19 Aber damit wird der Ausdruck "Autonomie" seines wesentlichen Kerns beraubt. "Autonomie" bezieht sich traditionell nicht darauf, irgendwelche Wahlhandlungen treffen zu können, sondern auf das Vermögen, vernünftig entscheiden und moralisch urteilen zu können. Unsere moralischen Intuitionen spiegeln hier Theorien wider, welche dieses Vernunftvermögen zum zentralen Bestandteil der Begründung moralischer Pflichten macht. Es zeichnet diesen Theorien nach die Natur des Menschen aus, dass er Bedürfnisse und Wünsche gemäß seiner Vernunft umgestalten kann. Dies stellt ihn über alle anderen Lebewesen und gibt ihm zugleich die Pflicht auf, als Mensch, nicht als Tier zu leben. Ein verdünnter "Autonomiebegriff", der die Befriedi- 19 Vgl. zum Beispiel Regans Versuch, moralische Rechte auf den Gedanken des „Subjekt eines Lebens“ abzustützen, Vgl, Regan, The Case for Animal Rights, S. 243-248, sowie ders. Defending Animal Rights,, ch. 3. 27 gung von Bedürfnissen und Wünschen als "autonom" bezeichnet, nimmt der spezifischen moraltheoretischen Begründung seinen Witz. Zweitens greift es zu kurz, den Geltungsbereich moralischer Rechte einfach mit dem Argument auszudehnen, dass damit ein Speziesismus vermieden wird. Die Standardvariante dieses Arguments lautet wie folgt: Gemäß unserer Alltagsmoral ist es moralisch falsch, nicht einwilligungsfähigen Menschen für Forschungszwecke Leid zuzufügen. Allenfalls minimal belastende Versuche sind hier denkbar, aber auch diese hat man sofort zu unterbrechen, wenn sich der Nicht-Einwilligungsfähige dagegen sträubt. Da die Gattungszugehörigkeit aber moralisch irrelevant ist, müsste das Gleiche auch für Tiere gelten. Denn auch diese sind nicht einwilligungsfähig und im gleichen Grade schutzbedürftig. Dieses Argument übersieht wiederum die speziellen Hintergrundannahmen, auf denen unsere Alltagsmoral fußt. Zu diesen gehört unzweifelhaft, dass die Spezieszugehörigkeit moralisch von zentraler Bedeutung ist. Versuche an nicht-einwilligungsfähigen Menschen sind zu unterlassen, weil sie Menschen sind. Wenn Menschsein nicht mehr von Bedeutung ist, besteht der Grund nicht mehr, der die Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen verbietet. Wir können damit unsere Alltagsmoral nicht antispeziesistisch ausdehnen. Die Verneinung des Speziesismus verneint zugleich unsere Alltagsmoral. Welche Optionen hat man, wenn diese beiden naheliegenden Wege verschlossen sind? Man könnte geneigt sein, eine kantianische Basis zu wählen. Sollte man dies tun, müsste man diese freilich von ihren naturphilosophischen Grundlagen befreien. Nicht die Gattungseigenschaft der Vernunft kann entscheiden, welchem Wesen Würde zukommt, sondern nur Eigenschaften einzelner Individuen. Gegenüber Individuen, die (potentiell) vernünftig sind, also zu moralischen Entscheidungen fähig sind, bestehen unbedingte Unterlassungspflichten wie ein Verbot der vollkommenen Instrumentalisierung oder der Tötung. Da moralische Subjekte auch sich selbst gegenüber solche Pflichten haben, schließt dies Pflichten gegenüber sich selbst ein, etwa das Verbot, sich selbst in die Sklaverei zu verkaufen, oder das Suizidverbot. In einer solchen Theorie bestehen gegenüber nicht-menschlichen Tieren nur indirekte Pflichten. Tierquälerei wäre falsch, weil der Mensch Gefahr läuft, seine eigene Würde zu missachten. Tierversuche dürfen, ja müssen durchgeführt werden, sofern eine solche Verrohungsgefahr nicht besteht und es auf Grund der Versuche möglich ist, vernünf- 28 tigen Menschen zu helfen. Das Problem dieser Theorie ist nur, dass sie begründet werden muss. Dass der Moralfähigkeit ein absoluter Wert zukommt, kann nicht einfach vorausgesetzt werden. Ebenfalls darf nicht einfach betont werden, diese Wertannahme läge unserem moralischen Denken einfach zugrunde. Denn auch letzteres verweist nur auf moralische Intuitionen. Bekanntermaßen bleibt selbst Kant am Ende nur, von einem "Faktum der Vernunft" zu sprechen, das wir anzuerkennen haben. Damit wird der absolute Wert aber einfach nur dogmatisch gesetzt. Es verbleibt eine Möglichkeit, Skeptiker doch zu überzeugen, dass gewisse moralische Normen anzuerkennen sind. Dies ist die Vertragstheorie oder, wie es besser heißen sollte, die interessenbasierte Ethik. Als Antwort auf die erste Frage verweist sie kurz gefasst auf folgendes: Es ist im Interesse jedes einzelnen, dass eine Moral besteht und gewisse Normen anerkannt werden. Man sollte moralische Normen beachten, weil diese Schutzfunktionen übernehmen, auf die jeder einzelne selbst angewiesen sein kann. Kern der interessenbasierten Ethik ist, dass es für jeden einzelnen klug ist, auf einen Teil seiner Freiheit zu verzichten, sofern alle anderen dies ebenfalls tun. Dies heißt auch, dass eigene Interessen nur dann durch moralische Rechte und darauf gegebenenfalls aufbauende juristische Rechte geschützt werden, wenn man sich selbst dazu verpflichtet, die Rechte anderer zu achten. Die zweite Frage, gegenüber welchen Wesen moralische Pflichten bestehen, ist schwieriger zu beantworten. Würde man nur Pflichten gegenüber solchen Wesen haben, die selbst Pflichten wahrnehmen können, würde der Schutz, den Moral jedem einzelnen gibt, erheblich eingeschränkt. Denn jeder einzelne muss damit rechnen, dass er in bestimmten Phasen seines Lebens kein moralisches Subjekt ist. Es ist im Interesse jedes einzelnen, dass sich moralische Normen auch auf diese Bereiche des eigenen Lebens beziehen. Allerdings gibt es Zweifel, ob sich eine interessenbasierte Ethik auch auf nicht-menschliche Lebewesen ausweiten lässt. Der Grund ist: Jeder muss damit rechnen, einmal keine moralische Pflichten wahrnehmen zu können, aber niemand muss damit rechnen, eine Ratte oder eine Maus zu sein. Viele interessenbasierte Ethiker beschränken moralische Rechte damit auf Menschen. Die Eingrenzung von Verpflichtungen auf die eigene Gattung ermöglicht den einzelnen moralischen Subjekten einen optimalen Schutz ihrer grundlegenden Interessen. Tierschutz wäre somit nur zu beachten, weil andere Personen ein Interesse am Schutz 29 von Tieren haben.20 Hier wird der Gattungszugehörigkeit nicht selbst moralische Relevanz zugesprochen, vielmehr wird sie für Praxisnormen verwendet. Die interessenbasierte Ethik kann so formuliert werden, dass sie nicht speziesistisch ist, aber dennoch muss sie nicht notwendig direkte Pflichten gegenüber nicht-menschlichen Lebewesen enthalten. Allerdings ist zu fragen, ob diese Beschränkung auf (einige) Menschen wirklich notwendig ist. Betrachten wir diesen Punkt etwas näher: Die interessenbasierte Ethik geht davon aus, dass es klug ist, moralisch zu sein. Durch den allgemeinen Schutz bestimmter Interessen gewinnt jeder einzelne Sicherheiten, die es ihm ermöglichen, auf eigene Weise nach seinem Glück zu streben. Im Rahmen einer solchen Theorie muss die Frage nach den Objekten der Moral nach anderen Gesichtspunkten beantwortet werden als in traditionellen ethischen Theorien wie dem Natur- und Vernunftrecht. Wie geht man in diesen traditionellen Theorien vor? Erst wenn es einen Grund gibt, einem Wesen mit Achtung, Respekt oder Ehrfurcht zu begegnen, wird ihm in diesen Theorien - um die Formulierung Hannah Arendts zu nehmen, "ein Recht" zugesprochen, "Rechte zu haben". Grund der Achtung sind in der Regel eine besondere Beziehung zu Gott oder Werteigenschaften wie etwa ein Eigenwert und eine Würde. Selbst letztere bedürfen zur Begründung stets einer starken metaphysischen Theorie. Für eine interessenbasierte Ethik kommt dieser Weg über die Klärung eines allgemeinen moralischen Status daher nicht in Frage. Weil sie auch Skeptiker überzeugen will, setzt sie ja zunächst bei Interessen jedes einzelnen an und begründet dann, dass es für jeden einzelnen von Vorteil ist, wenn eine Moral besteht, welche diese Interessen durch spezifische Normen schützt. Es würde der gewünschten Funktion moralischer Normen widersprechen, ein Wesen vor etwas zu schützen, wenn es auf Grund individueller Eigenschaften, seines Alters oder einer Erkrankung überhaupt kein Interesse haben kann, in dieser Hinsicht geschützt zu werden. Nehmen wir z.B. das Interesse auf Privatheit und gehen wir davon aus, dass es klug ist, ein moralisches Recht auf Privatheit einzuführen. Es ist ein Unterschied, ob Eltern ein Babyphon im Zimmer eines menschlichen Säuglings installieren oder eine vergleichbare Abhöranlage im Zimmer ihres 16jährigen Sohnes. 20 Vgl, Hoerster, Haben Tiere ein Würde?, sowie Stemmer, Handeln zugunsten anderer, S. 264-275. 30 Das Babyphon verletzt kein Interesse des Kindes, denn es hat kein Interesse auf Privatheit; ein 16jähriger hat ein solches in der Regel. Je nach zu schützendem Interesse gibt es unterschiedliche Geltungsbereiche der Normen. Da es besser ist, lieber einige unnötig in den Schutzbereich der Moral einzuschließen als jemand zu Unrecht auszuschließen, sollte der Schutzkreis in jedem Falle so weit gehen, dass sicher alle Wesen mit dem relevanten Interessen eingeschlossen werden. Aber stets gilt, dass alle Wesen, die über das betreffende Interesse verfügen, das gleiche Recht haben, in diesem Interesse geschützt zu werden. Der Grund ist, dass Moral alle moralischen Subjekte dazu bringen soll, bestimmte Interessen anderer ernst zu nehmen und zu respektieren. Wie sollte dies aber gehen, wenn man das Interesse auf Privatheit einmal respektiert und das andere Mal nicht? Schon wenn es um den Umgang mit Menschen geht, ist es sinnvoll, moralisch relevante Eigenschaften in den Blick zu nehmen und nicht einen allgemeinen moralischen Status. Moralisch relevant sind zunächst gewisse Interessen, also die spezifischen Bedürfnisse und Verletzlichkeiten, die durch die moralische Norm geschützt werden sollen. Der Bezug auf die Gattungszugehörigkeit ist wie das Alter der Betroffenen ein wichtiger Hinweis darauf, dass ein Wesen die relevante moralische Eigenschaft hat. Aber im Fokus der Aufmerksamkeit steht allein diese Frage, ob ein Wesen das relevante Interesse haben kann oder nicht. Aber heißt dies, dass man stets alle Wesen moralisch berücksichtigen muss, sofern sie ein moralisch zu schützendes Interesse haben? Da alle Tiere ein Interessen haben, nicht zu leiden, dehnte sich der Kreis der moralisch zu berücksichtigenden Wesen sehr weit aus. Müssen wir zudem nunmehr auch prüfen, ob etwa auch Tiger ein Interesse auf Privatheit haben? Denn dann wäre ja auch moralisch heikel, wenn Zoos Webkameras installieren, damit alle Welt ihre Tigerbabies betrachten kann. Gegen eine Berücksichtigung der Interessen aller spricht folgender Einwand: In einer interessenbasierten Ethik geht es darum, dass es für jeden einzelnen strategisch klug ist, gemäß moralischer Normen zu leben. Jeder verzichtet auf ein Teil seiner eigenen Freiheit, sofern alle anderen dies auch tun. Der zentrale Bezugspunkt ist, Sicherheiten zu gewinnen, die es ermöglichen, auf eigene Weise nach dem Glück zu streben. Aber welche Sicherheit kann der einzelne gewinnen, wenn andere Wesen nicht selbst in der Lage sind, strategisch auf den Verzicht anderer zu reagieren? Ge- 31 nau diese Überlegung führt dazu, dass in der Interessenbasierten Ethik nichtmenschliche Tiere normalerweise ausgeschlossen werden. Allerdings müssen wir vorsichtig sein. Relevant kann hier nicht das Vermögen sein, einen unparteiischen Standpunkt einzunehmen. Dieses Kriterium für moralisches Subjektsein ist in der Interessenbasierten Ethik ohne Bedeutung. In letzterer geht es um das Vermögen, strategisch handeln zu können. Strategisches Handeln setzt erstens die Fähigkeit voraus, auf die Realisierung kurzfristiger eigener Interessen zu verzichten, um langfristige Ziele zu erlangen. Zweitens muss die Fähigkeit vorliegen, auf Handeln anderer reagieren und insbesondere auf strategisches Handeln anderer ebenfalls strategisch antworten zu können. Genau diese beiden Fähigkeiten sind jedoch nicht nur innerhalb der menschlichen Spezies vorhanden, sondern, wenn auch in graduell geringerem Grade, auch bei nicht-menschlichen Spezies: wie zum Beispiel bei den großen Menschenaffen, Primaten, Elefanten oder Krähenvögeln. Dass sich deren strategisches Handeln nie mit dem der meisten Menschen messen kann, kann kaum bestritten werden. Aber ist diese graduelle Differenz relevant? Wichtig ist doch allein, dass sie zu solchem Handeln fähig sind. Wenn sich strategisches Handeln auch bei diesen Wesen findet, gibt es keinen Grund, sie aus dem Kreis der moralischen Objekte auszuschließen. Denn sie sind zum einen in der Lage, auf Aggression des Menschen ebenfalls aggressiv und auf friedliches Handeln selbst friedlich zu reagieren. Nicht bei allen Tieren gibt es Hinweise darauf, dass sie strateisch handeln. Bei Insekten und Spinnen würde es sehr überraschen, wenn sie stategisch agieren. Zudem gibt es eine Reihe von Tieren, bei denen wir wohl eher annehmen, dass sie nicht strategiefähig sind, aber es nicht ausschließen können. Greifvögel und Mäuse könnten in diese Kategorie gehören. Wie sieht vor diesem Hintergrund eine sinnvolle Demarkationsgrenze aus? Da es pragmatisch nur schwer möglich ist, sich auf einige Vögel und Säugetiere zu beschränken, nicht aber auf alle, ist es sinnvoll, bei den biologischen Ordnungen eine Grenze zu ziehen. Dies ist eine pragmatische Entscheidung, aber eine klügere als jene, welche nur Menschen in den Schutzbereich fasst. Gibt es ein Interesse, das alle Wirbeltiere haben - wie etwa jenes nicht zu leiden -, so bezieht sich der Schutzbereich auf alle Wirbeltiere. Bei den Wirbellosen scheint dagegen pragmatisch sinnvoll, eine andere Grenze anzunehmen. Denn strategisches Handeln kennen wir hier nur von Kraken und anderen Kopffüßern. Sich im Kontext der Wirbellosen auf diese zu beschränken, stellt Handelnde nicht vor pragmatische Probleme und ist längst Rechtspraxis der Schweiz. 32 Man könnte einwenden, dass die traditionelle Trennung von Mensch und Tier doch sinnvoller sei. Dass eine solche Grenzziehung zu funktionieren scheint, liegt allerdings daran, dass wir gewohnt sind, Menschen vom Tier prinzipiell zu unterscheiden und ersteren einen unvergleichlich höheren moralischen Wert zuzusprechen. Der Mensch ist nicht eine spezifische Tierart, er ist weit mehr als ein Tier. Diese prinzipielle Differenzierung zwischen Mensch und Tier können interessenbasierte Ethiker aber nicht mitvollziehen. Es handelt sich schließlich um eine ethische Theorie, die weder Tradition, noch Intuitionen, noch metaphysischen Dogmen traut. Aber wie können sie dann an der prinzipiellen moralischen Mensch-Tier-Unterscheidung festhalten? Denn diese stützen nur Traditionen, Intuitionen und Dogmen. Sobald man letztere in Frage stellt, muss man an der Effektivität einer Eingrenzung auf menschliche Interessen zweifeln. Welche moralischen Pflichten bestehen, hängt davon ab, welche Interessen durch die Moral geschützt werden sollen. Hier sollen nur die möglichen Auswirkungen auf den Bereich der Tierversuche interessieren. Eine zentrale Schutzfunktion der Moral ist, dass niemand einem anderen intentional Leid zufügt. Es mag Ausnahmen geben, wo eine Zufügung von Leid begründet werden kann. So ist es etwa klug, im Falle der Selbstverteidigung zu erlauben, unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit anderen Leid zuzufügen. Aber es widerspräche diametral der Funktion der Moral, wenn ein Eigeninteresse von A diesem erlauben könnte, B Leid zuzufügen. Denn das hieße, dass es doch dem Belieben anderer gelegt wird, ob sie einem schaden oder nicht. Wie groß dieses Eigeninteresse auch ist, kann es keine Missachtung des Schadensprinzips gestatten. Hier käme die alternative Deontologie zum selben Ergebnis wie die traditionelle. Im Tierversuchsbereich kommt sie aber zu einem anderen Ergebnis als das bisherige Paradigma. Denn es kann kaum im Interesse jedes einzelnen sein, dass eine wissenschaftliche Methode etabliert wird, die es den Forschenden erlaubt, Dritten Leid zuzufügen, um damit möglicherweise anderen helfen zu können. Dies heißt freilich nichts anderes, als dass es keine belastenden Tierversuche geben dürfte. Dagegen wird man einwenden wollen, dass es unklug sei, auf den möglichen medizinischen Fortschritt zu verzichten. Eine Ethik, welche Klugheit ins Zentrum stellt, dürfe doch nicht zu diesen Ergebnissen kommen. Zudem müsse man auch berücksichtigen, dass es doch auch wichtige Funktion der Moral sei, leidenden Wesen zu 33 helfen. Auch die alternative Deontologie müsse damit doch zum Ergebnis kommen, dass eine Güterabwägung erforderlich ist. Aber es ist zu bezweifeln, dass eine solche Regel, welche Güterabwägungen im Einzelfall einfordert, im Interesse jedes einzelnen ist. Bereits die Kenntnis einer solchen Regel erschwerte das eigene Leben in einer Art, die die Schutzfunktion der Moral in Frage stellte. Eine solche Norm schüfe eine hohe Bedrohungslage. Denn man muss bedenken, dass eine Norm, die solche Versuche erlaubte, auch gestattete, einen selbst oder die eigenen Kinder ohne Einwilligung in einen Versuch einzuschließen. Dieser Nachteil überwiegt den Vorteil, Nutznießer einer neuen Therapie zu sein. Ist es richtig, dass auch eine interessenbasierte Ethik gleiche Interessen stets gleich zu berücksichtigen hat, so hat sie gegenüber belastenden Tierversuchen nur eine Antwort: Sie legt ihr Veto ein. Die Pflicht, anderen zu helfen, müsste durch andere Maßnahmen angestrebt werden: durch Versuche an Wirbellosen oder Zellkulturen, durch Computersimulationen und durch Versuche an einwilligungsfähigen und einwilligenden Personen. Diese Methoden sind keine angemessenen Alternativen, wenn man wissenschaftliche Kriterien anlegt und ebenfalls keine, wenn es darum geht, die Hilfspflicht so effizient und schnell umzusetzen wie möglich. Es hätte also einen hohen Preis. Therapien rückten in weite Ferne, die jetzt möglich scheinen. Allerdings wird der Preis eines neuen Paradigmas schon dann geringer scheinen, wenn man in Betracht zieht, dass auch die konkurrierenden ethischen kaum all jene Tierversuche gutheißen werden, die derzeit durchgeführt werden. Jene Versuche, die statistische oder andere Mängel haben, werden von keiner Theorie gutgeheißen. Alle anderen werden eine kleinere oder größere Einschränkung fordern, so auch das aktuelle ethische Paradigma. Aber auch wenn man diese Überlegung heranzieht, werden die Restriktionen durch ein neues ethisches Paradigma größer sein. Aber der dabei zu zahlende Preis ist doch geringer als jener, Forschung an Nichteinwilligungsfähigen auf alle Nichteinwilligungsfähige, seien es Menschen oder Vertreter anderer Tierarten, auszudehnen. Wenn man dies hört, wird mancher gerne beim alten Paradigma bleiben. Blickt man nur auf die Ergebnisse, verheißt dieses uns Menschen das Bessere. Aber es ist falsch, nur auf das Ergebnis ethischer Theorien zu schauen; denn es braucht ja ethische Theorien, um zu bewerten, welche Ergebnisse gut oder schlecht sind. Zudem stehen wir bezüglich unseres jetzigen ethischen Paradigmas, auf das sich unsere Intuitionen weitgehend 34 abstützen, vor dem Problem, dass die Vorstellung einer moralischen Sonderstellung des Menschen nicht so einfach aufrechtzuerhalten ist. Die Säulen, auf denen das alte Paradigma ruht, sind nicht mehr tragfähig. Auch der Wunsch, dass man weitermachen will wie bisher, kann ihnen keine größere Tragfähigkeit geben. Die Notwendigkeit eines neuen Paradigmas bleibt bestehen. Es wäre jedoch illusorisch zu hoffen, dass sich diese alternative Deontologie zu Lebzeiten in einem Tierschutzrecht verankern könnte. Moralische Intuitionen wie jene, welche das heutige Tierschutzrecht stützen, sind einem langsamen Wandel unterworfen. Dass man an diesem Wandel arbeitet, ist eine Pflicht. Aber das heißt nicht, dass man damit Forschung so gewähren lässt wie sie derzeit geschieht. Es ist meines Ermessens auch unverzichtbar, drei Nahziele zu verfolgen: erstens die nötige Beschränkung der Tierversuche auf jene, die methodisch und korrekt arbeiten, und zweitens jenen, den deontologischen Geist des Tierschutzgesetzes wieder stärker zur Geltung zu bringen. Denn dieser liegt dem moralischen Endziel doch weit näher als eine Praxis, in der bereits Eigeninteressen ausreichende Gründe sind, Tieren zu schaden. Wenn man dies jedoch tut, kann man es drittens nur in einer Weise tun. Man muss sich gegen eine lexiographische Güterabwägung aussprechen. Dass einige Gerichtsurteile von dieser Form der Güterabwägung abweichen, ist ein Zeichen, dass ein Wandel durchaus im Gange ist. 35 Literatur: Birnbacher, Dieter: Gibt es überzeugende Gründe für eine axiologische Sonderstellung des Menschen? in: Simone Zurbuchen/Jean Claude Wolf (Hrsg), Humanismus, Sein kritisches Potential für Gegenwart und Zukunft, Freiburg: Freiburger Universitätsverlag, 2011, S. 99-115. Hofmann, Frank: Wahrheit und Wissen. Einige Überlegungen zur epistemischen Normativität, Zeitschrift für philosophische Forschung 61, 2, (2007), 1-28. Hoerster, Norbert: Haben Tiere eine Würde. Grundfragen der Tierethik, München: Beck 2004. Kluge, Hans Georg (Hrsg.): Tierschutzgesetz, Kommentar, Stuttgart: Kohlhammer 2002. Lorz, Albert: Die Entwicklung des deutschen Tierschutzrechts, in: Ursula M. Händel (Hrsg,): Tierschutz, Testfall unserer Menschlichkeit, Frankfurt: Fischer, 1984, 129-143. Regan, Tom: The Case for Animal Rights, Berkeley: University of California Press, 1984. Regan, Tom: Defending Animal Rights, Urbana: University of Illinois Press, 2001. Rippe, Klaus Peter: Ethik im außerhumanen Bereich, Paderborn: mentis, 2008. Rippe, Klaus Peter: Ethik in der Wirtschaft, Paderborn: mentis, 2010. Rippe, Klaus Peter: Kann es eine naturalistische Begründung für die moralische Sonderstellung des Menschen geben?, in: Simone Zurbuchen/Jean Claude Wolf (Hrsg), Humanismus, Sein kritisches Potential für Gegenwart und Zukunft, Freiburg: Freiburger Universitätsverlag, 2011, S. 117-126. Smith, Jane A. & Boyd, Kenneth M. (eds.): Lives in the Balance, The Ethics of Using Animals in Biomedical Research, The Report of the Working Party of the Institute of Mediacl Ethics, Oxford: Oxfort University Press, 1991. 36 Spaemann, Robert: Tierschutz und Menschenwürde, in: Ursula M. Händel (Hrsg,): Tierschutz, Testfall unserer Menschlichkeit, Frankfurt: Fischer, 1984, 71-81. Stemmer, Peter: Handeln zugunsten anderer. Eine moralphilosophische Untersuchung, Berlin: DeGruyter, 2000. Angaben zum Autor Prof. Dr. Klaus Peter Rippe hat an der Universität Göttingen Philosophie, Geschichte und Ethnologie studiert und wurde dort mit einer Arbeit zum Thema "Grenzen und Geltung des ethischen Relativismus" promoviert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Saarbrücken, Mainz und Zürich und habilitierte an der Universität Zürich mit einer Schrift zum Thema "Politischer Liberalismus und die Theorie des guten Lebens." 2008 erhielt er den Ruf auf die Professur für Praktische Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. 2011 wurde er zum ordentlichen Mitglied der „Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Salzburg ernannt. Er war zehn Jahre Präsident der "Eidgenössischen Ethikkommission für Biotechnologie im ausserhumanen Bereich". 1993 bis 2011 war er zudem Mitglied der Kantonalen Tierversuchskommission Zürich, die er 2003-2011 präsidierte. Zudem ist er Mitglied der "Arbeitsgruppe Würde", einer Expertengruppe, welche im Auftrag des Schweizerischen Bundesamts für Veterinärwesen Bedeutung und Applikation des Gesetzesbegriffs "Würde des Tiers" diskutiert. Die Veröffentlichung dieses Beitrages wurde angeregt durch Herrn Tomas Cabi. 37 In dieser Reihe sind bisher folgende Bände erschienen: Band 1 Prof. Dr. Gerfried Fischer „Medizinische Versuche am Menschen“, 2006 Band 2 Verena Ritz „Harmonisierung der rechtlichen Regelungen über den Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in der EG: Bioethik im Spannungsfeld von Konstitutionalisierung, Menschenwürde und Kompetenzen“, 2006 Band 3 Dunja Lautenschläger „Die Gesetzesvorlagen des Arbeitskreises Alternativentwurf zur Sterbehilfe aus den Jahren 1986 und 2005“, 2006 Band 4 Dr. Jens Soukup, Dr. Karsten Jentzsch, Prof. Dr. Joachim Radke „Schließen sich Ethik und Ökonomie aus“, 2007 Band 5 Prof. Dr. Hans Lilie (Hrsg.) „Patientenrechte contra Ökonomisierung in der Medizin“, 2007 Band 6 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) Auszug aus dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - AMG) Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz TFG), 2007 Band 7 Dr. Erich Steffen „Mit uns Juristen auf Leben und Tod“, 2007 Band 8 Dr. Jorge Guerra Gonzalez, Dr. Christoph Mandla „Das spanische Transplantationsgesetz und das Königliche Dekret zur Regelung der Transplantation“, 2008 Band 9 Dr. Eva Barber „Neue Fortschritte im Rahmen der Biomedizin in Spanien: Künstliche Befruchtung, Präembryonen und Transplantationsmedizin“ und „Embryonale Stammzellen - Deutschland und Spanien in rechtsvergleichender Perspektive“, 2008 Band 10 Prof. Dr. Dr. Eckhard Nagel „Was ist der Mensch? Gedanken zur aktuellen Debatte in der Transplantationsmedizin aus ethischer Sicht“ Prof. Dr. Hans Lilie „10 Jahre Transplantationsgesetz - Verbesserung der Patientenversorgung oder Kommerzialisierung?“, 2008 Band 11 Prof. Dr. Hans Lilie, Prof. Dr. Christoph Fuchs „Gesetzestexte zum Medizinrecht“, 3. Auflage, 2011 Band 12 PD Dr. Matthias Krüger „Das Verbot der post-mortem-Befruchtung § 4 Abs. 1 Nr. 3 Embryonenschutzgesetz –Tatbestandliche Fragen, Rechtsgut und verfassungsrechtliche Rechtfertigung“, 2010 38 Band 13 Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Dr. Marlis Hübner „Ärztlich assistierter Suizid - Tötung auf Verlangen. Ethisch verantwortetes ärztliches Handeln und der Wille des Patienten“, 2010 Band 14 Philipp Skarupinski „Medizinische, ethische und rechtliche Aspekte der Notwendigkeit einer Kinderarzneimittelforschung vor dem Hintergrund der EG-Verordnung 1901/2006“, 2010 Band 15 Stefan Bauer „Indikationserfordernis und ärztliche Therapiefreiheit: Berufsrechtlich festgelegte Indikation als Einschränkung ärztlicher Berufsfreiheit? Dargestellt am Beispiel der Richtlinie zur assistierten Reproduktion“, 2010 Band 16 Heidi Ankermann „Das Phänomen Transsexualität – Eine kritische Reflexion des zeitgenössischen medizinischen und juristischen Umgangs mit dem Geschlechtswechsel als Krankheitskategorie“, 2010 Band 17 Sven Wedlich „Konflikt oder Synthese zwischen dem medizinisch ethischen Selbstverständnis des Arztes und den rechtlich ethischen Aspekten der Patientenverfügung“, 2010 Band 18 Dr. Andreas Walker „Platons Patient – Ein Beitrag zur Archäologie des Arzt-Patienten-Verhältnisses“, 2010 Band 19 Romy Petzold „Zu Therapieentscheidungen am Lebensende von Intensivpatienten – eine retrospektive Analyse“, 2010 Band 21 Dr. Andreas Linsa „Autonomie und Demenz“, 2010 Band 20 Stephanie Schmidt „Die Beeinflussung ärztlicher Tätigkeit“, 2010 Band 22 Dr. Cerrie Scheler „Der Kaiserschnitt im Wandel – von der Notoperation zum Wunscheingriff“, 2010 Band 23 Lysann Hennig „Wenn sich Kinder den Traumkörper wünschen – Schönheitsoperationen, Piercings und Tätowierungen bei Minderjährigen“, 2010 Band 24 Dr. Michael Lehmann „Begründen und Argumentieren in der Ethik", 2011 Band 25 Dr. Susanne Kuhlmann „Der Dialyseabbruch: Medizinische, ethische und juristische Aspekte", 2011 Band 26 Dr. Katharina Eger „Off-label use - Eine Übersicht mit Beispielen aus dem Fachgebiet Neurologie", 2011 Band 27 Annette Börner „Die Macht der Sachverständigen im Arzthaftungsfall Rolle und Auswirkungen der Sachverständigengutachten unter besonderer Berücksichtigung von Medizin, Ethik und Recht", 2011 Band 28 Susanne Weidemann „Von der Wirkmacht der Messwerte. Überlegungen zum verschwundenen Einzelfall in der medizinischen Praxis", 2011 39 Band 29 Christian Albrecht „Das Patientenverfügungsgesetz - Eine Bilanz der praktischen Umsetzung", 2011 Band 30 Dr. Erich Steffen „Macht und Ohnmacht des Richters im Arzthaftungsrecht", 2011 Band 31 Franziska Kelle „Widerspruchslösung und Menschenwürde Eine verfassungsrechtliche Untersuchung zur Begründbarkeit einer Organspendepflicht und zur Vereinbarkeit von Menschenwürde und Widerspruchslösung unter Berücksichtigung ethischer und medizinischer Aspekte“, 2011 Band 32 Maria Busse „Transsexualität als Krankheit? Einordnung im Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung unter Berücksichtigung medizinischer und ethischer Aspekte“, 2011 Band 33 Dr. Daniel Ammann „Psychotherapie im System der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine interdisziplinäre Analyse struktureller Versorgungsprobleme und möglicher sozialrechtlicher Lösungsansätze insbesondere am Beispiel der unipolaren Depression und der BorderlinePersönlichkeitsstörung“, 2011 Band 34 Clemens Heyder; "Das Verbot der heterologen Eizellspende", 2012 Band 35 Dr. Uta Baddack, "Der Patient zwischen Autonomie und Compliance", 2012 Band 36 Andreas Raschke, „Der intensivpflichtige Patient und die ärztliche Schweigepflicht“, 2012