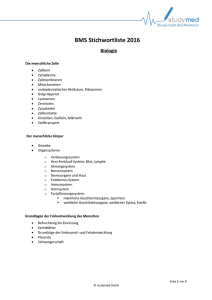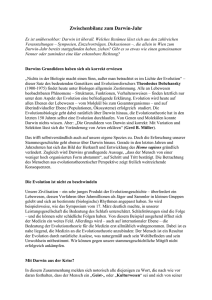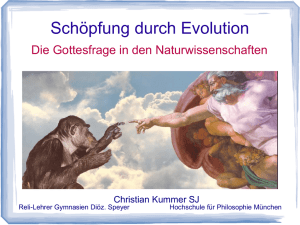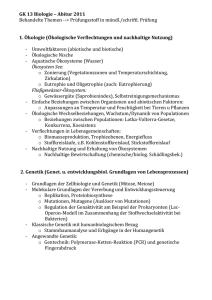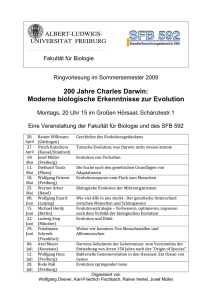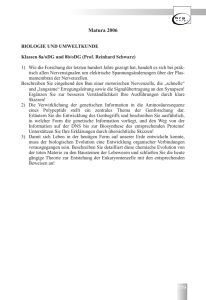Evolution wohin? - Content
Werbung
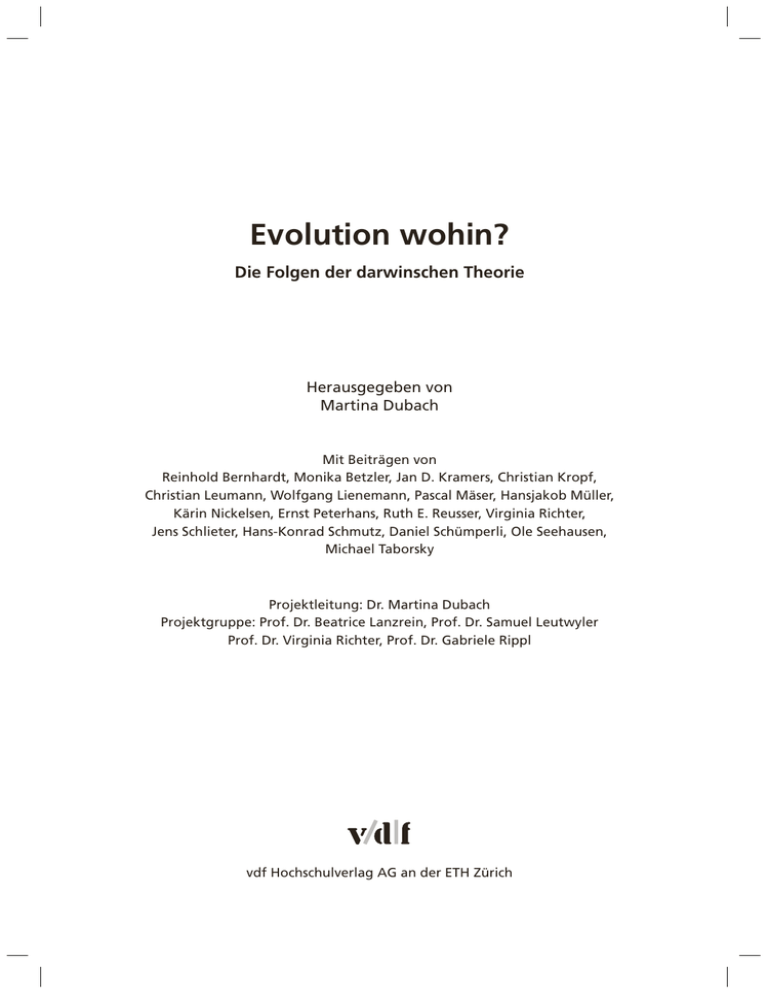
5 Rainer C. Schwinges Evolution wohin? Die Folgen der darwinschen Theorie Herausgegeben von Martina Dubach Mit Beiträgen von Reinhold Bernhardt, Monika Betzler, Jan D. Kramers, Christian Kropf, Christian Leumann, Wolfgang Lienemann, Pascal Mäser, Hansjakob Müller, Kärin Nickelsen, Ernst Peterhans, Ruth E. Reusser, Virginia Richter, Jens Schlieter, Hans-Konrad Schmutz, Daniel Schümperli, Ole Seehausen, Michael Taborsky Projektleitung: Dr. Martina Dubach Projektgruppe: Prof. Dr. Beatrice Lanzrein, Prof. Dr. Samuel Leutwyler Prof. Dr. Virginia Richter, Prof. Dr. Gabriele Rippl vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich Evolution wohin? Als Darwin 1859 sein bahnbrechendes Werk «On the Origin of Species by Means of Natural Selection» veröffentlichte, kam dessen Wirkung auf das menschliche Selbstverständnis einer Katastrophe gleich, ähnlich dem Aufkommen des heliozentrischen Weltbildes von Kopernikus im 16. Jahrhundert. Darwins Theorie war einerseits ein fundamentaler Bruch mit dem herkömmlichen Weltbild. Andererseits hat Darwin der Gesellschaft mit diesem Buch einen enormen kulturellen und wissenschaftlichen Schatz hinterlassen. Mittelpunkt des darwinschen Evolutionsgedanken ist die Aussage, dass die Entstehung und Veränderung der Arten eng mit der natürlichen Auswahl gekoppelt ist: Wer besser an seinen Lebensraum angepasst ist, hat bessere Überlebenschancen, wird mehr Nachkommen haben und seine Gene häufiger vererben. Evolution durch natürliche Selektion ist ein Naturgesetz, das nicht nur für die Beschreibung der Entwicklung von Tieren und Pflanzen essentiell ist, sondern heute einen zentralen Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Fragen bietet – von der Molekularbiologie bis zu den Wirtschaftswissenschaften. Die Evolutionstheorie ist für die Biologie ebenso fundamental wie die klassische Mechanik für die Physik. Auch wenn Darwin damals einige der Evolution zugrunde liegende Mechanismen, wie z.B. jene der Vererbung, noch nicht kannte, gelten die in seinem Buch beschriebenen Grundprinzipien heute noch genauso wie vor 150 Jahren. Sie bilden die Basis für die moderne Evolutionsforschung von der Molekulargenetik über die synthetische Evolutionsbiologie bis hin zur Populationsgenetik und Verhaltensökologie. Darwins Werk überrascht bis heute durch die Tiefgründigkeit der Analyse und den grossen Schatz an gesammelten Daten. «On the Origin of Species» ist wohl einzigartig als es sowohl eine wissenschaftliche Revolution ausgelöst hat als auch gleichzeitig allgemeinverständlich geschrieben ist. Die erste Ausgabe (1859) war bereits nach wenigen Wochen ausverkauft. Neuauflagen und Übersetzungen folgten rasch. Bereits 1860 erschien die erste deutsche Ausgabe. Die Grundideen Darwins scheinen noch immer auf in den aktuellen Debatten über selbstreplizierende Moleküle, Bio- und Gentechnologie, Altruismus und Kooperation. Auch die Theologie muss sich seit Darwin mit naturwissenschaftlich-kausalen Theorien zum Ursprung und zur Entwicklung des Lebens als Gegenvorschlag zum Schöpfungsmythos auseinandersetzen. Und seit die «Perfektionierung» von Lebewesen nicht mehr nur Science Fiction ist, sondern in den Bereich des Machbaren vorstösst, stellen sich auch ethische und juristische Fragen in Bezug auf die Tier- und Menschenwürde. Damit nicht genug, Darwins Interpretationen haben auch in der Literatur deutliche Spuren hinterlassen. Viele Schriftsteller wurden dazu angeregt, seine Theorie weiterzuspinnen, abzuwandeln oder im Sinne einer Rückentwicklung sogar umzudrehen. Die Implikationen von Darwins Theorie für die heutige Zeit waren Grund genug, dass sich das Forum für Universität und Gesellschaft der Universität Bern entschloss, 2009 eine Reihe von Veranstaltungen zu den Auswirkungen der Evolutionstheorie auf die heutige Wissenschaft und Gesellschaft zu organisieren. Rund um das Darwin-Jubiläumsjahr entstanden viele Bücher und Artikel, die das Lebenswerk des britischen Naturforschers in allen Facetten ausleuchten. Das Forum wollte diesem Reichtum nicht einfach eine weitere Würdigung beifügen. So sollten die vier halbtägigen Workshops und eine Vorlesungsreihe in Zusammenarbeit mit dem Collegium generale der Universität Bern auch weniger die historische Evolutionstheorie nachzeichnen als vielmehr auf die immer noch ungebrochene Aktualität und Relevanz des darwinschen Konzeptes hinweisen. Das Projekt sollte den verschiedenen Fachbereichen der modernen Evolutionsforschung eine Plattform sein, für ihr Wissen und die sich daraus entwickelnden neuen Fragestellungen zu sensibilisieren. Der interessierten Öffentlichkeit sollte es Einblicke geben in die vielfältigen Einflüsse einer wissenschaftlichen Theorie auf die Gesellschaft und ihre Entwicklung. So hat das Forum nachgefragt, was von Darwins Theorie übriggeblieben ist und welche Fragen aktuell im Mittelpunkt des Interesses stehen. Evolutionsbiologen und Philosophinnen, Geologen, Theologen und Mediziner, Juristinnen und Ethikerinnen berichten im vorliegenden Sammelband aus ihrer Forschung und bieten Informationen aus erster Hand zum modernen Verständnis der Evolutionstheorie und ihrer Auswirkungen. Die Auslegeordnung führt vom historischen Kontext und einem kleinen ABC der Evolutionstheorie hin zu Fragen nach der Ersetzbarkeit der Schöpfungsgeschichte durch die Evolutionstheorie oder «Sollen wir der Evolution ins Handwerk pfuschen»? Der vorliegende Band versammelt die Beiträge dieser Reihe. Unser Dank geht an alle, die diesen reichhaltigen Zyklus ermöglicht haben: an das Forum, welches die Projektidee unterstützt hat, an die Mitglieder der Begleitgruppe (Professorinnen Beatrice Lanzrein, Virginia Richter, Gabriele Rippl), die mit viel Engagement und Ausdauer geholfen haben, das Projekt aus der Taufe zu heben, an die Stiftung Universität und Gesellschaft, welche die Durchführung der Workshops und der Vorlesungsreihe finanziell ermöglichte, an die Vortragenden, die ihre Referate in mühevoller Kleinarbeit zu Manuskripten für den Sammelband umgearbeitet haben und auch an die Teilnehmenden aus allen Bereichen der Gesellschaft, die unsere Arbeit mit ihrem Interesse und mit ihren Fragen und Kommentaren belohnt haben. Lassen Sie sich einladen und überraschen von der Vielfalt der Beiträge und gönnen Sie sich vertiefte Einblicke in die modernen Ergebnisse der Evolutionsforschung. 111 Das Kernproblem der Evolutionstheorie: Kooperation und Altruismus MICHAEL TABORSKY Charles Darwin, der große Wegbereiter der modernen Biologie, erkannte bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass Kooperation im Tierreich auf naturwissenschaftlicher Basis schwerer zu erklären ist, als jegliche anderen Verhaltensmerkmale. In seiner Theorie der natürlichen Selektion, die auf dem Prinzip beruht, dass die Stärksten und Eigennützigsten sich in der Konkurrenz um Ressourcen durchsetzen und damit in einer Population von Generation zu Generation an Häufigkeit zunehmen, hatte die Beobachtung von Verzicht und Hilfeleistung zum alleinigen Vorteil anderer zunächst keinen Platz. Ja, sie lief Darwin’s Theorie so grundlegend entgegen, dass er diese, bereits ihm wohlbekannten Phänomene im Tierreich als Stolperstein für seine Evolutionstheorie ansah. So schrieb er in seinem epochalen Werk «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life» (1859; Abb. 1), das alsbald zur «Heiligen Schrift» der Biologie werden sollte: «Natural Selection will never produce in a being anything injurious to itself, for natural selection acts solely by and for the good of each» – um dann aber eingestehen zu müssen «I … will confine myself to one special difficulty, which at first appeared to me insuperable, and actually fatal to my whole theory. I allude to the neuters or sterile females in insect-communities.» Die Bedeutung dieser «besonderen Schwierigkeit» für die Evolutionstheorie durch die Existenz steriler Kasten bei staatenbildenden Insekten wird vielleicht am deutlichsten in Darwins Aussage «… this is by far the most serious special difficulty, which my theory has encountered.» Was ist nun die «besondere Schwierigkeit», die die Kooperation zwischen Tieren für die Evolutionstheorie darstellt? Um das zu verstehen, sollten wir uns die Grundprinzipien der biologischen Evolution in Erinnerung rufen. Die Wirkung natürlicher Selektion beruht auf drei Bausteinen: (1) einem Überangebot an Individuen in einer Population, (2) erblicher Merkmalsvariation zwischen ihnen und (3) dem Überleben und der Vermehrung der konkurrenzfähigeren Individuen. Wenn ein Individuum nun, zum Vorteil eines anderen, zum Beispiel auf die eigene Fortpflanzung verzichtet, wie dies bei den steri- 112 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS Abb. 1: Charles Darwin, als er mit seinem Buch über die Entstehung der Arten die Welt wachrüttelte. Kein anderes Werk hat in der Biologie eine annähernd grosse Bedeutung wie dieses, mit dem Darwin seine Erkenntnisse zur natürlichen Evolution nicht nur als Hypothese formulierte, sondern auch gleich mit einer Fülle von Ergebnissen seiner sich über Jahrzehnte erstreckenden Recherchen untermauerte. Nicht zu unrecht wird seither die Begründung der Evolutionstheorie in der Bedeutung auf eine Ebene gestellt mit den Erkenntnissen der Physiker Kopernikus, Newton und Einstein – bewirkte sie doch eine «kopernikanische Wende» in der Biologie. Von vielen wird dieses Werk als das bedeutendste wissenschaftliche Buch aller Zeiten gesehen. len Arbeiterinnen von Bienen und Ameisen der Fall ist, werden die Merkmale dieses Tieres nicht in die nächste Generation weitergegeben, seine «genetische Fitness» ist also null. Wie kann sich dieser altruistische Reproduktionsverzicht, bzw. auch das andere, altruistische Hilfeverhalten von Bienen- und Ameisenarbeiterinnen, das nicht der Förderung eigener Nachkommen dient, von Generation zu Generation aufrecht erhalten? Um diese Frage klären zu können, müssen wir zunächst wissen, dass Arbeiterinnen und Geschlechtstiere, oder Königinnen, im Insektenstaat genetisch identisch sind. Das heisst, ob aus einer weiblichen Larve einst eine Königin oder Arbeiterin wird, bestimmt nicht ihre genetische Struktur, sondern das Fütterungsverhalten der Arbeiterinnen, die sie aufziehen. Das verschiebt die Frage um eine Ebene. Es ist also nicht mehr die Frage, warum Arbeiterinnen auf eigene Fortpflanzung verzichten, sondern warum ihre Ammen sie durch suboptimale Versorgung dazu bringen, selbst zu sterilen Ammen zu werden – mit anderen Worten ein Programm abzurufen, das ihre eigene Fortpflanzung auf Lebenszeit unterdrückt. Es hat über ein Jahrhundert nach Darwins «Origin» gedauert, bis der – ebenfalls britische – Biologe William D. Hamilton 1964 mithilfe theoretischer Modelle eine plausible Antwort auf diese Frage fand. Er wusste nämlich, was Darwin vor der Geburtsstunde der Genetik noch nicht wissen konnte: dass Schwestern bei den Hautflüglern näher miteinander verwandt sind, als Mütter mit ihren eigenen Nachkommen. Die Ursache für diese, auf den ersten Blick absurd anmutenden Verwandtschaftsverhältnisse liegt in der Tatsache, dass Hautflüglermännchen nur einen einfachen Chromosomensatz tragen – also im Gegensatz zu den meisten anderen mehrzelligen Lebewesen nicht 113 MICHAEL TABORSKY Abb. 2: Charles Darwin, als er zwölf Jahre nach Erscheinen der «Origin of Species» in seinem Buch über die Abstammung des Menschen den Beweis antrat, dass auch der Mensch in der selben Art und Weise von anderen Lebewesen abstammt, wie alle anderen Organismen, mit denen er die Erde teilt. Hier hat Darwin auch die Theorie der sexuellen Selektion im Detail erläutert und in bezeichnender Konsequenz auch auf den Menschen angewendet. diploid, sondern haploid sind. Männchen entwickeln sich nämlich aus unbefruchteten Eiern. Da Männchen also nur einen Chromosomensatz haben, und nicht zwei, bekommen alle ihre Nachkommen dieselben genetischen Anlagen mit. Wenn nun der Verwandtschaftsgrad zwischen Schwestern (3/4) höher ist, als zwischen Müttern mit ihren Töchtern (1/2), kann sich genetisch bedingter Altruismus – also z.B. der Verzicht auf eigene Nachkommen zugunsten einer Schwester – in der Population gegenüber eigennützigem Verhalten – also der Produktion eigener Töchter – im Verlauf von Generationen durchsetzen. Die Auswirkungen dieser «Haplodiploidie» der Hautflügler auf ihr Verhalten sind weitreichend. Da die Verwandtschaft zwischen den Geschlechtern asymmetrisch ist, teilen Weibchen mit ihren Söhnen die Hälfte ihres Genoms, mit ihren Brüdern allerdings nur ein Viertel – das heisst, Weibchen verbreiten genetisch kodierte Merkmale besser durch die Produktion eigener Söhne, als durch die Förderung von Brüdern. Damit sollte ein Ameisenweibchen also zwar zugunsten einer Schwester auf die Produktion eigener Töchter verzichten, aber eher eigene Söhne produzieren. Verzicht auf eigene Nachkommenschaft zugunsten von Schwestern ist tatsächlich die Regel bei Ameisen und staatenbildenden Bienen, weswegen wir dort von einer «Königin» (Geschlechtstier) und «Arbeiterinnen» (sterile Brutpflegehelfer) sprechen. Jedoch werden entgegen der aus den Verwandtschaftsverhältnissen abgeleiteten Erwartung auch Männchen in der Regel von der Königin produziert und nicht von den Arbeiterinnen. Der Grund hierfür liegt, wie es scheint, in einem Überwachungssystem der Arbeiterinnen, die – obgleich sie selbst Söhne produzieren sollten, aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse aus der Produktion von Söhnen anderer Arbeiterinnen geringere Fitnessvorteile ziehen würden. Bei verschiedenen Arten fand man, dass Arbeiterinnen durch gezielten Kannibalismus die Produktion und Aufzucht von Eiern gegenseitig verhindern. 114 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS Der Verzicht auf eigene Fortpflanzung zugunsten einer Schwester im Insektenstaat ist aber nur eine Facette des Altruismus von vielen, die Spitze des Eisbergs gewissermassen. Die Evolutionsbiologen John Maynard Smith und Eörs Szathmary (1997) gliederten die evolutive Entwicklung von einfachen zu komplexen biologischen Strukturen in sieben aufeinanderfolgende Schritte, die alle durch die Notwendigkeit zu Kooperation und Verzicht (auf eigene Reproduktion) gekennzeichnet sind: 1) Von sich replizierenden Einzelmolekülen zu Molekülgruppen in Kompartimenten 2) Von unverbundenen Replikatoren zu Chromosomen 3) Von RNS als Gen und Enzym zur Arbeitsteilung zwischen DNS und Proteinen 4) Von Prokaryoten zu Eukaryoten (zellulären Organismen mit Zellkern und -membran) 5) Von asexuellen Klonen zu Organismen mit geschlechtlicher Fortpflanzung 6) Von Einzellern zu Vielzellern mit Zelldifferenzierung 7) Von Einzelindividuen zu Kolonien und arbeitsteiligen Gruppen Kooperation – anstatt Konkurrenz – als Prinzip der Evolution? Rufen wir uns in Erinnerung, was Charles Darwin dazu in seinem Buch The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871; Abb. 2) schrieb, in dem er zwölf Jahre nach seinem Werk über die Entstehung der Arten die biologischen Wurzeln des Menschen beleuchtete: • • «He who was ready to sacrifice his life … rather than betray his comrades, would often leave no offspring to inherit his noble nature» «Therefore it seems scarcely possible … that the number of men gifted with such virtues … could be increased through natural selection, that is, by the survival of the fittest» Wie kann man also Kooperation und Altruismus bei Mensch und Tier biologisch erklären, wenn dies dem Prinzip der Evolution durch natürliche Selektion so diametral entgegenläuft? Eine Erklärung haben wir oben schon kennengelernt – die Verwandtschaftsverhältnisse. Unterstützung von Verwandten ist natürlich nicht nur bei den asymmetrischen Verwandtschaftsverhältnissen von Hautflüglern vorteilhaft. Schliesslich ist die Verwandtschaft bei diploiden Organismen zwischen Eltern und Kindern gleich hoch, wie zwischen Geschwistern. Dies be- 115 MICHAEL TABORSKY deutet zwar nicht, dass Tiere auf ihre eigene Fortpflanzung zugunsten der Geschwisterproduktion verzichten sollten, wie für die haplodiploiden Hautflügler erläutert, aber wenn zum Beispiel der eigenen Fortpflanzung widrige Umweltbedingungen entgegenstehen, kann die Produktion von Nachkommen in der elterlichen Familie durchaus genetische Vorteile bringen – also die Verbreitung genetischer Wurzeln von Eigenschaften wie «Geschwisterpflege» befördern. Tatsächlich findet man bei vielen Fischen, Vögeln und Säugern Familiengruppen, in denen Subdominante, die selbst keine Nachkommen erzeugt haben, bei der Pflege der Nachkommen von Dominanten mithelfen – und dabei Fitnesskosten auf sich nehmen, wie zum Beispiel verlangsamtes Wachstum. In der Regel sind es nahe Verwandte, wie Geschwister und Halbgeschwister, die diese «Helfer» aufziehen. Zu den genetischen Vorteilen aus der Verwandtenförderung kommt noch ein zweiter, wichtiger Effekt, der Kooperation zum funktionstüchtigen Evolutionsprinzip macht: die Steigerung der Effizienz. Der Erfolg von Handlungen kann gegebenenfalls wesentlich höher sein, wenn Individuen in Gruppen kooperieren, als wenn sie einzeln agieren (Abb. 3). Besonders deutlich wird dies wiederum bei den staatenbildenden Insekten, wo die Evolution höchster Sozialität oft durch die Differenzierung von Gruppenmitgliedern charakterisiert ist. Dies umfasst Spezialisierungen in Verhalten, Morphologie und Physiologie und lässt sich eindrucksvoll mit den Unterschieden in Körperbau und Grösse zwischen Königinnen, Soldatinnen und Arbeiterinnen bei Ameisen und Termiten illustrieren (Abb. 4). Diese morphologische Variation geht einher mit entsprechenden Spezialisierungen im Verhalten – in diesem Fall der Eiproduktion, Verteidigung und Brutpflege im Insektenstaat. Mit dieser Arbeitsteilung sind beispielsweise Ameisen so effizient, dass sie Staaten mit mehreren Millionen Individuen bilden können, die ganze Landstriche für sich nutzbar machen. Ein Spiegel dieser Effizienz ist auch, dass die etwa 20.000 Arten von Ameisen insgesamt geschätzt etwa 15–20% der Biomasse der tierischen Weltbevölkerung ausmachen – sie übertreffen damit auch die menschliche Biomasse um ein Vielfaches. Hochsoziale Gruppenbildung und effiziente Kooperation ist aber bei weitem nicht auf das Insektenreich beschränkt. Bei kooperativ brütenden Wirbeltieren erhöhen Brutpflegehelfer, die in diesem Status meist keine eigenen Nachkommen produzieren, die Produktivität der Brutpaare, deren Junge sie aufziehen – und erhöhen durch ihr altruistisches Verhalten auch noch die Überlebensrate dieser Jungen (Abb. 5). Dabei nehmen sie aber Fitnesskosten auf sich, wie zum Bei- 116 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS Abb. 3: Bei der Heckenbraunelle erhöht sich die aus einem Gelege stammende Zahl überlebender Jungen statistisch signifikant (gekennzeichnet durch Sternchen zwischen benachbarten Säulen), wenn die Aufzucht vom Brutpaar mit mindestens einem zusätzlichen Männchen erfolgt («kooperative Polyandrie»; Quelle: Davies 1990). spiel ein erhöhtes Mortalitätsrisiko oder verlangsamtes Wachstum, die über die Lebenszeit irgendwie kompensiert werden müssen, damit sich ihr genetisch kodiertes, uneigennütziges Verhalten in der Evolution gegenüber egoistischem, nur auf eigene Fortpflanzung gerichteten Verhalten durchsetzen kann. Die Aufzucht von Verwandten und die damit verbundene Verbreitung genetischer Merkmale durch Verwandtenselektion ist dabei nicht die einzige Möglichkeit. 117 MICHAEL TABORSKY Abb. 4: Extreme Beispiele morphologischer Differenzierung bei staatenbildenden Insekten, die von entsprechender Spezialisierung im Verhalten begleitet sind: eine Ameisenarbeiterin auf dem Kopf einer Soldatin der gleichen Art (links) sowie eine Termitenkönigin im Kreise ihres «Gefolges». Von der Königin ist vor allem der aufgeblähte Hinterleib zu sehen, der zur Eierproduktionsmaschine umgewandelt wurde. Auf der tausende von Eiern umhüllenden Membran sind noch die Kutikulaplatten der Segmente des Hinterleibs als kleine, dunkle Querstriche zu erkennen. Dies wird klar, wenn wir uns die von William Hamilton postulierte, bestechend einfache Formulierung der Voraussetzung für die Evolution altruistischen Verhaltens ansehen: N/K > 1/r wobei N für Fitnessnutzen für den Empfänger, K für Fitnesskosten für den Akteur und r für den Verwandtschaftsgrad zwischen beiden steht, der, wie erwähnt, zwischen Eltern und Kindern – ebenso wie zwischen Vollgeschwistern – jeweils ½ ist. Wenn der Verwandtschaftsgrad zwischen Helfern und Hilfsempfängern klein ist, muss also der Nutzen der Hilfsempfänger steigen – oder die Kosten der Helfer müssen sinken – damit sich kooperatives Verhalten auf genetischer Basis evolutiv durchsetzen kann. Dabei sind die erwähnten Nutzen und Kosten in ihren Auswirkungen auf die genetische Fitness der Individuen auf ihre gesamte Lebenszeit bezogen, auf die Menge an Nachkommen oder Verwandten also, die sie im Verlauf ihres Lebens hervorbringen können. Dies sind natürlich sehr grobe Kategorien, die bei genauerer Betrachtung so manchen Spielraum ermöglichen. Wir wollen uns das an einem Beispiel ansehen. Der Buntbarsch aus dem Tanganjikasee mit dem klingenden Namen «Prinzessin von Burundi» bildet grosse Familiengruppen aus bis zu 30 Fischen, die bei der Verteidigung und Pflege eines Territoriums sowie bei der Brutpflege zusammenarbeiten. Dabei werden fast alle Nachkommen vom dominanten Brutpaar erzeugt. Die subdominanten Brutpflegehelfer nehmen für ihre Hilfe hohe Stoffwechselkosten in Kauf, was ihr Wachstum 118 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS verlangsamt. Vor ihrer Geschlechtsreife, wenn sie also noch klein bzw. jung sind, pflegen sie dabei oft Geschwister bzw. Halbgeschwister. Je älter sie werden, steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass bereits ein oder beide Elternteile durch fremde, unverwandte Tiere aus der Umgebung ausgetauscht wurden – die Zeit, für die man ein Territorium behaupten kann, ist begrenzt. Da die Helfer bleiben, wenn dies passiert, sinkt mit der Zeit der durchschnittliche Verwandtschaftsgrad von Helfern und Hilfsempfängern – geschlechtsreife Helfer leisten ihre Arbeit also oftmals für Nicht-Verwandte. Warum tun sie das? Warum hat die natürliche Selektion nicht Fische mit eigennützigem Verhalten hervorgebracht, die das heimische Territorium verlassen, sobald sie fortpflanzungsreif sind, um möglichst rasch möglichst viele eigene Nachkommen zu produzieren? Abb. 5: Anteil der Jungen des Buntbarsches Neolamprologus pulcher («Prinzessin von Burundi»), die überlebten, wenn die Hälfte der Brutpflegehelfer aus kooperativ brütenden Gruppen im Feld experimentell entfernt wurde («Removal»), im Vergleich mit Kontrollgruppen («Control»), bei denen die Helferzahl unverändert blieb (linke Graphik; dargestellt sind arithmetische Mittel und Standardfehler, die Unterschiede sind statistisch signifikant). Rechts ist die Zahl der Eier dargestellt, die Weibchen im Labor produzierten, wenn sie grosse (H) oder kleine (HF) Brutpflegehelfer, beide Typen von Helfern (H + HF), oder gar keine Helfer hatten (P only). Die Zahl der Eier, die Weibchen mit Helfern produzierten, war statistisch signifikant höher als diejenige, die sie ohne Helfer legten (Mediane und Quartile; Quellen: Brouwer et al. 2005, Taborsky 1984). 119 MICHAEL TABORSKY Um das besser verstehen zu können, sollte man zweierlei wissen. Erstens sind Fische mit Erreichen der Geschlechtsreife nicht ausgewachsen, ja sie wachsen in der Regel ein Leben lang – je älter, desto grösser also. Und zweitens ist die Grösse ein entscheidender Faktor für die Wahrscheinlichkeit, mit der man einem Räuber zum Opfer fällt. Je kleiner, desto gefährdeter. Wenn junge bzw. kleine Fische das Territorium verlassen, um anderswo selbst zu brüten, haben sie wenig Chancen, die Früchte ihrer Mühe zu ernten – sie werden schlichtweg von grösseren Raubfischen gefressen. Zu Hause zu bleiben hat also einen Vorteil – es bietet Sicherheit. Man wächst gewissermassen aus dem Grössenbereich heraus, in dem die Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund des Raubdrucks zu gross wäre, um ausserhalb des von der Gruppe verteidigten Territoriums überleben zu können – erst dann verlässt man den sicheren Hafen, um eine eigene Familie zu gründen. So weit, so verständlich – aber warum pflegen diese Helfer die Nachkommen von Dominanten, mit denen sie nicht verwandt sind, und wodurch sie langsamer wachsen – womit ihre eigene Fortpflanzungsmöglichkeit also in noch weitere Ferne rückt? Dieser selbstlose Aufwand wird von den dominanten Besitzern des Territoriums eingefordert. Im Territorium ist der Platz nicht unbeschränkt. Vor allem muss jedes Mitglied der Gruppe in den wenigen Verstecken, die sich im Territorium befinden, bei Gefahr Unterschlupf finden können. Je mehr Subdominante es gibt, desto mehr Konkurrenz um lebenswichtigen Platz herrscht in der Gruppe. Damit sie dennoch im Territorium bleiben dürfen, müssen subdominante Gruppenmitglieder die Kosten, die sie durch Platzkonkurrenz verursachen, durch nützliche Tätigkeiten kompensieren – zum Beispiel, indem sie helfen, das Territorium zu verteidigen, Verstecke auszugraben und sie frei von Sand zu halten, und indem sie die Brut der Dominanten pflegen. Dieser Aufwand wird bereitwillig geleistet, da Subdominante durch ihren Verbleib im Territorium die Wahrscheinlichkeit enorm erhöhen, so lange zu überleben, bis sie sich dereinst selbst fortpflanzen können. Sie bezahlen also mit ihrer Hilfe «Miete», um an einem sicheren Ort bleiben zu dürfen. Das mag plausibel klingen – aber wie können diese Zusammenhänge experimentell überprüft werden? Eine solche Prüfung umfasst mehrere Schritte. Zunächst muss man wissen, ob die Anwesenheit von Subdominanten im Territorium – und vor allem ihre Hilfe – für Dominante tatsächlich von Vorteil ist. Dies haben Experimente in Labor und Feld bewiesen, wo die Verringerung der Helferzahl in einer deutlichen Reduktion überlebender Nachkommen resultierte – und die 120 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS Abb. 6: Das Brutmännchen einer Familiengruppe von N. pulcher greift einen Raubfisch an (Lepidiolamprologus elongatus), der seinen Brutpflegehelfern (links oben) gefährlich werden könnte. Letztere geniessen durch diese Verteidigungsleistung Schutz im Territorium. Unten im Bild ist das Brutweibchen. Bruten grösser waren, wenn Helfer an der Pflege mitwirkten (siehe Abb. 5). Letzteres wird dadurch hervorgerufen, dass Weibchen sich Arbeitsaufwand ersparen, weshalb sie mehr Energie zur Eiproduktion übrig haben. Dann sollte man prüfen, ob Helfer tatsächlich im Heimterritorium Schutz geniessen (Abb. 6), und ob die verzögerte Abwanderung ihre Ursache in diesem Schutzbedürfnis hat. Experimente in grossen Käfigen im Feld, in denen der Raubdruck systematisch variiert werden konnte, haben gezeigt, dass Brutpflegehelfer ihre Bereitschaft, im Territorium zu bleiben und dort mitzuhelfen, tatsächlich nach der Höhe des Raubdrucks in der Umgebung richten. Ausserdem belegten Aquariumsexperimente, dass Gruppenmitglieder bei Anwesenheit ihrer natürlichen Fressfeinde wesentlich höhere Überlebenschancen hatten, als gleichgrosse Fische, die nicht den Schutz eines dominanten Brutpaars geniessen. Schliesslich sollte man auch den Nachweis erbringen, dass Subdominante mit ihrer Hilfe tatsächlich für ihren Verbleib im Territorium bezahlen. Dieser Frage kann man nachgehen, indem man die Information für Dominante und deren Helfer experimentell entkoppelt. Wenn erstere durch die Darbietung eines Eindringlings ins Territorium erhöhten Bedarf an Hilfe wahrnehmen, letztere dies aber aufgrund eines experimentellen Kniffs nicht mitkriegen und deshalb die erwartete Hilfe nicht leisten, wird eine Dis- MICHAEL TABORSKY 100 defence before after being prevented to help 80 defence 121 60 40 20 0 small large test helper Abb. 7: Im Experiment zeigen sowohl kleine als auch grosse Test-Helfer von N. pulcher nach einer Periode, in der sie am Helfen gehindert wurden, erhöhte Verteidigungsleistungen gegen einen Eindringling ins Territorium (abgebildet sind Mediane [Querstriche] und Quartile [Säulen]; die Unterschiede zwischen der Verteidigungsleistung vor der Periode, in der sie nicht halfen, und danach, sind sowohl für kleine als auch grosse Helfer statistisch gesichert; Quelle: Bergmüller & Taborsky 2005). krepanz erzeugt zwischen den Erwartungen der Dominanten und den tatsächlichen Hilfeleistungen der Subdominanten. In diesem Fall kompensieren derart säumige Helfer bei nachfolgenden Gelegenheiten sofort die (unfreiwillig) versagte Kooperation mit erhöhtem Hilfsaufwand (Abb. 7) – und sie bemühen sich, die Dominanten mit besonders intensivem Submissivverhalten zu beschwichtigen. Derlei Gegenseitigkeit, wie sie bei diesen Buntbarschen zu finden ist, ist auch bei anderen Tieren für altruistische Hilfeleistungen verantwortlich. Bei der berühmt-berüchtigten Vampirfledermaus, zum Beispiel, spenden nicht-verwandte Mitglieder von grossen Gruppen, die sich an gemeinsamen Schlafplätzen treffen, bei Bedarf Blut von den Beutetieren, die sie kurz zuvor zur Ader gelassen hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dies zu tun, hängt davon ab, ob sich der bedürftige, potentielle Empfänger vormals schon dem Spender gegenüber hilfreich erwies. Da diese Tiere, wie die meisten Fledermäuse, sehr klein sind und damit nur über wenig Reserven verfügen, um nahrungslose Zeiten zu überstehen, kann der Erhalt einer solchen Blutspende für ein Tier, das 2 Tage lang kein Jagdglück hatte, über Leben und Tod entscheiden (Abb. 8). Stattdessen kann sich ein er- 122 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS Abb. 8: Bei Vampirfledermäusen verlieren Altruisten (D) relativ wenig durch ihre Blutspende an hilfsbedürftige Empfänger (R): durch die Menge an Blut (gemessen in Prozent des Körpergewichts), die sie mittels Regurgitation abgeben, verringert sich, falls sie in der Zwischenzeit nicht wieder Nahrung finden, die Zeitspanne bis zum Verhungern nur um einen geringen Betrag. Für den Empfänger verlängert sich die Frist bis zum Hungertod aber beträchtlich, das heisst, sie gewinnen damit viel Zeit, um selbst wieder erfolgreich Nahrung finden zu können. Der Grund für diese Unterschiede in Kosten (C) und Nutzen (B) für Geber und Empfänger ist der negativ exponentielle Zeitverlauf der Beziehung zwischen verfügbarer Energie und dem Mindestbedarf an Reserven, der nötig ist, um am Leben zu bleiben (Quelle: Wilkinson 1984). folgreiches Tier, das den Magen noch voll hat, diese milde Gabe gut leisten. Auch hier zeigt sich also, dass das Nutzen-/Kosten-Verhältnis für die Hilfsbereitschaft gegenüber nicht-verwandten Artgenossen entscheidend ist. Neben Verwandtschaft und Gegenseitigkeit gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Tiere zur Hilfeleistung gezwungen werden – sie also entgegen ihrer eigenen genetischen Fitnessinteressen kooperieren. In der Interaktion zwischen verschiedenen Arten lässt sich dieses parasitische Verhalten besonders gut zeigen. Der europäische Kuckuck brütet nicht selber, sondern lässt seine Nachkommen von bestimmten Wirtsarten aufziehen. Letztere verlieren dadurch ihre eigenen Jungen und können sich damit in der entsprechenden Fortpflanzungssaison oft selbst gar nicht vermehren. Solch zwischenartlicher Altruismus lässt sich dadurch erklären, dass diejenigen Vö- 123 MICHAEL TABORSKY gel, die die Kuckucke aufziehen, ihren Fehler nicht erkennen – Kuckuckseier unterlaufen durch ihre Ähnlichkeit mit den eigenen Eiern des Wirtes dessen Erkennungsmechanismus. Eine derartige Ausbeutung kann natürlich nur funktionieren, wenn sie nicht allzu häufig vorkommt – und sie bewirkt einen starken Selektionsdruck darauf, die notwendige Diskriminierungsfähigkeit zu entwickeln, um solchen Irrtümern nicht aufzusitzen. Manipulationen ähnlicher Art gibt es natürlich auch zwischen Artgenossen, nur ist sie hier viel schwieriger zu entdecken. Ein Beispiel haben wir oben bereits kennengelernt: den durch andere Arbeiterinnen erzwungenen Verzicht von Ameisen- und Bienenweibchen, unbefruchtete Eier zu legen und damit Söhne zu produzieren, mit denen sie näher verwandt wären, als mit den von der Königin produzierten männlichen Nachkommen. Ein Experiment an Vögeln, bei dem Keas kooperieren mussten, um an begehrtes Futter zu gelangen, soll den Mechanismus der «Kooperation durch Manipulation» auf Verhaltensebene illustrieren. Ein dominanter und ein subdominanter Vertreter dieser neuseeländischen Bergpapageien wurden in einer grossen Voliere vor die Aufgabe gestellt, eine Wippe zu betätigen, damit sich der Deckel über einem Behälter mit begehrtem Eidotter öffnete. Das heisst, einer musste öffnen, der andere konnte ernten. Die zwei Vögel wechselten sich nun nicht in ihren Rollen ab, sodass jeder einmal den Helfer für den anderen spielte, sondern das dominante Tier zwang das subdominante, für es den Öffnungsmechanismus zu betätigen. Der einzige Platz in der ganzen Voliere, wo ein Subdominanter den Angriffen des Dominanten entkommen konnte, war der Griff der Wippe, mit dem er dem Dominanten zu seinem Leckerbissen verhalf (Abb. 9). Wenn die Dominanzverhältnisse experimentell umgedreht wurden, spielte jedes Tier sofort wieder die ihm zugeteilte Rolle – dominante verhielten sich unkooperativ und despotisch, während subdominante die vom anderen geforderte Hilfeleistung erbrachten. Diese kurze Betrachtung der Mechanismen, die Kooperation und Altruismus zwischen Verwandten und nicht-verwandten Tieren auf biologischer Basis hervorbringen können, zeigt Möglichkeiten auf, die auf den ersten Blick unverständlich erscheinende Selbstlosigkeit vor dem Hintergrund der darwinschen Evolutionstheorie zu erklären. Die Existenz von Kooperation und Altruismus im Tierreich stellt also die Evolutionstheorie nicht in Frage, sondern bietet dem Forscher eine willkommene Herausforderung, die Rahmenbedingungen und beteiligten Mechanismen aufzuklären, die hinter dem scheinba- 124 DAS KERNPROBLEM DER EVOLUTIONSTHEORIE: KOOPERATION UND ALTRUISMUS ren Widerspruch stecken – dass plötzlich nicht jeder nach seinem unmittelbaren (Fitness-)Nutzen agiert, sondern zugunsten von anderen bereit ist, mitunter hohe Kosten auf sich zu nehmen bzw. Verzicht zu leisten. Abb. 9: Keas wurden mit einer Wippe getestet, die von einem der Vögel betätigt werden musste, damit der andere an einen begehrten Leckerbissen gelangen konnte. Dies führte dazu, dass der jeweils Dominante seinen Versuchspartner zwang, für ihn den Deckel zu öffnen, wenn Futter im Behälter war – aber nur dann. Die Abbildung zeigt am Beispiel von zwei Versuchen mit jeweils zwei Männchen, dass die Zahl der aggressiven Annäherungen des Dominanten an den submissiven Partner wesentlich höher war, wenn der erstere Futter durch den durchsichtigen Deckel sehen konnte, als wenn der Behälter leer war. Durch dieses Verhalten zwang der Dominante den Submissiven, den Wippmechanismus für ihn zu betätigen, damit er ans Futter kam – ein Beispiel für erzwungene Hilfe (gezeigt sind Mediane und Quartile; die statistisch gesicherten Unterschiede zwischen Test und Kontrolle sind jeweils durch die entsprechenden Irrtumswahrscheinlichkeiten wiedergegeben (P < 0.001); Quelle: Tebbich et al. 1996). 125 MICHAEL TABORSKY Literatur Bergmüller, R./Taborsky, M., 2005: Experimental manipulation of helping in a cooperative breeder: helpers ‚pay to stay‘ by pre-emptive appeasement. Animal Behaviour 69, 19–28. Brouwer, L./Heg, D./Taborsky, M., 2005: Experimental evidence for helper effects in a cooperatively breeding cichlid. Behavioral Ecology 16, 667–673. Darwin, C., 1859: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray. Darwin, C., 1871: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: Murray. Davies, N.B., 1990: Dunnocks: cooperation and conflict among males and females in a variable mating system. In: Cooperative Breeding in Birds (Ed. by P.B. Stacey & W.D. Koenig), pp. 455–487. Cambridge, UK, Cambridge University Press. Hamilton,W.D., 1964: The genetical evolution of social behaviour I u. II. Journal of Theoretical Biology 7, 1–52. Maynard Smith, J./Szathmáry, E., 1997: The Major Transitions in Evolution. Oxford, UK: Oxford University Press. Taborsky, M., 1984: Broodcare helpers in the cichlid fish Lamprologus brichardi: their costs and benefits. Animal Behaviour 32, 1236–1252. Tebbich, S./Taborsky, M./Winkler, H., 1996: Social manipulation causes cooperation in keas. Animal Behaviour 52, 1–10. Wilkinson, G.S., 1984: Reciprocal food sharing in the vampire bat. Nature 308, 181–184. 231 Zur Evolution des Menschen: Von der DNA-Analyse zum Design? HANSJAKOB MÜLLER 1. Einleitung Die Vorstellung, dass ein allmächtiger Gott den Menschen einfach so erschaffen hat, findet man im Christentum und im Islam. Im Gegensatz dazu lässt Darwins naturwissenschaftliche Evolutionstheorie die Entstehung des Menschen ohne Bezug auf «Übernatürliches» erklären. Die menschliche Evolution macht zudem – wie von vielen angenommen – heute nicht einfach Stopp, weil wir eine Art «Optimum» erreicht hätten. Sie geht viel mehr weiter; in der Natur gibt es keinen Stillstand. Die Menschheit wird sich mit und ohne eigenes Zutun weiterhin verändern. Dabei ist der Homo sapiens wohl die einzige Spezies, von der wir annehmen, dass sie versuchen könnte, dies auch nach eigenen Wünschen zu tun. Dieser Beitrag geht vorerst mit einem Blick zurück und dann mit einem nach vorne auf die Evolution des Menschen ein. Dabei stehen molekulargenetische und medizinische Aspekte im Vordergrund. Unser Aussehen, wie auch unser Verhalten werden durch unser Erbgut in einem Wechselspiel mit Umwelteinflüssen bestimmt. Die genetische Forschung ist daran, den molekularen Aufbau unseres Genoms sowie die Funktion und die Wechselwirkungen seiner einzelnen Elemente zu entschlüsseln. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um einmal gezielt in dieses eingreifen zu können. Design bedeutet ja, dass wir unsere Natur nach eigenem Gutdünken gestalten möchten. Dabei interessieren in unserer Zeit vor allem die «Gesundheit», unser Wohlergehen, das Älterwerden und die Unsterblichkeit. 2. Über das menschliche Erbgut Unserem körperlichen und geistigen Funktionieren liegt ein genetischer Plan zugrunde. Dieser wird in der Schlüsselsubstanz der Vererbung, also in der DNA (Desoxyribonukleinsäure), gespeichert. Der in praktisch jeder einzelnen Zelle vorhandene DNA-Faden misst für alle 46 Chromosomen zusammengenommen nahezu 2 Meter. Die einzelnen Abschnitte/Segmente der DNA haben unterschiedliche Aufgaben. Recht gut erforscht sind diejenigen, die die gegen 25’000 Eiweiss-kodierenden Gene repräsentieren. Diese Gene enthalten die 232 ZUR EVOLUTION DES MENSCHEN: VON DER DNA-ANALYSE ZUM DESIGN? Rezepte, dank denen die Zellen spezifische Eiweisse (Proteine) mit einer umschriebenen Anzahl und Reihenfolge von Aminosäuren synthetisieren können. Die genetische Forschung zeigt immer deutlicher, dass das von Francis Crick 1958 formulierte Dogma «DNA macht RNA; RNA macht Protein» in dieser absoluten Formulierung nicht, respektive nur für die obgenannten Gene zutrifft. Die den Einbau von Aminosäuren kodierenden Sequenzen machen nicht einmal 2 Prozent des gesamten DNA-Fadens aus. Andere Abschnitte haben andere Funktionen. Das im September 2003 gestartete ENCODE (ENCyclopedia Of DNA Elements)-Projekt hat zum Ziel, alle funktionellen Elemente des menschlichen Erbgutes sowie alle DNA-Abschriften, also das ganze Transkriptom (alle RNAs), zu identifizieren und zu charakterisieren. Neben den aus unserem Schulunterricht gut bekannten RNA-Arten (rRNA, mRNA und tRNA) gibt es noch zahlreiche weitere. Diese dienen unter anderem der Regulierung der Genexpression (siRNA = small interfering RNA) oder der Regulation zellulärer Prozesse wie Proliferation und Zelltod (microRNA). Sie sind somit ebenfalls für eine artifizielle Beeinflussung unseres Erbgutes von Interesse (siehe Abb. 1). Zudem gilt es auch jene DNASequenzen zu beachten, die nicht in RNAs übersetzt werden, die aber im Verlaufe der Evolution konserviert blieben («conserved non-coding Abb. 1: Ebenen der therapeutischen Beeinflussung von genetisch (mit-)bedingten Krankheiten 233 HANSJAKOB MÜLLER sequences»). Letzteres deutet auf eine funktionelle Bedeutung dieser DNA-Sequenzen hin, die jedoch erst noch erforscht werden muss. 3. Ein Rückblick auf die Evolution des Menschen Unser Wissen um die Menschwerdung ist immer noch lückenhaft. Wie schon von Darwin vermutet, lässt sich der Urspung des Menschen dorthin zurückverfolgen, wo unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen und Gorillas, leben, nämlich nach Afrika (Darwin, 1871). Während sich in Europa die Neandertaler entwickelten, entstanden dort vor etwa 500’000 bis 200’000 Jahren die Vorfahren des modernen Menschen (Schrenk und Bromage, 2002). Dass ein multiregionaler Ursprung des Menschen unwahrscheinlich ist, lässt sich durch die Analyse der DNA untermauern. Sie weist bei den einzelnen Individuen vererbbare, aber verschiedene durch Mutationen entstandene Varianten auf, die man Snips (= SNPs; «single nucleotide polymorphisms») nennt. Das Erfassen und der Vergleich solcher Snips, wie sie bei verschiedenen Populationen vorkommen, ermöglicht es, eigentliche Zeittafeln («molecular clocks») für Migrationsbewegungen und die Entstehung der verschiedenen Menschenrassen aufzustellen. Die Analyse der Variationen innerhalb der sogenannten mtDNA (mitochondriale DNA), erweist sich dabei als besonders nützlich (Cann et al., 1987). Die Mitochondrien sind Organellen im Zytoplasma mit einem eigenen Erbgut. Diese werden über die Eizellen, also nur über die Mütter, von Generation zu Generation weitergegeben. mtDNA-Sequenzen-Varianten, die aussserhalb Afrikas vorkommen, finden sich auch bei Afrikanerinnen, während dies umgekehrt nicht der Fall ist. DNA-Varianten des Y-Chromosoms, das ausschliesslich von den Vätern auf die Söhne weitervererbt wird, lassen analoge Rückschlüsse über den afrikanischen Ursprung des Menschen zu (Seielstad et al., 1994). Der Vergleich des aufgrund von molekulargenetischen Daten erstellten Stammbaums von 42 Populationen mit dem weniger detaillierten, von Linguisten erstellten, ergab erfreulich viele Übereinstimmungen (Cavalli-Sforza et al., 1988). Cavalli-Sforza (1996), der Pionier der Erforschung genetischer Unterschiede verschiedener Populationen, zeigt diese Zusammenhänge in seinem gut verständlich, geradezu populärwissenschaftlich abgefassten Buch «Genes, Peoples, Languages» auf. Die Analyse genetischer Marker von 270 Individuen aus 4 Populationen (Han Chinesen, Japaner, Yarubaner und Nord-Europäer) er- 234 ZUR EVOLUTION DES MENSCHEN: VON DER DNA-ANALYSE ZUM DESIGN? gab, dass mindestens 7% der menschlichen Gene während der letzten 5’000 Jahren Veränderungen erfahren haben, die meist durch Anpassungen an eine bestimmte Umwelt zu erklären und nicht auf Menschenzüchtung, Eugenik oder Gentechnologie zurückzuführen sind. Cochran und Harpending (2009) kommen daher zum Schluss, dass der Mensch während der letzten 10’000 Jahren eine viel stärkere Evolution erfahren hat, als dies bei seinen Vorfahren der Fall war. Der Pool von neuen DNA-Mutationen, den die Evolutionsmechanismen nutzen können, wird beim stetigen Wachstum der Erdbevölkerung immer grösser. Einige Beispiele sollen diesen Sachverhalt illustrieren: Unsere Hautfarbe wird durch mindestens 3 verschiedene Gene bestimmt, die für die Bildung des Pigments Melanin, dessen Transport sowie auch seine Einlagerung in Pigmentzellen verantwortlich sind. Die Hautfarbe ist ein offensichtliches Kriterium zur Unterscheidung von Menschenrassen. Mutationen, die zur Hellhäutigkeit führen, haben sich bei Menschen verbreitet (Miller et al., 2007), die in nördlichere Regionen auswanderten wo weniger Sonnenlicht für die Bildung von Vitamin D vorhanden ist. Dunkelhäutige Menschen, die heute in diesen Breiten leben, haben daher ein erhöhtes Risiko, an einem Vitamin D-Mangel zu erkranken. Wir Menschen – wie alle Säuger – ernähren unsere Kinder vorerst mit Milch. Für deren Verdauung wird im Darm ein Enzym gebildet, das den Milchzucker, das Disaccharid Laktose, in Glukose und Galaktose spaltet. Die Fähigkeit des Galaktose-Verdaus erlischt mit Beendigung der Kindheit. Bei den Bewohnern Europas, Afrikas und des nahen Ostens, die in den letzten 10’000 Jahren dazu übergegangen sind, Milch von Kühen, Ziegen oder Kamelen als Nahrungsmittel auch im Erwachsenenalter zu verwenden, musste eine Anpassung geschehen. Sie benötigen die Laktose weiterhin. Genetische Varianten derjenigen DNA-Region, die die Produktion des Laktose-spaltenden Enzyms reguliert, machen dies möglich. Verschiedene Mutationen innerhalb dieses DNA-Abschnittes haben sich in den obengenannten Populationen ereignet, um den Laktose-Verdau während des ganzen Lebens zu erhalten (Enattah et al., 2008). Eine weitere nahrungsbezogene Mutation stellt die Vermehrung des Gens für die Amylase (AMY1) im Speichel dar, das für die Verdauung von Stärke benötigt wird. Während der Gorilla nur eine Kopie davon besitzt, findet man beim Menschen eine Vermehrung der Anzahl dieses Gens («gene copy number variant»). Diese ist bei Mitgliedern von Gesellschaften, bei denen Korn und Reis die Hauptnahrungsmit- 235 HANSJAKOB MÜLLER tel darstellen, grösser als bei solchen, die vom Fischen und der Jagd leben (Perry et al., 2007). Die Evolution des Menschen unter Einfluss von Umweltveränderungen wird vor allem am Beispiel seiner Gefährdung durch Krankheitserreger deutlich, denn Resistenz oder Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten haben eine klare genetische Basis. Die Evolution von Mikroorganismen ihrerseits ist gelegentlich so schnell, dass wir sie unmittelbar im Verlaufe unseres eigenen Lebens erkennen können, wie es das AIDS verursachende HI-Virus, das Schweinegrippevirus H1N1 oder auch Antibiotikaresistenzen illustrieren. Unser komplexes, genetisch determiniertes immunologisches Abwehrsystem muss jeweils Anpassungen vornehmen, um neuen Krankheitserregern erfolgreich begegnen zu können. Die Evolution des Menschen geht offensichtlich auch Kompromisse ein. Dies illustriert der sogenannte Heterozygotenvorteil für die Sichelzellanämie in Afrika oder für die β−Thalassämien im Mittelmeerraum. Es handelt sich um schwere autosomal-rezessiv vererbte Anomalien des Hämoglobins (roter Blutfarbstoff). Sie sind auf Mutationen der Gene für das Hämoglobin zurückzuführen (Müller, 2005). Menschen, die von beiden Eltern ein mutiertes (defektes) Gen erben, sind schwer krank. Diejenigen, die nur von einem Teil ein solches erhalten, also die Heterozygoten, sind gesund und zudem vom Malariaerreger, Plasmodium falciparum, besser geschützt, als diejenigen mit zwei normalen Genen. Der Malariaverursacher kann sich bei den Heterozygoten weniger gut vermehren. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass sich die mutierten, krankheitsverursachenden Hämoglobin-Gene in den obgenannten Regionen stark vermehrten, als dort die Malaria grassierte; deren heterozygote Träger hatten einen Überlebens- und damit Fortpflanzungsvorteil. Als Grund für das häufige Vorkommen verschiedener autosomal-rezessiv vererbter Krankheiten, wie die zystische Fibrose, wird ein solcher Heterozygotenvorteil postuliert, der in Zeiten wirkte, als bei uns die Cholera oder andere zu Durchfall führende Infektionskrankheiten wüteten. Die obgenannten Beispiele führen uns zur Frage nach den Kräften, die die Evolution des Menschen bisher bestimmten. 4. Welche Kräfte beeinflussen die Evolution des Menschen? Darwin baute seine Evolutionstheorie auf dem Konzept der natürlichen Selektion («Survival of the Fittest») auf: Merkmale, die es einem Individuum erlauben, mehr Nachkommen zu produzieren, breiten 236 ZUR EVOLUTION DES MENSCHEN: VON DER DNA-ANALYSE ZUM DESIGN? sich über Generationen hinweg aus. Im Kampf mit den begrenzten Ressourcen in der Umwelt («in the strugle of life») setzen sich diejenigen und deren Nachkommen durch, die besser angepasst sind. Darwins Evolutionstheorie wies jedoch eine beachtliche Lücke auf. Er konnte noch nicht erklären, auf welche Weise Körpermerkmale von Generation zu Generation weitergegeben werden und worauf deren Variationen beruhen. Es fehlte ihm dazu die solche Zusammenhänge erklärende Vererbungslehre. Die 1865 erfolgte Veröffentlichung der Entdeckungen des Augustinerpaters Gregor Mendel über die Vererbung von Merkmalen bei Pflanzen hatte während Darwins Zeit vorerst noch keine Beachtung gefunden. Mendel erfasste aufgrund der mit mathematischem Verstand ausgewerteten Ergebnisse aus Kreuzungsexperimenten mit Erbsen die Existenz der Gene. Die von ihm abgeleiteten Vererbungsgesetze ermöglichen es, verlässlich voraussagen, in welchem Verhältnis Merkmale bei Nachkommen wieder auftreten. Zudem kam er den Mutationen, den vererbbaren Veränderungen im genetischen Bauplan, auf die Spur, die dazu führen, dass von einem Gen verschiedene Varianten, sogenannte Allele, vorliegen, die unterschiedliche Auswirkungen auf das Erscheinungsbild, den Phänotyp, haben können. Ronald A. Fisher (1930), John Haldane (1933) und Sewall Wright (1932) begannen die Evolutionsbiologie mit mathematischen Modellen zu untermauern und begründeten damit die Populationsgenetik. Evolution basiert auf der Veränderung der genetischen Ausstattung einer Population. Die Zusammensetzung des Bestandes bestimmter Allele kann sich dabei in einer kleinen, abgespaltenen Population durch Zufallsschwankungen viel schneller verändern, als in einer grossen. Diese zufällige Änderung wird nach Wright «genetic drift» genannt. Dieser Gendrift spielt bei der Entstehung der Menschenrassen eine grosse Rolle. Er dient auch zur Erklärung, warum gewisse Krankheitsgene, wie z.B. dasjenige für das Ellis-van Creveld-Syndrom, bei den «Amish people», einer Abspaltung der Mennoniten-Gemeinschaft in den USA, häufiger vorkommt, als in der europäischen Bevölkerung, aus der sie hervorging. Die Fähigkeit zur Kooperation erweist sich auch für den Menschen als weiterer evolutionärer Vorteil, obwohl gerade in Biologie-Lehrbüchern im Gegensatz zu Selektion, Mutation oder Gendrift darauf kaum eingegangen wird. Wenn ein Individuum z.B. sehr erfolgreich bei der Nahrungsbeschaffung ist, kann es die Beute mit andern teilen und davon profitieren, wenn einmal die letzteren erfolgreich sind (Trivers, 1971; Axelrod and Hamilton, 1981). Dies wirkt sich im Hinblick auf Durchsetzung und Vermehrung günstig aus. 237 HANSJAKOB MÜLLER Erfolgreiche Kooperationsstrategien zeichnen sich durch Generosität, Hoffnung und Verzeihen aus. Generosität bedeutet, dass man nicht mehr bekommen will, als der Kontrahent. Hoffungsvoll ist eine Kooperation, wenn sie schon bei der ersten Aktion oder beim Fehlen von Informationen stattfindet. Verzeihen beinhaltet die Kooperation dann, wenn sich schon einmal ein Nachteil ergeben hat. Die Kooperationsfähigkeit dürfte eine Erklärung dafür sein, warum einzelne Religionsgemeinschaften Überlebens- und Reproduktionsvorteile haben. Mathematische Modelle erlauben heute die Analyse derartig grundlegender Aspekte menschlichen Verhaltens und die Erfassung deren evolutionären Bedeutung (Nowak, 2009). Die menschliche Kooperationsfähigkeit gilt als Erfolgsgeheimnis in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und allen sozialen Institutionen. 5. Heutige Kultur als Evolutionsfaktor Im Gegensatz zu unseren Vorfahren, die sich in der freien Natur behaupten mussten, leben wir heute in einer durch Zivilisation und Technik geprägten Umwelt, in der man sich vor allem auch sozial behaupten muss. Sie entspricht nicht mehr derjenigen, in der sich unsere Vorfahren entwickelt haben. Die Gefährdung unseres Erbgutes durch Strahlung und Umweltschadstoffe nimmt zu. Das Reproduktionsalter steigt stetig an. Es ist allgemein bekannt, dass mit der Zunahme des mütterlichen Alters bei den Kindern numerische Chromosomenstörungen, wie sie zum Down-Syndrom (Trisomie 21) führen, zunehmen (Müller, 2005). Am Beispiel mehrerer Erbkrankheiten wie Achondroplasie, Marfan- oder Apert-Syndrom konnte abgeleitet werden, dass die Genmutationsrate mit zunehmendem Alter des Vaters ansteigt, was mit der Zahl der Zellteilungen der Spermatogonien, respektive der jeweils vorangehenden DNA-Replikation zusammenhängt. Die Medizin und die Familienplanung beeinflussen das Evolutionsgeschehen ebenfalls. Gesundheit und immer mehr einfach nur «Wohlbefinden» stehen in unserer kulturellen Werteskala an oberster Stelle. Die Evolution hat ursprünglich dafür gesorgt, dass unser Körper Wunden heilen, Infektionen bekämpfen, respektive Krankheitserreger austricksen kann. Symptome wie Schmerz, Fieber, Husten, Erbrechen, Durchfall sind somit körpereigene Warnsignale oder Abwehrmechanismen. Heute werden sie als unangenehme Beschwerden unterdrückt oder bekämpft. Man vergisst dabei, dass Kranksein auch nützlich sein kann. 238 ZUR EVOLUTION DES MENSCHEN: VON DER DNA-ANALYSE ZUM DESIGN? Die Ziele der «klassischen» Medizin lauten: Krankheiten diagnostizieren, therapieren und verhindern. In den letzten Jahren hat sich immer mehr die «Enhancement-Medizin» ausgebreitet, die sich nicht auf die Bekämpfung von Krankheit, sondern auf die Veränderung oder Verbesserung nicht-pathologischer Merkmale richtet. Deren Kunden wollen bessere körperliche (Sport) oder geistige (Schule) Leistungen erbringen können, respektive «schöner» sein oder älter werden. Während früher die natürliche Selektion einen Grossteil der krankheitsbegünstigenden Veranlagungen ausmerzte, können sich heute dank medizinischer Massnahmen deren Träger fortpflanzen. Genetisch mitbedingte Herzfehler werden früh im Leben korrigiert; die Betroffenen erreichen das fortpflanzungsfähige Alter. Solche Einflüsse der Medizin fördern evolutionäre Veränderungen, die die Menschheit nicht fitter machen, ganz im Gegenteil. Man spricht von «reverser Evolution». Die Familienplanung und die Schwangerschaftsüberwachung mittels Ultraschall und Markern im mütterlichen Blut führen ihrerseits zu einer medizinisch gesteuerten, unnatürlichen Selektion. Ethnische und soziale Barrieren fallen. Die heutigen Verkehrsmittel erleichtern die Migration. Dies führt zu einer verstärkten Vermischung des menschlichen Erbgutes innerhalb der ganzen Menschheit. Wir steuern daher auf eine Globalisierung des menschlichen Genoms zu; dieses weist allerdings eine grosse Diversität (Vielfalt) auf. Die Auswirkungen solch zivilisatorischer Einwirkungen auf die Zukunft des Menschen sind schwierig einzuschätzen, zumal die sie beeinflussende Technik sich rasch entwickelt. 6. Gentests und deren evolutionären Auswirkungen Trotz der beachtlichen Erfolge der biomedizinischen Forschung sind heute erst etwa ein Drittel aller Krankheiten heilbar. Aus dem präziseren Wissen um die Ursachen, auch die genetischen, einer Krankheit auf molekularer Ebene werden innovative Therapien ableitbar. Jedoch nicht nur die Verursachung einer Krankheit und deren Verlauf werden durch die Veranlagung mitbestimmt. Erbeigenschaften beeinflussen auch die Aufnahme eines Medikamentes, dessen Transport, Verteilung und Anreicherung im Körper, seine chemische Umwandlung oder dessen Ausscheidung. Je besser man die individuelle Reaktionsweise auf Arzneimittel bestimmen kann, umso besser kann man sie auswählen und dosieren. Dadurch wird ein grösserer therapeutischer Nutzen erzielt. Zudem lassen sich unerwünschte oder gar 239 HANSJAKOB MÜLLER fatale Nebenwirkungen vermeiden (Müller, 2005). Die genetische Diagnostik gewinnt somit im medizinischen Alltag an praktischer Bedeutung! Wir stehen jedoch erst an der Schwelle des biomedizinischen Zeitalters mit mehr sinnvoller, d.h. indizierter genetischer Diagnostik. Von vielen unserer gegen 25’000 vermuteten Eiweiss-kodierenden Gene haben wir vorerst nur vage oder keine Kenntnisse; von nicht einmal 200 davon sind die Auswirkungen der einzelnen Mutationen/Varianten auf das menschliche Erscheinungsbild/die Gesundheit genauer bekannt (www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/mimstats.html). Die funktionelle Bedeutung vieler DNA-Sequenzen kennen wir noch nicht (siehe oben). Ein genetischer Test sollte daher nur bei klarer Indikation und eindeutig umsetzbarem Nutzen des Resultates sowie einer umfassenden genetischen Beratung der zu untersuchenden Person vorgenommen werden (Müller, 2009). Trotz der offensichtlichen Begrenztheit ihrer vorläufigen Aussagekraft hat die molekulargenetische Diagnostik den öffentlichen Markt erreicht. Seit Ende 2007 bieten immer mehr Privatfirmen genetische Tests zur Erstellung persönlicher, angeblich gesundheitsrelevanter Risikoprofile über das Internet an. Obwohl die Testanbieter detaillierte Berichte über ihre Untersuchungen abliefern, bleibt meist offen, welche Bedeutung die Ergebnisse für die Probanden effektiv haben und welche Konsequenzen daraus abgeleitet werden sollten. Die analysierten Personen und die sie betreuende Ärzteschaft werden mit der Interpretation solcher Resultate überfordert. Dies führt zu unberechtigten Ängsten oder auch zu falscher Sicherheit (Müller, 2009). Wir alle haben einige «schlechte» Gene, deren krankheitsverursachenden Auswirkungen von der normalen Kopie, die wir vom andern Elternteil geerbt haben, kompensiert werden können. Weil das Risiko, von miteinander verwandten Eltern ein gleiches mutiertes Gen zu erben, sehr goss ist, werden inzestuöse Verbindungen in praktisch allen Kulturen verpönt! Zudem sind wir Träger zahlreicher weiterer genetischer Eigenschaften, die im Hinblick auf ein Erkrankungsrisiko oder das Altwerden aufgrund von Assoziationsstudien als ungünstig beurteilt werden. Deren systematische Erfassung könnte einmal unmittelbare Auswirkungen auf die Familienplanung haben, falls derartige Veranlagungen nicht bei Nachkommen vorkommen sollen. Die Entwicklung der genetischen Analytik und der davon unweigerlich beeinflussten Präimplantationsdiagnostik und pränatalen Diagnostik verdient daher unsere kritische Aufmerksamkeit, weil sie zu einer Zunahme der Elimination von unerwünschten Nach- 240 ZUR EVOLUTION DES MENSCHEN: VON DER DNA-ANALYSE ZUM DESIGN? kommen führen könnte. Die Menschen haben die Evolution von Nutztieren und -pflanzen gesteuert. Warum sollten sie dies nicht auch auf diesem Wege mit der eigenen versuchen? 7. Gentherapie/Korrektur des menschlichen Erbguts Es gibt zahlreiche, vorerst oft mehr experimentelle Ansätze, um die Auswirkungen von monogenen Erbkrankheiten mit biomedizinischen Verfahren zu beeinflussen (siehe Abb. 1). Eingehendere Informationen über die einzelnen Verfahren sind in der einschlägigen Fachliteratur zu finden. Die meisten Vorgehensweisen könnten grundsätzlich auch für einen «Design» nicht-krankheitsbezogener Eigenschaften benutzt werden. Hier wird nur auf den Genersatz, also die somatische Gentherapie, kurz eingegangen. Primäres Ziel der somatischen Gentherapie war es, ein fremdes, funktionstüchtiges Gen mit den Verfahren der Gentechnologie in Körperzellen eines Patienten so einzubringen, dass dort der funktionelle Ausfall eines mutierten Gens kompensiert werden kann. Die erste Gentherapie wurde am 14. Sept. 1990 bei der damals vierjährigen Ashanti DaSilva vorgenommen, die an einer seltenen lebensbedrohlichen, genetisch verursachten Immunkrankheit litt. Der bei ihr vorliegende Adenosindeaminase (ADA)-Mangel führt zu einer toxischen Anreicherung von Metaboliten des Pyrimidinstoffwechsels, was vor allem die T-Lymphozyten (eine Art der weissen Blutzellen) beeinträchtigt. Dem Mädchen wurden eigene T-Lymphozyten entnommen und in vitro mit einem funktionstüchtigen ADA-Gen versehen. Die so gentechnisch ergänzten Zellen erhielt das Mädchen dann fraktionsweise zurück. Dies führte zu einer eindeutigen Verbesserung ihres Immunsystems; das Leben in einem Sterilzelt war nicht mehr nötig (Müller, 2001). Wegen des einfachen Konzeptes, ein fremdes normales Gen in Zellen eines Patienten als Ersatz für das mutierte oder verloren gegangene einfach einzusetzen, löste die Gentherapie von Anfang an in Wissenschafts- und Finanzkreisen eine grosse Euphorie aus (RehmannSutter und Müller, 2003). Diese legte sich jedoch bald wieder, als offensichtlich wurde, dass vorerst beachtliche Forschungsarbeit geleistet werden muss, bevor ein Genersatz oder gar eine Genkorrektur Anwendung in der medizinischen Praxis finden kann. Das fremde Gen muss im Wirtsgenom richtig gesteuert werden. Es darf auch nicht die Funktion anderer Gene beeinträchtigen. Das Potential der Gentherapie bleibt trotzdem weiterhin gross. Weltweit wurden bis- 241 HANSJAKOB MÜLLER lang im Rahmen von Forschungsstudien mehr als 6’000 Menschen mit verschiedenen Gentherapien behandelt. 8. Eugenik/Perfektionierung des Menschen/Design Die Erscheinung eines Menschen lässt sich durch 3 verschiedene Massnahmen beeinflussen/verbessern: 1. durch Veränderung der Umgebung (Euthänik), 2. durch Eingriffe in das unmittelbare Erscheinungsbild (Euphänik) sowie 3. durch Veränderungen des Erbgutes der Keimbahn (Eugenik) (Müller, 2001). Während der Begriff «Eugenik» recht geläufig ist, trifft dies für die beiden anderen weniger zu. Wie bei allen solchen Rastern gibt es beachtliche Überschneidungen. Nicht nur Eugenik, auch Euthänik und Euphänik können sich auch auf die Evolution des Menschen auswirken (Müller, 1993). Euthänik bezieht sich auf eine Veränderung von ungünstigen Einflüssen der Umgebung, die das Erscheinungsbild einer Person oder der Gesellschaft beeinflussen, wie z.B. die Reduktion der UV-Strahlung (Hautkrebs) oder des Rauchens (Lungenkrebs und andere Tumorkrankheiten). Verschiedenste euthänische Massnahmen werden durch die Präventivmedizin, die Pädagogik oder die Psychologie entwickelt und propagiert! Unter euphänischen Massnahmen wird die «Verbesserung» der Erscheinung eines Individuums mittels biologischen und medizinischen Massnahmen verstanden, die unmittelbar an ihm vorgenommen werden, die jedoch die Zellen der Keimbahn nicht miteinschliessen. Dazu gehören die somatische Gentherapie, das Neugeborenenscreening für genetisch bedingte Stoffwechselkrankheiten, deren Manifestation mittels Diät verhindert werden kann, oder die präsymptomatische Diagnostik von Erbkrankheiten und die Anwendung medizinischer Präventionsverfahren. So lassen sich bei Personen mit einer nachgewiesenen durchschlagskräftigen Veranlagung für Dickdarm- und Mastdarmkrebs dank regelmässiger Spiegelung dieser Organe (Kolonoskopie) allfällig auftretende Frühformen des Krebses (Polypen) frühzeitig erkennen und entfernen, bevor sie in schwer behandelbare Stadien übergegangen sind. Zur Euphänik gehört auch die Stammzelltherapie, dank der normale fremde Zellen bei einer Person den Ausfall oder einen Defekt der eigenen kompensieren sollen. Sir Francis Galton, der Vetter von Charles Darwin, schuf 1883 den Begriff «Eugenik», um damit die Hoffnung auszudrücken, unsere genetische Ausstattung zu verbessern. Er und weitere Ärzte befürch- 242 ZUR EVOLUTION DES MENSCHEN: VON DER DNA-ANALYSE ZUM DESIGN? teten damals, dass die künftige Existenz des Menschen durch das Nachlassen der natürlichen Selektion bedroht sei (Sozialdarwinismus). Schädliche Erbanlagen würden daher zunehmen. Daraus leiteten sie nicht nur das Recht, sondern geradezu eine Pflicht zu «eugenischen» Massnahmen ab, die letztlich zur Zwangssterilisierung und Tötung bestimmter Menschengruppen führte. Der deutsche Arzt Alfred Ploetz prägte dafür den Begriff «Rassenhygiene» (Müller, 2001). Er verstand darunter dasjenige Teilgebiet der Medizin, das sich um die «Hygiene» der menschlichen Rasse bemüht, dies im Unterschied zu der damals immer populärer werdenden allgemeinen Hygiene, die sich um die Gesunderhaltung des einzelnen Individuums kümmert. Politische Eingriffe wurden gefordert, um die eugenischen Konzepte durchzusetzen. Gerade die Geschehnisse in Nazideutschland illustrieren, in welch skandalöse Verirrungen sich Ärzte und Wissenschafter begeben können, wenn sie sich den jeweiligen Konjunkturen der Politik anpassen. Menschliche Populationen, in denen sich Mann und Frau zufallsgemäss fortpflanzen, gibt es kaum, denn überall werden Partner mit bestimmten geistigen und körperlichen Eigenschaften bevorzugt. Die DNA-Analytik ihrerseits hat heute noch kaum Einfluss auf die Partnerwahl. Alle Eltern wünschen sich jedoch gesunde, intelligente Kinder. So könnte es beim raschen Fortschritt der DNA-Analytik zu einer Ausweitung der vorgeburtlichen Diagnostik auf nicht zu schwerer Krankheit/Behinderung führende Veranlagungen kommen. Dies würde eine Ausweitung der nicht-natürlichen Selektion nach sich ziehen (siehe oben). Gentechnische Eingriffe in Zellen der menschlichen Keimbahn, die das Erbgut von einer Generation auf die nächste weitertragen, sind vorerst noch nicht zu befürchten. Medizinische, biologische und besonders ethische Aspekte sprechen gegen die Anwendung der Keimbahn-Gentherapie beim Menschen (Müller, 2001). Praktisch alle Gremien, die sich mit dieser Thematik befassten, kamen daher zum Schluss, dass genetische Eingriffe in die menschliche Keimbahn gesetzlich verboten werden müssen. 9. Quo vadis Homo futuris? Die Geschichte ist voll von Phantasmen, wie eine Perfektionierung des Menschen zu schaffen wäre und welche Ziele sie verfolgen könnte. Denken wir nur an die Superman-, Batman- und FrankensteinMythen. Die Erfahrungen im Umgang mit der Rassenhygiene (siehe oben) und mit der Veröffentlichung des Buches «Man and his future» 243 HANSJAKOB MÜLLER durch die CIBA Foundation im Jahre 1963 zeigen, wie gefährlich eine Vermischung von Wissenschaft und «Prophetentum» sein kann. Beide Versuche einer wissenschaftlich fundierten Prophetie schadeten zudem dem Image der Genetik enorm. Vorsicht ist daher einem Humangenetiker geboten, wenn er versuchen soll, vorherzusagen, in welche Richtung die Evolution des Menschen gehen wird und wo diese allfällig zu steuern wäre. Nicht wenige Zukunftsforscher nehmen an, dass die Menschheit sich vor einem radikalen Umbruch befindet. Der Mensch verändert sich zweifelsohne mit seinen Technologien. Wir werden immer abhängiger von den von uns erfundenen/entwickelten Werkzeugen. Ein Leben ohne Brillen ist kaum mehr denkbar. Prothesen werden im ganzen Körper verwendet. Somit ist der Gedanke keineswegs abwegig, dass wir einmal unseren Körper mit Robotern und unser Hirn mit Computer vernetzen werden. Mit implantierten oder auch extern angebrachten Hirn-Computer Schnittstellen («Brain-Computer-Interfaces») können Menschen bereits Computerprogramme und -spiele, Roboter oder Prothesen steuern. Eine Ablösung des heutigen Menschen durch Cyborgs («cybernetic organisms» = Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine), künstliche Intelligenzen etc. wäre eine Folge dieser Entwicklung. Die Evolution des Menschen hat mindestens einen offensichtlichen Vektor: sie wird an Komplexität zunehmen! So fragen wir uns: Kann unser Hirn mit dem raschen Zunehmen unseres Wissens und dem Forschritt unserer Technologien überhaupt noch Schritt halten? Niemals hat eine einzelne Art einen solchen Einfluss auf das Geschehen auf dieser Erde genommen wie der Mensch: Durch unseren Einfluss ist die Biodiversität gefährdet. Arten sterben heute mit einer Geschwindigkeit aus, die viel grösser ist als früher, als es noch keinen menschlichen Einfluss gab (Wilson 2002). Wir provozieren eine Klimakatastrophe und zerstören damit auch unsere Umwelt. Die Weltbevölkerung wächst und wächst bedrohlich. Die Apokalypse droht. Wie soll es weitergehen? Wird eine neue Art aus uns hervorgehen, die besser an die Klimaveränderungen oder gar an ein Leben auf anderen Planeten angepasst sein wird? Wir sind stolz auf unsere Intelligenz sowie die dank ihr von uns geschaffenen ethischen Werte. Es stellt sich die Frage, wie es um letztere bei den möglichen künftigen evolutionären Entwicklungen bestellt sein wird. Wie wird sich eine Gesellschaft mit Cyborgs verhalten? Gibt es einen Kerngehalt des heutigen Menschen, der einer Veränderung durch den Menschen entzogen werden müsste?