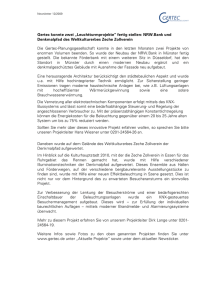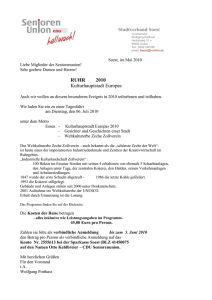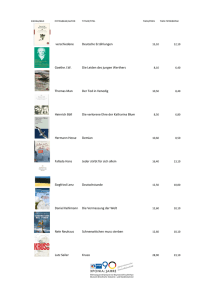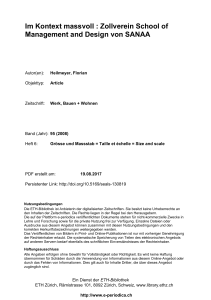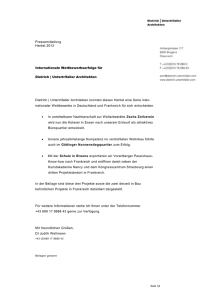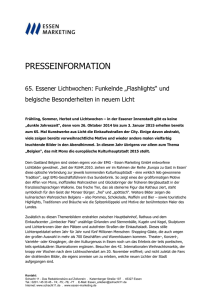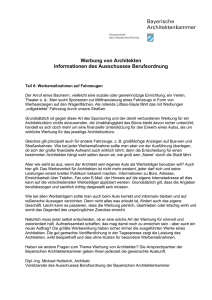Unter Dach und Fach - Architektursprache
Werbung

Unter Dach und Fach Ein Streifzug über die Zeche Zollverein „Industrie – Kultur – Landschaft.“ Wo einst Lärm und Gestank als unmissverständlicher Hinweis auf die Ankunft im Ruhrgebiet gelten konnten, macht uns nun ein braun-weißes Hinweisschild am Rand der A 3 darauf aufmerksam, dass wir den Pott erreicht haben. Wir sind auf dem Weg nach Essen, um dort den Architekten Heinrich Böll zu treffen – er wird uns über die Zeche Zollverein führen, die stellvertretend für den Umgang seines Büros mit dem baulichen Erbe der Montanindustrie steht. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts prägte dieser Industriezweig die Region zwischen Lippe und Ruhr, die sich heute einem tief greifenden Strukturwandel gegenübersieht: Die Zechen, die einstigen Garanten von Arbeit, sind geschlossen und somit ihrer originären Funktion entzogen. Doch der Bergbau hat eine verwundete Landschaft mit deutlichen Spuren hinterlassen – seine Artefakte kennzeichnen noch immer den Weg der Kohle und die Orte der Förderung unter Tage. Fritz Schupp, Martin Kremmer, Zeche Zollverein, Schacht XII, 1927-1932, Fördergerüst Vorhandene Identität Architekten sprechen oft und gerne davon, „Identität zu stiften“. Im Ruhrgebiet ist dies kaum nötig, denn die Spuren der Industrie sind bereits Träger der Identität. Hier beschränkt sich architektonische Arbeit nicht selten darauf, Bestehendes zu erhalten, neuen Nutzungen zuzuführen und damit das Vergangene dem Zukünftigen nutzbar zu machen. Heinrich Böll ist verwurzelt in der Region, er ist eng verbunden mit den Industriebauten, die lange Zeit die Atmosphäre des Potts prägten. So verwundert es nicht, dass er sein Büro in einem ihrer Relikte eingerichtet hat: in der ehemaligen Lohnhalle der Zeche Fritz-Heinrich in Altenessen. Die von Fritz Schupp (1896-1974) und Martin Kremmer (1894-1945) erbaute Halle findet sich heute in einem weitläufigen Gewerbegebiet, das noch seiner verdichtenden Bebauung harrt. Der Außenbau präsentiert sich in schlichter Klinkereleganz. Im Innern empfängt uns ein großzügiger Raum, wir überblicken die langen Tischreihen des Architekturbüros. Zu Architektursprache Rainer Schützeichel beiden Seiten rahmen Galerien die Lohnhalle, die als Sekundärstruktur in die Hallenkonstruktion eingestellt wurden. Durch ein Glasdach fällt – wenn auch etwas gedämpft an diesem regnerischen Mittwochvormittag – Tageslicht ein. Im Besprechungsraum begrüßen uns Heinrich Böll und sein Kollege Achim Pfeiffer. Beide sind aus Überzeugung im Ruhrgebiet beheimatet: Böll studierte Architektur in Berlin und diplomierte dort 1968 zusammen mit seinem späteren Büropartner Hans Krabel. Nach dem Studium erhielten beide 1975 den Auftrag, ein Jugendzentrum in der stillgelegten Zeche Carl in Altenessen einzurichten. Das Projekt brachte Böll zu einem frühen Zeitpunkt des allmählich um sich greifenden Zechensterbens mit der Umnutzung von Industrieanlagen in Kontakt, die für ihn bisher selbstverständlich mit dem Begriff der „Arbeit“ verbunden waren – eine Umnutzung war daher auch mit einem Umdenken in Bezug auf diese Begriffskopplung verbunden, denn bisher wurden zum Zwecke der „Arbeit“ nicht mehr benötigte Gebäude schlicht abgerissen. Zugleich sollte es den Auftakt einer Reihe von Sanierungen und Umbauten darstellen, die in der umfassenden Arbeit auf Zollverein gipfelten. Achim Pfeiffer studierte in Aachen und kehrte aus Überzeugung nach Essen zurück, um sich im mittlerweile etablierten Büro von Heinrich Böll dem Erhalt der industriekulturellen Symbole des Ruhrgebiets zu widmen. Nichts wirkt aufgesetzt, nichts nährt den Verdacht einer modischen Attitüde, wenn beide von ihrer Region erzählen – man spürt, dass nicht kurzlebige Trends, sondern nachhaltige, strukturelle Überlegungen ihren Umgang mit brach gefallenen Industrieanlagen leiten. So sollte etwa die Halle, in der heute das Büro untergebracht ist, abgerissen werden – sie stand der ursprünglichen Planung des Gewerbegebiets im Weg. Nicht ohne Ironie verweist Böll auf die fragwürdige Notwendigkeit neuer Flächen für Bau- und Supermärkte, aber auch auf die Debatten, die zum Erhalt der historischen Bausubstanz geführt werden mussten: Durch den Strukturwandel sei ein Wegfall von Arbeitsplätzen zu kompensieren, der die politischen Entscheidungsträger empfänglich für kurzfristige Jobperspektiven mache. So erhielte ein neues Architektursprache Rainer Schützeichel Industriegebiet mehr Gehör als der Versuch, vorhandene, aber brachliegende industrielle Strukturen zu nutzen. Das Neue werde mit dem Modernen gleichgesetzt, das Alte hingegen mit dem Überkommenen. Die Sanierung der Lohnhalle konnte schließlich durchgeführt werden, da sich ein Schulfreund Bölls der Finanzierung annahm und die Behörden von einer Revision der Planungen überzeugt wurden – sie mussten lediglich den Straßenverlauf korrigieren. Schacht XII Die kurze Strecke von Altenessen zur Zeche Zollverein ist schnell überwunden, zumal wir auf ein dichtes Wegenetz von Autobahnen, Umgehungsstraßen und Ortsdurchfahrten zurückgreifen können, das die ehemaligen Zechen verbindet. Die Infrastruktur, deren Anlage nicht zuletzt den Produktionszusammenhängen und den Transportwegen der Kohleverarbeitung folgte, überdauerte, während die Zechen verschwanden. Ich lasse das eben Gehörte Revue passieren und spanne den Bogen von Heinrich Bölls frühem Projekt – der Zeche Carl – zu Zollverein: dort die 1861 in Betrieb genommene Zeche mit ihrem Malakowturm, hier die moderne, ab 1927 erbaute Zeche, deren Fördergerüst zum Signet einer ganzen Region und deren Wandlung geworden ist. Innerhalb dieser Anlagen, und damit auch innerhalb der Projekte des Büros von Heinrich Böll, lassen sich die vergangene und die derzeitige Entwicklung des Ruhrgebiets ablesen. Wir erreichen das weitläufige Zechengelände im Essener Stadtteil Katernberg. Im Jahr 1847 wurde hier der erste Schacht abgeteuft – zehn weitere sollten folgen, bis die Vereinigte Stahlwerke AG in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschloss, die Zentralschachtanlage Zollverein XII anzulegen. Bisher war es üblich gewesen, ältere Anlagen zu ergänzen, nicht mehr benötigte Gebäude abzureißen und gegebenenfalls durch Neubauten zu ersetzen. Mit der zusammenhängenden Neuplanung von Schacht XII wurde das Ziel verfolgt, die Kohleförderung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu optimieren und in einer von Nebengebäuden befreiten Anlage zu konzentrieren. Nur notwendige Architektursprache Rainer Schützeichel Primärbauten sollten hier entstehen, sekundäre Einrichtungen und Verwaltungsbauten verblieben auf den älteren Schachtanlagen. So erhielten die Architekten Schupp und Kremmer hier die seltene Gelegenheit, der betriebstechnisch optimierten Gesamtanlage einen architektonischen Ausdruck zu geben, der die Zwänge des Förderungs- und Transportprozesses der Kohle in eine klar komponierte, konsequent funktionale Ordnung übersetzte. Zwei Hauptachsen prägen die Anlage von Schacht XII. Die eine verläuft über den Ehrenhof auf das Fördergerüst und die darunter befindliche Schachthalle, die andere kreuzt im Norden die Mitte des Hofes und ist auf das ehemalige Kesselhaus gerichtet. Heinrich Böll und Achim Pfeiffer führen uns zur Halle 5, der ehemaligen Zentralwerkstatt, die den Weg vom Ehrenhof zum Kesselhaus flankiert und heute als Ausstellungshalle genutzt wird. Sie kann prototypisch zur Anschauung des Konstruktionsprinzips auf Zollverein dienen: Schupp und Kremmer reagierten mit einer anpassungsfähigen Gebäudestruktur auf die Forderung an technische Betriebsgebäude, flexibel auf veränderte Ansprüche reagieren zu können. Statt einer Massiv- fand daher bei den Gebäuden für Schacht XII eine Stahlfachwerkbauweise Anwendung. Die zweischalige PfostenRiegel-Konstruktion besteht, so erklärt Heinrich Böll in der von hektischer Betriebsamkeit eines Ausstellungsaufbaus erfüllten Halle, aus zwei aneinander gesetzten I-Profilen. Das äußere misst 140 Millimeter, das innere ist 160 Millimeter stark. Die Felder der Fassade konnten den Erfordernissen entsprechend mit Ziegelsteinen oder Glas ausgefacht werden, wobei in den meisten Fällen Drahtglas verwendet wurde – dessen transluzente „Blindheit“ unterstützte die geschlossene kubische Wirkung der Gebäude nach außen und gab den Innenräumen eine flächige Begrenzung. Die innere Schale bestand ursprünglich aus Bimsstein und wurde im Zuge der Restaurierung durch Hochlochziegel oder, bei anderen Hallen, durch Gipskartonplatten mit dahinter liegender Wärmedämmung ersetzt. Da der Originalzustand der Halle 5 weitgehend erhalten bleiben sollte, ließ Böll zwischen den Schalen eine Korsettkonstruktion einbauen, um Architektursprache Rainer Schützeichel die Außenfassade zu stützen. Äußerlich erkennbare Eingriffe von Seiten der Architekten gab es kaum, vielmehr beschränkte sich ihre Arbeit auf Reparaturen – „Architektur“, so Pfeiffer, „haben wir hier nicht gemacht.“ Und als sich ein Betrachter nach dem Vergleich der ursprünglichen Bausubstanz mit dem Ergebnis der Sanierung zum Ausspruch hinreißen ließ: „Ihr habt ja gar nix gemacht“, fassten die Architekten dies mehr als Lob denn als Tadel auf. Der scheinbar selbstverständliche, zurückhaltende, aber bestimmte Eingriff liegt ihnen näher als die große Geste. Wir verlassen die Halle und stehen nun im Ehrenhof vor der Halle 6, in der sich früher die Elektrowerkstatt befand. Der reduzierte Materialkanon, auf den Schupp und Kremmer sich beim Bau von Schacht XII beschränkten, wird hier besonders deutlich: Neben dem prägenden roten Ziegelstein und den rot gestrichenen Stahlteilen finden sich Verglasungen aus Drahtglas und – in den Bunkerbereichen der Kohlenwäsche und an den Durchfahrten unter den Hallen – Beton. Diese vier Materialien genügen, um spannungsreiche Kontraste aufzubauen und zugleich die Einzelbauten zu einem Ensemble zusammenzufassen. Der anhaltende Regen lässt uns Schutz in der Halle suchen, in der Heinrich Böll und Achim Pfeiffer ihre Herangehensweise an das Denkmal Zollverein resümieren: In der Regel wurde der Versuch unternommen, die vorhandene Substanz zu erhalten. Wurde aber eine bessere Konstruktion gefunden, so war es oft wirtschaftlicher und in Anbetracht des Zeitdrucks, unter dem die Arbeit häufig stand, auch praktikabler, Vorhandenes abzureißen und durch Neues zu ersetzen. Pfeiffer spricht dabei von drei Phasen, die gleichsam eine hierarchische Abfolge in der Abwägung darstellen: Erstens die Restaurierung, also der Erhalt der originalen Bausubstanz. Zweitens die Rekonstruktion, also der Abriss von Bauteilen und ihr Nachbau eins zu eins. Drittens schließlich die, wie er sagt, „kritische Rekonstruktion“, durch die das gleiche Erscheinungsbild durch eine andere Konstruktion erzielt wird. Die Vertreter des Denkmalschutzes, die aufgrund des UNESCO-Welterbestatus’ der Zeche einen besonders strengen Blick auf dortige BaumaßnahArchitektursprache Rainer Schützeichel men haben, konnten durch diese Herangehensweise überzeugt werden, auch wenn es unter ihnen fraglos ambivalente Positionen gab. Kohlenwäsche Wieder im Freien verlassen wir den Ehrenhof und gehen in Richtung der Kohlenwäsche, die sich im Rücken des Fördergerüsts findet. Gemeinsam mit dem Rotterdamer Büro OMA planten die Architekten den Umbau dieses Gebäudes, das heute jenseits eines weiten Platzes mit querenden Gleisen über eine signifikante Gangway erschlossen wird. Heinrich Böll macht auf das Unübersehbare aufmerksam – die orangefarbene Treppe stammt nicht aus seiner Feder. Dies sei nicht seine Sprache, sondern die des Office for Metropolitan Architecture. Dennoch sei die Geste an dieser Stelle zu vertreten, denn die Kohlenwäsche „war eine riesige Maschine, die eigentlich nie von Menschen begangen wurde.“ Die neue Nutzung ließe hier, an diesem ausgewählten Ort, eine Zeichensetzung zu. Achim Pfeiffer bestätigt es: „Die Geste ist berechtigt an der Stelle – aber sie sollte einmalig bleiben.“ Die Zusammenarbeit mit OMA und den Projektarchitekten Floris Alkemade und Alex de Jong sei außerordentlich gut gewesen. Natürlich standen die Herangehensweisen konträr zueinander – OMA interessiert das große Bild, weniger das Detail –, aber gerade dies habe den Blick aller Beteiligten geschärft. Insbesondere die Einrichtung eines Projektbüros auf Zollverein und der tägliche Kontakt zum Objekt unterstützten eine effiziente und konstruktive Arbeit. Böll spricht von einem Prozess der Vereinfachung, der sich nach und nach auf die Umbauplanungen der Niederländer auswirkte: Wollten Alkemade und de Jong zunächst alle baulichen Eingriffe farblich hervorheben, habe sich schließlich die gegenteilige Strategie durchgesetzt, möglichst Nichts sollte verändert werden. Heute bricht lediglich das starke Orange der neuen Erschließungen mit der originalen Materialität – ein für OMA durchaus zurückhaltender Eingriff. Viele Bereiche der Kohlenwäsche wurden in ihrem Ursprungszustand belassen oder behutsam der neuen Nutzung angepasst. Man wollte „das Haus Architektursprache Rainer Schützeichel in weiten Teilen leer lassen“, Leere wurde als Luxus verstanden. Die Großzügigkeit etwa eines 2.000 Quadratmeter umfassenden Foyers, das wir nach der Rolltreppenfahrt auf 24 Metern Höhe erreichen, erklärt sich dann aus dem Vorhandensein eines umbauten Raums, der sich nicht aus dem menschlichen Maß, sondern aus dem Platzbedarf technischer Einbauten herleitet. Auf dem Weg durch die verschiedenen Geschosse – teils vorhandene Maschinenniveaus, teils neu eingezogene Zwischenebenen – wird der Spagat zwischen originalgetreuem Erhalt und notwendiger Anpassung deutlich, den die Architekten leisten mussten. Denn der denkmalpflegerische Anspruch, „den Weg der Kohle nachvollziehbar zu lassen“, wird durch einen wesentlichen Faktor konterkariert: Das Gebäude ist seinem eigentlichen Zweck entzogen – die noch vorhandenen Maschinen stehen still – und damit stummes Zeugnis, dessen komplexe Funktion ohne Erklärungen nur schwer zu verstehen ist. Somit lässt es seine Authentizität in der Weise vermissen, dass der Prozess der Kohlenverarbeitung nur als gedankliche Projektion, nicht aber realiter vorhanden ist. Die Architekten bildeten den Arbeitsprozess an exemplarischen Stellen ab, ohne die neue Nutzung dadurch zu behindern. In einer Abwägung des geschichtlichen Blickes „nach hinten“ und des vorausahnenden Blickes „nach vorne“ ist die Antizipation einer möglichen Zukunft wichtiger als ein rein konservatorisch motiviertes Festhalten an Vergangenem. Durch eine schwere Metalltür gelangen wir in den Reservebunker an der Nordseite der Kohlenwäsche, der die gesamte Gebäudehöhe einnimmt. Früher war dieser Bunker nicht zugänglich, heute zieht sich ein orangefarbenes Treppenband der Fluchttreppen durch den Raum und führt uns in die tiefer gelegenen Ebenen. Achim Pfeiffer bringt die Strategie dieses starken, aber begründeten Eingriffs in den Bestand auf den Punkt: „Der Raum war vorher fantastisch, aber nicht benutzbar. Jetzt ist er benutzbar, aber verändert“ – doch nicht weniger fantastisch. Der Pragmatismus der Umnutzung hat an dieser Stelle eine eigene Ästhetik entwickelt. Auf der mittleren Ausstellungsebene werden wir schließlich mit einer subtilen EinschreiArchitektursprache Rainer Schützeichel bung neuer Nutzungen konfrontiert: Die Wände spiegeln durch ihre schwarze Zeichnung noch immer die ehemalige Nutzung der heutigen Ausstellungsräume als Kohlebunker wider, doch sind sie – ähnlich wie beim Treppenhaus – schon durch das Ermöglichen ihrer Begehung im Charakter verändert. Das Raumkonzept entsteht aus den Möglichkeiten des Bestands – so bemessen sich etwa die Ausschnitte der Durchgänge in den massiven Wandungen nach den statischen Zulässigkeiten. Größere Öffnungen ließ die Statik des Bauwerks nicht zu. Die vorhandene Substanz wird hier zur Bezugsgröße, ohne dass die neue Nutzung diesem Diktat unterläge. Ihre Ausformung leitet sich vielmehr konsequent daraus ab. Der Regen hat aufgehört, als wir die Kohlenwäsche verlassen. Mein Blick schweift noch einmal über das weitläufige Zechengelände, das nicht zuletzt dank der behutsamen Eingriffe des Architekten Heinrich Böll seine Homogenität bewahrt hat. Sein Respekt vor dem Bestand und das eloquente Schweigen seiner baulichen Eingriffe haben zu einem Status quo geführt, der sich weder der Geschichte anbiedert noch die Zukunft durch aufgeladene Symbolik vorwegzunehmen versucht. Dieser Text ist erstmals erschienen in: Bund Deutscher Architekten (Hrsg.), der architekt 1/08, Ästhetik des Widerspruchs, Berlin 2008, S. 44-49. Architektursprache Rainer Schützeichel