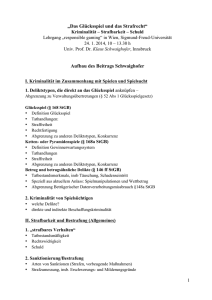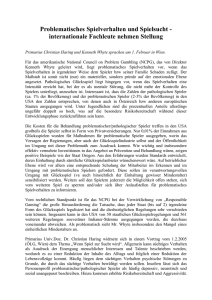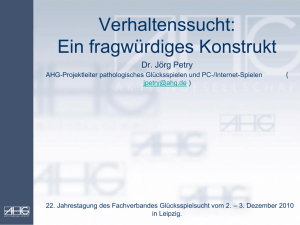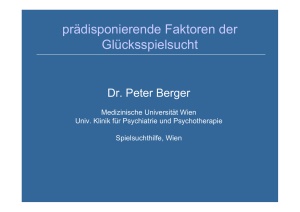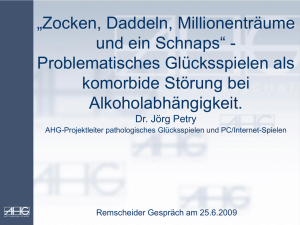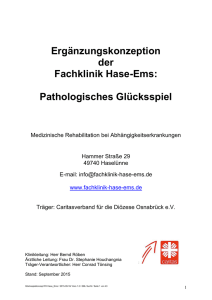Glücksspielsucht
Werbung

Friedrich M. Wurst Natasha Thon Karl Mann Herausgeber Glücksspielsucht Ursachen – Prävention – Therapie 5 Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Epidemiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Problematisches und pathologisches Glücksspielen in der Allgemeinbevölkerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Anja Bischof, Anja Westram, Christine Jeske, Gallus Bischof, Christian Meyer, Ulrich John und Hans-Jürgen Rumpf) 2. Glücksspielsucht – ein Risiko für Mann und Frau . . . . . . . . . . . . . . . (Malgorzata Zanki und Gabriele Fischer) 3. Komorbide psychische Störungen beim pathologischen Glücksspielen (Volker Premper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ätiopathogenese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4. Glücksspiel im Gehirn: neurobiologische Grundlagen pathologischen Glücksspielens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Chantal Patricia Mörsen, Andreas Heinz, Mira Fauth-Bühler und Karl Mann) 5. Lerntheoretische Erklärungsmodelle der Glücksspielsucht . . . . . . . (Klaus Wölfling) 6. Forensisch-psychiatrische Aspekte der Spielsucht . . . . . . . . . . . . . . . (Reinhard Haller) 10 26 82 109 115 Diagnostik und Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7. Diagnostik pathologischen Glücksspielens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rolf-Dieter Stieglitz) 8. Stationäre Therapie Spielsüchtiger: Chancen und Grenzen . . . . . . . (Bettina Quantschnig, Herwig Scholz, Jasmin Rachoi, Hannes Sterbenz und Michaela Becker) 9. «Sie hatten Glück, das war ihr Pech». Praxisrelevante Aspekte in der ambulanten Behandlung pathologischen Glücksspiels . . . . . . . . (Izabela Horodecki) 130 146 156 © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage. 6 Glücksspielsucht 10. Die Wirksamkeit psychologischer und psychopharmakologischer Interventionen beim pathologischen Glücksspiel – eine Metaanalyse (Max Leibetseder, Anton-Rupert Laireiter, Miriam Pecherstorfer und Bernhard Hittenberger) 11. Psychotherapie pathologischer Glücksspieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tagrid Leménager) 187 21 Prävention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 12. Effektivität der Spielsperre als Maßnahme des Spielerschutzes . . . . (Frank Peters) 13. Die Einschätzung des Gefährdungspotenzials von Glücksspielen: Ergebnisse einer Delphi-Studie und empirischen Validierung der Beurteilungsmerkmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gerhard Meyer, Jörg Häfeli, Chantal Mörsen und Marisa Fiebig) 226 Sozialkonzepte und politische Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 14. Glücksspiel und Glücksspielsucht in Deutschland – aktuelle Entwicklungen, Prävention und Spielerschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mechthild Dyckmans) 15. Möglichkeiten und Grenzen der Suchtprävention im «alten» und «neuen» Glücksspielstaatsvertrag (Jobst Böning) . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Glücksspiel und Glücksspielsucht in Österreich – die Sicht des BMG (Franz Pietsch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Glücksspiel und Glücksspielsucht in der Schweiz – Public Health und Spielerschutz (Jörg Häfeli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage. 2 250 254 273 276 289 26 2 Glücksspielsucht – ein Risiko für Mann und Frau Malgorzata Zanki und Gabriele Fischer Seit den 1980er Jahren hat pathologisches Spielen (PS) mit seiner offiziellen Anerkennung als eigenständige psychische Störung (1980 im DSM-III und 1991 im ICD-10) kontinuierlich an wissenschaftlichem Interesse gewonnen. Die Zuordnung des PS als Störung der Impulskontrolle (F63) im Rahmen der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F6) wurde in den folgenden Jahren kontrovers behandelt. Sowohl die Diagnosestellung als auch die Betrachtungsweise, wie es zu der Entwicklung der Störung kommt, beeinflussen die Behandlung. Eine eingeschränkte Sichtweise des PS als Impulskontrollstörung verhindert, dass geeignete Elemente aus der Behandlung suchtkranker Patienten in der Therapie eingesetzt werden (Potenza, 2006; Meyer & Bachmann, 2005; Bühringer, 2004; Petry, 1996). Die klinische Forschung der vergangenen drei Dekaden brachte immer mehr evidenzbasierte Erkenntnisse (auch Dank bildgebender Verfahren), die auf viele Gemeinsamkeiten in Ätiologie, Verlauf und Kernsymptomatik zwischen Spielsucht und substanzgebundenen Süchten hinweisen und schließlich dazu geführt haben, dass PS in das DSM-V als ein einziger Vertreter einer neuen Kategorie «Suchterkrankungen» aufgenommen werden soll. Nach einer Testphase sollte im Mai 2013 die überarbeitete Version DSM-V in Kraft treten. Beginn genderspezifischer Spielsuchtforschung In den meisten Studien wurden Forschungshypothesen an männlichen Stichproben untersucht. Mark und Lesieur beurteilten 1992 kritisch vorherrschende Tendenz in der Glücksspielforschung, die einer «patriarchalischen» Sicht der Welt folgte und den Mann als Prototyp des Menschen bzw. des Spielers im Mittelpunkt setzte. Ihre Literaturübersicht ergab, dass die Bedeutung des Genderaspekts in der Forschung nicht berücksichtigt wird, unterschiedliche mit pathologischem Spielen verbundene Themen, wie Spielerprofile über Persönlichkeitsmerkmale, Psychopathologie und Konsequenzen in Bezug auf männlichen Spieler behandelt und Ergebnisse schließlich auf «seltene» Fälle weiblicher Spielerinnen übertragen werden. Sie wiesen auf die Notwendigkeit hin, diesem Trend Einhalt zu gebieten und in der Zukunft genderorientierte Forschung zu forcieren. Mit der Etablierung © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage. 2. Glücksspielsucht – ein Risiko für Mann und Frau des Konzeptes von Gender-Mainstreaming auf der Pekinger Weltkonferenz der UNO 1999 ist dieser Aspekt aus der medizinischen Forschung nicht mehr wegzudenken. Ergebnisse aus klinischen Studien bestätigen fortlaufend, dass biopsychosoziale Bedingungen, einen unterschiedlichen Einfluss auf die Gesundheit und Krankheit der Frau und des Mannes haben – wenngleich die wissenschaftlichen schriftlichen Abbildungen nach wie vor nicht in diesem Umfang vorliegen, wie es gesellschaftspolitisch erwünscht wäre. Als Basis für die Genderforschung dient die Trennung in ein soziales Geschlecht (gender) und in ein biologisches Geschlecht (sex). Mit dem Begriff «gender» werden die gesellschaftlich, sozial sowie kulturell geprägten Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen von Frauen und Männern bezeichnet, und die sind im Unterschied zum biologischen Geschlecht im Rahmen des Sozialisationsprozesses erlernt. Als Konsequenz des gesellschaftlichen Wandels verändern sich auch Geschlechterrollen in ihren traditionellen Ansätzen. Diese Anpassungsanforderungen bedeuten unterschiedliche Belastung für beide Geschlechter und abhängig von geschlechtsbedingten und individuellen Ressourcen können sie unterschiedlich stark psychische Gesundheit beeinflussen. Sowohl biologische Faktoren als auch gesellschaftliche Konstrukte beeinflussen prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen des Krankheitsgeschehens. Genderspezifische Aspekte werden in der Entwicklung und dem Verlauf der Spielsucht beobachtet. Biologische, psychologische und soziale Faktoren bedingen eine individuelle Vulnerabilität, die als Prädisposition betrachtet werden kann. Ob sich aufgrund einer Prädisposition ein Suchtverhalten entwickelt, ist größtenteils von ungünstigen Lebensumständen und Komorbiditäten abhängig, und diese Risikofaktoren scheinen genderspezifisch zu sein. Infolge wird eine Auswahl aus wichtigsten Ergebnissen aus diesem Forschungsbereich präsentiert. Prävalenz Männliches Geschlecht als Risikofaktor? Den internationalen Studien zufolge schwanken Prävalenzraten für pathologisches Spielen (PS) in der Allgemeinbevölkerung zwischen 0,2 %–2,2 % (Volberg et al., 2001, Welte et al., 2001, Bondolfi et al., 2000, 2008, Bühringer et al., 2007). Auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen männlichem Geschlecht und pathologischem Spielverhalten wurde in vielen Studien hingewiesen (Bondolfi et al., 2000; Feigelman et al., 1995; King et al., 2010; Ladouceur et al. 1999; Volberg et al., 2001). Das männliche Geschlecht gilt noch immer in der Literatur als Prädiktor für Spielsuchtproblematik (Johansson et al., 2009; Tavares et al., 2010). Glücksspiele gelten als Domäne des Mannes, da sie typisch männliche Attribute wie Risikoverhalten, Dominanz und Machtstreben implizieren und oft auch mit illegalem Kontext in Verbindung stehen. Soziale Akzeptanz für Konsumverhalten bezüglich einer Substanz bzw. Teilnahme an Spielangeboten richtet sich nach der © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage. 27 28 Epidemiologie Tabelle 2-1: Genderspezifische Prävalenzraten für pathologisches Spielen. Studie Land Frauen Männer Bland et al. (1993) Kanada 0,2 0,7 Wong & So (2003) Hong Kong 2,1 9,5 Abbott & Volberg (2000) Neuseeland 2,0 4,0 Gotestam & Johansson (2003) Norwegen 0,2 1,0 Legarda et al. (1992) Spanien 3,8 10,4 Volberg et al. (2001) Schweden 1,9 6,6 Bondolfi et al. (2000) Schweiz 1,6 4,4 Sproston et al. (2000) England 0,5 1,3 Desai & Potenza (2008) USA 0,4 0,7 Verträglichkeit mit der Geschlechterrolle, was auch den Aspekt Legalität versus Illegalität miteinschließt. Breite und legale Zugangsmöglichkeiten zum Glücksspiel und größere finanzielle Unabhängigkeit infolge zunehmender Berufstätigkeit machen das Glücksspiel für Frauen attraktiver. In der Werbung wird der am Poker- bzw. am Roulettetisch spielenden Frau immer mehr Platz gewidmet. Das trägt dazu bei, dass Glücksspiel allmählich als weibliche Freizeitaktivität an sozialer Akzeptanz gewinnt. Generell geht man von etwa einem Drittel Frauen bei den Spielsüchtigen aus (Martins et al., 2002). In den USA und in Australien ist der Frauenanteil unter Glücksspielern in den letzten Jahren deutlich angestiegen und wird auf 39–48,6 % geschätzt (Ladd & Petry, 2002). Die neuesten Daten aus der Studie von Desai & Potenza (2008) zeigen eine weitere Steigerungstendenz in diesem Verhältnis (0,7 % Männer vs. 0,4 % Frauen) (vgl. Tab. 2–1). © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage. 2. Glücksspielsucht – ein Risiko für Mann und Frau Ätiologie der Spielsucht – genderspezifische Aspekte Physiologischen sowie sozio-kulturellen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren unterliegen beide Geschlechter gleichermaßen bei der Suchtentwicklung. Prämorbide Erfahrungen, Ursachen und Folgen der Spielsucht scheinen hingegen geschlechtsabhängig zu sein. Neurobiologie der Spielsucht und Genderforschung Aus neurobiologischer Sicht wurden drei Transmittersysteme als bedeutend für die Spielsucht identifiziert: 1. Serotonerges System im Zusammenhang mit Störung der Impulskontrolle, 2. noradrenerges System in Bezug auf das «Sensation Seeking», und 3. dopaminerges System, das über den Belohnungsaspekt das Suchtverhalten erklärt (Ibáñez et al., 2003a, Raylu & Oei, 2002). Dementsprechend wurden vor allem serotonerge, noradrenerge und dopaminerge Gene auf ihren Zusammenhang mit dem pathologischen Spielverhalten untersucht (Ibáñez et al., 2003a, Lobo & Kennedy, 2006). Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern ergab eine Studie, die einen Polymorphismus des Serotonin Transportergens (5-HTTLPR) untersuchte. Der genetische Unterschied wurde gehäuft bei männlichen Spielern im Vergleich zu den Kontrollen gefunden, nicht aber bei den weiblichen (Pérez de Castro et al. 1999). Die Monoaminooxidase (MAO) gilt als eine der wichtigsten biologischen Marker für impulsives Verhalten und «sensation-seeking» (Weyler at al., 1990). Laut einer Studie von Ibáñez et al. (2000), die Polymorphismen MAO-A und MAO-B bei Spielsüchtigen untersuchte, unterscheiden sich männliche pathologische Spieler signifikant in ihren MAO-A-Allelen von den gesunden männlichen Kontrollen. Diese Unterschiede konnten nicht bei weiblichen Spielern, unabhängig vom Schweregrad der Spielsymptomatik, festgestellt werden. Bildgebende Verfahren haben auf signifikante strukturelle und funktionelle Unterschiede im männlichen und weiblichen Gehirn hingewiesen, insbesondere in Regionen, die Impulskontrolle beeinflussen. Signifikante Unterschiede zwischen Mann und Frau wurden in kortikolimbischen Verbindungen gefunden, die für die Regulierung von Emotionen und für impulsive Entscheidungsfindung verantwortlich sind (Meyer-Lindenberg et al., 2006). Studien zum Zusammenhang von Testosteron und PS zeigen kontroverse Ergebnisse; einerseits sind erhöhte Testosteronkonzentrationen mit erhöhtem Risikoverhalten verbunden (Honk et al., 2004), andererseits konnten Blanco und seine Mitarbeiter (2001) keinen Zusammenhang zwischen Testosteronlevel und impulsivem Verhalten bei pathologischen Spielern nachweisen. © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage. 29 30 Epidemiologie Leider bedienen sich die Studien zur Genetik der Spielsucht vorwiegend männlicher Probanden und einige wenige Studien, die auch weibliche Probanden einschließen, haben sehr kleine Stichprobengrößen. Somit sind Schlussfolgerungen, die man aus diesen Studien ziehen kann, als Anregungen für weitere Forschung zu verstehen (Raylu & Oei, 2002, Ibáñez et al., 2003a). Genetik versus Umwelt In verschiedenen Zwillingsstudien wurden genetische Einflüsse auf die Suchtentwicklung untersucht und geschlechtsspezifische Vulnerabilität eingeschätzt, mit dem Ergebnis, dass den Männern ein stärkeres genetisches Risiko (z. B. in Bezug auf Alkoholismus) zugeschrieben wird (Heath et al., 1997). Bei separater Betrachtung genetischer und umfeldbezogener Einflussfaktoren auf Alkohol- und Drogenprobleme bei mono- und dizygoten Zwillingspaaren ergaben sich bedeutsame hereditäre Einflüsse nur bei Männern. Bei Frauen wurde als Risikofaktor der familiäre Hintergrund identifiziert, der nicht auf genetische Faktoren zurückzuführen war (Jang et al., 1997). Ähnliche geschlechtsspezifisch variierende hereditäre Einflussfaktoren konnten auch in der Spielsucht identifiziert werden (Beaver et al., 2010), was noch ein bedeutender Hinweis auf Gemeinsamkeiten zwischen substanzgebundener und substanzungebundener Abhängigkeit darstellt. Beaver und Mitarbeiter (2010) haben in einer Langzeitstudie anhand von Daten von 324 monozygotischen und 278 dizygotischen Zwillingen den Einfluss von Genetik versus Umweltfaktoren (geteilte und nicht-geteilte Umwelt) auf das Spielverhalten untersucht. Die Analyse für die gesamte Stichprobe hat den hereditären Faktoren einen wichtigen Platz eingeräumt: 72 % der Varianz der Spielproblematik konnte genetisch erklärt werden. Genderspezifische Auswertung der Daten hat ein überraschendes Ergebnis gebracht. Genetische Faktoren beeinflussen das Spielverhalten nur bei männlichem Geschlecht und erklären 85 % der Varianz, die restlichen 15 % werden auf die Unterschiede in nicht-geteilten Umweltbedingungen (individuelle Umweltfaktoren, die innerhalb von Zwillingspaaren variieren) zurückgeführt. Während die Genetik keine Einflussgröße auf das weibliche Spielverhalten zu haben scheint, wird den Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle zugeschrieben. Nicht-geteilte Umwelt (55 % der Varianz) scheint dabei mehr Einfluss auf das weibliche Spielverhalten als bei Männern (15 % der Varianz) zu haben. Die Bedingungen des gemeinsamen Aufwachsens der Zwillingspaare (geteilte Umwelt) scheinen auch einen unterschiedlichen Einfluss auf beide Geschlechter auszuüben. Während geteilte Umwelt bei Frauen 45 % der Varianz erklärt, zeigt sie keinen Einfluss auf das männliche Spielverhalten. Die Unterschiede im Einfluss der Umweltfaktoren auf das Spielverhalten beider Geschlechter wurden in vielen Studien beobachtet. Gewalterfahrungen und sexueller Missbrauch finden sich in der Vorgeschichte der Spielsucht häufiger bei Frauen als bei Männern (Ladd & Petry, 2002, Desai & Potenza, 2001, Tavares et al., 2001). Auch mangelhafte, eher passive und inadäquate Copingstrategien, begleitet © 2012 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus: Friedrich M. Wurst, Natasha Thon, Karl Mann (Hrsg.); Glücksspielsucht. 1. Auflage.