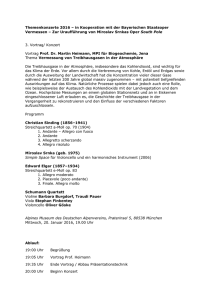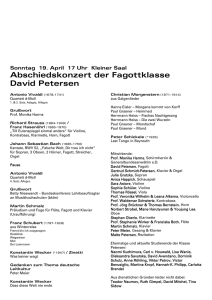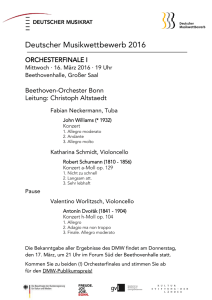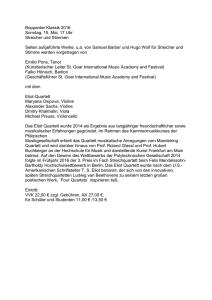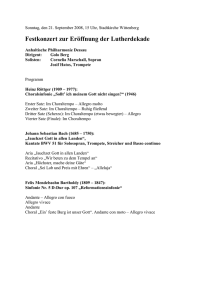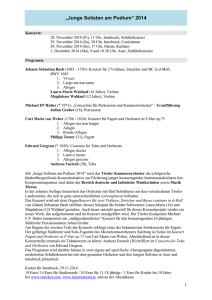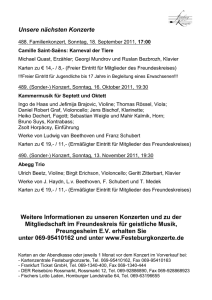18 . hambach er fest 2014
Werbung

18. HAMBACHERMusik FEST 2014 18. HAMBACHERMusik FEST 18. bis 22. Juni 2014 Neustadt an der Weinstraße Hambacher Schloss Weingut Georg Naegele Weingut Müller-Kern Pfarrkirche St. Jakobus Mandelring Quartett Jörg Brückner, Horn Nick Deutsch, Oboe Amy Dickson, Saxophon Jon Diven, Kontrabass Frank Forst, Fagott Wally Hase, Flöte Thorsten Johanns, Klarinette Paul Rivinius, Klavier Rautio Piano Trio Künstlerische Leitung: Mandelring Quartett Mittwoch, 18. Juni 2014, 20.00 Uhr Hambacher Schloss 19.30 Uhr Sektempfang Eröffnungskonzert Béla Bartók (1881-1945) Thorsten Johanns, Klarinette Sebastian Schmidt, Violine Paul Rivinius, Klavier „Kontraste“ Verbunkos: Moderato ben ritmico Pihenö: Lento Sebes: Allegro vivace Igor Strawinskij (1882-1971) „Sacre du printemps“ (bearbeitet für Bläserquintett von Michael Byerly) Erster Teil: Die Anbetung der Erde Introduktion – Verheißung des Frühlings: Tanz der Jünglinge – Das Spiel der Entführung – Frühlingsrondo – Wettspiele der Stämme – Auftritt der Weisen – Anbetung der Erde – Tanz der Erde Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Jörg Brückner, Horn Frank Forst, Fagott Zweiter Teil: Das Opfer Introduktion – Geheimnisvolle Kreise der Mädchen – Verherrlichung der Auserwählten – Anrufung der Ahnen – Weihevolle Ahnenfeier – Heiliger Tanz PAUSE Johannes Brahms (1833-1897) Paul Rivinius, Klavier Klavierquintett f-Moll op. 34 Mandelring Quartett Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Allegro non troppo Andante, un poco adagio Scherzo: Allegro Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto non troppo Konzert-Patenschaft: Familie Josef Pfister Wir danken dem Weingut Bergdolt für die Künstlerpräsente Als kleiner Junge konnte Béla Bartók stundenlang in den Hügeln, die seine Heimatstadt Nagyszentmiklós im heutigen Rumänien umgeben, im Gras liegen und dem geschäftigen Gekrabbel der Käfer und Ameisen zusehen; in seiner Jugend sammelte und klassifizierte er mit wissenschaftlichem Eifer Insekten. Beides, die Liebe zur Natur und die Sammelleidenschaft, ist ihm geblieben. Letztere bezog sich später aber auf ein völlig anderes Gebiet: die Volksmusik. Zusammen mit seinem Freund Zoltán Kodály reiste er ab 1905 in abgelegene Dörfer, um die traditionelle Musik zu erforschen. In fast allen späteren Kompositionen Bartóks hat diese Musik mit ihren archaischen Tonarten und ihren komplexen Rhythmen Spuren hinterlassen. Das Trio „Kontraste“ bezieht ungarische und rumänische Tänze ein. Es war ein Auftragswerk des Geigers Josef Szigeti und des Klarinettisten Benny Goodman; sie wünschten sich eine Komposition möglichst aus zwei selbständigen (und eventuell auch einzeln spielbaren) Teilen, in der eine brillante Klarinetten- und auch eine Violinkadenz vorkommen sollten. Bartók erfüllte ihnen diesen Wunsch mit zwei sehr wirkungsvollen Ecksätzen, fügte aber noch einen langsamen Mittelsatz ein. Diese Fassung führte der Komponist selbst im April 1940 in New York mit den beiden Kollegen erstmals auf, kurz nachdem er aus dem faschistischen Europa in die USA geflohen war. Der erste Satz beruht auf dem „Verbunkos“, einem Tanz, der im 18. Jahrhundert zur Anwerbung von Soldaten gespielt wurde. Die einzelnen Stimmen sind sehr selbständig und ausgesprochen effektvoll geführt; seinen Höhepunkt erreicht der Satz in der Klarinetten-Kadenz. Dialogisch verschränkt sind Klarinetten- und Violinstimme im mit „Pihenö“ („Entspannung“) überschriebenen langsamen Satz, der lediglich im Mittelteil durch Triller und Tremoli in schillernde Bewegung gerät. Umso lebhafter wirkt das Finale, „Sebes“, ein schneller Tanz, der mit den leeren Saiten der auf gis - d - a - es umgestimmten Violine beginnt (später tauscht der Geiger das Instrument gegen eines in normaler Stimmung aus). Eingeflochten in den Satz mit der Violin-Kadenz sind Anklänge an den Jazz, die eigentliche Domäne des Klarinettisten Benny Goodman – anspruchsvolle, aber sehr eingängige Kunstmusik. Auf traditionelle, in diesem Fall russische Lieder griff auch Igor Strawinskij in jenem Werk zurück, das zu einem der berühmtesten und folgenreichsten des 20. Jahrhunderts werden sollte. Als ich in St. Petersburg die letzten Seiten des „Feuervogels“ niederschrieb, überkam mich eines Tages […] die Vision einer großen heidnischen Feier: Alte weise Männer sitzen im Kreis und schauen dem Todestanz eines jungen Mädchens zu, das geopfert werden soll, um den Gott des Frühlings günstig zu stimmen. Das war das Thema von „Le sacre du printemps“. Als Librettisten gewann Strawinskij den befreundeten Nicholas Roerich, Maler, Hobby-Archäologe, Lebensphilosoph und Experte für frühe russische Geschichte. Roerich entwarf später auch die Ausstattung für die Aufführung der Ballets Russes, die am 29. Mai 1913 zu einem spektakulären Bühnenskandal geriet. Was die juwelenbehängten, mit Straußenfedern geschmückten Damen und die in edles Tuch gewandeten Herren im Pariser Théâtre des Champs-Elysées außer Fassung brachte und zu Handgemengen, Duellforderungen, gar dem Einschreiten der Polizei geführt haben soll, war indessen nicht so sehr die Musik als vielmehr die Choreographie: Sie zeigte keinen Spitzentanz, sondern archaisierende Bewegungen in bäuerlich-folkloristischen Kostümen. Zwar hatte der Dirigent Pierre Monteux schon einen Skandal vorhergesehen, als Strawinskij ihm das Werk auf dem Klavier vorspielte, wobei er in die Tasten hämmerte und manchmal mit seinen Füßen stampfte und auf und nie- 11 der sprang; aber die Musik setzte sich rasch durch, trotz – oder wegen – ihrer Wucht und Wildheit, trotz komplexester Rhythmik und Metrik, trotz ungewohnter Klänge wie dem geheimnisvoll-grotesken Fagott-Solo zu Beginn. Und sie wirkt selbst in reduzierten Fassungen, wie der Version für Klavier-Duo vom Komponisten selbst oder der Bearbeitung für Bläserquintett von Michael Byerly, der das Werk um knapp ein Drittel kürzt, dem es aber gelingt, den Farbreichtum der Partitur zu bewahren. Unterschiedliche Fassungen – das ist im Werk von Johannes Brahms ein Leitmotiv; immer wieder hat der Komponist verworfen, umgearbeitet, neu begonnen. Das Klavierquintett f-Moll op. 34 ist dafür ein Musterbeispiel: Ursprünglich hatte Brahms es als Streichquintett konzipiert. Von dem befreundeten Geiger Joseph Joachim darauf hingewiesen, dass die Instrumentation für die mächtigen rhythmischen Rückungen nicht energisch genug klinge, arbeitete er es zu einer Sonate für zwei Klaviere um. Wundervoll – großartig; aber: es ist keine Sonate, sondern ein Werk, dessen Gedanken Du wie aus einem Füllhorn über das ganze Orchester ausstreuen könntest – müßtest! befand Clara Schumann, woraufhin Brahms erneut zur Feder griff. Und die endgültige Fassung scheint tatsächlich die einzige zu sein, die diesem Werk gerecht wird. Die Arbeit daran fällt in eine entscheidende Zeit: Im September 1862 reiste Brahms zum ersten Mal in seine künftige Wahlheimat Wien; ein jugendlich wirkender 29-Jähriger auf dem besten Wege, die Musikwelt zu erobern. In der Donau-Metropole fand er rasch Anschluss an Musikerkreise, und in einem Brief an Julius Otto Grimm berichtet er beglückt: Ich wohne hier, zehn Schritte vom Prater, und kann meinen Wein trinken, wo ihn Beethoven getrunken hat. Auch in dem Quintett hat Beethoven seine Spuren hinterlassen: Der Musikpublizist Misha Donat weist auf die Ähnlichkeit mit dessen „Appassionata“ hin, nicht nur wegen der düsteren Tonart f-Moll, sondern auch in der Gestaltung des Kopfsatzes mit seinem Sechtzehntel-Ausbruch nach dem oktavierten Hauptthema. Der langsame Satz in As-Dur erinnert in seiner gemütvollen Atmosphäre an einen Schubert-Ländler. Ungewöhnlich gewichtig erscheint dagegen das energische c-Moll-Scherzo, das nach dem fast gespenstischen Anfang mit einem majestätischen Thema den sinfonischen Anspruch des Kopfsatzes aufgreift. Das Finale beginnt mit einer geheimnisvoll-fahlen, stark chromatischen Einleitung; der schnelle Teil mit wiederum orchestraler Klangfülle führt zu einem mächtigen Abschluss. Der Dirigent und Pianist Hermann Levi, der mit Clara Schumann die Klavier-Fassung aufgeführt hatte, befand nach dem Hören des Quintetts, es sei ein Meisterwerk von Kammermusik, wie wir seit dem Jahre 28 (Entstehung des Streichquintetts und Schuberts Tod) kein zweites aufzuweisen haben. Jedermann, der nur ein einziges Mal ein musikalisches Erlebnis gehabt hat, weiß, dass derjenige, welcher solche Erlebnisse nicht kennt, ein Bettler ist. Dieses Wort Franz Werfels gilt ohne Zweifel ganz besonders für die „reinste“ Musikart, die Kammermusik. Wir freuen uns, dazu beizutragen, dass das 18. HAMBACHERMusikFEST wieder eine reiche Palette bunter Werke in mustergültiger Interpretation bieten kann. FAMILIE JOSEF PFISTER Donnerstag, 19. Juni 2014, 15.30 Uhr Weingut Georg Naegele Schloßstr. 27-29, Hambach „Bunte Vielfalt“ Anton Reicha (1770-1836) Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Jörg Brückner, Horn Frank Forst, Fagott Bläserquintett Es-Dur op. 88,2 Lento – Allegro moderato Minuetto: Allegro Poco andante grazioso Finale: Allegro moderato Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) Kontrabassquartett Nr. 2 D-Dur Allegro moderato Menuett Andante Rondo Jon Diven, Kontrabass Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello PAUSE Adolf Busch (1891-1952) Amy Dickson, Saxophon Quintett für Saxophon und Streichquartett Mandelring Quartett Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Vivace, ma non troppo Scherzo: Allegro vivo Andante sostenuto – Vivace – Vivacissimo – Andante molto moderato e scherzando – Adagio – Allegretto amabile – Allegro moderato, ma con veemenza – Tempo primo György Ligeti (1923-2006) Sechs Bagatellen aus „Musica ricercata“ für Bläserquintett Allegro con spirito Rubato lamentoso Allegro grazioso Presto ruvido Adagio mesto (Béla Bartók in memoriam) Molto vivace capriccioso anschließend: Buffet im Weingut Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Jörg Brückner, Horn Frank Forst, Fagott Wir danken dem Weingut Naegele für die Künstlerpräsente Man hätte schon gerne ein Konzert der Bonner Hofkapelle erleben mögen, als der jugendliche Anton Reicha dort um 1790 die zweite Flöte blies und der gleichaltrige Ludwig van Beethoven Bratsche spielte: zwei Ausnahmemusiker und zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, die trotz unterschiedlicher Entwicklungen eine lange Freundschaft verband. Reicha, in Prag geboren, hatte schon als Kleinkind seinen Vater verloren und wurde von einem Onkel adoptiert, der Kapellmeister am Hof von Oettingen-Wallerstein war. Dort lernte er nicht nur Deutsch und Französisch, sondern neben Geige und Klavier auch sein zukünftiges Hauptinstrument, Flöte, und er lernte das berühmte Harmoniemusik-Ensemble des Fürsten kennen. Von Bonn aus verschlug es ihn nach Hamburg, dann nach Wien und schließlich nach Paris, wo er als Professor für Kontrapunkt und Fuge unter anderen Berlioz, Liszt und Franck unterrichtete. Nach den Erinnerungen seines Schülers Johann Georg Kastner war Reicha ein fantasievoller Lehrer, der den neugierigen Forschergeist anregte. Aber auch in seinen Kompositionen war er sehr experimentierfreudig. Das Bläserquintett hat er zwar nicht „erfunden“, aber populär gemacht. Insgesamt 24 dieser Quintette stammen aus seiner Feder; ausgesprochen effektvolle Werke, die ganz auf die Besonderheiten der Instrumente zugeschnitten sind. Im Es-Dur-Quintett op. 88 Nr. 2 erinnert vor allem der Kopfsatz an eine Opernszene, mit rhapsodischer Reihung von Motiven und Melodien, von denen einige Assoziationen an Mozarts „Zauberflöte“ und insbesondere die „Entführung aus dem Serail“ wachrufen. Auf ein Menuett mit zwei Trios folgt ein graziöser langsamer Satz mit dichtem Stimmengeflecht, an den sich ein Kehraus in Rondoform anschließt. Franz Anton Hoffmeister ist in erster Linie nicht als Komponist, sondern als Verleger bekannt geworden; das „Bureau de musique“, das er 1800 in Leipzig zusammen mit dem Organisten August Kühnel gründete, existiert noch heute in Form des Verlags C. F. Peters. Außer seinen eigenen Kompositionen veröffentlichte Hoffmeister insbesondere Werke von Komponisten aus seiner Wiener Wahlheimat, von Mozart, Beethoven, Vanhal. Er selbst schuf ein riesiges, bis heute kaum erforschtes Œuvre. Über 40 Sinfonien sind nachgewiesen, rund 100 Quartette für Flöte und Streicher, Dutzende weiterer Kammermusikwerke, neun Bühnenwerke, dazu Messen, Lieder, Solokonzerte – das für Bratsche gehört heute zum Kanon der Pflichtstücke für Orchester-Probespiele. Die Quartette mit Kontrabass anstelle der ersten Violine verlangen dem tiefsten Streichinstrument virtuose Fähigkeiten ab und bringen zugleich seine sonore Tiefe zur Geltung. Im Quartett Nr. 2 D-Dur stellt der Kontrabass sowohl das Haupt- als auch das Seitenthema des Kopfsatzes vor, um dann in einen Dialog mit der Violine zu treten. Das Menuett wird zunächst von der Bratsche geprägt, aber auch hier übernimmt er, mit zunehmend virtuosen Figurationen im Trio, bald das Zepter. Als verkapptes Kontrabass-Konzert präsentiert sich der lyrische langsame Satz; das Rondo-Finale geht mit einer kadenzartigen Passage voller virtuoser Doppelgriffe und Akkorde zu Ende. Adolf Busch ist einer jener Frühreifen, die geboren sind, um entweder große Diener der Kunst zu werden, oder an ihrer unheimlichen Begabung zugrunde zu gehen – so schrieb ein Kritiker nach dem Berliner Debüt des 19-jährigen Geigers im Jahre 1910. Busch ging nicht zugrunde, er wurde ein gefeierter Solist, geschätzter Konzertmeister und vor allem Kammermusiker, gerühmt für seine Ausdruckstiefe, seine Ernsthaftigkeit, seinen reinen Ton. Fast 40 Jahre lang spielte er im Busch-Quartett, von dessen Gründung bis zu seiner Auflösung; mit dem Pianisten Rudolf Serkin verband ihn eine einzigartige Künstlerfreundschaft, und als Lehrer hat er bei Ausnahmemusikern wie Yehudi Menuhin unauslöschliche Spuren hinterlassen. Der Komponist Adolf Busch stand und steht im Schatten des Geigers, obwohl er ein umfangreiches Œuvre geschaffen hat, keineswegs nur für Streicher, sondern auch Orchester-, Vokal- und Bühnenmusik. Das Quintett für Saxophon und Streichquartett ist 1925 entstanden, und es ist unverkennbar Max Reger verpflichtet, mit dem Busch befreundet war: Eine Komposition, die fest in der spätromantischen Tradition wurzelt, klangschwelgerisch, dabei aber sehr komplex und nicht ganz leicht zu hören – das gilt besonders für das einleitende Vivace in SonatensatzForm. In ungewöhnlicher Satzfolge schließt sich ein motorisch geprägtes Scherzo an und dann ein langsamer Variationen-Satz, dessen Thema zunächst als ausdrucksvolles Saxophon-Solo vorgestellt wird, gefolgt von einer munteren Folge sehr unterschiedlicher Varianten, die schließlich im Nichts verschwindet. „Popstar der E-Musik“ titelte der SPIEGEL anlässlich des 80. Geburtstags von György Ligeti im Jahre 2003. Die Bezeichnung ist mehr griffig als treffend, zumal dem Österreicher ungarisch-jüdischer Herkunft jede Art von Stargehabe fern lag; sie entbehrt aber doch nicht eines gewissen Sinns: Denn obwohl er einer der bedeutendsten Vertreter der Nachkriegs-Avantgarde war, sich mit den verschiedensten musikalischen Systemen vom Serialismus bis zur Polyphonie der AkáPygmäen auseinandergesetzt und hyperkomplexe, höchst ambitionierte Werke geschrieben hat, war Ligeti ein Komponist zum Anfassen, und seine Musik ist immer sinnlich und unmittelbar ansprechend – man muss ihre raffinierte Struktur nicht verstehen, um in ihren Bann gezogen zu werden. Das gilt für sein bekanntestes Stück, das durch Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ berühmt gewordene „Atmosphères“, ebenso wie für die Sechs Bagatellen für Bläserquintett. Diese sind Bearbeitung einer Auswahl von Stücken aus dem Klavierzyklus „Musica ricercata“, den Ligeti 1951-1953, wenige Jahre vor seiner Flucht aus dem sozialistischen Ungarn, komponiert hat. In jeder der Miniaturen beschränkt er sich auf eine festgelegte Auswahl von Tönen, von zweien im ersten bis zu 12 im letzten Stück. Schon in der Klavierfassung erzeugt er mit Hilfe differenzierter Artikulation und Dynamik eine ungeheure Farbigkeit; diese Wirkung wird in der Bläser-Bearbeitung noch gesteigert. Wer würde beim Hören glauben, dass das erste Stück lediglich aus vier Tönen, denen des C-Dur- und des c-Moll-Dreiklangs, besteht? Einige, wie Nummer zwei, beruhen auf folkloristisch anmutendem Material; in Nummer drei spannt sich die Melodie über eine pulsierende Septolen-Bewegung. Die vierte und die sechste Bagatelle erinnern mit ihrem motorischen Gestus an Strawinskij, während die fünfte ausdrücklich „in memoriam Béla Bartók“ konzipiert ist. Dass das spielfreudige letzte Stück seinerzeit als zu radikal eingestuft wurde und bei der Budapester Uraufführung der Bagatellen 1953 nicht gespielt werden durfte, vermag man sich heute kaum mehr vorzustellen. Donnerstag, 19. Juni 2014, 20.00 Uhr Hambacher Schloss Podium junger Künstler Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Rautio Piano Trio Jane Gordon, Violine Adi Tal, Violoncello Jan Rautio, Klavier Klaviertrio G-Dur KV 564 Allegro Andante (Thema mit sechs Variationen) Allegretto Gabriel Fauré (1845-1924) Klaviertrio d-Moll op. 120 Allegro, ma non troppo Andantino Finale: Allegro vivo PAUSE Felix Mendelssohn (1809-1847) Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66 Allegro energico e con fuoco Andante espressivo Scherzo: Molto allegro quasi presto – Trio Finale: Allegro appassionato Drei späte Werke stellt dieses Programm vor – Werke, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: das c-Moll-Klaviertrio von Mendelssohn, das zu seinen spannendsten Kompositionen gehört und unbegreiflicherweise völlig im Schatten des Schwesterwerkes in d-Moll steht, Faurés zurückgenommenes, weltabgewandtes Opus 120 sowie mit dem letzten Klaviertrio von Wolfgang Amadeus Mozart ein spielerisch heiteres und geradezu simples Stück. Es ist im Jahre 1788 entstanden, in einer Zeit der verzweifelten wirtschaftlichen Notlage. Wenn Sie vielleicht so bald nicht eine Solche Summa entbehren könnten, so bitte ich sie mir wenigstens bis Morgen ein paar hundert gulden zu lehnen, weil mein Hausherr auf der Landstrasse so indiscret war, daß ich ihn gleich auf der Wir danken der Confiserie Endle, Karlsruhe, für die Künstlerpräsente stelle (um ungelegenheit zu vermeiden) auszahlen musste, welches mich sehr in unordnung gebracht hat! schrieb Mozart im Juni jenes Jahres an seinen Logenbruder Michael Puchberg – der diese und weitere Bitten um Darlehen großzügig erfüllte. Um finanziell über die Runden zu kommen, komponierte Mozart neben der g-Moll- und der Jupiter-Sinfonie auch einige für den Hausgebrauch geeignete Kammermusikwerke, mit denen er breite Käuferschichten zu gewinnen hoffte: die „Sonata facile“ KV 454, noch heute ein Lieblingsstück im Klavierunterricht, die kleine klavier Sonate - für Anfänger mit einer Violin KV 547 und eben dieses Klaviertrio G-Dur KV 564. Es ist unmittelbar eingängig: schlichte achttaktige Perioden mit leicht fasslichen Melodien, ein Variatio- nen-Satz, der zunächst dreimal das weitgehend unveränderte Thema umspielt, bevor er sich in etwas anspruchsvolleres Gelände vorwagt und nach der üblichen gefühlvollen Moll-Variation einen unbeschwerten Kehraus bringt, schließlich das Rondo-Finale, für das man, wie die Musikwissenschaftlerin Nicole Schwindt etwas boshaft bemerkt, kindlichen Gemüts sein oder sich ein solches bewahrt haben muss, wenn man es genießen will. Und doch gelingt es Mozart auch hier, wie in der „Sonata facile“, sich in aller Einfachheit die Herzen der Zuhörer zu erschließen. Dem 76-jährigen Gabriel Fauré lag an der Meinung des Publikums nicht viel, als er sich 1922 auf Drängen seines Verlegers Jacques Durand daran machte, ein Klaviertrio zu komponieren. Durand wollte den fast völlig tauben und allmählich erblindenden Grandseigneur der französischen Kammermusik damit aus seiner Schaffenskrise aufrütteln. Eher lustlos machte sich Fauré ans Werk. Ich schäme mich, zuzugeben, dass ich das Leben einer Kellerassel führe! schrieb er an seine Frau. Ich mache nichts, gar nichts, und habe, seit ich in Nizza bin, noch keine zwei brauchbaren Noten geschrieben. […] Ohne das geringste Bedürfnis nach Ausgang oder Arbeit verbringe ich meine Tage im Haus. Ein gutes Jahr verging, bis das Klaviertrio d-Moll op. 120 endlich vollendet war. Nur noch eine weitere Komposition sollte ihm folgen, Faurés einziges Streichquartett, dem es in seiner reduzierten Tonsprache und seinem klaren, durchsichtigen Satz verwandt ist. Ein eindrucksvolles, berührendes, dabei nicht leicht zugängliches Werk, schwebend, schwerelos, mit einer Tonalität, die zum Modalen, eher Farb- als Funktionsgebundenen tendiert. Die Streicher werden über weite Strecken unisono oder in Oktaven geführt, bei einem ebenfalls reduzierten Klaviersatz. Der ausgedehnteste Satz ist das überirdisch schöne Andantino mit seinem intimen Zwiegespräch der Streichinstrumen- te, dem ein in seiner Ausgelassenheit fast schon unheimliches Scherzo mit einer Überfülle an Einfällen folgt. Wie weit würde er wohl gehen, fragten nach der Uraufführung im privaten Kreis Faurés verblüffte Freunde, wenn er hundert Jahre lebte? Gerade einmal 36 Jahre alt war Felix Mendelssohn Bartholdy, als er sein zweites Klaviertrio c-Moll op. 66 komponierte, und doch trägt es die Züge eines Spätwerks: ein äußerst faszinierendes, komplexes Werk, in c-Moll stehend, das seit Beethovens 5. Sinfonie als „Schicksals-Tonart“ gilt. Es sei ein bißchen eklig zu spielen, verriet Mendelssohn seiner Schwester Fanny, der er das Werk 1845 zum Geburtstag schenkte. Der erste Satz erinnert an eine wild zerklüftete Landschaft. Aus dem vorwärtsstürmenden Hauptthema, das im ersten Moment so gar nicht thematisch-gesetzt erscheint, erwächst das lyrischere Seitenthema – wie überhaupt der ganze Satz etwas Organisch-Wucherndes hat, bis hin zu der gewaltigen Coda, die den Blick auf ganz neue Klanglandschaften eröffnet. Nach diesem grandiosen Beginn lassen zwei schlichtere Sätze Atem schöpfen: ein „Lied ohne Worte“ in wiegendem 9/8-Takt und ein kurzes Scherzo mit dem typisch Mendelssohnschen Elfenspuk, der im Mittelteil und ein weiteres Mal gegen Ende von einem derberen volkstümlichen Tanz abgelöst wird. Das gewaltige Finale greift auf den ersten Satz zurück; eingeschoben ist ein Abschnitt, den viele Kommentatoren auf den Choral „Vor Deinen Thron tret ich hiermit“ zurückführen und der leise im Klavier angestimmt wird, während die zwei Streicher weiterhin Fragmente des Anfangsthemas austauschen und so wie zwei kleine Menschenfiguren wirken, die beim Betreten einer großen Kathedrale flüsternd miteinander sprechen, so der Musikpublizist Robert Philip in einem Booklet-Text. Wie der erste Satz schließt auch dieser mit einer grandiosen Coda. Freitag, 20. Juni 2014, 19.00 Uhr Pfarrkirche St. Jakobus Freiheitstraße, Hambach Kammermusik in St. Jakobus „Jubilare 2014” Richard Strauss (1864-1949) Sebastian Schmidt, Violine Paul Rivinius, Klavier Sonate Es-Dur op. 18 Allegro, ma non troppo Improvisation: Andante cantabile Finale: Andante – Allegro Albéric Magnard (1865-1914) Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Frank Forst, Fagott Paul Rivinius, Klavier Quintett d-Moll op. 8 Sombre Tendre Léger Joyeux PAUSE Johan Halvorsen (1864-1935) Sarabande mit Variationen über ein Thema von Georg Friedrich Händel Richard Strauss Streichquartett A-Dur op. 2 Allegro Scherzo: Allegro molto Andante cantabile, molto espressivo Finale: Allegro vivace Sebastian Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Mandelring Quartett Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello anschließend: kulinarischer Ausklang «chez St. Jacques» im Gewölbekeller der Winzergenossenschaft Das Konzert wird vom SWR 2 mitgeschnitten und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Wir danken der Heim’schen Privat-Sektkellerei für die Sektspende Wir bitten das verehrte Publikum, die Würde des Kirchenraumes beim Applaus zu respektieren. Drei Komponisten, innerhalb eines guten Jahres in drei verschiedenen Ländern geboren, und drei Werke, die stilistisch und im Anspruch unterschiedlicher kaum sein könnten, umfasst das Programm dieses Konzertes. Nur wenige Schüler gibt es, die in gleichem Grade wie dieser Knabe Pflichtgefühl, Talent und Lebhaftigkeit in sich vereinen – so erinnerte sich einer seiner Lehrer aus dem Münchner Ludwigs-Gymnasium an Richard Strauss. Seine Aufmerksamkeit beim Unterricht ist sehr groß, nichts entgeht ihm. Und doch kann er kaum eine Minute ruhig sitzen […]. Ungetrübte Heiterkeit und Fröhlichkeit lacht ihm aus den blauen Augen Tag für Tag. Strauss hatte gut lachen: Der Unterrichtsstoff schien ihm nur so zuzufliegen, sah man einmal vom leidigen Thema Mathematik ab. Dabei interessierte ihn von klein auf vor allem eins: Musik. Als Sohn des an der Münchner Hofkapelle angestellten Hornisten Franz Strauss, der auch gerne zu Geige, Bratsche oder Gitarre griff, war er seit seiner Geburt von Klängen umgeben. Mit vier erhielt er Klavierunterricht, mit sechs schrieb er die ersten Lieder für eine sängerisch begabte Tante, mit sieben fing er an, sich für die Oper zu begeistern, mit elf bekam er Theorie-Unterricht, und er hätte sicher als Wunderkind für Aufsehen gesorgt, hätte der Vater ihn nicht vor allzu frühem Star-Rummel geschützt. Spätestens mit dem Abitur war indessen klar, dass für Strauss junior kein Weg an der Musik vorbeiführen würde. Als er 16 war, erschien sein erstes Werk im Druck, der „Festmarsch“ in Es-Dur, den er als Zwölfjähriger geschrieben hatte; im selben Jahr führte das Ensemble seines Geigenlehrers das Streichquartett A-Dur op. 2 auf – kurz danach schwang übrigens kein Geringerer als Hermann Levi den Taktstock bei der Uraufführung seiner ersten Sinfonie. Das Quartett ist deutlich an Mozart, dem Hausgott der Familie Strauss, orientiert, mit einem humorvollen Scherzo, das an Haydn erinnert. An die erste Geige stellt es erhebliche Anforderungen – vielleicht hatte Strauss, der mit dem Instrument eher auf Kriegsfuß stand, schon bei der Komposition die Fähigkeiten seines Lehrers im Sinn. Handwerklich erscheint es perfekt; dass der Komponist auch später kein Hochschulstudium brauchte, um seine Fähigkeiten zu vervollkommnen, verwundert da nicht. Technisch einwandfreie, elegante und feine Arbeit im reinsten frühklassischen Quartettstil bescheinigt ihm später Strauss‘ Schulkamerad und Biograph Max Steinitzer – wobei dieser „Frühklassik“ Mendelssohn und Schubert ihren Stempel aufgedrückt haben; auch das Finale aus Mozartschem Geist erweist sich mit munteren Modulationen und farbigen Akkorden letztlich doch als Kind des 19. Jahrhunderts. Das Jahr 1881, in das Komposition und Uraufführung des Quartetts fallen, bildete den Startpunkt für Richard Strauss‘ Karriere. Langsam aber zielstrebig erkundete er in jener Zeit die Musikwelt über die Isar-Metropole hinaus – Leipzig, Dresden, Berlin, Wien – und, eins der wichtigsten Ereignisse: Er gewann den Dirigenten Hans von Bülow für sich, von dem er einige Jahre später, gerade einmal 21-jährig, die Meininger Hofkapelle übernehmen sollte, die von Bülow zu einem der besten Orchester Deutschlands, wenn nicht Europas gemacht hatte. Strauss entwickelte seine von Hause aus eher konservativen musikalischen Ansichten weiter. Er entdeckte Brahms für sich – über dessen dritte Sinfonie er noch kurz zuvor seinen Eltern geklagt hatte: Mir brummt noch heute der Kopf von dieser Unklarheit – und später den vom Vater als besoffener Lump beschimpften Richard Wagner. Bald schon gehörte Strauss selbst in den Kreis der „Zukunftsmusiker“. Er komponierte 1887 seine erste vollgültige Sinfonische Dichtung, „Macbeth“, und im selben Jahr sein letztes eigenständiges Kammermusikwerk: die Sonate Es-Dur op. 18 für Violine und Klavier. Im Charakter steht sie den Sinfonischen Dichtungen näher als einer herkömmlichen Sonate, deren Form Strauss zu dieser Zeit nicht mehr genügte. Zwar sind die Ecksätze noch an die Sonatensatzform angelehnt, diese wird jedoch ins Überdimensionale ausgedehnt. Das „ritterliche“ Hauptthema des Finales erinnert an den im folgenden Jahr komponierten „Don Juan“, und die sinfonische Klangfülle, die riesige Register-Spanne, der ganze Duktus weisen auf den OrchesterMagier der kommenden Jahre voraus. Von einer Karriere wie der Richard Strauss‘ wird Albéric Magnard, fast exakt ein Jahr später in Paris geboren, nicht einmal geträumt haben. Es passt zum Leben dieses als Misanthrop berüchtigten Einzelgängers, dass er der Öffentlichkeit vor allem wegen seines Endes im Gedächtnis geblieben ist: Am 3. September 1914 wurde er beim Versuch, sein Anwesen in Baron im Département Oise, nicht weit von Paris, zu verteidigen, von einem deutschen Soldaten erschossen – eins der ersten namhaften Kriegsopfer. Um Selbstvermarktung hat sich Magnard nie bemüht, noch weniger wollte er die Verbindungen seines Vaters ausnutzen, der als Chefredakteur der Zeitung „Figaro“ zu den einflussreichsten Intellektuellen Frankreichs gehörte. Erst nach einem abgeschlossenen Jurastudium begann er, sich intensiv der Musik zu widmen – angeblich unter dem überwältigenden Eindruck einer Aufführung von „Tristan und Isolde“ in Bayreuth – und nahm zusätzlich zu den Kursen am Pariser Conservatoire Privatunterricht bei Vincent d‘Indy, dem glühenden Wagnerianer und Experten für früh- und vorbarocke Musik. Dort erwarb Magnard sich ausgefeiltes Handwerkszeug und einen Sinn für die Musik der Vergangenheit. Auch wenn er sich in seinen Opern der Leitmotivtechnik und der Instrumentationsweise Richard Wagners bediente, suchte er seine Vorbilder eher im 18. Jahrhundert, bei Rameau und Gluck, auch Beethoven gehörte zu seinen Heroen. Sein Œuvre ist ausgesprochen schmal und sehr persönlich: Mit der „Hymne à la Justice“ unterstrich er seine Position als erklärter Dreyfusard, seine vierte Sinfonie widmete er – ein früher Feminist – der „Vereinigung der Professorinnen und Komponistinnen“ und die „Hymne à Venus“, weniger erstaunlich, seiner Frau. Der „Chant funèbre“ aus dem Jahre 1894 verarbeitet den plötzlichen Tod seines Vaters, mit dem ihn ein enges Verhältnis verband. Das kurz zuvor entstandene Quintett d-Moll op. 8 erweckt den Eindruck, auch hier spiegele sich ein schicksalhaftes Geschehen, namentlich im dunklen Kopfsatz und dem Klagegesang der Klarinette zu Beginn des mit „Tendre“, „Zärtlich“, überschriebenen langsamen Satzes. Der Gestus des Werkes wechselt zwischen geradezu sinfonischen und sehr kammermusikalischen Passagen, in denen oft einzelne Instrumente in den Vordergrund treten – im zweiten Satz das Klavier, zu Beginn des dritten die Flöte und schließlich das Fagott im trotz der Anweisung „Joyeux“, „Fröhlich“, erstaunlich schwerblütigen Finale. Orientiert sich der Franzose Albéric Magnard, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen Debussy und Ravel, an der deutschen Klassik und Romantik, so treffen im Œuvre des Norwegers Johan August Halvorsen die unterschiedlichsten nationalen und stilistischen Richtungen aufeinander – was sicherlich auf seinen abwechslungsreichen Lebensweg zurückzuführen ist. Seine ersten musikalischen Schritte machte Halvorsen als Militärmusiker, wobei er außer Geige auch Flöte sowie Kornett und andere Blechblasinstrumente lernte. In Kristiania (dem heutigen Oslo) verdiente er sein Geld als Geiger im Theater und setzte gleichzeitig sein Violinstudium fort. Weitere Stationen auf seinem Studien- und Berufsweg waren Stockholm, Leipzig, Aberdeen, Helsinki, St. Peters- burg und Lüttich. Als Komponist – und auch als äußerst erfolgreicher Dirigent – war Halvorsen weitgehend Autodidakt, aber er verarbeitete eine Vielzahl von Anregungen in seinen Werken. Außer der norwegischen Folklore und exotischen Elementen spielt die Barockmusik eine besondere Rolle. Die Sarabande mit Variationen über ein Thema von Georg Friedrich Händel ist eins von mehreren Stücken, in denen sich Halvorsen auf Musik des 18. Jahrhunderts bezieht, in diesem Falle auf die berühmte Sarabande aus der Cembalo-Suite d-Moll HWV 437 von Georg Friedrich Händel. Anfangs bleibt er dem barocken Stil treu, doch schon bald entwickelt sich eine fulminante Abfolge eigenwilliger und sehr origineller Ideen, ranken sich die Stimmen der beiden Instrumente immer fantasievoller und virtuoser umeinander – um dann zu einer sehr barocken Schlusssteigerung zu finden. 23 Samstag, 21. Juni 2014, 15.30 Uhr Weingut Georg Naegele Schloßstr. 27- 29, Hambach „à la française“ Edouard Dupuy (1770-1822) Frank Forst, Fagott Fagottquintett Allegro moderato Andante sostenuto Allegro Mandelring Quartett Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Georges Onslow (1784-1853) Mandelring Quartett Streichquartett g-Moll op. 9/1 Allegro Andante Menuetto Agitato Albert Roussel (1869-1937) Frank Forst, Fagott Jon Diven, Kontrabass Duo für Fagott und Kontrabass PAUSE Alphonse Stallaert (1920-1995) Saxophonquintett Amy Dickson, Saxophon Mandelring Quartett Introduction Intermezzo Scherzo Finale Ferdinand Thieriot (1838-1919) Serenade B-Dur für Bläserquintett Allegretto grazioso Allegro giocoso Andante lento Allegretto vivace anschließend: Buffet im Weingut Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Jörg Brückner, Horn Frank Forst, Fagott Wir danken dem Weingut Naegele für die Künstlerpräsente Eine schillernde Figur muss der Geiger, Sänger und Komponist Edouard Dupuy gewesen sein, ein Zeitgenosse Beethovens. An der Frage, wann und wo genau er geboren wurde, scheiden sich die Geister: Das schweizerische Neuchâtel und Südfrankreich werden häufig genannt. Fest steht, dass Dupuy in Paris seine Ausbildung absolviert hat – und dass er ein notorischer Querkopf war: Vom Musenhof des Prinzen Heinrich von Preußen in Rheinsberg soll er verbannt worden sein, nachdem er sich erdreistet hatte, zu Pferde zum Gottesdienst zu erscheinen; aus Schweden wies man den Konzertmeister der Königlichen Hofkapelle in Stockholm und erfolgreichen Opernsänger aus, nachdem er seiner Begeisterung für Napoleon allzu freien Lauf gelassen hatte. Und seine nächste Arbeitsstelle am Königlichen Theater in Kopenhagen, wo er in der Rolle des Don Giovanni Aufsehen erregt haben soll, war er los, als seine Liebesaffäre mit seiner Schülerin Charlotte Friederike, der Ehefrau des Kronprinzen, ans Licht kam. Später kehrte er nach Stockholm zurück und wurde eine der einflussreichsten Figuren des schwedischen Musiklebens. Mit Franz Preunmayr, dem Fagottisten der Hofkapelle, verband ihn eine enge Freundschaft, und man darf vermuten, dass dieser Dupuy zu seinen beiden konzertanten Werken für Fagott und dem Fagottquintett angeregt hat. Näheres zu den Entstehungsumständen ist nicht bekannt; dass der letzte Satz nicht von Dupuy, sondern aus der Feder des Oboisten Carl Anton Braun stammt, legt den Gedanken nahe, dass es kurz vor seinem Tod 1822 entstanden ist. Das Quintett ist jedenfalls ein effektvolles, frisches, lebendiges Stück, das dem Fagott freie Entfaltungsmöglichkeiten bietet, ohne die Streicher einzuengen. Den berühmtesten Jagdunfall der Musikgeschichte erlitt der Komponist Georges Onslow: Mit Mitte 40 traf ihn ein Streifschuss, in dessen Folge er auf dem linken Ohr ertaubte; er hat dies in seinem programmatischen Streichquintett „La balle“ verarbeitet. Ansonsten führte der Franzose aus altenglischem Adel ein eher beschauliches Leben in Clermont-Ferrand. Die Musik war ursprünglich nur ein Teil seiner Ausbildung als Sohn aus besserem Hause, und seine ersten Quintette schrieb er als Autodidakt. Sie hatten allerdings durchschlagenden Erfolg, und so beschloss Onslow, sich fortan diesem Gebiet zu widmen, und nahm Unterricht bei Anton Reicha in Paris. So wie dessen Name untrennbar mit dem Bläserquintett verbunden ist, steht Onslow für das Streichquintett, aber auch in verschiedenen anderen Kammermusik-Genres war er sehr produktiv. Drei Dutzend Streichquartette sind aus seiner Feder geflossen, und die frühen, zu denen auch die drei Quartette Opus 9 gehören, sind besonders interessant: In der Tradition der Wiener Klassik stehend, verraten sie doch eine eigene Handschrift, und sie lassen das Etikett „französischer Beethoven“, das Onslow von einem Zeitgenossen angeheftet wurde, verständlich erscheinen. Im Quartett g-Moll op. 9 Nr. 1, 1814 entstanden, setzt der Komponist seinen englischen Vorfahren ein Denkmal, mit vier hymnenartig feierlichen Variationen über „God Save the King“, die offenbar den Variationssatz aus Haydns „Kaiserquartett“ zum Vorbild haben. Auch die übrigen Sätze folgen dem klassischen Muster: ein energiegeladener Sonatensatz, ein schnelles Menuett mit Trio, in dem zunächst das Cello die Melodie vorstellt, und ein spritziges, rhythmisch betontes Finale mit auffälligen chromatischen Linien. Alle vier Sätze zeichnen sich durch ein komplexes Stimmengeflecht und überraschende Einfälle aus – genaues Hinhören lohnt sich! Albert Roussel gehört zu den Komponisten, deren Biographie auf den ersten Blick interessanter scheint als ihr Œuvre. Der Franzose, Zeitgenosse von Debussy und Ravel, hatte drei Passionen, die mit „M“ beginnen: Die Musik, die Mathematik und das Meer, und der letzteren widmete er zunächst als Marineoffizier sein Berufsleben. Auf hoher See beschäftigte er sich mit Harmonielehre und verfasste erste Kompositionen. Die Sehnsucht nach fremden Ländern ließ ihn auch nicht los, nachdem er den Dienst quittiert und mit 25 Jahren ein Kompositionsstudium begonnen hatte; er bereiste später Indien und Südostasien und ließ die Musik, die er dort kennen lernte, in seine Werke einfließen. Die sind nicht eben zahlreich, aber es ist ein vielseitiges Œuvre, und das Duo für Fagott und Kontrabass, entstanden 1925 für den Dirigenten und Kontrabass-Virtuosen Sergej Kussevitzkij anlässlich seiner Ernennung zum Chevalier de la Légion d‘Honneur, gehört zu den originellsten Werken, eine geistreiche Miniatur, in der eine schlichte Melodie den Boden für allerlei klangliche Effekte abgibt. Glissandi, Pizzicati, Flageolett-Töne, große Sprünge und unverdrossen liegende Töne münden in eine Art ironischer Verbeugung. Zwei Generationen trennen Alphonse Stallaert von Roussel; verwurzelt ist er aber in der Debussy-Ravel-Tradition. Ursprünglich stammt er aus den Niederlanden, wo er auf elterliches Drängen ein Jurastudium in Angriff genommen hatte. Er konnte seinem Vater aber die Erlaubnis abringen, für ein Jahr Musik zu studieren, und soll es geschafft haben, in dieser Zeit eine auf zwei Jahre angelegte Ausbildung in Komposition und Dirigieren mit Bravour zu absolvieren. Sir John Barbirolli lud ihn zur weiteren Ausbildung zu seinem Hallé-Orchester in Manchester ein, wenig später ging er, mit 100 Francs in der Tasche, nach Paris. Geldsorgen plagten Stallaert jahrelang, während er unter anderem bei Arthur Honegger weiterstudierte und ein Orchester mit jungen enthusiastischen Musikern gründete – das er wenig später aus finanziellen Gründen aufgeben musste. Aber er hatte schnell Erfolg, seine Werke wurden in Frankreich und in den Niederlanden von namhaften Ensembles gespielt. Ab 1960 widmete er sich ausschließlich dem Komponieren. In dieser Zeit entstand auch, als Auftragswerk des Saxophonisten George Goudet, das Saxophonquintett, ein dramatisches und sehr klangsinnliches Werk. Der erste Satz, in einer Art Rondo-Form, scheint mit „Introduction“ zu harmlos bezeichnet. Er stellt in dichtem Klanggewebe Saxophon und Streicher einander gegenüber; sein dunkles Thema und die charakteristische Basslinie markieren den Refrain. Einem „Intermezzo“ in Gestalt eines „Valse triste“ folgt ein imitatorisch beginnendes Scherzo, in dem die Bratsche neben dem Saxophon eine herausgehobene Rolle spielt; der Wechsel von kontrapunktischen und homophonen Abschnitten ergibt ein kaleidoskopisch buntes Bild. Das Finale weckt Assoziationen an einen Stummfilm. In das turbulente Geschehen bricht unvermittelt das Thema des ersten Satzes ein, es kann aber den unaufhaltsam dem Ende zu stampfenden Verlauf nicht zum Stillstand bringen. Den Namen Ferdinand Thieriot sucht man in Musiklexika vergeblich. Dabei hat er ein umfangreiches Œuvre hinterlassen, mit Opern, Kantaten, Orchester- und Kammermusik, Liedern, Klavierstücken, Chorwerken. Dass er in Vergessenheit geraten ist und erst in den letzten Jahren allmählich wiederentdeckt wird, hängt mit der Überlieferungsgeschichte zusammen: Sein Nachlass wurde zwar bereits kurz nach seinem Tod 1919 der Hamburger Staatsbibliothek übergeben, aber in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ins sächsische Lauenstein ausgelagert und dort von der Roten Armee beschlagnahmt. Erst 1991 fanden die Manu- skripte nach Hamburg zurück, wo Thieriot seinerzeit als einer der wichtigsten musikalischen Söhne der Stadt nach Brahms angesehen wurde. Mit diesem verbindet ihn außer dem ehrfurchteinflößenden Bart auch die Tatsache, dass er sein Berufsleben großenteils in Österreich verbrachte, als Direktor des Steiermärkischen Musikvereins in Graz. Dabei war anfangs keineswegs ausgemacht, dass er Musiker werden würde: Sein musikbegeisterter Vater, ein erfolgreicher Versicherungskaufmann, ließ ihm zwar eine gründliche Ausbildung angedeihen, aber da Ferdinand, wie ein zeitgenössischer Kritiker berichtet, die Musikstunden als eine höchst lästige Erfindung verdammte und weder am Klavierspiel sich entzücken, noch dem Violoncell einen hervorragenden Platz in dem sauren, täglichen Musikpensum einräumen wollte […], beschloss der Vater, aus dem widerspenstigen Orpheus einen tüchtigen Kaufmann zu machen. Aber seltsam, als der Knabe erst auf seinem Kontorbock saß, Briefe kopierte und Rechnungen schrieb, kam es ihm vor, als seien die „Täglichen Übungen für das Violoncell“ und die „Schule der Geläufigkeit“ gar nicht so übel … Die Begeisterung, mit der sich Ferdinand im zweiten Anlauf auf die Musik stürzte, hat ihn offenbar zeitlebens nicht mehr losgelassen, und sie spiegelt sich in vielen seiner Werke: heitere, spielerische Musik wie die Serenade B-Dur für Bläserquintett, deren vier Sätze, bis auf den langsamen mit seinem ausdrucksvollen Horn-Solo, durchwegs lebensfroh und unbeschwert wirken. Samstag, 21. Juni 2014, 20.00 Uhr Hambacher Schloss Festkonzert Ernö Dohnanyi (1877-1960) Thorsten Johanns, Klarinette Jörg Brückner, Horn Sebastian Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Paul Rivinius, Klavier Sextett C-Dur op. 37 Allegro appassionato Intermezzo: Adagio Allegro con sentimento Finale: Allegro vivace, giocoso Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Amy Dickson, Altsaxophon Frank Forst, Fagott Sebastian Schmidt, Violine Bernhard Schmidt, Violoncello Choros Nr. 7 PAUSE Ludwig van Beethoven (1770-1827) Septett Es-Dur op. 20 Adagio – Allegro con brio Adagio cantabile Tempo di menuetto Tema con variazioni: Andante Scherzo: Allegro molto e vivace Andante con moto alla marcia – Presto Thorsten Johanns, Klarinette Frank Forst, Fagott Jörg Brückner, Horn Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Jon Diven, Kontrabass PAUSE (mit kleinem Snack) Surprisekonzert Das Konzert wird vom SWR 2 mitgeschnitten und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Ernö Dohnányi, Pianist, Dirigent und Komponist, gehört zu den eindrucksvollsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte; mit seiner bewegten Biographie ließen sich dicke Bände füllen. 1877 geboren im heutigen Bratislava, folgte er dem Ruf an die Hochschule für Musik in Berlin, kehrte bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Ungarn zurück, wo er zu einer der einflussreichsten Figuren des Budapester Musiklebens wurde, suchte dann unter dem faschistischen Horthy-Regime verstärkt den Kontakt in die USA – dort wählte man ihn 1925 zum Chefdirigenten des New York State Symphony Orchestra – , und kehrte nach wenigen Jahren abermals nach Ungarn zurück. Als Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters Budapest schützte er, solange es ihm möglich war, die jüdischen Orchestermitglieder, flüchtete aber 1944 vor der Roten Armee ausgerechnet ins nationalsozialistisch besetzte Wien, was zum Ende seiner Karriere in Ungarn und Westeuropa führte; besonders bitter angesichts der Tatsache, dass sein Sohn Hans als einer der Widerstandskämpfer des 20. Juli hingerichtet worden war. Nach einem Intermezzo in Argentinien siedelte Dohnányi in die USA über, wo er 1955 eingebürgert wurde und 1960 starb. Als Komponist steht er bis heute im Schatten von Brahms, der sein Klavierquintett op. 1 mit den Worten gelobt haben soll: Das hätte ich selbst nicht besser machen können. Das Sextett C-Dur op. 37 entstand, als Dohnányi 1934 krankheitshalber ans Bett gefesselt war. Davon ist dem Werk allerdings nichts anzumerken, im Gegenteil: Es ist eine ausgesprochen kraft- und lebensvolle Komposition, wenn auch mit dunklem Grundton. Dem schwergewichtigen einleitenden Sonatensatz folgt ein „Intermezzo“, das kammermusikalisch durchsichtig, noch ohne die Bläser, beginnt, dann aber in einen düsteropulenten Marsch von zunehmend sinfonischem Gestus übergeht; er wird von einem lyrisch-zärtlichen Abschnitt unterbrochen und verklingt schließlich sanft. Ein schlichtes Klarinetten-Solo leitet den dritten Satz ein, in dem sich lyrische Passagen und mendelssohnhafte Scherzo-Abschnitte abwechseln. Ein lebenssprühendes Finale schließt sich unmittelbar an, mit Anklängen an den Jazz der 20er Jahre, den Dohnányi in den USA kennen gelernt hatte (aber nicht mochte) und einem Walzer; es schließt mit grandioser Geste. Die klassische Musik Lateinamerikas ist hierzulande terra incognita; ein einziger Komponist hat es zu einiger Popularität gebracht: der Brasilianer Heitor Villa-Lobos. Und genau betrachtet mit einem einzigen seiner über 1000 Werke: der „Bachiana Brasilieira“ Nr. 5 für Sopran und acht Celli. Dass er in Europa überhaupt eine Rolle spielt, hat Villa-Lobos, neben seinen kompositorischen Fähigkeiten, drei Faktoren zu verdanken: seiner publikumswirksamen Synthese aus abendländischer Kunstmusik und brasilianischer Folklore, seinem zweiten Aufenthalt in Paris 1927, der einen durchschlagenden Erfolg brachte – und seiner Begabung zur Selbststilisierung. Die Europäer, das erkannte er schnell, interessierten sich für das exotische Flair seiner Musik, und so komponierte er seine „brasilianischen“ Stücke vor allem nach seinem ersten Besuch in Paris. Die Reisen, auf denen er angeblich als Jugendlicher im Norden Brasiliens traditionelles Material sammelte, werden von den Biographen eher ins Reich der Fantasie verwiesen. Aber tatsächlich hat sein Vater, Bibliothekar und ambitionierter Laienmusiker, dafür gesorgt, dass er nicht nur mit europäischer Klassik, sondern auch mit brasilianischer Folklore in Berührung kam. Nach dem frühen Tod des Vaters verdingte sich Villa-Lobos als Cellist in Theatern und Kinos, trat aber auch mit populären Musikgruppen auf, in denen er Gitarre, Klarinette oder Saxophon spielte. In einer seiner berühmtesten Werkserien hat er den Choro zur Vorlage genommen, jene Form der Unterhaltungsmusik, die europäische Modetänze wie Polka, Walzer, Mazurka mit brasi- lianischer Musikkultur verband und in den Salons der Mittel- und Oberschicht ebenso wie in den Vorsälen der Kinos, auf Bällen und in Bars zu hören war. Villa-Lobos schafft daraus etwas ganz Eigenes, eine, wie er sagte, neue Form des Komponierens, bei der die verschiedenen Formen indigener und volkstümlicher Musik Brasiliens zusammengefügt werden. Die Hauptelemente sind der Rhythmus und unterschiedlichste Volksmelodien, die dann und wann auftauchen und immer vom Komponisten verändert werden. […] Der Begriff „Serenade“ vermittelt eine ungefähre Idee dessen, was mit Choros gemeint ist. Die insgesamt 14 Choros sind sehr unterschiedlich in Besetzung, Länge und Ausdruck. Choros Nr. 7 zeichnet sich durch starke Kontraste aus. Die treibenden Rhythmen erinnern entfernt an Strawinskijs „Sacre du printemps“; es folgen klagende Melodien, ein Walzer, im Fagott angestimmt, Anklänge an konzertante Musik, kurz, eine bunte Folge von Stimmungen, in denen die farbenreiche Besetzung ausgeschöpft wird, bis dahin, dass die gezupfte Violine das Cavaquinho, ein typisches Instrument der ChoroEnsembles, imitiert – das Ganze in lockerer, improvisatorischer Anmutung. Die Verbindung unterschiedlicher musikalischer Sphären schafft auch das Septett Es-Dur op. 20 von Ludwig van Beethoven: die von kunstvoller Sonatenform und Serenade, widergespiegelt in der Konstruktion aus vier gewichtigen Sonatensätzen (Kopfsatz und Finale in sinfonischer Manier mit langsamer Einleitung) mit eingeschobenen divertimentohaften Mittelsätzen. Manche Autoren vermuten, das Werk sei von der Widmungsträgerin Maria Theresia höchstselbst in Auftrag gegeben worden, denn die Kaiserin besaß eine kleine Sammlung von Septetten in teils kuriosen Besetzungen, wie dasjenige für Violine, Xylophon, Harfe, Piccoloflöte, Schalmei, Tamburin und Violoncello eines gewissen Ignaz Schweigl. Beethovens Instrumentenauswahl erscheint demgegenüber geradezu konventionell. Ein Vorläufer ist indessen nicht bekannt – ebenso wenig das genaue Entstehungsdatum. Erstmals öffentlich aufgeführt wurde das Septett im April 1800 in einem von Beethoven selbst veranstalteten Konzert im Hofburgtheater. Und der Erfolg war von Anfang an überwältigend. Mein Septett schikt ein wenig geschwinder in die welt, drängte der Komponist seinen Verleger Hoffmeister, weil der Pöbel drauf harrt […] – drum spudet euch. Wenig später distanzierte sich Beethoven von dem unterhaltsamen Werk; sein Sep- tett konnte er nicht leiden und ärgerte sich über den allgemeinen Beifall, den es erhielt, erinnerte sich sein Schüler und Biograph Carl Czerny – was den Meister allerdings nicht daran hinderte, eigenhändig eine Klaviertrio-Fassung herzustellen und nachträglich Metronomzahlen zu veröffentlichen. Und vielleicht hat er sich doch über die lobenden Worte im „Allgemeinen musikalischen Anzeiger“ 1826, im Jahr vor seinem Tod, gefreut, der von einem melodiereichen Werk von herrlicher Wirkung sprach, welches allein hinreichen könnte, des trefflichen Beethoven frühe Periode zu bezeichnen. 31 Sonntag, 22. Juni 2014, 11.00 Uhr Weingut Müller-Kern Andergasse 38, Hambach „Mozart im Weingut” Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Streichquartett A-Dur KV 464 Allegro Menuetto – Trio Andante Allegro non troppo Wolfgang Amadeus Mozart Mandelring Quartett Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Amy Dickson, Saxophon Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Oboenquartett F-Dur KV 370 (in einer Bearbeitung für Saxophon) Allegro Adagio Rondeau: Allegro PAUSE Wolfgang Amadeus Mozart Aus der Harmoniemusik zu „Così fan tutte“ KV 588 (bearbeitet für Bläserquintett von Ulf-Guido Schäfer) Ouverture Ah guarda sorella Soave sia il vento Come scoglio immoto resta Un’ aura amorosa Benedetti i doppi conjugi Wolfgang Amadeus Mozart Serenade für Streichquintett G-Dur KV 525 „Eine kleine Nachtmusik“ Wally Hase, Flöte Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Jörg Brückner, Horn Frank Forst, Fagott Mandelring Quartett Jon Diven, Kontrabass Allegro Romanze: Andante Menuett: Allegretto Rondo: Allegro anschließend: Winzerbraten des Weinguts Müller-Kern Wir danken dem Weingut Müller-Kern für die Künstlerpräsente Ein Vater, der entschlossen, seine Kinder in die große Welt zu schicken, so schrieb Wolfgang Amadeus Mozart 1785 im Widmungsvorwort zu seinen als Opus 10 veröffentlichten Streichquartetten, wird sie natürlich der Obhut und Führung eines daselbst hochberühmten Mannes anvertrauen, zumal es das Glück will, daß dieser sein bester Freund ist. Berühmter Mann und mein teuerster Freund, nimm hier meine Kinder! Sie sind wahrhaftig die Frucht einer langen, mühevollen Arbeit. Der hochberühmte Mann war Joseph Haydn, daher heute der Name „Haydn-Quartette“, und er hat die drei letzten der ihm anvertrauten Kinderschar bei einer Soiree im Hause Mozart kennen gelernt; der stolze Vater Leopold überlieferte seinen Ausspruch: Ich sage ihnen vor gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der größte Componist, den ich von Person und dem Nahmen nach kenne. Eindrucksvolle Worte des berühmtesten Tonsetzers seiner Zeit über einen 29-Jährigen. Der hatte sich Haydns Opus 33 zum Vorbild genommen, das heute als Prototyp des klassischen Streichquartetts gilt, erweiterte die Form aber erheblich – was bei vielen Zeitgenossen auf Unverständnis stieß: Man sagt von den 6 Mozartschen Quartetten, daß sie zum totlachen seyen; sie stimmen gar nicht, berichtet selbst Beethoven, der seinerseits gerade das fünfte, das A-Dur-Quartett KV 464, sehr schätzte und eigenhändig eine Partitur davon anfertigte. Es ist ein heiteres Werk, in der Tonart, die Mozart in seinen Opern oft für Liebesbeteuerungen verwendet, höchst kunstvoll, namentlich in der Kontrapunktik der beiden Ecksätze, und versehen mit kleinen Überraschungen, die an Haydns musikalischen Witz erinnern, wie die unerwartete Generalpause im zweiten Teil des Menuetts. Im Adagio, für den Mozart-Experten Wolf-Dieter Seiffert einer der schönsten und elegantesten Variationssätze der Musikgeschichte, blitzt typisch Mozartscher Humor auf, wenn in der sechsten und letzten Variation der perkussive Begleitrhythmus, der zunächst im Cello erscheint und dann durch die Stimmen wandert, fanfarenartige Impertinenz entwickelt. Ein hoher künstlerischer Anspruch, wie er die „Haydn-Quartette“ auszeichnet, verbindet sich im Oboenquartett F-Dur KV 370 mit konzertanter Unterhaltsamkeit. Es ist einige Jahre früher entstanden, Anfang 1781 in München. Dorthin war Mozart gereist, um seine Oper „Idomeneo“ einzustudieren, und dorthin war einige Jahre zuvor die berühmte Mannheimer Hofkapelle umgezogen. Für deren Oboisten Friedrich Ramm ist das Quartett entstanden. Er galt als einer der führenden Oboisten der Zeit, gerühmt für seinen schönen, runden, sanften und wahren Ton. Das „Baierische Musik-Lexikon“ von 1811 berichtet, er habe einen sehr gefühlvollen Vortrag im Adagio, wisse aber auch Geist und Feuer in dasselbe zu legen, wenn der Effekt und die Begeisterung es erfordern. Beides, gefühlvollen Vortrag und Geist und Feuer, verlangt das Quartett, das Mozart ihm auf den Leib geschrieben hat. Die Oboe, die im langsamen Satz sogar eine Kadenz zu improvisieren hat, ist hier in Konzert-Manier den Streichern gegenübergestellt – die allerdings keineswegs zu bloßer Begleitung degradiert werden –, und ihr wird höchste Virtuosität abverlangt, mit Läufen, riesigen Sprüngen und Spitzentönen, die mit dem dreigestrichenen f an die Grenze des seinerzeit Möglichen stoßen. Etwa in der Mitte des Finales hat Mozart eine Kuriosität eingebaut: Die Oboe wechselt plötzlich in einen Viervierteltakt, was zu dem durchgehenden Sechsachteltakt der Streicher nicht passt und den Oboisten gehörig ins Stolpern bringen könnte – vielleicht, so wurde gelegentlich vermutet, ein Scherz, den sich der Komponist mit dem berühmten Virtuosen Ramm erlaubte. Dies würde jedenfalls zu dem fröhlichen Werk passen, das lediglich im langsamen Satz eine melancholische Note erhält – dessen Nähe zu einer Klagearie nach Art der kurz zuvor entstandene Oper „Idomeneo“ wird immer wieder konstatiert. Geradewegs hinein in die Welt der Oper führt die Harmoniemusik zu „Così fan tutte“ – zu Deutsch: „So machen‘s alle oder Die Schule der Liebenden“ –, jener schwer zu deutenden Verwechslungskomödie um die Untreue der Frauen, in der einige von Mozarts schönsten Melodien versammelt sind. Harmoniemusiken, Arrangements für sechs oder acht Blasinstrumente, erfreuten sich in der Zeit um 1800 größter Beliebtheit. Jeder Fürst, der etwas auf sich hielt, leistete sich eine Bläsertruppe, eine „Harmonie“, die ein farbenreiches Klangspektrum bot und darüber hinaus sehr variabel einsetzbar war: bei der Jagd, bei geselligen Ausflügen und Militärparaden ebenso wie im Gottesdienst, bei Bällen und in Kammerkonzerten. Und diese „Orchester des kleinen Mannes“ ermöglichten es selbst an den entferntesten Höfen des Habsburger-Reiches, die Melodien der populären Opern wieder und wieder zu hören – das Arrangieren erwies sich als ertragreiche Einkommensquelle. Nun habe ich keine geringe arbeit. Bis Sonntag acht Tag muss meine Opera [„Die Entführung aus dem Serail“] auf die harmonie gesezt seyn, sonst kommt mir einer bevor – und hat anstatt meiner den Profit davon, schreibt Mozart im Juli 1782 an seinen Vater. Der Bearbeiter der Version von „Così fan tutte“, die heute zu hören ist, machte Mozart indessen keine Konkurrenz: Sie stammt von Ulf-Guido Schäfer, dem Klarinettisten des Ma‘alot Quintetts, der in seinem Einführungstext zur CD-Aufnahme schreibt, trotz der reichen Bläsersätze in der Oper sei eine Imitation des Originals überflüssig, vielmehr erscheine es notwendig, daß sich eine Bearbeitung weit vom Original entfernt, sich verselbständigt und einen eigenen Charakter annimmt. Das ist Schäfer gelungen, der überdies dem Hörer ebenso viel Vergnügen wünscht, wie es die Musiker beim „Verkleiden, Rollentauschen, Singen und Verführen“ gehabt hätten. Nicht nur Harmoniemusiken dienten der gehobenen Unterhaltung, auch Streicher konnten bei einer festlichen Tafel oder an lauen Sommerabenden im Freien musikalische Genüsse bescheren. Zu welchem Anlass die „Kleine Nachtmusik“ KV 525 entstanden ist, weiß man allerdings nicht, ebenso wenig, ob Mozart eine kammermusikalische Besetzung oder ein kleines Orchester, die heute üblichere Besetzung, im Sinn hatte. Gesichert erscheint lediglich, dass diese kürzeste seiner Serenaden 1787 in Wien entstanden ist, just während der Arbeit an „Don Giovanni“. Und Anklänge an die Oper, allerdings an eine andere, enthält auch dieses Werk: Die Romanze erinnert deutlich an die Arie des Belmonte „Wenn der Freude Tränen fließen“ aus der „Entführung aus dem Serail“. Ansonsten präsentiert sich die „Kleine Nachtmusik“ als schlichtes und gerade dadurch so eminent wirkungsvolles Werk, mit simpler achttaktiger Periodenstruktur, einfachen Harmonien, äußerst einprägsamer Melodik – und einem Zauber, der bis heute seine Wirkung entfaltet. Sonntag, 22. Juni 2014, 18.00 Uhr Hambacher Schloss Festliches Finale Alexander Glasunow (1865-1936) Amy Dickson, Saxophon Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Jon Diven, Kontrabass Konzert für Saxophon und Streicher Première partie: Allegro moderato Canzone variée: Andante Final: Allegro André Caplet (1878-1925) Amy Dickson, Saxophon Nick Deutsch, Oboe Thorsten Johanns, Klarinette Frank Forst, Fagott Mandelring Quartett Jon Diven, Kontrabass „Légende“ PAUSE Franz Schubert (1797-1828) Quintett A-Dur D 667 „Forellenquintett“ Allegro vivace Andante Scherzo: Presto – Trio Thema mit Variationen: Andantino – Allegretto Finale: Allegro giusto Paul Rivinius, Klavier Sebastian Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Jon Diven, Kontrabass Ausklang mit den Künstlern bei Sekt und Brezel Das Konzert wird vom SWR 2 mitgeschnitten und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Wir danken dem Weingut Weegmüller für die Künstlerpräsente Ich versuche also, ein Nilpferd aus dem Sumpf meiner Erinnerungen zu ziehen. Es heißt Glasunow, dieses gütige, freundliche und hilfsbereite Nilpferd. Dmitrij Schostakowitsch, der dies in Anlehnung an einen russischen Kinderreim formulierte, hat Alexander Glasunows Güte und Hilfsbereitschaft am eigenen Leib erfahren – fand doch Glasunow, damals Direktor des berühmten St. Peterburger Konservatoriums, seine Musik abscheulich, erkannte aber Schostakowitschs überragende Begabung und setzte sich vehement für ihn ein. Überhaupt war er ein äußerst engagierter Pädagoge, der seine Studenten nach Kräften förderte. Gütig, freundlich, hilfsbereit, stets mit einer Zigarre zwischen den wurstigen Fingern, berühmt seit der Aufführung seiner ersten Sinfonie, die er als 16-Jähriger komponiert hatte, ausgestattet mit einem phänomenalen Gedächtnis und einem außergewöhnlich guten Gehör, imstande, nahezu jedem Instrument brauchbare Töne zu entlocken, war Glasunow eine der prägenden Figuren des russischen Musiklebens. Selbst nach der Oktoberrevolution, als viele Musiker aus seinem Umfeld emigrierten, behauptete er seinen Platz im kulturellen Leben; erst 1928 nutzte er einen Aufenthalt in Wien mit seiner Familie zur Flucht. In der Musikmetropole Paris, am Ziel seiner Träume, entkam er auch dem Alkohol, den er in ungeheuren Mengen in seinen massigen Körper hineingeschüttet hatte. Indessen forderte die jahrelange Trunksucht ihren Tribut. Trotz allerlei Gebrechen komponierte Glasunow unablässig: Noch zwei Jahre vor seinem Tod, im Winter 1933/34, schrieb er auf Bitten des Virtuosen Sigurd Raschèr und in enger Zusammenarbeit mit ihm das Konzert für Saxophon und Streicher – heute das berühmteste klassische Werk für das Instrument. Es ist ein heiteres, unbeschwertes Stück, ebenso weit entfernt von der damaligen Avantgarde wie vom Jazz – den Glasunow durchaus schätz- te. In einem Satz, aber voller Tempo- und Ausdruckswechsel, rhapsodisch angelegt, bringt es alle Qualitäten zur Geltung, die den Ausnahme-Saxophonisten Raschèr auszeichneten: weiche, sonore Klänge ebenso wie funkelnde Tonkaskaden. In eine gänzlich andere Welt führt die „Légende“ von André Caplet: flirrend, geheimnisvoll, verschattet, in der impressionistischen Farbpalette Debussys gehalten, dem Caplet eng verbunden war. Er galt als der beste Dirigent von dessen Werken, orchestrierte große Teile seines „Martyre de Saint Sébastien“ und war einer der wenigen Freunde, die dem schwierigen Komponisten bis zu seinem Tod die Treue hielten. Entstanden ist die „Légende“ 1903 als Auftragswerk der in Boston lebenden Amateur-Saxophonistin Elisa Hall, die jungen Musikern aus ihrer französischen Heimat in den USA eine Plattform zu verschaffen suchte; außer Caplet haben auch Debussy, d‘Indy und andere für sie komponiert. Das Werk wirkt sehr persönlich, Ausdruck möglicherweise der tiefen Religiosität, die Caplets Musik insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg prägen sollte. Er meldete sich als Freiwilliger, wurde durch Gas verwundet und starb vermutlich aufgrund dessen bereits mit 46 Jahren. In den sakralen Ton zu Anfang des Werkes mischen sich zunehmend düstere Klänge. Sie wirken wie die Illustration eines unheimlichen Geschehens, vergleichbar Caplets berühmter Fantasie „Le masque de la mort rouge“ nach Edgar Allan Poe. Nach der Wiederkehr des träumerischen Anfangsteils und einem letzten Aufbäumen verschwindet das Stück im Nichts. Einen dunklen Unterton haben viele Kompositionen von Franz Schubert, namentlich die späte Streicher-Kammermusik – nicht aber das Quintett A-Dur D 667, das „Forellenquintett“: In lichtem A-Dur versprüht es überschwängliche Lebensfreude. Die Gelehrten streiten sich darüber, wann genau es entstanden ist: Stilistische Eigentümlichkeiten sprechen für 1823 – das wäre die Zeit, in der sich Schuberts Syphilis-Erkrankung bemerkbar machte; im folgenden Jahr sollte er sich in einem erschütternden Brief als den unglücklichsten, elendsten Menschen auf der Welt bezeichnen. Vielfach wird aber auch das Jahr 1819 genannt, genauer noch eine Reise in jenem Jahr, die zu den unbeschwertesten Ereignissen in Schuberts Leben gehört haben dürfte. Damals nahm ihn der Sänger Johann Michael Vogl, Mittelpunkt der späteren „Schubertiaden“ und als Interpret ein leidenschaftlicher Fürsprecher seiner Lieder, mit in seine oberösterreichische Heimat, nach Steyr. Überall wurde er freundlich aufgenommen und allem Anschein nach auch kostenlos bewirtet, schreibt der Schubert-Biograph Ernst Hilmar. Und er lernte den Amateur-Cellisten Sylvester Paumgartner kennen, der regelmäßig Hauskonzerte veranstaltete – und der, wie wiederum Albert Stadler, Freund aus Konviktszeiten, berichtet, über das köstliche Liedchen „Die Forelle“ ganz entzückt war. Das Quintett soll auf seine Anregung zurückgehen. Dabei bildet der Variationen-Satz, anders als etwa im Quartett „Der Tod und das Mädchen“, keineswegs den Mittelpunkt des Werkes. Der Schwerpunkt liegt auf dem ersten Satz, der sich nach der vorsichtig tastenden Einleitung zu einem brillanten Sonatensatz entwickelt. Es schließt sich die traditionelle Abfolge an: ein inniger langsamer Satz – mit ungewöhnlich farbiger Harmonik –, ein geistreiches Scherzo mit kontrastierendem Trio, dem der Variationen-Satz folgt, und ein Finale in volkstümlich Duktus, das mit Anklängen an den Kopfsatz und vor allem an das Forellen-Thema für eine geschlossene Form sorgt. Vieles ließe sich noch über die kunstvolle Faktur des Werkes sagen, man kann es aber auch mit Albert Einsteins Diktum über Schubert halten: Musizieren, lieben – und Maul halten! E VA B L A S K E W I T Z Die Künstler Mandelring Quartett Sebastian Schmidt, Violine Nanette Schmidt, Violine Roland Glassl, Viola Bernhard Schmidt, Violoncello Suche nach musikalischer Wahrheit Die Frankfurter Allgemeine Zeitung konstatierte schon 2008, das Mandelring Quartett habe das Zeug, an die Stelle des Alban Berg Quartetts zu treten. Mit Bezug auf den Schostakowitsch-Zyklus bei den Salzburger Festspielen sah das führende österreichische Kulturmagazin „Die Bühne“ das Mandelring Quartett als Erben des legendären Borodin-Quartetts und das renommierte Musikmagazin Fono Forum zählt das Mandelring Quartett zu den sechs besten Streichquartetten der Welt. Markenzeichen des Mandelring Quartetts ist seine Expressivität und phänomenale Homogenität. Die vier Individualisten verschmelzen im gemeinsamen Willen, stets nach dem Kern der Musik zu suchen und sich der musikalischen Wahrheit zu stellen. Durch Erfassen der geistigen Dimension, Ausloten der emotionalen Extreme und Arbeit am Detail machen die Musiker die Vielschichtigkeit der Werke erlebbar. Dabei ist ihr Zugang zur Musik immer emotional und persönlich. Der Gewinn großer Wettbewerbe – München (ARD), Evian (Concours International de Quatuor à Cordes) und Reggio Emilia (Premio Paolo Borciani) – war der Einstieg in die internationale Karriere. Konzertreisen führen das Ensemble in europäische Musikzentren wie Amsterdam, Brüssel, London, Madrid, Paris und Wien. Die Metropolen New York, Washington, Los Angeles, Vancouver und Tokio finden sich ebenso im Konzertkalender wie regelmäßige Tourneen nach Mittel- und Südamerika, in den Nahen Osten und nach Asien. Das Quartett ist zu Gast beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Oleg Kagan Musikfest, den Festivals in Montpellier, Lockenhaus und Kuhmo, dem Enescu-Festival Bukarest und bei den Salzburger Festspielen. Zahlreiche mit Preisen der Deutschen Schallplattenkritik und International Classical Award-Nominierungen ausgezeichnete CDAufnahmen zeigen die außergewöhnliche Qualität und das breite Repertoire des Quartetts. So wurde die Einspielung der Streichquartette von Schostakowitsch vielfach mit Preisen ausgezeichnet und von der Presse als eine der herausragenden Gesamteditionen unserer Zeit beurteilt. Produktionen mit Werken von Schubert und Schumann wurden als neue Referenzaufnahmen gewürdigt, und auch die Aufnahme der Streichquartette von Leoš Janáček erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Aktuelles Projekt ist die Gesamteinspielung der Streicherkammermusik von Mendelssohn auf vier CDs. 1997 vom Mandelring Quartett ins Leben gerufen, ist das HAMBACHERMusikFEST, jedes Jahr ein Treffpunkt für Kammermusikfreunde aus aller Welt. Seit 2010 gestaltet das Mandelring Quartett eigene Konzertreihen in der Berliner Philharmonie und in seiner Heimatstadt Neustadt an der Weinstraße. Das Mandelring Quartett führte mehrfach Zyklen mit allen 15 Schostakowitsch-Quartetten auf – unter anderem in Berlin und bei den Salzburger Festspielen. Die Künstler Jörg Brückner, Horn Jörg Brückner wurde 1971 in Leipzig geboren und begann seine Ausbildung als Hornist 1985 an der Spezialschule für Musik „Belvedere“ in Weimar. Es folgte von 1989-1992 das Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bei Rainer Heimbuch und Karl Biehlig sowie in Leipzig bei Hermann Märker. Nach Abschluss des Studiums wurde Jörg Brückner 1992 als 3. Hornist im Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur engagiert und wechselte 1997 als Solohornist zur Dresdner Philharmonie. Als Solist trat er mit der Dresdner Philharmonie, dem Bachorchester Leipzig und dem Dresdner Kammerorchester auf. Er spielte Solokonzerte unter der Leitung von Jeffrey Tate, Walter Weller, Simone Young und Rafael Frühbeck de Burgos. Seit 1997 ist Jörg Brückner Mitglied im Blechbläserensemble „Brass partout“ und im „Carus“-Ensemble Dresden. In verschiedenen bedeutenden Orchestern wie dem Orchester des Bayerischen Rundfunks, der Staatskapelle Dresden, dem Orchestre National de Paris und dem Tonhalle Orchester Zürich war er als Aushilfe tätig. 2009 spielte der Künstler während der Salzburger Osterfestspiele bei den Berliner Philharmonikern Solohorn. Seit 2006 hat Jörg Brückner eine Professur für Horn an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar inne. Er ist heute Solohornist der Münchner Philharmoniker. Die Künstler Nick Deutsch, Oboe Nick Deutsch, 1972 in Israel geboren, begann bereits mit 13 Jahren sein Studium am Musikkonservatorium in Sydney. Am Victorian College of the Arts in Melbourne machte er 1993 seinen Abschluss und wurde als der beste Student mit dem „Gwen-Nisbet-Preis“ ausgezeichnet. Ein Stipendium ermöglichte ihm weitere Studien bei Diethelm Jonas an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Als Solooboist arbeitete er mit großen Orchestern und Ensembles wie z. B. dem Chamber Orchestra of Europe, den Münchner Philharmonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, den Radio-Symphonie-Orchestern von Frankfurt, Köln, Stuttgart, Berlin und München sowie mit den Opernorchestern München, Berlin, Dresden, Bayreuth, Stuttgart – um nur einige zu nennen – unter berühmten Dirigenten wie Zubin Mehta, James Levine, Kurt Masur, Lorin Maazel, Gustavo Dudamel, Semyon Bychkov und Ivan Fischer. Nick Deutsch tritt regelmäßig als Solooboist mit dem Israel Philharmonic Orchestra auf und war 2004 bis 2012 Mitglied des Budapester Festival-Orchesters. Als Solist trat er mit der Camerata Salzburg, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Bach Kollegium Stuttgart, dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester, der Polnischen Kammerphilharmonie, der Real Filharmonia de Galicia (Spanien) und dem Münchener Kammerorchester auf. Nick Deutsch konzertierte im Rahmen bekannter internationaler Musikfestivals wie den Salzburger Festspielen, dem Edinburgh International Festival, den BBC Proms, dem Rheingau Musik Festival, dem Prager Frühling, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker und mehreren Musikfestivals in Japan, Korea, Israel und Australien. Als begehrter Kammermusikpartner ist er Gründungsmitglied des Hindemith-Quintetts in Frankfurt am Main und tritt mit dem Ensemble Modern, dem Linos Ensemble und der von András Schiff gegründeten „Cappella Andrea Barca“ auf. Von 2003 bis 2010 war Nick Deutsch Solooboist des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters. An der Hochschule für Musik Mainz war er von 2004 bis 2010 Professor für Oboe, seit 2010 ist er in gleicher Position an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig tätig. Die Künstler Amy Dickson, Saxophon Die Saxophonistin Amy Dickson begann im Alter von 6 Jahren mit dem Musikunterricht und feierte 10 Jahre später ihr Konzertdebüt. Die Künstlerin ist wegen ihres bemerkenswerten und unverwechselbaren Tones und ihrer außergewöhnlichen Musikalität allgemein anerkannt. Sie tritt weltweit als Solistin mit vielen Orchestern auf – unter anderem mit dem Sydney Symphony Orchestra, dem Wiener Kammerorchester und dem London Philharmonic Orchestra in Konzertsälen wie der Wigmore Hall, der Royal Albert Hall und dem Sydney Opera House. Amy Dickson wurde in Sydney geboren, wo sie mit dem Ku-Ring-Gai Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Henryk Pisarek debütierte. Anschließend wurde sie mit der „James Fairfax Australian Young Artist of the Year“-Medaille ausgezeichnet. An ihrem 18. Geburtstag nahm sie Dubois‘ Divertissement mit dem Sydney Symphony Orchestra unter John Harding auf. Im folgenden Jahr ging Amy Dickson nach London, wo sie mit Hilfe des „Jane Melber“-Stipendiums am Royal College of Music bei Kyle Horch und danach am Conservatorium van Amsterdam bei Arno Bornkamp studierte. In dieser Zeit gewann Amy Dickson als erste Saxophonistin überhaupt bedeutende Wettbewerbe wie den „Royal Overseas League“-Wettbewerb (Goldmedaille), den „Symphony Australia Young Performer of the Year“-Wettbewerb und den Londoner „Prince’s Prize“. Amy Dickson hat drei Alben bei Sony Music aufgenommen: „Smile“, „Glass Tavener Nyman“ und „Dusk & Down“. Letzteres erreichte die Nummer Eins in den britischen Klassik-Charts. Das Album „Smile“ veranlasste das renommierte englische Fachmagazin „The Gramophone“ zu folgender Beur- teilung ihres Spiels: Sie hat einen individuellen und ungewöhnlichen Ton, saftig, seidenweich, sinnlich und zuweilen aufreizend … Amy Dickson hat eine Reihe von Welturaufführungen auf CD eingespielt, unter anderem Holbrookes Saxophonkonzert und Bennetts „Seven Country Dances“ mit dem Royal Scottish National Orchestra. Mit dem Melbourne Symphony Orchestra nahm sie Williams „Escapades“ und Carmens Konzert für Saxophon auf. Im Jahr 2012 wurde Edwards „Full Moon Dances“ live in der Oper von Sydney aufgezeichnet und im Jahr 2014 veröffentlicht. Amy Dickson fühlt sich der Weiterentwicklung eines modernen Repertoires für Saxophon verpflichtet und gibt immer wieder neue Werke in Auftrag oder arrangiert Werke aus dem Fundus anderer Instrumente neu. Amy Dickson, die heute in London lebt, ist Botschafterin der „Australian Children’s Music Foundation“. 45 Die Künstler Jon Diven, Kontrabass Nachdem der aus Texas stammende Bassist Jon Diven seine musikalische Ausbildung zunächst an Saxophon und Tuba begonnen hatte, absolvierte er ein Kontrabassstu- dium an der renommierten Eastman School of Music in Rochester, New York, das er mit dem Masters-Diplom abschloss. Sogleich folgten Engagements im Rochester Philharmonic Orchestra und an den Theatern St. Gallen und Stuttgart. Als Kontrabassist und E-Bassist spielte er sieben Jahre in den Musicals „Miss Saigon“, „Die Schöne und das Biest“ (Stuttgart) sowie in „Der Glöckner von Notre-Dame“ (Berlin). Jon Diven erhielt Einladungen zum Rheingau Musik Festival und vielen weiteren in- und ausländischen Festivals. Er wirkte zudem bei der Deutschen Oper Berlin, den Berliner Symphonikern, im Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern und als Tourbassist des belgischen Stars Helmut Lotti mit. Zur Zeit ist Jon Diven Solobassist der Philharmonie Merck in Darmstadt und Mitglied der Heidelberger Sinfoniker. Außerdem bildet er mit der Schweizer Harfenistin Ulrike Neubacher „Das etwas andere Duo“. In Neustadt ist Jon Diven bekannt durch seine Mitwirkung beim 14. HAMBACHERMusikFEST. Die Künstler Frank Forst, Fagott Frank Forst wurde 1969 in Aalen geboren. Mit elf Jahren erhielt er seinen ersten Fagottunterricht. Ein Jahr später wurde er Privatschüler von Gerhard Hase in Stuttgart und gewann während dieser Zeit den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. 1989 - 1992 folgte ein Studium an der Musikhochschule Hannover bei Prof. Klaus Thunemann. 1991 wurde Frank Forst Preisträger des internationalen Musikwettbewerbs „Prager Frühling“ und Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs mit anschließender Aufnahme in die Bundesauswahl „Konzerte junger Künstler“. Von 1990 - 1992 war er Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie. 1992 wurde er als Solofagottist des Berliner Sinfonie-Orchesters berufen und begann 1997 als Solofagottist zusätzlich eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Camerata Salzburg. Seitdem folgten auch Soloauftritte mit dem Philharmonischen Orchester Bremen, der Staatsphilharmonie RheinlandPfalz, der Nordwestdeutschen Philharmonie, der Camerata Europea, dem California Youth Symphony Orchestra und dem Neuen Berliner Kammerorchester. Frank Forst ist zudem Mitglied des Euphorion-Ensembles und war bereits 2008 beim 12. HAMBACHERMusikFEST zu hören. 1996 übernahm er zunächst einen Lehrauftrag an der Musikhochschule „Hanns Eisler“, Berlin und 2002 eine eigene Fagottklasse an der Musikhochschule Franz Liszt Weimar. Wenig später wurde er dort zum Professor berufen. Daneben gibt Frank Forst Meisterkurse in Deutschland, Griechenland, Luxemburg, Ungarn, Spanien, China, Japan und den USA. Die Künstler Wally Hase, Flöte Die Flötistin Wally Hase wurde in Freiburg im Breisgau geboren und war Schülerin von Prof. Karl Friedrich Mess. 1986 begann sie bei ihm ihr Studium an der Hochschule für Musik in Stuttgart, nachdem sie im gleichen Jahr ein Stipendium zum Weltjugendorchester in die USA geführt hatte. Ihr Studium setzte sie bei Prof. Jean-Claude Gérard und Prof. Aurèle Nicolet fort. Als Mitglied im Festspielorchester Ludwigsburg unternahm Wally Hase Tourneen nach China, Japan und Südamerika. 1989 konzertierte sie in Neuseeland beim „Festival of the Arts“. 1990 war sie Stipendiatin der Richard- Wagner-Gesellschaft Bayreuth. Zwischen 1990 und 1993 war sie Mitglied im Karlsruher „Ensemble 13“ sowie im Bach Collegium Stuttgart unter der Leitung von Helmuth Rilling. Bereits vor Beendigung ihres Studiums wurde Wally Hase 1992 als Soloflötistin der Staatskapelle Weimar verpflichtet. Diese Position hatte sie bis 2009 inne. Seit 2008 verbindet sie eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Camerata Salzburg. Neben Solokonzerten tritt sie häufig als Kammermusikerin auf – so im Duo mit dem Gitarristen Thomas Müller-Pering, dem Pianisten Thomas Wellen und dem Mandelring Quartett. Projekte „Musik & Lyric“ verbinden sie mit dem Germanisten und Sprecher Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma. Ihr vielseitiges Engagement als Solistin, Kammermusikerin und Gründungsmitglied verschiedener Ensembles wird durch Fernsehund Rundfunkproduktionen sowie CD-Einspielungen ergänzt. Letztere wurden 2006 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und 2007 mit dem „Leopold“ ausgezeichnet. Im Jahr 2000 wurde Wally Hase als Professorin für Flöte an die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar berufen. Darüber hinaus unterrichtet sie im Rahmen von Meisterkursen im In- und Ausland. Wally Hase begeisterte das Publikum des HAMBACHERMusikFESTES bereits 2006 und 2008. Die Künstler Thorsten Johanns, Klarinette Geboren und aufgewachsen in Krefeld, hatte Thorsten Johanns viele Jahre Klarinetten- und Saxophonunterricht bei seinem ungarischen Lehrer László Dömötör. In dieser Zeit konnte er sich zahlreiche erste Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erspielen. Es folgte ein Studium bei Prof. Ralph Manno an der Musikhochschule Köln. Thorsten Johanns war Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. Bevor er als 25-Jähriger seine jetzige Position als Soloklarinettist des WDR-Sinfonieorchesters Köln antrat, war Thorsten Johanns stellvertretender Soloklarinettist der Essener Philharmoniker. Als Mitglied der Ensembles Quintetto Amadeo, opera senza, Zephyr und Saxemble tritt der Künstler bei zahlreichen Festivals im In- und Ausland auf. Hier sind insbesondere zu nennen: Schleswig-Holstein Musik Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Luzern Festival, Musik-Triennale Köln und Tiroler Festspiele. Der Dirigent Christoph von Dohnanyi verpflichtete Thorsten Johanns als Soloklarinettisten für viele Projekte mit dem NDR-Sinfonieorchester Hamburg. In derselben Position trat er auch mehrfach mit den Berliner Philharmonikern auf. Auch bei den Münchner Philharmonikern, dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin und dem Ensemble Modern, Frankfurt, war und ist er häufiger Gast. Als erster und bis heute einziger deutscher Klarinettist wurde Thorsten Johanns persönlich vom Chefdirigenten Alan Gilbert nach New York eingeladen, um dort wiederholt als Soloklarinettist mit dem New York Philharmonic Orchestra zu spielen. Mehrfach wurde Thorsten Johanns als Soloklarinettist zum Super World Orchestra nach Tokyo eingeladen. Er arbeitete mit den Dirigenten Sir Neville Marriner, Semyon Bychkov, Eivind Aadland und Yutaka Sado zusammen und konzertiert auch regelmäßig als Solist. Der Künstler wirkte bei vielen erfolgreichen CD-Produktionen mit. Die Einspielung von Mozarts „Don Giovanni“ mit dem Ensemble opera senza wurde mit dem ECHO-Klassik 2008 ausgezeichnet. Zuletzt hat Thorsten Johanns mit dem Quintetto Amadeo für das Label Col Legno eine vielbeachtete CD mit Mozarts Quintett für Bläser und Klavier KV 452 und Moritz Eggerts „Amadé, Amadé“ eingespielt. Die Saison 2013/14 startete für Thorsten Johanns mit einer ausgedehnten Konzerttournee und Meisterkursen in Australien und mit seiner Mitwirkung bei Festivals in Finnland und Schweden. Der Künstler unterrichtete zudem in Meisterkursen in den USA und in China. Er hat eine Professur für Klarinette in Maastricht inne. Die Künstler Paul Rivinius, Klavier Der Pianist Paul Rivinius erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren. Seine Lehrer waren zunächst Gustaf Grosch in München, später Alexander Sellier, Walter Blankenheim und Nerine Barrett an der Musikhochschule in Saarbrücken. Nach dem Abitur studierte er zusätzlich Horn bei Marie-Luise Neunecker an der Frankfurter Musikhochschule und setzte seine Klavierausbildung bei Raymund Havenith fort. 1994 wurde er in die Meisterklasse von Gerhard Oppitz an der Musikhochschule München aufgenommen, die er 1998 mit Auszeichnung abschloss. Paul Rivinius war langjähriges Mitglied als Hornist im Bundesjugendorchester und im Gustav Mahler Jugendorchester. Als Kammermusiker profilierte er sich mit dem 1986 gegründeten Clemente Trio, das 1998 den renommierten ARD-Musikwettbewerb in München gewann und anschließend als „Rising Star“-Ensemble in den wichtigen Konzertsälen der Welt gastierte, darunter sind die Carnegie Hall in New York und die Wigmore Hall in London zu nennen. Außerdem musiziert Paul Rivinius gemeinsam mit seinen Brüdern Benjamin, Gustav und Siegfried im Rivinius Klavier-Quartett. Zusammen mit Musikern des Deutschen Symphonie Orchesters Berlin bildet er das Akanthus Ensemble, und seit 2004 gehört er dem Mozart Piano Quartet an. Zahlreiche Rundfunk- und CD-Produktionen, unter anderem mit den Cellisten Julian Steckel und Johannes Moser, dokumentieren seine künstlerische Arbeit. Paul Rivinius lehrte als Professor für Kammermusik an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin und lebt heute in München. Die Künstler Rautio Piano Trio Jane Gordon, Violine Adi Tal, Violoncello Jan Rautio, Klavier Im Rautio Piano Trio spielen drei herausragende Musiker aus Großbritannien, Israel und Russland. Von der Kritik wird das Trio wegen seiner Vielseitigkeit, seines intelligenten Kunstverständnisses und seiner phantasievollen Programmgestaltung gelobt. Sein Repertoire erstreckt von historisch ausgerichteten Aufführungen von Musik der Klassik bis zu zeitgenössischen Werken. Bislang ist es im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa aufgetreten, mit Konzerten in der Wigmore Hall, dem Purcell Room, der Bridgewater Hall, in St. George’s Bristol, live beim Radiosender BBC Radio 3, im Wiener Haydn-Saal und beim Pablo Casals Festival im französischen Prades. Des Weiteren erfreut sich das Rautio Piano Trio vielseitiger musikalischer Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Joan Rodgers, Sopran, Julian Bliss, Klarinette, Sarah-Jane Bradley, Violine und dem Nottingham Symphony Orchestra. Seine jüngsten Darbietungen zeitgenössischer Musik umfassen unter anderen die Uraufführung von Benjamin Wallfischs „Syzygy“ in der Wigmore Hall und Sally Beamishs „The Seafarer“ beim Sound Contemporary Music Festival in Schottland. Das Rautio Piano Trio hat viele angesehene Auszeichnungen erhalten, u. a. durch die Teilnahme an der Young Artist-Plattform des Tillett Trusts, durch den Maisie Lewis Wigmore Award, den Park Lane Group Award und den Musicians Benevolent Fund Ensemble Award. Alle diese Preise ermöglichen den Gewinnern Auftritte bei angesehenen Veranstaltungen in berühmten Konzerthäusern. Das Trio gewann zudem den Publikumspreis bei der Londoner Parkhouse Preisverleihung. Die drei Musiker sind preisgekrönte Absolventen der Royal Academy of Music, des Royal College of Music sowie des Royal Northern College of Music. Sie erhielten zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen für ihr solistisches Wirken. 2008 wurde das Rautio Piano Trio als das erste britische Klaviertrio für die European Chamber Music Academy ausgewählt. Unter den jüngsten Projekten, die für viel Aufsehen gesorgt haben, ist sicherlich die Aufführung des kompletten Zyklus der Klaviertrios von Mozart auf historischen Instrumenten im Konzerthaus St. George’s Bristol und am Tel Aviv Museum of Art im Jahr 2013. Impressum VERANSTALTER Stadt Neustadt an der Weinstraße KÜNSTLERISCHE LEITUNG Mandelring Quartett ORGANISATION UND DURCHFÜHRUNG Förderkreis HAMBACHERMusikFEST e.V. Ahornweg 7 67434 Neustadt-Hambach Telefon: (06321) 9 20 43 Telefax: (06321) 899 782 [email protected] WERKTEXTE Eva Blaskewitz Lausitzer Str. 21 10999 Berlin Tel: 030 / 41 71 43 47 Mobil: 0179 / 144 07 58 E-Mail: [email protected] Foto: Dr. Collofong REDAKTION Erika Buße Jörg S. Schmidt Ana-Maria Souca GRAFIK Federico Mampaey Unsere nächsten Konzerttermine: DIE KLASSIK-REIHE 19. HAMBACHERMusikFEST Mandelring Quartett vom 3. bis 7. Juni 2015 Herbst/Winter-Zyklus im Saalbau Neustadt 19. Oktober 2014 / 2. Dezember 2014 17. Februar 2015 / 19. April 2015 Information und Karten – Telefon: 0 6321 - 92 043 www.hambachermusikfest.de ���������� ������������ ������������� ���������������� ��������������������� ������������������������������ ������� �� ��� �� �� � � ����������������� MANDELRING QUARTETT www.audite.de MENDELSSOHN DIE KAMMERMUSIK FÜR STREICHER Vol. I aud. 92.656 Vol. II aud. 92.657 Vol. III aud. 92.658 Vol. IV aud. 92.659 MUSIKPRODUKTION e-mail: [email protected] http: www.audite.de erhältlich im Handel über: [email protected]