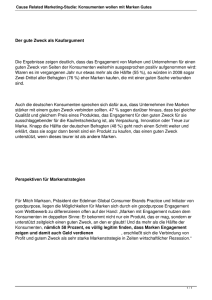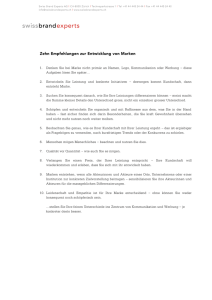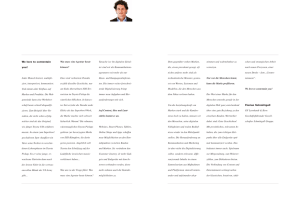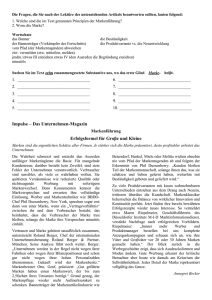Artikel runterladen - transfer Zeitschrift
Werbung

04/2011 | transferWerbeforschung & Praxis SERVICE 65 forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung Ich, Du, Er, Sie, Wir – Konsumentenverhalten zwischen Ego, Freundschaft und sozialer Erwünschtheit PD Dr. Andreas Strebinger Associate Professor an der School of Administrative Studies der York University in Toronto ✉ [email protected] Immer mehr Marken entdecken das Ich der Konsumenten als zentrale Möglichkeit der Differenzierung – und das nicht erst seit „i“ – Phones, Pods, Pads & Co. Auch die akademische Forschung hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit dem Käufer-Ego beschäftigt. Aber was bedeutet „Ich-Orientierung“ eigentlich und was passiert, wenn alle Marken nur mehr ich-orientiert positioniert werden? Und wo bleiben das Du und das Wir? Welche Rolle spielt dabei das Geschlecht des Konsumenten? Ein lose zusammenhängender Streifzug durch einige jüngere akademische Befunde ... Das Ich des Konsumenten – eine unerschöpfliche Quelle für Markendifferenzierung? Ein Forscherteam um Alexander Chernev (Northwestern University) machte jüngst im Journal of Marketing (MaiAusgabe) auf die Gefahren aufmerksam, die entstehen können, wenn nun alle Marken versuchen, sich rund um Lifestyle und Identität des Konsumenten zu positionieren. In fünf klug gestalteteten Laborexperimenten weisen sie nach, dass das Bedürfnis des Konsumenten, sich selbst über Marken auszudrücken, endlich ist und nicht nur durch Marken befriedigt wird. Zunächst einmal zeigen sie auf kreative Weise, dass Lifestyle-Marken tatsächlich das Bedürfnis, sich selbst auszudrücken, stillen. Gibt man einer Gruppe von Testpersonen Gelegenheit, ihre Identität durch Beurteilung der Ich-Nähe einer Vielzahl von Marken auszudrücken, und bittet sie anschließend, sich selbst als Strichmännchen zu zeichnen, zeichnen sich die Probanden dieser Gruppe nicht etwa größer, sondern signifikant kleiner als eine Kontrollgruppe mit anderer vorangehender Aufgabe. Mit anderen Worten: Ihr Ego ist befriedigt! Dies führt dazu, wie die Forscher zeigen, dass eine vorangehende Wahl zwischen Lifestyle-Marken in einer Produktkategorie die Ich-Nähe der Marken in einer nachfolgenden Markenwahl einer anderen Produktkategorie weniger wichtig macht. Lifestyle-Marken werden auch dann weniger attraktiv, wenn man zuvor die eigene Persönlichkeit über Lieblingssportteams, -musik, -popstars, -filme etc. oder auch durch das individuelle Designen eines T-Shirts zum Ausdruck bringen konnte. Das drückt sich – zumindest in Laborexperimenten – auch in Preisbereitschaften aus. ProbandInnen, welche zuvor ihren Wunsch nach Selbstausdruck sättigen konnten, gaben beispielsweise danach im transfer Werbeforschung & Praxis, 57 (4), 65-68 Durchschnitt eine 20 Prozent geringere Preisbereitschaft für ihre Lieblingssonnenbrillen-Marke an als ProbandInnen, welche das nicht konnten. Umgekehrt steigt das Bedürfnis nach Lifestyle-Marken, wenn das Ego zuvor durch ein negatives Feedback eine Delle erhalten hat. Die Forscher mahnen daher, dass eine emotionale Markendifferenzierung über Ich-Nähe zwar die Austauschbarkeit mit Produkten der eigenen Produktkategorie reduziert, man sich aber gleichzeitig in Konkurrenz zu einem weitem Feld an Lifestyle-Marken und sogar Marken der Unterhaltungsindustrie begibt. Dagegen jedoch die gute Nachricht: Das Ich des Konsumenten hat mehr auschöpfbare Facetten als bloß den „Lifestyle“, wie die folgende Studie zeigt. „Mein Wille geschehe ...“ als generalisierte „IchOrientierung“ Bei vielen der „i“´s der heutigen Markenwelt könnte man fast zu der Ansicht gelangen, dass es den KonsumentInnen ausschliesslich um eine Apotheose des eigenen Egos per Götzendienst („Apple Unser, ...“) geht (siehe dazu auch „Gott, Mammon, Marke: Marken als Opium für die nichtreligiösen Massen?“ aus meiner Kolumne "Forschung aus aller Welt" in der vorangegangenen Ausgabe von transfer). Dem ist aber nicht so, wie eine Reihe von Experimenten von Michal Maimaran (Northwestern University, Chicago) und Itamar Simonson (Stanford University, Kalifornien) im Journal of Marketing Research (August) zeigt. Denn: In Wahrheit ist die Differenzierung des Ichs von anderen, welche für die Mehrheit in der westlichen Welt ein bedeutendes Ziel ist, Teil einer allgemeineren, auch Ratio und transferWerbeforschung & Praxis 66 SERVICE | 04/2011 forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung a Sinneseindrücke umfassenden Individualität. Und so zeigen sie, dass eine Aktivierung des Ichs vor Kaufentscheidungen allgemein die Risikobereitschaft von Konsumenten erhöht, die Tendenz verringert, sich für Kompromisslösungen anstelle von Produkten mit klaren funktionalen Vor- und Nachteilen zu entscheiden, die Wahrscheinlichkeit von Käufen, welche die fünf Sinne ansprechen, erhöht und Marken mit hoher Qualität und hohem Preis gegenüber günstigeren Marken mit geringerer Qualität begünstigt. Gemeinsame Wurzel ist der eigene Wille, welcher in der Kaufentscheidung verwirklicht wird – auch oder gerade mit dem Effekt, das man von den durchschnittlichen Präferenzen der breiten Masse abweicht. „Mein Wille geschehe ...“ als Substrat eines generalisierten Dienstes am Ich. Daher, so zeigt eines der Experimente, verschwinden alle oben genannten Effekte stärkerer Individualität gleichermaßen wieder, wenn man Konsumenten informiert, dass ihre (fiktiven) Kaufentscheidungen von der Allgemeinheit der Probanden einer anderen Studie kritisch unter die Lupe genommen würden. Und natürlich ist es nicht immer der eigene Wille, der im Produkt geschehen soll, wie einem bei der Geschenksuche vor Weihnachten nachdrücklich bewusst wird. Ich & Du: Was KonsumentInnen wichtig ist, wenn sie für Freunde ein Geschenk designen Dass es beim Geschenkeaussuchen nicht um den eigenen Willen geht, ist einer der Faktoren, der Schenken so schwierig macht. Denn schließlich kennt man die eigenen Wünsche und den eigenen Geschmack viel besser als selbst jene naher Verwandter oder guter Freunde – von entfernten Verwandten oder Freunden ganz zu schweigen. Ein anderer Unterschied ist, dass es beim Schenken nicht nur der Wille ist, der für das Werk zählt, sondern auch Aufwand und Mühe, welche im Geschenk stecken. Frühere Forschung hat gezeigt, dass ein Geschenk beim Beschenkten besser ankommt, wenn es sehr mühevoll oder aufwändig war, es zu besorgen. Denn Mühe und Aufwand stehen für das Ausmaß an Wertschätzung, welches der Schenker dem Beschenkten entgegenbringt. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum viele Unternehmen, welche ihren Kunden online die Möglichkeit geben, etwas (z. B. Schuhe, eine Handtasche) selbst zu designen, einen großen Anteil ihres Jahresumsatzes in den Geschenkesaisonen machen. Denn beim Selbstdesignen steht hinter dem persönlichen Geschenk auch erkennbare Mühe des Schenkers. Und der ist beim Schenken positiv – während viele Menschen, wenn es um Produkte für den Eigengebrauch geht, die Mühen des Selbstdesignens doch scheuen. Die andere Besonderheit des Schenkens – man kennt die Wünsche und den Geschmack des Beschenkten nicht so gut – macht hingegen das Selbstdesignen eines Geschenks noch schwieriger, als es für den Eigenbedarf ohnehin schon ist. Denn – auch das kennen viele Unternehmen, welche ihren Kunden die Möglichkeit zum Selbstdesignen geben: So sehr das Selbstdesignen manchen Konsumenten Spaß macht, so sehr sind viele von ihnen dann unangenehm überrascht, wenn die eigene Kreation per Post ins Haus kommt. C. Page Moreau (University of Colorado) und KollegInnen haben nun im Journal of Marketing (September 2011) in zwei Studien untersucht, wie man die Schenker beim Designen bestmöglich unterstützen kann. In einer der beiden Studien baten sie junge Frauen, auf einer Website eine Handtasche entweder (a) als Geschenk für eine Freundin oder (b) für sich selbst zu designen. Des Weiteren boten sie einer zufällig ausgewählten Hälfte der Studienteilnehmerinnen extensiven Designsupport an, mit Online-Informationen bei jedem Schritt wie Schnitt der Tasche, Farben, Muster etc. und sogar der Möglichkeit, nach Fertigstellung der eigenen Kreation, aber vor Produktion, ein Feedback von einem Designspezialisten der Marke zu erhalten. Die andere Hälfte der Teilnehmerinnen erhielt keinen Designsupport. Umittelbar nach der Online-Kreation gaben die Testpersonen an, wie hoch sie ihre eigenen Designkünste einschätzten, wie unsicher sie beim Designen waren und wie sehr sie erwarteten, dass sie (bzw. die Beschenkte) mit der Tasche glücklich sein würden. Einige Wochen später erhielten die Studienteilnehmerinnen dann tatsächlich (kostenlos) per Post die selbstdesignte Tasche und mussten Fragen zur tatsächlichen Zufriedenheit sowie ihrer Preisbereitschaft (wenn sie die Tasche erwerben müssten) beantworten. In der zweiten Studie variierten die AutorInnen experimentell die Marke des Unternehmens, welche für eine Hälfte der Teilnehmerinnen eine sehr bekannte, prestigeträchtige Marke war, für die andere Hälfte eine unbekannte Marke. Des Weiteren maßen sie die Zeit, welche die Teilnehmerinnen in das Designen der Tasche investierten. Das Ergebnis: Wenn die Tasche für eine Freundin designt wurde, senkte das Angebot von Design-Unterstützung die Unsicherheit beim Designen signifikant, vor allem bei jenen Konsumentinnen, welche ihre eigenen Designerfähigkeiten als niedrig einstuften. Gleichzeitig erhöhte sich dadurch auch die Erwartung, dass das Produkt der Beschenkten gefallen würde. Wurde die Tasche hingegen für den Eigengebrauch gestaltet, hatte Design-Support keinen solchen Effekt. Die AutorInnen interpretieren das dahingehend, dass Design-Support hauptsächlich über den Geschmack von durchschnittlichen Käuferinnen Auskunft gibt. Das wird beim Schenken als hilfreich erlebt, für den Eigengebrauch jedoch nicht unbedingt. Und auch beim Schenken war der Design-Support letztendlich nicht unbedingt erfolgreich. Denn als die Taschen dann tatsächlich bei 04/2011 | transferWerbeforschung & Praxis SERVICE 67 aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller we Abb. 1: Selbstdesignen eines Geschenks - Hilfe erwünscht! geliefert werden, in welchem durch die Angabe des Namens auf die besondere Hingabe hingewiesen wird, mit welcher der Schenker das Produkt für den Beschenkten gestaltet hat. Das gilt auch und gerade für individualisierte Produkte starker Marken. Dann zeigen sowohl Geld und Mühe dem Beschenkten an, wie teuer und vor allem lieb er dem Schenker ist. In der nächsten Studie geht es mehr darum, wie teuer Freunde sein können – diesmal vor allem für männliche Konsumenten. Ich, Du, Er, Sie, Wir? Wann “Mit-FreundenEinkaufen-Gehen” teuer wird … Quelle: www.berlinbag.com; Abruf am 23.10.2011 ihren Schöpferinnen ankamen, erwiesen sich die durch den Design-Support erhöhten Erwartungen als überhöht. Die enttäuschten Erwartungen schlugen sich in geringerer Zufriedenheit und auch geringerer (fiktiver) Preisbereitschaft für ein mit Design-Support geschaffenes Geschenk nieder. Ein etwas überraschendes Ergebnis erbrachte auch die zweite Studie. Denn auch eine bekannte Marke ist beim Schenken eines selbstdesignten Artikels nicht nur positiv. Auf der einen Seite ist das Schenken einer bekannten, prestigeträchtigen Marke ein gutes Zeichen für die Wertschätzung für den Beschenkten. Anderseits führt es beim Schenker auch zu der Befürchtung, dass ein gelungenes Design vom Schenker nicht der Mühe des Schenkers, sondern der bekannten Marke zugerechnet wird. Und so hatte die investierte Mühe nur bei jener Gruppe von Testpersonen, welche die Tasche von einer unbekannten Marke und als Geschenk gestaltete, einen positiven Effekt auf die (fiktive) Zahlungsbereitschaft. Im Endeffekt äußerten die Testpersonen für ein selbstdesigntes Geschenk sogar eine höhere Zahlungsbereitschaft, wenn es sich um eine unbekannte Marke handelte, als wenn es von einer bekannten Marke kam. Bei einer Tasche für den Eigengebrauch bevorzugten sie hingegen die bekannte Marke. Als praktische Tipps empfehlen die Autorinnen den Unternehmen, welche individualisierte Produkte anbieten, gleich zu Beginn des Designvorgangs zu erfassen, ob das Produkt für den Eigengebrauch oder als Geschenk gestaltet wird, und den Designvorgang dann unterschiedlich zu unterstützen. Zum Abbau kognitiver Dissonanzen und von Erwartungsenttäuschungen empfehlen sie, dem Schenker, der den Designsupport in Anspruch genommen hat, durch eine zwischenzeitliche Email während des Produktionsprozesses zur Kreation zu gratulieren. Ein Geschenk sollte schließlich auch mit zusätzlichem Infomaterial (z. B. einem Sticker) Shopping mit Freunden macht vielen mehr Spaß – aber ist das ein teurer Spaß? Didem Kurt (University of Pittsburgh) und Kollegen untersuchten in der August-Ausgabe des Journal of Marketing Research, ob Menschen, die mit einem Freund einkaufen gehen, mehr ausgeben, als wenn sie alleine einkaufen. In zwei Studien befragten sie KonsumentInnen in Shopping Malls in den USA und der Türkei vor und nach dem Einkaufen nach ihren geplanten und tatsächlichen Ausgaben und hielten auch fest, ob und von wem der Konsument begleitet wurde. Des Weitereren führten sie eine Reihe von Experimente mit U.S. StudentInnen durch. In einem davon schufen sie beispielsweise einen “neuen Freund” (in Wahrheit ein Mitglied des Forscherteams), der bei einer ersten Studio-Befragung anwesend war. Die Befragung wurde unter einem Vorwand unterbrochen, um den beiden genügend Zeit zu geben, sich anzufreunden. Ein paar Tage später wurden dieselben Probanden gebeten, in einem bestimmten Geschäft einen Einkauf durchzuführen, für welchen ihnen die Untersuchungsleiter Geld zur Verfügung stellten. Einen nicht verwendeten Rest durften die Probanden behalten. Im Geschäft trafen sie dann „zufällig“ auf jenen Mitstudenten, mit dem sie sich bei der ersten Untersuchung angefreundet hatten und welcher angeblich gerade die gleiche Aufgabe zu erledigen hatte. Ein weiterer, unauffälliger Beobachter hielt fest, wieviel die Testperson ausgab und wie viel sie vom zur Verfügung gestellten Budget sparte. Alle Untersuchungen verwendeten nur Fälle, in denen entweder kein oder genau ein (alter oder neuer) Freund anwesend war, nicht aber Shopping im Rudel oder mit Partner/in. Unabhängig von der Untersuchungsweise und -ort zeigten die Ergebnisse, dass Einkaufen mit Freunden vor allem für Männer teurer wird: Sie geben, wenn ein Freund dabei ist, signifikant mehr Geld aus. Für Frauen gilt das nicht. Das liegt, wie spezielle Untersuchungs- und Auswertungsmethoden zeigen, daran, dass Männer im Durchschnitt eine stärkere „Ich“-Orientierung transferWerbeforschung & Praxis 68 SERVICE | 04/2011 forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung aus aller welt | forschung („Agency Orientation“) haben, während Ich & Du (d. h. Einkauf mit einem Freund) bei Frauen eher eine „Wir“-Orientierung aktiviert. Er neigt dann im Durchschnitt eher zu teureren Käufen, während sie im Sinne von Harmonie und Kooperation von Prestigekäufen im Durchschnitt eher Abstand nimmt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dieser Effekt ist unabhängig davon, ob der begleitende Freund vom selben oder anderen Geschlecht ist – das männliche Ego kommt also nicht nur zum Vorschein, wenn es darum geht, eine weibliche Begleitung zu beeindrucken. Wer jetzt allerdings meint, dass nur Männer bei Anwesenheit eines Freundes ihrem Ego fröhnen, liegt wohl falsch. Auch bei ihr kann die Anpassung der Ausgaben einen „strategischen Charakter“ haben, wie Wissenschafter beschönigend für Selbstdarstellung sagen. Das zeigt sich am Einfluss eines weiteren Faktors, den die Experimente nachweisen: der Tendenz zu Selbstüberwachung („SelfMonitoring“). Menschen haben eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Tendenz, ihr Verhalten an ihre soziale Umgebung anzupassen. Manche tun, was in der augenblicklichen Ungebung gerade opportun ist, um den besten Eindruck zu hinterlassen („starke Selbstüberwacher“), während andere recht unbeeindruckt vom sozialen Rundherum entsprechend ihrer wahren Persönlichkeit und Werthaltungen handeln („schwache Selbstüberwacher“). Starke Selbstüberwacher gibt es gleichermaßen bei Frauen wie Männern. Allerdings verstärkt sich der Einfluss durch die Anwesenheit eines Freundes bei ihnen noch, d. h., starke Selbstüberwacher unter den Männern geben bei Anwesenheit eines Freundes noch mehr aus, während starke Selbstüberwacherinnen bei Anwesenheit eines Freundes sogar weniger ausgeben als wenn sie alleine shoppen gehen. Dieser Befund deutet bereits darauf hin, dass das Wir, welches die Anwesenheit eines Freundes bei Frauen bewirkt, nicht nur als Gefühl, sondern auch als sozial erwünscht erlebt wird. Und auch durch ostentative Einkaufszurückhaltung unterstrichen werden kann. Noch deutlicher zeigt sich der strategische Charakter der weiblichen Anpassung an die Anwesenheit eines Freundes, wenn es um wohltätige Spenden geht. Die ForscherInnnen baten dazu StudentInnen in ein Teststudio. Die Hälfte nahm an der Befragung alleine teil, die andere Hälfte wurde gebeten, einen Freund mitzubringen und führte die Befragung in Anwesenheit des Freundes durch. Als Dankeschön für die Teilnahme an der Befragung erhielten die Probanden 50 Dollar, welche sie Abb. 2: Männer geben beim Einkaufen mit Freunden mehr aus als beim Einkauf alleine. Quelle: © Peter Atkins - Fotolia.com nach Belieben ganz oder teilweise behalten oder aber auch an ausgewählte karitative Organisationen spenden durften. Resultat: Eine hohe Wir-Orientierung bewirkt, dass bei Anwesenheit eines Freundes signifikant mehr gespendet wird, jedoch nur bei starker Selbstüberwachungstendenz. Ist hingegen niemand anwesend, den man kennt, reduziert eine Kombination aus hoher Wir-Orientierung und starker Selbstüberwachungstendenz den Spendenbetrag – und zwar sogar noch unter den Betrag von „Ich“-Orientierten. Und so erscheint das schöne, auf Harmonie und Gleichheit ausgerichtete „Wir“-Verhalten, das Freunde im Durchschnitt bei Frauen auslösen, bei manchen Frauen dann doch wieder als strategische Selbstdarstellung, welche kompensiert wird, sobald man alleine ist. Männer, welche mit Freunden einkaufen gehen, sind nach Ansicht der Autoren eine von Einkaufszentren noch zu wenig erschlossene Einnahmequelle. Sie schlagen daher beispielsweise Einkaufszentren oder Bekleidungsketten vor, „Freundschaftsdeals“ anzubieten, gezielt mit Fokus auf männliche Kunden. Die dabei gewährten Rabatte könnten durch die Mehrausgaben, zu denen sich Männer in Anwesenheit von Freunden hinreißen lassen, wieder wettgemacht werden. Wie realistisch das ist, wäre wohl lohnendes Untersuchungsziel für weitere Studien (Journal of Marketing, 75, May und September 2011; Journal of Marketing Research, 48, August 2011).