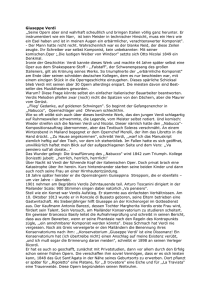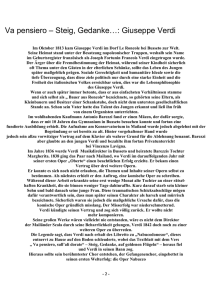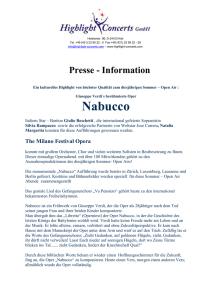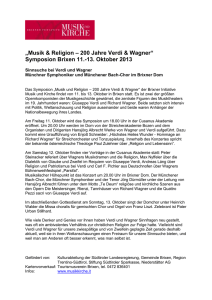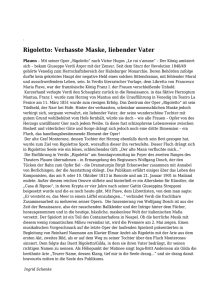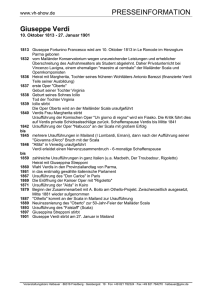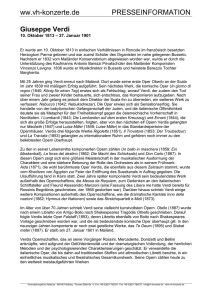Professor Dr. Sabine Henze-Döhring Musikwissenschaftlerin im
Werbung

Sendung vom 29.7.2013, 21.00 Uhr Professor Dr. Sabine Henze-Döhring Musikwissenschaftlerin im Gespräch mit Hans-Jürgen Mende Mende: Herzlich willkommen zum alpha-Forum, meine Damen und Herren. Zu Gast ist heute eine Opernliebhaberin, eine Opernkennerin, eine Opernforscherin, nämlich Frau Sabine Henze-Döhring, Professorin für den Bereich "Oper", wenn ich das mal so sagen darf. Der Anlass dieser Sendung ist der 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi. Wir wissen, es gibt ein Verdi- und ein Wagnerjahr 2013: Viele haben sich auf Wagner gestürzt, Sie jedoch, Frau Professor, auf Verdi. Warum ein neues VerdiBuch? Es ist ja nicht so, dass es bis heute zu wenig über Verdi gäbe. Henze-Döhring: Nun, warum ein Verdi-Buch? Sie sagen mit Recht, dass es genügend Verdi-Bücher gibt. Mir kam es jedoch sehr darauf an, Verdi auch mal aus einer anderen Perspektive in den Blick zu nehmen. Ich wollte seine musikalischen Werke selbstverständlich ganz genau betrachten, aber ich wollte doch auch ein bisschen die Patina von Verdi wegnehmen und pragmatischer auf seine Musik schauen. Und ich wollte mir den Menschen Verdi genauer anschauen. Wir wissen, Verdi gilt als der Bauer von Roncole, aus armen, armen Verhältnissen stammend. Noch in einigen Büchern, die in diesem Jahr erschienen sind, kann man das nachlesen. Aber in unserem Fach ist längst bekannt, dass das alles gar nicht so gewesen ist, dass das ein ganz knallharter Geschäftsmann gewesen ist, dass er ein sehr gebildeter Mensch gewesen ist usw. Der "Bauer von Roncole" passt da herzlich wenig zu ihm. Ich wollte so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und ihn ein bisschen zurechtrücken. Ich habe aber auch seine Vorgeschichte und seine postume Wirkung betrachtet. Man feiert ihn ja als großen Revolutionär, als Galionsfigur der italienischen Einigungsbewegung, als politisch engagiert, also liberal, als Volkstribun usw. Aber wenn man genauer hinschaut, wenn man die Quellen genauer studiert, wenn man sich also mit dieser Materie genau befasst, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass das Sichtweisen des späten 19. Jahrhunderts waren – wenn nicht des 20. Jahrhunderts. Man merkt dann, dass man aus Verdi eine Figur gemacht hat, die für etwas anderes steht und die nicht für das genommen wird, was er eigentlich gewesen ist. Das wollte ich auf diesen 123 Seiten ein wenig zurechtrücken. Ich wollte vor allem nicht nur eine reine Biografie schreiben, denn das hätte mich in der Tat nicht interessiert, sondern ich wollte eine Werkdarstellung machen, eine Betrachtung seiner Werke unternehmen. Dies wollte ich jedoch einbetten und in Beziehung setzen zu seiner Biografie und zu allgemeinen operngeschichtlichen Phänomenen. Mende: Das heißt, Sie wollen Verdi nicht demontieren ... Henze-Döhring: Nein, das will ich nicht. Mende: Es wird in Ihrem Buch deutlich, dass Sie auf der einen Seite ein Herz für die Musik, für die Opern von Verdi haben. Aber das ganze Drumherum wird von Ihnen sehr kritisch betrachtet. Heute würde man ja von einer perfekten PR in Sachen Verdi sprechen. Diese perfekte PR wollen sie jedoch hinterfragen. Henze-Döhring: Ja, hinterfragen wollte ich sie natürlich auch, aber ich wollte vor allem ganz nüchtern und auch mit einer klar verständlichen Sprache die Dinge richtigstellen und sagen: Das war ein Mann, der aus bürgerlichen Verhältnissen kam, sein Vater war Gastwirt und besaß nebenbei einen Krämerladen. Verdi hatte das große, große Glück, dass man sehr früh sein Talent erkannt hat, dass er professionell gefördert wurde. Und dann kam Verdi nach Mailand: Da war nichts mehr zu spüren von diesem vermeintlichen Bauernsohn aus Roncole, aus angeblich ganz, ganz armen Verhältnissen, denn da kam er aufgrund von Umständen, die uns bis heute nicht zu 100 Prozent bekannt sind – aber wir können das ja vom Ergebnis her nehmen – in adelige Kreise, wo er wirklich gefördert und gesponsert wurde. Wäre das nicht so gewesen, dann wäre es überhaupt nicht denkbar gewesen, dass dieser Mann, dass dieser Nobody gleich mit seinem ersten Werk an der Scala landete. Denn normalerweise fingen die Opernkomponisten in der Provinz an mit einer kleinen Opera buffa. Wenn sie Glück hatten, machten sie dort noch eine zweite und anschließend traten sie ihre Tour durch Oberitalien an. Und wenn sie dann immer noch gut waren, dann durften sie vielleicht mal nach Venedig oder nach Mailand. Aber dass jemand sofort als Nobody mit seinem ersten Werk in Mailand an der Scala landete, also am ersten oder zumindest einem der ersten Häuser Italiens, beruht ganz wesentlich darauf, dass man das Talent dieses Mannes erkannt hatte, dass er eine gute Bildung hatte, dass er eine gute musikalische Grundausbildung besaß usw. Er war wirklich ein anderer als der, zu dem man ihn im Zuge der späteren Rezeption gemacht hat. Mende: Woher kam das bei ihm? Gab es für ihn musikalische Vorbilder? Gab es jemanden in seiner Familie, der sehr tief in der Kultur verwurzelt gewesen wäre? Henze-Döhring: Nein, in seiner unmittelbaren Familie nicht. Aber er hatte ja die Förderung durch die Barezzis. Mende: Das heißt, er hatte eine Familie als Mäzen, die ihn stark gefördert und unterstützt hat. Henze-Döhring: Ja, von denen wurde er promotet. Und dann kam er nach Mailand. Dort hatte er allerdings zunächst einmal die Enttäuschung zu verarbeiten, dass er nicht aufgenommen wurde am Mailänder Konservatorium. Aber vom Endergebnis her gesehen kann ich nicht erkennen, wo und wie ihm das großartig geschadet hätte. Denn wenn man sich seinen Weg ansieht und die Geschwindigkeit, die er dabei an den Tag legte, fragt man sich schon: "Mein Gott, was hat er schon verpasst am Konservatorium? Wohl nichts." Mende: Wie haben Sie denn Verdi kennengelernt? Was war denn Ihre erste Begegnung mit einer Verdi-Oper? Henze-Döhring: Ich stamme ja aus einer Kleinstadt in Westfalen. In dieser Kleinstadt gastierte eines Tages die Detmolder Landesbühne. Dort habe ich als Kind mal seine Oper "Die Macht des Schicksals" gesehen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Im Anschluss daran hatte ich natürlich nur sehr selten die Möglichkeit, eine Verdi-Oper zu sehen, denn dafür musste man in die größeren und weiter entfernt liegenden Städte fahren. Aber im Studium kam dann so allmählich die absolute Begeisterung für diese Musik. In meiner Kindheit haben wir natürlich Platten gehört von morgens bis abends. Das waren damals noch diese sogenannten Querschnittplatten, auf denen nur die Highlights drauf waren. Die deutsche Übersetzung davon konnten wir wirklich auswendig und haben das vor uns hingesungen. Das heißt, meine Begeisterung für diese Musik wurde bereits in früher Kindheit geprägt. Wie gesagt, kennengelernt habe ich das alles über diese Querschnittplatten, die heute kein Mensch mehr kennt und die sich auch niemand mehr auflegen würde. Mende: Sie waren auch noch meistens in deutscher Sprache gehalten. Henze-Döhring: Ja, mit diesen wabernden Zwischentexten! Herrlich! Mende: Ja, ich kenn die auch noch. Henze-Döhring: Sie kennen die noch? Aber die gibt es heute gar nicht mehr. Mende: Das heißt, Sie sind damals wohl auch mit diesem Gefühl aufgewachsen, das damals sehr stark propagiert wurde: Wagner macht tolle Musik, ist aber ein fieser Typ, ein unangenehmer Mensch, während Verdi auch tolle Musik macht, aber eben ein Mensch ist, den man auch lieben kann, den man als Menschen toll finden kann. Es gibt ja auch diese vielen Bilder von Verdi: Er sah grandios aus, hatte mächtige graue Haare und alle Welt weiß von seinem Altersheim Casa Verdi und seinem sozialen Engagement. Mit diesen Bildern sind Sie vermutlich auch aufgewachsen, oder? Henze-Döhring: Nein, als Kind oder in meiner Jugendzeit, also noch vor meinem Studium, habe ich mich ehrlich gesagt um diesen Mann selbst gar nicht gekümmert. Mende: Es war Ihnen also ganz egal, wer diese Musik geschrieben hat? Henze-Döhring: Ja, diese Frage hat sich für mich nicht gestellt. Ich habe meine herrlichen Platten angehört und lauthals mitgesungen, d. h. ich habe mich einfach an der Musik erfreut. Wagner? Mit Wagner bin ich eigentlich in meiner Kindheit oder frühen Jugend überhaupt nicht in Berührung gekommen. Auch in meinem Studium habe ich dann eher einen Bogen um ihn gemacht. Denn in meinem Studium habe ich meine Doktorarbeit über Mozarts "Don Giovanni" und über die Opera seria, die Opera buffa um Mozart herum und in dessen Vorzeit gemacht. Mozart war in meiner Kindheit mein absolutes Idol – und eben diese Opern. Mit Wagner bin ich überhaupt nicht in Berührung gekommen – und ich weiß auch gar nicht, ob ich das bedauern soll. Mende: Heute noch? Henze-Döhring: Ja (lacht). Mende: Da könnten wir jetzt lange diskutieren, aber das wollen wir nicht, denn heute geht es ja um Verdi. Sie haben es soeben schon kurz angedeutet und vielleicht schicken wir das einfach mal voraus: Was macht denn eigentlich ein Musikwissenschaftler mit dem Spezialthema "Oper"? Was ist seine Aufgabe? Man kann sich ja vorstellen, was ein Sänger mit Verdi macht oder ein Instrumentalist oder ein Dirigent oder ein Regisseur. Aber was macht ein Musikwissenschaftler? Sucht er Quellen? Forscht er nach Unentdecktem? Wo liegt da Ihre Aufgabe? Henze-Döhring: Normalerweise betreibt ein Opernforscher Quellenforschung, Quellensuche. Man fährt in die Archive, schaut sich die Partituren an, die noch keiner gesehen hat, und versucht, einen historischen Bezug herzustellen und einen opernkompositionsgeschichtlichen Kontext zu erschließen. Bei Verdi ist das etwas einfacher, weil doch ein Großteil seiner Partituren inzwischen in sogenannten kritischen Ausgaben vorliegt. Mende: Da gibt es also zuerst einmal und im besten Fall die Handschrift eines Komponisten. Diese handschriftliche Komposition wurde dann gedruckt, nachdem sie von irgendwelchen Kopisten übertragen und von Schriftsetzern gesetzt worden ist. Und dann gab es, wie bei Büchern, über Jahrhunderte hinweg immer wieder Neuauflagen. Aber da schlichen sich eben auch immer wieder Fehler ein. Die Aufgabe der Musikwissenschaft besteht nun darin, herauszufinden, was denn ursprünglich in einer Komposition gestanden hat. Das, was man eine "kritische Ausgabe" nennt, ist eben eine Ausgabe, die die Fehler, die sich eingeschlichen haben, herausgenommen hat. Henze-Döhring: Ja, eine kritische Ausgabe versucht diesen sogenannten ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Die modernere Sichtweise einer kritischen Ausgabe besteht darin, dass sie versucht, bei einem Werk verschiedene Fassungen, verschiedene Formen, zusätzliche Kompositionen mitzuteilen, also die Vielfalt an Quellen und Texten, die das Gesamtwerk z. B. bei der Oper "La Traviata" ausmachen. Denn es hat sich oft irgendwann eine kanonisierte Form eines Werks durchgesetzt, die aber nicht unbedingt dem entsprechen muss, was die Gesamtheit und die Ganzheit des Werks ausmacht. Es wird dann in einer kritischen Ausgabe all das kritisch studiert, kommentiert und belegt usw. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was die Aufgabe des Musikhistorikers, des Musikwissenschaftlers ist – und nicht des reinen Opernforschers, denn da würden ja auch die Libretti dazugehören: Die Herausforderung besteht nun darin – und das ist es auch, warum das für mich so außerordentlich interessant ist und warum mich das mein ganzes Leben bisher so fasziniert und beschäftigt hat –, dass man sich da wirklich mit einer dramatischen Kunst befasst, einer dramatischen Kunst, die um Grundfragen der Menschheit kreist: um Liebe, Eifersucht, Wettkampf, um die Schlauheit der kleinen Bäuerin, um den Geizhals, der bloßgestellt wird usw. Das sind alles wirklich grundsätzliche Menschheitsfragen und die sind in ein Drama gegossen. Dieses Drama wird dann sozusagen noch in Musik übertragen. Es ist ja nicht so, dass der Komponist sagen würde: "Ah, das ist also der Text, da gieße ich jetzt ein wenig Musiksoße drüber." Nein, diese Musik hat ja eine Struktur: Es ist ja ein geistiger Akt, der zu dem geführt hat, was wir Musik nennen, d. h. es ist eine intellektuelle, ganz bewusste, ganz überlegt und durchdacht vorgenommene Tätigkeit, dieses Drama in Musik zu übertragen. Mende: Mit dem Ziel, das Drama emotional erfassbarer zu machen? Henze-Döhring: Ja. Ich sage meinen Studenten immer: "Oper ist, wenn man ein Drama hat und dieses Drama vom Komponisten in Musik gegossen wurde!" Denken Sie als Beispiel an Alfredo, wenn er zu Violetta sagt, diese Liebe sei wie "der Herzschlag des Universums". Und dazu kommt nun diese Musik. Ich kann das jetzt leider nicht vorsingen, ich bitte um Verständnis. Mende: Schade. Henze-Döhring: Ja, schade, aber ich kann das wirklich nicht bringen. Diese Aussage ist also in diese wunderbare Verdi-Musik getaucht. Ich sage immer, das ist so, als würde diese Musik direkt ins Herz greifen: "Ja, das ist die Liebe! So wie der Herzschlag des Universums!" Diese Musik wirkt unglaublich und bewegt die Menschen ganz tief und ergreift sie – insofern man überhaupt dafür empfänglich ist, denn das ist, wie in allem, die Voraussetzung dafür. Wenn man aber dafür empfänglich ist, dann ist das etwas so Wunderbares, dass man sich nichts Schöneres vorstellen kann – ich jedenfalls kenne nichts Besseres. Die Aufgabe des Wissenschaftlers besteht nun darin, von diesen Emotionen zunächst einmal Abstand zu nehmen und wirklich gezielt zu überlegen: Wie hat der Komponist das gemacht? Wie geht der Komponist da mit den Arien um? Wie geht er mit dem, wie wir das nennen, Formmodell einer Arie um? Was hat er sich bei dem und dem Tonsatz überlegt? Alles wird genau betrachtet und so zu deuten versucht, dass die Studenten bzw. in diesem Fall die Leser das verstehen und danach dann eben dieses Stück belehrter oder erfahrener hören und mit dem, was wir das Wunderwerk "Oper" nennen, bewusster umgehen können. Mende: Das ist ja schrecklich! Können Sie eigentlich noch in die Oper gehen und, ohne wissenschaftlich zu denken, einfach die Augen zumachen und die Musik genießen? Henze-Döhring: Ja, und wie! Mende: Das geht also noch? Henze-Döhring: Ja, natürlich, es ist immer wieder ein großer Augenblick, wenn wirklich alles passt. Ich habe vor einiger Zeit "Die Hugenotten" in Brüssel gesehen oder "La Traviata" in Hannover mit der wunderbaren Nicole Chevalier. Da habe ich mir schon gedacht: "Lieber Gott, ich bin ja so dankbar, dass ich da dabei sein durfte!" Mende: Es gibt ja, wie ich neulich gelernt habe, neben der “ersten Unmittelbarkeit“ auch den Ausdruck "zweite Unmittelbarkeit". Denn Musikstücke, die über alle Zeiten hinweg geschätzt werden, haben beides: Sie verursachen beim Hörer einen ersten emotionalen Eindruck. So ein Hörer geht einfach völlig unbedarft in die Oper, hat vorher nichts gelesen darüber und sitzt dann trotzdem da und sagt: "Ha, ist das toll!" Die zweite Unmittelbarkeit ist diejenige, die auch noch jemanden wie Sie ergreifen kann, nämlich den Hörer, der sich auskennt, der sich damit intensiv beschäftigt hat. Henze-Döhring: Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man dann, wenn man diesen zweiten Schritt gemacht hat, mehr davon hat. Ich will das – wie Sie es genannt haben – unbedarfte Hören einer Oper überhaupt nicht kritisieren. Wenn sich einer in die Oper setzt und sagt: "Ich will einfach nur einen schönen Abend haben und höre mir das jetzt mal an! Ob ich das verstehe oder begreife, wer da wen liebt oder nicht lieben darf, ist mir vollkommen egal! Ich lass das einfach mal auf mich wirken." Das ist völlig legitim. Und es ist auch völlig legitim, wenn jemand sagt: "Ich will wenigstens wissen, wer wen liebt, und lese mir halt vorher das Textbuch durch oder ein Programmheft." Auch das ist völlig legitim, es gibt da nämlich keine Gesetze. Aber ich bin davon überzeugt, dass man diese Musik dann, wenn man ein bisschen eingedrungen ist in die Sache, wenn man anfängt, davon etwas zu verstehen, noch ganz anders genießen kann. Denn da erschließt sich einem plötzlich eine ganz Welt. Man versteht viel besser! Man fühlt nicht nur, sondern man versteht. Diese Zweiheit von sinnlicher Wahrnehmung und Verstehen ist bei der Musikwahrnehmung sehr, sehr wichtig. Da geht es mir nicht um irgendwelche unwichtigen Buchstaben im Text oder um eine bestimmte Grammatik usw. Nein, es geht mir um das Verstehen im tieferen Sinne. Damit die Menschen dieses tiefere Verstehen bekommen können, dafür arbeitet der Opernforscher, wie ich ihn verstehe. Ich sehe jedenfalls meine Aufgabe als Musikwissenschaftlerin genau darin. Ich möchte also diese beiden Teile überhaupt nicht voneinander trennen. Mende: Denn es wäre ja tatsächlich schlimm, wenn das auf einmal nur mehr über den Kopf liefe. Henze-Döhring: Ja, das wäre aber so was von furchtbar! Es gibt ja solche Leute, aber mein Gott, die nehme ich nicht ernst, die sind halt so. Mende: Sie haben vorhin gesagt, dass die Musik von Verdi einem direkt ins Herz greift. Kann man sagen, dass das etwas ist, was Verdi besonders gut konnte? Henze-Döhring: Ja. Sie haben ja vorhin die Quellen angesprochen. Wir haben heute aufgrund von sehr viel Forscherfleiß die Briefe von Verdi in sehr guten Editionen vorliegen – noch nicht alle, denn es gibt noch keine VerdiGesamtausgabe der Briefe. Aber es gibt z. B. die dreibändige Ausgabe des Briefwechsels von Verdi mit dem Verleger Ricordi, es gibt Bücher zum Briefwechsel von Verdi mit seinen Librettisten. Wenn man das artig liest, dann ist man sozusagen Gast in der Werkstatt von Verdi. Mit Piave z. B. pflegte er einen recht kumpelhaften Ton und schreibt immer wieder: "Komm! Mach mal!" Mende: Piave war einer seiner Librettisten. Henze-Döhring: Genau. Da kann man sehen, wie er sich die Dinge wirklich genau überlegt hat. Das Allerwichtigste, das er begriffen hatte, bestand in Folgendem: Die Musik bei Rossini, bei Donizetti usw. hatte einfach immer zu lange gedauert! Da gab es immer wieder lange Phrasen aus acht Takten und dann noch einmal acht Takten in der Wiederholung. Oder es gab lange Rezitative, in denen die Handlung erklärt und erläutert wurde, damit man auch jede Einzelheit genau versteht usw. Verdi hat jedoch zu seinem Librettisten Piave gesagt: "Fasse dich kurz! Die Leute wollen diese langweiligen Rezitative nicht mehr haben! Fasse dich also kurz! Wenn du etwas in einem Wort statt in zwei Worten sagen kannst, dann sag es in einem!" Und dann kam bei Verdi noch dieser Anspruch bzw. seine große Leistung hinzu, eine Phrase, eine Melodik zu erfinden, die eben knapp, prägnant und in sich komplex war. Denn er hat erkannt, dass die Kategorie des Klanges, der Klangfarbe entscheidend ist, dass sich die dramatische Situation nicht nur über die Melodik mitteilt, sondern ganz wesentlich über die Kategorie des Klanges. Hierfür hat er das berühmte Wort von der "tinta musicale", also von der Farbe der Musik geprägt. Er sagte immer: "Ich habe die Tinta bereits im Kopf! Ich brauch das nur noch hinzuschreiben!" Mit "Tinta" meinte er die Klangfarbe, die genau zum Sujet passen musste. Dafür wollte er jeweils eine ganz bestimmte Klanglichkeit entwickeln. Spezifisch für ihn ist auch noch diese Knappheit, diese ungeheure Dichte seiner Musik, seiner melodischen Formulierung, der knappen Phrase: Da wird nichts mehr erklärt, da ist nichts mehr redundant, da sitzt alles! Das war sein Anliegen und das macht auch seine Größe aus. Mende: Lassen Sie uns jetzt noch ein wenig zum Text, zur Sprache kommen. Ich habe neulich mit jemandem diskutiert, der sowohl Verdi wie auch Wagner singt. Es gibt ja nur ganz wenige Sänger und Sängerinnen, denen es vergönnt ist, beides zu können. Dieser Sänger sagte mir, der Unterschied bestünde darin, dass bei Wagner das Wort, der Text, die Bedeutung des Textes ganz wichtig sei, während Verdi sogar mal gesagt hätte: "Es reicht, wenn man pro Arie zwei, drei Worte erkennt, um zu wissen, worum es so ungefähr geht." Bei Verdi herrscht also ein Vorrang der Musik und der musikalischen Stimmung. Henze-Döhring: Auch dafür gibt es einen Fachausdruck. Mende: Es gibt dazu einen berühmten Satz von ihm. Henze-Döhring: Ja, das ist die Parola scenica. Das meint das knappe und prägnante Wort, das wirklich sitzt: mit einem Schlag, mit einer knappen Formulierung, mit einer sprachlichen Geste, die die Situation voll erfasst. Das meinte ich vorhin, als ich von der Knappheit, der Dichte im Werk von Verdi gesprochen habe. Knappheit könnte ja auch bedeuten, dass etwas weggenommen wird oder dass etwas weniger wird. Aber bei ihm wurde auf der rein textlichen Ebene nur dieses redundante Erläutern und Erklären weggenommen. Und durch die Musik kam dafür etwas hinzu. Aber eben nicht irgendeine Musik, sondern Musikdramatik. Und das hat er meisterhaft verstanden. Mende: Es gab ja auch vorher schon hervorragende Komponisten wie Donizetti, Rossini oder auch Bellini, der großen Einfluss auf Verdi hatte. Heißt das, dass diese Vorgänger von ihm all das nicht so "zusammenfassen" konnten? Denn das Besondere von Verdi war wohl, dass er diese Sachen konzentrieren konnte. Und dennoch gibt es Opern von Verdi wie z. B. "Don Carlos", die, wenn man sie fünfaktig spielt, auch in etwa viereinhalb Stunden lang sind. Das heißt, es bleibt trotzdem auch bei Verdi immer noch eine ganze Menge Musik und Wort. Henze-Döhring: Diese Oper dauert in der Tat länglich, und wenn man die komplette Fassung nimmt mit dem Fontainebleau-Akt, dann stimmt das. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Dieser Fontainebleau-Akt, der zwar in der italienischen Bearbeitung immer weggefallen ist, dann aber durch die wunderbare Editionsarbeit von Ursula Günther wiederentdeckt wurde, wird seit ungefähr Mitte der 70er Jahre wieder öfter gespielt. In diesem Akt kommt es erstmals zu der Begegnung zwischen Elisabeth und Carlos. Er will schauen, wer denn nun diese Frau ist, die ihm als Ehefrau zugesprochen worden ist. Es kommt also so allmählich zu der Begegnung zwischen den beiden. Er begreift dann: "Das ist die Frau meines Lebens! Diese Frau liebe ich! Das ist sie!" Sie wiederum fühlt das Gleiche: Mit einem Schlag ist auch bei ihr die große Liebe da! Und in dem gleichen Moment wird im Hintergrund der Frieden verkündet. Mende: Und das bedeutet, dass diese Ehe zwischen Elisabeth und Don Carlos nun nicht mehr sein darf. Henze-Döhring: Ja, sie darf nun nicht mehr sein. In diesem einen Duett wird wirklich zugleich, also zu gleicher Zeit erfasst, dass das wirklich eine große Liebe ist – diese Liebe ist ja politisch geplant gewesen, weswegen es gut hätte sein können, dass sich die beiden überhaupt nicht lieben – und dass diese große Liebe mit der Haupt- und Staatshandlung, wie man das früher genannt hat, auf eine ganz bestimmte Weise verknüpft ist, nämlich mit diesem Friedensschluss. Fontainebleau ist zwar die ganze Zeit hinten zu sehen, zunächst völlig unscheinbar, aber auf einmal leuchtet es in ungeheurem Glanz und es kommt die Nachricht vom Friedensschluss, der für die beiden eine Katastrophe bedeutet, denn Elisabeth soll nun nicht mehr Carlos heiraten, sondern dessen Vater Philipp II. Mende: Es gibt Opern von Verdi, wenn man da versucht, deren Geschichte zu erzählen, bekommt man zuerst einmal einen Schweißausbruch und braucht mindestens fünf Stunden, um das alles darzulegen, weil da so unglaublich viel Vorgeschichte usw. mit dabei ist. Das ist sicherlich etwas, was einen verwirrt. Selbst wenn man eine ganzseitige Inhaltsangabe gelesen hat, weiß man von der Geschichte, die sich auf der Bühne abspielt, noch nicht allzu viel. Dieses hat freilich einen Vorläufer, denn gerade bei der Belcanto-Oper sind die Geschichten ja oft nur ein äußerer Anlass für etwas. Das heißt, die Arien sind in ihrem textlichen Gehalt kaum erkennbar. Nehmen wir mal die berühmte Wahnsinn-Arie der Lucia aus "Lucia di Lammermoor": Wenn man das hört, ohne zu wissen, was das ist, dann könnte man wirklich alles Mögliche in diese Arie hineininterpretieren. Ist der Umstand, dass für Verdi das einzelne Wort, der Text nicht so wichtig gewesen ist, sondern dass es ihm viel eher auf die Tinta, auf diese Grundfarbe angekommen ist, der Grund dafür, dass er sich Libretti andrehen ließ, von denen man sagen kann, dass sie eigentlich noch mal richtig überarbeitet gehört hätten? Nehmen wir mal die Oper "Il Trovatore", also "Der Troubadour": Das ist doch eine haarsträubende Geschichte! Henze-Döhring: Na ja, so haarsträubend ist sie gar nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, als ich noch jünger war, ... Mende: ... haben Sie das auch gedacht? Henze-Döhring: Ja, da hatte ich das gelesen und kaum hatte ich es gelesen, hatte ich es schon wieder vergessen. Als ich dieses Buch nun geschrieben habe, musste ich mich aber wieder intensiv damit beschäftigen. Das Problem dabei ist ja der Transferprozess, denn ich wollte einen knappen Text produzieren. Ich kann heute sagen, dass man diese Geschichte sehr wohl begreift und man begreift sie auch sehr schnell. Aber bis in jedes Detail hinein muss man diese Geschichten gar nicht verstehen, um die ganze Oper zu verstehen. Bei Verdi ist es ja so, dass er sich diese Texte selbst ausgesucht hat. Es ist ja auch so ein Irrtum, wenn man immer sagt, Verdi sei halt ein typischer Italiener gewesen: Bekommt einen Text vorgelegt und dann muss dieser arme Kerl so eine Tragödie mit so einem verwirrenden Text irgendwie vertonen. Aber so war es gar nicht, sondern er hat sich nach den ersten zwei, drei Opern die Sachen selbst ausgesucht. Das Hauptproblem bestand immer darin, eine gute Vorlage zu bekommen. Er hat immer gesucht, gesucht, gesucht, bis er fündig geworden ist. Und dann erst hat er sich an die Arbeit gemacht. Und er hat eben auch selbst mit seinem Librettisten das Libretto erarbeitet und hat sich diese Textvorlage dabei so zugeschnitten, dass sie zu seinen dramatischen, zu seinen operndramaturgischen Vorstellungen passte. Piave und Verdi haben oft Seite an Seite zusammengesessen und haben an den Texten letzte Hand angelegt. Er, Verdi, hat da halt oft in seiner typisch harschen Art Kommandos erteilt, wie das zu funktionieren hat. Die Libretti von Verdis Opern sind meiner Meinung nach keine Lesedramen oder Lesestücke, sondern es Stücke für das Theater im Allgemeinen und für das Musiktheater im Besonderen. Aus diesem Grund habe ich das bei meinem Büchlein eben anders gemacht als in normalen Opernführern, wo erst langatmig die Handlung geschildert wird, dann der Kommentar dazu folgt und am Ende ein paar Sätze zur Musik verloren wird. Stattdessen führe ich den Leser eigentlich durch das vertonte Werk. Das war mir sehr wichtig und das habe ich da umgesetzt. Ich habe also nicht geschrieben: "1. Akt: So und so lieben sich, aber der und der ist dagegen!" Ich habe stattdessen versucht, das dramatische Geschehen in Verbindung zu bringen mit dem in Musik übertragenen Geschehen – denn das ist auch Ereignis, das ist auch Handlung, eben in Musik gegossene dramatische Handlung. Mende: Wagner hat daraus ja die Konsequenz gezogen und gesagt: "Ich schreibe meine Texte selbst!" Sie sagten soeben, dass die Texte, dass auch die frühen Texte der frühen Opern doch nicht so verwirrend sind, wenn man sie liest. Oft werden da ja historische Ereignisse verarbeitet, die dann auch noch meistens mit einer Liebesgeschichte verknüpft werden – selbst dann, wenn die reale Vorlage eine rein politische Geschichte gewesen ist. Glauben Sie nicht, dass der Erfolg einer Oper mit einer nachvollziehbaren Geschichte zusammenhängt? Oder war damals der Gang in die Oper für die Menschen so etwas wie der sonntägliche "Tatort"? Die Menschen damals wollten einfach eine spannende Geschichte erleben? Henze-Döhring: Der Opernbesuch war nicht etwas für die allgemeine, also die sogenannte breite Bevölkerung, denn das war einfach teuer. Wenn wir an die italienische Oper der Verdi-, Rossini-, Donizetti- oder Bellini-Zeit denken, dann war etwas ganz wichtig, was wir heute gelegentlich vergessen, weil unsere Wahrnehmung heute eine ganz andere ist: Der Gesang war zentral. Mende: Kann man sagen, dass den Menschen damals die Geschichte, die Story selbst nicht so wichtig gewesen ist? Henze-Döhring: Nun, ich kann die Menschen von damals ja nicht mehr befragen und ich kann auch in deren Köpfe nicht mehr hineinschauen. Aber wenn man sich die damaligen Selbstzeugnisse anschaut, dann merkt man, dass wir aus heutiger Sicht den Gesang doch oft unterschätzen. Das merkt man auch, wenn man sich anschaut, wie sehr die Komponisten darauf geachtet haben, wer diese Partien überhaupt interpretiert. Die Hauptsorge der Komponisten war ja immer, die richtigen Sänger zu finden. Bei Giacomo Meyerbeer war das ganz stark ausgeprägt, denn er hat teilweise seine Werke ewig liegen lassen, weil er die geeigneten Sänger nicht hatte. Bei Verdi war das nicht viel anders. Wer überhaupt singt, wer die Partien interpretiert, war ihm sehr, sehr wichtig. Denken Sie an den berühmten Felice Varesi, der in der Uraufführung der Oper "Rigoletto" den titelgebenden Hofnarren gesungen hat, denn da merkt man einen sogenannten Wandel im Denken dessen, was bei einem Sänger wichtig ist: kein reiner Schöngesang mehr, sondern der Gesang muss dramatisch wahr sein, muss dramatisch charakterisiert sein. Wenn man die damaligen Rezensionen liest, dann stellt man fest, dass die Handlung nur kurz erzählt wird, während man sehr ausführlich auf die Sänger einging. Diese Begeisterung für den Gesang! Das ist die Ebene, die uns eine Antwort geben kann bei der Frage, warum die Menschen damals in so großer Schar in die Oper gegangen sind: Es ging ihnen meiner Meinung nach in erster Linie um die Sänger. Mende: Heute ist es ja fast schon umgekehrt: Da wird ausführlichst über die Inszenierung geschrieben und nur relativ wenig über die Sänger. Anders war wohl auch, dass sich die Besucher der Oper relativ wortreich verhalten haben. Es gibt einen Bericht von Berlioz über eine DonizettiOper, in dem er schreibt, er hörte überhaupt niemanden mehr singen, er habe nur noch gesehen, wie da die Sänger auf der Bühne ihre Münder auf und zu gemacht hätten. Das heißt, das heute übliche andachtsvolle Ausharren im Opernhaus ohne zu sprechen war damals noch nicht bekannt. Wenn heute jemand hustet, dann wird sofort "pssst!" gemacht. Damals war das nicht so: Eine Oper war ein Unterhaltungsunternehmen. Henze-Döhring: Ja, man ging das damals ganz entspannt an: Das war eben Unterhaltung, wirklich Unterhaltung. Aber ich möchte gerne noch darauf eingehen, warum heute die Regie so wichtig geworden ist. Das hängt, wie ich vermute – wissen kann ich das nicht, ich kann das wirklich nur vermuten –, damit zusammen, dass die Menschen heute doch sehr viel mehr Wert auf das Visuelle Wert legen. Man nimmt heute in allen Bereichen des Lebens vor allem visuell wahr: Man schaut. Damals jedoch war die Attraktion eben der Gesang. Mende: Gab es denn eine regelrechte Inszenierung bereits zu Verdis Zeiten? Ich habe mal gelesen, dass Goethe einer der Ersten gewesen ist, der damals als Intendant in Weimar regelrecht inszeniert hat. Die damaligen Schauspieler hätten daraufhin gefragt, ob Goethe einen Vogel habe: "Der will uns erzählen, wie wir den Text aufzusagen und wo wir zu stehen haben!" Die Opernsänger damals jedenfalls reisten von Ort zu Ort, weil sie als Gäste engagiert wurden. Sie hatten wohl auch alle ihre eigenen Kostüme mit dabei. Gab es denn damals schon einen Regisseur, der gesagt hat: "Du kommst von dort unten, singst hier im Liegen und dann lässt du dich von dort oben runterfallen!"? Henze-Döhring: Es gab einen Spielleiter, aber man hatte damals noch nicht das, was man ein Regiekonzept nennen könnte. Was jedoch sehr wichtig war, war die Ausstattung. Gerade bei Verdi kann man in seinen frühen Opern wie z. B. "Alzira" bereits sehr gut beobachten, wie er überlegt und mitdenkt: "Als Komponist kann ich doch nicht nur auf das in Musik gegossene Drama an sich achten. Ich muss doch bei meiner Musik auch überlegen, welchen Schauplatz ich z. B. habe." Das nannte man damals "Couleur locale": Die Wiege dieser Art zu komponieren – also mit "Couleur locale" und "Couleur de temps", also mit der Farbe des Ortes und der Zeit – war in Paris in den Jahren ungefähr um 1830. Verdi hat sehr, sehr früh darauf reagiert und hat sich Gedanken darüber gemacht, in welcher Zeit sein Musikdrama eigentlich spielt. Und dann hat er versucht, so etwas wie Couleur locale und Couleur de temps mit in seine Komposition einzubeziehen. Aber den Regisseur, der gesagt hätte: "So, das ist also das Stück, aber jetzt will ich mal sehen, was ich daraus mache oder wie ich das interpretiere oder wie ich glaube, dass die Menschen das verstehen müssen!", den hat es nicht gegeben. Mende: Ich kann mir vorstellen, dass nun viele, die Sie sehen und Ihnen zuhören, sagen: "Ach Gott, was war das für eine schöne Zeit damals! Gäbe es die doch heute auch noch!" Henze-Döhring: Man kann ja sehr wohl das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich kenne wunderbare Regiekonzepte, die wirklich überzeugend sind. Das ist einfach unsere heutige Zeit und dabei kann es von mir aus auch bleiben. Aber man darf auch nicht die Regieleistung diskreditieren, die das eben nicht macht, die nicht eine Metaebene mitinszeniert. Mende: Die ersten Opern von Verdi waren kein Erfolg, die erste Oper, die wirklich großen Erfolg hatte, war "Nabucco". Danach gab es diese berühmte mittlere Phase, in der er drei ganz große Erfolge komponiert hat. Anschließend kam sozusagen die Spätphase und daraufhin eine lange Ruhepause. Und zum Schluss kamen noch als Alterswerke "Otello" und "Falstaff". In seinem langen Leben hat Verdi natürlich nicht nur komponiert, sondern auch ein persönliches, ein privates Leben geführt. Seine erste Frau ist relativ früh gestorben, seine zwei Kinder ebenfalls und er wollte aufhören zu komponieren. Danach hat er dann zwölf Jahre in "wilder Ehe" mit der Sängerin Giuseppina Strepponi zusammengelebt, bevor er sie geheiratet hat. Findet sich dieses private Leben denn in seinen Werken wieder? Wir haben vorhin schon über "La Traviata" gesprochen. In dieser Oper geht es um die von der Gesellschaft ausgegrenzte Frau: Hatte das etwas mit seiner zweiten Frau zu tun, die ja von der Gesellschaft damals sehr misstrauisch beäugt worden war? Wie viel persönliches Leben hat denn Verdi in seine Werke hineingegeben? Henze-Döhring: Ich persönlich sehe keinen Bezug zu seinem Privatleben und zu seinen Werken. Ich kenne, wie ich mir einbilde, die Quellen sehr genau. Die Strepponi hat selbstverständlich mit geschaut bei seiner Textauswahl. Er hatte ja so eine kleine Anthologie spanischer Dramen: Es kann sein, dass sie ihm das nahegebracht hat und dass sie vielleicht gemeinsam nach neuen Vorlagen gesucht haben. Sie hat sicherlich einen sehr, sehr großen Anteil an seinem Leben auch als Komponist und hat an seiner Berufstätigkeit im weitesten Sinne partizipiert. Aber dass persönliche Erfahrungen auf so eine ganz psychologische Art in die Werke eingegangen wären, ist außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Stattdessen glaube ich, dass er sich einfach sehr, sehr intensiv mit der Literatur auseinandergesetzt hat. Denn das war ja Literatur, das waren keine realen Lebensgeschichten. Das waren z. B. Romane von Victor Hugo, das waren Theaterstücke von Shakespeare oder von Schiller usw. Mende: Das, was dann bei ihm dabei herausgekommen ist, war aber, wie man wohl sagen muss, immer Shakespeare oder Schiller "light". Henze-Döhring: Das war eben kein Sprechtheater, sondern das war eben Musiktheater. Das heißt, er musste diese Literatur, diese Dramen im Grunde genommen in ein ganz anderes Medium übertragen. Mende: Das ist wohl so, wie wenn man z. B. ein Buch verfilmt, oder? Henze-Döhring: Ja, genau. Man überträgt ein Werk eines bestimmten Mediums in ein neues Medium: z. B. ein Schauspiel in eine Oper. Man kann das, wenn Sie unbedingt wollen, als defizitär betrachten, aber dann misst man so eine Oper an Maßstäben, die man an eine Oper nicht anlegen sollte. Verdis Opern sind Opern und keine vertonte Literatur! Denn das ist der springende Punkt. Nehmen wir den Vergleich von "Don Carlos" bei Schiller und Verdi. Ich habe mich mit diesem Thema selbst mal intensiv auseinandergesetzt und auch mal vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten über "Schillers Belcanto-Opern". Bei diesem Buch nun habe ich erneut gemerkt: Das eine ist das eine und das andere ist das andere! Das heißt, das ist nicht Schillers Drama mit Musik, sondern etwas anderes, Neues. Mende: Man sollte also das Drama von Schiller möglichst gar nicht kennen, wenn man diese Oper anschaut. Das ist vermutlich so, wie wenn man in einen Film geht und den Roman, der dem Film zugrunde liegt, vorher bereits gelesen hat: Das ist meistens enttäuschend. Wagner hatte ja nach der gescheiterten Revolution des Jahres 1848, an der er ja doch so weit beteiligt gewesen war, dass er steckbrieflich gesucht wurde und vielleicht sogar füsiliert worden wäre, wenn er nicht nach Zürich geflohen wäre, jedenfalls das Gefühl, er müsse nun die Welt mittels der Kunst verändern und bessern. Was wollte denn Verdi mit seinen Opern? Henze-Döhring: Verdi wollte erfolgreiche Opern schreiben. Mende: Er war also jemand, der Karriere machen wollte, der den Erfolg genießen und Geld verdienen wollte. Henze-Döhring: Richtig. Da gibt es bei Verdi überhaupt kein Vertun: Er wollte mit seinen Opern nicht die Welt verbessern. Verdi war gleichwohl politisch sehr interessiert und hat sehr wohl wahrgenommen, was um ihn herum passierte. Aber er wollte mit seinen Opern nicht die Welt verbessern. Wenn das jemand behaupten sollte, kann ich nur sagen, dass es dafür überhaupt keinen Beleg gibt. Er hat, das wird z. B. sehr oft vergessen, gar nicht so regelmäßig in Italien gelebt, sondern er war über Jahre hinweg in Paris. Eine Kollegin von mir hat vor Jahren penibel Tag für Tag recherchiert, wo er wann gewesen ist: Er war viele Jahre in Paris, ist dort viel ins Theater gegangen und hat einfach sein "Ding gemacht" als Opernkomponist. Er wollte ein erfolgreicher Opernkomponist sein und er wollte Geld damit verdienen, möglichst viel Geld. Er wollte an seinen Werken auch Verwertungsrechte haben, wie er das in Paris gelernt hat, denn er hat das dann auch für Italien mit seinem Verleger Ricordi ausgehandelt. Mende: Es ging ihm also um die Urheberrechte, die es in diesem Sinne davor in Italien gar nicht gegeben hat. Donizetti hat, glaube ich, 70 Opern in 20 Jahren schreiben müssen, um davon leben zu können. Denn wenn seine Oper fertig war, wurde sie aufgeführt und er besaß keine Rechte mehr daran. Jeder konnte sie hinterher jeder aufführen, wann und so oft er wollte. Henze-Döhring: Genau. Und in Paris hat Verdi eben so etwas wie ein Urheberrecht kennengelernt. Er hat das im Zuge seiner frühen Oper "Jérusalem" mitbekommen, denn diese Oper wurde in den 1840er Jahren in Paris uraufgeführt und sollte dann auch in Italien gespielt werden. Deswegen hat er dann damit begonnen, mit seinem Verleger Ricordi Verträge abzuschließen, die ihm eine Partizipation an den sogenannten Verwertungsrechten sicherten. Das klappte dann aber nicht sofort, denn zunächst einmal sollte das eine große fixe Summe sein. Man stellte dann aber fest, dass in schlechten Zeiten die Leute nicht mehr in die Oper gingen, sodass sich das nicht hinten und nicht vorne rechnete. Also hat man eine prozentuale Beteiligung ausgehandelt usw. Verdi war einfach ein gewiefter Geschäftsmann und wollte Geld verdienen. Für Verdi gab es, das kann ich hier klipp und klar sagen, keinen künstlerischen Erfolg, wenn die Kasse nicht stimmte. Mende: Das widerspricht einfach sehr den gängigen Vorstellungen von Verdi. Ihr Buch rückt da wohl einiges zurecht. Man hat ja so die Vorstellung von Verdi als gutem Menschen ... Henze-Döhring: Auch ein erfolgreicher Geschäftsmann kann durchaus ein guter Mensch sein. Das schließt sich ja nicht aus. Mende: Hat er denn diese PR gefördert oder hat man das sozusagen über ihn drübergestülpt? Waren das andere, die dieses ganz extrem positive Bild des Menschenfreunds Verdi gezeichnet haben? Henze-Döhring: Das kam erst in späterer Zeit. Das stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das, was Sie als professionelles Marketing bezeichnet haben, kam z. T. schon auf, als der Verleger Giulio Ricordi für die späten Opern "Otello" und "Falstaff" mit unglaublichem Geschick Verdi vermarktete. Nehmen Sie als Beispiel die frühe Verdi-Biografie von Arthur Pougin und diese Geschichte mit "Nabucco" und dass Verdi nur einen Blick gebraucht hätte, um festzustellen: "Ah, das ist das Stück!" Das sind ja alles Legenden, die von meinen Kollegen und Kolleginnen längst enthüllt wurden – d. h. ich kann da von deren Kärrnerarbeit nur profitieren. Das war also ein Image. Diese Biografie von Pougin ist ja in Frankreich in einer Vorform in einer Zeitung in 18 Teilen erschienen. Dort stehen all diese Anekdoten noch nicht drin. Später kam diese Biografie in Mailand in Buchform heraus. Da standen dann plötzlich in den Anhängen zu den Kapiteln all diese Anekdoten drin. Und Anekdoten sind nun einmal immer lustiger als die Wahrheit. Mende: Liegt dem auch das Bedürfnis des Publikums zugrunde, dass ein Mensch, der Großes geschaffen hat, auch ein lieber, guter Mensch gewesen sein muss? Das ist ja das, was die Leute bei Wagner so stört, wenn sie sagen: "Das ist tolle Musik, aber das muss man von ihm als Person trennen, denn er als Mensch war ein Ekel. Aber seine Musik ist großartig." Man hätte also so gerne, dass beide Eigenschaften in einer Person zusammenkommen, das Gute und das Große. Henze-Döhring: Sie fragen also, ob Verdi ein guter Mensch gewesen ist? Mende: Nein, ich frage mich, ob dieses Zusammenfügen eines Bildes, wie das bei Verdi geschehen ist, daher kommt, dass man sich das eben so wünscht: dass derjenige, der Großes schafft, eben auch ein guter Mensch ist. Henze-Döhring: Das mag sein. Aber das würde dann ja bei Wagner überhaupt nicht passen. Mende: Ja, das ist ja diese Diskrepanz, diese Ambivalenz, die man bei ihm hat und unter der man leidet. Jeder Wagnerianer leidet unter dieser Diskrepanz und beginnt daher jeden Satz zu diesem Thema mit den Worten: "Leider ..., das muss man irgendwie verstehen ..., das kann man vielleicht nachvollziehen ..." Bei Verdi hat man es hingegen geschafft, das Werk und diesen Menschen gleichzeitig positiv zu gestalten. Henze-Döhring: Hier könnte natürlich immer noch, das fällt mir gerade im Moment ein, das Klischee in Bezug auf die italienische Oper eine Rolle spielen. Denken Sie daran, wie man Rossini rezipiert hat: als Koch, der so gerne und so viel und so gut isst. Mende: Und als jemand, der immer seine Witzchen gemacht hat, während wir heute wissen, dass er unter Depressionen litt. Henze-Döhring: Ja und man beschrieb ihn als kindlich usw. usf. Heute jedoch wissen wir, dass er ein ganz komplexer und schwieriger Charakter mit einer eigentlich schwierigen Existenz gewesen ist. Das hat einfach mit diesem Klischee über die italienische Oper zu tun, die im Gegensatz zur deutschen Oper stehen soll. Die italienische Oper ist Melodie und Belcanto und man singt, was man in der Seele fühlt, während die deutsche Oper die Harmonie ist, der Nebel, das Gedachte, das Dunkle, das Komplexe, das Tiefsinnige und das Tiefgründige. Die italienische Oper soll dagegen leicht, heiter, unproblematisch sein. Das, was Sie sagen, kann also schlicht mit diesem Klischee zusammenhängen, mit dieser etwas antagonistischen Sichtweise von italienischer und deutscher Musik, die wirklich ururalt ist und immer mit denselben Bildern operiert: dunkel und harmonisch, melodisch und leicht usw. Deswegen hat man dann vielleicht auch die Menschen so gesehen. Ich glaube nicht, dass Verdi ein einfacher Zeitgenosse oder gar ein fröhlicher Mensch gewesen ist – vor allem dann nicht, wenn er Schwierigkeiten hatte und nicht komponieren konnte. Mende: Puccini hingegen war angeblich ein richtiger Lebemann: Er besaß das erste Auto, das erste Motorrad überhaupt, fuhr als Erster Motorboot usw. Das sind die Klischees, an denen man sich gerne festhält, die aber eigentlich absolut trivial sind. Man sagt ja bis heute, ein Intendant habe, wenn er sein Haus voll bekommen muss, sozusagen eine "ABC-Waffe", nämlich die Opern "Aida", "La Bohème" und "Carmen". "Aida" ist auch tatsächlich, wie ich gelesen habe, die Oper mit den allermeisten Gesamtaufnahmen, nämlich mit über 200. Wenn man sich nun – angeregt vielleicht auch durch diese Sendung – mit Verdi beschäftigen möchte, sich aber nicht den Tort antun will, alle seine Opern von der Anfangszeit bis zum "Falstaff" anzuhören, mit was sollte man dann Ihrer Meinung nach beginnen? Bei welcher Oper "entdeckt" man sozusagen die Mitte Verdis? Henze-Döhring: Ich würde mit "Rigoletto" anfangen. Ich mache gerade ein Seminar über Verdi und hatte dabei das für mich sehr freudige Erlebnis, dass jemand, der überhaupt noch nichts mit Verdi zu tun hatte, der nur deshalb dieses Seminar besucht, weil er das von seinem Studienplan her so machen muss und sich darüber zu Beginn keineswegs gefreut hat, dass also dieser Student dann mit wirklich leuchtenden Augen und Lobgesängen gesagt hat, er sei glücklich, dass er dadurch "Rigoletto" kennengelernt habe. Durch "Rigoletto" hat er wirklich einen Zugang zur Musik von Verdi gefunden. Bei einem Referat im Seminar merkt man einfach, ob jemand das Thema nur herunterleiert oder ob jemand wirklich ein Verhältnis zum Thema bekommen hat. Ich würde also vorschlagen, mit "Rigoletto" zu beginnen – und mit "La Traviata". So würde ich jedenfalls einsteigen. Nicht vergessen darf man aber die Oper "Ernani", die heute nicht mehr so bekannt ist, die damals jedoch sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Und dann sollte man sich – das ist freilich die Oper, der meine persönliche Leidenschaft gehört – "Don Carlos" widmen. Dieses Werk liebe ich in der fünfaktigen Fassung über alles, denn ohne den ersten Akt mag ich es nicht so gerne: Gerade der erste Akt mit seinem Duett und seinem Finale ist absolut wunderbar! Mende: Dann müssen Sie diese Oper aber in aller Regel auch auf Französisch ertragen. Henze-Döhring: Ja, das stimmt. Mende: Es macht Ihnen also nichts aus, dass da der Italiener Verdi eine Oper mit einem französischen Text geschrieben hat? Henze-Döhring: Nein. Verdi war ein Kosmopolit, er hat lange Jahre in Paris gelebt, hat sich dort sozialisiert und ging dort auch regelmäßig ins Theater, ins Boulevardtheater. Er hat das alles in sich aufgesogen wie ein Schwamm. Das ist ja schon wieder dieses Klischee: der Italiener mit seiner italienischen Musik und seiner italienischen Sprache, in der der Volksgeist wabern soll. Das ist schon wieder das alte Klischee, von dem ich ja gerade ein bisschen weg wollte. Mende: Aber die Oper lebt schon auch von den Klischees. Henze-Döhring: Ja, richtig, sie lebt auch von den Klischees. Mende: Und die genießen wir. Wie schön, wenn unsere Vorurteile und Klischees dann auch noch Bestätigung finden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke in Verdi und seine Zeit und in die Verdi-Opern. Alles Gute Ihnen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich auch ein herzliches Dankeschön für Ihre Interesse. Henze-Döhring: Ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier über Verdi zu sprechen. Mende: Herzlich gerne. © Bayerischer Rundfunk