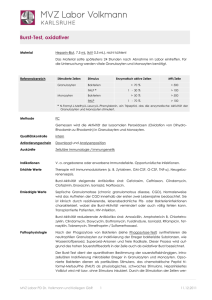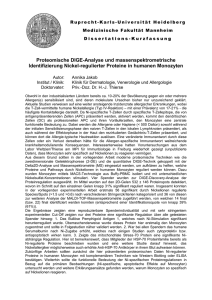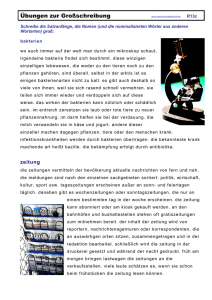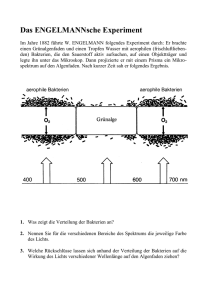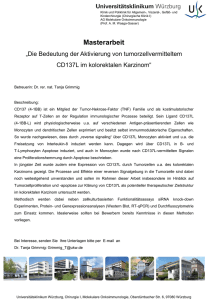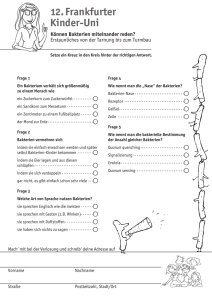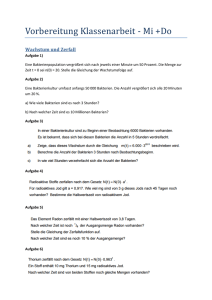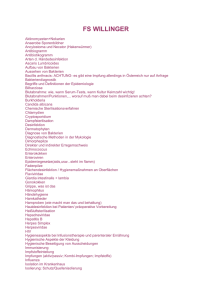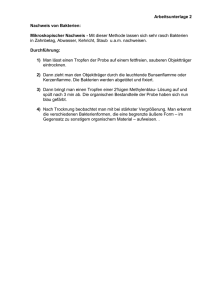Wachstumsphasenabhängige Merkmale von Streptococcus suis
Werbung

Tierärztliche Hochschule Hannover Institut für Mikrobiologie Wachstumsphasenabhängige Merkmale von Streptococcus suis und deren Bedeutung für das Überleben im Wirt INAUGURAL - DISSERTATION zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Naturwissenschaften - Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt von Daniela Willms Bad Oeynhausen Hannover 2014 Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Peter Valentin-Weigand Institut für Mikrobiologie Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 1. Gutachter: Prof. Dr. Peter Valentin-Weigand 2. Gutachter: Prof. Dr. Georg Herrler Tag der mündlichen Prüfung: 03.11.2014 Die vorliegende Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn, im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 587 „Immunreaktionen der Lunge bei Infektion und Allergie“ gefördert. Für Mama Diese Arbeit wurde in Teilen veröffentlicht: Publikation Willenborg, J., Willms, D., Bertram, R., Goethe, R., und Valentin-Weigand P. (2014) Characterization of multi-drug tolerant persister cells in Streptococcus suis. BMC Microbiol. 14:120. doi: 10.1186/1471-2180-14-120 Präsentation Willms, D., Willenborg, J., Rohde, M., Goethe, R. und Valentin-Weigand, P. (2012) Growth dependent interactions of Streptococcus suis serotype 2 and 9 strains with porcine monocytes 112th ASM General Meeting, San Francisco, 16.-19. Juni 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................... 17 2 Schrifttum...................................................................................... 21 2.1 Streptococcus suis ....................................................................................... 21 2.1.1 Epidemiologie .................................................................................................21 2.1.2 Virulenzfaktoren und Virulenz-assoziierte Faktoren .........................................23 2.2 Wachstumsphasenabhängige Regulation bei Bakterien .............................. 29 2.2.1 2.3 Pathomechanismen und Erreger-Wirtszell-Interaktionen bei S. suis............ 33 2.3.1 Pathogenese von S. suis-Erkrankungen..........................................................33 2.3.2 Allgemeine Merkmale von Monozyten und deren Bedeutung für S. suis: (Modifizierte) Trojan horse theory ....................................................................35 2.3.3 Interaktion von S. suis mit Monozyten und Makrophagen................................38 2.4 3 Wachstumsphasenabhängige Genregulation in S. suis ...................................32 Antibiotikaresistenz und -toleranz von Bakterien ......................................... 42 2.4.1 Therapie und Resistenz gegenüber Antibiotika ...............................................42 2.4.2 Antibiotikatoleranz und Persisterzellen ............................................................43 2.4.3 Genetik von Persistern ....................................................................................46 2.4.4 Mechanismen der Persisterformation ..............................................................48 2.4.5 Persister und small colony variants (SCVs) .....................................................49 2.4.6 Eliminierung von Persistern .............................................................................50 2.4.7 Persisterbildung und Antibiotikatoleranz von Streptokokken............................51 Material und Methoden ................................................................. 53 3.1 Material ........................................................................................................ 53 3.1.1 Chemikalien, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Geräte........................53 3.1.2 Bakterienstämme ............................................................................................53 3.1.3 Antikörper........................................................................................................54 3.1.4 Antibiotika .......................................................................................................55 3.2 Methoden ..................................................................................................... 55 3.2.1 Bakteriologische Methoden .............................................................................55 3.2.2 Bestimmung von Antibiotikatoleranzen ............................................................58 3.2.3 Zellbiologische Methoden ................................................................................62 4 3.2.4 Interaktion von S. suis mit CD14-positiven Monozyten ....................................70 3.2.5 Proteinbiochemische Methoden ......................................................................79 Ergebnisse .................................................................................... 84 4.1 Wachstumskinetiken verschiedener Streptokokken-Spezies ....................... 85 4.2 Wachstumsphasenabhängige Persisterbildung von S. suis ......................... 88 4.2.1 MHK-Bestimmung ...........................................................................................89 4.2.2 Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis gegenüber Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen .......................................................................90 4.2.3 Vererbbarkeit der Persistenz von S. suis .........................................................94 4.2.4 Eliminierung von S. suis-Persisterzellen ..........................................................96 4.2.5 Small-colony-variants (SCV)-ähnlicher Phänotyp von S. suis nach Gentamicinbehandlung ...................................................................................98 4.2.6 Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis gegenüber Antibiotikakombinationen ................................................................................99 4.2.7 Toleranz von S. suis gegenüber Gentamicin nach Hemmung der PMF .........103 4.2.8 Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suisStoffwechselmutanten gegenüber Gentamicin ..............................................104 4.2.9 Wachstumsphasenabhängige Toleranz verschiedener S. suis-Stämme gegenüber Gentamicin ..................................................................................108 4.2.10 Verlängerte Antibiotikatoleranz verschiedener Streptokokken-Spezies .........111 4.3 5 6 Wachstumsphasenabhängige Wechselwirkung von S. suis mit porzinen Monozyten ................................................................................................. 114 4.3.1 Präparation und Charakterisierung porziner MNCs und CD14-positiver Monozyten ....................................................................................................116 4.3.2 Überlebensfähigkeit von S. suis in Anwesenheit porziner CD14-positiver Monozyten ....................................................................................................126 4.3.3 Auswirkungen von S. suis auf die Vitalität und Morphologie porziner CD14-positiver Monozyten ............................................................................139 4.3.4 Induktion der ROS-Produktion porziner CD14-positiver Monozyten durch S. suis ...........................................................................................................144 Diskussion .................................................................................. 148 5.1 Wachstumsphasenabhängige Persisterbildung von S. suis ....................... 150 5.2 Wachstumsphasenabhängige Wechselwirkung von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten ........................................................................ 163 Zusammenfassung ..................................................................... 175 7 Summary ..................................................................................... 178 8 Literaturverzeichnis.................................................................... 181 9 Anhang ........................................................................................ 217 9.1 Ergebnisse ................................................................................................. 217 9.1.1 Kapseldicke der S. suis Serotypen 2 (10) und 9 (A3286/94) während des Wachstumsphasenverlaufs ...........................................................................217 9.1.2 Überleben von S. suis in PBS .......................................................................218 9.1.3 Vermehrungsfaktor von S. suis in RPMI-Medium ..........................................218 9.1.4 S. suis (10): Vergleich der Überlebensfähigkeit von kryokonservierten und frisch kultivierten Bakterien nach Gentamicinbehandlung ..............................219 9.1.5 Vergleich der Überlebensfähigkeit von S. suis-Stamm 10 in verschiedenen Medien nach Gentamicinbehandlung ....................................219 9.1.6 Auswirkungen der MHK von Gentamicin auf die Ausprägung der Antibiotikumtoleranz von S. suis-Stamm 10 im Heritabilitätstest....................220 9.1.7 Überlebenskinetik der erythromycinresistenten Mutante 10∆ccpA und von S. suis-Stamm 10 in Anwesenheit von Erythromycin. ....................................221 9.1.8 Charakterisierung porziner MNCs anhand der Verteilung von CD-Markern ...221 9.1.9 CFSE-Markierung von S. suis .......................................................................222 9.1.10 ROS-Produktion verschiedener Zellpopulationen ..........................................223 9.2 Reagenzien, Materialien, Geräte und Software ......................................... 224 9.2.1 Reagenzien und Chemikalien........................................................................224 9.2.2 Kits ................................................................................................................226 9.2.3 Verbrauchsmaterialien ..................................................................................226 9.2.4 Geräteverzeichnis .........................................................................................226 9.2.5 Software ........................................................................................................228 9.3 Abbildungsverzeichnis ............................................................................... 229 9.4 Tabellenverzeichnis ................................................................................... 232 Abkürzungsverzeichnis α Alpha ∆ Delta % Prozent < kleiner als 6PDG 6-Phosphoglukonatdehydrogenase A. bidest Aqua bidestillata A. dest Aqua destillata AD Arginin Deiminase ADS Arginin Deiminase System AP alkalische Phosphatase APS Ammoniumpersulfat ApuA Amylopullulanase ATP Adenosintriphosphat BCA engl.: bicinchoninic acid BMEC engl.: brain microvascular endothelial cells BSA bovines Serumalbumin bzw. beziehungsweise °C Grad Celcius Ca Calcium ca. circa CCCP engl.: Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone CcpA engl.: catabolite control protein A CD engl.: cluster of differentiation CDC engl.: cholesterol-dependent pore-forming cytolysins cDNA engl.: complementary DNA CDS engl.: colostrum deprived serum CK Carbamat-Kinase CFSE engl.: carboxyfluorescein succinimidyl ester CNS engl.: central nervous system CO2 Kohlenstoffdioxid cps engl.: capsule polysaccharide CSP engl.: competence stimulating peptide DAPI 4’,6-Diamidin-2-phenylindol DHR Dihydrorhodamin DNA engl.: deoxyribonucleic acid DIF Doppelimmunfluoreszenz DPA engl.: daptomycin protection assay EDTA Ethylendiamintetraessigsäure EF engl.: extracellular factor ENO Enolase et al. lat.: et alii etc. lat.: et cetera evtl. eventuell exp exponentiell FACS engl.: fluorescence-activated cell sorting FBPS engl.: fibronectin and fibrinogen binding protein of S. suis FCS enfl.: fetal calf serum FITC Fluoresceinisothiocyanat FL engl.: fluorescent FlpS engl.: FNR-like protein (von S. suis) FSC engl.: forward scatter g Erdbeschleunigung g Gramm GalU Glukose-1-phosphat Uridylyltransferase GAPDH Glycerinaldehyd-3-Phosphatdehydrogenase GAS Gruppe A-Streptokokken GBS Gruppe B-Streptokokken GlnA Glutamin Synthetase h lat.: hora (Stunde) HEp-2-Zellen Humane Epitheliomzellen Typ 2 HeLa Henrietta Lacks (Namensgeberin für Epithelzellen eines Zervixkarzinoms) i. d. R. in der Regel IgG Immunglobulin G IL Interleukin KBE koloniebildende Einheiten l Liter LPS Lipopolysaccharid M Molarität (mol/l) MACS engl.: magnetic-activated cell sorting MCP-1 engl.: monocyte chemotactic protein one mg Milligramm MHK minimale Hemmkonzentration MIC engl.: minimal inhibitory concentration MIF Membranimmunfluoreszenz min Minute(n) ml Milliliter mM Millimolar MNCs engl.: mononuclear cells MOI engl.: multiplicity of infection MRP engl.: muramidase-released protein µg Mikrogramm µl Mikroliter µM Mikromolar N normal NaCl Natriumchlorid n. d. nicht determiniert ng Nanogramm NH3 Stickstofftrihydrid (= Ammoniak) NK Zellen natürliche Killerzellen nm Nanometer menschliche n. s. nicht signifikant OCT Ornithin-Carbamoylransferase OD optische Dichte OFS Opazitätsfaktor von S. suis PAGE Polyacrylamid-Gelelektrophorese PBS engl.: phosphate buffered saline PE Phycoerythrin PMF engl.: proton-motive force Pgm Phosphoglucomutase pH engl.: power of hydrogen (pH-Wert) PJ Propidiumjodid PTS Phosphotransferasesystem PVDF Polyvinylidenfluorid QS engl.: quorum sensing RALP engl.: RofA-like protein ROS engl.: reactive oxygen species RPMI Roswell Park Memorial Institut RT Raumtemperatur ® engl.: registered trademark SAO engl.: surface antigen one SCV engl.: small colony variant SDS engl.: sodium dodecyl sulphate sek Sekunde(n) SLY Suilysin SSC engl.: sideward scatter7 SLA-II engl.: swine leucocyte antigen II STSS engl.: streptococcal toxic shock syndrome stat stationär SWC engl.: swine workshop cluster TA Toxin-Antitoxin TEM Transmissionelektronenmikroskopie TEMED N, N, N’, N’-Tetramethylethylendiamin TBST engl.: tris-buffered saline Tween-20 THB engl.: Todd Hewitt broth ™ engl.: trade mark TNF-α Tumornekrosefaktor Alpha Tris Tris-(hydroxymethyl-)aminomethan U engl.: unit (Einheit) u. a. unter anderem ÜNK Übernachtkultur UpM Umdrehungen pro Minute V Volt VBNC engl.: viable but not culturable [v/v] Volumen pro Volumen [w/v] Gewicht pro Volumen WT Wildtyp x -fache/mal z. B. zum Beispiel ZNS zentrales Nervensystem Abkürzungen erwähnter Bakterienstämme E. coli Escherichia coli L. lactis Lactococcus lactis M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis P. aeruginosa Pseudomonas aeruginosa S. agalactiae Streptococcus agalactiae S. dysgalactiae Streptococcus dysgalactiae S. gordonii Streptococcus gordonii S. mutans Streptococcus mutans S. pneumoniae Streptococcus pneumoniae S. pyogenes Streptococcus pyogenes S. suis Streptococcus suis Staph. aureus Staphylococcus aureus Einleitung 1 Einleitung Bei Streptococcus (S.) suis handelt es sich um ein grampositives, fakultativ anaerobes, bekapseltes Kokkenbakterium. Der natürliche Wirt des Bakteriums ist das Schwein, in dessen oberen Respirationstrakt, Genitaltrakt und Intestinaltrakt es als Kommensale die Mukosa besiedeln kann (Higgins et al., 1990; Robertson und Blackmore, 1989; Swildens et al., 2004). Eine Besiedlung mit S. suis kann zur Infektion der Schweine führen und Erkrankungen wie Septikämien, Meningitiden, Pneumonien, Endokarditiden oder Arthritiden verursachen (Clifton-Hadley und Alexander, 1980; Staats et al., 1997). S. suis kann auch Menschen, die in engem Kontakt zu Schweinen stehen, infizieren, und gilt deshalb als ein bedeutender Zoonoseerreger. Bei erkrankten Menschen wurden z. B. Endokarditiden und Meningitiden diagnostiziert (Arends und Zanen, 1988; Rosenkranz et al., 2003). In China kam es 1998 und 2005 bei infizierten Menschen zu schweren S. suisAusbrüchen, in deren Zusammenhang u. a. das streptococcal toxic shock-like syndrome (STSS) beschrieben wurde (Tang et al., 2006; Yu et al., 2006). Schweine, die mit S. suis kolonisiert sind, aber keine klinischen Symptome zeigen, können maßgeblich zur Verbreitung des Keimes beitragen. Die Zusammensetzung der polysaccharidhaltigen Kapsel bildet die Grundlage für die Serotypisierung von S. suis. Bisher wurden 33 Serotypen beschrieben, wobei Serotyp 2 weltweit am häufigsten isoliert wurde und als der virulenteste gilt (Gottschalk et al., 2010). Die Kapsel stellt den wichtigsten Virulenzfaktor von S. suis dar. Für Serotyp 2 konnte gezeigt werden, dass sie vor Phagozytose durch porzine Monozyten und murine Makrophagen schützt und somit maßgeblich zur Virulenz von S. suis beiträgt (Charland et al., 1998; Segura et al., 1998; Segura und Gottschalk, 2002; Smith et al., 1999). Allgemein ist allerdings wenig über die Pathogenese von S. suis-Erkrankungen bekannt. Ein wichtiger Schritt in der Pathogenese von S. suis stellt das Übertreten der mukosalen Epithelzell- und Endothelzellbarriere dar, um im Wirt ins Blut zu gelangen. Mit dem Blutstrom kann sich S. suis im Organismus ausbreiten und die Zielorgane erreichen, wobei eine Manifestation im ZNS eine besondere Hürde darstellt, da hierzu die Überwindung der Blut-Liquor-Schranke nötig ist. In dem Zusammenhang 17 Einleitung wurde die Trojan horse theory postuliert, laut derer S. suis intrazellulär in den Monozyten persistierend das ZNS erreicht (Williams und Blakemore, 1990). Die modifizierte Trojan horse theory besagt dagegen, dass S. suis extrazellulär an den Monozyten adhärierend ins ZNS gelangt (Gottschalk und Segura, 2000). Dass die Wachstumsphase einen Einfluss auf die Expression von Adhäsinen und somit auf die Stärke der Bindung des Bakteriums an die Wirtszelle hat, wurde für S. pyogenes zusammengefasst (Kreikemeyer et al., 2003). Bakterielle Infektionen werden vornehmlich antibiotisch behandelt, wobei das Versagen von Antibiotikatherapien ein epidemiologisches und wirtschaftliches Problem darstellen kann. Neben der Antibiotikaresistenz existiert das Phänomen der Antibiotikatoleranz, das bereits für viele Bakterien, und in dieser Arbeit erstmalig für S. suis beschrieben wurde. Eine Antibiotikatoleranz kann durch die Ausbildung von Persisterzellen vermittelt werden. Bakterielle Persister stellen eine phänotypisch variante Subpopulation in einer Bakterienkultur dar (Lewis, 2007; Lewis, 2010a; Lewis, 2010b; Wiuff et al., 2005). Der Anstieg antibiotikatoleranter Zellen mit zunehmendem Wachstum einer Bakterienkultur gilt als ein typisches Merkmal für die Ausbildung von Persisterzellen (Lewis, 2007) und wird durch einen Einfluss der limitierenden Bedingungen in der stationären Wachstumsphase diskutiert (Keren et al., 2004a). Vielfach wurde bei Bakterien eine Veränderung des Phänotyps und des Genexpressionsprofils während des Wachstums beschrieben (Amako et al., 2008 Beckert et al., 2001; Chaussee et al., 1997; Chaussee et al., 2001; Chaussee et al., 2002; Kreikemeyer et al., 2002; Lleo Mdel et al., 2007; McIver und Scott, 1997; Molinari et al., 2001; Na et al., 2006; Navarro Llorens et al., 2010; Nystrom, 2004; Oliver, 2005; Reid et al., 2001; Schuster et al., 2004; Sitkiewicz und Musser, 2009). Willenborg et al. (2011) ermittelten eine wachstumsphasenabhängige Expression Virulenz-assoziierter und Metabolismus-regulierender Faktoren in S. suis. 18 Einleitung Zielsetzung der Arbeit Die Wachstumsphase scheint sowohl für den Metabolismus als auch für die Virulenz von S. suis eine Rolle zu spielen. In dieser Arbeit wurde die wachstumsphasenabhängige Ausprägung von Merkmalen und die Konsequenzen für das Überleben und die Ausbreitung von S. suis im Wirt näher analysiert. Der Fokus lag dabei auf der Untersuchung der Fähigkeit von S. suis zur Bildung von Persistern und der Wechselwirkung von S. suis mit porzinen Monozyten. Die unter Bakterien weit verbreitete Persisterbildung äußert sich in einer Toleranz gegenüber Antibiotika, was sich als problematisch im Hinblick auf die Eliminierung von Persisterzellen darstellt. Da von anderen Pathogenen bekannt ist, dass die Wachstumsphase einen Einfluss auf die Ausbildung von antibiotikatoleranten Phänotypen haben kann, wurde in dieser Arbeit die wachstumsphasenabhängige Persisterbildung des virulenten S. suis Serotyp 2-Stammes 10 untersucht, um einen Eindruck zu erlangen, ob dieses Phänomen auch von Relevanz für diesen Erreger ist. Weitere Analysen sollten erste Hinweise liefern, welche Faktoren an einer evtl. bestehenden Fähigkeit zur Persisterbildung beteiligt sein könnten. Die Dissemination von S. suis im Blut inklusive der Translokation zu den Zielorganen stellt einen wichtigen Schritt in der Pathogenese dar. Laut (modifizierter) Trojan horse theory wird vermutet, dass S. suis Monozyten als Vehikel nutzt, um intrazellulär persistierend bzw. extrazellulär adhärierend ins ZNS zu gelangen. In vorangegangenen Studien wurde die Assoziation von S. suis mit adhärenten oder vorbehandelten Monozyten oder Makrophagen erforscht. In dieser Arbeit wurde die Assoziation von S. suis erstmals mit affinitätsaufgereinigten, naïven Monozyten aus porzinem Vollblut in Suspension (Batch-Verfahren) untersucht. Ziel dieser Arbeit war es, durch diesen Versuchsaufbau den in-vivo-Bedingungen möglichst nahe zu kommen, um so genauere Aussagen bezüglich der Assoziation von S. suis mit porzinen Monozyten treffen zu können. Da gezeigt wurde, dass die Wachstumsphase von S. suis einen Einfluss auf den Metabolismus und die Expression von Virulenz-assoziierten Faktoren hat, sollte in dieser Arbeit dementsprechend ermittelt werden, ob wachstumsphasenabhängige Unterschiede in der Assoziationsfähigkeit von S. suis bestehen. In den Studien wurden der 19 Einleitung hochvirulente S. suis Serotyp 2-Stamm 10 und der Serotyp 9-Stamm A3286/94 hinsichtlich ihrer Assoziation miteinander verglichen. Darüber hinaus wurden weitere Einflüsse, den S. suis auf die Eigenschaften der porzinen Monozyten hat, untersucht. 20 Schrifttum 2 Schrifttum 2.1 Streptococcus suis Streptococcus (S.) suis ist ein bedeutender Krankheitserreger des Schweins, der auch Menschen infizieren kann und deshalb als wichtiger Zoonoseerreger gilt. Es handelt sich um ein grampositives, fakultativ anaerobes Kokkenbakterium, das auf Schafblutagar eine α-Hämolyse verursacht, wobei es auf pferdebluthaltigen Nährböden auch mit β-Hämolyse wachsen kann. S. suis besitzt eine Kapsel, die größtenteils aus Polysacchariden zusammengesetzt ist. Die Komposition der Polysaccharid-Antigene bildet die Grundlage für die Serotypisierung von S. suis. Bislang wurden 33 Seroytypen beschrieben, es existieren allerdings zusätzlich zahlreiche nicht typisierbare Serotypen (Wisselink et al., 2000). Die verschiedenen Serotypen weisen bezüglich ihrer Virulenz eine große Diversität auf, selbst innerhalb eins Serotyps gibt es avirulente und virulente Stämme. Das klinische Erscheinungsbild infizierter Schweine reicht dabei von Arthritiden, Abszessen, Pneumonien über Septikämien bis hin zu Endokarditiden und Meningitiden (Staats et al., 1997). 2.1.1 Epidemiologie S. suis kolonisiert als Kommensale insbesondere die Tonsillen und Nasennebenhöhlen des oberen Respirationstraktes, aber auch den Genital- und Intestinaltrakt des Schweins (Higgins et al., 1990; Robertson und Blackmore, 1989; Swildens et al., 2004). Neben einer Infektion der Schweine, die in einem klinischen Erscheinungsbild resultiert, können klinisch symptomlose Tiere Träger von S. suis sein und so maßgeblich zur Verbreitung des Erregers zwischen Betrieben und zur Infektion ganzer Bestände beitragen. Faktoren, die bei den Tieren Stress verursachen und somit einen Krankheitsausbruch begünstigen, können beispielsweise mangelnde Hygiene, zu dicht besetzte Ställe oder andere Infektionen sein. Saug- und Absatzferkel sind dabei besonders anfällig für eine S. suis-Infektion (Staats et al., 1997), wobei die Übertragung sowohl horizontal als auch vertikal über 21 Schrifttum die Muttersau stattfinden kann (Amass et al., 1997). Die meisten Tiere, die Träger von S. suis sind, zeigen allerdings subklinische Erscheinungen, was sich in Kümmern und geringer Tagegewichtszunahme widerspiegelt. Neben der klinischen Symptomatik resultieren v. a. diese subklinischen Erscheinungen in hohen finanziellen Verlusten in der Schweinehaltung (Staats et al., 1997). S. suis kommt ebenfalls häufig bei Wildschweinen vor (Baums et al., 2007). Serotyp 2 wurde weltweit am häufigsten aus erkrankten Schweinen isoliert und gilt als der virulenteste Serotyp (Gottschalk et al., 2010). In den letzten Jahren hat in Europa neben Serotyp 2 zunehmend Serotyp 9 an Bedeutung erlangt. In Deutschland und in den Niederlanden ist Serotyp 9 sogar der am häufigsten isolierte Serotyp (Wisselink et al., 2000). Nach nasaler Infektion von Schweinen wurde für Serotyp 9 eine geringere Virulenz als für Serotyp 2 festgestellt (Beineke et al., 2008). Weitere in Europa bedeutsame Serotypen sind die Serotypen 1, 7 und 14 (Allgaier et al., 2001; Higgins et al., 1992; Wisselink et al., 2000). S. suis kann als Zoonoseerreger auch Menschen infizieren, und zwar vor allem dann, wenn über einen längeren Zeitraum enger Kontakt zwischen Mensch und Schwein oder dessen Produkten besteht. Gefährdet sind z. B. Schlachthofmitarbeiter, Landwirte, Jäger oder Tierärzte. In westlichen Ländern kommt es meist nur zu sporadischen Infektionen beim Menschen. Das klinische Erscheinungsbild äußert sich zumeist in Arthritiden, Meningitiden, Endokarditiden oder Septikämien (Arends und Zanen, 1988; Rosenkranz et al., 2003). Gehäufte S. suis-Infektionen beim Menschen treten v. a. in asiatischen Ländern auf. Eine S. suis-Infektion gilt in Vietnam als die häufigste Ursache bakterieller Meningitis bei Erwachsenen und in Thailand als zweithäufigste Ursache. In Hong Kong wurde S. suis als dritthäufigster Erreger bakterieller Meningitis diagnostiziert (Hui et al., 2005; Mai et al., 2008; Wangkaew et al., 2006). In China kam es 1998 und 2005 zu untypisch schweren S. suis-Ausbrüchen bei infizierten Menschen (Tang et al., 2006; Yu et al., 2006). Der Ausbruch im Jahr 2005 forderte innerhalb weniger Wochen 215 Erkrankte, wovon 38 starben. Bemerkenswert war das gehäufte Vorkommen invasiver Gewebsinfektionen. Diese entsprachen dem Krankheitsbild des streptococcal toxic shock-like syndrome (STSS), welches normalerweise durch Gruppe A-Streptokokken (GAS) verursacht 22 Schrifttum wird. Damit einhergehend waren hämorrhagisches Fieber, niedriger Blutdruck, Schock und multiples Organversagen. Allerdings wurde in den entsprechenden S. suis-Stämmen nicht das für das STSS verantwortliche Superantigen, wie es in GAS vorkommt, gefunden. 2.1.2 Virulenzfaktoren und Virulenz-assoziierte Faktoren Für S. suis wurden wenige experimentell bestätigte Virulenzfaktoren und zahlreiche Virulenz-assoziierte-Faktoren beschrieben. In dieser Arbeit ist eine Auswahl bestimmter Virulenz-assoziierter Faktoren beschrieben. Für einen umfassenden Überblick sei auf die Übersichtsartikel von Baums und Valentin-Weigand (2009) und Fittipaldi et al. (2012) verwiesen. 2.1.2.1 Kapsel Die Kapsel gilt als der wichtigste Virulenzfaktor von S. suis, da sie das Bakterium vor Phagozytose durch Immunzellen schützt. In Infektionsversuchen konnte nachgewiesen werden, dass kapsellose Serotyp 2-Mutanten sowohl im Schwein als auch in der Maus im Vergleich zum Wildtyp (WT) avirulent waren (Charland et al., 1998; Smith et al., 1999). Die Avirulenz der kapsellosen Mutanten wird auf deren verstärkte Phagozytose durch murine und porzine Makrophagen bzw. durch porzine Monozyten und neutrophile Granulozyten zurückgeführt (Charland et al., 1998; Segura et al., 1998; Smith et al., 1999; Benga et al., 2008). Die Kapsel von S. suis Serotyp 2 scheint auch eine Bedeutung in der Pathogenese zu haben. Es wird angenommen, dass S. suis während der Infektion für eine bessere Adhäsion an den Epithelzellen die Expression der Kapseldicke herunterreguliert und nach Eintritt in den Blutstrom wieder heraufreguliert, um den Phagozytoseschutz aufrecht zu erhalten (Gottschalk und Segura, 2000). Die Kapsel von S. suis besteht vornehmlich aus verschiedenen Polysacchariden, auf deren Komposition die Serotypisierung basiert. Bisher wurden 33 Serotypen beschrieben. Die Kapsel der Serotypen 1 und 2 ist hauptsächlich aus Glukose, Galaktose, N-Acetylglukosamin und N-Acetylneuraminsäure (Sialinsäure) aufgebaut, 23 Schrifttum die Kapsel von Serotyp 1 enthält zusätzlich noch N-Acetylgalaktosamin und die von Serotyp 2 Rhamnose (Charland et al., 1995). Smith et al. (2000) konnten Sialinsäure als Kapselbestandteil in den Serotypen 1, 2, 14, 27 und ½, aber nicht in Serotyp 9 nachweisen. Segura und Gottschalk (2002) beschrieben, dass Sialinsäure zur Adhärenz von S. suis Serotyp 2 an murine Makrophagen beiträgt. 2.1.2.2 MRP und EF Das muramidase-released protein (MRP) wurde als Membran-assoziiertes Protein beschrieben (Smith et al., 1992), wohingegen der extracellular factor (EF) als sezerniertes Protein im Kulturüberstand nachgewiesen wurde (Vecht et al., 1991). Auffällig war das gehäufte Vorkommen dieser Proteine in hochvirulenten S. suisStämmen, die aus erkrankten Schweinen isoliert wurden. Isolate von Tonsillen gesunder Schweine waren zumeist MRP-/EF-negativ (Vecht et al., 1991). MRP-, EFoder MRP-/EF-Deletionsmutanten zeigten im Infektionsversuch hingegen die gleiche Virulenz wie der WT, weshalb diese Proteine keine essentielle Rolle in der Virulenz zu spielen scheinen (Smith et al., 1996). Allerdings konnten Wisselink et al. (2001) zeigen, dass eine MRP/EF-Kombinationsvakzinierung bei Schweinen eine Protektion gegen S. suis hervorrief, eine Vakzinierung mit nur einem der beiden Proteine dagegen nicht. Die Funktion von MRP und EF ist bisher ungeklärt. Aufgrund des hohen Vorkommens bei den meisten virulenten S. suis-Stämmen, werden diese beiden Faktoren als Virulenzmarker bezeichnet und diagnostisch zur Identifikation von virulenten S. suis-Stämmen herangezogen (Smith et al., 1996). 2.1.2.3 Suilysin (SLY) Suilysin wurde in fast allen S. suis Serotypen nachgewiesen (Okwumabua et al., 1999). Die Prävalenz für den hochvirulenten Serotyp 2 beträgt sogar 95% (Segers et al., 1998). Dieses Protein wurde von Jacobs et al. (1994) aus S. suisKulturüberständen gewonnen und als ein Hämolysin identifiziert. Analysen ergaben, dass es zur Familie der Cholesterol-abhängigen porenbildenden Zytolysinen (engl.: cholesterol-dependent pore-forming cytolysins, CDC) gehört und die Aminosäuresequenz eine Homologie von 52% zum Pneumolysin von S. pneumoniae 24 Schrifttum aufweist. Durch das Vorhandensein einer N-terminalen Signalsequenz wurde es als sezerniertes Exotoxin beschrieben (Jacobs et al., 1994; Segers et al., 1998). Es wurde ein zytotoxischer Effekt des Suilysins auf Epithelzellen (Lalonde et al., 2000; Norton et al., 1999), Endothelzellen (Charland et al., 2000) und Makrophagen (Segura und Gottschalk, 2002) nachgewiesen. Norton et al. (1999) beschrieben, dass bekapselte sly-positive S. suis-Stämme im Gegensatz zu sly-negativen Stämmen in der Lage sind, HEp-2-Zellen zu invadieren, wobei von sublytischen Suilysin-Konzentrationen ausgegangen wurde. Sie vermuteten, dass Suilysin die Invasion der Epithelzellen des oberen Respirationstraktes von virulenten S. suisStämmen vermittelt. Benga et al. (2008) fanden heraus, dass Suilysin keinen Einfluss auf die Adhärenz von S. suis an neutrophile Granulozyten hat, aber dass die Phagozytose sly-positiver Stämme im Vergleich zu sly-negativen Stämmen reduziert ist. Infektionsversuche im Schwein zeigten, dass eine sly-negative Mutante nur eine leicht attenuierte Infektion hevorruft (Allen et al., 2001). Lun et al. (2003) beschrieben sogar, dass eine sly-negative Mutante ebenso virulent wie der WT ist. Suilysin scheint an der Pathogenese von S. suis beteiligt zu sein, ist aber als Virulenzfaktor nicht essentiell. Es wird als Virulenz-assoziierter Faktor angesehen, der eine wichtige Rolle in der Interaktion von S. suis mit dem Wirt zu spielen scheint (Baums und Valentin-Weigand, 2009). 2.1.2.4 Adhäsine Adhäsine sind von großer Bedeutung in der Pathogenese von S. suis, da sie dem Bakterium ermöglichen, mit Komponenten der extrazellulären Matrix zu interagieren (Esgleas et al., 2005). Smith et al. (2001) identifizierten das Fibronektin- und Fibrinogen-bindende Protein von S. suis (FBPS). Es weist Homologien zu den Fibrinogen-bindenden Proteinen von S. pyogenes und S. gordonii auf. Das fbps-Gen wurde in allen Serotypen nachgewiesen. In vitro wurde gezeigt, dass das Protein humanes Fibronektin und Fibrinogen binden kann. Eine im Vergleich zum WT reduzierte Kolonisation der Organe durch die fbps-Mutante lässt vermuten, dass FBPS an der Pathogenese von S. suis beteiligt ist (de Greeff et al., 2002). 25 Schrifttum Die Enolase vermittelt die Bindung von Bakterien an Plaminogen (Pancholi, 2001). Für die Enolase von S. suis wurde nachgewiesen, dass sie neben Plasminogen auch Fibronektin binden kann. Durch die Bindung der Enolase an das Plasmin bzw. Plasminogen des Wirts wird wahrscheinlich durch dessen Aktivierung eine fibrinolytische Wirkung an der Bakterienoberfläche verursacht, wodurch die Invasion der Bakterien in das Gewebe ermöglicht wird (Esgleas et al., 2008). Es wurde nachgewiesen, dass die Enolase in infizierten Schweinen die Produktion von Antikörpern induziert und eine protektive Wirkung hat (Zhang et al., 2009). Die Glycerinaldehyd-3-Phosphatdehydrogenase (GAPDH) von S. suis ist zur GAPDH von GAS homolog und kommt in virulenten und avirulenten S. suis-Stämmen vor. In einem Infektionsversuch in der Maus kam es erst nach Zugabe von Albumin zum Kulturmedium zu einer Erhöhung der Virulenz von S. suis, was vermuten lässt, dass Albumin und GAPDH miteinander interagieren, und dass die GAPDH an der Pathogenese von S. suis beteiligt sein könnte (Quessy et al., 1997). Jobin et al. (2004) konnten zeigen, dass die GAPDH die Bindung von S. suis an humanes und porzines Plasminogen vermittelt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass eine Präinkubation mit rekombinanter GAPDH zu einer verminderten Adhäsion von S. suis an porzine Epithelzellen der Trachea und HEp-2-Zellen führte, was die Vermutung nahe legt, dass dieses Protein in den ersten Schritten einer S. suisInfektion involviert ist (Brassard et al., 2004; Wang und Lu, 2007). Proteomanalysen ergaben, dass die GAPDH in Schweinen eine starke immunogene Reaktion hervorruft (Zhang et al., 2008a). Ferner wurde gezeigt, dass die 6-Phosphoglukonatdehydrogenase (6PDG) an der Bindung von HEp-2- und HeLa-Zellen beteiligt ist. Eine Immunisierung von Mäusen mit rekombinanter 6PDG führte zu deren Protektion vor einer S. suis Serotyp 2Infektion. Somit scheint die 6PDG eine Rolle in der Pathogenese von S. suis zu spielen (Tan et al., 2008). Si et al. (2009) beschrieben eine putative Beteiligung der Glutamin Synthetase (GlnA) an der Virulenz von S. suis. Sie fanden heraus, dass die Adhärenz einer glnAMutante an HEp-2-Zellen im Vergleich zum WT stark reduziert war. Außerdem scheint die GlnA bei der Kolonisation spezifischer Organe, die bei einer S. suis- 26 Schrifttum Infektion betroffen sind, eine Rolle zu spielen. Des Weiteren erwies sich im Mausmodell die Virulenz der glnA-Mutante im Vergleich zum WT als attenuiert. Von der Amylopullulanase (ApuA) wird einerseits angenommen, dass sie in vivo durch den Abbau von Glycogen und Stärke im oberen Respirationstrakt des Schweins der Bereitstellung von Nährstoffen dient. Andererseits wurde in vitro gezeigt, dass ApuA die Adhäsion von S. suis an porzine Epithelzellen und porzinen Mukus fördert. Diese Bifunktionalität könnte eine Verbindung zwischen der Kohlenhydratverwertung und der Kolonisation und Infektion des Wirtes durch S. suis darstellen (Ferrando et al., 2010). 2.1.2.5 Arginin Deiminase System Das Arginin Deiminase System (ADS) ist ein weiterer putativer Virulenzfaktor von S. suis. Es ist unter prokaryotischen Organismen weit verbreitet und existiert z. B. in Halobakterien, Pseudomonas spp., Bacillus spp., Milchsäurebakterien oder oralen Streptokokken (Casiano-Colón und Marquis, 1988; Cunin et al., 1986; Gamper et al., 1991; Maghnouj et al., 2000; Ruepp und Soppa, 1996; Zúñiga et al., 1998). Das ADS stellt für S. suis einen alternativen Stoffwechselweg dar. Die Expression des ADS in S. suis ist, wie auch für viele andere Bakterien beschrieben, mit dem Kohlenhydratstoffwechsel verknüpft und unterliegt der Katabolitrepression (Gruening et al., 2006; Zeng et al., 2006). Dies bedeutet, dass in Anwesenheit einfach zu metabolisierender Zucker, vornehmlich Glukose, klassische Stoffwechselwege aktiviert und alternative Stoffwechselweg reprimiert werden, während es v. a. während des Wachstums durch Verbrauch der primären Kohlenhydrate zu einer Aufhebung der Repression kommt (Titgemeyer und Hillen, 2002). Bei S. suis besteht das ADS aus den drei Enzymen Arginin-Deiminase (AD), Ornithin- Carbamoyltransferase (OCT) und Carbamat-Kinase (CK), die die Umsetzung von Arginin zu Adenosintriphosphat (ATP), Ammoniak (NH3) und Kohlenstoffdioxid (CO2) katalysieren. Citrullin, Ornithin und Carbamoylphosphat entstehen dabei als Nebenbzw. Zwischenprodukte (Gamper et al., 1991). Die Enzyme AD und OCT wurden bei S. suis als Zellwand-assoziiert und Temperatur-induzierbar beschrieben (Winterhoff et al., 2002). Das ADS von S. suis scheint allgemein eine wichtige Rolle bezüglich 27 Schrifttum seines Metabolismus und seiner Pathogenität zu spielen, da es dem Bakterium ermöglicht, mittels dieses alternativen Stoffwechselweges durch die Produktion von ATP bzw. Ammoniak unter Sauerstoff- oder Nahrungslimitierung bzw. unter sauren Bedingungen zu überleben (Gruening et al., 2006). Die drei Enzyme AD, OCT bzw. CK werden von den Genen arcA, arcB bzw. arcC kodiert. Für diese Gene wurde nachgewiesen, dass sie als Operon organisiert sind und polycistronisch transkribiert werden (Winterhoff et al. 2002). Das arcABC Operon wird von weiteren Genen flankiert, die mit ihm assoziiert sind und deren entsprechenden Produkte teilweise regulierend auf das ADS wirken. Stromaufwärts vom arcA-Gen liegt das Gen flpS. Es weist eine Homologie von 64% zu dem Gen flp von S. gordonii auf. Außerdem hat es Homologien zu den Crp/Fnr Transkriptionsfaktoren, welche in vielen Bakterien verantwortlich für die anaerobe Genregulation sind (Spiro, 1994). Gruening et al. (2006) wiesen nach, dass das ADS von S. suis unter mikroaerophilen und anaeroben Wachstumsbedingungen induziert wird, wobei das flpS-Gen wahrscheinlich die sauerstoffabhängige Regulation des ADS unterstützt. Stromabwärts vom arcC-Gen existieren die Gene arcD, arcT, arcH und argR. Das arcD-Gen hat eine Homologie von 70% zu einem Arginin-Ornithin-Antiporter von S. gordonii. Es konnte nachgewiesen werden, dass das arcD-Gen mit dem arcABC-Operon ko-transkribiert wird (Gruening, Dissertation, 2004). Analysen ergaben, dass dieses Gen in S. suis evtl. ebenfalls für einen Arginin-Ornithin-Antiporter kodiert und durch den Import von Arginin vermutlich zur besseren Überlebensfähigkeit von S. suis beiträgt (Fulde, Dissertation, 2007). Das arcT-Gen ist zu 67 bis 72% zu dem arcT-Gen von S. gordonii homolog, und das arcH-Gen hat eine Homologie bis zu 69% zu einer βEndogalaktosidase von Clostridium perfringens. Das Gen argR ist zu 70% zu dem arcR-Gen, das in S. gordonii für einen Arginin Repressor kodiert, homolog (Gruening et al., 2006). Für S. suis wurde nachgewiesen, dass das ADS durch Arginin induziert werden kann, da eine potentielle Bindungsstelle für ArgR existiert (Fulde et al., 2011). Fernab vom arcABC-Operon liegt das ccpA-Gen. Das CcpA (catabolite control protein A) ist ein wichtiger Katabolitrepressor. Es wurde beschrieben, dass es während des Wachstums bei einem Zuckerüberschuss die Expression von Genen reprimiert (Kietzman und Caparon, 2010; Titgemeyer und Hillen, 2002; Zomer et al., 28 Schrifttum 2007). Willenborg et al. (2011, 2014) konnten zeigen, dass das CcpA in S. suis als globaler Genregulator fungiert und u. a. die Expression Virulenz-assoziierter Faktoren, so auch indirekt das ADS, wachstumsphasenabhängig reguliert. 2.2 Wachstumsphasenabhängige Regulation bei Bakterien Das bakterielle Wachstum in einer statischen Bakterienkultur ist durch verschiedene Phasen gekennzeichnet. Nach einer Adaptationszeit (lag-Phase) werden in der exponentiellen Wachstumsphase (log-Phase) die noch ausreichend zur Verfügung stehenden Nährstoffe verstoffwechselt. Anschließend folgt die stationäre Phase, in der es zu einer Limitierung der Nährstoffe und zur Akkumulation hemmender Stoffwechselprodukte kommt. Der Verbrauch der Nährstoffe und das Erreichen des Toleranzwertes der Bakterienpopulationsdichte führen schließlich in die Absterbephase (Sahl, 1994). Während des Wachstums kann es zur Veränderung der Ausprägung verschiedener Merkmale und zur massiven Reprogrammierung des Expressionsprofils von Bakterien, was u. a. auch die Expression Virulenz-assoziierter Faktoren betrifft, kommen. Navarro Llorens et al. (2010) lieferten eine Übersicht über verschiedene Regulationswege gramnegativer Bakterien beim Eintritt in die stationäre Wachstumsphase. Die Expression des alternativen Sigmafaktors RpoS, die Aktivierung des stringent response durch Akkumulation von ppGpp (TetraGuanosinphosphat) und diverser anderer Regulatoren kann beispielsweise in einer schnellen Veränderung des Genexpressionsmuster zur Anpassung an wechselnde Umgebungsbedingungen zu Beginn der stationären Wachstumsphase resultieren. Weiterhin wurden während der stationären Wachstumsphase Veränderungen kataboler Aktivitäten, wie z. B. der Anstieg von Enzymen der Glykolyse und der Abfall von Enzymen des Zitratzyklus, beobachtet (Nystrom, 2004). Sitkiewicz und Musser (2009) ermittelten wachstumsphasenabhängige Veränderungen des Transkriptoms von S. agalactiae (Gruppe B-Streptokokken, GBS). Während des Wachstums wurden Gene, die im alternativen Stoffwechsel involviert sind, heraufreguliert. So konnte beispielsweise eine Aktivierung des Argininmetabolismus 29 Schrifttum inklusive der Gene, die für einen Arginin-Ornithin-Antiporter, für die ArgininDeiminase, für die Ornithin-Carbamoyltransferase und für die Carbamat-Kinase kodieren, festgestellt werden. Stressfaktoren aus der Umwelt, wie z. B. Nährstoffmangel in der stationären Wachstumsphase, können auch den bakteriellen Zelltod induzieren. Dieser Vorgang wird häufig über Toxin-Antitoxin (TA)-Module vermittelt (Engelberg-Kulka et al., 2006). Bakterien, die sich langfristig in der stationären Wachstumsphase befinden, sind außerdem in der Lage, spezielle Phänotypen auszubilden, die das Überleben der Population unter diesen harschen Bedingungen sichern. Einen besonderen Status, den Bakterien als Überlebensstrategie einnehmen können, ist die Unkultivierbarkeit bei bestehender Viabilität (engl.: viable but not culturable, VBNC) (Lleo Mdel et al., 2007; Na et al., 2006). Dieser Status ist gekennzeichnet durch geringe Stoffwechselaktivität und morphologische Veränderungen und ist charakteristisch für Bakterien in der stationären Wachstumsphase oder dormante Stadien (Amako et al., 2008; Oliver, 2005). Die Dormanz spielt eine Rolle bei der in Kapitel 2.4 beschriebenen Persisterbildung von Bakterien. Quorum sensing (QS) ist ein Phänomen von Bakterien, bei dem die Genexpression abhängig von der Zelldichte koordiniert wird (Keller und Surette, 2006). In Pseudomonas (P.) aeruginosa kontrolliert RpoS die QS-Genexpression beim Eintreten in die stationäre Wachstumsphase (Schuster et al., 2004). QS ist allgemein beim Übergang in die stationäre Wachstumsphase involviert und hat einen Einfluss auf andere Eigenschaften, wie z. B. die Bildung von Biofilmen und Virulenz (Lazazzera, 2000). Begleitend zu der erhöhten Stressantwort der Bakterien bedingt durch die limitierenden Bedingungen in der stationären Wachstumsphase kommt es außerdem zu einer veränderten Expression Virulenzassoziierter Faktoren. Ein bedeutendes Beispiel für eine nährstoff- und milieuabhängige Expression von Virulenzfaktoren ist die Regulation der Kapselexpression in S. pneumoniae während der Infektion des Wirts (Kadioglu et al., 2008). Die maximale Expression der Kapsel stellt einen wichtigen Phagozytoseschutz während der systemischen Infektion dar, behindert allerdings durch die Maskierung der Adhäsine die Interaktion mit den Epithelzellen zu Beginn einer Infektion. Hammerschmidt et al. (2005) beschrieben, 30 Schrifttum dass während der Interaktion mit respiratorischen Epithelzellen die Kapsel von S. pneumoniae in vivo und in vitro herunterreguliert war. Sitkiewicz und Musser (2009) beschrieben für S. agalactiae, dass in der stationären Phase Virulenzfaktoren herunterreguliert wurden, die bei der Etablierung einer Infektion beteiligt sind, so z. B. auch in der Kapselsynthese involvierte Gene. Des Weiteren wurde gezeigt, dass das CcpA-Homolog RegM die Transkription des cps Locus in S. pneumoniae reguliert. Dies lässt darauf schließen, dass die Zuckerverfügbarkeit ebenso einen Einfluss auf die Kapselexpression hat (Giammarinaro und Paton, 2002). Es wurde weiterhin beschrieben, dass die zwei Proteine Pgm (Phosphoglucomutase) und GalU (Glukose-1-phosphat Uridylyltransferase), die im Kohlenhydratstoffwechsel eine Rolle spielen, die Kapselexpression beeinflussen. Die Mutation der entsprechenden Gene führte dazu, dass S. pneumoniae nahezu keine Kapsel mehr produzierte und Beeinträchtigungen im Wachstum zeigte (Cieslewicz et al., 2001; Mollerach et al., 1998). Kreikemeyer et al. (2003) fassten für den humanpathogenen Erreger S. pyogenes (GAS) eine wachstumsphasenabhängige Expression verschiedener Virulenzfaktoren und Genregulatoren zusammen und schlossen daraus, dass sich das Bakterium während der Infektion den jeweiligen Bedingungen und Anforderungen im Wirt anpassen kann. So beeinflusst eine wachstumsphasenabhängige Aktivität und gegenseitige Regulation der ‘stand-alone’ response Regulatoren Mga, RALP (RofAlike protein) und Rgg/RopB wahrscheinlich die Interaktion von GAS mit dem Wirt im Hinblick auf Adhärenz, Kolonisierung, Persistenz und Ausbreitung des Erregers (Beckert et al., 2001; Chaussee et al., 1997; Chaussee et al., 2001; Chaussee et al., 2002; Kreikemeyer et al., 2002; McIver und Scott, 1997; Molinari et al., 2001; Reid et al., 2001). Die Identifikation bestimmter putativer Domänen innerhalb des Mga Regulons lassen eine Phosphorylierung des Mga durch ein Phosphotransferasesystem (PTS) vermuten, was ein weiter Hinweis darauf ist, dass eine wachstumsphasenabhängige Zuckerverwertung mit der Expression von Virulenzfaktoren zusammenhängt (Hondorp und McIver, 2007). Diese Vermutung wird durch die Erkenntnis unterstützt, dass der Katabolitrepressor CcpA an den mgaPromotor bindet und die Expression von mga während des Wachstums beeinflusst 31 Schrifttum (Almengor et al., 2007). Kürzlich beschrieben Guo et al. (2014), dass die Induktion der Kompetenz und die Expression der Kompetenzgene durch XIP (sigX-inducing peptide) und CSP (competence-stimulating peptide) in S. mutans abhängig von der Wachstumsphase sind. Außerdem hatte der pH-Wert der Umgebung einen maßgeblichen Einfluss auf den XIP-vermittelten Signalweg. 2.2.1 Wachstumsphasenabhängige Genregulation in S. suis Allgemein ist sehr wenig über eine wachstumsphasenabhängige Genexpression und wachstumsphasenabhängige Phänotypen bei S. suis bekannt. Während der Pathogenese ist S. suis unterschiedlichen Bedingungen im Wirt ausgesetzt, wie z. B. wechselnden pH-Werten oder Zuckerkonzentrationen. Dies erfordert eine ständige Anpassung von S. suis während der Pathogenese, was z. B. durch eine gesteuerte Regulation der ADS- oder Kapsel-Expression gewährleistet werden kann. Der Wechsel von einer nährstoffreichen zu einer nährstoffarmen Umgebung findet auch während des Wachstums von S. suis in einer Flüssigkultur statt. Willenborg et al. (2011) untersuchten die wachstumsphasenabhängige Expression von Virulenzassoziierten Faktoren in S. suis. Die Gene arcB (stellvertretend für das arcABCOperon) und sly (Suilysin) waren in stationär gewachsenen Bakterien im Vergleich zu exponentiell gewachsenen Bakterien heraufreguliert, während die Gene cps2A (erstes Gen des Kapsel-Synthese-Locus), sao (surface antigen one) und ofs (Opazitätsfaktor) in stationär gewachsenen Bakterien im Vergleich zu exponentiell gewachsenen Bakterien herunterreguliert waren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Regulation der Expression von Virulenz-assoziierten Faktoren in S. suis vermutlich durch die Glukoseverfügbarkeit vermittelt wird. Außerdem wurde gezeigt, dass der Katabolitrepressor CcpA einen regulatorischen Einfluss auf die Expression Virulenz-assoziierter Gene hat. In der exponentiellen Wachstumsphase kam es durch CcpA zur Repression von arcB, wohingegen die Expression der Gene cps2A, sly, ofs, sao, eno (Enolase) und mrp (muramidase-released protein) durch CcpA aktiviert wurde. Zudem ergaben cDNA-Microarray-Analysen, dass das CcpA als globaler Genregulator fungiert. So gehört ein Großteil der Gene, die unter dem 32 Schrifttum regulatorischen Einfluss von CcpA stehen, dem Kohlenhydratstoffwechsel an. Außerdem scheint das CcpA einen Einfluss auf die Expression von Genen zu haben, die in der Kapsel- und Sialinsäuresynthese involviert sind. Spätere Analysen ergaben, dass das CcpA sowohl einen direkten als auch einen indirekten Effekt auf die Genexpression hat (Willenborg et al., 2014). Die Ergebnisse zeigen, dass sich das CcpA als zentrales Protein in der wachstumsphasenabhängigen Expression von Virulenz-assoziierten Faktoren in S. suis erweist und bestätigen die bereits für andere Pathogene beschriebene Verbindung von Metabolismus und Virulenz. 2.3 Pathomechanismen und Erreger-Wirtszell-Interaktionen bei S. suis 2.3.1 Pathogenese von S. suis-Erkrankungen Über die genaue Pathogenese von S. suis ist wenig bekannt. Es wird angenommen, dass S. suis in den Tonsillen der Schweine für längere Zeit überleben und nach Adhäsion und Invasion der Epithelzellen der Immunabwehr entgehen kann (Fittipaldi et al., 2012). Die Adhäsion von S. suis an Epithelzelllinien diverser Spezies wurde in mehreren Studien untersucht. So wurde herausgefunden, dass S. suis sowohl an porzine, als auch an humane und canine Epithelzellen adhäriert (Benga et al., 2004; Lalonde et al., 2000; Norton et al., 1999). An der Oberfläche von S. suis befindliche Adhäsine scheinen allerdings von der Polysaccharidkapsel maskiert zu werden, da für kapsellose Mutanten im Vergleich zum WT eine erhöhte Adhäsion festgestellt werden konnte (Lalonde et al., 2000; Benga et al., 2004). Bereits 1991 beschrieben Gottschalk et al., dass in Lungenschnittpräparaten eine erhöhte Adhärenz von S. suis mit einer dünneren Kapsel einherging. Fittipaldi et al. (2012) postulierten die Hypothese, dass S. suis zu Beginn des Infektionsgeschehens als Reaktion auf Umweltsignale die Expression der Kapsel herunterreguliert, was zu einer verstärkten Interaktion von bakteriellen Adhäsinen und Wirtsrezeptoren führt. Die Ergebnisse bezüglich der Invasion der Epithelzellen durch S. suis sind konträr. So konnten beispielsweise Norton et al. (1999) und Benga et al. (2004) die Invasion der Epithelzellen durch S. suis bestätigen. Lalonde et al. (2000) konnten dagegen keine 33 Schrifttum Invasion durch S. suis feststellen. Für Suilysin-sezernierende S. suis-Stämme konnte jeweils ein zytolytischer Effekt auf die Zellen nachgewiesen werden, wohingegen dieser Effekt durch sly-negative Stämme nicht eintrat. Lalonde et al. (2000) postulierten daraufhin, dass für das Überwinden der Epithelzellbarriere der zytolytische Effekt des Suilysins nötig ist. Eine weitere Studie ergab, dass Suilysin in einer sublytischen Konzentration zu einer Aufnahme von S. suis in HEp-2-Zellen beiträgt (Seitz et al., 2013). In in-vivo-Experimenten in der Maus stellte sich heraus, dass sly-negative Mutanten zwar das respiratorische Epithel kolonisierten, aber im Vergleich zum WT in der Virulenz attenuiert waren (Seitz et al., 2012). Für die Invasion von Epithelzellen stellte sich auch die Kapsel als ein wichtiger Faktor heraus. Benga et al. (2004) beschrieben, dass kapsellose S. suis-Stämme im Gegensatz zu bekapselten Stämmen invasiv waren. Zum Verlassen des Blutstromes und zur Manifestion im Zielgewebe bzw. des ZNS muss S. suis das Endothel bzw. den Plexus choroideus überqueren. Ähnlich den Ergebnissen bezüglich der Adhärenz am Epithel konnte gezeigt werden, dass bekapselte Stämme eine verminderte Adhärenz an Endothelzellen aufweisen, aber auch, dass eine kapsellose Mutante nicht-invasiv war (Benga et al., 2005). Benga et al. (2005) fanden heraus, dass S. suis an porzine brain microvascular endothelial cells (BMEC) adhäriert, aber diese nicht invadiert. Charland et al. (2000) ermittelten ähnliche Ergebnisse für humane BMEC. Vanier et al. (2004) beschrieben dagegen auch eine Invasion porziner BMEC. Tenenbaum et al. (2009) wiesen nach, dass S. suis in der Lage ist, porzine Epithelzellen des Plexus choroideus zu invadieren und von der basolateralen, also der dem Blutstrom zugewandten Seite, zur apikalen, also der dem Liquorraum zugewandten Seite, zu durchdringen. Das Suilysin wird bedingt durch seine zytotoxischen Effekte im Zusammenhang mit der Penetration der BlutLiquor-Schranke diskutiert. Allerdings konnten auch sly-negative Stämme die zerebralen Endothelzellen invadieren (Vanier et al., 2004). Für die Dissemination von S. suis mit dem Blutstrom spielt die Kapsel in der Hinsicht eine wichtige Rolle, da sie vor Phagozytose durch Monozyten, Makrophagen und neutrophile Granulozyten schützt (Benga et al., 2008; Charland et al., 1998; Smith et al., 1999). Es wird angenommen, dass S. suis die Expression der Kapsel für eine bessere Adhäsion an 34 Schrifttum den Zellen herunterreguliert und nach dem Erreichen des Blutstroms wieder heraufreguliert, um den Phagozytoseschutz zu gewährleisten (Gottschalk und Segura, 2000). Mit dem Blutstrom gelangt S. suis zu den Zielorganen. In diesem Zusammenhang wurde die Trojan horse theory (Williams und Blakemore, 1990) bzw. die modifizierte Trojan horse theory (Gottschalk und Segura, 2000; Segura und Gottschalk, 2002) entwickelt, die in Kapitel 2.3.2 näher erläutert sind. Zur Aufklärung der genauen Mechanismen zum Überqueren der Epithel- bzw. Endothelzellen, sowie der exakten Art der Verbreitung mit dem Blut bedarf es weiterer Untersuchungen. 2.3.2 Allgemeine Merkmale von Monozyten und deren Bedeutung für S. suis: (Modifizierte) Trojan horse theory Monozyten sind Teil der unspezifischen und spezifischen Immunantwort. Sie eliminieren Pathogene und Tumorzellen durch Phagozytose; außerdem wirken sie regulierend auf das Immunsystem ein, indem sie Zytokine produzieren und Antigene prozessieren und diese den Lymphozyten präsentieren. Sie stammen zusammen mit neutrophilen Granulozyten von einer gemeinsamen myeloiden Vorläuferzelle ab. Obwohl während der Myelopoese eine Aufspaltung in die granulozytäre und monozytäre Zelllinie erfolgt, besitzen diese beiden Zelllinien viele gleiche Oberflächenantigene. Die myeloiden Vorläuferzellen differenzieren sich im Knochenmark über die Promonozyten zu den Monozyten aus, die schließlich ins Blut abgegeben werden. Im Blut können die Monozyten einige Tage zirkulieren, bevor sie in verschiedene Gewebe auswandern, wo sie weiter zu spezifischen Gewebsmakrophagen ausdifferenzieren (Gordon et al., 1988; van Furth et al., 1972). Jede Zelle exprimiert bestimmte Oberflächenantigene, anhand derer sich die Zelle differenzieren und charakterisieren lässt. Hier erfolgt eine Beschreibung einiger wichtiger myeloider und speziell monozytärer Oberflächenantigene, um die Monozyten, die in dieser Arbeit über eine Oberflächenmarker-vermittelte paramagnetische Separation angereichert wurden, zu charakterisieren. Die Oberflächenmarker SWC3/CD172a, CD14, CD16 und SWC1 (CD = engl.: cluster of differentiation; SWC = engl.: swine workshop cluster) sind charakteristisch für die myeloide Zelllinie. Das Oberflächenantigen SWC3 war der erste etablierte porzine 35 Schrifttum myelomonozytäre Marker (Blecha et al., 1994). Dieser Marker diente als Hauptmarker der porzinen myelomonozytären Zellen, da er bereits auf den Vorläuferzellen und auch während des gesamten Differenzierungsprozesses der Monozyten und neutrophilen Granulozyten exprimiert wird (Summerfield und McCullough, 1997). Der porzine Marker SWC3 ist zum humanen Marker CD172a homolog (Alvarez et al., 2000). Ezquerra et al. (2009) vermuteten, dass die frühe Expression von CD172a und die mit der Zelldifferenzierung ansteigende Expression dieses Oberflächenantigens darauf hindeuten, dass dieses Molekül in der Kontrolle der Proliferation, Differenzierung und Aktivierung der Zellen involviert ist. Die Identifizierung des porzinen Markers CD14 beruhte ursprünglich auf seine Kreuzreaktivität mit Antikörpern, die gegen humane CD14-Marker gerichtet sind. CD14 galt als einer der charakteristischsten myeloiden Marker. Er wird auf Monozyten, Gewebsmakrophagen und zu einem geringen Level auch auf Granulozyten exprimiert (Kielian et al., 1994; Domínguez et al., 1998). Für das humane CD14-Molekül wurde gezeigt, dass es an der Bindung von Lipopolysacchariden (LPS) gramnegativer Bakterien beteiligt ist (Triantafilou, M. und Triantafilou, K., 2002) und eine Rolle in der Erkennung und Phagozytose von Zellen, die apoptotisch sind, spielt (Gregory, 2000a; Gregory, 2000b). CD16 wird von porzinen Monozyten und Makrophagen und zu einem geringen Anteil von neutrophilen Granulozyten (Dato et al., 1992) und SWC1 wird ebenfalls sowohl von Monozyten als auch von Granulozyten exprimiert (Saalmüller et al., 1987). Die Oberflächenantigene CD163 und SWC9/CD203a stellen wichtige Marker im Zuge des Differenzierungsprozesses der Monozyten und Makrophagen dar. Sie werden nicht von Granulozyten exprimiert. Sánchez et al. (1999) beschrieben, dass das porzine Oberflächenantigen 2A10 zu dem humanen Marker CD163 homolog ist. Dieses Molekül ist entscheidend für die Untersuchung der Heterogenität von porzinen Monozyten und Makrophagen (Thacker et al., 2001). Humane CD163Marker bilden Rezeptoren für Hämoglobin/Haptoglobin-Komplexe (Kristiansen et al., 2001) und eine Stimulation humaner Monozyten/Makrophagen über CD163 führt zur Produktion pro- und anti-inflammatorischer Zytokine (Philippidis et al., 2004; van den Heuvel et al., 1999). Das porzine Oberflächenantigen SWC9 stellte sich als homolog 36 Schrifttum zum humanen Marker CD203a heraus (Petersen et al., 2007). Die Expression von SWC9 wird während der Differenzierung porziner Monozyten zu Makrophagen heraufreguliert und dient somit der Untersuchung des Reifegrades von Monozyten (Basta et al., 1999; Chamorro et al., 2000; McCullough et al., 1999). Die Heterogenität humaner Monozyten basiert vornehmlich auf der Stärke der Expression von CD14 und CD16. So lassen sich grob die zwei MonozytenSubpopulationen CD14high CD16- und CD14+ CD16+ unterscheiden (Passlick et al., 1989; Ziegler-Heitbrock et al., 1993). Im Gegensatz zu humanen Monozyten exprimiert der Hauptteil aller porzinen Monozyten kontinuierlich CD16. Porzine Monozyten können stattdessen basierend auf der CD163-Expression in zwei Subpopulationen unterteilt werden (Chamorro et al., 2000; Sánchez et al., 1999). Zusammen mit der CD172a- und CD14-Expression und der Expression des sogenannten swine leucocyte antigen II (SLA-II) können porzine Monozyten in vier Subsets eingeteilt werden (Chamorro et al., 2005). Die Einteilung korrespondiert mit dem Reifegrad der Monozyten. Die Expression der Oberflächenmarker der vier Subsets ist in Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1: Expressionsmuster von CD172a, CD163, CD14 und SLA-II innerhalb Subsets porziner Monozyten und deren Reifegrad (modifiziert nach Chamorro et al., 2005) Subset CD172a CD163 CD14 SLA-II Reifegrad I + - high - unreif II + - + low III + + low high IV + + - high reif + Expression, - keine Expression Porzine Monozyten exprimieren außerdem SWC1, aber kein SWC9 (SWC1+ SWC9-). Während der Ausreifung zu Makrophagen werden die Monozyten größer und produzieren mehr Granula. Außerdem kommt es zu einer rapiden Heraufregulierung von SWC9. Des Weiteren wird die Expression von CD163 weiter heraufreguliert und die von SWC1 und CD14 herunterreguliert. Reife Makrophagen exprimieren schließlich kein SWC1 mehr, wohingegen CD14 noch in sehr geringen Mengen 37 Schrifttum vorhanden ist (Chamorro et al., 2000; McCullough et al., 1997; McCullough et al., 1999). Es wird vermutet, dass porzine Monozyten in der Pathogenese von S. suis von Bedeutung sind. S. suis kann nach Überschreiten der Epithelzellbarriere ins Blut gelangen, sich dort ausbreiten und mit dem Blutstrom das Zielorgan erreichen, wobei die genauen Mechanismen bisher ungeklärt sind. Insbesondere das Erreichen des ZNS, wozu zusätzlich die Überwindung der Blut-Liquor-Schranke nötig ist, stellt eine Hürde in der Pathogenese von S. suis dar. In diesem Zusammenhang wurde die Trojan horse theory postuliert, die besagt, dass S. suis porzine Monozyten als Vehikel benutzt, um intrazellulär persistierend zum Gehirn zu gelangen (Williams und Blakemore, 1990). Hinweise für diese Theorie lieferten Monozyten, die aus dem Blut eines Schweines, das eine S. suis-Bakteriämie aufwies, gewonnen wurden. Der bakterienenthaltende Monozytenanteil war mit 2% allerdings nur sehr gering. Busque et al. (1998) konnten mittels Durchflusszytometrie ebenfalls eine Aufnahme von S. suis durch porzine und humane Phagozyten feststellen. Die Ergebnisse der meisten anderen Studien lassen allerdings vermuten, dass auch andere Wege existieren, die zur Dissemination von S. suis beitragen. Außerdem wurde gezeigt, dass die Kapsel vor Phagozytose schützt, während kapsellose Mutanten schneller phagozytiert und auch abgetötet werden (Charland et al. 1996; Smith et al., 1999). Gottschalk und Segura (2000) stellten dagegen fest, dass eine hohe Bakterienanzahl an Phagozyten adhäriert, ohne phagozytiert zu werden, und postulierten daraufhin die modifizierte Trojan horse theory. Laut dieser Theorie wird vermutet, dass Bakterien zum größten Teil außen an die Monozyten binden, was eine Bakteriämie verursacht und so zur Verbreitung der Infektion führt. 2.3.3 Interaktion von S. suis mit Monozyten und Makrophagen Es existiert eine Reihe von Studien, die sich mit der Assoziation von S. suis mit Phagozyten beschäftigen. In Bezug auf diese Arbeit war insbesondere die Assoziation mit Monozyten und Makrophagen von Interesse. Charland et al. (1996) beschrieben, dass sowohl virulente als auch avirulente S. suis Serotyp 2-Stämme von Monozyten, die aus porzinem Blut gewonnen und adhärieren 38 Schrifttum gelassen wurden, phagozytiert werden. Nach 3 h Ko-Inkubation wiesen etwa 20 bis 30% der Monozyten intrazellulär vorhandene Bakterien auf, wobei rund 20% der Bakterien des avirulenten Stammes und 40% der Bakterien des virulenten Stammes in den Monozyten überleben konnten. Des Weiteren vermuteten sie, dass das Vorhandensein von Sialinsäure in der Kapsel von S. suis wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Phagozytoserate hat. Charland et al. (1998) ermittelten, dass nach 1 h Ko-Inkubation der WT eines Serotyp 2-Stammes von knapp über 20% von porzinen Monozyten abstammmenden Makrophagen phagozytiert wurde, während zwei kapsellosen Serotyp 2-Mutanten von rund 70% der Makrophagen phagozytiert wurden. Für murine Makrophagen wurden ähnliche Ergebnisse erzielt. Zur Auswertung der von Charland et al. (1996 und 1998) ermittelten Ergebnisse wurden die intrazellulären Bakterien jeweils mit Farbstoffen sichtbar gemacht. Segura et al. (1998) bestimmten das intrazelluläre Vorhandensein von Bakterien in adhärenten murinen Makrophagen erstmalig durch Ausplattieren der Bakterien mit anschließender quantitativer Auswertung. Extrazelluläre Bakterien wurden zuvor antibiotisch abgetötet. Sie verwendeten die murinen Makrophagenzelllinien J774 und P388D1 und murine peritoneale Exsudatmakrophagen. Sie stellten fest, dass ein bekapselter Serotyp 2-Stamm nach 90 min Ko-Inkubation fast gar nicht von den murinen Makrophagen phagozytiert wurde. Im Vergleich dazu konnte eine kapsellose Serotyp 2-Mutante von den murinen Makrophagen besser phagozytiert werden, wobei die Phagozytoserate mit 0,5% allgemein sehr gering war. Die Phagozytoserate eines bekapselten und eines unbekapselten Stammes von Gruppe B-Streptokokken (GBS) betrug dagegen jeweils bis zu 10%. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die phagozytierte kapsellose S. suis Serotyp 2-Mutante nicht in der Lage war, länger in den Makrophagen zu überleben – im Gegensatz zum bekapselten und kapsellosen GBS-Stamm. Die im Vergleich zu früheren Ergebnissen deutlich geringere Internalisation von S. suis begründeten Segura et al. (1998) mit den verschiedenen Methoden, mit denen die Ergebnisse erzielt und ausgewertet wurden. Busque et al. (1998) beschrieben anhand durchflusszytometrischer Analysen, dass S. suis von jeweils über 90% der humanen neutrophilen Granulozyten und Monozyten phagozytiert wurde. Der Anteil an porzinen Leukozyten, der phagozytierte 39 Schrifttum Bakterien aufwies, war etwas geringer. Es zeigten sich keine Unterschiede in der Phagozytose virulenter und avirulenter Diese S. suis-Stämme. hohen Phagozytosewerte stehen im Gegensatz zu der zuvor beschriebenen deutlich geringeren Internalisation durch adhärente Monozyten bzw. Makrophagen. Smith et al. (1999) erforschten die Phagozytose und das Abtöten des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 (WT) und zweier davon abgeleiteter kapsellosen Mutanten (10cps∆AB und 10cps∆EF) durch porzine Alveolarmakrophagen. Sie werteten ihre Versuche ebenfalls durch Ausplattieren der Bakterien mit anschließender Berechnung des quantitativen Anteils aus. Sie wiesen nach, dass der bekapselte WT nur zu einem minimalen Anteil von den Alveolarmakrophagen phagozytiert wurde, wohingegen die kapsellosen Mutanten effektiv phagozytiert wurden. Im Falle einer Phagozytose wurden der WT und die kapsellosen Mutanten allerdings mit einer ähnlichen relativen Effizienz abgetötet. Smith et al. (1999) vermuteten daraufhin, dass der Verlust der Kapsel mit dem Verlust der Fähigkeit, der Phagozytose zu widerstehen, korreliert. Diese Vermutung ging einher mit dem Verlust der Virulenz der kapsellosen Mutanten in einem Schweineinfektionsversuch. Diese Ergebnisse bestätigten die Kapsel von S. suis als einen wichtigen Virulenzfaktor, da sie vor Phagozytose schützt. Jener WT-Stamm des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 und seine isogene Kapselmutante 10cps∆EF (hier: 10∆cps) wurden ebenfalls in dieser Arbeit verwendet. Segura und Gottschalk (2002) konnten zeigen, dass der WT eines S. suis Serotyp 2-Stammes an Zellen der murinen Makrophagenzelllinie J774 adhäriert, wobei mit steigender Bakterienkonzentration und steigender Inkubationszeit ein Anstieg der Adhäsion beobachtet werden konnte. Eine Vorbehandlung der Makrophagen mit Cytochalasin hatte keinen Einfluss auf die Adhärenz von S. suis an die Makrophagen, was bestätigte, dass es zu keiner Aufnahme von S. suis durch die Makrophagen kam. Ferner wurde ein zytotoxischer Effekt von S. suis auf die Makrophagen beschrieben. Segura et al. (2002) stellten fest, dass es durch die Interaktion von S. suis und Monozyten zu einer Zytokin- und Chemokinproduktion durch die Monozyten kommt. Sie verwendeten die humane THP-1 Monozyten-Zelllinie, die von einer akuten Monozytenleukämie abstammt. S. suis konnte die Produktion des Tumornekrosefaktor Alpha (TNF-α), von Interleukin 40 Schrifttum (IL)-1, IL-6, IL-8 und des monocyte chemotactic protein one (MCP-1) durch die Monozyten induzieren. Die Stärke der inkubationszeitabhängig. Lun et (2003) rekombinant Suilysin hergestelltem al. Induktion eine war konnten dabei nach IL-6-Produktion dosis- Stimulation durch und mit porzine Alveolarmakrophagen und Monozyten feststellen und eine TNF-α-Produktion durch humane Monozyten (jeweils adhärente Zellen). Sie vermuteten, dass das Suilysin an der Pathogenese der Meningitis beteiligt sein könnte, da eine Produktion von TNF-α, IL-1- und IL-6 mit bakterieller Meningitis assoziiert ist (van Furth et al., 1996). Lun et al. (2003) stellten außerdem fest, dass eine Suilysin-defiziente S. suis-Mutante in porzinem Vollblut ebenso gut überleben konnte wie der WT, und vermuteten, dass das Suilysin nicht zur Resistenz gegenüber Phagozytose oder Abtötung durch sonstige bakterizide Faktoren beiträgt. Durchflusszytometrischen Analysen von Lun und Willson (2004) ergaben, dass ohne Opsonisierung der Bakterien nur maximal 6% der neutrophilen Granulozyten und Monozyten S. suis phagozytierten. Dabei war die Phagozytoserate des bekapselten, des Suilysin-defizienten und des unbekapselten S. suis-Stammes gleich niedrig. Nach Opsonisierung stieg die Phagozytoserate des unbekapselten Stammes durch die neutrophilen Granulozyten und Monozyten um jeweils etwa das zehnfache an. Der bekapselte und der Suilysindefiziente Stamm wurden nicht stärker phagozytiert, was die Autoren vermuten ließ, dass das Suilysin keinen Einfluss auf die Phagozytose hat. Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen zeigten, dass der unbekapselte Stamm bereits 10 min nach der Aufnahme der Phagozyten ganz oder teilweise lysiert wurde. Tanabe et al. (2010) ließen Monozyten zu Makrophagen ausdifferenzieren und stellten eine dosisabhängige Sekretion von TNF-α, IL-1b, IL-6 und IL-8 nach Stimulation mit S. suis fest, wobei die kapsellose Mutante jeweils eine stärkere Sekretion als der WT hervorrief. Die präparierte S. suis-Zellwand induzierte ebenfalls die Sekretion dieser Zytokine. Die Autoren schlossen aus den Ergebnissen, dass das Fehlen der Kapsel Bestandteile der Zellwand freilegt, was zu einer Stimulation der Makrophagen führt und spekulierten, dass die Kapsel einerseits die Immunantwort des Wirtes unterdrücken könnte oder andererseits, dass der Kapselverlust eine verstärkte Immunantwort bedingt durch die freigelegte Zellwand hervorrufen könnte. 41 Schrifttum Liu et al. (2011) untersuchten die Veränderung der Genexpression von THP-1 Monozyten nach Stimulation S. suis. Insgesamt waren nach der Stimulation 328 Gene differentiell exprimiert. Ein Großteil der Gene spielt u. a. eine Rolle in der Apoptose, Zellteilung, Immunabwehr, im Stoffwechsel, in der Signaltransduktion, Transkription und Translation. Dieses breite Spektrum demonstriert den großen Einfluss von S. suis auf die Physiologie und Funktion des Wirtes. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Assoziationsstudien bisher nur mit adhärenten Monozyten bzw. Makrophagen durchgeführt wurden; auch eine vorherige Affinitätsaufreiniging von monozytären Zellen fand nicht statt. Im Gegensatz dazu wurde in dieser Arbeit zum ersten Mal die Assoziation von S. suis mit affinitätsaufgereinigten, in Suspension befindlichen Monozyten ermittelt. 2.4 Antibiotikaresistenz und -toleranz von Bakterien 2.4.1 Therapie und Resistenz gegenüber Antibiotika Eine S. suis-Infektion wird i. d. R. antibiotisch behandelt, wobei die Zunahme und Verbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien bedingt durch den massiven Einsatz von Antibiotika weltweit zunehmend ein Problem darstellt. In Schweineisolaten wurden Resistenzraten von S. suis von bis zu 90% gegenüber Tetrazykline und bis zu 70% gegenüber Makrolide beschrieben (Hendriksen et al., 2008; Princivalli et al., 2009; Wisselink et al., 2006; Zhang et al., 2008b), wobei ein starker Anstieg der Resistenzen ab Anfang der 1980er Jahre festgestellt wurde (Aarestrup et al., 1998). Auch humane Stämme weisen Resistenzen gegenüber Tetrazykline und Makrolide auf (Chu et al., 2009; Hoa et al., 2011; Ye et al., 2008). Des Weiteren wurden Resistenzen von S. suis gegenüber Aminoglykoside (Hendriksen et al., 2008; Marie et al., 2002; Tian et al., 2004; Touil et al., 1988; Wasteson et al., 1994; Wisselink et al., 2006), Fluorochinolonen (Aarestrup et al., 1998; Escudero et al. 2007; Escudero et al., 2011; Hendriksen et al., 2008; Hu et al., 2011) und Chloramphenicol in porzinen (Takamatsu et al., 2003) und humanen Stämmen (Hoa et al., 2011) beschrieben. Die Prävalenz penicillinresistenter S. suis-Stämme ist generell niedrig, vor allem in humanen Isolaten. Jedoch existieren auch Resistenzen gegenüber 42 Schrifttum Penicillin. Sie wurden mehrfach für porzine Isolate (Higgins und Gottschalk, 2005; Huang et al., 2005; Marie et al., 2002; Zhang et al., 2008b) und 1980 von Shneerson et al. erstmals für ein humanes Isolat beschrieben. In Dänemark wurde die Zunahme der Resistenz von S. suis gegenüber Makrolide und Linkosamide mit dem Einsatz dieser Antibiotika in der Viehwirtschaft in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu gibt es in Schweden, wo Antibiotika als Wachstumsförderer verboten wurden, keine Berichte über Resistenzen gegenüber Makrolide und Linkosamine (Aarestrup et al., 1998). Palmieri et al. (2011) vermuteten, dass S. suis als Reservoir für Antibiotikaresistenzen fungiert und zur Verbreitung von Resistenzgenen auch zu anderen Spezies wie S. pyogenes, S. pneumoniae und S. agalactiae beiträgt. Um die Auswirkungen und die Verbreitung von antibiotikaresistentem S. suis in Schweinen zu minimieren, und um dennoch einen maximalen therapeutischen Effekt zu erzielen, ist ein umsichtiger Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung verschiedener Parameter nötig, wie z. B. eine genaue Diagnose der Erkrankung, die Berücksichtigung pharmakokinetischer Eigenschaften und des Immunstatus des Tieres, die Bestimmung von Wirksamkeit und Wirkungsweise und die Einhaltung von Dosierung des Antibiotikums und die Dauer der Behandlung (Varela et al., 2013). Neben dem Mechanismus der Antibiotikaresistenz existiert das Phänomen der Antibiotikatoleranz von bakteriellen Persisterzellen. Im Gegensatz zur genetisch vererbten Antibiotikaresistenz handelt es sich bei einer Antibiotikatoleranz um eine phänotypische Variation, die nicht genetisch vererbt wird. Persister sind prinzipiell empfänglich für eine antibiotische Behandlung; sie sind aufgrund ihres speziellen Status dennoch tolerant gegenüber Antibiotika. 2.4.2 Antibiotikatoleranz und Persisterzellen Das Phänomen der bakteriellen Antibiotikatoleranz wurde erstmalig 1944 von Joseph Bigger beschrieben. Er behandelte eine Staphylokokkenkultur mit dem damals kürzlich entdeckten Penicillin, was zu einer Lyse der Staphylokokken führte. Bigger plattierte die transparent gewordene Kultur aus und registrierte unerwarteterweise überlebende Bakterienkolonien, mit denen er neues Medium animpfte. In dem 43 Schrifttum Medium wuchsen erneut Staphylokokken heran, die wiederum durch Penicillin lysierbar waren und eine überlebende Subpopulation ausbildeten. Bigger bezeichnete diese Subpopulation als “Persister“ und unterschied sie von resistenten Mutanten. Er vermutete, dass es sich bei den “Persistern“ um nicht-teilende (dormante) Bakterienzellen handelt, die sich durch ihren ruhenden Zustand unangreifbar für eine Antibiotikabehandlung machen. Kurz nach der Einführung von Penicillin wurde von penicillinresistenten Bakterien berichtet, die durch die Produktion von β-Laktamasen in der Lage sind, Penicillin zu zerstören. In den folgenden Jahren rückte somit die Erforschung von Antibiotikaresistenzen in den Fokus. Das Phänomen der Persisterbildung geriet dadurch in Vergessenheit und wurde erst nach etwa 40 Jahren intensiver erforscht. Mittlerweile ist die bakterielle Persisterbildung ein bekanntes und besser erforschtes Themengebiet. Sie wurde für diverse gramnegative und grampositive Bakterien beschrieben, wie z. B. für Staphylococcus (Staph.) aureus (Keren et al. 2004a, Lechner et al., 2012), P. aeruginosa (Brooun et al., 2000; Harrison et al., 2005; Möker et al., 2010; Spoering und Lewis, 2001) Escherichia (E.) coli (Keren et al., 2004a, Keren et al., 2004b; Shah et al., 2006), Mycobacterium (M.) tuberculosis (Keren et al., 2011) oder S. mutans (Leung und Lévesque, 2012). Trotz reichlicher Studien sind viele Aspekte, die mit der Persisterbildung zusammenhängen, unklar. Die Persistenz von Bakterien ist durch eine Toleranz gegenüber einer Antibiotikumbehandlung gekennzeichnet. Diese Toleranz geht zumeist mit einer Vielfachtoleranz gegenüber verschiedene Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen einher (Levin und Rozen, 2006). Im Gegensatz zu resistenten Bakterien wachsen Persister nicht in Anwesenheit des Antibiotikums, aber sie sterben auch nicht ab (Keren et al., 2004a). Durch einen herunterregulierten Stoffwechsel, die den dormanten Status der Persister hervorruft, kann ein Antibiotikum nicht die Funktion seiner Zielmoleküle beschädigen, auch wenn es prinzipiell noch zu einer Bindung an die Zielmoleküle fähig ist. So entgehen die Persister zwar dem Zelltod durch das Antibiotikum, aber sie büßen dadurch ihre Proliferationsfähigkeit ein (Lewis, 2007). Trotz der bestehenden Antibiotikatoleranz weisen Persisterzellen im Vergleich zu regulären Zellen keine erhöhte minimale 44 Schrifttum Hemmkonzentration (MHK) der Antibiotika auf. Des Weiteren können Persisterzellen sogar ein Vielfaches der eingesetzten MHK eines Antibiotikums tolerieren (Levin und Rozen, 2006). Das Vorkommen von Persisterzellen ist als eine vorübergehende phänotypische Varianz innerhalb einer Bakterienpopulation beschrieben, wobei die Ausbildung der Persisterzellen anscheinend durch spezielle Bedingungen induziert wird. Unter Antibiotikabehandlung sterben die regulären Zellen, während die Persisterzellen überleben (Lewis, 2007; Lewis, 2010a; Lewis, 2010b; Wiuff et al., 2005). Keren et al. (2004a) beschrieben die biphasische Überlebenskinetik während der Antibiotikabehandlung als ein typisches wachstumskinetisches Merkmal, die eine Bakterienkultur mit darin enthaltenen Persisterzellen charakterisiert. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass es im Zuge einer Antibiotikabehandlung zunächst zu einem schnellen Abtöten der regulären Bakterienzellen kommt, die einen Großteil der Bakterienkultur ausmachen. Ein kleiner Teil der Bakterienpopulation kann dagegen über einen längeren Zeitraum bei fortwährender Antibiotikabehandlung nur langsam bis gar nicht abgetötet werden. Diese Subpopulation besteht aus Persisterzellen und aus Bakterienzellen, die zwar noch lebensfähig, aber nicht mehr teilungsfähig sind (engl.: viable but not culturable, VBNC; Lleo Mdel et al., 2007; Na et al., 2006). Eine Re-Inokulation der Persisterzellen und eine erneute Antibiotikabehandlung der herangewachsenen Bakterienkultur resultiert erneut in einem Großteil an regulären Bakterien, die durch das Antibiotikum abgetötet werden können, und in einer kleinen Persister-Subpopulation, die nicht oder nur langsam abgetötet werden kann. Die Sensibilität der Bakterienkultur gegenüber das Antibiotikum bleibt somit bestehen und es kommt zu keiner Anreicherung antibiotikatoleranter Bakterien (Keren et al., 2004a). Des Weiteren wurde für verschiedene Spezies eine starke Zunahme von Persisterzellen während der mittleren exponentiellen Wachstumsphase beschrieben. Der Anteil an Persisterzellen in einer stationär gewachsenen Kultur im Vergleich zur Gesamtpopulation ist zumeist wesentlich höher als in einer exponentiell gewachsenen Kultur (Keren et al., 2004a; Lewis, 2007). Nach Entfernen des Antibiotikums können Persister weiterhin teilungsfähig sein und wieder den Status von regulären Bakterienzellen einnehmen. Diese Zellen sind i. d. R. wieder auf künstlichen Nährböden kultivierbar. Es besteht allerdings auch die 45 Schrifttum Möglichkeit, dass Bakterien, die mit einem Antibiotikum behandelt wurden und in den Persisterstatus eintraten, nach Entfernen des Antibiotikums trotz bestehender Viabilität nicht mehr kultivierbar sind (VBNC). Diese Zellen verharren in einem dormanten Status und stellen ein zusätzliches Risiko dar, da sie kulturell nicht nachweisbar sind, aber dennoch ein infektiöses Agens darstellen (Navarro Llorens et al., 2010). Ein Beispiel für die Persisterbildung in vivo lieferten Helaine et al. (2014), die für Salmonella eine intrazelluläre Formation von Persisterzellen beschrieben. Die Internalisation von Salmonella durch Makrophagen führte zur Entstehung phänotypisch unterscheidbarer Subpopulationen, die entweder noch in der Lage waren sich zu teilen oder in einen nicht-replizierenden Status eintraten. Bei einem Teil der nicht-replizierenden Bakterien handelte es sich um Persisterzellen, denn diese wiesen eine Antibiotikatoleranz auf und waren in der Lage, sich erneut extrazellulär oder intrazellulär zu vermehren. Außerdem wurde festgestellt, dass an der intrazellulären Bildung von Persistern TA-Module beteiligt sind. Die phänotypische Heterogenität wurde auf die sauren Bedingungen und den Nährstoffmangel in den Vakuolen zurückgeführt. Diese Stressbedingungen induzieren auch die Expression von Virulenzgenen in Salmonella. 2.4.3 Genetik von Persistern Es wurden diverse Gene bzw. Genprodukte in Zusammenhang mit der Bildung von Persistern gebracht. Durch das Screening einer E. coli knockout library konnten viele Gene identifiziert werden, deren Ausschalten zu einem 10-fachen Abfall von Persisterleveln führte (Hansen et al., 2008). Die Gene mit den größten Auswirkungen auf den Persisterlevel waren die globalen Regulatoren DksA, DnaKJ, HupAB und IhfAB. Dies spricht dafür, dass mehrere an der Persisterbildung beteiligte Gene gleichzeitig reguliert werden können, was jedoch in nur einem Phänotyp resultiert. TA-Module sind ebenfalls mit Persisterzellen assoziiert. TA-Module tragen zum Erhalt des Zellgleichgewichtes bei (Gerdes et al., 1986; Hayes, 2003). Sie kommen zumeist auf Plasmiden vor und bestehen aus zwei oder mehr Genen, die für ein Toxin und das korrespondierende Antitoxin kodieren. Das Toxin ist ein stabiles 46 Schrifttum Protein und bildet einen Komplex mit dem labilen Antitoxin. In Abwesenheit bzw. nach Abbau des labilen Antitoxins (z. B. nach einer Zellteilung) verursacht das stabile Toxin den Zelltod oder verhindert die weitere Zellteilung. TA-Module existieren auch auf bakteriellen Chromosomen, wobei ihre genaue Funktion zum Großteil unbekannt ist. Der erste Genlocus, der mit der Bildung von Persistern in Zusammenhang gebracht wurde, war der hip-Locus (Moyed und Bertrand, 1983). Eine Mutation im hipA-Gen führte bei gleich bleibender MHK zu einem Anstieg des Persisterzelllevels. HipA bildet einen Komplex mit dem Antitoxin HipB (Black et al., 1991; Moyed und Broderick, 1986). HipA phosphoryliert den Elongationsfaktor EF-Tu, was zur Inhibierung der Translation und somit zur Dormanz führt (Schumacher et al., 2009). Die TA-Loci relBE und mazEF tragen ebenfalls zur Ausbildung eines dormanten Phänotyps bei, da die Überexpression von RelE bzw. MazF in E. coli zur einer verstärkten Antibiotikatoleranz führte (Keren et al., 2004b; Vazquez-Laslop et al., 2006). Das TA-Modul tisAB/istR-1 steht unter der SOS-Regulation. Hierbei handelt es sich um einen Mechanismus von Zellen, auf Stress zu reagieren, der durch DNASchäden induziert wird. Die Antibtiotikaklasse der Fluorochinolone verursacht beispielsweise DNA-Schäden und induziert somit auch eine SOS-Antwort in Bakterien (Phillips et al., 1987). Fluorochinolone sind prinzipiell in der Lage, auch nicht-teilende Bakterienzellen abzutöten. Für E. coli wurde dagegen beschrieben, dass die Fluorochinolon-vermittelte SOS-Antwort die Persisterbildung begünstigt (Dörr et al., 2009). Die Mutation von tisAB führte zu einem starken Abfall der Persisterlevel (Dörr et al., 2010). Von dem Peptid TisB ist bekannt, dass es an Membranen binden und so die protonenmotorische Kraft (engl.: proton-motive force, PMF) zum Erliegen bringen kann (Unoson und Wagner, 2008). Die PMF entsteht, wenn ein Protonengradient entlang einer Membran aufgebaut wird (Mitchell, 2011) und wurde als wesentlich für die Aufnahme von Aminoglykosiden beschrieben (Taber et al., 1987). Amato et al. (2013) untersuchten im Detail die metabolische Regulation der Persisterbildung während des normalen Wachstums unter Einfluss nativen Stresses. Sie konnten zeigen, dass der Verbrauch der primären Zuckerquelle (Glukose) und der Wechsel zum Verbrauch einer zweiten Zuckerquelle während diauxischem 47 Schrifttum Wachstum die Bildung von Persisterzellen, die tolerant gegenüber Fluorochinolone sind, stimuliert. Die Analyse auf molekularer Ebene ergab, dass der Glukoseverbrauch metabolische TA-Module aktiviert. Das zentrale Molekül dieses Netzwerkes ist ppGpp, wobei es sich um ein Downstream-Molekül des cAMPSignalweges handelt, dessen Akkumulation den stringent response aktiviert. Es wird durch RelA und SpoT synthetisiert und es wurde gezeigt, dass ppGpp-SpoT das zentrale TA-Modul bildet. Das Molekül DksA trägt ebenso zur Persisterbildung bei, da es durch die Interaktion von ppGpp und DksA zur Inhibierung der Transkription kommt. Erhöhte ppGpp-Level und die Beteiligung weiterer Faktoren inhibieren bzw. modulieren das DNA negative supercoiling, was die DNA Gyrase-Aktivität inhibiert und somit zu einer Toleranz der Bakterien gegenüber Fluorochinolonen führt. 2.4.4 Mechanismen der Persisterformation Balaban et al. (2004) beschrieben zwei Typen von Persisterzellen, die auf unterschiedlichem Wege gebildet werden. Demnach stellen Typ I-Persister eine Population sich nicht-teilender Bakterienzellen dar, die in der stationären Wachstumsphase generiert werden. Die Anzahl an Typ I-Persistern ist direkt proportional zur Anzahl an Zellen der stationären Wachstumsphase und nach Inokulation von frischem Medium wechseln sie nach einer gewissen Zeitverzögerung wieder in den teilenden Status. Damit konform geht die Annahme, dass die Bildung von Persistern durch Stressfaktoren induziert wird, da Bakterien in der stationären Wachstumsphase Stressbedingungen ausgesetzt sind. Keren et al. (2004a) beschrieben in dem Zusammenhang, dass eine wiederholte Re-Inokulation von exponentiell gewachsenen E. coli-Bakterien zu einer Eliminierung der Typ IPersisterzellen innerhalb der Kultur führte. Da zu Beginn des Experiments in der exponentiellen Wachstumsphase noch Persisterzellen vorhanden waren, vermuteten sie, dass die Persisterzellen beim Überimpfen aus einer stationär gewachsen Kultur mit übertragen wurden. Typ II-Persister werden dagegen kontinuierlich unabhängig von externen Stimuli gebildet. Es wird angenommen, dass Schwankungen in zellulären, physikalischen und biochemischen Prozessen zufällig die Expression bestimmter Gene beeinflussen, was zur Produktion toxischer Proteine und somit zu 48 Schrifttum einer Bakteriostase führen kann (Balaban et al., 2004; Lewis, 2010a). Lewis (2010a) hält eine Kombination wahrscheinlich. Kürzlich von zielgerichteten wurde die und zufälligen Prozessen für ‘persistence-if-stuff-happens‘-Hypothese aufgestellt. Diese Hypothese besagt, dass die Bildung von Persisterzellen in einer wachsenden Bakterienpopulation ein unvermeidlicher Vorgang ist, der durch Fehler in der Zellteilung bedingt ist und in einem vorübergehenden Status mit reduzierter bzw. aufgehobener Replikation und/oder verlangsamten Stoffwechsel einzelner Bakterien resultiert (Johnson und Levin, 2013). Welcher Weg exakt für die Ausbildung von Persisterzellen verantwortlich ist, bedarf weiterer Untersuchungen. Ebenso ist bisher ungeklärt, welcher Mechanismus genau zum “Wiederbeleben“ der dormanten Persisterzellen führt. Die alleinige Aufgabe dieser spezialisierten Zellen scheint es jedenfalls zu sein, das Überleben einer Bakterienpopulation unter harschen Bedingungen zu sichern. 2.4.5 Persister und small colony variants (SCVs) Ein weiteres interessantes Phänomen, das im Zusammenhang mit den Persistern zu stehen scheint, wurden von Lechner et al. (2012) und Singh et al. (2009) beschrieben. Sie konnten feststellen, dass ein Teil der überlebenden Zellen eines Staph. aureus-Stammes nach einer Aminoglykosidbehandlung den Phänotyp der sogenannten small colony variants (SCVs) ausbildete. Hierbei handelt es sich um kleine Varianten von Bakterienkolonien einer Spezies. SCVs wurden z. B. mehrfach für Staph. aureus beschrieben. In vitro wurden SCVs selektiert, nachdem Staph. aureus mit Antibiotika, vor allem Aminoglykosiden, behandelt wurde (Balwit et al., 1994; Massey et al., 2001; Miller et al., 1980; Musher et al., 1977; Sadowska et al., 2002; Schaaff et al., 2003; Wise und Spink, 1954). Ferner wurde beobachtet, dass die SCVs atypische morphologische und biochemische Eigenschaften verglichen mit dem ursprünglichen Phänotyp aufweisen (Atalla et al., 2008; Balwit et al., 1994; Gilligan et al., 1987; McNamara und Proctor, 2000; Proctor et al., 2006; von Eiff et al., 2006), und dass sie z. B. eine verlangsamte Wachstumsrate haben (Atalla et al., 2011). SCVs werden häufig in Krankenhäusern in Folge von wiederaufkeimenden Infektionen isoliert. In der Humanmedizin werden sie deshalb auch häufig in 49 Schrifttum Verbindung mit persistierenden und rezidivierenden Infektionen gebracht (Proctor et al., 2006; von Eiff, 2008). 2.4.6 Eliminierung von Persistern Chronische und wiederaufkeimende Infektionen stellen in der Medizin allgemein ein sehr großes Problem dar, da deren Behandlung als sehr schwierig gilt. Chronische Infektionen gehen zumeist mit der Bildung von Biofilmen einher. Bei einem Biofilm handelt es sich um eine bakterielle Population, die sich auf Oberflächen vermehrt und in eine Exopolymer-Matrix eingebettet ist (Hall-Stoodley et al., 2004). Eine antibiotische Behandlung von Biofilmen führt oft nicht zum Abtöten der Bakterien, obwohl die Bakterien im Biofilm keine gesteigerte Antibiotika-Resistenz im Vergleich zu den entsprechenden planktonischen Zellen aufweisen (Lewis, 2001). In Anbetracht der Persister-Thematik werden die meisten planktonischen und BiofilmZellen abgetötet, während die Persisterzellen überleben. Bei einer Infektion mit planktonischen Bakterien können die Immunzellen die verbleibenden Persisterzellen eliminieren. Im Falle einer Biofilm-Infektion sind die Persisterzellen durch die Exopolymer-Matrix vor dem Immunsystem geschützt und können sich nach ausbleibender Antibiotikabehandlung wieder vermehren und so zum Wiederaufkeimen der Infektion beitragen (Lewis, 2007). Diese Theorie lässt darauf schließen, dass allgemein eine eingeschränkte Immunantwort zu einem verstärkten Überleben von Persistern beiträgt. Eine Immunschwäche könnte somit beispielsweise ebenfalls eine Ausbreitung von Infektionen begünstigen, da das Immunsystem nicht in der Lage wäre, verbleibende Persisterzellen zu eliminieren. Aber auch in immunkompetenten Organismen können die Persister einer Immunantwort entgehen, wenn das Pathogen für die Komponenten des Immunsystems nicht zugänglich ist. Dies würde ebenso das Wiederaufkeimen von Infektionen erklären (Lewis, 2010a). Ein Beispiel für eine chronische Infektion, bei dem der Erreger dem Immunsystem entkommt, ist die Tuberkulose. Der Erreger verharrt oft in einer latenten Form (Barry et al., 2009). Lewis (2010a) stellte die Überlegung an, dass die latente Form des Erregers äquivalent mit Persisterzellen sein könnte. Da Persister sich durch ihren dormanten Status unangreifbar für 50 Schrifttum Antibiotika machen, stellt die antibiotische Eliminierung von bakteriellen Persistern offensichtlich eine Hürde dar. Eine Möglichkeit, Persisterzellen abzutöten, wäre eine Kombinationsbehandlung mit einem Antibiotikum und einer zusätzlichen Komponente, die z. B. ein in die Aufrechterhaltung des Persisterstatus involvierten Proteins inhibiert. Eine weitere Möglichkeit könnte die Gabe eines inaktiven Moleküls (“Pro-Antibiotikum“) sein, das erst innerhalb der Bakterienzelle durch ein bakterienspezifisches Enzym in die aktive Form umgewandelt wird. Die aktivierte Medikamentenform könnte daraufhin die DNA oder die Membran des Bakteriums angreifen und somit dormante Zellen abtöten. Die Antibiotikaklassen der Isonidazide, Pyrazinamide, Ethionamide und Metronidazole besitzen bereits Eigenschaften von “Pro-Antibiotika“, wobei deren Wirksamkeit weiterer Verbesserung bedarf (Lewis, 2007). Allison et al. (2011) berichteten, dass die Anwesenheit der Zucker Glukose, Mannitol oder Fruktose das Abtöten von E. coli-Persisterzellen durch Gentamicin induzierte; Staph. aureus-Persister konnten ebenfalls nach Gabe von Fruktose mit Gentamicin abgetötet werden. Außerdem wurden E. coli-Biofilme verstärkt durch die Behandlung von Mannitol und Gentamicin in vitro und in vivo im Maus-Modell reduziert. Diese Ergebnisse zeigen, dass bestimmte metabolische Stimuli das Abtöten von Persisterzellen gramnegativer und grampositiver Bakterien mit Aminoglykosiden induzieren. Die Theorie besagt, dass durch den glykolytischen Abbau der Metabolite NADH generiert wird, welches durch die Enzyme der Elektronentransportkette oxidiert wird und so zur Entstehung der PMF beiträgt. Die gesteigerte PMF erhöht die Aminoglykosidaufnahme, was das Abtöten der Persisterzellen verstärkt. Die Gabe PMF-stimulierender Metabolite in Kombination mit Aminoglykosiden könnte sich somit als wirksame Behandlung chronischer bakterieller Infektionen erweisen. 2.4.7 Persisterbildung und Antibiotikatoleranz von Streptokokken Die Persisterbildung bei Streptokokken ist allgemein sehr wenig erforscht. Leung und Lévesque (2012) untersuchten die Bildung von Persistern durch S. mutans. Sie beschrieben, dass S. mutans in der Lage ist, Persister zu bilden, die eine Toleranz gegenüber Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen aufweisen. Des Weiteren 51 Schrifttum ermittelten sie, dass Persisterlevel von Bakterien, die einen Biofilm ausbilden, sich statistisch nicht signifikant von den Persisterleveln planktonischer Bakterien unterschieden. Interessanterweise stieg der Anteil an Persistern mit dem Alter des Biofilms. Dies wurde auf die fortschreitenden limitierenden Bedingungen im Biofilm, wie z. B. Nährstoffmangel, zurückgeführt. Eine Überexpression der TA-Module MazEF und RelBE führte zu einem Anstieg des Persisterzelllevels, so dass davon auszugehen ist, dass die entsprechenden Gene mit der Antibiotikatoleranz assoziiert sind. Eine Mutation dieser beiden TA-Module hatte keinen Einfluss auf die Antibiotikatoleranz – dies lässt darauf schließen, dass weitere TA-Module in der Ausbildung der Persisterzellen involviert sind. Das Gen rnhB, das für eine putative RNase H kodiert, wurde ebenfalls als ein mit der Persisterbildung assoziiertes Gen identifiziert. Stressoren wie Hitze, ein saurer pH-Wert, oxidativer Stress und Nährstoffmangel führten ebenfalls zu einem erhöhten Persisterlevel in S. mutans. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass das QS-System von S. mutans ebenfalls in der Bildung stressinduzierter Persister involviert ist. Zuvor wurde beschrieben, dass das QS-Peptid (CSP Pheromon) von S. mutans durch Stress induzierbar ist und Signale innerhalb der Bakterienpopulation übermitteln kann (Perry et al., 2009). Bei S. suis war zu Beginn dieser Arbeit noch nichts über die Persisterbildung bekannt. 52 Material und Methoden 3 Material und Methoden 3.1 Material 3.1.1 Chemikalien, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Geräte Alle in dieser Arbeit verwendeten Chemikalien und Reagenzien stammten, wenn nicht anders gekennzeichnet, von den Firmen Merck (Darmstadt), Roth (Karlsruhe) oder Sigma (Taufkirchen). Gekennzeichnete Medien und Puffer wurden vor Verwendung bei 121°C und 1 bar Überdruck autoklaviert. Im Anhang befindet sich eine alphabetisch geordnete detaillierte Auflistung aller verwendeten Chemikalien, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Gerätschaften mit Angabe der Firmen. 3.1.2 Bakterienstämme In dieser Arbeit wurde der Streptococcus (S.) suis-Stamm 10 (Serotyp 2) (Smith et al., 1999) verwendet. Dieser hochvirulente S. suis-Stamm wurde aus einem an Meningitis erkrankten Schwein isoliert und exprimiert die Virulenzmarker EF, MRP, SLY, OFS und FBPS. Des Weiteren wurden verschiedene isogene Mutanten von S. suis-Stamm 10 verwendet. Die Kapselmutante 10cps∆EF (hier bezeichnet mit 10∆cps) wurde durch Insertion einer Erythromycinresistenzgenkassette in die zur Kapselsynthese wichtigen Gene cps2E und cps2F hergestellt und zeigte eine deutlich geringere Virulenz als der unveränderte Wildtyp (WT)-Stamm (Smith et al., 1999). Die Mutanten 10∆ccpA, 10∆arcD und 10∆sly wurden ebenfalls durch das Einfügen einer Erythromycinresistenzgenkassette in das ccpA-Gen, in das arcD-Gen bzw. in das sly-Gen (Benga et al., 2008) konstruiert. Das CcpA ist ein global aktives Regulatorprotein und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des ArgininDeiminase-Systems (ADS) und im alternativen Kohlenhydrat-Stoffwechsel (Willenborg et al., 2011). Das ArcD ist ebenfalls mit dem ADS assoziiert und stellt einen putativen Arginin-Ornithin-Transporter dar (Fulde, Dissertation, 2007). Das Suilysin (Sly) ist ein Hämolysin von S. suis (Jacobs et al., 1994; Seitz et al., 2013). Die Mutanten 10∆flpS und 10∆AD 53 wurden hergestellt, indem eine Material und Methoden Spectinomycinresistenzgenkassette in das flpS-Gen bzw. in das arcA-Gen inseriert wurde. Das FlpS ist ebenfalls ein Regulatorprotein des ADS und scheint sauerstoffabhängig reguliert zu sein (Gruening et al., 2006; Fulde, Dissertation, 2007). Von den drei Enzymen, die das ADS bilden, stellt das ArcA das erste Enzym dar (Arginin-Deiminase), dessen Mutante hier mit 10∆AD bezeichnet ist (Gruening et al., 2006). Als einen weiteren S. suis-Serotyp 2-Stamm wurde der Stamm 05ZYH33 eingesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Humanisolat, das für einen S. suis-Ausbruch in China, begleitet von Symptomen eines streptococcal toxic shock syndrome (STSS), verantwortlich war (Chen et al., 2007). Außerdem wurde der S. suis Serotyp 9-Stamm A3286/94 verwendet. Dieser SLYund MRP-positive Stamm wurde ebenfalls aus einem an Meningitis erkrankten Schwein isoliert (Allgaier et al., 2001), war nach intranasaler Infektionen von Schweinen aber weniger virulent im Vergleich zu Serotyp 2-Stamm 10 (Beineke et al., 2008). Des Weiteren wurden die (fakultativ) humanpathogenen Streptokokken-Spezies S. gordonii (Stamm 30; Rohde et al., 2003), S. pyogenes (M Typ 12, Stamm A40; Molinari et al., 1997) und S. agalactiae (Serotyp III, Stamm 6313; Schubert et al., 2002) verwendet. Bei S. pyogenes und S. agalactiae handelt es sich um klinische Isolate. Als einen weiteren Vertreter der Familie Streptococcaceae wurde der apathogene Lactococcus lactis Supspezies cremoris-Stamm MG1363 (L. lactis) verwendet. 3.1.3 Antikörper Für die Anreicherung der porzinen CD14-positiven Monozyten diente der mit magnetischen Microbeads konjugierte mouse anti-human CD14-Antikörper (Biotec, Bergisch Gladbach). Zur Charakterisierung der porzinen mononukleären Zellen (engl.: mononuclear cells, MNCs) und der CD14-positiven Monozyten wurden der Alexa 647-konjugierte mouse anti-human CD14-Antikörper (AbD Serotec, Puchheim), der Phycoerythrin (PE)-konjugierte mouse anti-pig CD163-Antikörper (AbD Serotec, Puchheim) und der Fluorescein Isothiocyanat (FITC)-konjugierte 54 Material und Methoden mouse anti-pig CD172a-Antikörper (BD, Heidelberg) eingesetzt. Zur Darstellung der Bakterien in der Doppelimmunfluoreszenz (DIF) wurden als Primärantikörper die Antikörper rabbit anti-S. suis K62 (Beineke et al., 2008) und rabbit anti-S. suis Serotyp 9 (Büttner et al., 2012) und als Sekundärantikörper der Alexa® Fluor 488konjugierte goat anti-rabbit-Antikörper und der Alexa® Fluor 568-konjugierte goat anti-rabbit-Antikörper verwendet (Invitrogen, Darmstadt). Gereinigte porzine IgGs (Sigma) wurden verwendet, um Latexpartikel mit porzinen Antikörpern zu beladen. Zum Nachweis des Suilysins in Überständen S. suis-infizierter Monozyten dienten der polyklonale Primärantikörper rabbit anti-Suilysin (Benga et al., 2008) und der mit alkalischer Phosphatase (AP)-konjugierte goat anti-rabbit-Sekundärantikörper (Dianova, Hamburg). 3.1.4 Antibiotika Penicillin G, Amoxicillin, Ciprofloxacin, Rifampicin und Erythromycin wurden von Sigma (Taufkirchen), Gentamicin wurde von Roth (Karlsruhe), Cubicin (Wirkstoff Daptomycin) von Novartis Pharma (Nürnberg) und die Penicillin-StreptomycinKombinationsantibiotikalösung Pen-Strep von Gibco (Darmstadt) bezogen. 3.2 Methoden 3.2.1 Bakteriologische Methoden 3.2.1.1 Stammhaltung und Kulturbedingungen Alle Bakterienstämme wurden als Glyzerolstocks bei -80°C gelagert. Für die Herstellung der Glyzerolstocks wurde eine 50%-ige Glyzerollösung [v/v] 1:1 mit der Übernachtkultur (ÜNK) des entsprechenden Stammes gemischt. Für die Kultivierung auf festen Nährböden wurden die Glyzerolstocks auf entsprechenden Agarplatten ausgestrichen. S. suis (Stamm 10, A3286/94, 05ZYH33 und die Kapselmutante 10∆cps), S. gordonii (Stamm 30), S. pyogenes (Stamm A 40), S. agalactiae (Stamm 6313) und L. lactis (Stamm MG1363) wurden auf Columbia Agarplatten mit Zusatz von 7% Schafblut (Oxoid, Wesel) kultiviert, die 55 Material und Methoden Mutanten 10∆ccpA, 10∆arcD und 10∆sly auf Columbia Agarplatten (Oxoid, Wesel) mit Zusatz von 6% Pferdeblut (WDT, Serumwerk Memsen, Hoyerhagen) und Erythromycin in einer Finalkonzentration von 2 µg/ml und die Mutanten 10∆flpS und 10∆AD auf Columbia Agarplatten mit 6% Pferdeblutzusatz und 100 µg/ml (Finalkonzentration) Spectinomycin. Alle Mutanten wurden vor der weiteren Verwendung in den Persisterversuchen auf Columbia Schafblutagar ohne Antibiotikumzusatz subkultiviert. Für die Kultivierung in Flüssigkultur wurde ausgehend von der Kultur auf den festen Nährböden Bacto™ Todd Hewitt broth (THB; Difco, Heidelberg; angesetzt nach Herstellerangaben und autoklaviert) mit einer oder mehreren Kolonien inokuliert. Die THB-Flüssigkultur wurde über Nacht bei 37°C unter aeroben Bedingungen stehend inkubiert. Für alle Studien bezüglich der Antibiotikatoleranz und der Assoziation mit porzinen Monozyten wurde chemisch definiertes RPMI-Medium 1640 (RPMI-Medium; Gibco, Darmstadt) verwendet. 3.2.1.2 Wachstumskinetiken Zur Ermittlung der Wachstumskinetiken von S. suis-Stamm 10, seiner isogenen Mutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD, der S. suis-Stämme A3286/94 und 05ZYH33, der Streptococcus Spezies S. gordonii (Stamm 30), S. pyogenes (Stamm A40) und S. agalactiae (Stamm 6313) und dem weiteren Vertreter der Familie Streptococcaceae L. lactis wurden von auf den Blutagarplatten gewachsenen Bakterienkolonien ÜNK in 50 ml THB-Medium inokuliert. Die ÜNK wurden stehend für etwa 14 bis 15 h bei 37°C bebrütet und die optischen Dichten (OD) der ÜNK wurden photometrisch bei einer Wellenlänge von 600 nm (OD600) bestimmt. Die ÜNK wurden mit frischem THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt, wobei das Gesamtvolumen 50 ml betrug. Die Kulturen wurden stehend bei 37°C bebrütet und die OD600 wurde stündlich photometrisch erfasst. Zu Beginn der exponentiellen und der stationären Wachstumsphase wurden die Bakterien für weitere Versuche geerntet. 56 Material und Methoden 3.2.1.3 Frischkulturen und Kryokonservierung Beim Erreichen der Wachstumsphase wurden die Bakterien geerntet, indem 19 ml der Kultur in der exponentiellen Wachstumsphase und 4 ml der Kultur in der stationären Wachstumsphase für 10 min bei 2700 x g und 4°C in einem 50 ml- bzw. 14 ml-Röhrchen zentrifugiert wurden. Die Bakterienpellets wurden einmal mit 5 ml eiskaltem PBS gewaschen und wiederum für 5 min bei 2700 x g und 4°C zentrifugiert. Für die Verwendung von Frischkulturen wurden die Bakterienpellets in 1 ml THBMedium resuspendiert und direkt in weiterführenden Versuchen eingesetzt, wobei die entsprechende Kulturmenge mit der gewünschten Anzahl an KBE entnommen wurde. Die entnommene Kulturmenge entsprach der Menge an kryokonservierten Bakterien (siehe unten), dessen KBE-Konzentration im Vorfeld durch Ausplattieren bestimmt werden kann. In weiteren Versuchen wurde die Menge bei Abweichungen des Eingangsinokulums angepasst. Für die Kryokonservierung wurden die Bakterienpellets in 850 µl THB-Medium resuspendiert und mit 150 µl 100%-igem [v/v] Glyzerol gemischt (Finalkonzentration des Glyzerols 15%), zu 50 µl-Aliquots in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei -80°C gelagert. Zusammensetzung des verwendeten Puffers: 1 x Phosphate buffered saline (PBS) (pH 7,5): A. bidest + 137 mM [w/v] Natriumchlorid (NaCl) + 2,7 mM [w/v] Kaliumchlorid (KCl) + 10 mM [w/v] Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat (Na2HPO4 * 2H2O) + 2 mM [w/v] Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4) Einstellen des pH-Wertes auf 7,5 mit Salzsäure (HCl) 57 Material und Methoden 3.2.2 Bestimmung von Antibiotikatoleranzen 3.2.2.1 Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) Um die Bakterien mit einer definierten Antibiotikakonzentration behandeln zu können, wurde zunächst die minimale Hemmkonzentration (MHK) jedes verwendeten Antibiotikums in RPMI-Medium bestimmt. Die MHK ist die geringste Konzentration eines Antibiotikums, die die Vermehrung der Bakterien sichtbar hemmt. Dazu wurde in einer 96-well-Mikrotiterplatte das entsprechende Antibiotikum geometrisch verdünnt. In die erste Vertiefung wurden 200 µl einer Antibiotikastocklösung pipettiert. Die Stocklösungen von Gentamicin (1,6 mg/ml), Penicillin G (25 µg/ml), Amoxicillin (25 µg/ml) und Daptomycin (1,6 mg/ml) wurden in RPMI-Medium angesetzt, die Stocklösung von Rifampicin (25 µg/ml) in Methanol, die Stocklösung von Ciprofloxacin (100 µg/ml) in 0,1 N Salzsäure und die Stocklösung von Erythromycin (1,6 mg/ml) in Ethanol. In Vertiefung zwei bis zwölf wurden jeweils 100 µl RPMI-Medium vorgelegt. Ausgehend von Vertiefung eins wurden jeweils 100 µl Antibiotikalösung bis Vertiefung zwölf überpipettiert; aus Vertiefung zwölf wurden 100 µl verworfen. Anschließend wurden in jede Vertiefung 100 µl der zu testenden Bakteriensuspension hinzupipettiert, wobei kryokonservierte Bakterien der exponentiellen und stationären Wachstumsphase eingesetzt wurden. Die Anzahl der hinzugegeben koloniebildenden Einheiten (KBE) betrug 5 x 105 pro Vertiefung bzw. 5 x 106 pro Vertiefung. 5 x 106 KBE wurden bei den schlecht sichtbar pelletierenden Bakterienspezies S. gordonii und S. pyogenes eingesetzt. Als Kontrolle dienten Vertiefungen ohne Antibiotikum, in die die gleiche Menge Bakterien pipettiert wurde (Wachstumskontrolle) und Vertiefungen ohne Antibiotikum mit Zugabe von 1% [v/v] Formaldehyd (finale Konzentration), in die ebenfalls die gleiche Menge Bakterien pipettiert wurde (Fixierung der Bakterien zur Kontrolle der Pelletbildung ohne Vermehrung). Die Mikrotiterplatten wurden anschließend mit einer Breathe Easy®Folie abgedichtet, um eine Verdunstung von Flüssigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Gasaustausches zu verhindern, und für 24 h bei 37°C inkubiert. Um die MHK abzulesen, wurden die Mikrotiterplatten mit dem Fotoscanner perfection V700 photo eingescannt (Epson, Meerbusch) und die Konzentration des 58 Material und Methoden Antibiotikums, die die Vermehrung der Bakterien gerade noch hemmte, wurde visuell bestimmt. Zur Bestimmung des tatsächlichen Eingangsinokulums wurde weiterhin ein 20 µl-Aliquot aus der Wachstumskontrollvertiefung in 180 µl PBS überführt, geometrisch verdünnt und auf Columbia Schafblutagar in Triplikaten zu jeweils 10 µl ausplattiert. In Tabelle 2 sind die MHK-Bestimmungen der eingesetzten Antibiotika für die entsprechenden S. suis-Stämme und Spezies aufgelistet. Tabelle 2: Zusammenfassung der MHK-Bestimmungen für die entsprechenden S. suis-Stämme und Spezies. Antibiotikum Bakterienstamm Gentamicin Penicillin G Ampicillin Ciprofloxacin Rifampicin Daptomycin Erythromycin S. suis-Stamm 10 + + + + + + + S. suis-Stamm A3286/94 + - - - - - - S. suis-Stamm 05ZYH33 + - - - - - - S. gordonii (30) + - - + - - - S. pyogenes (A40) + - - + - - - S. agalactiae (6313) + - - + - - - + bestimmt; - nicht bestimmt 3.2.2.2 Überleben in Anwesenheit von Antibiotika Um festzustellen, inwiefern die Bakterien in der Lage sind, die Anwesenheit von Antibiotika, deren Konzentration das Hundertfache der MHK übersteigt, zu tolerieren, wurden Überlebenskinetiken durchgeführt. Dazu wurde RPMI-Medium in einem 1,5 ml Reaktionsgefäß mit 1 x 107 KBE von Bakterien, die sich entweder in der beginnenden exponentiellen oder in der stationären Wachstumsphase befanden, inokuliert. Es wurden entweder Frischkulturen oder kryokonservierte Bakterien verwendet. Das Gesamtvolumen der Reaktion betrug 1 ml. Vor Zugabe der Antibiotika wurden den Ansätzen 20 µl-Aliquots entnommen, um das genaue Eingangsinokulum festzustellen. Es wurden Triplikate zu jeweils 10 µl auf Columbia Schafblutagar ausplattiert. Anschließend wurden die Antibiotika, von denen jeweils eine Stocklösung frisch angesetzt wurde, hinzupipettiert. Die Finalkonzentration der Antibiotika in den Ansätzen entsprach jeweils der 100-fachen Menge der MHK. Die Ansätze wurden daraufhin rotierend bei 37°C inkubiert. Nach 1, 2, 4, 6, 8 und 24 h 59 Material und Methoden wurden den Ansätzen jeweils 100 µl-Aliquots entnommen, die 5 min bei 7500 x g und 4°C zentrifugiert wurden. Der Überstand wurde abpipettiert und das Pellet mit 500 µl eiskalter 0,85%-iger [w/v] NaCl-Lösung gewaschen. Dazu wurden die Reaktionsgefäße nach Zugabe der NaCl-Lösung viermal geschwenkt und erneut für 5 min bei 7500 x g und 4°C zentrifugiert. Der Waschüberstand wurde anschließend ebenfalls abpipettiert. Das Pellet wurde in 50 µl eiskalter 0,85%-iger [w/v] NaClLösung resuspendiert, wovon 20 µl nach geometrischer Verdünnung in 180 µl PBS auf Columbia Schafblutagar in Triplikaten (jeweils 10 µl) ausplattiert wurden. Die verbleibende Bakteriensuspension wurde unverdünnt in Triplikaten zu jeweils 10 µl ausplattiert. Das Überleben der Bakterien wurde durch Auszählen der KBE bestimmt. Die Agarplatten wurden bis zu 72 h inkubiert, um auch langsamwachsende Kolonien zu erfassen. Zur Inhibierung der protonenmotorischen Kraft (engl.: proton-motive force, PMF) wurden den Ansätzen vor der Antibiotikum-Zugabe der Inhibitor carbonyl cyanide mchlorphenyl hydrazone (CCCP; angesetzt nach Herstellerangaben) in einer Finalkonzentration von 20 µM hinzugegeben. Die Ansätze wurden für 10 min auf Eis vorinkubiert, bevor das Antibiotikum hinzugegeben wurde und wie oben beschrieben weiter verfahren wurde. 3.2.2.3 Test auf Heritabilität Mit dem Heritabilitätstest lässt sich feststellen, ob die Toleranz gegenüber Antibiotika von den Bakterien vererbt wird oder ob die Eigenschaft zur Antibiotikatoleranz der Bakteriensubpopulation eine phänotypische Varianz darstellt. Bei einem horizontalen Transfer der Eigenschaften, die zur Toleranz gegenüber den Antibiotika führen, würde es sich um eine vererbte Resistenz handeln im Gegensatz zur nicht vererbten Antibiotikatoleranz. Für diesen Test wurden wie unter 3.2.1.3 beschrieben ÜNK von S. suis mit frischem THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt, weiter wachsen gelassen und beim Erreichen der exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase geerntet. Die Pellets wurden einmal mit 5 ml PBS gewaschen, indem die Reaktionsgefäße viermal geschwenkt und erneut für 5 min bei 2700 x g und 4°C zentrifugiert wurden. 60 Material und Methoden Anschließend wurden die Pellets in jeweils 1 ml frischem THB-Medium resuspendiert. Daraufhin wurde RPMI-Medium mit 8 µl der resuspendierten exponentiell gewachsenen bzw. mit 7 µl der resuspendierten stationär gewachsenen Bakterien (entsprechend jeweils 1 x 107 KBE) inokuliert. Das Gesamtvolumen des Reaktionsansatzes betrug 1 ml. Zwanzig µl dieses Ansatzes wurden entnommen, geometrisch in PBS verdünnt und auf Columbia Schafblutagar zur Bestimmung des Eingangsinokulums ausplattiert. Anschließend wurden den Ansätzen Gentamicin hinzugegeben; die Finalkonzentration des Gentamicins entsprach dabei in den Ansätzen der 100-fachen MHK. Gentamicin wurde als Antibiotikum im Heritabilitätstest eingesetzt, da es sich in vorangegangenen Versuchen aufgrund seiner Eigenschaften als das Antibiotikum der Wahl herausstellte. Die Ansätze wurde für 3 h rotierend bei 37°C inkubiert, wobei den Ansätzen stündlich ein Aliquot von 100 µl entnommen wurde. Die Aliquots wurden für 5 min bei 7500 x g und 4°C zentrifugiert und die Überstande wurden abpipettiert. Die Pellets wurden wie unter 3.2.2.2 beschrieben gewaschen und zur Bestimmung der KBE auf Columbia Schafblutagar ausplattiert. Nach 3 h Inkubation mit Gentamicin wurden die Ansätze für 5 min bei 7500 x g und 4°C zentrifugiert und die Pellets wurden einmal mit 500 µl 0,85%-iger [w/v] NaCl gewaschen, indem erneut für 5 min bei 7500 x g und 4°C zentrifugiert wurde. Mit den Bakterienpellets wurde eine neue ÜNK in THB-Medium angeimpft. Der Zyklus, der das Animpfen der ÜNK, das Ernten der entsprechenden Wachstumsphase, die Antibiokumbehandlung und das erneute Animpfen einer ÜNK umfasst, wurde insgesamt viermal wiederholt. Für jeden Zyklus wurde der Anteil der antibiotikatoleranten Subpopulation durch ausplattieren und zählen der KBE bestimmt. Die Agarplatten wurden ebenfalls bis zu 72 h inkubiert, um auch hier langsam wachsende Kolonien zu erfassen. 3.2.2.4 Test auf die Eliminierung von Persistern Um festzustellen, ob S. suis Typ I- oder Typ II-Persiterzellen bildet, wurde der Persisterzell-Eliminierungstest durchgeführt. Bei diesem Test wird eine exponentiell gewachsene Bakterienkultur durch wiederholte Re-Inkulation für mehrere Zyklen in der exponentiellen Wachstumsphase gehalten. Während jedes Zyklus werden 61 Material und Methoden exponentiell gewachsene Bakterien mit einem Antibiotikum behandelt. Typ IPersisterzellen werden wahrscheinlich stressbedingt in der stationären Wachstumsphase gebildet und beim Überimpfen übertragen und somit mit jeder wiederholten Re-Inokulation und Antibiotikumbehandlung durch einen Verdünnungseffekt eliminiert. Da Typ II-Persisterzellen kontinuierlich gebildet werden, bleibt der Typ II-Persisterzelllevel mit jeder weiteren Re-Inokulation und Antibiotikumbehandlung konstant. Für diesen Test wurde eine ÜNK von S. suis-Stamm 10 mit frischem THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und bis zur exponentiellen Wachstumsphase wachsen gelassen. Mit einem Aliquot dieser exponentiell gewachsenen S. suis-Kultur wurde erneut frisches THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und bis zur exponentiellen Wachstumsphase wachsen gelassen. Dieser Zyklus wurde dreimal wiederholt. Für jeden Zyklus wurde eine Gentamicinbehandlung durchgeführt. Dafür wurde in einem 1,5 ml-Reaktionsgefäß RPMI-Medium mit 1 x 107 KBE von exponentiell gewachsenen Bakterien inokuliert. Das genaue Eingangsinokulum wurde wie unter 3.2.2.2 beschrieben bestimmt. Nach Inokulation wurde Gentamicin in der 100-fachen MHK hinzupipettiert und die Ansätze wurden für 1 h bei 37°C rotierend inkubiert. Das Gesamtvolumen der Ansätze betrug 1 ml. Nach der einstündigen Inkubation wurden wie unter 3.2.2.2 beschrieben die überlebenden Bakterien durch Ausplattieren auf Columbia Schafblutagar bestimmt. Der prozentuale Anteil überlebender Bakterien in Bezug auf das Eingangsinokulum vor Gentamicinbehandlung wurde berechnet. 3.2.3 Zellbiologische Methoden 3.2.3.1 Separation mononukleärer Zellen (MNCs) aus porzinem Vollblut Für das Studium der Assoziation von S. suis mit naïven porzinen Monozyten, mussten zunächst die Monozyten aus heparinisiertem Vollblut gewonnen und angereichert werden. Monozyten stellen einen Teil der MNCs dar, wobei der Anteil der Monozyten an den MNCs beim Schwein etwa 2 bis 10% beträgt (Thorn, 2010). Die Hauptmasse der MNCs stellen somit die Lymphozyten dar. Das Vollblut, aus 62 Material und Methoden denen die MNCs gewonnen wurden, stammte von gesunden Schweinen. Die Separierung der MNCs von den anderen korpuskulären und flüssigen Bestandteilen des Blutes erfolgte über eine Biocoll-Dichtegradienten-Zentrifugation. Dazu wurden in vier 50 ml-Röhrchen jeweils 13 ml heparinisiertes Vollblut (16 I.E. Heparin/ml Blut) 1+1 mit 13 ml 0,85%-iger [w/v] NaCl verdünnt. Anschließend wurden 12 ml des Polymers Biocoll mit einer Dichte von 1,077 g/ml (Biochrom, Darmstadt) mit 12 ml verdünntem Blut vorsichtig überschichtet (insgesamt acht Ansätze) und für 30 min bei 2000 x g und 4°C zentrifugiert, wobei die Beschleunigung und die Abbremsung der Rotordrehung auf langsam gestellt wurde. Nach der Zentrifugation bildet sich ein Gradient, bei dem sich im Pellet die Granulozyten und die Erythrozyten befinden, dann folgen die Biocoll-Schicht und abschließend die Blutplasma-Schicht, wobei sich die MNCs in der Interphase zwischen der Biocoll- und der Blutplasma-Schicht anreichern. Die Interphase mit den MNCs wurde abpipettiert und in ein neues 50 mlRöhrchen überführt. Pro Gradient wurden 5 ml Interphase entnommen, wobei jeweils die Interphasen von vier Gradienten vereint wurden. Die Interphase in beiden 50 mlRöhrchen wurde auf 50 ml mit RPMI-Medium aufgefüllt und für 10 min bei 1000 x g und 4°C zentrifugiert. Nach Absaugen der Überstände wurden die Pellets mit 12 ml RPMI-Medium gewaschen und erneut für 5 min bei 1000 x g und 4°C zentrifugiert. Die Überstände wurden wiederum abgesaugt und die Pellets mit den MNCs in jeweils 1 ml RPMI-Medium resuspendiert. Hierbei wurde darauf geachtet, dass nicht resuspendierbare Zellklümpchen verworfen wurden. Die beiden in 1 ml RPMIMedium resuspendierten Pellets wurden erneut vereint. Anschließend wurde die Anzahl der MNCs bestimmt, wozu eine Neubauer Zählkammer verwendet wurde. Die Zellsuspension wurde dafür 1:100 in RPMI-Medium verdünnt. Die Zellzahl aller vier Großquadrate (bestehend aus jeweils 16 Kleinquadraten) wurde gezählt und durch vier geteilt, um den Mittelwert eines Großquadrates zu erhalten. Die gezählte und gemittelte Zellzahl entspricht der Zellzahl x 104/ml (unter Berücksichtigung der Verdünnung). Um die Qualität der präparierten MNCs zu kontrollieren, wurde die Morphologie und Vitalität der Zellen durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) überprüft und mit der BD accuri™ C6 Software ausgewertet. 63 Material und Methoden 3.2.3.2 Immunomagnetische Aufreinigung porziner CD14-positiver MNCs Monozyten stellen innerhalb der MNCs nur eine kleine Subpopulation dar. Beim Schwein beträgt der Anteil an Monozyten innerhalb der MNCs 2 bis 10% (Thorn, 2010). Um ausschließlich Monozyten zu erhalten, wurden diese aus den MNCs über den Oberflächenmarker CD14 per magnetic activated cell sorting (MACS) angereichert. Dies erfolgte nach Separierung der MNCs mittels einer Antikörpermarkierung und anschließender immunomagnetischer Aufreinigung. Dazu wurden 2 x 108 MNCs für 10 min bei 250 x g und 4°C zentrifugiert. Das Pellet wurde in 1,6 ml MACS-Puffer resuspendiert und mit 100 µl mouse anti-human CD14Antikörper, der mit magnetischen Microbeads konjugiert ist, versetzt. Dieser Antikörper kreuzreagiert mit porzinen Monozyten und fungiert als Monozytenmarker. Die MNCs wurden mit dem Antikörper rotierend für 15 min bei 4°C inkubiert. Nach der Inkubation wurden die markierten MNCs in ein 14 ml-Röhrchen überführt, und mit 12 ml MACS-Puffer gewaschen, indem die Zellsuspension für 10 min bei 250 x g und 4°C zentrifugiert wurde. Das Pellet wurde in 1 ml MACS-Puffer resuspendiert. Anschließend erfolgte die Anreicherung der CD14-positiven Zellen, die mit den magnetischen Microbeads konjugiert waren, in einem magnetischen Feld mittels des MiniMACS™ Separator Sytems (Miltenyi, Bergisch Gladbach). Dazu wurde ein Dauermagnet (MiniMACS™ Separator; Miltenyi, Bergisch Gladbach) an einem Magnetständer (MultiStand; Miltenyi, Bergisch Gladbach) angebracht und mit einer MS-Säule (MS Column; Miltenyi, Bergisch Gladbach) bestückt. Der Dauermagnet induziert ein starkes magnetisches Feld innerhalb der MS-Säule, die eine Matrix, bestehend aus ferromagnetischen Partikeln, enthält. Die Säule wurde einmal mit 500 µl MACS-Puffer gespült. Anschließend wurde die Suspension mit den MNCs und den markierten CD14-positiven Zellen (= Monozyten) auf die Säule pipettiert, wobei der Durchfluss aufgefangen wurde. Nachdem die gesamte MNC-Suspension die Säule passiert hatte, wurde die Säule dreimal mit jeweils 500 µl MACS-Puffer gespült. Bei dem Durchfluss handelte es sich um die nicht-markierten Zellen, also um von CD14positiven Monozyten depletierte MNCs. Anschließend wurde die Säule aus dem magnetischen Feld entfernt. Durch Zugabe von 1 ml MACS-Puffer auf die Säule und schnelles Herunterdrücken des Stopfens wurden die CD14-positiven Zellen von der 64 Material und Methoden Säule eluiert. Im Eluat befanden sich demzufolge die CD14-positiven Monozyten. Um festzustellen, wie viele CD14-positiven Monozyten sich im Eluat befanden, wurde die Zellzahl mittels einer Neubauer Zählkammer wie in Kapitel 3.2.3.1 beschrieben bestimmt. In weiterführenden Versuchen wurde die Menge an Eluat entsprechend der gewünschten Zellzahl eingesetzt. Die Qualität der präparierten CD14-positiven Monozyten wurde durch Erfassung der Morphologie und Vitalität der Zellen durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) überprüft. Die Auswertung erfolgte mit der BD accuri™ C6 Software. Zusammensetzung des verwendeten Puffers: MACS-Puffer: PBS (pH 7,5) + 0,5% [w/v] Bovines Serumalbumin (BSA; Serva, Heidelberg) + 2 mM [w/v] Natrium-EDTA (Na-EDTA) Sterilfiltration In Tabelle 3 sind die Behandlung und die eingesetzte Zellzahl der porzinen MNCs und CD14-positiven Monozyten für die verschiedenen Experimente aufgelistet. Tabelle 3: Behandlung und eingesetzte Zellzahl der porzinen MNCs und CD14-positiven Monozyten in den Experimenten (Zusammenfassung) Assoziation, (mit S. suis, Latexbeads) Doppelimmunfluoreszenz (DIF) Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) Verteilung CDMarker ROS-Produktion MNCs - - - Resuspendiert in MACS-Puffer Resuspendiert in RPMI-Medium CD14-positive Monozyten Resuspendiert in MACS-Puffer Nach Assoziation mit Nach Assoziation mit S. suis S. suis (MOI 1:10) (MOI 1:10) Resuspendiert in MACS-Puffer Resuspendiert in RPMI-Medium 1 x 105/Zyto SpinVertiefung Verfügbare Zellzahl 4 x 105/100µl 2 x 105/100µl Eingesetzte Zellzahl 6 1 x 10 /ml 3.2.3.3 Durchflusszytometrische Analysen und fluorescence-activated cell sorting (FACS) Zellen können durchflusszytometrisch durch Erfassung verschiedener Parameter hinsichtlich spezieller Eigenschaften untersucht werden. Zunächst können die Zellgröße und die Granularität von Zellen zur Darstellung einer charakteristischen Zellmorphologie ermittelt werden. Die Zellgröße wird durch Erfassung des 65 Material und Methoden Vorwärtsstreulichtes (engl.: forward scatter, FSC) im FSC-Kanal und die Granularität durch Erfassung des Seitwärtsstreulichtes (engl.: sideward scatter, SSC) im SSCKanal bestimmt. In dieser Arbeit wurde die Morphologie von S. suis, den MNCs und den CD14positiven Monozyten untersucht. Dazu wurden 50 µl von den kryokonservierten Bakterien, den präparierten MNCs bzw. den präparierten CD14-positiven Monozyten mit 150 µl PBS verdünnt und anschließend durchflusszyometrisch erfasst. Es wurden jeweils 10000 Zellen im FSC- und SSC-Kanal gemessen und als Dot-Plot dargestellt. Die Größe der Zellen (x-Achse) wurde dabei gegen die Granularität (y-Achse) aufgetragen. Anschließend konnten gewünschte Zellpopulationen für weitere Darstellungen definiert werden. Mittels der durchflusszytometrischen Analyse können auch Fluoreszenz-markierte Zellen erfasst werden. In diesem Fall handelt es sich um fluorescence-activated cell sorting (FACS). Dabei kann die Fluoreszenz mehrerer verschiedener Wellenlängen in verschiedenen Kanälen gleichzeitig detektiert werden. Durch Erfassung von Fluoreszenz-markierten Zellen können diese von unmarkierten Zellen abgegrenzt werden. Zellen, die mit mehreren Fluoreszenzfarbstoffen gleichzeitig markiert werden, können hinsichtlich bestimmter Merkmale differenziert werden. Die Mehrfachfluoreszenzmessung erfolgte am Durchflusszytometer BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg). Die CFSE-, FITC-, PE- und Propidiumjodid (PJ)-markierten Zellen wurden dabei von einem blauen Laser bei einer Wellenlänge 488 nm und die Alexa Fluor® 647-markierten Zellen von einem roten Laser bei einer Wellenlänge von 640 nm angeregt. Das Durchflusszytometer ist neben zwei Detektoren zur Erfassung des Vorwärts- und Seitwärtsstreulichtes mit vier optischen Filtern und den zugehörigen Detektoren zur Erfassung der emittierten Fluoreszenz ausgestattet. Die Detektion der grünen Fluoreszenz (CFSE, FITC) erfolgte bei 533 nm im FL1-Kanal, die Detektion der dunkelroten Fluoreszenz (PE) bei 585 nm im FL2-Kanal, die Detektion der orange-roten Fluoreszenz (PJ) bei 670 nm im FL3-Kanal und die Detektion der blauen Fluoreszenz (Alexa Fluor® 647) bei 640 nm im FL4-Kanal. 66 Material und Methoden 3.2.3.4 Durchflusszytometrische phänotypische Charakterisierung CD14- positiver Monozyten Für jede Zellpopulation ist die Expression spezifischer CD-Marker (CD = engl.: cluster of differentiation) charakteristisch. Um die Expression und Verteilung einiger ausgewählter CD-Marker auf den CD14-positiven Monozyten zu untersuchen, wurden die CD-Marker mit fluoreszenzkonjugierten Antikörpern markiert. Anschließend wurden die Zellen hinsichtlich der Expression der CD-Marker per Fluoreszenzmessung durchflusszytometrisch erfasst. Für diese Analyse wurden in MACS-Puffer resuspendierte Zellen eingesetzt. Als Kontrolle dienten MNCs, die vor dem Experiment für 10 min bei 250 x g und 4°C zentrifugiert und in 2 ml MACSPuffer resuspendiert wurden. Die Zellzahl wurde wie in Kapitel 3.2.3.1 beschrieben mit der Neubauer-Zählkammer bestimmt. Als Antikörper wurden anti-CD172a (FITC-konjugiert, grüne Fluoreszenz), anti-CD14 (Alexa 647-konjugiert, blaue Fluoreszenz) und anti-CD163 (PE-konjugiert; dunkelrote Fluoreszenz) verwendet. CD172a wird von der Gesamtheit der porzinen Monozytenund Makrophagenpopulation exprimiert (Haverson et al., 1994; McCullough et al., 1997). Da in diesem Versuch nur die MNCs/Monozyten von Interesse waren und diese Zellen nach der Dichtegradienten-Zentrifugation von den Granulozyten separiert wurden, und da sich im zirkulierenden Blut keine Makrophagen befinden, fungierte der anti-CD172a-Antikörper als Gesamt-Monozytenmarker. CD14 und CD163 werden während des Reifungsprozesses der porzinen Monozyten in unterschiedlicher Quantität exprimiert, wodurch sich durch Verwendung von Antikörpern gegen diese Moleküle die Monozyten in grobe Untergruppen einteilen lassen (Chamorro et al., 2005). Für diesen Versuch wurden zunächst die drei eingesetzten Antikörper gemischt und dabei verdünnt. Der anti-CD172a- und der anti-CD163-Antikörper wurden jeweils 1:50 in Membranimmunfluoreszenz (MIF)-Puffer verdünnt und der anti-CD14Antikörper wurde 1:20 in MIF-Puffer verdünnt, das heißt in 91 µl MIF-Puffer wurden jeweils 2 µl anti-CD172a- und anti-CD163-Antikörper und 5 µl anti-CD14-Antikörper pipettiert. Die Antikörper-Mischung wurde kurz gevortext. Außerdem wurden in eine 96-well-Rundboden-Mikrotiterplatte jeweils 4 x 105 Zellen der MNCs und der CD14- 67 Material und Methoden positiven Monozyten pro Vertiefung ausgesät. Das Gesamtvolumen pro Vertiefung betrug 100 µl, wobei fehlendes Volumen mit MIF-Puffer ergänzt wurde. Die Zellen wurden für 3 min bei 300 x g und RT auf den Boden der Vertiefungen der Mikrotiterplatte zentrifugiert. Der Überstand wurde einmalig aus den Vertiefungen abgeschüttelt und die Zellen durch eine kurze Schüttelung der Platte in der Restflüssigkeit resuspendiert. Pro Vertiefung wurden 20 µl der Antikörper-Mischung zu den Zellen hinzupipettiert. Die Mikrotiterplatte mit den Zellen wurde auf Eis gestellt und bei 4°C in der Dunkelheit (im Kühlschrank) für 15 min inkubiert. Nach der Inkubationszeit wurden in jede Vertiefung 150 µl MIF-Puffer pipettiert und die Platte wurde für 3 min bei 300 x g und RT zentrifugiert. Der Überstand wurde einmalig abgeschüttelt und die Zellen durch kurzes Schütteln der Platte resuspendiert. Anschließend wurde erneut 150 µl MIF-Puffer pro Vertiefung hinzupipettiert, zentrifugiert, der Überstand abgeschüttelt und die Zellen wurden durch kurzes Schütteln der Platte erneut resuspendiert. Die Zellen wurden jeweils in 50 µl MIFPuffer aufgenommen und mit 50 µl in 1,5 ml-Reaktionsgefäße vorgelegtem SheathPJ (PJ angesetzt in PBS und 0,01% Natriumazid; Konzentration der Stocklösung 4 µg/ml, Finalkonzentration 2 µg/ml) gemischt. Das Sheath-PJ dient als Trägerflüssigkeit für das Durchflusszytometer und durch den Zusatz von PJ wurde die Vitalität der untersuchten Zellpopulation bestimmt, da dieser Farbstoff nur in beschädigte Zellen eindringt. PJ weist eine orange-rote Fluoreszenz auf, welche durchflusszytometrisch im FL2-Kanal erfasst werden kann. Zusammensetzung des verwendeten Puffers: MIF Puffer: PBS (pH 7,5) + 0,5% [w/v] BSA + 0,01% [w/v] Natriumazid 3.2.3.5 Assoziation CD14-positiver Monozyten mit porzinen IgG beladenen Latexbeads Um festzustellen, ob die präparierten porzinen CD 14-positiven Monozyten grundsätzlich in der Lage sind zu phagozytieren, wurden die Monozyten einerseits 68 Material und Methoden zusammen mit porzinen IgG beladenen Latexbeads und andererseits mit unbeladenen Latexbeads inkubiert. Für das Beladen der Latexbeads mit porzinen IgG wurden in einem 1,5 mlReaktionsgefäß 10 µl der Latexbeads Suspension, was etwa 4,3 x 108 Latexbeads entsprach, und 1 ml PBS (pH 7,2) zusammenpipettiert. Nach einer Zentrifugation für 5 min bei 1000 x g und 8°C wurde das Pellet dreimal mit jeweils 500 µl Coating Puffer gewaschen und anschließend in 500 µl Coating Puffer resuspendiert. Diese Probe wurde anschließend in 2 Ansätze zu jeweils 250 µl aufgeteilt, die jeweils 2,15 x 108 Latexbeads enthielten. Einem Ansatz wurden 10 µl porzine IgG, die in einer Stocklösung von 10 mg/ml angesetzt waren, hinzugegeben, so dass die finale Konzentration der IgG in dem Ansatz 400 µg/ml betrug. Beide Ansätze wurden für 18 h bei 4°C rotiert, wobei die Reaktionsgefäße durch Umwickeln mit Aluminiumfolie dunkel gehalten wurden. Nach einem Zentrifugationsschritt für 5 min bei 4400 x g und RT wurden die Pellets in 500 µl Coating Puffer + 0,5% FCS (Biochrom, Darmstadt) resuspendiert. Nachdem die Ansätze für 5 min bei RT rotierend inkubiert wurden, erfolgte ein weiterer Zentrifugationsschritt (4400 x g, 5 min, RT). Die Pellets beider Ansätze wurden abschließend in 500 µl PBS + Ca2+ (Gibco, Darmstadt) resuspendiert. Ein Ansatz enthielt nun mit porzinen IgG beladene Latexbeads und der andere Ansatz unbeladene Latexbeads. Beide Ansätze wurden bei 4°C gelagert. Zur Ermittlung der Assoziation wurden 1 x 106 Monozyten mit 10 µl der IgGbeladenen und unbeladenen Latexbeads-Suspension (entspricht jeweils etwa 8,6 x 106 Latexbeads) in RPMI-Medium inkubiert, wobei die Menge des Gesamtansatzes 1 ml betrug. Die Inkubation erfolgte rotierend für 3 h bei 37°C. Anschließend wurden die Ansätze für 5 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert und die Pellets dreimal mit 500 µl PBS gewaschen. Abschließend wurden die Pellets in 200 µl RPMI-Medium resuspendiert. Die Phagozytosefähigkeit wurde auf zwei Arten ermittelt: konfokalmikroskopisch und durchflusszytometrisch. Für die konfokal-mikroskopische Auswertung wurde die Anzahl der Monozyten erneut mittels Neubauer Zählkammer bestimmt. Daraufhin wurden 1 x 105 Monozyten mit Zyto Spins (Thermo Fisher Scientific, Schwerte) für 5 min bei 500 x g und 4°C auf einen Objektträger zentrifugiert und nach Absaugen des 69 überschüssigen RPMI-Mediums mit Material und Methoden methanolfreiem 3%-igem [v/v] Formaldehyd bei 4°C über Nacht fixiert. Die restlichen Monozyten wurden für das Durchflusszytometer verwendet. Nach der Fixierung wurde der Objektträger zweimal für 5 min in PBS geschwenkt, um ihn zu waschen. Nach Absaugen überschüssigen PBS‘ wurden die Monozyten zur Darstellung der Zellkerne mit Prolong® Gold mit Dapi (Invitrogen, Darmstadt) eingedeckt, welches 24 h auspolymerisierte. Die Präparate wurden am konfokalen Mikroskop Leica TCS SP5 (Leica, Wetzlar) untersucht und mit der Software LAS ausgewertet. Zusammensetzung des verwendeten Puffers: 1 x Coating Puffer (pH 9,6): A. bidest + 30 mM [w/v] Natriumcarbonat (Na2CO3) + 70 mM [w/v] Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) 3.2.4 Interaktion von S. suis mit CD14-positiven Monozyten 3.2.4.1 Bestimmung des Überlebensfaktors von S. suis Vor der Untersuchung der Assoziation von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten sollte ermittelt werden, inwiefern S. suis in der Lage ist, in Anwesenheit dieser Monozyten zu überleben. Dafür wurde der Überlebensfaktor des WT und der Kapselmutante 10∆cps des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 und des WT des S. suis Serotyp 9-Stammes A3286/94 bestimmt. Dazu wurden in einem 1,5 ml-Reaktionsgefäß 1 x 106 Monozyten mit 1 x 107 kryokonservierten von ursprünglich in der exponentiellen oder stationären Phase befindlichen Bakterien (MOI 1:10) in RPMI-Medium inokuliert, wobei das Gesamtvolumen der Ansätze jeweils 1 ml betrug. Zum Zeitpunkt T0 wurde den Ansätzen jeweils ein Aliquot von 20 µl entnommen, welcher geometrisch in 180 µl eiskaltem PBS bis 10-3 verdünnt wurde. Die 10-3-Verdünnung wurde in Triplikaten zu jeweils 10 µl auf Schafblutagar ausplattiert, und die Agarplatte anschließend bei 37°C für 24 h inkubiert. Das Eingangsinokulum der Bakterien wurde durch Berechnung der eingesetzten KBE zum Zeitpunkt T0 genau bestimmt. Die Reaktionsansätze wurden rotierend für 3 h bei 37°C inkubiert. Nach der Inkubationszeit wurde den Ansätzen 70 Material und Methoden jeweils ein Aliquot von 20 µl entnommen, welcher geometrisch in 180 µl eiskaltem PBS bis 10-5 verdünnt wurde. Die 10-4- und 10-5-Verdünnung wurde in Triplikaten zu jeweils 10 µl auf Schafblutagar ausplattiert. Die Agarplatte wurde für 24 h bei 37°C inkubiert und die KBE der Bakterien zum Zeitpunkt T3 wurden durch Auszählen bestimmt. Der Überlebensfaktor wurde durch Teilen der KBE/ml zum Zeitpunkt T3 durch die KBE/ml zum Zeitpunkt T0 berechnet 3.2.4.2 CFSE-Markierung Um die Assoziation von S. suis mit den porzinen Monozyten durchflusszytometrisch ermitteln zu können, wurden die Bakterien vor der Kryokonservierung mit carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) markiert, wofür das CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit (Invitrogen, Darmstadt) verwendet wurde. Dazu wurden ebenfalls ÜNK der Bakterien mit THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 in 50 ml THBMedium verdünnt Wachstumsphase und bis wachsen zur frühen gelassen. exponentiellen Nach Ernten der bzw. stationären entsprechenden Wachstumsphase (siehe Kapitel 3.2.1.3.) wurde das Pellet zweimal mit jeweils 5 ml eiskaltem PBS gewaschen und anschließend in 1 ml eiskaltem PBS resuspendiert und in ein 1,5 ml-Reaktionsgefäß überführt. Anschließend wurde 1 µl CFSE-Lösung (angesetzt nach Herstellerangaben) zu dem resuspendierten Bakterienpellet pipettiert. Um die Markierung vor Lichteinwirkung zu schützen, wurde das Reaktionsgefäß mit Bakteriensuspension Aluminiumfolie für 20 min abgedunkelt. bei 37°C Daraufhin rotierend wurde die inkubiert. Die Bakteriensuspension wurde anschließend in ein 12 ml-Röhrchen überführt und für 10 min bei 2700 x g und 4°C zentrifugiert. Das Pellet wurde erneut zweimal mit jeweils 5 ml eiskaltem PBS gewaschen (Zentrifugation 5 min, 2700 x g, 4°C), in 850 µl THBMedium resuspendiert und wie oben erläutert kryokonserviert. Die CFSE-markierten Kryokonservate wurden ebenfalls bis zur weiteren Verwendung bei -80°C gelagert. Die Effiziens der CFSE-Markierung wurde durchflusszytometrisch am FACscan® (BD, Heidelberg) gemessen und mit der winMDI-Software (Version 2.9) ausgewertet. Um in weiterführenden Versuchen die gewünschte Menge an CFSE-markierten Bakterien einsetzen zu können, wurden im Vorfeld die KBE durch eine geometrische 71 Material und Methoden Verdünnung der kryokonservierten Bakterien in eiskaltem PBS und anschließendem Ausplattieren auf Schafblutagar quantifiziert. 3.2.4.3 Assoziationsstudien Die Assoziation von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten wurde durch Ausplattieren und durchflusszytometrisch ermittelt. Es wurden der WT und die Kapselmutante 10∆cps des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 und der WT des S. suis Serotyp 9-Stammes A3286/94 hinsichtlich ihrer Assoziation miteinander verglichen. Dazu wurden in einem 1,5 ml-Reaktionsgefäß 1 x 106 Monozyten mit 1 x 107 unmarkierten bzw. CFSE-markierten kryokonservierten von ursprünglich in der exponentiellen oder stationären Phase befindlichen Bakterien (MOI 1:10) in RPMIMedium inokuliert, wobei das Gesamtvolumen der Ansätze jeweils 1 ml betrug. Das Eingangsinokulum zum Zeitpunkt T0 wurde wie in Kapitel 3.2.4.1 beschrieben bestimmt. Die Reaktionsansätze wurden rotierend bei 37°C inkubiert. Bei Verwendung von CFSE-markierten Bakterien wurden die Reaktionsgefäße durch Umwickeln mit Aluminiumfolie vor Licht geschützt. Diese Inkubationszeit stellte die Assoziationszeit der Bakterien mit den Monozyten dar und dauerte je nach Versuch 1 oder 3 h. Im Falle der einstündigen Assoziationszeit wurde den Ansätzen zusätzlich 20% [v/v] porzines Serum neonataler Schweine (engl.: colostrum deprived serum, CDS) hinzugefügt. Nach der Inkubationszeit von 1 bzw. 3 h wurde die Anzahl an Bakterien, die mit den CD14-positiven Monozyten assoziiert war, durch ausplattieren bestimmt. Dazu wurden den Ansätzen jeweils ein Aliquot von 400 µl entnommen. Die Aliquots wurden für 5 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert, um die CD14-positiven Monozyten zu pelletieren. Nicht assoziierte Bakterien sollten im Überstand verbleiben und mit Absaugen desselbigen nach der Zentrifugation entfernt werden. Anschließend wurden die pelletierten CD14-positiven Monozyten dreimal mit jeweils 500 µl PBS gewaschen. Das Monozyten-Pellet wurde daraufhin in 100 µl 1%-igem [w/v] eiskaltem Saponin lysiert. Zwanzig µl des Lysats wurden in 180 µl eiskaltem PBS geometrisch bis 10-4 oder 10-5 (je nach Assoziationszeit) verdünnt. Von der 10-3und der 10-4-Verdünnung (1 h Assoziation) bzw. von der 10-4- und der 10-5Verdünnung (3 h Assoziation) wurden Triplikate zu jeweils 10 µl auf Schafblutagar 72 Material und Methoden ausplattiert. Die Agarplatte wurde für 24 h bei 37°C inkubiert und der relative Anteil an assoziierten Bakterien konnte nach Auszählen der KBE durch Zurückrechnen auf das Eingangsinokulum kalkuliert werden. Nach einstündiger Inkubationszeitszeit wurde zusätzlich der Anteil an CD14-positiven Monozyten, der mit CFSE-markiertem S. suis assoziiert war, durchflusszytometrisch am FACscan® (BD, Heidelberg) gemessen und mit der winMDI-Software (Version 2.9) ausgewertet. 3.2.4.4 Internalisationsstudien - Daptomycin protection assay (DPA) Die durch Ausplattieren bestimmte Anzahl mit CD14-positiven Monozyten assoziierten Bakterien besagt nicht, ob es sich hierbei um adhärente oder internalisierte Bakterien handelt. Um speziell die Menge an internalisierten Bakterien zu bestimmen, wurde ein antibiotic protection assay durchgeführt. In diesem Assay wurden die extrazellulären Bakterien durch das Antibiotikum Daptomycin abgetötet und die intrazellulären Bakterien nach Lyse der CD14-positiven Monozyten durch Ausplattieren ermittelt. Es wurden der WT und die Kapselmutante 10∆cps des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 und der WT des S. suis Serotyp 9-Stammes A3286/94 hinsichtlich ihrer Internalisation miteinander verglichen. In einem 1,5 ml-Reaktionsgefäß wurden 1 x 106 Monozyten mit 1 x 107 stationär gewachsenen kryokonservierten Bakterien (MOI 1:10) in RPMI-Medium inokuliert. Das Gesamtvolumen der Ansätze betrug jeweils 1 ml. Das Eingangsinokulum zum Zeitpunkt T0 wurde wie in Kapitel 3.2.4.1 beschrieben bestimmt. Die Ansätze wurden rotierend für 3 h bei 37°C inkubiert. Anschließend wurde den Ansätzen jeweils ein Aliquot von 400 µl entnommen, welche für 5 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert wurden, um die CD14-positiven Monozyten zu pelletieren. Die pelletierten CD14positiven Monozyten wurden zweimal mit jeweils 500 µl PBS gewaschen und daraufhin in 500 µl RPMI-Medium mit Daptomycin in einer Finalkonzentration von 31,25 µg/ml, was einer zehnfachen MHK entspricht, resuspendiert. Die Resuspension wurde zum Abtöten der adhärenten, also extrazellulären, Bakterien für weitere 2 h bei 37°C rotierend inkubiert. Die Ansätze wurden daraufhin für 5 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert und dreimal mit jeweils 500 µl PBS gewaschen. Der 73 Material und Methoden Waschüberstand wurde zur Überprüfung darin verbleibender noch vitaler Bakterien auf Schafblutagar ausplattiert. Das Monozyten-Pellet wurde in 100 µl 1%-igem [w/v] eiskaltem Saponin lysiert und wie in Kapitel 3.2.4.3 beschrieben ausplattiert, wobei das Lysat nur bis 10-1 verdünnt wurde. Die 10-1-Verdünnung und die unverdünnten Ansätze wurden in Triplikaten zu jeweils 10 µl auf Schafblutagar ausplattiert. Die Agarplatten wurden bis zu 72 h bei 37°C inkubiert. Der relative Anteil der internalisierten Bakterien wurde nach Auszählen der KBE und Zurückrechnen auf das Eingangsinokulum bestimmt. 3.2.4.5 Doppelimmunfluoreszenz (DIF) Um die durch Ausplattieren ermittelten Assoziations- und Internalisationswerte der Bakterien zu bestätigen und mikroskopisch zu visualisieren, wurde eine DIF durchgeführt. Dazu wurden ebenfalls in einem 1,5 ml-Reaktionsgefäß 1 x 106 Monozyten mit 1 x 107 kryokonservierten Bakterien (S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94) in RPMI-Medium, wobei der Gesamtansatz 1 ml betrug, inokuliert (MOI 1:10). Die Aufbereitung der Proben für die DIF fand nach einer einstündigen KoInkubation (= Assoziation) von Monozyten und Bakterien statt. Dazu wurden die Ansätze nach der Ko-Inkubation für 5 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert und dreimal mit jeweils 500 µl PBS gewaschen. Das Pellet wurde in 200 µl RPMI-Medium resuspendiert. Die darin enthaltene Menge an Monozyten wurde wie in Kapitel 3.2.3.1 beschrieben mit der Neubauer Zählkammer bestimmt. Anschließend wurden 1 x 105 Monozyten mittels Zyto-Spins für 5 min bei 500 x g und 4°C auf einen Objektträger zentrifugiert. Nach der Zentrifugation wurde überschüssiges RPMI-Medium abgesaugt und die Zellen wurden über Nacht mit ca. 100 µl methanolfreiem 3%-igem [v/v] Formaldehyd (Polysciences, Eppelheim) bei 4°C fixiert. Die auf dem Objektträger befindlichen Zellen wurden zweimal für jeweils 5 min mit PBS + 1% FCS gewaschen und anschließend für 20 min mit PBS + 5% FCS bei RT geblockt. Zunächst wurden die Zellen für 45 min mit dem gegen S. suis gerichteten Primärantikörper rabbit anti-S. suis, der 1:100 in PBS + 1% FCS verdünnt wurde, bei RT inkubiert (rabbit anti-S. suis K62 gegen den Serotyp 2-Stamm 10 und rabbit anti-Serotyp 9 gegen den Serotyp 9-Stamm A3286/94). Die Zellen wurden 74 Material und Methoden erneut dreimal für jeweils 5 min mit PBS + 1% FCS gewaschen. Anschließend erfolgte für die Markierung der extrazellulären Bakterien eine 30-minütige Inkubation (RT) mit dem Alexa Fluor 568-konjugiertem Sekundärantikörper goat anti-rabbit, der gegen den Primärantikörper gerichtet ist. Ab diesem Schritt wurden die Zellen mit Aluminiumfolie vor Lichteinwirkung geschützt. Die Zellen wurden wiederum dreimal für jeweils 5 min mit PBS + 1% FCS gewaschen. Nun folgte die Permeabilisierung der Zellen, um auch intrazelluläre Bakterien darstellen zu können. Dazu wurde der Objektträger mit den Zellen in auf -20°C vorgekültes 100%-iges [v/v] Aceton gelegt und für 8 min bei -20°C inkubiert. Anschließend wurde das Aceton entfernt und der Objektträger trocknen gelassen. Dann erfolgte ein weiter Inkubationsschritt mit dem Primärantikörper (siehe oben). Die Zellen wurden daraufhin wieder dreimal für jeweils 5 min mit PBS + 1% FCS gewaschen. Die Markierung der intrazellulären Bakterien erfolgte durch eine 30-minütige Inkubation (RT) mit dem Alexa Fluor 488 konjugiertem Sekundärantikörper goat anti-rabbit, der ebenfalls gegen den Primärantikörper gerichtet ist. Die Zellen wurden erneut dreimal für jeweils 5 min mit PBS + 1% FCS gewaschen. Nachdem der Überstand gut abgesaugt wurde, wurden die Zellen zur Darstellung der Monozytenkerne mit Prolong Gold® mit DAPI eingedeckt. Das Eindeckmittel polymerisierte für mindestens 24 h bei RT. Die Präparate wurden mit dem Fluoreszenzmikroskop Nikon Eclipse Ti-S (Nikon, Düsseldorf) untersucht. Die Auswertung erfolgte mit der NIS Elements software BR 3.2. 3.2.4.6 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) Diese Methode wurde in dieser Arbeit angewandt, um einerseits durch eine Visualisierung einen Beweis für eine eventuelle S. suis-Internalisation durch porzine CD14-positiven Monozyten zu erhalten, und um andererseits die eventuelle Veränderung der Kapseldicke vom S. suis Serotyp 2-Stamm 10 und S. suis Serotyp 9-Stamm A3286/94 während verschiedener Wachstumsphasen zu untersuchen. Um die Präparate für TEM-Aufnahmen aufzubereiten, wurde eine Fixierung mit Lysin und Ruthenium Rot durchgeführt. Diese Fixierung wird u. a. angewandt, um die Kapseln von Bakterien anzufärben bzw. sichtbar zu machen. Aber auch andere 75 Material und Methoden Zellstrukturen, wie z. B. von eukaryotischen Zellen, können sichtbar gemacht werden. Anschließend können von den fixierten Proben Ultradünnschnitte hergestellt werden, von denen anschließend TEM-Aufnahmen gemacht werden können. Die finale Aufbereitung der Proben für die TEM-Aufnahmen und die TEM-Aufnahmen selbst wurden von Manfred Rohde am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig durchgeführt. Alle Fixierungsschritte erfolgten auf Eis (wenn nicht anders beschrieben). Zur Beurteilung der S. suis-Internalisation wurden 6 x 106 porzine Monozyten mit 6 x 107 KBE von stationär gewachsenen kryokonservierten Bakterien in RPMI-Medium unter Zusatz von 20% CDS (Gesamtansatz 1 ml) rotierend für 2 h bei 37°C koinkubiert. Anschließend wurden die Ansätze für 10 min bei 500 x g und 4°C zentrifugiert und einmal mit 500 µl PBS gewaschen. Das Pellet wurde wie unten beschrieben für die Fixierung weiterverarbeitet. Zur Beurteilung der Kapseldicke wurden ÜNK von Bakterien in frischem THBMedium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und insgesamt für 24 h inkubiert. In der frühen exponentiellen Wachstumsphase, in der stationären Wachstumsphase und nach 24 h wurden 50 ml der entsprechenden Kultur für 10 min bei 1300 x g und 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und das Pellet wie folgt beschrieben für die Fixierung weiterverarbeitet. Alle Zentrifugationsschritte erfolgten für 10 min bei 1300 x g und 4°C. Die Pellets wurden in 2 ml Fixierlösung I resuspendiert, in ein 2 ml-Reaktionsgefäß überführt und für 20 min inkubiert. Nach einem Zentrifugationsschritt wurden die Pellets zweimal mit jeweils 1,5 ml Waschlösung gewaschen und erneut zentrifugiert. Daraufhin wurden die Pellets in 2 ml Fixierlösung II resuspendiert und über Nacht bei 4°C inkubiert. Die Pellets wurden dreimal mit jeweils 1,5 ml Waschlösung gewaschen, nach der ersten Waschung in ein 1,5 ml-Reaktionsgefäß überführt und wiederum zentrifugiert. Die Pellets wurden in Fixierlösung III resuspendiert, für 1 h bei RT inkubiert und zentrifugiert. Anschließend wurden die Pellets in 1,5 ml Cacodylat-Puffer (ohne Ruthenium Rot) resuspendiert. Die fixierten Proben wurden daraufhin zur Weiterverarbeitung an Manfred Rohde ins HZI (Braunschweig) geschickt. Hier wurden die Pellets nach einer erneuten Zentrifugation mit dem 76 Material und Methoden gleichen Volumen 1,75%-igem Noble Agar (angesetzt in A. bidest; Difco, Heidelberg) gemischt. Nach Erstarren des Agars wurden die Proben in einer aufsteigenden Ethanolreihe (10%, 30%, 50%, 70%, 90% und zweimal 100%) dehydriert, wobei jeder Schritt 15 min dauerte. Daraufhin wurden die Proben für 24 h zunächst mit einer 1:1-Mischung von 100%-igem Ethanol und LR White resin (London resin company, Reading, England) und anschließend für 2 Tage mit reinem LR White resin infiltriert. Anschließend wurden mit einem Diamantmesser Ultradünnschnitte hergestellt, die für 1 min mit wässrigem Uranylacetat (Science Services, München) gegengefärbt wurden. Die Ultradünnschnitte wurden in einem TEM 910 Transmissionselektronenmikroskop (Zeiss, Jena) untersucht. Die TEM-Bilder wurden digital mit einer Slow-Scan Kamera (ProScan) aufgenommen und mit der ITEMSoftware 5.0 ausgewertet (Olympus Soft Imaging Solutions). Zusammensetzung der verwendeten Lösungen: Waschlösung: 0,2 M Cacodylatpuffer + 0,15% [w/v] Ruthenium Rot Verdünnung 1 + 1 mit A. bidest Fixierlösung I: 0,2 M Cacodylatpuffer + 0,15% [w/v] Ruthenium Rot + 2% [w/v] Paraformaldehyd + 2,5% [v/v] Glutardialdehyd + 75 mM [w/v] L-Lysinacetat Fixierlösung II: 0,2 M Cacodylatpuffer + 0,15% [w/v] Ruthenium Rot + 2% [w/v] Paraformaldehyd + 2,5% [v/v] Glutardialdehyd Fixierlösung III: 4 Teile Waschlösung + 1 Teil 5%-ige [w/v] Osmiumtetroxidlösung (angesetzt in A. bidest) 77 Material und Methoden 3.2.4.7 Bestimmung der ROS-Produktion Als Reaktion auf einen Stimulus, wie z. B. Stress, kann es bei Zellen durch die Produktion von reaktiven Sauerstoff-Spezies (engl.: reactive oxygen species; ROS) zu einem oxidative burst kommen. Bei phagozytierenden Zellen kann dies auch ein Hinweis auf Phagozytoseaktivität sein (Hassett und Cohen, 1989). Die ROS-Bildung kann durchflusszytometrisch durch die Verwendung spezifischer fluoreszierender Farbstoffe dargestellt werden. Kommt es zur ROS-Bildung, wird durch die Anwesenheit des Superoxids der Farbstoff Dihydrorhodamin (DHR) 123 zu Rhodamin 123 oxidiert, welcher eine grüne Fluoreszenz aufweist. Es sollte die generelle Fähigkeit zur ROS-Produktion von CD14-positiven Monozyten überprüft werden. Zusätzlich wurde die ROS-Produktion der MNCs, die als Negativkontrolle dienten, ermittelt. Die MNCs, die nach der Gewinnung der Interphase bereits in RPMI-Medium resuspendiert waren, konnten nach Bestimmung der Zellzahl mit der Neubauer-Zählkammer direkt eingesetzt werden. Die eluierten CD14-positiven Monozyten wurden für 10 min bei 250 x g und 4°C zentrifugiert und in 1 ml RPMI-Medium resuspendiert. Die Zellzahl wurde wie in Kapitel 3.2.3.1 beschrieben mit der Neubauer-Zählkammer bestimmt. In eine 96-well-RundbodenMikrotiterplatte wurden von jeder Zellpopulation drei Ansätze zu jeweils 2 x 105 Zellen pro Vertiefung ausgesät. Das Volumen jeder Vertiefung wurde auf 100 µl mit RPMI-Medium angeglichen. Ein Ansatz jeder Zellpopulation wurde mit S. suisStamm 10 (WT) und ein weiterer Ansatz mit der Kapselmutante 10∆cps mit einer MOI von jeweils 1:10 stimuliert. Der dritte Ansatz wurde nicht mit Bakterien stimuliert. Nachdem die Platte kurz geschüttelt wurde, wurde sie für 20 min bei 37°C inkubiert. Anschließend erfolgte die Zugabe des Farbstoffes DHR 123 zu den Ansätzen. Der Farbstoff wurde in einer Finalkonzentration von 1,4 µg/ml eingesetzt (10 µl der 15 µg/ml-Stocklösung). Die Platte wurde erneut kurz geschüttelt und für weitere 10 min bei 37°C inkubiert. Daraufhin wurde in die Vertiefung jeden Ansatzes 100 µl RPMIMedium pipettiert und die Zellen wurden für 3 min bei 300 x g und RT auf den Boden der Vertiefungen zentrifugiert. Der Überstand wurde einmalig kurz abgeschüttelt und in jede Vertiefung wurden 50 µl RPMI-Medium und 50 µl Sheath-PJ (Finalkonzentration des PJ 2 µg/ml) pipettiert. Die Platte wurde für 10 min 78 Material und Methoden abgedunkelt auf Eis inkubiert. Anschließend wurden die Zellen jeden Ansatzes in der Vertiefung resuspendiert und in ein 1,5 ml-Reaktionsgefäß überführt. Die Morphologie, Vitalität und die ROS-Produktion der Zellen wurden mittels des Durchflusszytometers BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) untersucht und mit der BD accuri™ C6 Software ausgewertet. 3.2.5 Proteinbiochemische Methoden 3.2.5.1 Gewinnung von Überständen infizierter porziner CD14-positiver Monozyten Es sollte untersucht werden, ob durch die Ko-Inkubation von porzinen CD14positiven Monozyten und S. suis ein Einfluss von den Bakterien auf die Monozyten ausgeht, was eventuell zu einer Schädigung der Monozyten führen könnte. Ein Hinweis auf einen schädigenden Einfluss auf die Monozyten könnte die Produktion des Proteins Suilysin sein. Suilysin ist ein von S. suis sezerniertes Exotoxin, das durch seine zytolytische Aktivität Wirtszellen schädigen kann (Benga et al., 2004; Charland et al., 2000; Jacobs et al., 1994; Lalonde et al., 2000; Norton et al., 1999; Segura und Gottschalk, 2002; Tenenbaum et al., 2005; Tenenbaum et al., 2006; Vanier et al., 2004). Deshalb wurde die Menge an sezerniertem Suilysin des WT, der Kapselmutante 10∆cps, der Suilysinmutante 10∆sly des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 und des WT des Serotyp 9-Stammes A3286/94 bestimmt. Dazu wurden in 1,5 ml-Reaktionsgefäßen 1 x 106 Monozyten mit 1 x 107 KBE von S. suis in RPMI-Medium rotierend für 3 h bei 37°C inkubiert. Die Menge des Gesamtansatzes betrug 1 ml. Nach der Inkubation der Monozyten mit den Bakterien wurden die Ansätze für 10 min bei 8600 x g und 4°C zentrifugiert. Von den Überständen wurden 500 µl abgenommen und bis zur weiteren Verwendung bei -80°C gelagert. Der Überstand wurde hinsichtlich der Menge an Suilysin nach Auftrennung der Proteine in der SDS-PAGE mittels Immunoblot analysiert. 79 Material und Methoden 3.2.5.2 Bestimmung der Proteinkonzentration Um in den folgenden Versuchen (SDS-PAGE, Immunoblot) für alle Proben die gleiche Proteinmenge einzusetzen, musste die Proteinkonzentration in den einzelnen Proben bestimmt werden. Dies erfolgte durch die BCA-Methode mittels des Bio-RadDC-Protein-Assays (Bio-Rad, München) nach Herstellerangaben. Der entstandene Farbkomplex wurde photometrisch bei einer Wellenlänge von 550 nm im Plattenlesegerät GENios Pro (Tecan, Crailsheim) gemessen. In der nachfolgenden SDS-PAGE wurden von jeder Probe jeweils 19 µg Protein eingesetzt. 3.2.5.3 Sodium dodecyl sulphate-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) Um gezielt das Suilysin aus den gewonnenen Überstanden infizierter CD14-positiver Monozyten nachweisen zu können, wurden die Proteine zunächst nach ihrem Molekulargewicht in einem elektrischen Feld aufgetrennt. Die Auftrennung erfolgte unter denaturierenden Bedingungen in einem Polyacryamidgel bestehend aus einem 5%-igen [v/v] Sammelgel und einem 10%-igem [v/v] Trenngel. Es wurden jeweils 37,5 µl Probe mit 12,5 µl 4 x Roti Load gemischt und für 10 min bei 95°C gekocht. Von den behandelten Proben wurden 35 µl auf das Gel aufgetragen. Der Einlauf in das Sammelgel erfolgte für 30 min bei 100 Volt (V), die Auftrennung im Trenngel für etwa 3 h bei 150 V in 1 x SDS-PAGE-Laufpuffer in einer Gelelektrophoreselaufkammer. Die Spannung lieferte das Power Pac 200 (Bio-Rad, München). Als Größenstandard diente der Proteinmarker PageRuler™ Prestained Protein Ladder #26619 (Fermentas, St. Leon-Rot). Zusammensetzung des verwendeten Puffers und der Gele: 10 x SDS-PAGE-Laufpuffer: A. bidest + 0,25 mM [w/v] Tris + 1,9 mM [w/v] Glycin + 1% [w/v] SDS Verdünnung auf 1 x mit A. bidest 80 Material und Methoden 5%-iges Sammelgel: A. bidest + 5% [v/v] Acrylamid + 130 mM [w/v] Tris-HCl (pH 6,8) + 0,1% [w/v] SDS + 0,2% [v/v] TEMED + 0,12% [w/v] Ammoniumpersulfat (APS) 10%-iges Trenngel: A. bidest + 10% [v/v] Acrylamid + 380 mM [w/v] Tris-HCl (pH 8,8) + 0,08% [w/v] SDS + 0,2% [v/v] TEMED + 0,12% [w/v] APS 3.2.5.4 Immunoblot Die elektrophoretisch aufgetrennten Proteine wurden mittels eines Elektrotransfers auf eine Polyvinyliden Fluorid- (PVDF-) Membran (Millipore, Darmstadt) übertragen, wozu das halbtrockene Westernblot Verfahren angewandt wurde. Hierfür wurde zunächst die PVDF-Membran für 1 min in Methanol aktiviert, in A. bidest gewaschen und für 10 min in Transferpuffer äquilibriert. Das Polyacrylamidgel mit den aufgetrennten Proteinen und 4 Whatman® Filterpapiere (3 mm; Hartenstein, Würzburg) wurden ebenfalls für 10 min in Transferpuffer äquilibriert. Anschließend wurden die einzelnen Komponenten wie folgt luftblasenfrei in die WesternblotApparatur geschichtet: 2 x Filterpapier, PVDF-Membran, Gel, 2 x Filterpapier. Der Transfer der Proteine erfolgte für 70 min bei 15 V mittels des Trans-Blot® SD SemiDry Transfer Cell Systems (Bio-Rad, München). Der gezielte Nachweis des Suilysins nach dem Transfer der aufgetrennten Gesamtproteine auf die PVDF-Membran erfolgte durch die Verwendung eines polyklonalen rabbit anti-Suilysin-Antikörpers. Zunächst wurden die unspezifischen Antikörper-Bindungsstellen durch Inkubation der Membran über Nacht in 1 x TBST (engl.: tris-buffered saline Tween 20) mit 5% [w/v] Milchpulver (Sucofin, Edeka, Hannover) und 0,02% [v/v] Natriumazid geblockt. Die Membran wurde zweimal mit A. 81 Material und Methoden bidest und einmal mit 1 x TBST gespült. Dann wurde die Membran mit 8 ml des polyklonalen Primärantikörpers rabbit anti-Suilysin, der gegen das Suilysin gerichtet ist, für 1 h bei RT inkubiert. Der Primärantikörper wurde dazu 1:1300 in 1 x TBST mit 1% [w/v] Milchpulver angesetzt. Anschließend wurde die Membran viermal für jeweils 5 min mit 1 x TBST schüttelnd bei 200 UpM gewaschen (Schütteltisch). Daraufhin erfolgte die Inkubation mit dem 1:10-vorverdünnten Sekundärantikörper goat antirabbit-AP für 1 h bei RT (8 ml). Der Sekundärantikörper ist gegen den Primärantikörper gerichtet und mit der alkalischen Phosphatase (AP), einem Enzym, konjugiert. Der Sekundärantikörper wurde vor Gebrauch auf 1:10000 in 1 x TBST mit 5% [w/v] Milchpulver weiterverdünnt. Nach der Inkubation wurde die Membran erneut viermal für jeweils 5 min mit 1 x TBST schüttelnd bei 200 UpM gewaschen. Anschließend wurde die Membran für 4 min mit 800 µl des Substrats AP Juice (p.j.k., Kleinbittersdorf) inkubiert. Dazu wurde die Membran auf eine Folie gelegt und mit dem Substrat beträufelt. Eine zweite Folie wurde luftblasenfrei auf die Membran gelegt, so dass es zur gleichmäßigen Verteilung des Substrats auf der Membran kam. Die AP, die mit dem Sekundärantikörper konjugiert ist, setzt das Substrat APJuice enzymatisch um, wobei es zu einer Chemielumineszenzreaktion kommt. Nach der Inkubation mit dem Substrat wurde die Membran zwischen zwei Whatman®Filterpapieren getrocknet. Die Detektion der Signale erfolgte daraufhin mittels einer Chemielumineszenzmessung durch den Chemo Cam Imager 3.2 (Intas, Göttingen) und die Auswertung mit der Chemostar Aufnahmesoftware. Zusammensetzung der verwendeten Pufferr: Transferpuffer: 25 mM Tris-HCl (pH 7,5) + 192 mM Glycin + 10% [v/v] Methanol 10 x TBST (autoklaviert): 0,1 mM Tris-HCl (pH 7,5) + 1,5 mM NaCl + 0,5% [v/v] Tween 20 Verdünnung auf 1 x mit A. bidest 82 Material und Methoden Zur statistischen Auswertung wurden der t-Test (normalverteilte Werte) bzw. der Mann-Whitney-U-Test (nicht normalverteile Werte) angewendet. 83 Ergebnisse 4 Ergebnisse In dieser Arbeit wurde die wachstumsphasenabhängige Ausprägung von Merkmalen in Hinblick auf die Persisterbildung und die Wechselwirkung mit porzinen Monozyten von S. suis untersucht. Es ist bekannt, dass die Wachstumsphase von Bakterien einen Einfluss auf deren Metabolismus und Virulenz hat. S. suis generiert während des frühen Wachstums in einer statischen Kultur die Energie mittels klassischer Stoffwechselwege durch Umsetzung primärer Zucker, vornehmlich Glukose. Mit voranschreitendem bakteriellen Wachstum und dem zunehmenden Verbrauch von Glukose kommt es zur Aufhebung der Repression des ADS, so dass das ADS S. suis als alternativer Stoffwechselweg zur Verfügung steht. Das ADS ermöglicht S. suis unter Nährstoffund Sauerstofflimitierung und unter sauren Bedingungen zu überleben und gilt als Virulenz-assoziierter Faktor (Gruening et al., 2006). Der metabolische Zustand von S. suis in der exponentiellen Wachstumsphase unterscheidet sich demnach sehr von dem in der stationären Wachstumsphase. Des Weiteren wurde für S. suis eine wachstumsphasenabhängige Regulation der Virulenz-assoziierten Faktoren arcB, sly, sao, ofs und cps2A beschrieben (Willenborg et al., 2011). Für S. pneumoniae wurde ebenso eine nährstoff- und milieuabhängige Regulation der Kapselexpression während der Infektion des Wirts festgestellt (Kadioglu et al., 2008). Kreikemeyer et al. (2003) beschrieben für S. pyogenes eine wachstumsphasenabhängige Expression von Adhäsinen, was es dem Erreger ermöglicht, während des Infektionsgeschehen die Intensität der Adhärenz und Kolonisation zu regulieren und sich den Bedingungen im Wirt anzupassen. Bei bakteriellen Persistern handelt es sich um eine antibiotikatolerante Subpopulation innerhalb einer Bakterienkultur, und es ist bekannt, dass es während des bakteriellen Wachstums zu einer Zunahme des Anteils der Persisterzellen gemessen an der Gesamtpopulation kommt (Lewis, 2007). Der Einfluss der Wachstumsphase auf die Fähigkeit zur Bildung von Persistern und der Assoziation mit porzinen Monozyten von S. suis wurde in dieser Arbeit durch den Vergleich von exponentiell und stationär gewachsenen Bakterien ermittelt. 84 Ergebnisse 4.1 Wachstumskinetiken verschiedener Streptokokken-Spezies Während des Wachstums von Bakterien kommt es zu Veränderungen der Genexpression und des Metabolismus. Für Bakterien in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase werden somit unterschiedliche Zustände erwartet. Um die unterschiedlichen Streptokokken-Spezies und S. suis-Stämme zu diesen Zeitpunkten miteinander vergleichen zu können, wurden zunächst Wachstumskinetiken ermittelt. Es wurden Wachstumskinetiken des WT von S. suis Serotyp 2-Stamm 10 und von den von Stamm 10 abgeleiteten isogenen Mutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD erstellt. Bei diesen Mutanten waren bereits in vorhergehenden Studien bestimmte Gene ausgeschaltet worden, die regulierend auf den Stoffwechsel oder auf andere Stoffwechselgene wirken. Da das Ausschalten bestimmter für den Stoffwechsel wichtiger Gene einen Einfluss auf das Wachstumsverhalten haben kann, wurde für jede untersuchte Mutante eine Wachstumskurve erstellt. Des Weiteren wurden neben dem Serotyp 2-Stamm 10 von S. suis auch der weniger virulente Serotyp 9-Stamm A3286/94 und der Seroytp 2-Stamm 05ZYH33, ein Humanisolat, getestet. Außerdem wurden von den (fakultativ) humanpathogenen Streptokokken-Spezies S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 Wachstumskinetiken ermittelt. Zusätzlich wurde L. lactisStamm MG1363 als apathogener Vertreter der Streptococcaceae wachstumskinetisch untersucht. Für die Erstellung der Wachstumskurven wurden wie in Kapitel 3.2.1.2 beschrieben Bakterienkulturen in THB-Medium angeimpft und die OD600 jedes Stammes wurde stündlich photometrisch bestimmt. In Abbildung 1A sind die Wachstumskurven von S. suis-Stamm 10, von den isogenen S. suis-Stamm 10 Mutanten, von Stamm A3286/94 und von Stamm 05ZYH33 dargestellt. Die Wachstumskinetiken von Stamm 10, der Mutanten 10∆flpS und 10∆arcD und der Stämme A3286/94 und 05HZY33 zeigen über die Zeit einen ähnlichen Verlauf. Stamm 10, die Mutanten 10∆flpS und 10∆arcD und Stamm A3286/94 befinden sich nach einer kurzen lag-Phase nach etwa 2 h in der exponentiellen Phase, Stamm 05HZY33 etwas später (OD600 0,2 bis 0,3). Für diese 85 Ergebnisse Stämme und Mutanten war ein steiler Anstieg der Wachstumskurve zu verzeichnen und nach 3 bis 4 h war die stationäre Wachstumsphase bei einer OD600 von etwa 1,2 bis 1,4 erreicht. Das Wachstum der Mutante 10∆ccpA war dagegen etwas verzögert. Der Übergang von der lag-Phase in die exponentielle Phase erfolgte nach 2 bis 3 h und die Wachstumskurve verlief während der exponentiellen Wachstumsphase nicht so steil wie bei den bereits beschriebenen Stämmen und Mutanten. Auch die stationäre Wachstumsphase wurde erst nach 7 bis 8 h erreicht. Allerdings war die OD600 in der stationären Wachstumsphase mit etwa 1,3 mit den bereits beschriebenen Stämmen und Mutanten vergleichbar. Die Mutante 10∆AD zeigte ein noch verzögerteres Wachstum. Ein Übergang zwischen der lag-Phase und der exponentiellen Phase war kaum feststellbar und es war kein typisches exponentielles Wachstum zu verzeichnen. Es kam vielmehr zu einem gleichmäßigen Bakterienwachstum über die Zeit bis die stationäre Wachstumsphase erreicht war. Der Eintritt in die stationäre Wachstumsphase erfolgte erst nach 8 bis 9 h bei einer OD600 von etwa 1,0. Auffällig war der deutliche Abfall der OD600, also ein deutliches Überwiegen von sterbenden im Vergleich zu sich teilenden Bakterien, bei Stamm 10 nach 24 h. Für die Mutante 10∆ccpA und Stamm 05ZYH33 war nach 24 ein leichter Abfall der OD600 festzustellen. Die Mutanten 10∆flpS, 10∆arcD, 10∆AD und der Stamm A3286/94 waren dagegen in der Lage, sich nach 24 h erneut zu vermehren oder zumindest das Gleichgewicht von Absterben und Vermehrung, also die stationäre Wachstumsphase, aufrecht zu erhalten. Abbildung 1B zeigt die Wachstumskurven von S. suis-Stamm 10, S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40, S. agalactiae-Stamm 6313 und L. lactis-Stamm MG1363. S. agalactiae und L. lactis erreichen wie S. suis nach einer etwa zweistündigen lag-Phase die exponentielle Wachstumsphase. S. gordonii hat eine etwas längere lag-Phase und erreicht die exponentielle Wachstumsphase nach 2 bis 3 h. Bei S. suis, S. gordonii, S. agalactiae und L. lactis kam es während des exponentiellen Wachstums zu einem steilen Anstieg der Wachstumskurve, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. 86 Ergebnisse A B Abbildung 1: Wachstumskinetiken ausgewählter S. suis-Stämme und isogener Mutanten (A) sowie weiterer Streptokokken-Spezies (B) in THB-Medium. Flüssige Übernachtkulturen (ÜNK) der gezeigten Bakterienstämme wurden in 50 ml THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und bei 37°C stehend bebrütet. Der bakterielle Wachstumsverlauf wurde stündlich durch Messung der OD600 photometrisch bestimmt. Für alle nachfolgenden Versuche wurden die Kulturen in der exponentiellen Wachstumsphase (grüne Symbole) und in der stationären Wachstumsphase (rote Symbole) geerntet. Gezeigt ist jeweils ein repräsentatives Wachstumsexperiment. A: Wachstumskinetik von S. suis-Stamm 10 (Serotyp 2), den isogenen Mutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD, S. suis-Stamm A3286/94 (Serotyp 9) und S. suis-Stamm 05ZYH33 (Serotyp 2). B: Wachstumskinetik ausgewählter Vertreter der Familie Streptococcaceae: S. suis-Stamm 10, S. gordoniiStamm 30, S. pyogenes-Stamm A40, S. agalactiae-Stamm 6313 und L. lactis-Stamm MG1363. 87 Ergebnisse Die vier Spezies erreichten etwa nach 5 bis 6 h die stationäre Wachstumsphase, wobei die maximale OD600 der einzelnen Spezies variierte. Bei S. agalactiae kam es nach 5 bis 6 h allerdings immer noch zu einer leichten stetigen Vermehrung, die bis nach 10 h feststellbar war. S. pyogenes zeigte ein verzögerteres Wachstum. Ein Übergang von der lag-Phase in die exponentielle Phase war nicht eindeutig abzugrenzen und es fand auch kein typisches exponentielles Wachstum statt. Der Eintritt in die stationäre Wachstumsphase verlief ebenfalls langsamer im Vergleich zu den anderen Spezies. Nach 24 h war für alle Spezies bis auf S. pyogenes ein Abfall der OD600 feststellbar. Für weitere Versuche wurden die Bakterien während der exponentiellen Wachstumphase (grüne Symbole) und der stationären Wachstumsphase (rote Symbole) geerntet. 4.2 Wachstumsphasenabhängige Persisterbildung von S. suis Ein typisches Merkmal für die Präsenz von Persisterzellen in einer Bakterienpopulation ist eine biphasische Überlebenskinetik. Die biphasische Überlebenskinetik ist dadurch gekennzeichnet, dass es nach Beginn der Antibiotikabehandlung zu einem schnellen Abtöten des Großteils der Bakterienzellen kommt, während ein kleiner Teil der Bakterienpopulation über einen längeren Zeitraum bei fortwährender Antibiotikabehandlung nur langsam bis gar nicht abgetötet werden kann, so dass eine erstellte Kurve der Überlebenskinetik ein Plateau ausbildet- hierbei handelt es sich um die Persisterzellen. Außerdem ist für die Bildung von Persistern typisch, dass es während des bakteriellen Wachstums innerhalb einer Kultur zu einer Zunahme des Anteils der Persisterzellen gemessen an der Gesamtpopulation kommt, weshalb eine Kultur in der exponentiellen Wachstumphase weniger Persisterzellen als eine Kultur in der stationären Wachstumsphase aufweist (Lewis, 2007). Für S. suis lagen zu Beginn dieser Arbeit keine publizierten Daten vor. In dieser Arbeit wurde dieses wichtige Phänomen für S. suis untersucht. Da der Anstieg an antibiotikatoleranten Zellen im Zuge des bakteriellen Wachstums ein typisches Merkmal der Persisterbildung ist, wurde die 88 Ergebnisse Persisterbildung sowohl für die exponentielle als auch für die stationäre Wachstumsphase von S. suis untersucht. Dies sollte einen Hinweis darauf liefern, ob S. suis Persister bildet. Innerhalb der Spezies S. suis wurden die Stämme 10, A3286/94 und 05ZYH33 hinsichtlich der Fähigkeit zur Persisterbildung verglichen. Außerdem wurden S. gordonii, S. pyogenes und S. agalactiae als weitere Spezies innerhalb der Gattung Streptococcus in die Untersuchungen einbezogen. 4.2.1 MHK-Bestimmung Da ein Merkmal der Persisterbildung die Toleranz gegenüber das Vielfache der MHK eines Antibiotikums ist, musste zunächst die MHK der eingesetzten Antibiotika für die untersuchten S. suis-Stämme und Streptokokken-Spezies bestimmt werden. Dazu wurde in einer 96-well-Mikrotiterplatte die zu testenden Antibiotika ausgehend von einer Stocklösung geometrisch verdünnt und mit kryokonservierten Bakterien inokuliert. Die Platte wurde für 24 h bei 37°C inkubiert und die niedrigste Antibiotikum-Konzentration, die die Vermehrung der Bakterien sichtbar hemmte, wurde als MHK-Wert festgelegt. Für S. suis wurden die MHK-Werte sowohl für die exponentielle als auch für die stationäre Wachstumsphase von Gentamicin, Penicillin G, Amoxicillin, Ciprofloxacin, Rifampicin, Daptomycin und Erythromycin bestimmt. Gentamicin gehört zur Gruppe der Aminoglykoside und hemmt die Proteinbiosynthese. Penicillin G und Amoxicillin sind β-Laktam-Antibiotika. Sie inhibieren die Zellwandsynthese und führen zur osmotischen Lyse der Bakterienzellen. Ciprofloxacin gehört zu den Fluorochinolonen und inhibiert die DNAReplikation und die Zellteilung. Rifampicin gehört zu den Antibiotika der RifamycinGruppe und hemmt die Transkription. Daptomycin ist ein zyklisches Lipopeptid. Es depolarisiert das Membranpotential und inhibiert die Protein-, DNA- und RNASynthese. Erythromycin gehört zu den Makrolid-Antibiotika und hemmt die Proteinsynthese. Die bestimmten MHKs sind in Tabelle 4 abzulesen. Es wurde kein Unterschied in den MHK-Werten für die exponentielle und stationäre Wachstumsphase von S. suisStamm 10 festgestellt. 89 Ergebnisse Tabelle 4: Bestimmung der MHK ausgewählter Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen für S. suis- Stamm 10 Für die Bestimmung der MHK wurden die Antibiotika ausgehend von einer Stocklösung in einer Mikrotiterplatte geometrisch verdünnt und mit exponentiell und stationär gewachsenen kryokonservierten Bakterien inokuliert. Nach 24-stündiger Bebrütung bei 37°C wurde die niedrigste Antibiotikum-Konzentration, die die Vermehrung der Bakterien sichtbar hemmte, als MHK-Wert festgelegt. Dargestellt sind die Werte einer repräsentativen MHKBestimmung. MHK [µg/ml] Antibiotikum exp stat Gentamicin 25,000 25,000 Penicillin G 0,049 0,049 Amoxicillin 6,250 6,250 Ciprofloxacin 1,563 1,563 Rifampicin 3,125 3,125 Daptomycin 3,125 3,125 Erythromycin 1,563 1,563 Die MHK von Gentamicin wurde außerdem für die anderen S. suis-Stämme und Streptokokken-Spezies bestimmt. Sie betrug für S. suis Stamm A3286/94 ebenso 25 µg/ml, für S. suis Stamm 05ZYH33 50 µg/ml, für S. gordonii 3,125 µg/ml, für S. pyogenes 6,25 µg/ml und für S. agalactiae 25 µg/ml. Des Weiteren wurde die MHK von Ciprofloxacin für die anderen Streptokokken-Spezies bestimmt. Sie betrug für S. gordonii und für S. pyogenes jeweils 1,563 µg/ml und für S. agalactiae 6,25 µg/ml. 4.2.2 Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis gegenüber Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen Um aufzuklären, ob S. suis grundsätzlich in der Lage ist, antibiotikatolerante Persisterzellen zu bilden, und ob dessen Entstehung womöglich einer Wachstumsphasenabhängigkeit unterliegt, wurden der S. suis-Stamm 10 hinsichtlich seiner Toleranz gegenüber mehreren Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen getestet. Dazu wurden kryokonservierte Bakterien mit der 100-fachen MHK der in Kapitel 4.2.1 erwähnten Antibiotika (außer Erythromycin) für insgesamt 24 h inkubiert. Nach 1, 2, 4, 6, 8 und 24 h wurde die Anzahl der überlebenden und kultivierbaren Bakterien durch Ausplattieren bestimmt. 90 Ergebnisse Abbildung 2A zeigt die Überlebenskinetik von S. suis-Stamm 10 aus der exponentiellen unterschiedlicher Wachstumsphase gegenüber Wirkstoffklassen. Die ausgewählten Bakterien Antibiotika wiesen unter Gentamicinbehandlung eine typische biphasische Überlebenskinetik auf. In der ersten Stunde kam es zu einer rapiden Verringerung der Bakterienanzahl um vier log-Stufen. In den darauffolgenden Stunden wurden die überlebenden Bakterien langsam um eine bis eineinhalb weitere log-Stufen abgetötet bis sie nach 24 h nicht mehr zuverlässig detektierbar waren. Die biphasische Überlebenskinetik war für die Antibiotika Penicillin G, Amoxicillin und Ciprofloxacin kaum ausgeprägt. Stattdessen wurden die Bakterien über einen Zeitraum von 8 h Antibiotikabehandlung gleichmäßig um etwa zwei bis drei log-Stufen abgetötet. Die Überlebenskinetik der Bakterien war unter Anwendung dieser drei Antibiotika vergleichbar, wobei die Bakterien durch Ciprofloxacin etwas stärker abgetötet wurden als durch die βLaktam-Antibiotika Penicillin G und Amoxicillin. Nach 24 h waren noch lebende Bakterien unter Penicillin G- und Amoxicillinbehandlung nachweisbar, während unter Ciprofloxacinbehandlung nach 24 h lebende Bakterien nicht mehr nachzuweisen waren. Durch Rifampicin wurden die Bakterien kaum abgetötet. Nach 8 h wurde die Anzahl lebender Bakterien nur um etwa eine halbe log-Stufe verringert und nach 24 h kam es nur zu einer Verringerung von etwa zwei log-Stufen. Dagegen wurden die Bakterien durch Daptomycin bereits nach 1 bis 2 h komplett abgetötet. Ein Kontrollansatz ohne Antibiotikumzusatz zeigte, dass die Bakterien in der Lage waren, sich weiter zu vermehren. Es kam zu einem Anstieg der Bakterienanzahl um mehr als eine log-Stufe über einen achtstündigen Inkubationszeitraum. In Abbildung 2B ist die Überlebenskinetik für die stationäre Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10 dargestellt. Die unter Gentamicinbehandlung typische biphasische Überlebenskinetik von Bakterien, die sich ursprünglich in der exponentiellen Wachstumsphase befanden, war für Bakterien aus der stationären Wachstumsphase fast komplett aufgehoben. Über einen Zeitraum von 24 h kam es zu einer gleichmäßigen Abnahme der Anzahl der lebenden Bakterien um insgesamt zwei logStufen. Das Überleben von Bakterien aus der stationären Wachstumsphase zeigte 91 Ergebnisse unter Penicillin G-, Amoxicillin- und Ciprofloxacinbehandlung eine ähnliche Kinetik wie Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase. A B Abbildung 2: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber der 100-fachen MHK verschiedener Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen über die Zeit. 7 Kryokonservate von S. suis-Stamm 10 (1x10 KBE) wurden mit der 100-fachen MHK von Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen in chemisch definiertem RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den angegeben Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. Getestet wurden Gentamicin (Aminoglykosid), Penicillin G (β-Laktam-Antibiotikum), Amoxicillin (β-Laktam-Antibiotikum), Ciprofloxacin (Fluorochinolon), Rifampicin (Rifamycin-Gruppe) und Daptomycin (zyklisches Lipopeptid). RPMIMedium ohne Antibiotikum (ohne AB) diente als Wachstumskontrolle. n. d.: definierte Quantifizierungsgrenze unterhalb von 100 KBE/ml (nicht determiniert). A: Überlebenskinetik der exponentiellen Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. B: Überlebenskinetik der stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10. Dargestellt sind die Werte aus einem repräsentativen Experiment. 92 Ergebnisse Allerdings wurden stationär gewachsene Bakterien weniger stark abgetötet als exponentiell gewachsene Bakterien. Bis nach 24 h kam es zu einer gleichmäßigen Abnahme der Anzahl der lebenden Bakterien um insgesamt etwa zwei bis drei logStufen, jedoch waren unter Amoxicillinbehandlung nach 24 h keine lebenden Bakterien mehr detektierbar. Die Überlebenskinetik unter Rifampicin war für Bakterien aus der exponentiellen und stationären Wachstumsphase ebenfalls vergleichbar, aber auch in diesem Fall wurden die Bakterien aus der stationären Wachstumsphase weniger stark abgetötet als Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase, d. h. bis nach 8 h befand sich die Anzahl der lebenden Bakterien auf etwa einem Level. Erst nach 24 h kam es zu einer Abnahme der Anzahl der lebenden Bakterien um etwa anderthalb log-Stufen. Durch Daptomycin wurden auch Bakterien aus der stationären Wachstumsphase nach 1 h komplett abgetötet. Die Vielfachtoleranz gegenüber verschiedene Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen, die ausgeprägtere Toleranz gegenüber Antibiotika von stationär gewachsenen Bakterien im Vergleich zu exponentiell gewachsenen Bakterien und die zumindest unter Gentamicinbehandlung typische biphasische Überlebenskinetik von Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase deutete darauf, dass auch S. suis in der Lage ist, Persister zu bilden. Da die Gentamicinbehandlung bei exponentiell gewachsenen Bakterien in einer typischen biphasischen Überlebenskinetik resultierte und sich ein deutlicher wachstumsphasenabhängiger Unterschied in der Überlebenskinetik unter der Gentamicinbehandlung herausstellte, wurde Gentamicin zum Antibiotikum der Wahl erklärt und in folgenden Versuchen als Standardantibiotikum eingesetzt. Um auszuschließen, dass das Glyzerol einen signifikanten Einfluss auf die Antibiotikatoleranz von kryokonservierten Bakterien hat, wurde im Vorfeld eine Überlebenskinetik von S. suis-Stamm 10 durchgeführt, in der die Toleranz von Kryokonservaten mit der einer Frischkultur gegenüber das vierfache der MHK von Gentamicin verglichen wurde (siehe Anhang, Abbildung 26). Sowohl für die exponentielle als auch für die stationäre Wachstumsphase zeigte sich eine vergleichbare Überlebenskinetik der kryokonservierten und frisch gewonnenen Bakterien, so dass ein signifikanter Einfluss des Glyzerols auf die Toleranz 93 Ergebnisse gegenüber Gentamicin ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich wurde die Überlebensfähigkeit von S. suis-Stamm 10 in Anwesenheit der vierfachen MHK von Gentamicin in RPMI-Medium mit der Überlebensfähigkeit in RPMI-Medium mit Zusatz von 20% Serum (CDS) und THB-Medium verglichen (siehe Anhang, Abbildung 27), um festzustellen, ob das Medium einen Einfluss auf die Antibiotikatoleranz hat. Es zeigte sich, dass sowohl exponentiell als auch stationär gewachsene Bakterien in RPMI-Medium und RPMI-Medium mit 20% Serumzusatz eine vergleichbare Überlebenskinetik aufwiesen, so dass ein Einfluss des Serums ausgeschlossen werden kann. Jedoch wurden Bakterien aus beiden Wachstumsphasen in THB-Medium stärker abgetötet als in RPMI-Medium, wenngleich die Bakterien auch in THB-Medium in der Lage waren, über einen längeren Zeitraum zu überleben. Da die Zusammensetzung des THB-Mediums Schwankungen unterliegt, wurden alle Überlebenskinetiken in chemisch definiertem RPMI-Medium durchgeführt. 4.2.3 Vererbbarkeit der Persistenz von S. suis Um einen Beweis zu erbringen, dass es sich bei der Toleranz von S. suis gegenüber Gentamicin um eine Persistenz und nicht um eine Resistenz handelt, wurde ein Heritabilitätstest durchgeführt. Im Gegensatz zu einer Resistenz handelt es sich bei der Persistenz um einen vorübergehenden Phänotyp, der nicht vererbt wird (Moyed und Bertrand, 1983). Bei diesem Test wird die bestehende Sensibilität einer Bakterienkultur auf eine wiederholte Antibiotikumbehandlung überprüft, wobei im Falle einer Persistenz die Kultur bei jeder Behandlungswiederholung ähnlich sensibel auf die Antibiotikabehandlung reagiert wie die unbehandelte Ursprungskultur. In dieser Arbeit wurde eine ÜNK in THB von S. suis mit frischem THB-Medium verdünnt und bis zur exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase wachsen gelassen. Die Bakterien wurden geerntet und 1 x 107 KBE wurden mit der 100fachen MHK von Gentamicin inkubiert. Nach 1, 2 und 3 h wurden der Anteil der überlebenden Bakterien durch Ausplattieren bestimmt. Nach 3 h Inkubation wurde mit den überlebenden Bakterien eine neue ÜNK angeimpft. Dieser Zyklus wurden insgesamt viermal wiederholt, wobei ein Zyklus einen Tag repräsentiert (Tag 1 bis 4). 94 Ergebnisse Abbildung 3 zeigt das Ergebnis des Heritabilitätstests von S. suis-Stamm 10. Für Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase wurde für jeden Tag eine typische biphasische Überlebenskurve festgestellt. Die exakte Menge an überlebenden Bakterien schwankte zwar innerhalb der vier Tage, allerdings wurde an jedem Tag zunächst innerhalb des kurzen Zeitraumes von 1 h der Großteil der Bakterien abgetötet, während in den weiteren 2 h der Gentamicinbehandlung nur ein Abtöten geringer Bakterienmengen festzustellen war. Teilweise wurden in der ersten Stunde so viele Bakterien abgetötet, so dass sie in den darauffolgenden Stunden nicht mehr sicher detektierbar waren (Tag 2 und 3), jedoch reichte die Menge an überlebenden Bakterien nach 3 h Gentamicinbehandlung aus, um eine neue ÜNK anzuimpfen. stat exp Abbildung 3: Test auf die Vererblichkeit der Gentamicintoleranz in S. suis-Stamm 10 (Heritabilitätstest). Eine ÜNK von S. suis-Stamm 10 wurde in THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und bis zur 7 exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase wachsen gelassen. Die Bakterien wurden geerntet und 1 x 10 KBE wurden mit der 100-fachen MHK von Gentamicin in RPMI-Medium rotierend bei 37°C inkubiert. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. Nach 3 h Inkubation mit Gentamicin wurden die Bakterien pelletiert, gewaschen und es wurde eine neue ÜNK angeimpft. Dieser Zyklus wurde insgesamt viermal wiederholt (Tag 1 bis 4). Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. n. d.: definierte Quantifizierungsgrenze unterhalb 100 KBE/ml (nicht determiniert). Bakterien aus der stationären Wachstumsphase wurden dagegen weniger stark abgetötet als Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase. Auch hier kam es zu Schwankungen in der Menge der abgetöteten Bakterien an den vier Tagen, allerdings wurden an jedem Tag in der ersten Stunde mehr Bakterien abgetötet als in 95 Ergebnisse den darauffolgenden zwei h. An Tag 1 und 3 kam es ebenfalls zur Ausbildung einer bisphasischen Überlebenskurve, die allerdings weniger stark ausgeprägt als für die exponentielle Wachstumsphase war. Die biphasische Überlebenskurve war für Tag 2 und 4 fast aufgehoben. Dennoch kam es in keinem Fall zu einer Vermehrung der Bakterien über das Eingangsinkulum hinaus. Diese Daten zeigen, dass die Gentamicintoleranz von S. suis-Stamm 10 kein vererbter Resistenzmechanismus ist, denn in diesem Fall käme es zu einer Anreicherung und Vermehrung der resistenten Zellen bei der wiederholten Gentamicinbehandlung. Stattdessen konnte bei jeder erneuten Gentamicinbehandlung ein sensibler Anteil an Bakterien abgetötet werden. Diese Feststellung spricht für eine phänotypische Varianz. Die Tatsache, dass die Gentamicintoleranz nicht vererbt wird und die damit im Zusammenhang stehende Wachstumsphasenabhängigkeit ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass S. suis-Stamm 10 Persisterzellen bildet. 4.2.4 Eliminierung von S. suis-Persisterzellen In der Literatur wurden zwei Typen von Persisterzellen beschrieben, die auf unterschiedlichem Wege gebildet werden. Bei Typ I-Persistern handelt es sich um eine Population sich nicht-teilender Bakterienzellen, die in der stationären Wachstumsphase wahrscheinlich durch die dort herrschenden Stressbedingungen generiert werden. Typ II-Persister werden dagegen unabhängig von externen Stimuli vermutlich durch zelluläre, physikalische und biochemische Veränderungen zufällig und kontinuierlich gebildet (Balaban et al., 2004; Lewis, 2010a). Um festzustellen, ob S. suis-Stamm 10 Typ I- oder Typ II-Persisterzellen bildet, wurde ein PersisterzellEliminierungstest durchgeführt. Dazu wurde eine exponentiell gewachsene S. suisKultur durch wiederholte Re-Inokulation für drei Zyklen in der exponentiellen Wachstumsphase gehalten. Während jedes Zyklus wurden 1 x 107 KBE exponentiell gewachsener Bakterien mit der 100-fachen MHK von Gentamicin für 1 h inkubiert. Die KBE/ml vor und nach Gentamicinbehandlung wurden bestimmt und der prozentuale Anteil überlebender Bakterien wurde berechnet. Bei diesem Test würden 96 Ergebnisse Typ I-Persisterzellen durch einen Verdünnungseffekt eliminiert werden, während zufällig gebildete Typ II-Persisterzelllevel konstant blieben. Abbildung 4: Test auf Eliminierung von S. suis-Persisterzellen. Eine ÜNK von S. suis-Stamm 10 wurde in THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und bis zur exponentiellen Wachstumsphase wachsen gelassen. Mit einem Aliquot dieser Kultur wurde frisches THB-Medium angeimpft, auf eine OD600 von 0,02 eingestellt und erneut bis zur exponentiellen Wachstumsphase wachsen 7 gelassen. Dieser Zyklus wurde dreimal wiederholt (Zyklus 1 bis 3). Bei jedem Zyklus wurden 1 x 10 KBE exponentiell gewachsener Bakterien mit der 100-fachen MHK von Gentamicin in RPMI-Medium für 1 h rotierend bei 37°C inkubiert. Angegeben sind die prozentualen Anteile überlebender Bakterien in Bezug auf das Eingangsinokulum vor Gentamicinbehandlung. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus drei unabhängigen Experimenten. Die gestrichelte Linie repräsentiert das Detektionslimit. Abbildung 4 zeigt, dass der prozentuale Anteil antibiotikumtoleranter Persisterzellen in einer in der exponentiellen Wachstumsphase gehaltenen S. suis-Kultur mit jeder wiederholten Re-Inokulation und anschließender Gentamicinbehandlung (100-fache MHK) abnahm. Nach dem ersten Zyklus betrug der Persisteranteil etwa 3%, nach dem zweiten rund 0,2% und nach dem dritten nur noch ungefähr 0,01%. Diese Werte deuten darauf hin, dass gentamicintolerante Persisterzellen nicht, oder nur zu einem sehr geringen Maße in der exponentiellen Wachstumsphase neu gebildet werden. Es handelt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um Typ I-Persisterzellen, die aus der ÜNK übertragen und mit jeder wiederholten Re-Inokulation weiter verdünnt wurden. Somit bildet S. suis-Stamm 10 Persister höchstwahrscheinlich nicht kontinuierlich, sondern bedingt durch die limitierenden Wachstumsphase. 97 Bedingungen in der stationären Ergebnisse 4.2.5 Small-colony-variants (SCV)-ähnlicher Phänotyp von S. suis nach Gentamicinbehandlung Ein Phänotyp, der im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Persistern beschrieben wurde, sind die SCVs (Lechner et al., 2012). Es handelt es sich hierbei um kleine Varianten von Bakterienkolonien einer Spezies. SCVs wurden ausführlich für Staphylococcus aureus beschrieben. In vitro wurden SCVs selektiert, nachdem Staphylococcus aureus mit Antibiotika, vor allem Aminoglykosiden, behandelt wurde (Balwit et al., 1994; Massey et al., 2001; Miller et al., 1980; Musher et al., 1977; Sadowska et al., 2002; Schaaff et al., 2003; Wise und Spink, 1954). Der Phänotyp der SCVs wurde in dieser Arbeit nicht weiter analysiert, es soll aber eine Beobachtung aufgeführt werden, die im Zuge der Antibiotikabehandlungen gemacht wurde (Abbildung 5). Um die Anzahl der lebenden und kultivierbaren KBE bestimmen zu können, wurden die Bakterien auf Schafblutagar ausplattiert. A B Abbildung 5: Koloniemorphologie von S. suis-Stamm 10 nach Antibiotikumbehandlung. A: Koloniemorphologie von S. suis-Stamm 10 auf Columbia-Blutagarplatte nach einstündiger Gentamicinbehandlung; vereinzelt ist eine kleinere Koloniemorphologie (SCV-ähnlicher Phänotyp) sichtbar (Pfeil). B: Koloniemorphologie von S. suis-Stamm 10 auf Columbia-Blutagarplatte nach einstündiger Penicillin GBehandlung. Dabei fiel auf, dass sich unter Gentamicinbehandlung die Koloniemorphologie von S. suis-Stamm 10 in der Hinsicht verändert darstellte, dass zwischen normal groß gewachsenen Kolonien auch Kolonien zu sehen waren, die teilweise deutlich kleiner waren (Abbildung 5A), während unter Penicillinbehandlung die Koloniemorphologie keine sichtbaren Veränderungen erfuhr (Abbildung 5B). Die kleineren Kolonien wuchsen viel langsamer als die Kolonien regulärer Größe; sie waren teilweise erst 98 Ergebnisse nach 48 bis 72 h sichtbar. Diese Veränderung hinsichtlich der Koloniegröße und der Geschwindigkeit des Koloniewachstums unter Gentamicinbehandlung deutet darauf, dass Gentamicin die Ausbildung von kleinen Kolonien von S. suis-Stamm 10 induziert, die rein visuell dem SCV-Phänotyp entsprechen. 4.2.6 Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis gegenüber Antibiotikakombinationen Nachdem festgestellt wurde, dass der wachstumsphasenabhängige PersisterPhänotyp von S. suis-Stamm Gentamicinbehandlung vermittelt, 10 eine wurde Toleranz untersucht, gegenüber eine ob eine auch wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber gängigen Antibiotikakombinationen besteht. Zu diesem Zweck wurden zunächst das Aminoglykosid-Antibiotikum Gentamicin und das β-Laktam-Antibiotikum Penicillin G parallel eingesetzt. Neben Gentamicin wurde zusätzlich als weiteres AminoglykosidAntibiotikum Streptomycin mit Penicillin G kombiniert. Der Einsatz von Gentamicin und Penicillin G dient z. B. im klassischen antibiotic protection assay dazu, in Assoziationsstudien extrazelluläre Bakterien abzutöten, um im Anschluss die intrazellulären Bakterien detektieren zu können. Die Kombination Streptomycin und Penicillin G wird häufig verwendet, um bei Infektionsversuchen in Zellkulturexperimenten Kontaminationen mit unerwünschten bakteriellen Spezies zu verhindern. In dieser Arbeit wurde eine Überlebenskinetik von S. suis-Stamm 10 unter Behandlung von Gentamicin und Penicillin G erstellt (Abbildung 6A), außerdem wurden diese beiden Antibiotika im Heritabilitätstest eingesetzt (Abbildung 6B). Dabei wurden die Antibiotika in den Konzentrationen eingesetzt, wie sie auch regulär im klassischen antibiotic protection assay eingesetzt werden. Diese Konzentration entsprach der 4-fachen MHK von Gentamicin und der 200-fachen MHK von Penicillin G. Für die Erstellung der Überlebenskinetik wurden kryokonservierte Bakterien aus der exponentiellen und stationären Wachstumsphase (S. suis-Stamm 10) mit Gentamicin und Penicillin G für insgesamt 24 h inkubiert. Die Anzahl der überlebenden und kultivierbaren Bakterien wurden wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben bestimmt (Abbildung 6A). Der Heritabilitätstest wurde wie in Kapitel 4.2.3 99 Ergebnisse beschrieben durchgeführt, wobei der Zyklus insgesamt nur dreimal wiederholt wurde (Abbildung 6B). In Anwesenheit der Kombination von Streptomycin und Penicillin G wurde ebenfalls eine Überlebenskinetik von S. suis-Stamm 10 erstellt (Abbildung 6C), wobei die Konzentrationen der Antibiotika so gewählt wurden, dass sie den Konzentrationen entsprachen, wie sie in der Zellkultur eingesetzt werden. Die Konzentration des Streptomycins betrug 50 µg/ml und die des Penicillin Gs 50 U/ml. Eine Angabe als MHK-Wert ist nicht möglich, aber auch nicht notwendig, da in diesem Fall für Vergleichszwecke nur die konkreten in der Zellkultur eingesetzten Antibiotikakonzentrationen wichtig waren. Abbildung 6A verdeutlicht, dass nach der Kombinationbehandlung mit Gentamicin (vierfache MHK) und Penicillin G (200-fache MHK) S. suis-Stamm 10 einen ähnlichen Phänotyp wie nach der Behandlung mit Gentamicin allein (100-fache MHK) aufwies (siehe wachstumphasenabhängige Abbildung 2A und Überlebenskinetik, die 2B). für Es die konnte eine exponentielle Wachstumsphase einen typischen biphasischen Verlauf aufzeigte, festgestellt werden. Innerhalb der ersten Stunde wurde der Großteil an Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase um fast drei log-Stufen abgetötet. Bis nach 8 h Antibiotikabehandlung verringerte sich die Anzahl an überlebenden Bakterien nur noch minimal bis sie nach 24 h nicht mehr sicher detektierbar war. Die Anzahl an Bakterien aus der stationären Wachstumsphase wurde innerhalb der ersten Stunde nur um etwa eine halbe log-Stufe abgetötet. Anschließend kam es erneut zu einer Vermehrung der Bakterien, allerdings erreichte die Anzahl der überlebenden Bakterien nicht ganz das Eingangsinokulum. 100 Ergebnisse A B stat exp C Beschriftung siehe nächste Seite 101 Ergebnisse Abbildung 6: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber der Kombination eines Aminoglykosid- und eines β-Laktam-Antibiotikums. Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. n. d.: definierte Quantifizierungsgrenze unterhalb 100 KBE/ml (nicht determiniert). A: Überlebenskinetik; Kryokonservate der exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 7 10 (1 x 10 KBE) wurde mit der 4-fachen MHK von Gentamicin (Aminoglykosid) und der 200-fachen MHK von Penicillin G (β-Laktam-Antibiotikum) in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. B: Heritabilitätstest; eine ÜNK von S. suis-Stamm 10 wurde in THB-Medium auf eine OD600 von 0,02 verdünnt und bis zur exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase wachsen gelassen. Die Versuchsdurchführung erfolgte wie oben beschrieben (Abb. 3) mit folgenden Abweichungen: die Inkubation der Bakterien erfolgte mit der 4-fachen MHK von Gentamicin und der 200-fachen MHK von Penicillin G und der Zyklus wurde insgesamt dreimal wiederholt (Tag 1 bis 3). C: Überlebenskinetik; Kryokonservate der exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 7 10 (1 x 10 KBE) wurde mit der alternativen Aminoglykosid-/β-Laktam-Antibiotika-Kombination Streptomycin und Penicillin G in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Die Konzentration des Streptomycins lag bei 50 µg/ml und die von Penicillin G bei 50 U/ml. Zu den angegeben Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. Nach 6 h Antibiotikabehandlung reduzierte sich leicht die Anzahl der überlebenden Bakterien und fiel nach 24 h um etwa zwei log-Stufen. Im Heritabilitätstest resultierte die Antibiotikakombination Gentamicin (vierfache MHK) und Penicillin G (200-fache MHK) ebenfalls in einem ähnlichen Phänotyp (Abbildung 6B) wie S. suis-Stamm 10 im Heritabilitätstest unter alleiniger Gentamicinbehandlung (100-fache MHK; Abbildung 3) aufwies. Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase zeigten für jeden Zyklus (Tag 1 bis 3) eine typische biphasische Überlebenskinetik. Zwar schwankte die Anzahl der Persisterzellen an den drei Tagen, es konnte aber für jeden Tag nach 1 h Antibiotikabehandlung ein rapides Abtöten des Großteils der Bakterien und eine darauffolgende PlateauBildung der Bakterienpopulation festgestellt werden. Bakterien aus der stationären Wachstumsphase wurden kaum durch die Antibiotikakombination abgetötet. Die Persisterlevel der Bakterien aus der stationären Wachstumsphase pendelten sich in jedem Zyklus (Tag 1 bis 3) etwa bei der Anzahl der als Eingangsinokulum eingesetzten Bakterien ein, es kam aber zur keiner Vermehrung über das Eingangsinokulum hinaus. Die Bakterien reagierten wachstumsphasenabhängig nach jeder weiteren Antibiotikabehandlung ähnlich sensibel wie die unbehandelte Ursprungskultur. Auch nach der Kombinationsbehandlung mit Streptomycin und Penicillin G zeigten sich eine Wachstumsphasenabhängigkeit und eine typische biphasische Überlebenskinetik für Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase (Abbildung 6C). Die Kinetik ähnelte sehr stark der Kinetik unter Gentamicin- und Penicillin G- 102 Ergebnisse Behandlung (Abbildung 6A). Nach 24 h waren noch lebende Bakterien detektierbar, wohingegen nach Behandlung mit Gentamicin und Penicillin G keine lebenden Bakterien mehr detektierbar waren. Bakterien aus der stationären Wachstumsphase wurden über einen Behandlungszeitraum von 8 h schleichend um etwa eine halbe log-Stufe abgetötet und nach 24 h wurde die Anzahl der überlebenden Bakterien um zwei weitere log-Stufen reduziert. Der Einsatz sowohl der Kombination Gentamicin und Penicillin G, als auch der Kombination Streptomycin und Penicillin G resultierte in einer ähnlichen wachstumsphasenabhängigen Überlebenskinetik wie der Einsatz von Gentamicin allein. Der Heritabilitätstest bestätigte zusätzlich, dass die Antibiotikatoleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber die Antibiotikakombination Gentamicin und Penicillin G nicht durch einen vererbten Resistenzmechanismus bedingt ist, sondern auf das Vorliegen einer phänotypischen Varianz zurückzuführen ist, die sich in dem Persisterphänotyp äußerte. 4.2.7 Toleranz von S. suis gegenüber Gentamicin nach Hemmung der PMF Allison et al. beschrieben 2011, dass die Hemmung der der protonenmotorischen Kraft (engl.: proton-motive force, PMF) durch den Protonen-Ionophor Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone (CCCP) zu einer erhöhten Überlebensrate von Staph. aureus führte, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass die PMF für die Aufnahme von Aminoglykosiden benötigt wird (Taber et al., 1987). Der Einfluss der CCCP-Behandlung auf die Toleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber einer Gentamicinbehandlung wurde in dieser Arbeit untersucht. Dazu wurden in einem Ansatz 1 x 107 KBE von Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase mit 20 µM CCCP in 1 ml RPMI-Medium für 10 min vorinkubiert und anschließend mit der 100-fachen MHK von Gentamicin für 8 h inkubiert. In einem weiteren Ansatz fand keine Vorinkubation der Bakterien mit CCCP statt. Nach 1, 2, 4, 6 und 8 h Inkubation mit Gentamicin wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE bestimmt. Das Verhältnis von unbehandelten CCCP-behandelten Gentamicin-toleranten Gentamicin-toleranten Bakterien wurde Bakterien über zu einen Inkubationszeitraum von 8 h ermittelt (Abbildung 7). Nach 1 h Inkubation war der 103 Ergebnisse Anteil an Gentamicin-toleranten Bakterien in dem CCCP-behandelten Ansatz dreimal so groß wie in dem unbehandelten Ansatz. Bis nach 6 h Inkubation kam es zu einem weiteren Anstieg Gentamicin-toleranter Bakterien innerhalb der CCCP-behandelten Population auf etwa das Siebenfache im Vergleich zu unbehandelten Bakterien. Nach weiteren 2 h Inkubation stieg der Anteil CCCP-behandelter Gentamicintoleranter Bakterien im Vergleich zu unbehandelten Bakterien sogar auf fast das 20fache. Abbildung 7: Einfluss der PMF-Hemmung auf die Gentamicintoleranz von S. suis-Stamm 10. 7 Kryokonservate der exponentiellen Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10 (1 x 10 KBE) wurden mit 20 µM CCCP für 10 min präinkubiert und anschließend mit der 100-fachen MHK von Gentamicin in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den angegeben Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE im CCCP-behandelten und unbehandelten Ansatz bestimmt und in Bezug zueinander gesetzt. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. Signifikanz über die Zeit 1 h bis 8 h: p < 0,001 (Kaplan-Meier Log-Rank Test) CCCP = Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone (Protonen-Ionophor) Die Ergebnisse zeigen, dass die protonenmotorische Kraft auch die Gentamicintoleranz von S. suis-Stamm 10 beeinflusst. 4.2.8 Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis- Stoffwechselmutanten gegenüber Gentamicin Das ADS wird von S. suis als alternativer Stoffwechselweg genutzt, bei dem Arginin umgesetzt und ATP generiert wird. Es ermöglicht S. suis unter Nährstoff- und Sauerstoffmangel und unter sauren Bedingungen zu überleben. Das ADS von S. suis 104 Ergebnisse ist ein Enzymsystem bestehend aus drei Enzymen, deren kodierenden Gene (arcABC) als Operon organisiert sind. Mit dem Operon sind die Gene ccpA, flpS und arcD assoziiert, deren Genprodukte z. T. regulierend auf das ADS und auf die Expression anderer Gene wirken. Das CcpA fungiert als Katabolitrepressor und inhibiert die Transkription des Operons in der frühen Wachstumsphase in Anwesenheit primärer Kohlenstoffquellen. Außerdem gilt das CcpA als globales Regulatorprotein. Von dem FlpS wird angenommen, dass es das ADS sauerstoffabhängig reguliert (Gruening et al., 2006). Das ArcD stellt einen putativen Arginin-Ornithin-Antiporter dar, von dem angenommen wird, dass es durch den Import von Arginin zusätzlich Substrat für das ADS bereitstellt (Fulde, Dissertation, 2007; Gruening et al., 2006). Durch die Hydrolyse von ATP und einen Antiport von Molekülen über eine Membran können Protonengradienten ausgebildet werden, was wichtig für die Aufrechterhaltung einer PMF und somit für die Aufnahme von Aminoglykosiden ist. Um einen ersten Hinweis zu erlangen, welche Gene bzw. Genprodukte an der Persisterbildung von S. suis-Stamm 10 beteiligt sein könnten, wurden die isogenen Stoffwechselmutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD mit dem WT hinsichtlich der wachstumsphasenabhängigen Persisterbildung verglichen. Bei der Mutante 10∆AD wurde das komplette ADS inaktiviert. Die Persisterbildung von S. suis-Stamm 10 und seiner isogenen Mutanten wurde wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben ermittelt. Abbildung 8A zeigt die Überlebenskinetik der Bakterien aus der exponentiellen Wachstumsphase. Sowohl beim WT als auch bei den Mutanten resultierte die Gentamicinbehandlung in einer typischen biphasischen Überlebenskurve, die für die 10∆AD-Mutante allerdings weniger stark ausgeprägt war. Während die Anzahl der überlebenden Bakterien beim WT und bei den Mutanten 10∆ccpA, 10∆flpS und 10∆arcD nach 1 h Inkubation mit Gentamicin um etwa dreieinhalb log-Stufen reduziert wurde, verringerte sich die Anzahl der überlebenden Bakterien der 10∆ADMutante nach 1 h Gentamicinbehandlung nur um etwa eineinhalb log-Stufen. Bis nach 8 h Gentamicinbehandlung verringerte sich die Anzahl der überlebenden Bakterien beim WT und allen Mutanten weiter stetig, wobei für die 10∆ccpA-Mutante bereits nach 6 h und für die Mutanten 10∆flpS und 10∆arcD nach 8 h keine 105 Ergebnisse überlebenden Bakterien mehr sicher detektierbar waren. Überlebende Bakterien vom WT waren erst nach 24 h Gentamicinbehandlung nicht mehr sicher detektierbar. Der Persisterzelllevel der 10∆AD-Mutante lag während der Behandlung etwa zwei logStufen oberhalb des Persisterzelllevels vom WT. Erst nach 24 h waren nur noch teilweise überlebende Bakterien der 10∆AD-Mutante detektierbar. In Abbildung 8B ist die Überlebenskinetik der Bakterien aus der stationären Wachstumsphase dargestellt. Die biphasische Überlebenskurve ist für den WT und alle Mutanten im Vergleich zur exponentiellen Wachstumsphase weniger stark ausgeprägt. Die Anzahl der überlebenden Bakterien des WT und der Mutanten 10∆flpS und 10∆AD wurde nach 1 h Gentamicinbehandlung nur um etwa eine halbe log-Stufe reduziert, die der 10∆ccpA-Mutante um etwa eine log-Stufe und die der 10∆arcD-Mutante um etwa eineinhalb log-Stufen. Die Anzahl der überlebenden Bakterien verringerte sich bis nach 8 h weiter stetig. Nach 8 h Inkubation war die Anzahl der überlebenden Bakterien vom WT und der Mutanten 10∆flpS und 10∆AD nur um etwa eine log-Stufe reduziert, die der Mutanten 10∆ccpA und 10∆arcD dagegen um drei log-Stufen. Während der Gentamicinbehandlung lag die Anzahl der Persisterzellen vom WT und der Mutanten 10∆flpS und 10∆AD eineinahalb bis zwei log-Stufen oberhalb der Anzahl der Persisterzellen der Mutanten 10∆ccpA und 10∆arcD, wobei sich sowohl die Überlebenskurven vom WT, der 10∆flpS-Mutante und der 10∆AD-Mutante untereinander ähnelten, als auch die Überlebenskurven der Mutanten 10∆ccpA und 10∆arcD. Nach 24 h Inkubation war die Anzahl der überlebenden Bakterien vom WT und der Mutanten 10∆flpS und 10∆AD um etwa zweineinhalb bis drei log-Stufen reduziert, die Anzahl der überlebenden Bakterien der Mutanten 10∆ccpA und 10∆arcD war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sicher detektierbar. 106 Ergebnisse A B Abbildung 8: Wachstumsphasenabhängige Gentamicintoleranz von S. suis-Stamm Stoffwechselmutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD. 10 und der 7 Kryokonservate von S. suis-Stamm 10 und der Mutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD (1 x 10 KBE) wurden mit der 100-fachen MHK von Gentamicin in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. n. d.: definierte Quantifizierungsgrenze unterhalb 100 KBE/ml (nicht determiniert). A: Überlebenskinetik der exponentiellen Wachstumsphase. B: Überlebenskinetik der stationären Wachstumsphase. In der exponentiellen Wachstumsphase lag die Anzahl der Persisterzellen der Mutanten 10∆ccpA, 10∆flpS und 10∆arcD in etwa auf oder knapp unter der Anzahl der Persisterzellen des WT, wobei die 10∆ccpA-Mutante am wenigsten in der Lage war, der Gentamicinbehandlung standzuhalten. Die Persisterbildung der 10∆AD- 107 Ergebnisse Mutante lag dagegen deutlich oberhalb des Levels der Persisterbildung des WT (Abbildung 8A). Vergleicht man dazu die Persisterlevel der stationären Wachstumsphase, fällt auf, dass die Anzahl der Persisterzellen vom WT und der 10∆flpS-Mutante in etwa der Anzahl der Persisterzellen der 10∆AD-Mutante entsprachen, während das Level der Persisterbildung der Mutanten 10∆ccpA und 10∆arcD unterhalb des Levels der Persisterbildung vom WT und der Mutanten 10∆flpS und 10∆AD lag (Abbildung 8B). Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das ADS und der mit ihm assoziierten Genprodukte an der Persisterbildung in S. suis-Stamm 10 beteiligt zu sein scheinen. Sowohl die Mutation des Gens, das für das erste Enzym des ADS kodiert (AD), als auch die Mutation von Genen, dessen Genprodukte mit dem ADS assoziiert sind (ccpA und arcD), wirken sich wachstumsphasenabhängig auf die Persisterbildung aus, da sich die Persisterlevel dieser Mutanten je nach Wachstumsphase vom WT unterscheiden. Der Persisteranteil der 10∆flpS-Mutante unterscheidet sich dagegen weder in der exponentiellen noch in der stationären Wachstumsphase wesentlich vom Persisteranteil des WT. 4.2.9 Wachstumsphasenabhängige Toleranz verschiedener S. suis-Stämme gegenüber Gentamicin Die bisherigen Ergebnisse machten deutlich, dass der S. suis-Stamm 10 in der Lage ist, die Anwesenheit der 100-fachen MHK verschiedener Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen zu Aminoglykosidantibiotikum tolerieren, wobei Gentamicin die in Behandlung einer mit dem typischen wachstumsphasenabhängigen biphasischen Überlebenskinetik von S. suis-Stamm 10 resultierte. Im Folgenden sollte untersucht werden, ob es sich bei der Gentamicintoleranz um ein spezifisches Charakteristikum von S. suis-Stamm 10 handelt oder ob dieses Phänomen in weiteren S. suis-Stämmen beobachtet werden kann. Dazu wurde die wachstumsphasenabhängige Toleranz gegenüber Gentamicin von Stamm 10 mit zwei weiteren S. suis-Stämmen verglichen (Abbildung 9). Zum einen wurde der Stamm A3286/94 in die Untersuchung mit einbezogen. Dieser Stamm ist wie Stamm 10 ein porzines Isolat (Smith et al., 1999; Allgaier et al., 2001), 108 Ergebnisse und gehört zum Serotyp 9. Der dritte S. suis-Stamm, der untersucht wurde, war Stamm 05ZYH33, ein weiterer Serotyp 2-Stamm (Chen et al., 2007). Bei diesem Stamm handelt es sich um ein humanes Isolat, das für S. suis-Ausbrüche in China verantwortlich war und u. a. das streptococcal toxic shock syndrome (STSS) verursachte (Sriskandan und Slater, 2006; Tang et al., 2006; Yu et al., 2006). Die Ermittlung der Toleranz der S. suis-Stämme gegenüber Gentamicin wurde wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben durchgeführt. Bakterien aller drei Stämme aus der exponentiellen Wachstumsphase zeigten eine typische biphasische Überlebenskinetik, wobei die Stämme unterschiedlich stark abgetötet wurden (Abbildung 9A). Stamm 10 wurde nach 1 h um etwas mehr als drei log-Stufen abgetötet, Stamm A3286/94 um etwa viereinhalb log-Stufen und Stamm 05ZYH33 um etwa vier log-Stufen. Für Stamm 10 und 05ZYH33 fand bis nach 8 h Inkubation ein weiteres langsames Abtöten der Bakterien statt, wobei Stamm 05ZYH33 stärker als Stamm 10 abgetötet wurde. Es waren bis nach 8 h Inkubation zu jedem Zeitpunkt noch überlebende Bakterien von Stamm 10 und 05ZYH33 detektierbar. Stamm A3286/94 wurde dagegen bereits nach 4 bis 6 h so stark abgetötet, dass eine Detektion überlebender Bakterien nicht mehr möglich war. Nach 24 h waren für keinen Stamm mehr überlebende Bakterien nachweisbar. Für exponentiell gewachsene Bakterien zeigte sich, dass S. suis-Stamm 10 die größte Toleranz und S. suis-Stamm A3286/94 die geringste Toleranz gegenüber Gentamicin aufwies. Stamm 05ZYH33 zeigte einen intermediären Phänotyp. Für alle drei Stämme war eine Wachstumsphasenabhängigkeit feststellbar, da Bakterien aus der stationären Wachstumsphase eine erhöhte Toleranz gegenüber Gentamicin aufwiesen verglichen mit Wachstumsphase. 109 Bakterien aus der exponentiellen Ergebnisse A B Abbildung 9: Wachstumsphasenabhängige Gentamicintoleranz der S. suis-Stämme 10 (Serotyp 2), A3286/94 (Serotyp 9) und 05ZYH33 (Serotyp 2). 7 Kryokonservate der S. suis-Stämme 10, A3286/94 und 05ZYH33 (1 x 10 KBE) wurden mit der 100-fachen MHK von Gentamicin in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. n. d.: definierte Quantifizierungsgrenze unterhalb 100 KBE/ml (nicht determiniert). A: Überlebenskinetik der exponentiellen Wachstumsphase. B: Überlebenskinetik der stationären Wachstumsphase. Allerdings wurde für die Stämme, die sich in der stationären Wachstumsphase befanden, auch ein unterschiedlich starkes Abtöten ermittelt (Abbildung 9B). Die biphasische Überlebenskurve der stationären Wachstumsphase war für Stamm 10 110 Ergebnisse fast aufgehoben, für Stamm A3286/94 stark reduziert und für Stamm 05ZYH33 um etwa eine log-Stufe vermindert. Nach 1 h Inkubation wurde die Anzahl der überlebenden Bakterien von Stamm 10 nur um etwa eine halbe log-Stufe verringert, von Stamm A3286/94 um rund eineinhalb log-Stufen und von Stamm 05ZYH33 um etwa zweieinhalb log-Stufen. Bis nach 8 h Inkubation wurden alle drei Stämme weiter abgetötet, wobei die Stämme A3286/94 und 05ZYH33 stärker abgetötet wurden als Stamm 10. Nach 8 h waren für alle drei Stämme noch überlebende Bakterien detektierbar. Nach 24 h Inkubation waren dagegen keine überlebenden Bakterien der Stämme A3286/94 und 05ZYH33 mehr nachweisbar, während überlebende Bakterien von Stamm 10 noch detektierbar waren- die Anzahl der überlebenden Bakterien wurde insgesamt nur um etwa zweieinhalb log-Stufen reduziert. Der Stammvergleich zeigte für Bakterien aus der stationären Wachstumsphase, dass Stamm 10 die größte und Stamm 05ZYH33 die geringste Gentamicintoleranz aufwies, während Stamm A3286/94 einen intermediären Phänotyp einnahm. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die drei untersuchten Stämme eine wachstumsphasenabhängige Toleranz gegenüber Gentamicin aufwiesen, wobei die Wachstumsphasenabhängigkeit bei den drei Stämmen in unterschiedlicher Ausprägung festgestellt wurde. Nach 1 h Gentamicinbehandlung war bei Stamm 10 und Stamm A3286/94 ein Unterschied an überlebenden Bakterien zwischen exponentieller und stationärer Wachstumsphase von jeweils etwa drei log-Sufen feststellbar. Die Wachstumsphasenabhängigkeit dieser beiden Stämme ist somit stärker ausgeprägt als die von Stamm 05ZYH33. Bei Stamm 05ZYH33 betrug der Unterschied überlebender Bakterien zwischen exponentieller und stationärer Wachstumsphase nach 1 h Gentamicinbehandlung nur etwa anderthalb log-Stufen. Die Gentamicintoleranz ist also kein spezifisches Phänomen von S. suis-Stamm 10. 4.2.10 Verlängerte Antibiotikatoleranz verschiedener Streptokokken-Spezies Da die verlängerte Toleranz gegenüber Gentamicin sich als eine stammübergreifende Fähigkeit von S. suis herausstellte, war eine weiterführende Hypothese, dass es sich hierbei auch um eine speziesübergreifende Fähigkeit der Gattung Streptococcus handelt. In dieser Arbeit war von Interesse, ob andere 111 Ergebnisse Streptokokken-Spezies wie S. suis unter denselben Versuchsbedingungen ebenfalls eine verlängerte Toleranz einerseits gegenüber Gentamicin und andererseits gegenüber Ciprofloxacin aufweisen. Zu diesem Zweck wurden neben S. suis-Stamm 10 auch die (fakultativ) humanpathogenen Spezies S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 getestet (Abbildung 10). ÜNK der beschriebenen Spezies wurden geerntet und der Anteil antibiotikatoleranter Bakterien wurde wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben bestimmt. Da bekannt ist, dass im Zuge der fortschreitenden bakteriellen Vermehrung der Anteil der Persisterzellen ansteigt, wurden für den Spezies-Vergleich ÜNK, also Bakterien aus der späten stationären Wachstumsphase eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit für die Detektion antibiotikatoleranter Bakterienzellen zu erhöhen. Abbildung 10A zeigt, dass S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 durch die 100-fache MHK des Aminoglykosid-Antibiotikums Gentamicin bereits nach 1 h Inkubation auf ein nicht mehr detektierbares Level abgetötet wurden. Die Anzahl der überlebenden Bakterien von S. suis-Stamm 10 wurden dagegen nur um etwa eine halbe log-Stufe verringert. Über einen Zeitraum von 6 h konnte für S. suis-Stamm 10 eine fast konstante Anzahl an gentamicintoleranten Bakterien festgestellt werden. Die Toleranz gegenüber der 100fachen MHK von Gentamicin ist von den untersuchten Spezies somit nur auf S. suisStamm 10 beschränkt. Anders verhält es sich mit der Toleranz der untersuchten Spezies gegenüber Ciprofloxacin, einem Fluorochinolon (Abbildung 10B). Sowohl für S. suis-Stamm 10, als auch für S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und für S. agalactiaeStamm 6313 konnte über einen Zeitraum von 8 h eine verlängerte Toleranz gegenüber die 100-fache MHK von Ciprofloxacin festgestellt werden. 112 Ergebnisse A B Abbildung 10: Antibiotikatoleranz ausgewählter Vertreter der Gattung Streptococcus. ÜNK von S. suis-Stamm 10, S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 7 wurden geerntet und 1 x 10 KBE der jeweiligen Spezies wurden mit der 100-fachen MHK des Antibiotikums in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den angegebenen Zeitpunkten wurden die überlebenden und kultivierbaren KBE durch Ausplattieren bestimmt. n. d.: definierte Quantifizierungsgrenze unterhalb 100 KBE/ml (nicht determiniert). A: Überlebenskinetik infolge Gentamicin-Behandlung. Dargestellt sind die Werte aus einem repräsentativen Experiment. B: Überlebenskinetik infolge Ciprofloxacin-Behandlung. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. 113 Ergebnisse Erst nach 24 h Inkubation waren überlebende Bakterien von S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 nicht mehr sicher detektierbar, während für S. suis-Stamm 10 teilweise noch überlebende Bakterien festgestellt werden konnten. Alle vier Spezies wurden bis nach 8 h Inkubation stetig und gleichmäßig durch Ciprofloxacin abgetötet, wobei S. gordonii-Stamm 30 und S. agalactiae-Stamm 6313 stärker abgetötet wurden als S. suis-Stamm 10 und S. pyogenes-Stamm A40. Die Anzahl der überlebenden Bakterien von S. suisStamm 10 und S. pyogenes-Stamm A40 reduzierte sich nach 8 h Inkubation um etwas mehr als zwei log-Stufen und die Anzahl der überlebenden Bakterien von S. gordonii-Stamm 30 und S. agalactiae-Stamm 6313 dagegen um rund viereinhalb log-Stufen. Somit wiesen sowohl S. suis-Stamm 10 und S. pyogenes-Stamm A40), als auch S. gordonii-Stamm 30 und S. agalactiae-Stamm 6313 einen ähnlichen Phänotyp bezüglich ihrer Überlebenskinetik unter Ciprofloxacinbehandlung auf. Die Antibiotikatoleranz der Streptokokken-Spezies war wirkstoffabhängig, da im Gegensatz zu S. suis-Stamm 10 für S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 nur eine verlängerte Toleranz gegenüber Ciprofloxacin (Fluorochinolon) und nicht gegenüber Gentamicin (Aminoglykosid) festgestellt wurde. 4.3 Wachstumsphasenabhängige Wechselwirkung von S. suis mit porzinen Monozyten Wie bereits beschrieben, besagt die Trojan horse theory bzw. die modifizierte Trojan horse theory, dass S. suis porzine Monozyten als Vehikel benutzen könnte, um intrazellulär persistierend bzw. extrazellulär an den Zellen adhärierend mit dem Blutstrom zum Zielorgan, dem Gehirn, zu gelangen (Gottschalk und Segura, 2000; Williams und Blakemore, 1990). Um den Theorien in vitro nachzugehen, wurden Assoziationsversuche mit isolierten porzinen Monozyten und S. suis durchgeführt, um festzustellen, ob die Bakterien an den Monozyten adhärieren und ob auch eine Internalisation der Bakterien stattfindet. Von besonderem Interesse war hierbei, ob die initiale Wachstumsphase von S. suis einen Einfluss auf die Bakterien-Zell- 114 Ergebnisse Interaktion hat. Eine wachstumsphasen- bzw. nährstoffabhängige Regulation von Metabolismus, Adhäsinen Streptokokken-Spezies, und wie Virulenzfaktoren z. B. für wurde S. pyogenes, bereits S. für diverse agalactiae oder S. pneumoniae, beschrieben (Kapitel 2.1.4). Willenborg et al. (2011) zeigten beispielsweise, dass einige Virulenz-assoziierte Gene von S. suis wachstumsphasenabhängig exprimiert werden und unter der Regulation des Katabolitrepressors und globalen Regulators CcpA stehen. In dieser Arbeit wurden der WT und die Kapselmutante 10∆cps des S. suis Serotyp 2-Stammes 10 und der WT des S. suis Serotyp 9-Stammes A3286/94 hinsichtlich der wachstumsphasenabhängigen Assoziation mit porzinen Monozyten miteinander verglichen. Bislang wurden Studien zur Interaktion von S. suis mit porzinen Monozyten nur mit adhärenten oder vorbehandelten Monozyten, oder auch Makrophagen untersucht (Charland et al., 1996; Charland et al., 1998; Segura et al., 1998; Segura et al., 2002; Segura und Gottschalk, 2002; Smith et al., 1999). In dieser Arbeit wurde die Assoziation von S. suis mit Monozyten erstmalig in Suspension untersucht. Die Monozyten wurden dazu im Gegensatz zu den anderen Studien selektiv über eine immunomagnetische Anreicherung von den anderen Blutbestandteilen separiert, so dass der Anteil nicht erwünschter Zellen auf ein Minimum reduziert wurde. Dieser Versuchsaufbau wurde gewählt, um in-vivoBedingungen im Blut so gut wie möglich zu simulieren und um dadurch die Aussagekraft bezüglich der tatsächlichen Assoziation von S. suis mit im Blut zirkulierenden porzinen Monozyten zu erhöhen. Da die Wachstumsphase einen Einfluss auf den Metabolismus und die Expression Virulenz-assoziierter Gene von S. suis hat und die Bakterien in der exponentiellen Wachstumsphase somit offensichtlich einen anderen Status als Bakterien in der stationären Wachstumsphase innehaben, wurden Bakterien aus beiden Wachstumsphasen hinsichtlich ihrer Assoziation mit den porzinen Monozyten verglichen. Interessant war hierbei einerseits der Vergleich zwischen dem WT und der Kapselmutante 10∆cps von S. suis-Stamm 10, da für die Kapselmutante bereits eine höhere Phagozytoserate im Vergleich zum WT beschrieben wurde. Andererseits war der Serotypen-Vergleich zwischen dem Serotyp 2-Stamm 10 und dem Serotyp 9-Stamm 115 Ergebnisse A3286/94 von Interesse, da die unterschiedliche Kapseldicke (siehe Anhang, Abbildung 23) einen Einfluss auf die Assoziation dieser beiden Stämme haben könnte und eine unterschiedliche Assoziation eventuell mit der unterschiedlichen Virulenz zusammenhängen könnte. Darüber hinaus wurde die Wechselwirkung von S. suis und den porzinen Monozyten näher untersucht im Hinblick auf den Einfluss, den die Bakterien auf charakteristische Eigenschaften der Monozyten haben. 4.3.1 Präparation und Charakterisierung porziner MNCs und CD14-positiver Monozyten Um die Wechselwirkung von S. suis mit den porzinen Monozyten testen zu können, mussten die Monozyten zunächst aus dem Vollblut gesunder Schweine gewonnen werden. Monozyten bilden zusammen mit den Lymphozyten die Zellpopulation der MNCs, wobei die Lymphozyten den Hauptanteil der MNCs ausmachen. Sowohl die MNCs als auch die Monozyten wurden morphologisch charakterisiert, bevor die Monozyten in weiteren Experimenten eingesetzt wurden. In einem ersten Schritt wurden die MNCs mittels einer Biocoll-Dichtegradientenzentrifugation aus dem Vollblut separiert. Dazu wurde Biocoll mit dem porzinen Vollblut überschichtet und zentrifugiert, was in einer dichteabhängigen Separierung der Blutbestandteile resultierte. Die MNCs reicherten sich in der Interphase zwischen Biocoll- und Blutplasmaschicht an. Die Interphase wurde abpipettiert, gewaschen, in RPMIMedium resuspendiert und durchflusszytometrisch hinsichtlich Morphologie und Vitalität am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) untersucht und mit der BD accuri™ C6 Software ausgewertet (Abbildung 11A und 11B). Des Weiteren wurde anhand spezifischer fluoreszenzkonjugierter Antikörper die Verteilung bestimmter Oberflächenmoleküle durchflusszytometrisch untersucht, um die MNCs näher zu charakterisieren und um Subpopulationen zu definieren (Abbildung 11C bis 11E). Abbildung 11A zeigt die durchflusszytometrische Erfassung der Morphologie der in der Interphase befindlichen Zellen. Es wurden 10000 Zellen gemessen und als Dotplot dargestellt. Aufgetragen ist die Größe der Zellen, gemessen im forward scatter (FSC-Kanal, x-Achse), gegen die Zellgranularität, gemessen im sideward scatter (SSC-Kanal, y-Achse). Die Hauptpopulation wurde eingegrenzt und als MNCs 116 Ergebnisse definiert. Von der Gesamtheit der erfassten Zellen betrug der Anteil der als MNCs definierten Zellpopulation 96,4%. Dieser Wert lässt auf eine saubere Separation der Interphase schließen und zeigt, dass mit der Interphase die MNCs von den übrigen Blutzellen separiert wurden. Zur Erfassung der Vitalität wurden die MNCs mit dem Vitalitätsmarker Propidiumjodid (PJ) inkubiert. In Abbildung 11B ist die Vitalität der separierten MNCs dargestellt. Der Anteil der vitalen MNCs an den Gesamt-MNCs betrug 98,5%. Die in den Assoziationsversuchen eingesetzten porzinen Monozyten wurden durch die Erfassung einer charakteristischen Verteilung spezifischer Oberflächenmoleküle (CD-Marker) definiert. Da es während der Prozedur der Anreicherung der Monozyten bereits zu einer Besetzung spezifischer CD-Marker kommt, wurde eine Charakterisierung der Zellen zusätzlich vor der Anreicherung der Monozyten durchgeführt. Dazu wurden die MNCs mit den fluoreszenzkonjugierten Antikörpern gegen die Oberflächenmarker CD172a, CD14 und CD163 inkubiert. CD172a ist ein Panmonozytenmarker (Haverson et al., 1994; McCullough et al., 1997). Die Verteilung und die Intensität der Expression von CD14 und CD163 variiert während des Reifungsprozesses der Monozyten, wodurch sich Monozyten-Subsets definieren lassen (Chamorro et al., 2005). In Abbildung 11C wurde der prozentuale Anteil der CD172a-positiven MNCs und der CD172a-negativen Zellen erfasst. Es wurden 100000 MNCs durchflusszytometrisch erfasst und als Dotplot dargestellt. Die Zellen, die eine deutliche Fluoreszenz im FL1Kanal aufwiesen, wurden als Region R1 definiert und die darin befindlichen Zellen als CD172a-positive Zellen. CD172a ist ein Panmonozytenmarker, der innerhalb der gesamten Monozytenpopulation, inklusive aller Reifungsstadien, exprimiert wird. Da Lymphozyten kein CD172a exprimieren, handelt es sich bei den CD172a-positiven Zellen um die Monozyten. Der Anteil an CD172a-positiven MNCs, also an Monozyten, innerhalb der Gesamt-MNCs betrug 2,2%. Hierbei handelt es sich um eine repräsentative durchflusszytometrische Erfassung. Anzumerken ist, dass der Anteil der Monozyten an den MNCs innerhalb von drei Messungen von etwa 2 bis 6% variierte (siehe Anhang, Tabelle 5). Diese Werte verdeutlichen den allgemein geringen Anteil von Monozyten an den MNCs in porzinem Vollblut. Die Zellen in R2 117 Ergebnisse repräsentieren die Lymphozyten, die kein CD172a exprimieren. Der Anteil CD172anegativer Zellen betrug 88,6%. Über das Expressionsmuster von CD14 und CD163 lassen sich Monozytensubpopulationen bzw. -reifegrade klassifizieren. Laut Chamorro et al. (2005) können porzine Monozyten je nach Expression von CD172a, CD14, CD163 und SLA DR in die vier Subsets I, II, III und IV unterteilt werden. In Abbildung 11D sind die CD172a-negativen Zellen (Lymphozyten) aus Region R2 im FL2-/FL4-Kanal dargestellt. Im FL2-Kanal werden die CD163-positiven Zellen und im FL4-Kanal die CD14-positiven Zellen erfasst. Da Lymphozyten kein CD14 bzw. CD163 exprimieren, konnte die Grenzwerte im FL2- und FL4-Kanal für CD163- und CD14-negative Zellen definiert werden. Der Anteil CD14- und CD163-negativer Zellen aus R2 betrug 98,7%. Abbildung 11E zeigt die prozentuale Verteilung der CD14- und CD163-positiven Zellen innerhalb der CD172a-positiven Zellen aus Region R1 (siehe Abbildung 11C). Über die Intensität der Fluoreszenzmessungen lassen sich sowohl Monozyten mit hoher Ausprägung von CD14 bzw. CD163 als auch Monozyten mit geringer Ausprägung von CD14 bzw. CD163 erfassen. 118 Ergebnisse A B C D E Abbildung 11: Präparation porziner MNCs und Oberflächenmoleküle (CD-Marker). deren Charakterisierung anhand spezifischer Die Morphologie, Vitalität und Verteilung spezifischer Oberflächenmoleküle der Zellen wurden durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) untersucht und mit der BD accuri™ C6 Software 119 Ergebnisse ausgewertet. Mononukleäre Zellen (MNCs) des porzinen Vollblutes wurden nach BiocollDichtegradientenzentrifugation und anschließender Separation der Interphase nach Herstellerangaben präpariert. Die MNCs wurden mit fluoreszenzkonjugierten Antikörpern gegen die Oberflächenmarker CD14, CD163 und CD172a inkubiert und in Propidiumjodid (PJ)- Lösung aufgenommen. Dargestellt sind repräsentative FACSBilder. A: Darstellung der Morphologie mononukleärer Zellen aus der Interphase nach der Biocoll-Separation als Dichteplot im FSC-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Größe der Zellen (FSC/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). B: Erfassung des prozentualen Anteils vitaler Zellen im FL3-/SSC-Kanal nach Ausgrenzung der Propidiumjodid (PJ)-positiven Zellen. PJ dient als Indikator für die Zellvitalität und wird im FL3-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL3/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). C: Erfassung des prozentualen Anteils CD172a-positiver MNCs im FL1-/SSC-Kanal, hier definiert als Region R1, und des prozentualen Anteils CD172a-negativer MNCs (Lymphozyten), hier definiert als Region R2. CD172a ist ein Panmonozytenmarker und diente somit als Eingrenzung der porzinen Monozytenpopulation. Der FITCkonjugierte anti-CD172a-Antikörper wird im FL1-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL1/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). D: Darstellung der CD172-negativen Zellen aus R2 im FL2-/FL4-Kanal zur Festlegung der Grenzwerte für CD163-positive Zellen im FL2-Kanal und CD14-positive Zellen im FL4-Kanal. E: Erfassung der prozentualen Verteilung der CD14-positiven und CD163-positiven MNCs innerhalb der CD172apositiven MNCs (Monozyten) aus R1 im FL2-/FL4-Kanal. Über die CD14- und CD163-Verteilung lassen sich Monozytensubpopulationen klassifizieren. Die definierte Region R3 repräsentiert die Monozytensubpopulation high low low high CD14 CD163 und die definierte Region R4 die Monozytensubpopulation CD14 CD163 . Der Alexa 647konjugierte anti-CD14-Antikörper wird im FL4-Kanal und der PE-konjugierte anti-CD163-Antikörper im FL2-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität im FL2-Kanal (x-Achse) gegen die Fluoreszenzintensität im FL4-Kanal (y-Achse). Anhand der unterschiedlichen Intensität der Verteilung von CD14 und CD163 wurden die zwei Regionen R3 und R4 definiert, die jeweils eine Monozytensubpopulation repräsentieren. R3 repräsentiert die Monozytensubpopulation CD14high CD163low. Der prozentuale Anteil an der Gesamtmonozytenpopulation beträgt 34,6%. Die Monozytensubpopulation CD14low CD163high wird durch R4 repräsentiert. Ihr prozentualer Anteil an den Gesamtmonozyten beläuft sich auf 55,3%. Die Monozytenpopulation besteht somit zu etwa einem Drittel aus der Subpopulation CD14high CD163low und zu knapp zwei Dritteln aus der Subpopulation CD14low CD163high. Der Restanteil CD14- und CD163-negativer Zellen betrug 8,0%. Die Verteilung von CD14 und CD163 innerhalb der Monozyten (CD172a-positive MNCs) ergab, dass die mit der Interphase separierten Monozyten größtenteils Subset III zuzuordnen waren. Der Monozytenanteil innerhalb der MNCs ist sehr gering. Den Hauptanteil bilden die Lymphozyten, wohingegen der Anteil der Monozyten an den MNCs beim Schwein nur etwa 2 bis 10% beträgt (Thorn, 2010). Um Studien hinsichtlich der Wechselwirkung von S. suis ausschließlich mit porzinen Monozyten durchführen zu können, mussten die Monozyten aufgereinigt und aus den MNCs angereichert 120 Ergebnisse werden. Dazu wurden die MNCs mit einem anti-CD14-Antikörper, der mit magnetischen Microbeads konjugiert ist, markiert. CD14 fungiert als Monozytenmarker, da fast die komplette im Blut zirkulierende Monozytenpopulation CD14 exprimiert. Die markierten MNCs wurden in einem magnetischen Feld von den unmarkierten MNCs separiert und dadurch angereichert (engl.: magnetic activated cell sorting, MACS). Die immunomagnetisch angereicherten CD14-positiven MNCs wurden in RPMI-Medium aufgenommen und durchflusszytometrisch sowohl hinsichtlich ihrer Morphologie und Vitalität (Abbildung 12A und 12B), als auch in Bezug auf die Verteilung spezifischer Oberflächenmoleküle (CD-Marker, Abbildung 12C und 12D) untersucht. In Abbildung 12A ist die durchflusszytometrische Erfassung der Morphologie der angereicherten CD14-positiven MNCs dargestellt. Der Anteil der als CD14-positiven MNCs definierten Zellpopulation betrug in Bezug auf die gesamten erfassten Zellen 93,9%. Dieser Wert deutet auf eine effiziente Anreicherung der CD14-positiven MNCs. Die deutlich sichtbare Verlagerung der Population der CD14-positiven MNCs im Vergleich zur nicht aufgereinigten MNC-Gesamtpopulation (Abbildung 11A) bestätigt eine Anreicherung einer MNC-Subpopulation. Der Anteil der vitalen CD14-positiven MNCs an den gesamten CD14-positiven MNCs betrug 92,1%. Dieser Wert deutet darauf, dass die CD14-positiven MNCs durch die Aufreinigung nur eine geringe Schädigung erfuhren. Die aufgereinigten und angereicherten CD14-positiven MNCs wurden wie die nichtangereicherten MNCs ebenso hinsichtlich der Expression spezifischer CD-Marker untersucht. Dazu wurden die CD14-postiven MNCs mit Fluoreszenz-konjugierten Antikörpern gegen CD172 und CD163 inkubiert. Abbildung 12C zeigt die Erfassung des prozentualen Anteils der CD172a-positiven MNCs innerhalb der CD14-positiven MNCs. Der eingegrenzte Bereich wurde als Region R1 definiert und die darin befindlichen Zellen als CD172a-positive Zellen. Der Anteil an CD172a-positiven MNCs, also an Monozyten, betrug 94,6%. Im Vergleich zu Abbildung 11C, in der die CD172a-positiven MNCs innerhalb der Gesamt-MNCs dargestellt sind, wird ebenso das Verschwinden der CD172a-negativen Zellen (Lymphozyten) innerhalb der angereicherten CD14-positiven MNCs deutlich. 121 Ergebnisse In Abbildung 12D ist die Erfassung des prozentualen Anteils der CD163-positiven MNCs innerhalb der CD14-positiven MNCs dargestellt. Die Abgrenzung der CD163positiven Zellen erfolgte anhand unmarkierter Zellen im FL2 Kanal (Daten nicht gezeigt). Der eingegrenzte Bereich wurde als Region R2 definiert und die darin befindlichen Zellen als CD163-positive Zellen. Der Anteil CD163-positiver MNCs innerhalb der CD14-positiven MNCs betrug 66,7%. A B C D Abbildung 12: Anreicherung porziner CD14-positiver MNCs (Monozyten) und deren Charakterisierung anhand spezifischer Oberflächenmoleküle (CD-Marker). Die Morphologie, Vitalität und Verteilung spezifischer Oberflächenmoleküle der Zellen wurden durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) untersucht und mit der BD accuri™ C6 Software ausgewertet. MNCs des porzinen Vollblutes wurden mit magnetischen anti-CD14-Antiköpern markiert und anschließend wurden die CD14-positiven MNCs mittels immunomagnetischer Separation angereichert. Die CD14-positiven MNCs wurden mit fluoreszenzkonjugierten Antikörpern gegen CD163 und CD172a inkubiert und in PJ-Lösung aufgenommen. Dargestellt sind repräsentative FACS-Bilder. A: Darstellung der Morphologie der angereicherten CD14-positiven MNCs als Dichteplot im FSC-/SSC-Kanal. 122 Ergebnisse Aufgetragen ist die Größe der Zellen (FSC/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). B: Erfassung des prozentualen Anteils vitaler CD14-positiver MNCs im FL3-/SSC-Kanal nach Ausgrenzung der Propidiumjodid (PJ)-positiven Zellen. PJ dient als Indikator für die Zellvitalität und wird im FL3-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL3/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). C: Erfassung des prozentualen Anteils der CD172a-positiver Zellen innerhalb der CD14-positiven MNCs im FL1-/ SSC-Kanal, hier definiert als Region R1. CD172a als Panmonozytenmarker diente zur Bestätigung der CD14positiven MNCs als porzine Monozyten. Der FITC-konjugierte anti-CD172a-Antikörper wird im FL1-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL1/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). D: Erfassung des prozentualen Anteils der CD163-positiven MNCs innerhalb der CD14-positiven MNCs (Monozyten) im FL2-/SSC-Kanal, hier definiert als Region R2. Die Ausprägung von CD163 klassifiziert eine Monozytensubpopulation. Der PE-konjugierte anti-CD163-Antikörper wird im FL2-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL2/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). Anhand der Verteilung der CD-Marker auf den porzinen CD14-positiven Monozyten wurden diese Subset III zugeordnet. Auf eine zusätzliche Charakterisierung mit dem anti-CD14-Antikörper wurde verzichtet, da die CD14-positiven MNCs bereits über den anti-CD14-Antikörper angereichert wurden. Die Verlagerung der Population im FSC-/SSC-Kanal vor und nach der Anreicherung der CD14-positiven MNCs und der Nachweis der Expression des Panmonozytenmarkers CD172a auf fast den gesamten CD14-positiven MNCs bestätigen die CD14-positiven MNCs als Monozyten. Die CD14-positiven MNCs wurden in den folgenden Versuchen deshalb genauer als CD14-positive Monozyten beschrieben. Anhand des Expressionsmuster von CD14 und CD163 innerhalb der porzinen Monozyten vor der Anreicherung und der CD14-positiven Monozyten nach der immunomagnetischen Aufreinigung wurden die in den weiteren Versuchen eingesetzten CD14-positiven Monozyten Subset III zugeordnet. In einem weiteren Schritt wurden die immunomagnetisch angereicherten porzinen CD14-positiven Monozyten funktionell hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Phagozytosefähigkeit charakterisiert. Dazu wurden die CD14-positiven Monozyten mit fluoreszierenden Latexbeads bei einer MOI von 1:8 für 3 h in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Die Latexbeads besaßen einen Durchmesser von einem µm und entsprachen somit in etwa der Größe von S. suis. Ein separater Ansatz der Latexbeads-Suspension wurde mit porzinen Immunglobulinen der Klasse G (IgG) beladen, um eine eventuell bestehende Phagozytosefähigkeit zu stimulieren. Nach der Inkubation der porzinen CD14-positiven Monozyten mit den unbehandelten bzw. IgG-beladenen Latexbeads wurde ein Aliquot durchflusszytometrisch untersucht (Abbildung 13A und 13D). Es wurden 10000 Zellen erfasst und als Dotplot 123 Ergebnisse dargestellt. Ein weiteres Aliquot wurde auf einen Objektträger zentrifugiert und zur Darstellung der Zellkerne der Monozyten mit Prolong® Gold mit DAPI eingedeckt. Die Präparate wurden am konfokalen Mikroskop Leica TCS SP5 (Leica; Wetzlar) untersucht und mit der Software LAS ausgewertet (Abbildung 13B, 13C, 13E und 13F). Bei den konfokalmikroskopischen Aufnahmen handelt es sich um repräsentative Aufnahmen (40-fache Vergrößerung), die das Bild mehrerer Gesichtsfelder widerspiegeln. In den konfokalmikroskopischen Aufnahmen weisen die Latexbeads eine Grünfluoreszenz und die Zellkerne der porzinen CD14-positiven Monozyten eine Blaufluoreszenz auf. Abbildung 13A zeigt die durchflusszytometrische Erfassung des prozentualen Anteils mit unbehandelten Latexbeads assoziierten porzinen CD14-positiven Monozyten. Der Anteil an CD14positiven Monozyten, die mit unbehandelten Latexbeads assoziiert waren, betrug nur 0,2%. Dieser Wert ist vernachlässigbar und deutet darauf, dass porzine CD14positive Monozyten nicht oder nur minimal mit Latexbeads assoziieren. Diese Feststellung wird durch die zugehörigen konfokalmikroskopischen Aufnahmen bestätigt, dargestellt in Abbildung 13B und 13C. Die unbehandelten Latexbeads lagen vereinzelt zwischen den Monozyten (Abbildung 13B). Eine räumliche Nähe vereinzelter Latexbeads zu den CD14-positiven Monozyten (Abbildung 13C) kann auf eine minimal vorhandene Assoziation oder auf ein zufälliges Beieinanderliegen deuten. 124 Ergebnisse A B C D E F Abbildung 13: Assoziation von fluoreszierenden unbehandelten bzw. IgG-beladenen Latexbeads mit porzinen CD14-positiven Monozyten. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit fluoreszierenden Latexbeads (MOI 1:8) für 3 h in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Ein Aliquot der Ansätze wurde durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) untersucht und mit der BD accuri™ C6-Software ausgewertet (Fluoreszenz im FL1-Kanal), ein ® weiterer wurde auf einen Objektträger zentrifugiert, zur Darstellung der Zellkerne mit ProLong Gold mit DAPI eingedeckt, am konfokalen Mikroskop Leica TCS SP5 (Leica) untersucht und mit der Software LAS ausgewertet. Dargestellt sind repräsentative FACS-Bilder und konfokal-mikroskopische Aufnahmen. A-C: Assoziation porziner CD14-positiver Monozyten mit unbehandelten Latexbeads. A: Durchflusszytometrische Erfassung des prozentualen Anteils mit unbehandelten Latexbeads assoziierten CD14-positiven Monozyten im FL1-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Fluoreszenz der Zellen (FL1/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). B und C: Konfokal-mikroskopische Überprüfung der Assoziation der CD14-positiven Monozyten mit unbehandelten Latexbeads. D-F: Assoziation porziner CD14-positiver Monozyten mit porzinen IgG-beladenen Latexbeads. D: Durchflusszytometrische Erfassung des prozentualen Anteils mit IgG-beladenen Latexbeads assoziierten CD14-positiven Monozyten im FL1-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Fluoreszenz der Zellen (FL1/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). E und F: Konfokal-mikroskopische Überprüfung der Assoziation der CD14-positiven Monozyten mit IgGbeladenen Latexbeads. B, C, E und F: grün = Latexbeads, blau = Zellkerne der porzinen CD14-positiven Monozyten; Vergrößerung 40fach. 125 Ergebnisse Abbildung 13D zeigt die Assoziation der porzinen CD14-positive Monozyten mit den IgG-beladenen Latexbeads. Der Anteil an CD14-positiven Monozyten, die mit IgGbeladenen Latexbeads assoziiert waren, betrug 5,6%. Dieser Wert lässt auf eine Assoziation der Latexbeads zu den CD14-positiven Monozyten schließen, die zwar gering ist, aber durch die Beladung mit den porzinen IgG erhöht wurde. Die zugehörigen konfokalmikroskopischen Aufnahmen, dargestellt in Abbildung 13E und 13F, bestätigen die Assoziation der CD14-positiven Monozyten mit den IgGbeladenenen Latexbeads. Mehrere vereinzelte, in Haufen oder in Ketten liegende IgG-beladene Latexbeads waren mit den CD14-positiven Monozyten assoziiert, wobei zwischen einer Adhärenz und einer Internalisation nicht unterschieden werden kann. Allerdings ist eine Internalisation der IgG-beladenen Latexbeads nicht auszuschließen. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die porzinen CD14positiven Monozyten prinzipiell zur Antikörper-vermittelten Phagozytose fähig sind. 4.3.2 Überlebensfähigkeit von S. suis in Anwesenheit porziner CD14-positiver Monozyten Vor der Untersuchung der Assoziation wurde zunächst überprüft, inwiefern der WT und die Kapselmutante 10∆cps des S. suis-Stammes 10 und der WT des S. suisStammes A3286/94 in der Lage sind, unter diesen Bedingungen über einen längeren Zeitraum in Anwesenheit der angereicherten und zuvor charakterisierten (siehe Kapitel 4.3.1) porzinen Monozyten zu überleben. Dazu wurden porzine CD14positive Monozyten mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase der drei S. suis-Stämme (MOI 1:10) inkubiert. Zum Zeitpunkt T0 und nach dreistündiger KoInkubation wurden die KBE durch Ausplattieren bestimmt und der Überlebensfaktor der Bakterien innerhalb dieses Zeitraumes wurde errechnet. In Abbildung 14 ist der Überlebensfaktor der drei S. suis-Stämme in Anwesenheit der porzinen CD14-positiven Monozyten dargestellt. Der Überlebensfaktor für den WT des S. suis-Stammes 10 lag bei 12,4, somit replizierten sich die Bakterien innerhalb der dreistündigen Inkubation durchschnittlich etwas mehr als dreimal. Die Kapselmutante 10∆cps hatte einen Überlebensfaktor von 15,2 und replizierte sich demzufolge durchschnittlich knapp viermal. Der S. suis-Stamm A3286794 wies einen 126 Ergebnisse Überlebensfaktor von durchschnittlich 16,6 auf, was einer etwas mehr als vierfachen Replikation entspricht. Die Anzahl der Bakterien aller drei Stämme stieg im Vergleich zum Eingangsinokulum um ein Vielfaches. Die getesteten S. suis-Stämme sind somit sehr gut in der Lage, über einen Zeitraum von mindestens 3 h in Anwesenheit der porzinen CD14-positiven Monozyten zu überleben und sich sogar zu vermehren. Abbildung 14: Überlebensfaktor der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in Anwesenheit porziner CD14-positiver Monozyten nach 3 h. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suisStamm 10, 10∆cps und A3286/94 (MOI 1:10) in RPMI-Medium für 3 h bei 37°C rotierend inkubiert. Zu den Zeitpunkten T0 und T3 wurden die KBE durch Ausplattieren bestimmt und der Überlebensfaktor wurde durch Berechnung von T3/T0 ermittelt. Dargestellt sind die Mittelwerte und Standardabweichungen aus vier unabhängigen Experimenten. 4.3.3 Assoziation von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten Nachdem eine Überlebensfähigkeit der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in Anwesenheit der Monozyten festgestellt werden konnte, wurde im Folgenden untersucht, ob diese drei S. suis-Stämme eine wachstumsphasenabhängige Assoziation mit den porzinen CD14-positiven Monozyten zeigen. Es wurde beschrieben, dass bestimmte Gene, darunter auch einige Virulenz-assoziierte Gene, wachstumsphasenabhängig in S. suis-Stamm 10 exprimiert werden (Willenborg et al., 2011). Um die wachstumsphasenabhängige Assoziation von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 zu untersuchen, wurden porzine CD14-positive Monozyten mit Kryokonservaten der exponentiellen und stationären Wachstumsphase der drei Stämme (1 x 106 Monozyten und 1 x 107 Bakterien; MOI 1:10) für 1 h rotierend in 127 Ergebnisse 1 ml RPMI-Medium bei 37°C inkubiert. Nachdem die CD14-positiven Monozyten zentrifugiert, gewaschen und lysiert wurden, wurde die Anzahl der mit den Monozyten assoziierten Bakterien durch Ausplattieren bestimmt. In Abbildung 15 ist die relative Assoziation der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 aus jeweils der exponentiellen (exp) und stationären (stat) Wachstumsphase mit den porzinen CD14-positiven Monozyten nach 1 h KoInkubation dargestellt. Für alle drei Stämme wurde sowohl für die exponentielle als auch für die stationäre Wachstumsphase eine sehr hohe Assoziation mit den Monozyten ermittelt, wobei alle drei Stämme einen wachstumsphasenabhängigen Unterschied hinsichtlich der Anzahl der assoziierten Bakterien zeigten. Dieser Unterschied war für die Kapselmutante 10∆cps statistisch allerdings nicht signifikant. Auffällig war, dass sowohl der WT als auch die Kapselmutante 10∆cps des Serotyp 2-Stammes 10 aus der stationären Wachstumsphase eine höhere relative Assoziation zu den Monozyten aufwiesen, als die entsprechenden exponentiell gewachsenen Stämme, wobei die relative Assoziation des WT allgemein höher war als die der Kapselmutante. In der exponentiellen Wachstumsphase betrug die relative Assoziation des WT knapp über 100% und die der Kapselmutante etwa 80%. In der stationären Wachstumsphase wies der WT dagegen eine relative Assoziation von etwa 250% und die Kapselmutante von ungefähr 120% auf. Der Serotyp 9Stamm A3286/94 zeigte im Gegensatz zu Stamm 10 in der exponentiellen Wachstumsphase eine höhere relative Assoziation. Für Stamm A3286/94 konnte eine relative Assoziation in der exponentiellen Wachstumsphase von etwa 200% und in der stationären Wachstumsphase von rund 150% ermittelt werden. Geht man davon aus, dass eine relative Assoziation von 100% einer Anzahl von assoziierten Bakterien entspricht, die als Eingangsinokulum (1 x 107 KBE/ml) eingesetzt wurde, bedeutet eine Erhöhung der relativen Assoziation über 100% hinaus, dass eine Vermehrung bereits assoziierter Bakterien stattfand. 128 Ergebnisse * * n. s. 10∆cps 10 A3286/94 Abbildung 15: Assoziation der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 mit porzinen CD14-positiven Monozyten nach 1 h. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der exponentiellen (exp) bzw. stationären (stat) Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 (MOI 1:10) in RPMI-Medium unter Zusatz von 20% colostrum deprived serum (CDS) für 1 h bei 37°C rotierend inkubiert. Der Anteil assoziierter Bakterien wurde durch Ausplattieren bestimmt und als relative Assoziation in Prozent in Bezug auf das Eingangsinokulum angegeben.bDargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus drei unabhängigen Experimenten. Die Signifikanz ist angegeben mit * (t-Test; p-Wert < 0,05; n. s.: nicht signifikant). Eine Ausnahme bildet die Kapselmutante 10∆cps aus der exponentiellen Wachstumsphase, da es hier nicht zu einer Erhöhung der relativen Assoziation über 100% hinaus kam. Dies könnte einerseits bedeuten, dass bei bestehender Vermehrungsfähigkeit die Assoziationsfähigkeit reduziert ist oder andererseits, dass die Vermehrungs- bzw. Überlebensfähigkeit durch die Anwesenheit der CD14positiven Monozyten eingeschränkt ist. In diesem Versuch wurde die Assoziation von S. suis mit den porzinen CD14positiven Monozyten auf bakterieller Ebene durch Ausplattieren ermittelt. Um die Ergebnisse aus den Plattierungsversuchen zu überprüfen, wurde die Assoziation zusätzlich durchflusszytometrisch untersucht. Dazu wurden porzine CD14-positive Monozyten mit CFSE-markierten Kryokonservaten der exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 bei einer MOI von 1:10 in RPMI-Medium für 1 h bei 37°C rotierend inkubiert. Aufgrund der Assoziation der fluoreszierenden CFSE-markierten Bakterien mit den Monozyten, konnte der Anteil an Monozyten, der mit den Bakterien assoziiert war und dadurch 129 Ergebnisse eine Fluoreszenz aufwies, durchflusszytometrisch erfasst werden. Abbildung 16A zeigt die durchflusszytometrische Erfassung der Morphologie von S. suis-Stamm 10 aus der stationären (stat) Wachstumsphase. Die Hauptpopulation der erfassten Bakterienzellen wurde eingegrenzt und als Region R1 definiert. In Abbildung 16B ist der prozentuale Anteil fluoreszierender Bakterien von unmarkierten Bakterien dargestellt. Diese Messung diente der Erfassung der Autofluoreszenz der Bakterien und zur Abgrenzung nicht-fluoreszierender Bakterien. Nur 0,01% der gemessenen Bakterien, die unmarkiert waren, wies eine Autofluoreszenz auf. Abbildung 16C zeigt die Erfassung des prozentualen Anteils fluoreszierender Bakterien von CFSE-markierten Bakterien. Von den CFSE-markierten Bakterien zeigten 99,43% eine Fluoreszenz. Da fast die Gesamtheit der gemessenen Bakterien eine Fluoreszenz aufwies, war die CFSE-Markierung höchst effizient. Es ist anzumerken, dass es sich bei Abbildung 16A bis 16C um beispielhafte FACSBilder von Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10 handelt, die repräsentativ für Kryokonservate sowohl von der exponentiellen als auch von der stationären Wachstumsphase der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 stehen. Bei allen drei Stämmen, sowohl bei exponentiell als auch bei stationär gewachsenen Bakterien, lag die Effizienz der CFSE-Markierung bei annähernd 100% (siehe Anhang, Abbildung 30). In Abbildung 16D ist der durchflusszytometrisch erfasste prozentuale Anteil porziner CD14-positiver Monozyten, der mit den S. suis-Stämmen 10, 10∆cps oder A3286/94, jeweils aus der exponentiellen (exp) oder aus der stationären (stat) Wachstumsphase, assoziiert war, graphisch dargestellt. Der Anteil an Monozyten, der mit exponentiell gewachsenem S. suis-Stamm 10 assoziiert war, betrug etwa 70%, und der mit stationär gewachsenem S. suis-Stamm 10 assoziiert war, knapp 80%. Der Anteil an Monozyten, der mit der Kapselmutante 10∆cps (Stamm 10) und dem S. suis-Stamm A3286/94 assoziert war, betrug jeweils sowohl für exponentiell als auch für stationär gewachsene Bakterien über 80%. 130 Ergebnisse A B C D E n. s. 10 F n. s. n. s. 10∆cps A3286/94 G H 131 Ergebnisse I J K Abbildung 16: Wachstumsphasenabhängige Assoziation CFSE-markierter S. suis-Stämme mit porzinen CD14-positiven Monozyten. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit CFSE-markierten Kryokonservaten der exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 (MOI 1:10) in RPMI-Medium unter Zusatz von 20% CDS für 1 h bei 37°C rotierend inkubiert. Die Effizienz der CFSE-Markierung und der Anteil ® fluoreszierender CD14-positiver Monozyten wurden durchflusszytometrisch am FACscan (BD, Heidelberg) gemessen und mit der winMDI-Software (Version 2.9) ausgewertet. A-C: Dargestellt sind repräsentative FACS-Bilder. A: Darstellung der Morphologie von S. suis-Stamm 10 (stat) als Dichteplot im FSC-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Größe der Bakterien (FSC/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). Region R1 umfasst die S. suisPopulation, die in B und C dargestellt ist. B und C: Erfassung des prozentualen Anteils fluoreszierender Bakterien von unmarkierten (B, Autofluoreszenz und Abgrenzung der Fluoreszenz) und CFSE-markierten (C) Bakterien am Beispiel von S. suis-Stamm 10 (stat) im FL1-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Fluoreszenz (FL1/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). D: Graphische Darstellung des prozentualen Anteils CD14-positiver Monozyten assoziiert mit S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 (jeweils exponentielle und stationäre Wachstumsphase), gemessen an der Fluoreszenzintensität der mit den CD14-positiven Monozyten assoziierten CFSE-markierten Bakterien. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus sieben unabhängigen Experimenten. E-K: Erfassung der CD14-positiven Monozyten im FL1-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Fluoreszenz der Monozyten (FL1/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). Dargestellt sind repräsentative FACS-Bilder. E: Erfassung des prozentualen Anteils autofluoreszierender CD14-positiver Monozyten und Abgrenzung der Fluoreszenz. F-K: Erfassung des prozentualen Anteils CD14-positiver Monozyten assoziiert mit fluoreszierendem/CFSEmarkiertem S. suis-Stamm 10 (F, I), 10∆cps (G, J) und A3286/94 (H, K), jeweils aus der exponentiellen (F-H) und aus der stationären (I-K) Wachstumsphase. Diese Ergebnisse sind zusätzlich in den Abbildungen 16E bis 16K als repräsentative Dotplots dargestellt. In Abbildung 16E ist der prozentuale Anteil autofluoreszierender CD14-positiver Monozyten erfasst. Ein Anteil autofluoreszierender Zellen von 0,2% war sehr gering. Außerdem diente diese Messung dazu, die nicht-fluoreszierende Monozytenpopulation abzugrenzen. Durchflusszytometrisch konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Assoziation exponentiell und stationär gewachsener Bakterien mit porzinen CD14-positiven Monozyten festgestellt werden. Allerdings war die Tendenz zu erkennen, dass evtl. eine wachstumsphasenabhängige Assoziation der Monozyten mit dem WT von S. suis- 132 Ergebnisse Stamm 10 besteht, da ein größerer Anteil an Monozyten mit stationär gewachsenem S. suis-Stamm 10 assoziiert war verglichen mit exponentiell gewachsenem S. suisStamm 10. Es scheint allerdings auch ein gewisser Monozytenanteil zu existieren, der keine Assoziation zu den untersuchten S. suis-Stämmen aufweist. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 stark mit den porzinen CD14-positiven Monozyten assoziiert sind. In den Plattierungsversuchen wurde für Stamm 10 und A3286/94 ein statistisch signifikanter Unterschied im Vergleich der Assoziation exponentiell und stationär gewachsener Bakterien festgestellt. Durchflusszytometrisch wurde dagegen kein statistisch signifikanter wachstumsphasenabhängiger Unterschied in der Assoziation ermittelt. Dies ist wahrscheinlich auf die unterschiedliche Methodik zur Erfassung assoziierter Bakterien zurückzuführen. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse lassen auf eine hohe Assoziation zwischen den porzinen CD14-positiven Monozyten mit den S. suis-Stämmen 10, 10∆cps und A3286/94 schließen. In einem weiteren Schritt sollten die Ergebnisse durch Visualisierung der Assoziation von porzinen CD14-positiven Monozyten mit den S. suis-Stämmen mittels der DIF bestätigt werden. Dieses Untersuchungsverfahren ermöglicht außerdem eine Unterscheidung zwischen extrazellulären/adhärenten und intrazellulären/internalisierten Bakterien. Dazu wurden porzine CD14-positive Monozyten mit den S. suis-Stämmen 10, 10∆cps und A3286/94 bei einer MOI von 1:10 inkubiert. Anschließend wurden die Monozyten gewaschen, auf Objektträger zentrifugiert und zur Darstellung der Zellkerne mit ProLong® Gold mit DAPI eingedeckt. Die assoziierten S. suis-Stämme wurden mit Primärantikörpern markiert und anschließend mit fluoreszierenden Sekundärantikörpern detektiert. Die Präparate wurden mit dem Fluoreszenzmikroskop Nikon Eclipse Ti-S (Nikon, Düsseldorf) untersucht. In Abbildung 17A bis 17C sind repräsentative mikroskopische Aufnahmen mit einer 100-fachen Vergrößerung dargestellt. Intrazelluläre Bakterien wiesen eine grüne Fluoreszenz, extrazelluläre Bakterien eine gelb-orangefarbene Fluoreszenz und die Zellkerne der porzinen CD14-positiven Monozyten eine blaue Fluoreszenz auf. Die DIF bestätigte die hohe Assoziation von S. suis-Stamm 10 (Abbildung 17A), 10∆cps 133 Ergebnisse (Abbildung 17B) und A3286/94 (Abbildung 17C) mit den porzinen CD14-positiven Monozyten. Auffällig war die offensichtliche starke Vermehrung von S. suis-Stamm 10 und die zusätzliche starke Akkumulation der Bakterienzellen untereinander, die in der Ausprägung für die Kapselmutante 10∆cps und Stamm A3286/94 nicht zu beobachten war. B A C Abbildung 17: Darstellung der Assoziation von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 mit porzinen CD14-positiven Monozyten. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suisStamm 10, 10∆cps und A3286/94 (MOI 1:10) in RPMI-Medium unter Zusatz von 20% CDS für 1 h bei 37°C rotierend inkubiert. Die Monozyten wurden gewaschen, auf Objektträger zentrifugiert und zur Darstellung der ® Zellkerne mit ProLong Gold mit DAPI eingedeckt. Die assoziierten Bakterien wurden mit den Primärantikörpern rabbit anti-S. suis K62 (Stämme 10 und 10∆cps) bzw. rabbit anti-S. suis Serotyp 9 (Stamm A3286/94) markiert. ® Zur Detektion der extrazellulären Bakterien wurden die Präparate mit dem Sekundärantikörper Alexa Fluor 568 goat anti-rabbit und zur Detektion der intrazellulären Bakterien nach Permeabilisierung der Monozytenmembran ® mit 100% Aceton mit dem Sekundärantikörper Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit inkubiert. Die Präparate wurden mit dem Fluoreszenzmikroskop Nikon Eclipse Ti-S (Nikon, Düsseldorf) untersucht und mit der NIS Elements Software BR 3.2. ausgewertet. Dargestellt sind repräsentative mikroskopische Aufnahmen. Vergrößerung 100fach. grün = intrazelluläre Bakterien; gelb-orange = extrazelluläre Bakterien; blau = Zellkerne der porzinen CD14positiven Monozyten; Pfeil = eventuelles intrazelluläres Vorhandensein von S. suis-Stamm 10∆cps. A: Porzine Monozyten mit S. suis-Stamm 10 (stat). B: Porzine Monozyten mit S. suis-Stamm 10∆cps (stat). C: Porzine Monozyten mit S. suis-Stamm A3286/94 (stat). Außerdem wurde ersichtlich, dass es sich bei den mit den porzinen CD14-positiven Monozyten assoziierten Bakterien hauptsächlich um adhärente Bakterien handelt. Intrazelluläre Bakterien waren nicht eindeutig zu erkennen. Die mit der Kapselmutante 10∆cps infizierten Monozyten wiesen jedoch evtl. vereinzelt intrazelluläre Bakterien auf (Abbildung 17B, Pfeil). Die DIF bestätigte zwar die hohe Assoziation der untersuchten S. suis-Stämme mit den porzinen CD14-positiven Monozyten, ließ aber auch vermuten, dass diese S. suis-Stämme zumindest nach einer Assoziationszeit von 1 h nicht oder kaum von den Monozyten internalisiert wurden. Um die Internalisationsfähigkeit der S. suis- 134 Ergebnisse Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 durch die porzinen CD14-positiven Monozyten näher zu untersuchen, wurde ein antibiotic protection assay, genauer gesagt ein daptomycin protection assay (DPA), durchgeführt. Hier werden extrazelluläre Bakterien antibiotisch abgetötet, so dass der ausschließliche Nachweis intrazellulärer Bakterien möglich ist. Dazu wurden porzine CD14-positive Monozyten mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 bei einer MOI von 1:10 in RPMI-Medium bei 37°C rotierend inkubiert. Die Assoziationszeit wurde dabei von 1 auf 3 h erhört. Zur Abtötung der extrazellulären Bakterien wurden die Monozyten in RPMI-Medium mit der zehnfachen MHK des Antibiotikums Daptomycin resuspendiert und weitere 2 h bei 37°C rotierend inkubiert. Der Anteil intrazellulärer Bakterien wurde nach Entfernen des Antibiotikums durch Ausplattieren bestimmt. Wie in Abbildung 18 zu sehen ist, waren die relativen Internalisationswerte der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 durch porzine CD14-positive Monozyten trotz Verlängerung der Assoziationszeit von 1 h auf 3 h sehr gering und bestätigten die in den DIF-Darstellungen geringe Internalisation. Für S. suis-Stamm 10 konnte eine relative Internalisation von etwa 0,007%, für die Kapselmutante 10∆cps von rund 0,02% und für Stamm A3286/94 von ca. 0,0003% ermittelt werden. Die Kapselmutante 10∆cps wurde somit am stärksten internalisiert, wobei zu bedenken ist, dass in den drei unabhängigen Experimenten die ermittelten relativen Internalisationswerte sehr stark voneinander abwichen und es somit zu einer großen Standardabweichung kam. 135 Ergebnisse Abbildung 18: Internalisation von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 durch porzine CD14-positive Monozyten. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suisStamm 10, 10∆cps und A3286/94 (MOI 1:10) in RPMI-Medium für 3 h bei 37°C rotierend inkubiert. Extrazelluläre Bakterien wurden mit der 10-fachen MHK von Daptomycin abgetötet. Der Anteil intrazellulärer Bakterien wurde durch Ausplattieren bestimmt und als relative Internalisation in Prozent in Bezug auf das Eingangsinokulum angegeben. Dargestellt sind die Mittelwerte und Standardabweichungen aus drei unabhängigen Experimenten. Allgemein waren die durch Ausplattieren bestimmten relativen Internalisationswerte jedoch so verschwindend gering, vor allem für Stamm A3286/94, dass die Zuverlässigkeit dieser Daten zweifelhaft erschien. Die bisherigen Ergebnisse aus den Assoziationsstudien zeigen, dass S. suis eine hohe Adhäsion an porzine CD14-positive Monozyten aufweist, wohingegen keine oder nur eine sehr geringe Invasion festgestellt werden konnte. Um weiterhin zu überprüfen, ob S. suis porzine Monozyten invadieren kann, wurden transmissionselektronenmikroskopische (TEM-) Aufnahmen angefertigt. Es wurden die bereits beschriebenen S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 hinsichtlich ihres intrazellulären Vorhandenseins untersucht. Zusätzlich wurde die ebenfalls von Stamm 10 abgeleitete Suilysin-defiziente Mutante 10∆sly in diese Untersuchung eingeschlossen. Suilysin wurde als ein Hämolysin von S. suis identifiziert (Jacobs et al., 1994) und weist als sezerniertes Exotoxin eine zytolytische Aktivität auf diverse Wirtszellen auf, was zu deren Schädigung führt. Für die Erstellung der TEM-Aufnahmen wurden porzine CD14-positive Monozyten mit 136 Ergebnisse den S. suis-Stämmen infiziert. Die Proben wurden wie in Kapitel 3.2.4.6 beschrieben weiterbearbeitet. Mittels der TEM-Aufnahmen konnte das intrazelluläre Vorhandensein sowohl der von S. suis-Stamm 10 abgeleiteten Mutanten 10∆cps (Abbildung 19B und 19C) und 10∆sly (Abbildung 19D) als auch von S. suis-Stamm A3286/94 (Abbildung 19E) bestätigt werden. In den Detailaufnahmen ist zu sehen, dass mehrere Bakterienzellen der Mutanten 10∆cps (Abbildung 19C) und 10∆sly (Abbildung 19D) und des Stammes A3286/94 (Abbildung 19E) intrazellulär in einem Monozyt vorhanden waren. Im Falle der internalisierten Mutante 10∆sly (Abbildung 19D) und des Stammes A3286/94 (Abbildung 19E) ist eine Vakuolisierung um die Bakterienzellen herum erkennbar, was darauf deutet, dass eine Aufnahme der Bakterien in die monozytären Phagolysosomen erfolgte. Teilweise befinden sich jeweils zwei Bakterien in einem Phagolysosom. In den Detailaufnahmen der Suilysinmutante 10∆sly (Abbildung 19D) und des Stammes A3286/94 (Abbildung 19E) ist außerdem die Kapsel der Bakterien erkennbar. Das Kapselmaterial zeigt sich als aufgelockerte Struktur um die Bakterienzellen herum. Die Kapselstruktur des Stammes A3286/94 füllt im Gegensatz zur Kapselstruktur der Mutante 10∆sly den Raum des Phagolysosoms weitesgehend aus. In der Detailaufnahme der internalisierten Mutante 10∆cps (Abbildung 19C) ist dagegen keine Vakuolisierung um die intrazellulären Bakterien zu sehen. Die eukaryotische Zellstruktur schließt direkt an die Zellwand der Kapselmutante an, was mit dem Fehlen der Kapsel in Zusammenhang stehen könnte. In der Übersichtsaufnahme der Kapselmutante 10∆cps (Abbildung 19B) ist jedoch eine Vakuolisierung des Monozyten mit darin befindlichen Bakterien zu sehen, wobei jedoch fraglich ist, ob es sich hierbei tatsächliche um die Aufnahme von 10∆cps in ein Phagolysosom, um eine Beschädigung des Monozyten oder um ein Artefakt handelt. 137 Ergebnisse A B C D E Beschriftung siehe nächste Seite 138 Ergebnisse Abbildung 19: TEM-Aufnahmen von porzinen intrazellulären Streptokokken. CD14-positiven Monozyten mit adhärenten und Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suisStamm 10 (A), 10∆cps (B und C), 10∆sly (D) und A3286/94 (E) (MOI 1:10) für 2 h in RPMI-Medium unter Zusatz von 20% CDS bei 37°C rotierend inkubiert. Die Monozyten mit den assoziierten Bakterien wurden mit Lysin und Ruthenium Rot fixiert und angefärbt. Ultradünnschnitte wurden hergestellt und in einem TEM 910 Transmissionselektronenmikroskop (Zeiss, Jena) untersucht. Die TEM-Bilder wurden mit einer Slow-Scan Kamera (ProScan) aufgenommen und mit der ITEM-Software 5.0 ausgewertet. Die Übersichtsdarstellungen in Abbildung 19A und 19B bestätigen die hohe Assoziation des WT und der Kapselmutante 10∆cps von S. suis-Stamm 10 mit porzinen CD14-positiven Monozyten. Für Stamm 10 ist eine Assoziation von in Ketten angeordneten Bakterien zu sehen (Abbildung 19A). Allerdings lässt sich in den Abbildungen 19A und 19B auch erkennen, dass es zu Schädigungen der Monozyten kam, wobei fraglich war, ob dies auf die harsche Prozedur des Fixierungsvorganges oder auf den Einfluss durch S. suis zurückzuführen ist. Eine Aussage darüber, ob eine Internalisation von S. suis-Stamm 10 stattfindet bzw. vor der Schädigung der Monozyten stattfand, kann nicht sicher getroffen werden (Abbildung 19A). 4.3.3 Auswirkungen von S. suis auf die Vitalität und Morphologie porziner CD14-positiver Monozyten In den TEM-Aufnahmen waren neben mit S. suis assoziierten auch beschädigte porzine CD14-positiven Monozyten zu erkennen. Die Annahme, dass im Zuge der fortschreitenden Assoziation S. suis einen Einfluss auf die porzinen CD14-positiven Monozyten haben könnte, sollte im Folgenden geklärt werden. Demnach wurden zunächst Veränderungen von Morphologie und Vitalität der Monozyten durchflusszytometrisch analysiert. Dazu wurden porzine CD14-positive Monozyten mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase der S. suis-Stämme 10, 10∆cps, 10∆sly und A3286/94 bei einer MOI von 1:10 in RPMI-Medium für 3 h bei 37°C rotierend inkubiert. Als Kontrolle wurde ein Ansatz ohne Bakterien mitgeführt. Anschließend wurde der Vitalitätsmarker PJ zu den Ansätzen pipettiert und die Morphologie und die Vitalität der durchflusszytometrisch analysiert. 139 CD14-positiven Monozyten wurden Ergebnisse Die Abbildungen 20A bis 20E zeigen die Morphologie der CD14-positiven Monozyten nach 3-stündiger Inkubation (Abbildung 20A) und nach Ko-Inkubation mit S. suisStamm 10 (Abbildung 20B), 10∆cps (Abbildung 20C), 10∆sly (Abbildung 20D) und A3286/94 (Abbildung 20E). Im Vergleich zur Morphologie uninfizierter CD14-positiver Monozyten (Abbildung 20A) zeigten sich nach Infektion mit der Kapselmutante 10∆cps die größten Veränderungen in der Morphologie der Monozyten. Während eine Abnahme der Größe der Monozyten zu verzeichnen war, nahm deren Granularität stark zu. Außerdem wurde eine große Streuung der Monozyten vor allem im SSC-Kanal festgestellt, was auf viele unterschiedlich stark granulierte Monozyten deutet (Abbildung 20C). S. suis-Stamm 10 hatte im Vergleich zur Kapselmutante 10∆cps einen deutlich geringeren, aber dennoch großen Einfluss auf die Morphologie der Monozyten. Neben einer homogenen Hauptpopulation, die der Morphologie uninfizierter Monozyten entspricht, wurden auch Populationen kleinerer und weniger granulierter Monozyten detektiert. Ein kleiner Anteil an Monozyten zeigte ebenfalls eine Streuung vor allem im SSC-Kanal und deutete auch auf das Vorliegen stärker granulierter Monozyten (Abbildung 20B). Die Suilysinmutante 10∆sly hatte die geringste Auswirkung auf die Morphologie der Monozyten. Die Morphologie war ähnlich der uninfizierter Monozyten. Ein geringer Anteil zeigte eine etwas größere Streuung im FSC-kanal und deutete auf das Vorliegen von teilweise kleineren Monozyten (Abbildung 20D). Der Einfluss von S. suis-Stamm A3286/94 auf die Monozyten war etwas größer als von der Suilysinmutante 10∆sly, aber im Vergleich zum WT von Stamm 10 deutlich geringer. Die Hauptpopulation der Monozyten war im FSC-Kanal etwas breiter gestreut. Dies deutete auf das Vorhandensein eines Anteils etwas kleinerer Monozyten (Abbildung 20E). In den Abbildungen 20F bis 20J ist die Erfassung des prozentualen Anteils vitaler CD14positiver Monozyten dargestellt. Auffällig war, dass es mit zunehmender Veränderung der Morphologie der Monozyten auch zunehmend zu einem Verlust der Zellvitalität kam. Uninfizierte Monozyten wiesen eine hohe Vitalitätsrate von 96,9% auf (Abbildung 20F). 140 Ergebnisse A B D E F G I J C H Beschriftung siehe nächste Seite 141 Ergebnisse Abbildung 20: Auswirkung der S. suis-Stämme 10, 10∆cps, 10∆sly und A3286/94 auf die Morphologie und Vitalität porziner CD14-positiver Monozyten nach 3 h Ko-Inkubation. Porzine CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suisStamm 10, 10∆cps, 10∆sly und A3286/94 (MOI 1:10) in RPMI-Medium für 3 h bei 37°C rotierend inkubiert. Die Ansätze wurden in PJ-Lösung aufgenommen und die Morphologie und die Vitalität der CD14-positiven Monozyten wurden durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) untersucht und mit der BD accuri™ C6 Software ausgewertet erfasst. Dargestellt sind repräsentative FACS-Bilder. A-E: Darstellung der Morphologie der CD14-positiven Monozyten nach 3 h Inkubation (A) und nach 3 h KoInkubation mit S. suis-Stamm 10 (B), 10∆cps (C), 10∆sly (D) und A3286/94 (E) als Dichteplot im FSC-/SSCKanal. Aufgetragen ist die Größe der Zellen (FSC/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). F-J: Erfassung des prozentualen Anteils vitaler CD14-positiver Monozyten im FL3-/SSC-Kanal nach Ausgrenzung PJ-positiver Zellen nach 3 h Inkubation (F) und nach 3 h Ko-Inkubation mit S. suis-Stamm 10 (G), 10∆cps (H), 10∆sly (I) und A3286/94 (J) im FL3-/SSC-Kanal. PJ dient als Indikator für die Zellvitalität und wird im FL3-Kanal detektiert. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL3/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). Der Einfluss der Kapselmutante 10∆cps, die von den getesteten Stämmen den größten Einfluss auf die Zellmorphologie hatte, führte bei den Monozyten auch zu dem größten Vitalitätsverlust. Nach Inkubation mit der Kapselmutante 10∆cps waren nur noch 11,7% der Zellen vital (Abbildung 20H). Nach Inkubation mit S. suis-Stamm 10 waren dagegen noch 60,6% der Monozyten vital (Abbildung 20G). Der geringste Einfluss der Suilysinmutante 10∆sly auf die Morphologie der Monozyten spiegelte sich ebenso in deren Zellvitalität wider, da die Monozyten eine Vitalitätsrate von 83,6% aufwiesen (Abbildung 20I). Stamm A3286/94 hatte ebenfalls einen geringen Einfluss auf die Morphologie der Monozyten, der allerdings etwas größer als der von der Suilysinmutante 10∆sly war. Dementsprechend waren nach Inkubation mit Stamm A3286794 noch 75,3% der Monozyten vital (Abbildung 20J). Allgemein fiel auf, dass nicht-vitale Monozyten (PJ-positive Monozyten) eine große Streuung im SSC-Kanal aufwiesen, also unterschiedlich stark granuliert waren, und dass die Streuung umso größer war, je niedriger die Zellvitalität war (Abbildung 20F bis 20J). Diese Auffälligkeit geht mit den Ergebnissen bezüglich des Einflusses der Bakterien auf die Morphologie der Monozyten konform, da mit zunehmendem Einfluss auf die Morphologie der Monozyten auch eine größere Streuung im SSC-Kanal festgestellt wurde (Abbildung 20A bis 20E). Die bisherigen Ergebnisse ergaben, dass mit der hohen Assoziation von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten auch ein Einfluss der Bakterien auf die Morphologie und Vitalität der Zellen einhergeht. Eine Infektion mit der Kapselmutante 10∆cps führt zu den stärksten Veränderungen in der Morphologie und zum größten 142 Ergebnisse Vitalitätsverlust der Monozyten, gefolgt von Stamm 10 (WT), Stamm A3286/94 und der Suilysinmutante 10∆sly. Die durchflusszytometrischen Untersuchungen zeigten, dass die S. suis-Stämme 10, 10∆cps, 10∆sly und A3286/94 einen schädigenden Einfluss auf die porzinen CD14positiven Monozyten haben, wobei ein höherer Vitalitätsverlust nach Infektion mit Suilysin-exprimierenden Stämmen im Vergleich zur Infektion mit der Suilysinmutante 10∆sly zu verzeichnen war. Deshalb lag die Vermutung nahe, dass während einer Ko-Inkubation von porzinen CD14-positiven Monozyten und S. suis das sezernierte Suilysin ebenso zu einer Schädigung dieser Monozyten führen könnte. Folglich war von Interesse, ob die beschriebenen S. suis-Stämme unter den Versuchsbedingungen der Infektionsexperimente unterschiedliche Mengen an Suilysin sezernieren, was den unterschiedlichen Schädigungsgrad der porzinen CD14-positiven Monozyten erklären könnte. Nachdem die Monozyten mit den S. suis-Stämmen wie in Kapitel 3.2.5.1 beschrieben infiziert wurden, wurden die Monozyten mit den Bakterien zentrifugiert und die Gesamt-Proteinmenge der Überstände wurde bestimmt. Anschließend wurden gleiche Proteinmengen in einem 10%-igen SDS-Gel aufgetrennt. Der Nachweis des sezernierten Suilysins erfolgte wie unter 3.2.5.4 beschrieben mittels spezifischer Antikörper im Immunoblot. Ko 10 A3286/94 10∆sly 10∆cps anti-SLY Abbildung 21: Immunoblot zur Detektion sezernierten Suilysins im Überstand nach 3 h Infektion porziner CD14-positiver Monozyten mit S. suis-Stamm 10, A3286/94, 10∆sly und 10∆cps. Nach 3-stündiger Infektion CD14-positiver Monozyten mit den S. suis-Stämmen 10, A3286/94, 10∆sly und 10∆cps (MOI 1:10) wurden die Überstände der infizierten Monozyten nach Angleichung der Proteinmenge elektrophoretisch in einem 10%-igen SDS-Gel aufgetrennt. Der Nachweis des bakteriell sezernierten Suilysins erfolgte mittels Immunoblot mit einem polyklonalen anti-Suilysin-Antikörper (anti-SLY) und einem mit alkalischer Phosphatase (AP) konjugiertem Sekundärantikörper. Die anschließende Detektion erfolgte mittels Inkubation mit AP-Substrat und nachfolgender Chemielumineszenz-Messung am Chemo Cam Imager 3.2 (Intas, Göttingen) und die Auswertung mit der Chemostar Aufnahmesoftware. Ko: Suilysin-Positivkontrolle. Abbildung 21 zeigt, dass im Vergleich der untersuchten S. suis-Stämme, im Überstand mit Stamm 10 infizierter Monozyten die größte Suilysinmenge nachgewiesen wurde. Nach Infektion mit S. suis-Stamm A3286/94 war im Vergleich zu Stamm 10 deutlich weniger Suilysin nachzuweisen. Nach Infektion mit der 143 Ergebnisse Suilysinmutante 10∆sly konnte im Überstand kein Suilysin nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die sezernierte Suilysinmenge für den Grad der Schädigung der Monozyten verantwortlich sein könnte. Interessanterweise war die sezernierte Suilysinmenge durch die Kapselmutante 10∆cps geringer als durch den WT von S. suis-Stamm 10. Dies korreliert nicht mit dem Grad der Schädigung der Monozyten durch die Kapselmutante und bedarf weiterer Abklärung. 4.3.4 Induktion der ROS-Produktion porziner CD14-positiver Monozyten durch S. suis In Kapitel 4.3.4 wurde ein großer Einfluss der Kapselmutante 10∆cps von S. suisStamm 10 auf die Morphologie und Vitalität der porzinen CD14-positiven Monozyten beschrieben. Allerdings wurde auch eine im Vergleich zu Stamm 10 (WT) geringere Menge an sezerniertem Suilysin ermittelt, wobei Stamm 10 im Vergleich zur Kapselmutante einen geringeren Einfluss auf die Morphologie und Vitalität der porzinen CD14-positiven Monozyten hatte. In einem weiteren Versuch wurde deshalb der Einfluss von S.suis-Stamm 10 und der Kapselmutante 10∆cps auf porzine CD14-positive Monozyten durch die Bestimmung der Produktion reaktiver Sauerstoff-Spezies (engl.: reactive oxygen species, ROS) näher untersucht. Bei phagozytierenden Zellen deutet die ROS-Produktion insbesondere auf antibakterielle Aktivität durch Phagozytose und das Abtöten internalisierter Bakterien (Hassett und Cohen, 1989). Im Falle einer ROS-Produktion wird der Indikator Dihydrorhodamin (DHR) 123 zu dem durchflusszytometrisch im FL1-Kanal detektierbaren grünfluoreszierenden Farbstoff Rhodamin 123 oxidiert. Um die ROS-Produktion der porzinen CD14-positiven Monozyten zu erfassen, wurden diese Zellen mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10 und 10∆cps stimuliert und anschließend mit dem ROS-Indikator DHR 123 inkubiert. Als Kontrolle dienten MNCs und unstimulierte CD14-positive Monozyten zur Detektion der basalen ROS-Produktion. In Abbildung 22A ist die ROS-Produktion unstimulierter, mit dem WT und mit der Kapselmutante 10∆cps stimulierter porziner MNCs bzw. CD14-positiver Monozyten graphisch dargestellt. Die ROS-Produktion durch die MNCs war allgemein deutlich 144 Ergebnisse geringer als die der CD14-positiven Monozyten. Dies war zu erwarten, da der Großteil der MNCs aus Lymphozyten besteht, die als nicht-phagozytierende Zellen zumindest eine Phagozytose-bedingte ROS-Produktion ausschließen lassen. Die ROS-Produktion unstimulierter CD14-positiver Monozyten war durchschnittlich etwa dreimal größer als die der MNCs. Nach Infektion mit Stamm 10 konnte keine Erhöhung der ROS-Produktion im Vergleich zur ROS-Produktion unstimulierter Monozyten festgestellt werden. Allerdings war die ROS-Produktion nach Stimulation mit der Kapselmutante 10∆cps ungefähr sechsfach höher als die basale ROSProduktion unstimulierter CD14-positiver Monozyten. Die Induktion der ROSProduktion porziner CD14-positiver Monozyten nur durch die Kapselmutante 10∆cps lässt vermuten, dass die Kapsel vor antibakterieller Aktivität der Monozyten schützt. Die Histogramme in Abbildung 22B und 22C veranschaulichen zusätzlich die allgemeine geringe ROS-Produktion der porzinen MNCs und die durch die Kapselmutante 10∆cps induzierte ROS-Produktion von porzinen CD14-positiven Monozyten. Die im Vergleich zu den CD14-positiven Monozyten (Abbildung 22C) nach links verlagerten Kurven der MNCs (Abbildung 22B) bestätigen die geringere Fluoreszenzintensität durch eine allgemeine geringe ROS-Produktion. Der Kurvenverlauf unstimulierter und mit Stamm 10 stimulierter CD14-positiver Monozyten war in der Histogrammdarstellung annähernd identisch, wodurch bestätigt wurde, dass die CD14-positiven Monozyten nicht durch Stamm 10 zur ROS-Produktion angeregt wurden. 145 Ergebnisse A * * B * n. s. C Abbildung 22: ROS-Produktion porziner MNCs und CD14-positiver Monozyten ohne Stimulation und nach Stimulation mit S. suis-Stamm 10 und 10∆cps. Porzine MNCs bzw. CD14-positive Monozyten wurden mit Kryokonservaten der stationären Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10 und 10∆cps (MOI 1:10) stimuliert und anschließend mit einem fluoreszierenden ROSIndikator inkubiert. Die ROS-Produktion wurde mittels Fluoreszenzmessung durchflusszytometrisch am BD accuri™ C6 (BD, Heidelberg) erfasst und mit der BD accuri™ C6 Software ausgewertet. A: Graphische Darstellung der ROS-Produktion unstimulierter, mit S. suis-Stamm 10 und mit der Kapselmutante 10∆cps stimulierter porziner MNCs bzw. CD14-positiver Monozyten. Dargestellt sind die Mittelwerte und Standardabweichungen aus drei unabhängigen Experimenten. Die Signifikanz ist angegeben mit * (MannWhitney-U-Test; p-Wert < 0,05; n. s.: nicht signifikant). B und C: Histogrammdarstellung der quantitativen Verteilung porziner MNCs (B) bzw. CD14-positiver Monozyten (C) unterschiedlicher Fluoreszenzintensitäten im FL1-Kanal mit Darstellung der Zellen ohne Stimulation (grüne Linie), nach Stimulation mit 10 (rote Linie) und nach Stimulation mit 10∆cps (blaue Linie). Erfasst wurden jeweils 10000 Zellen. Aufgetragen ist die Fluoreszenzintensität (FL1/x-Achse) gegen die Anzahl der entsprechenden Zellen (y-Achse). Nach der Stimulation mit der Kapselmutante 10∆cps war eine zweigeteilte Monozytenpopulation sichtbar (C). Dargestellt sind repräsentative Histogramme. 146 Ergebnisse Auffällig war dagegen der Kurvenverlauf der CD14-positiven Monozyten nach Stimulation mit der Kapselmutante, da diese Kurve zwei Gipfel aufwies. Der eine Gipfel dieser Kurve mit der größeren Anzahl der Zellen lag auf Höhe der Fluoreszenzintensität unstimulierter Monozyten. Der zweite Gipfel war deutlich nach rechts verschoben. Diese Monozytenpopulation wies somit eine größere Fluoreszenzintensität auf, was auf die erhöhte ROS-Produktion zurückzuführen war. Dieses Ergebnis deutete auf eine zweigeteilte Monozytenpopulation nach Stimulation mit der Kapselmutante 10∆cps und legt die Vermutung nahe, dass die Kapselmutante die ROS-Produktion nur von einem Teil der porzinen CD14-positiven Monozyten induzierte (Abbildung 22C). Dieser Teil entsprach ungefähr 45% der Gesamtmonozytenpopulation. 147 Diskussion 5 Diskussion Infolge eines Infektionsgeschehens kann S. suis unterschiedlichen Bedingungen, wie schwankenden Glukosekonzentrationen oder pH-Werten, ausgesetzt sein. Unterschiedliche Bedingungen herrschen auch während des bakteriellen Wachstums in einer Flüssigkultur, da mit fortschreitender Vermehrung der Bakterien primäre Zuckerquellen, wie z. B. Glukose, verbraucht werden und es durch die Ausscheidung von Stoffwechselabbauprodukten zu einer Ansäuerung des Mediums kommt. Während des Wachstums bzw. beim Übertritt in die stationäre Wachstumsphase kann es bei Bakterien zu einer Veränderung des Genexpressionsprofils kommen. Häufig wurde in dem Zusammenhang eine herunterregulierte Expression von Virulenzgenen, wie z. B. eine reduzierte Kapselexpression, beschrieben (Kadioglu et al., 2008; Sitkiewicz und Musser, 2009). Eine herunterregulierte Kapselexpression könnte in Kombination mit einer Heraufregulierung Oberflächen-assoziierter Gene (Kreikemeyer et al., 2003) zu einer verstärkten Exponierung von Oberflächenproteinen und somit zu einer intensiveren Adhäsion an Wirtszellen führen. Des Weiteren ist eine Heraufregulierung von Genen des alternativen Stoffwechsels ein Merkmal stationär gewachsener Bakterien (Nystrom, 2004; Sitkiewicz und Musser, 2009). Die limitierenden Bedingungen der stationären Wachstumsphase können ebenso eine Reduktion des bakteriellen Stoffwechsels bis hin zur Dormanz (Amako et al., 2008; Oliver, 2005) und Unkultivierbarkeit (Lleo Mdel et al., 2007; Na et al., 2006) induzieren. Da es während des bakteriellen Wachstums zu einer starken Veränderung des Phänotyps kommen kann, wurde in dieser Arbeit für S. suis der Einfluss der initialen Wachstumsphase zum einen auf die Ausprägung antibiotikatoleranter Eigenschaften und zum anderen auf die Wechselwirkung mit naïven porzinen Monozyten untersucht. Nährstoffmangel Stressbedingungen oder in können der zu stationären einer Wachstumsphase Herunterregulierung des herrschende bakteriellen Stoffwechsels führen, was in der Bildung von dormanten Bakterienzellen bzw. Persistern resultieren kann. Persisterzellen weisen aufgrund ihrer Dormanz eine hohe Toleranz gegenüber Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen bei gleich 148 Diskussion bleibender MHK auf und stellen eine phänotypisch variante Subpopulation in einer Bakterienkultur dar (Levin und Rozen, 2006; Lewis, 2007). Ein Anstieg antibiotikatoleranter Subpopulationen in einer Bakterienkultur im Zuge des bakteriellen Wachstums, evtl. bedingt durch die Zunahme limitierender Bedingungen, wurde von Keren et al. (2004a) beschrieben. Da eine Antibiose das Mittel der Wahl bei der Behandlung bakterieller Infektionen ist, stellen antibiotikatolerante Persisterzellen ein Problem bei der antibiotischen Eliminierung dar. Das Phänomen der Persisterbildung wurde bereits für viele Bakterien beschrieben. In dieser Arbeit wurde untersucht, ob S. suis ebenfalls eine wachstumsphasenabhängige Antibiotikatoleranz aufweist und Persister bildet. Wie oben erwähnt könnte die Wachstumsphase zu einer unterschiedlichen Ausprägung der bakteriellen Oberflächenstruktur, z. B. bezüglich der Expression der Kapsel oder der Exponierung von Oberflächenproteinen, führen. Aufgrund dessen wurde in dieser Arbeit untersucht, ob die initiale Wachstumsphase einen Einfluss auf die Assoziationseigenschaften von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten hat. Ein Schritt in der Pathogenese von S. suis ist die Dissemination mit dem Blutstrom und die dadurch ermöglichte Translokation zu den Zielorganen, wobei die Überwindung der Blut-Liquor-Schranke zum Erreichen des ZNS eine besondere Hürde darstellt. In diesem Zusammenhang wurden die Trojan horse theory bzw. die modifizierte Trojan horse theory postuliert, die besagt, dass S. suis im Blutstrom zirkulierende Monozyten als Vehikel benutzen kann, um intrazellulär in diesen persistierend bzw. extrazellulär an diesen adhärierend das ZNS erreichen kann (Gottschalk und Segura, 2000; Williams und Blakemore, 1990). Die Assoziation von S. suis mit Zellen der monozytären Linie wurde in mehreren Studien untersucht, wobei bislang für in vitro-Studien zur Untersuchung der Trojan horse theory zumeist adhärente oder vorbehandelte Monozyten, oder auch Makrophagen, eingesetzt wurden (Charland et al., 1996; Charland et al., 1998; Smith et al, 1999; Segura et al., 2002; Segura und Gottschalk, 2002). In dieser Arbeit wurde die Assoziation von S. suis erstmalig mit affinitätsaufgereinigten, naïven Monozyten im Batch-Verfahren untersucht, mit dem Ziel, durch diesen Versuchsaufbau den in-vivo-Bedingungen möglichst nahe zu kommen und so genauere Aussagen bezüglich der Assoziation 149 Diskussion treffen zu können. Zusätzlich wurden weitere Einflüsse von S. suis auf die Eigenschaften porziner CD14-positiver Monozyten analysiert. 5.1 Wachstumsphasenabhängige Persisterbildung von S. suis Typische Merkmale von Persisterzellen sind die Vielfachtoleranz gegenüber Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen und die Toleranz des Vielfachen einer MHK eines eingesetzten Antibiotikums (Levin und Rozen, 2006). In dieser Arbeit wurde für S. suis-Stamm 10 eine verlängerte Toleranz gegenüber Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen (Gentamicin, Penicillin G, Amoxicillin, Ciprofloxacin und Rifampicin), eingesetzt in der 100-fachen MHK, festgestellt (Abbildung 2). Angelehnt an einer vorherigen Studie mit Staph. aureus (Lechner et al., 2012), erwies sich der Einsatz dieser hohen Antibiotikakonzentration als geeignete Methode, um Persister zu identifizieren, da sensible Bakterienzellen abgetötet und Persisterzellen effektiv selektiert werden. Die Toleranz gegenüber dieser hohen Antibiotikakonzentration lieferte einen ersten Hinweis, dass S. suis-Stamm 10 Persister bilden kann. Die starke Zunahme an antibiotikatoleranten Zellen während der mittleren exponentiellen Wachstumsphase und die wachstumsphasenabhänge Anzahl an antibiotikatoleranten Bakterien gemessen an der Gesamtpopulation gilt als ein weiteres typisches Merkmal der Bildung von Persisterzellen (Keren et al., 2004a; Lewis, 2007). Für S. suis-Stamm 10 wurde ebenso eine wachstumsphasenabhängige Bildung von antibiotikatoleranten Zellen festgestellt, da exponentiell gewachsene Bakterien (Abbildung 2A) allgemein stärker abgetötet wurden als stationär gewachsene Bakterien (Abbildung 2B). In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass S. suis-Stamm 10 aus der exponentiellen und aus der stationären Wachstumsphase dieselbe MHK aufwies (Tabelle 4). Die stärkere Antibiotikatoleranz von Bakterien, die bis zur stationären Wachstumsphase wuchsen, ist somit nicht auf eine höhere MHK im Vergleich zu exponentiell gewachsenen Bakterien zurückzuführen. Die Stressbedingungen in der stationären Wachstumsphase induzieren vermutlich eine erhöhte Antibiotikatoleranz stationär 150 Diskussion gewachsener Bakterien bedingt durch eine herunterregulierte Stoffwechselaktivität und einer damit einhergehenden Inaktivierung von Molekülen, die als Angriffspunkte der Antibiotika dienen. Mittels eines Wachstumsexperiments wurde bestätigt, dass stationär gewachsene Bakterien besser als exponentiell gewachsene Bakterien in nährstoffarmem PBS überleben; stationär gewachsener S. suis-Stamm 10 war sogar in der Lage, sich zu vermehren (Anhang, Abbildung 24). Diese Ergebnisse deuten darauf, dass stationär gewachsene Bakterien sich den limitierenden Bedingungen anpassen und durch Veränderung ihrer Eigenschaften eine Robustheit erlangen, die ein Überleben oder sogar eine Vermehrung unter diesen widrigen Bedingungen ermöglichen. Diese Annahme steht im Einklang mit Erkenntnissen von Kolter et al. (1993), die herausstellten, dass gramnegative Bakterien durch physiologische und morphologische Differenzierung in Nährstoffmangelbedingungen gelangen und diesen wieder entkommen können. Weiterhin beschrieben sie, dass Anpassungen, die Bakterien unter Nährstoffmangel vollziehen, globale Veränderungen in der Zellphysiologie einschließen. Ferner wurde beschrieben, dass Bakterien in der stationären Wachstumsphase einen Status einnehmen, in dem sie resistenter gegenüber verschiedene Faktoren wie hohe Temperaturen, hohe Osmolarität und oxidierenden Substanzen werden (Eisenstark et al., 1996; Foster, 1995; HenggeAronis, 1996; Loewen und Hengge-Aronis, 1994). Diese Veränderungen resultieren bei E. coli aus dem Anschalten mehrerer, zu einem Regulon zusammengefassten Gene zu Beginn der stationären Wachstumsphase (Loewen und Hengge-Aronis, 1994). Für Typ I-Persister ist charakteristisch, dass deren Bildung durch ein Signal ausgelöst wird, und dass ihr Level beim Eintreten in die stationäre Wachstumsphase bedingt durch eine Zunahme von limitierenden Bedingungen bzw. Stressfaktoren ansteigt, während im Gegensatz dazu Typ II-Persister zufällig und kontinuierlich entstehen (Balaban et al., 2004; Dhar und McKinney, 2007; Gefen et al., 2008; Gefen und Balaban, 2009; Keren et al., 2004a; Kussell et al., 2005). Eine wiederholte Re-Inokulation von exponentiell gewachsenem S. suis-Stamm 10 führte zur Eliminierung von Persisterzellen, was die Annahme bestätigt, dass S. suis höchstwahrscheinlich Typ I-Persister als Reaktion auf die Zunahme von limitierenden 151 Diskussion Bedingungen beim Eintreten in die stationäre Wachstumsphase bildet (Abbildung 4). Anderl et al. (2003) stellten passend dazu fest, dass in einem Klebsiella pneumoniaeBiofilm die Bakterien unsensibel auf eine Behandlung mit Ampicillin und Ciprofloxacin reagierten. Sie vermuteten, dass die Bakterien im Biofilm lokal einer Limitierung von Nährstoffen ausgesetzt sind und somit in die stationäre Wachstumsphase eintreten, was sie unempfänglicher für eine Antibiotikumbehandlung macht. Der Einsatz von Antibiotika verschiedener Wirkstoffklassen ergab, dass die Überlebenskinetiken von S. suis-Stamm 10 unterschiedliche Verläufe aufwiesen (Abbildung 2). Die Profile variierten zumindest für exponentiell gewachsene Bakterien von einem ausgeprägten biphasischen bis hin zu einem annähernd flachen Verlauf (Abbildung 2A). Da die verschiedenen Antibiotikaklassen unterschiedliche Wirkmechanismen innehaben, kommt es durch die Dormanz evtl. auch zu einer unterschiedlich ausgeprägten Inaktivierung der antibiotischen Zielmoleküle, was die Varianzen in den Überlebenskinetiken erklären könnte. Der ähnliche Kurvenverlauf der beiden β-Laktam-Antibiotika Penicillin G und Amoxicillin (Inhibierung der Zellwandsynthese und somit osmotische Lyse der Bakterienzelle) deutet darauf, dass die Ausprägung der Antibiotikatoleranz von der eingesetzten Antibiotikaklasse abhängig sein könnte. Um diese Annahme weiter zu verifizieren, müssten weitere Antiobiotika derselben Wirkstoffklasse verglichen werden. Die unter Behandlung mit Gentamicin (Hemmung Überlebenskinetik lässt der Proteinbiosynthese) vermuten, dass stark festgestelle tolerante biphasische Bakterien effizient angereichert werden. Der Verlauf der Überlebenskurven unter Einfluss der anderen Antibiotika deutet darauf hin, dass abhängig von den molekularen Zielmolekülen der verschiedenen Antibiotika innerhalb der Bakterienpopulation vermutlich unterschiedliche Grade von Antibiotikatoleranzen ausgeprägt sind. S. suis-Stamm 10 war sogar nach der Behandlung mit Ciprofloxacin, dem Fluorochinolon (Inhibierung der Gyraseaktivität und damit der DNA-Replikation und der Zellteilung), weiterhin überlebensfähig. Fluorochinolone induzieren zudem eine SOS-Antwort in Bakterien und sind dafür bekannt, dass sie auch nicht-teilende Bakterien abtöten können (Phillips et al., 1987). Somit sollten sogar stationär gewachsene Bakterien, die sich nur noch sehr langsam oder gar nicht mehr teilen, empfänglich für eine 152 Diskussion Fluorochinolon-Behandlung sein. Für E. coli wurde jedoch beschrieben, dass die Fluorochinolon-vermittelte SOS-Antwort die Persisterbildung und somit eine Antibiotikatoleranz begünstigt (Dörr et al., 2009). Dieser Mechanismus greift evtl. auch in S. suis-Stamm 10 und bedingt dadurch offensichtlich auch eine Unangreifbarkeit gegenüber dieser Antibiotikaklasse. Auffällig war, dass Daptomycin als einziges der getesteten Antibiotika sowohl exponentiell, als auch stationär gewachsene Bakterien nach 1 bis 2 h komplett abtötete. Aufgrund seines vielfältigen Wirkmechanismus (Depolarisierung des Membranpotentials und Inhibierung der Protein-, DNA- und RNA-Synthese) scheint dieses Antibiotikum, zumindest wenn es in der 100-fachen MHK eingesetzt wird, in der Lage zu sein, auch die KBE von S. suis-Stamm 10 abzutöten, die gegenüber den anderen beschriebenen Antibiotika tolerant wären. Dies steht im Gegensatz zu der Beobachtung, dass stationär gewachsener Staph. aureus nicht durch die 100-fache MHK von Daptomycin abgetötet werden konnte (Lechner et al., 2012). Dies deutet darauf, dass in S. suis und Staph. aureus, und somit evtl. in den Familien Streptococcaceae und Staphylococcaceae, der Ausbildung von Persisterzellen vermutlich unterschiedliche Mechanismen zugrunde liegen, oder dass die molekularen Zielmoleküle verändert bzw. unterschiedlich exprimiert sind. Die prinzipielle Wirksamkeit der untersuchten Antibiotika wurde durch die Überlebenskinetik der Bakterien in RPMI-Medium ohne Antibiotikumzusatz bestätigt, denn in Abwesenheit von Antibiotika konnte sich S. suis-Stamm 10 im RPMI-Medium deutlich weiter über das Eingangsinokulum hinaus vermehren (Abbildung 2A und 2B), was unter Antibiotikumeinfluss nicht feststellbar war. Einen Beweis, dass es sich bei den antibiotikatoleranten Zellen von S. suis-Stamm 10 tatsächlich um Persister und nicht um resistente Bakterien handelt, lieferte der Heritabilitätstest (Abbildung 3). Bei dem Test auf Heritabilität (Vererbbarkeit) wird die bestehende Sensibilität einer wiederholt überimpften Bakterienkultur mit anschließender Antibiotikumbehandlung überprüft. Enthielt die Kultur eine resistente Subpopulation, käme es zu deren Anreicherung infolge der Antibiotikabehandlung und schließlich zu einer Vermehrung der Bakterien über das Eingangsinokulum hinaus. Da aber jede neu angeimpfte Kultur ähnlich sensibel wie die unbehandelte 153 Diskussion Ursprungskultur reagierte, ist davon auszugehen, dass es sich bei den Antibiotikatoleranten Bakterien um eine Subpopulation mit einer phänotypischen Varianz handelt, die den Persister-Phänotyp ausbildet. Der Heritabilitätstest spiegelt auch die für die Persisterzellen typische Wachstumsphasenabhängigkeit wider, da Bakterien in der exponentiellen Wachstumsphase sensibler reagierten als Bakterien in der stationären Wachstumsphase und die typische biphasische Überlebenskinetik aufwiesen. Die eingesetzte KBE des Eingangsinokulums stationär gewachsener Bakterien wurde während der Antibiotikabehandlung zweier Zyklen sogar nur minimal unterschritten, was darauf schließen ließ, dass diese Bakterienkultur zum Großteil, wenn nicht sogar komplett, aus gentamicintoleranten Persisterzellen bestand. In weiteren Versuchen wurde festgestellt, dass die Anzahl der Persisterzellen im Heritabilitätstest ebenfalls abhängig von der Konzentration des Gentamicins ist (Anhang, Abbildung 28). Mit fallender Gentamicinkonzentration (67fache, 13-fache und vierfache MHK) korrelierte ein Anstieg der Persisterzellen sowohl exponentiell (Anhang, Abbildung 28A, 28C und 28E), als auch stationär gewachsener Bakterien (Abbildung 28B, 28D und 28F), wobei der Persisterzelllevel stationär gewachsener Bakterien wie erwartet jeweils höher als der exponentiell gewachsener Bakterien war. Dieses Ergebnis unterstützt die Vermutung, dass unterschiedliche Toleranzgrade einzelner Bakterienzellen innerhalb einer Population existieren. Die Behandlung der stationär gewachsenen S. suis-Kultur mit der vierfachen MHK von Gentamicin resultierte an allen drei Tagen während des dreistündigen Inkubationszeitraumes in einer konstanten Anzahl an Persisterzelllen, die in etwa dem Eingangsinokulum entsprach. Die Inkubation stationär gewachsener Bakterien mit dieser niedrigen Gentamicinkonzentration führt anscheinend zu einer “Anreicherung“ von Persisterzellen. Dieses Ergebnis ist ein vielversprechender Ansatz für zukünftige Experimente, um die Persisterzellen zu isolieren und auf DNAund RNA-Ebene zu analysieren. Keren et al. (2004a) vermuteten ebenfalls, dass eine Kultur mit stationär gewachsenen Bakterien zum Großteil aus Persisterzellen besteht, und dass das Vorhandensein von Persisterzellen in einer exponentiell gewachsenen Bakterienkultur durch eine Übertragung von Persisterzellen aus der stationären Kultur herrührt. Die Übertragung von Persisterzellen aus der stationären 154 Diskussion Wachstumsphase könnten auch die Schwankungen der Persisterzelllevel der einzelnen Zyklen im Heritabilitätstest sowohl für die Bakterien aus der exponentiellen als auch aus der stationären Wachstumsphase erklären. Für den Heritabilitätstest werden wiederholt ÜNK angeimpft, verdünnt und bis zur exponentiellen bzw. stationären Wachstumsphase weiter wachsen gelassen. Da davon auszugegehen ist, dass das bakterielle Wachstum Schwankungen unterliegt und die limitierenden Bedingungen jedes Zyklus nicht identisch sind, ist vermutlich der Persisterlevel jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt, was ein Übertragen unterschiedlicher Mengen an Persisterzellen und somit die Schwankungen im Heritabilitätstest erklären würde. Diese Vermutung stützt die Annahme, dass eine Kultur von S. suisStamm 10 umso mehr Persisterzellen ausbildet, je weiter sie ausgewachsen ist, und dass eine stationär Bedingungen, gewachsene zumindest zum Kultur, Großteil bedingt aus durch die Persisterzellen limitierenden besteht. Die Beobachtung, dass Kryokonservate exponentiell und stationär gewachsener Bakterien, die aus einer nicht ausgewachsenen ÜNK gewonnen wurden, eine deutlich weniger stark ausgeprägte Antibiotikatoleranz zeigten (Daten nicht gezeigt), untermauert zusätzlich diese Theorie. Abbildung 29 im Anhang zeigt, wie die Überlebenskinetik des WT von S. suis-Stamm 10 im Vergleich zu der davon abgeleiteten Mutante 10∆ccpA in Anwesenheit der 100-fachen MHK von Erythromycin verläuft. Die ccpA-Mutante wurde durch die Insertion einer Erythromycinresistenzgenkassette erstellt und weist somit einen genetischen Resistenzmechanismus auf. Die resistente ccpA-Mutante konnte sich im Gegensatz zum WT über das Eingangsinokulum hinaus vermehren. So wurde zusätzlich bestätigt, dass es sich bei der Antibiotikatoleranz von S. suis-Stamm 10 um eine Persistenz und nicht um eine Resistenz handelt. Dies wurde weiterhin durch die Beobachtung unterstützt, dass S. suis-Stamm 10 nicht in der Lage war, auf Blutagarplatten mit einem Zusatz von Gentamicin in einer vierfachen MHK, also in Anwesenheit des Antibiotikums in einer geringen Konzentration, zu wachsen (Daten nicht gezeigt). Die wachstumsphasenabhängige Antibiotikatoleranz von S. suis-Stamm 10 wurde auch gegenüber gängige Antibiotikakombinationen getestet (Abbildung 6). Die 155 Diskussion Kombination des Aminoglykosid-Antibiotikums Gentamicin mit dem β-LaktamAntibiotikum Penicillin G wird häufig im klassischen antibiotic protection assay eingesetzt, um extrazelluläre Bakterien nach Infektion eukaryotischer Wirtszellen abzutöten. Die Überlebenskinetik von S. suis-Stamm 10 zeigte in Anwesenheit dieser Antibiotikakombination einen ähnlichen Phänotyp wie unter alleiniger Gentamicinbehandlung (Abbildung 6A). Die Wachstumsphasenabhängigkeit und die bestehende Sensibilität wurden im Heritabilitätstest bestätigt (Abbildung 6B). S. suisStamm 10 bildet also auch Persister, die die gleichzeitige Anwesenheit von Gentamicin und Penicillin tolerieren. Die Überlebenskinetik unter der Antibiotikakombinationsbehandlung verzeichnete sogar höhere Persisterlevel als eine Behandlung mit einer 100-fachen MHK von Gentamicin bzw. Penicillin G allein (Abbildung 2), trotz der hohen MHK des Penicillin Gs (200-fach). In einem vorangegangenen Experiment wurde festgestellt, dass L. lactis, ein apathogener Vertreter der Streptococcaceae, bereits nach 1 h komplett durch die Kombination von Gentamicin und Penicillin abgetötet wurde. Allerdings stellte sich ebenfalls heraus, dass die Antibiotikumwirkung allein auf das Gentamicin und nicht auf das Penicillin G zurückzuführen war, da eine alleinige Penicillin G-Behandlung nicht zum Abtöten von L. lactis führte (Daten nicht gezeigt). Diese Ergebnisse zeigten, dass L. lactis vermutlich auch in der Lage ist, Persister zu bilden, die zumindest eine Toleranz gegenüber Penicillin G aufweisen. Streptomycin, ein weiteres AminoglykosidAntibiotikum, wurde ebenfalls mit Penicillin G kombiniert. Die Behandlung von S. suis-Stamm 10 mit dieser Antibiotiakombination resultierte in einer ähnlichen wachstumsphasenabhängigen Überlebenskinetik (Abbildung 6C) wie unter der Behandlung von Gentamicin und Penicillin G (Abbildung 6A). Dies führt zu der Annahme, dass der Grad der Persisterzellbildung auf die Kombination der Antibiotikaklassen der Aminoglykoside und der β-Laktam-Antibiotika zurückzuführen sein könnte und stützt die Vermutung, dass der Grad der Ausprägung der Antibitikatoleranz von der Antibiotikaklasse abhängig ist. Diese Ergebnisse legen außerdem die Vermutung nahe, dass ein Einsatz dieser Antibiotika in diesen Konzentrationen zu verfälschten Testergebnissen führen kann. Die Verwendung von Gentamicin und Penicillin G im antibiotic protection assay könnte beispielsweise 156 Diskussion durch das mangelnde Abtöten der Bakterien Internalisationswerte vortäuschen. Interessanterweise wurde beobachtet, dass S. suis-Stamm 10 unter GentamicinBehandlung auf Schafblutagar eine veränderte Koloniemorphologie aufwies, die rein visuell dem SCV-Phänotyp entsprach. Zwischen regulär gewachsenen Kolonien waren wesentlich kleinere Kolonien zu erkennen, die auch deutlich langsamer wuchsen als die regulären Kolonien (Abbildung 5A). Diese Kolonieveränderung wurde nicht unter Penicillin G-Behandlung beobachtet (Abbildung 5B). Lechner et al. (2012) und Singh et al., (2009) beschrieben für Staph. aureus das Vorkommen von SCVs im Zusammenhang mit der Bildung von Persistern nach Aminoglykosidbehandlung. In vitro wurden SCVs selektiert, nachdem Staph. aureus mit Antibiotika, vor allem Aminoglykosiden, behandelt wurde (Balwit et al., 1994; Massey et al., 2001; Miller et al., 1980; Musher et al., 1977; Sadowska et al., 2002; Schaaff et al., 2003; Wise und Spink, 1954). Diese Veränderung hinsichtlich der Koloniegröße und der Geschwindigkeit des Koloniewachstums deutet auf die Fähigkeit von S. suis-Stamm 10 zur Ausbildung von SCVs hin, welche durch Gentamicin selektiert werden. Weiterhin kann die Vermutung angestellt werden, dass es sich bei SCVs um Persisterzellen bzw. um ehemalige Persisterzellen handelt, die langsam wieder den Status regulärer Zellen einnehmen. Dies könnte auch eine Erklärung für das langsame Wachstum von SCVs sein und deutet auf ein allmähliches “Wiederbeleben“ dormanter Bakterienzellen. SCVs werden häufig in Krankenhäusern in Folge von wiederaufkeimenden Infektionen isoliert und in Verbindung mit persistierenden und rezidivierenden Infektionen gebracht (von Eiff, 2008; Proctor et al., 2006). Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den während rezidivierender Infektionsgeschehen isolierter SCVs um (ehemalige) Persisterzellen handelt, was zusätzlich das Versagen von Antibiotikabehandlungen erklären würde. Für die Aufnahme von Aminoglykosiden in die Bakterienzelle ist die protonenmotorische Kraft (engl.: proton motive force, PMF) nötig (Taber et al., 1987). Allison et al. (2011) stellten fest, dass die Hemmung der PMF durch den ProtonenIonophor CCCP in einer erhöhte Überlebensrate von Staph. aureus nach Gentamicinbehandlung resultierte. Eine CCCP-Vorbehandlung von S. suis-Stamm 157 Diskussion 10 führte ebenfalls zu einer verstärkten Toleranz gegenüber Gentamicin im Vergleich zu unbehandelten Bakterien (Abbildung 7). Allerdings war die Erhöhung der Gentamicintoleranz nach CCCP-Behandlung nicht so stark ausgeprägt, wie sie Allison et al. (2011) für Staph. aureus beschrieben. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass in S. suis-Stamm 10 die PMF für die Aufnahme von Gentamicin ebenfalls eine Rolle spielen könnte. Jedoch scheinen weitere Mechanismen für die Aufnahme von Gentamicin bzw. für dessen Wirksamkeit in S. suis-Stamm 10 zu existieren. Durch den Vergleich der Persisterbildung der isogenen Stoffwechselmutanten 10∆AD, 10∆ccpA, 10∆flpS und 10∆arcD mit dem WT sollte untersucht werden, welche Gene bzw. Genprodukte an der Persisterbildung von S. suis-Stamm 10 beteiligt sein könnten (Abbildung 8). Die Überlebenskinetiken der exponentiell gewachsenen Bankterien zeigten, dass die Mutante 10∆AD höhere Persisterzelllevel als der WT und die anderen Mutanten aufwies (Abbildung 8A). Die AD (ArgininDeiminase) stellt das erste Enzym des ADS dar, das durch das Gen arcA kodiert wird. Das ADS ist ein alternativer Stoffwechselweg in S. suis, das durch die Verstoffwechselung von Arginin ATP produziert. Ein Protonengradient, der die PMF aufrecht erhält (Mitchell, 2011), kann durch die Hydrolyse von ATP erzeugt werden. Die höchste Gentamicin-Toleranz der AD-Mutante könnte somit darauf deuten, dass das ADS auch in der exponentiellen Wachstumsphase eine basale Aktivität innehat. Mit dem Ausschalten des ADS in der AD-Mutante käme auch die basale Aktivität und die damit einhergehende ATP-Produktion zum Erliegen, was eine Verringerung der PMF und somit eine verminderte Aufnahme von Gentamicin zur Folge hätte und in einer erhöhten Gentamicin-Toleranz resultieren würde. Eine andere Erklärung für die erhöhte Gentamicin-Toleranz der AD-Mutante könnte sein, dass durch das Ausschalten des ADS S. suis in einen zusätzlichen Stresszustand gerät. Die Mutation des ADS bedeutet den Verlust eines kompletten Stoffwechselweges. Die dadurch bedingte Stresssituation könnte den im Vergleich zum WT erhöhten Persisterzelllevel erklären. Aus der Wachstumskinetik in Abbildung 1A wird ersichtlich, dass die Mutante 10∆AD im Vergleich zum WT und zu den anderen Stoffwechselmutanten (10∆ccpA, 10∆flpS und 10∆arcD) ein verlangsamtes Wachstum und keinen typischen exponentiellen Wachstumsanstieg in Flüssigkultur 158 Diskussion aufweist, was auf die verminderte ATP-Bildung und eine geringere Stoffwechselaktivität zurückzuführen sein könnte. Die verminderte Wachstumsrate der Mutante 10∆AD könnte ebenfalls die verstärkte Gentamicintoleranz erklären. Die Überlebenskinetik exponentiell gewachsener Bakterien zeigte weiterhin, dass die Mutante 10∆ccpA sensibler als der WT auf Gentamicin reagierte (Abbildung 8A). Durch die Mutation des ccpA kommt es zur Aufhebung der Repression des normalerweise in der exponentiellen Wachstumsphase durch das CcpA indirekt reprimierte ADS (Willenborg et al., 2014). Die Aufhebung der Repression führt dazu, dass das ADS in der exponentiellen Wachstumsphase als zusätzlicher Stoffwechselweg und somit als ATP-Lieferant zur Verfügung steht. Der Zusatz an ATP könnte die PMF verstärken, was eine vermehrte Aufnahme von Gentamicin zur Folge hätte und ein verstärktes Abtöten der ccpA-Mutante erklären würde. Das CcpA fungiert auch als ein globales Regulatorprotein von S. suis-Stamm 10 (Willenborg et al., 2011), weshalb auch möglich ist, dass ein oder mehrere andere Gene, die unter der Regulation von CcpA stehen, in der Persisterbildung involviert sind. Da das CcpA auch die Expression Virulenz-assoziierter Gene reguliert, könnte ein Zusammenhang zwischen der Persistenz und Virulenz von S. suis-Stamm 10 bestehen. Aus den Überlebenskinetiken von stationär gewachsenen Bakterien wird ersichtlich, dass die Persisterzelllevel des WT und der Mutante 10∆flpS in etwa auf das Level der Mutante 10∆AD anstiegen (Abbildung 8B). Bemerkenswert ist, dass der WT im Gegensatz zur AD-Mutante ein funktionierendes ADS hat, sich die Anzahl der Persisterzellen von WT und AD-Mutante aber auf einem Niveau bewegen. Das ADS, dessen Repression in der stationären Wachstumsphase aufgehoben ist, scheint somit nicht den stressbedingten Anstieg des Persisterzelllevels in der stationären Wachstumsphase zu beeinflussen. Vielmehr scheinen die in der stationären Wachstumsphase allgemein verringerte Wachstumsrate und die dort herrschenden Stressbedingungen die verstärkte Gentamicintoleranz zu verursachen. Die Persisterzelllevel der ccpA-Mutante und der arcD-Mutante waren im Vergleich zum WT erniedrigt. Die Tatsache, dass die Repression des ADS durch das CcpA in der stationären Wachstumsphase aufgehoben ist, führt zu der Annahme, dass das ADS in der stationären Wachstumsphase für die Ausbildung von Persisterzellen eine 159 Diskussion untergeordnete Rolle spielt und unterstützt die Vermutung, dass weitere Gene, die unter der Regulation von CcpA stehen, an der Persisterbildung beteiligt sind. Für E. coli wurden ebenfalls diverse Gene mit globaler Regulatorfunktion beschrieben, deren Ausschalten zu einem Abfall des Persisterzelllevels führte (Hansen et al., 2008) und für S. gordonii wurde festgestellt, dass durch die Inaktivierung von ccpA eine antibiotikumtolerante Mutante wieder fast komplett empfänglich gegenüber Penicillin wurde (Bizzini et al., 2007). Da die regulatorische Tätigkeit des CcpA an die Glukoseverfügbarkeit geknüpft ist, wäre eine Verbindung von Antibiotikatoleranz und Zuckermetabolismus denkbar. Der erniedrigte Persisterzelllevel der arcD-Mutante im Vergleich zum WT lässt sich auf Anhieb nicht erklären. Das arcD-Gen kodiert für einen putativen Arginin-Ornithin-Antiporter, der durch den Import von Arginin dem ADS zusätzlich Substrat liefern könnte (Fulde, Dissertation, 2007; Gruening, Dissertation, 2004). In Anbetracht der Theorie, dass ein Antiportersystem ebenfalls einen Protonengradient erzeugen und dadurch die PMF aufrechterhalten kann, was die Aufnahme von Gentamicin begünstigt, würde der Umkehrschluss bedeuten, dass in der arcD-Mutante die geringere PMF eine erniedrigte Gentamicinaufnahme und somit ein erhöhtes Überleben der Bakterien zur Folge hätte. Da die arcD-Mutante jedoch sensibler als der WT auf die Gentamicinbehandlung reagiert, scheint das Fehlen des putativen Antiporters noch weitere Auswirkungen zu haben. Evtl. begünstigt der Import von Arginin zusätzlich die Ausbildung von Persisterzellen. Trotz bestehender Unklarheiten verdeutlichen die Ergebnisse, dass das ADS und mit ihm assoziierte Genprodukte an der Persisterbildung von S. suis-Stamm 10 beteiligt zu sein scheinen. Der genaue zugrunde liegende Mechanismus bedarf jedoch weiterer Abklärung. Auffällig war, dass der Persisteranteil der 10∆flpS-Mutante sich weder in der exponentiellen noch in der stationären Wachstumsphase wesentlich vom Persisteranteil des WT unterschied. Das bedeutet einerseits, dass das FlpS keine Rolle in der Persisterbildung zu spielen scheint, andererseits konnte gezeigt werden, dass das Einbringen einer Spectinomycinresistenz keinen Einfluss auf die Persisterbildung infolge der Gentamicinbehandlung zu haben scheint, da die 10∆flpS-Mutante durch die Insertion einer Spectinomycinresistenzgenkassette erzeugt wurde. Somit kann auch 160 ein Einfluss der inserierten Diskussion Spectinomycinresistenzgenkassette in der 10∆AD-Mutante auf die Persisterbildung ausgeschlossen werden. Für den WT und für alle Mutanten war jedoch eindeutig, dass stationär gewachsene Bakterien im Vergleich zu exponentiell gewachsenen Bakterien allgemein höhere Persisterzelllevel aufwiesen, was die Annahme unterstützt, dass die Wachstumsphase von S. suis-Stamm 10 allgemein einen großen Einfluss auf die Bildung von Persisterzellen hat, und dass die Stressbedingungen in der stationären Wachstumsphase die Persisterzellbildung begünstigen. Der Vergleich der drei S. suis-Stämme 10, A3286/94 und 05ZYH33 ergab, dass es sich bei der Antibiotikatoleranz von S. suis nicht um ein Stamm 10-spezifisches Phänomen handelt, da alle drei Stämme eine wachstumsphasenabhängige Gentamicintoleranz und eine biphasische Überlebenskinetik exponentiell gewachsener Bakterien aufwiesen (Abbildung 9A und 9B). Allerdings scheint der Grad der Wachstumsphasenabhängigkeit innerhalb der Stämme zu variieren. Evtl. beeinflussen stammspezifische Eigenschaften die Entwicklung von dormanten Stadien. Die Ergebnisse deuten darauf, dass die Ausbildung von antibiotikatoleranten Persistern innerhalb der Spezies S. suis allgemein weit verbreitet zu sein scheint, wobei diese Vermutung durch Untersuchung weiterer S. suis-Stämme und Antibiotika überprüft werden muss. Die vermutlich antibiotikumabhängige Vielfachtoleranz von S. suis-Stamm 10 und die stammübergreifende Toleranz gegenüber Gentamicin führten zur der Annahme, dass bestimmten Antibiotikaklassen ein allgemeiner Mechanismus der Toleranzausbildung zugrunde liegt. Deshalb wurde überprüft, ob weitere Spezies innerhalb der Gattung Streptococcus eine Antibiotikatoleranz unter den für S. suis in dieser Arbeit beschriebenen Bedingungen aufweisen (Abbildung 10). S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 wurden durch die 100fache MHK von Gentamicin bereits nach 1 h auf ein nicht detektierbares Level abgetötet, während S. suis-Stamm 10 innerhalb von 6 h nur minimal abgetötet wurde (Abbildung 10A). Diese festgestellte Toleranz von S. suis gegenüber Gentamicin lässt einen gleichen genetischen Hintergrund innerhalb der Gattung Streptococcus ausschließen und führt zu der Annahme, dass es im Zuge der Evolution zumindest 161 Diskussion nach Betrachtung der hier untersuchten Stämme zu einer Modifikation der Zielmoleküle des Gentamicins speziell in S. suis gekommen sein könnte. Um diese Vermutung weiter zu verifizieren, müsste die Toleranz von S. suis gegenüber weitere Aminoglykoside getestet werden. Im Gegensatz zur Behandlung mit Gentamicin wurde für alle untersuchten Spezies eine Toleranz gegenüber einer Behandlung mit der 100-fachen MHK von Ciprofloxacin festgestellt (Abbildung 10B). Inwiefern es sich bei der Ciprofloxacin-Toleranz von S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenes-Stamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313 tatsächlich um eine Persistenz handelt, müsste in weiteren Versuchen abgeklärt werden. Evtl. begünstigt der spezielle Wirkmechanismus des Ciprofloxacins, also die Fluorochinolon-vermittelte SOSAntwort, auch die Bildung von Persisterzellen in S. gordonii-Stamm 30, S. pyogenesStamm A40 und S. agalactiae-Stamm 6313. In dem Versuch zum Spezies-Vergleich wurden ÜNK, also Bakterien aus der späten stationären Wachstumsphase eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Bakterien in der ÜNK extremen limitierenden Bedingungen, also Stress, ausgesetzt sind. Das minimale Abtöten von S. suis-Stamm 10 durch Gentamicin unterstützt demzufolge die Theorien, dass es unter Stressbedingungen zur Bildung von Persisterzellen kommt, und dass eine Kultur mit stationär gewachsenen Bakterien aus Persisterzellen besteht. Des Weiteren wurde deutlich, dass eine verstärkte Antibiotikatoleranz wahrscheinlich nicht nur in der Spezies S. suis, sondern evtl. in weiteren Vertretern der Gattung Streptococcus auftritt. Nach allen bisherigen experimentellen Erkenntnissen aus den in-vitro-Versuchen stellt sich die Frage nach der Relevanz von S. suis-Persisterzellen in vivo. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kolonisierungsrate von Schweinen mit S. suis annähernd 100% beträgt (Brisebois et al., 1990; MacInnes et al., 2008; Varela et al., 2013), und dass durch die Behandlung mit Penicillin, Ampicillin oder Ceftiofur keine Eliminierung von mit S. suis besiedelter Tonsillen in Schweinen erreicht wurde (Amass et al., 1996), liegt die Vermutung nahe, dass die Persisterzellbildung von S. suis zur Problematik des Versagens von Antibiotikatherapien beitragen könnte. Da S. suis in der Lage ist, in vitro Biofilme zu bilden, die eine Antibiotikabehandlung tolerieren (Bonifait et al., 2008; Olson et al., 2002), ist außerdem möglich, dass 162 Diskussion Persisterzellen einen Teil von S. suis-Biofilmen ausmachen. Für P. aeruginosa wurden Persisterzellen als Hauptpopulation, die eine Antibiotikatoleranz in Biofilmen verursacht, beschrieben (Spoering und Lewis, 2001). Allerdings fehlen für S. suis bisher die Beweise für die Bildung von Persisterzellen und Biofilmen in vivo. Da allgemein eine bakterielle Persistenz und eine Zunahme der Antibiotikatoleranz in Zusammenhang mit wiederkehrenden bakteriellen Infektionen gebracht wird und speziell eine S. suis Serotyp 2-Infektion als ursächlich für einen wiederkehrenden septischen Schock beim Menschen beschrieben wurde (Francois et al., 1998), kann der Bildung von Persisterzellen durch S. suis vermutlich eine klinische Relevanz zugeschrieben werden. 5.2 Wachstumsphasenabhängige Wechselwirkung von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten Da es während des bakteriellen Wachstums zu einer differentiellen Ausprägung der bakteriellen Oberflächenstruktur kommen kann, wurde die Assoziation von S. suis mit porzinen CD14-positiven Monozyten ebenfalls unter dem Aspekt der Wachstumsphasenabhängigkeit untersucht. Im Gegensatz zu vorherigen Studien wurden in dieser Arbeit die Assoziationsstudien zur Überprüfung der Trojan horse theory zum ersten mal mit affinitätsaufgereinigten, naïven Monozyten im BatchVerfahren durchgeführt. Hierfür wurden die Monozyten nach Gewinnung der MNCs per Dichtegradientenzentrifugation immunomagnetisch angereichert. über Der den Anteil der Oberflächenmarker gewünschten CD14 präparierten Zellpopulationen gemessen an den gesamten durchflusszytometrisch erfassten Zellen (Abbildung 11A und 12A) und der Anteil vitaler Zellen (Abbilung 11B und 12B) betrug jeweils über 90%. Dies deutete auf effiziente Zellpräparationen mit einem geringen zellschädigenden Einfluss. Die Monozytenpopulation innerhalb der gewonnenen MNCs und nach Anreicherung über das Oberflächenmolekül CD14 wurde hinsichtlich der Expression des Panmonozytenmarkers CD172a und der Reifegrad-Marker CD14 und CD163 charakterisiert (Abbildung 11C, 11D und 11E; Abbildung 12C und 12D). Die Monozyten vor und nach Anreicherung wurden 163 Diskussion basierend auf der Einteilung der Monozyten von Chamorro et al. (2005) dem Subset III zugeordnet. Die in den weiteren Versuchen eingesetzten Monozyten exprimieren somit CD172a, CD14 und CD163, wobei sich je nach Stärke der Expression von CD14 und CD163 die Monozytensubpopulation CD14high CD163low und CD14low CD163high unterscheiden ließen. Die Subpopulation CD14high CD163low machte etwa ein Drittel und die Subpopulation CD14low CD163high rund zwei Drittel der Gesamtmonozyten aus (Anhang, Tabelle 5). Für in Suspension befindliche porzine CD14-positive Monozyten kann eine grundsätzliche Antikörper-vermittelte Phagozytosefähigkeit angenommen werden, da sie mit Latexbeads assoziierten, die mit porzinen IgG beladen wurden. Eine Internalisation konnte zwar nicht sicher bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen werden (Abbildungen 13D, 13E und 13F). Für die Phagozytose der Latexbeads scheinen jedenfalls grundsätzlich porzine Komponenten nötig zu sein, da unbehandelte Latexbeads kaum mit den Monozyten assoziierten (Abbildungen 13A, 13B und 13C). Die Latexbeads wiesen einen Durchmesser von 1 µm auf, was in etwa der Größe von S. suis entspricht und somit auch eine Phagozytosefähigkeit von S. suis wahrscheinlich macht. Für die folgenden Infektionsexperimente wurde zunächst die Überlebensfähigkeit der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in Anwesenheit der porzinen CD14positiven Monozyten überprüft. S. suis-Stamm 10 replizierte sich in Anwesenheit einer dreistündigen Ko-Inkubation mit den in Suspension befindlichen Monozyten etwa dreimal und die S. suis-Stämme 10∆cps und A3286/94 rund viermal, was einer Generationszeit von ungefähr 60 min bzw. 45 min entspricht (Abbildung 14). Somit ist offensichtlich, dass die S. suis-Stämme im Batch-Verfahren und unter den etablierten Versuchsbedingungen sehr gut in der Lage sind, in Anwesenheit der Monozyten zu überleben und sich sogar zu vermehren. Der Vergleich der Stämme 10 und A3286/94 bezüglich der Assoziationsfähigkeit sollte einen eventuellen Hinweis auf die unterschiedliche Interaktion der beiden Stämme mit porzinen CD14-positiven Monozyten liefern. In den Plattierungsversuchen wiesen Stamm 10 und 10∆cps aus der stationären Wachstumsphase und Stamm A3286/94 aus der exponentiellen Wachstumsphase 164 Diskussion eine höhere relative Assoziation auf. Die relative Assoziation betrug für alle Stämme über 100%, außer für die cps-Mutante aus der exponentiellen Wachstumsphase (rund 80%) (Abbildung 15). Eine relative Assoziation über 100% bedeutet, dass es mit der Vermehrung der Bakterien auch zu einer Erhöhung der Assoziation kam und lässt vermuten, dass eine Vermehrung bereits mit Monozyten assoziierter Bakterien stattfand. Dieses Ergebnis bestätigt zudem die ermittelte hohe Überlebensfähigkeit der Stämme in Anwesenheit der Monozyten. Die vergleichsweise geringe Assoziation der exponentell gewachsenen cps-Mutante könnte einerseits bedeuten, dass bei bestehender Vermehrungsfähigkeit die Assoziationsfähigkeit reduziert war oder andererseits, dass die Vermehrungs- bzw. Überlebensfähigkeit zumindest in der einstündigen Ko-Inkubation im Vergleich zu den anderen Stämmen bzw. zu Bakterien aus der stationären Wachstumsphase durch die Anwesenheit der Monozyten eingeschränkt war. Die von Segura und Gottschalk (2002) ermittelten Assoziationswerte von S. suis mit adhärenten Makrophagen von nur etwa 1% waren somit deutlich niedriger als die Assoziation von S. suis mit Monozyten in Suspension. Die umgekehrte Wachstumsphasenabhängigkeit von Stamm 10 (WT und 10∆cps) und A3286/94 spiegelt sich auch im Vermehrungsfaktor dieser Stämme nach einstündiger Inkubation in RPMI-Medium ohne Monozyten wider (Anhang, Abbildung 25). Dies deutet darauf, dass wachstumsphasenabhängige Assoziationsunterschiede auch auf einen Mengeneffekt bedingt durch die unterschiedlichen Teilungsraten von exponentiell bzw. stationär gewachsenem Stamm 10 bzw. A3286/94 zurückzuführen sein könnten. Für S. pyogenes wurde eine wachstumsphasenabhängige Expression von Faktoren beschrieben, die die Adhärenz während des Infektionsgeschehens verstärken oder reduzieren (Kreikemeyer et al., 2003). Ob die hier in den Plattierungsversuchen ermittelte wachstumsphasenabhängige Assoziation von S. suis mit den porzinen Monozyten ebenfalls auf eine unterschiedliche Expression von Adhäsinen oder auf einen Mengeneffekt zurückzuführen ist, bedarf weiterer Abklärung. Des Weiteren wird vermutet, dass S. suis die Kapselexpression zur besseren Adhäsion an die Wirtszellen herunterreguliert und im Blut zur Sicherstellung des Phagozytoseschutzes wieder heraufreguliert (Fittipaldi et al., 2012; Gottschalk und Segura, 2000). Willenborg et al. (2011) konnten feststellen, 165 Diskussion dass in stationär gewachsenem S. suis das in die Kapselsynthese involvierte Gen cps2A im Vergleich zu exponentiell gewachsenem S. suis herunterreguliert war. Eine in der stationären Wachstumsphase herunterregulierte Expression von Kapselgenen ermittelten Sitkiewicz und Musser (2009) auch für S. agalactiae. TEM-Aufnahmen zeigen jedoch, dass die S. suis-Stämme 10 und A3286/94 sowohl in der exponentiellen, als auch in der frühen stationären und in der späten stationären (24 h-Kultur) Wachstumsphase die jeweils gleiche Kapseldicke aufwiesen (Anhang, Abbildung 23). Dies deutet darauf, dass die Regulation der Kapselgenexpression keinen unmittelbaren Einfluss auf die tatsächliche Kapseldicke hat. Außerdem wäre möglich, dass für eine Variation der Kapseldicke ein Kontakt mit Wirtszellen, wie z. B. Monozyten, nötig ist. Für die durchflusszytometrische Analyse der Assoziation wurde zunächst eine effiziente Markierung von nahezu 100% aller drei S. suis-Stämme aus beiden Wachstumsphasen mit dem Fluoreszenzfarbstoff CFSE bestätigt (Abbildung 16A bis 16C und Anhang, Abbildung 30). Die durchflusszytometrische Erfassung fluoreszierender Monozyten bestätigte die hohe Assoziation der CFSE-markierten S. suis-Stämme mit den porzinen CD14-positiven Monozyten (Abbildung 16D bis 16K). Allerdings scheint nicht die gesamte Monozytenpopulation mit S. suis assoziiert zu sein, da jeweils ein gewisser Monozytenanteil nicht fluoreszierte. Evtl. handelt es sich hierbei um eine Monozytensubpopulation, die eine geringere Assoziationsfähigkeit aufweist. Die Plattierungsversuche zeigten, dass Stamm 10 allgemein eine höhere Assoziation mit den Monozyten als Stamm 10∆cps und A3286/94 aufwies. Im Gegensatz dazu ergab die durchflusszytometrische Analyse, dass mehr Monozyten mit Stamm 10∆cps und A3286/94 als mit Stamm 10 assoziiert waren. Diese Diskrepanz lässt sich aus der unterschiedlichen Methodik zur Erfassung der Assoziation erklären, denn einerseits wurde die Anzahl der assoziierten Bakterien erfasst und andererseits die Anzahl der Monozyten, die eine Assoziation mit Bakterien aufwiesen. Die durch Ausplattieren im Vergleich zur durchflusszytometrischen Analyse ermittelte höhere Assoziation von Stamm 10 lässt vermuten, dass es zu einer stärkeren Vermehrung bereits assoziierter Bakterien dieses Stammes kommt, und dass im Vergleich zu Stamm 10∆cps und A3286/94 166 Diskussion mehr Bakterien pro Monozyt assoziieren. Busque et al. (1998) ermittelten durchflusszytometrisch ebenfalls eine hohe Assoziation von bis zu 90% von S. suis mit humanen und porzinen Granulozyten und Monozyten. Diese Arbeitsgruppe interpretierte die Assoziation als eine Phagozytose der Bakterien, obwohl nicht auszuschließen ist, dass es sich bei den assoziierten Bakterien auch um adhärente Bakterien handeln könnte. Durch Visualisierung mittels der Doppelimmunfluoreszenz (DIF) konnte die hohe Assoziation der drei S. suis-Stämme mit den porzinen CD14-positiven Monozyten nach einstündiger Ko-Inkubation bestätigt werden (Abbildungen 17). Auffällig war, dass Stamm 10 regelrechte Bakterienzellverbände bildete, die mit den Monozyten assoziiert waren und die diese sogar teilweise umschlossen (Abbildung 17A). Dagegen waren die Kapselmutante 10∆cps und Stamm A3286/94 eher gleichmäßig mit den Monozyten assoziiert (Abbildung 17B und 17C). Dieses mikroskopische Bild bestätigt die Vermutung, dass es bei Stamm 10 zu einer verstärkten Vermehrung bereits assoziierter Bakterien kommt, und dass von Stamm 10 im Vergleich zur Kapselmutante 10∆cps oder zu Stamm A3286/94 mehr Bakterien pro Monozyt assoziieren. Die unterschiedliche Akkumulation der Bakterien könnte durch das Vorhandensein der Kapsel und deren Struktur bedingt sein. Einerseits wäre denkbar, dass die Kapseldicke einen Einfluss auf die Akkumulation der Bakterien hat. TEMAufnahmen zeigten, dass Stamm 10 eine dickere Kapsel als Stamm A3286/94 hat (Anhang, Abbildung 23), und zwar unabhängig von der Wachstumsphase. Der Mutante 10∆cps fehlt die Kapsel komplett. Da Smith et al. (2000) Sialinsäure als Kapselbestandteil für Serotyp 2, aber nicht für Serotyp 9 nachweisen konnten, könnte die in der Kapsel vorhandene Sialinsäure für die dickere Kapsel von Stamm 10 verantwortlich sein und dadurch ebenfalls zur verstärkten Akkumulation von Stamm 10 beitragen. Eine Sialinsäure-defiziente S. suis Serotyp 2-Mutante, in der das für die Sialinsäuresynthese involvierte Gen neuB ausgeschaltet wurde, besitzt eine um etwa 20% reduzierte Kapselproduktion (Lecours et al., 2012; Segura, 2012). Diese Kapselreduktion entspricht ungefähr dem Wert, um den die Kapseldicke von S. suis-Stamm A3286/94 (Serotyp 9) im Vergleich zu S. suis-Stamm 10 (Serotyp 2) reduziert ist (Anhang, Abbildung 23). Die Theorie der verstärkten Assoziation von 167 Diskussion Stamm 10 bedingt durch das Vorhandensein der Sialinsäure wird unterstützt durch die Ergebnisse von Segura und Gottschalk (2002), die beschrieben, dass Sialinsäure die Adhärenz von S. suis Serotyp 2 an murine Makrophagen fördert. Durch die DIF wurde außerdem ersichtlich, dass es sich bei der Assoziation von S. suis mit den porzinen CD14-positiven Monozyten hauptsächlich um eine Adhärenz handelt. Nur die Kapselmutante 10∆cps kam in geringen Mengen intrazellulär in den Monozyten vor (Abbildung 17B, Pfeil). Dieses Ergebnis geht konform mit der Erkenntnis, dass die Kapsel vor Phagozytose schützt, und dass kapsellose Mutanten verstärkt phagozytiert werden (Charland et al. 1996, Smith et al., 1999). Um die Internalisationsfähigkeit der Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 näher zu untersuchen, wurde ein Daptomycin protection assay (DPA) durchgeführt. Das Antibiotikum Daptomycin wurde zum Abtöten der extrazellulären Bakterien eingesetzt, da es sich als einziges von den getesteten Antibiotika als bakterizid erwies (Abbildung 2A und 2B). Außerdem wurde die Infektionszeit der Monozyten mit den Bakterien von 1 h auf 3 h erhöht, um die Anzahl intrazellulärer Bakterien bei einer evtl. bestehenden Internalisationsfähigkeit zu erhöhen. Die Internalisationswerte aller drei Stämme waren allgemein jedoch so gering, dass sie außerhalb eines vertrauenswürdigen Detektionslevels lagen (Abbildung 18). Der DPA bestätigte somit die sehr geringe Internalisation der drei untersuchten S. suisStämme durch porzine CD14-positive Monozyten. Dies steht in Kontrast zur ermittelten effektiven Phagozytose kapselloser S. suis-Stämme durch murine (Segura et al., 1998) oder porzine (Smith et al., 1999) Makrophagen, was darauf hindeutet, dass ausgereifte Makrophagen eine größere Phagozytoseleistung als naïve Monozyten besitzen. Da die Ergebnisse aus dem DPA und der DIF nur sehr ungenaue Ergebnisse bezüglich des intrazellulären Vorhandenseins von S. suis lieferten, wurden TEMAufnahmen erstellt, die einen genauen Aufschluss darüber geben sollten, ob S. suis nach Infektion intrazellulär in den porzinen CD14-positiven Monozyten vorkommt (Abbildung 19). Nach zweistündiger Infektion konnten per TEM-Aufnahmen die Kapselmutante 10∆cps, die Suilysin-defiziente Mutante 10∆sly und Stamm A3286/94 intrazellulär in den Monozyten nachgewiesen werden (Abbildung 19B bis 19E), 168 Diskussion allerdings waren intrazelluläre Nachweise nur sehr selten. Für den WT von Stamm 10 konnte wahrscheinlich aufgrund des allgemein seltenen intrazellulären Vorkommens in diesem Experiment ebenfalls kein eindeutiger Nachweis für das intrazelluläre Vorhandensein in Monozyten erbracht werden. Für den WT kann jedoch aufgrund des intrazellulären Nachweises der anderen Stämme ebenfalls eine intrazelluläre Lokalisation in Monozyten vermutet werden. Übersichtsaufnahmen von Stamm 10 und der Kapselmutante 10∆cps bestätigten jedoch die hohe Assoziation von S. suis mit den Monozyten (Abbildung 19A und 19B). Die Assoziation von in Ketten angeordneter Bakterien von Stamm 10 mit den Monozyten unterstützt die Vermutung, dass es zu einer Vermehrung bereits assoziierter Bakterien kommt (Abbildung 19A). Die Übersichtsaufnahmen des WT und der Kapselmutante 10∆cps zeigen, dass es neben der Assoziation von S. suis auch zu einer Schädigung der Monozyten kam (Abbildung 19A und 19B). Ein Grund für die Schädigung der Monozyten könnte die zytolytische Aktivität des von S. suis sezernierten Exotoxins Suilysin sein. Demzufolge wäre denkbar, dass eine Internalisation von Stamm 10 ebenso durch das sezernierte Suilysin beeinträchtigt wird. Auffällig war, dass um die Suilysinmutante 10∆sly und um Stamm A3286/94 eine Vakuolisierung des Monozyten erkennbar war (Abbildung 19D und 19E). Dies deutet auf eine Aufnahme der Bakterien in Phagolysosomen. Außerdem kamen zwei oder mehrere Bakterien in einem Phagolysosom vor, was vermuten lässt, dass mehrere oder in Ketten vorliegende Bakterien auf einmal phagozytiert werden können. Die Tatsache, dass die phagozytierten Bakterien noch eine Kapsel aufwiesen, bedeutet, dass die Kapsel eine Phagozytose nicht grundsätzlich verhindert. In der Detailaufnahme der phagozytierten Kapselmutante 10∆cps war keine Vakuolisierung des Monozyten um die Bakterien zu erkennen (Abbildung 19C). Der Grund hierfür könnte das Fehlen der Kapsel sein und lässt auf einen dadurch bedingten anderen Internalisierungsprozess schließen. Um den Einfluss der S. suis-Stämme 10, 10∆cps, 10∆sly und A3286/94 auf die porzinen CD14-positiven Monozyten nach dreistündiger Infektion näher zu untersuchen, wurden die Monozyten durchflusszytometrisch hinsichtlich Veränderungen in der Morphologie (Abbildung 20A bis 20E) und Vitalität (Abbildung 169 Diskussion 20F bis 20J) untersucht. Allgemein ließ sich feststellen, dass der Anteil an vitalen Zellen umso geringer war, je größer die morphologischen Veränderungen der Monozyten waren. Den größten Einfluss auf die Morphologie und die Vitalität der Monozyten hatte eine Infektion mit der Kapselmutante 10∆cps, gefolgt von Stamm 10, Stamm A3286/94 und der Suilysinmutante 10∆sly. Die Ergebnisse deuten auf eine sehr hohe Interaktion von porzinen CD14-positiven Monozyten mit der Kapselmutante 10∆cps. Der geringe Einfluss der Suilysinmutante 10∆sly auf die Morphologie und Vitalität der Monozyten unterstützt die Vermutung, dass das Suilysin für die Schädigung der Monozyten verantwortlich ist und erklärt den schädigenderen Einfluss der Suilysin-positiven Stämme. Allerdings war der Grad der Schädigung unterschiedlich stark ausgeprägt. Demzufolge wurde untersucht, ob der unterschiedliche Schädigungsgrad der Monozyten durch unterschiedliche Mengen an sezerniertem Suilysin bedingt sein könnte (Abbildung 21). Mittels Immunoblot war nach dreistündiger Infektion der Monozyten mit Stamm 10 eine deutlich größere Suilysinmenge im Überstand nachweisbar als nach Infektion mit Stamm A3286/94. Nach Infektion mit der Suilysin-defizienten Mutante 10∆sly war wie erwartet kein Suilysin nachweisbar. Das durch die Stämme 10, A3286/94 und 10∆sly in unterschiedlichen Mengen sezernierte Suilysin korreliert mit dem unterschiedlichen Schädigungsgrad der Monozyten nach Infektion mit diesen drei Stämmen. Die von Stamm 10 vergleichsweise stärkste Sezernierung von Suilysin geht mit der Vermutung konform, dass das Suilysin zusätzlich die Internalisation von Stamm 10 beeinflussen könnte. In der Literatur wurde beschrieben, dass Suilysin-positive Stämme von dem zytotoxischen Effekt, den sie auf murine Makrophagen und porzine neutrophile Granulozyten haben, zu profitieren scheinen (Chabot-Roy et al., 2006; Segura und Gottschalk, 2002). Des Weiteren wurde berichtet, dass das Suilysin die Phagozytose und das Abtöten der Bakterien durch porzine neutrophile Granulozyten und MNCs zu reduzieren scheint (Benga et al., 2008; Chabot-Roy et al., 2006). Der höchste Grad der Schädigung der Monozyten durch die Kapselmutante 10∆cps korreliert allerdings nicht mit der ermittelten sezernierten Suilysinmenge, da diese im Vergleich zur sezernierten Suilysinmenge von Stamm 10 geringer war. Der Grund für die unterschiedlichen Suilysinmengen von WT und Kapselmutante 10∆cps bedarf 170 Diskussion weiterer Abklärung. Es wäre beispielsweise möglich, dass das Suilysin-Molekül nach Sekretion eine Wechselwirkung mit der Bakterienoberfläche eingeht. Bei der Kapselmutante 10∆cps könnte die Wechselwirkung durch die Veränderung der Oberflächenstruktur in der Hinsicht beeinflusst sein, dass es z. B. zu einer verstärkten Bindung des Suilysins auf der Bakterienoberfläche kommen könnte. Dies würde den geringeren Suilysinnachweis im Überstand und den schädigenderen Einfluss der Kapselmutante 10∆cps auf die Monozyten erklären. Das Fehlen der Kapsel könnte durch Exponierung der Oberflächenproteine auch zu einer allgemein stärkeren Interaktion mit den Monozyten führen, was ebenfalls die starke Reaktivität und Schädigung der Monozyten erklären könnte. Die Wechselwirkung von WT und Kapselmutante 10∆cps mit den porzinen CD14positiven Monozyten wurde zusätzlich durch die Bestimmung von reaktiven Sauerstoff-Spezies (engl.: reactive oxygen species, ROS) näher untersucht (Abbildung 22). Während die Stimulation mit der Kapselmutante 10∆cps einen signifikanten Anstieg der ROS-Produktion CD14-positiver Monozyten zur Folge hatte, führte die Stimulation mit dem WT nicht zu einer verstärkten ROS-Produktion (Abbildung 22A). Die fehlende ROS-Stimulation durch den WT lässt vermuten, dass der Kapsel eine Schutzfunktion zukommt, die S. suis vor antibakterieller Aktivität der Monozyten schützt, und dass zwischen den porzinen CD14-positiven Monozyten und der Kapselmutante 10∆cps eine intensive Interaktion stattfindet, die über eine Adhärenz der Bakterien an die Monozyten hinausgeht. Da die Kapselmutante 10∆cps bis auf die fehlende Kapsel wie der WT ausgestattet ist und somit auch keine stoffwechselbedingten Unterschiede zwischen diesen beiden Stämmen zu erwarten sind, ist der Grund für die verstärkte Interaktion wahrscheinlich die Kapseldefizienz. Diese Interaktion ist womöglich auch verantwortlich für die Veränderungen der Morphologie der Monozyten und deren Vitalitätsverlust. Tanabe et al. (2010) beschrieben dazu passenderweise, dass eine kapsellose S. suis-Mutante eine verstärkte Zytokinproduktion durch Makrophagen induzierte und vermuteten, dass das Fehlen der Kapsel Bestandteile der Zellwand freilegt, was zu einer Stimulation der Makrophagen führte. Die MNCs, deren Hauptpopulation nicht-phagozytierende Lymphozyten ausmachen, konnten wie erwartet nicht zur ROS-Produktion angeregt 171 Diskussion werden. Die Histogrammdarstellungen verdeutlichten zusätzlich die Stimulierbarkeit der Monozyten ausschließlich durch die Kapselmutante 10∆cps (Abbildung 22B und 22C). Interessanterweise zeigte diese Darstellung auch, dass die Kapselmutante 10∆cps die ROS-Produktion von nicht einmal der Hälfte der Monozytenpopulation induzierte. Mit einer verlängerten Infektionszeit käme es evtl. auch zu einer Zunahme der ROS-produzierenden Monozyten. Bei den Monozyten, die bereits nach einer Infektionszeit von nur 20 min eine gesteigerte ROS-Produktion aufweisen, handelt es sich möglicherweise um eine Monozytensubpopulation, die schneller auf einen Reiz reagiert, was evtl. durch einen höheren Reifegrad der Monozyten bedingt sein könnte. Ein weiterer Versuch zeigte, dass porzine Granulozyten allgemein stärker, sowohl durch die Kapselmutante 10∆cps als auch durch den WT, zur ROSProduktion angeregt werden konnten (Anhang, Tabelle 6). Dies deutet darauf, dass Granulozyten allgemein eine höhere phagozytotische Aktivität als Monozyten aufweisen. Fazit In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Wachstumsphase einen maßgeblichen Effekt auf die Eigenschaften von S. suis bezüglich der Ausbildung antibiotikumtoleranter Persister und der Assoziation mit in Suspension befindlicher porziner CD14-positiver Monozyten hat. Im Hinblick auf die Fähigkeit zur Antibiotikatoleranz und die dadurch vermittelte Persisterbildung wurde ersichtlich, dass eine stationär gewachsene S. suis-Kultur deutlich höhere Persisterzelllevel aufweist als eine exponentiell gewachsene Kultur, was durch limitierende Bedingungen in der stationären Wachstumsphase bedingt sein könnte, und darauf schließen lässt, dass S. suis-Stamm 10 Typ I-Persister bildet. Das ADS und das globale Regulatorprotein CcpA scheinen an der Persisterbildung beteiligt zu sein. Da das CcpA als ein globales Regulatorprotein gilt, ist möglich, dass in S. suis-Stamm 10 mehrere Gene, die unter der Regulation von CcpA stehen, an der Persisterbildung beteiligt sind. Um welche Gene es sich hierbei handelt, bedarf weiterer Untersuchungen. Da das CcpA die Expression Virulenzassoziierter Faktoren reguliert und seine Aktivität mit der Zuckerverfügbarkeit 172 Diskussion verknüpft ist, könnte ein Zusammenhang von Antibiotikatoleranz, Virulenz und Zuckermetabolismus bestehen. Inwiefern weitere Moleküle, wie z. B. TA-Module, im Zusammenhang mit der Persistenz von S. suis stehen, bedarf ebenfalls weiterer Abklärung. Trotz des Wissens, welche genetischen Elemente an der Persisterbildung beteiligt sind, bleibt unklar, wie genau der dormante Status der Bakterien hervorgerufen wird und welche Mechanismen zu einem “Wiederbeleben“ der dormanten Bakterien führen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die verlängerte Antibiotikatoleranz auch in den S. suis-Stämmen A3286/94 und 05ZYH33 und in den Spezies S. gordonii, S. pyogenes und S. agalactiae eine Rolle spielt, also allgemein ein weitverbreitetes Phänomen in der Familie Streptococcaceae zu sein scheint. Die Erforschung des Phänomens der Persisterbildung für S. suis erweist sich als sehr wichtig, da eine verminderte Antibiotikawirkung, die sogar nach Kombination verschiedener Antibiotikaklassen feststellbar war, klinisch relevant sein könnte. So könnten das Versagen von Antibiotikatherapien infizierter Schweine, die mangelnde antibiotische Eliminierung einer Kolonisation mit S. suis und rezidivierende Infektionen auf die Persisterbildung zurückzuführen sein. Mit einem besseren Verständnis zum Funktionieren der Persistenz lässt sich möglicherweise die Eliminierung von Persistern verbessern und somit evtl. auch die Behandlung von chronischen und rezidivierenden Erkrankungen. Im zweiten Ergebnisteil konnte gezeigt werden, dass S. suis im Batch-Verfahren eine sehr starke Assoziation mit CD14-positiven Monozyten aufweist. Stationär gewachsener S. suis-Stamm 10 und exponentiell gewachsener S. suis-Stamm A3286/94 assoziierten stärker mit den Monozyten als Bakterien aus der jeweils anderen Wachstumsphase. Diese Wachstumsphasenabhängigkeit spiegelt sich auch im Vermehrungsfaktor der beiden Stämme wieder, weshalb fraglich ist, ob die unterschiedliche Stärke der Assoziation auf einen Mengeneffekt oder auf während des Wachstums differentiell exprimierte Adhäsine zurückzuführen ist. Das sezernierte Suilysin hat anscheinend einen schädigenden Einfluss auf die Monozyten und behindert evtl. zusätzlich eine Internalisation von Stamm 10. Die Akkumulation von Stamm 10 könnte auf die in der Kapsel vorhandene Sialinsäure zurückzuführen sein. Das Fehlen der Sialinsäure in der Kapsel von Stamm A3286/94, was evtl. eine 173 Diskussion im Vergleich zu Stamm 10 dünnere Kapsel zur Folge hat und möglicherweise die Phagozytose von Stamm A3286/94 begünstigt, könnte mit der im Vergleich zu Stamm 10 geringeren Virulenz zusammenhängen. Die Kapsel von Stamm 10 scheint ebenso vor Phagozytose und antibakterieller Aktivität durch in Suspension befindliche Monozyten zu schützen. Die Feststellung, dass S. suis-Stamm 10 im Batch-Verfahren sehr stark an den porzinen CD14-positiven Monozyten adhäriert, aber nicht oder nur in einem sehr geringen Maße von diesen internalisiert wird, spricht für die modifizierte Trojan horse theory. Ob S. suis tatsächlich adhärierend an den Monozyten ins ZNS gelangen kann, bedarf weiterer gezielter Untersuchungen. 174 Zusammenfassung 6 Zusammenfassung Wachstumsphasenabhängige Merkmale von Streptococcus suis und deren Bedeutung für das Überleben im Wirt Daniela Willms Streptoccocus (S.) suis ist ein bedeutender Krankheitserreger des Schweins. Neben Infektionserkrankungen wie Septikämien, Pneumonien, Endokarditiden, Arthritiden oder Meningitiden, können auch asymptomatische Verlaufsformen zur Verbreitung des Keims und zu Verlusten in der Schweinehaltung beitragen. Außerdem gilt S. suis als wichtiger Zoonoseerreger. Für das Überleben im Wirt muss der Erreger seinen Stoffwechsel an sich verändernde Umgebungsbedingungen anpassen. In der vorliegenden Arbeit wurde daher untersucht, welchen Einfluss die Wachstumsphase von S. suis auf die Ausprägung von Merkmalen hat, die im Hinblick auf die Bildung antibiotikatoleranter Persisterzellen und auf Wechselwirkungen mit porzinen Monozyten von Bedeutung sind. Im ersten Teil wurde gezeigt, dass S. suis in der stationären Wachstumsphase einen deutlich höheren Anteil antibiotikatoleranter Persisterzellen bildet als in der exponentiellen Wachstumsphase. Diese für die Ausbildung von Persisterzellen typische Wachstumsphasenabhängigkeit, sowie die fehlende Vererbbarkeit der Antibiotikatoleranz und Eliminierung antibiotikatoleranter Zellen nach Re-Inokulation exponentiell gewachsener Bakterien zeigten, dass S. suis höchstwahrscheinlich Typ I-Persister bildet, die durch die limitierenden Bedingungen in der stationären Wachstumsphase ausgelöst werden. Die Persisterzellen wiesen zudem eine wachstumsphasenabhängige Vielfachtoleranz gegenüber Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen auf. In Anwesenheit von Gentamicin zeigte S. suis in der exponentiellen Wachstumsphase eine ebenfalls für das Vorkommen von Persisterzellen typische biphasische Überlebenskinetik. Das Arginin-abbauende Arginin Deiminase System (ADS), kodiert durch das arcABC-Operon, und die damit assoziierten Proteine CcpA (catabolite control protein A) und ArcD (putativer ArgininOrnithin-Antiporter) scheinen mit der Persisterbildung von S. suis im Zusammenhang zu stehen. Die Beteiligung des globalen Regulators CcpA lässt darauf schließen, 175 Zusammenfassung dass mehrere Gene in der Persisterbildung von S. suis involviert sind, und dass Virulenz, Metabolismus und Persistenz evtl. miteinander verknüpft sind. Des Weiteren wurde eine Antibiotikatoleranz sowohl für die S. suis-Stämme A3286/94 und 05ZYH33, als auch für einzelne Stämme der Spezies S. gordonii, S. pyogenes und S. agalactiae festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Antibiotikatoleranz in der Familie der Streptococcaceae ein verbreitetes Phänomen sein könnte. Im zweiten Teil der Arbeit wurde der Einfluss des bakteriellen Wachstums auf die Interaktion mit Monozyten untersucht, da angenommen wird, dass Monozyten eine wichtige Rolle für die Ausbreitung des Erregers im Gewebe spielen. Laut Trojan horse theory bzw. modifizierter Trojan horse theory gelangt S. suis intrazellulär in Monozyten persistierend bzw. extrazellulär an Monozyten adhärierend ins zentrale Nervensystem (ZNS). Dafür wurde erstmalig ein in-vitro-Infektionsmodell mit über den Oberflächenmarker CD14 affinitätsaufgereinigten naïven porzinen Monozyten im Batch-Verfahren etabliert, das den in-vivo-Bedingungen relativ nahe kommt. Die eingesetzte Monozytensubpopulation exprimierte den Panmonozytenmarker CD172a und die Reifemarker CD163 und CD14, wobei die Expression von CD163 stärker als die von CD14 ausgeprägt war. Durch den Daptomycin protection assay (DPA), sowie Doppelimmunfluoreszenz (DIF)- und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)Experimente wurde gezeigt, dass S. suis sehr stark an die Monozyten adhärierte, aber kaum von diesen phagozytiert wurde. Der intrazelluläre Nachweis der Kapselmutante 10∆cps, der Suilysinmutante 10∆sly und des Stamms A3286/94 in TEM-Experimenten zeigte, dass S. suis grundsätzlich von porzinen Monozyten internalisiert werden kann. Für S. suis-Stamm 10 konnte eine stärkere Assoziation stationär gewachsener Bakterien und für S. suis-Stamm A3286/94 eine stärkere Assoziation exponentiell gewachsener Bakterien festgestellt werden. Es konnte allerdings nicht geklärt werden, ob dies auf einer unterschiedlichen Vermehrung der Bakterien oder auf eine wachstumsphasenabhängige differentielle Expression von Adhäsinen zurückzuführen war. Weitergehende Untersuchungen zeigten, dass S. suis in der Lage war, sich in Anwesenheit der Monozyten zu vermehren und einen Einfluss auf deren Vitalität und Morphologie hatte. Der Suilysinnachweis im Überstand infizierter Monozyten und durchflusszytometrische Analysen lassen 176 Zusammenfassung vermuten, dass das durch S. suis-Stamm 10 sezernierte Suilysin die Monozyten schädigte und damit möglicherweise die Phagozytose reduzierte. Eine im Gegensatz zur Kapselmutante 10∆cps fehlende Induktion der Monozyten zur ROS-Produktion durch Stamm 10 deutet zusätzlich darauf, dass die Kapsel vor antibakterieller Aktivität schützt. Zusammenfassend zeigte die Arbeit erstmals, dass S. suis in der Lage ist, antibiotikatolerante Persisterzellen zu bilden, und dass die Bildung dieser Persister abhängig vom bakteriellen Wachstum ist. Weiterhin konnten durch ein neues in-vitroInfektionsmodell mit porzinen Monozyten Erkenntnisse gewonnen werden, die die sogenannte modifizierte Trojan horse theory unterstützen. Der Einfluss der Wachstumsphase auf die Interaktion von S. suis mit Monozyten bleibt allerdings noch zu klären. 177 Summary 7 Summary Growth-dependent features of Streptococcus suis and their relevance for the survival in the host Daniela Willms Streptoccocus (S.) suis is a major pathogen in pigs. Besides clinical infectious diseases like septicaemia, pneumonia, endocarditis, arthritis or meningitis asymptomatic infections can contribute to spreading of the pathogen and to economical losses in pig husbandry as well. S. suis is also an important zoonotic agent. For survival in the host the pathogen has to adapt its metabolism to changing environmental conditions. Therefore the influence of the growth phase of S. suis on the development of features important for forming of antibiotic-tolerant persister cells and for interactions with porcine monocytes was investigated in this thesis. The first part revealed that S. suis in stationary growth phase forms a considerable higher number of antibiotic-tolerant cells than in exponential growth phase. This growth dependence, which is typical for the formation of persister cells, the absent heritability of the antibiotic tolerance and the elimination of antibiotic-tolerant cells after re-inoculation of exponential grown bacteria indicated that S. suis most likely forms type I-persisters which are triggered by the limitating conditions in stationary growth phase. Furthermore, the persister cells showed a growth dependent multidrug tolerance against different classes of antibiotics. In the presence of gentamicin S. suis in exponential growth phase exhibited a biphasic killing kinetic which is also typical for the presence of persister cells. The arginine-catabolic arginine deiminase system (ADS), encoded by the arcABC-operon, the associated proteins CcpA (catabolite control protein A), and ArcD (putative arginine-ornithine-antiporter) seem to be linked to the formation of persisters of S. suis. The involvement of the global regulator CcpA suggests that several genes contribute to persister formation of S. suis-strain 10 and that virulence, metabolism, and persistence may be connected with each other. An antibiotic tolerance was also detected for the S. suis-strains A3286/94 and 05ZYH33 as well as for selected strains of the species S. gordonii, 178 Summary S. pyogenes and S. agalactiae. This indicates that antibiotic tolerance might be widespread within the family Streptococcaceae. Since it is supposed that monocytes play an important role for the spreading of the pathogen in the tissue the influence of bacterial growth on the interaction with monocytes was investigated in the second part of this work. According to the Trojan horse theory or the modified Trojan horse theory, respectively, S. suis reaches the central nervous system (CNS) persistent in monocytes (intracellularly) or adherent to monocytes (extracellularly), respectively. For this an in-vitro-infection model with naïve porcine monocytes purified via the surface marker CD14 in batch culture, which closely mimicks in-vivo-conditions, was established for the first time. The used monocyte subpopulation expressed the pan-monocytic marker CD172a and the maturity-marker CD163 and CD14, whereas the expression of CD163 was stronger compared to the expression of CD14. A daptomycin protection assay (DPA), as well as double immunofluorescence (DIF) and transmission electron microscopy (TEM) experiments showed that S. suis adhered strongly to the monocytes but was hardly phagocytosed. The intracellular detection of the capsular mutant 10∆cps, of the suilysin deficient mutant 10∆sly and of strain A3286/94 via TEM experiments showed that S. suis can be internalized by porcine monocytes in principal. For S. suis-strain 10 an increased association of stationary grown bacteria and for S. suis-strain A3286/94 an increased association of exponential grown bacteria could be detected. However, it could not be cleared if this was attributed to a different replication of the bacteria or to a growth dependent differential expression of adhesin(s). Further investigations showed that S. suis was able to proliferate in the presence of the monocytes and had an influence on their vitality and morphology. The detection of suilysin in the supernatant of infected monocytes and flow cytometric analyses suggest that the suilysin secreted by S. suis-strain 10 damaged the monocytes and thereby reduced phagocytosis. In addition, a lacking induction of ROS-production of the monocytes by strain 10 in contrast to the capsular mutant 10∆cps suggests that the capsule protects against antibacterial activity. Taken together this work showed for the first time that S. suis is able to form antibiotic-tolerant persister cells and that the formation of the persister cells is 179 Summary dependent on bacterial growth. Furthermore, findings obtained by a new in-vitroinfection model with porcine monocytes support the so-called modified Trojan horse theory. However, the influence of the growth phase on the interaction of S. suis with monocytes still has to be cleared. 180 Literaturverzeichnis 8 Literaturverzeichnis Aarestrup, F. M., Rasmussen, S. R., Artursson, K., und Jensen, N. E. (1998) Trends in the resistance to antimicrobial agents of Streptococcus suis isolates from Denmark and Sweden. Vet.Microbiol. 63: 71-80 Allen, A. G., Bolitho, S., Lindsay, H., Khan, S., Bryant, C., Norton, P., Ward, P., Leigh, J., Morgan, J., Riches, H., Eastty, S., und Maskell, D. (2001) Generation and characterization of a defined mutant of Streptococcus suis lacking suilysin. Infect. Immun. 69: 2732-2735. Allgaier, A., Goethe, R., Wisselink, H. J., Smith, H. E., und Valentin-Weigand, P. (2001) Relatedness of streptococcus suis isolates of various serotypes and clinical backgrounds as evaluated by macrorestriction analysis and expression of potential virulence traits. J. Clin. Microbiol. 39: 445-453 Allison, K. R., Brynildsen, M. P., und Collins, J. J. (2011) Metabolite-enabled eradication of bacterial persisters by aminoglycosides. Nature 473: 216-220 Almengor, A. C., Kinkel, T. L., Day, S. J., McIver, K. S. (2007) The catabolite control protein CcpA binds to Pmga and influences expression of the virulence regulator Mga in the Group A streptococcus. J. Bacteriol. 189: 8405-8416 Alvarez, B., Sánchez, C., Bullido, R., Marina, A., Lunney, J., Alonso, F., Ezquerra, A., und Domínguez, J. (2000) A porcine cell surface receptor identified by monoclonal antibodies to SWC3 is a member of the signal regulatory protein family and associates with protein-tyrosine phosphatase SHP-1. Tissue Antigens 55: 342-351 181 Literaturverzeichnis Amako, K., Takade, A., Taniai, H., und Yoshida, S. (2008) Electron microscopic examination of uncultured soil-dwelling bacteria. Microbiol. Immunol. 52: 265-269 Amass, S. F., SanMiguel, P., und Clark, L. K. (1997) Demonstration of vertical transmission of Streptococcus suis in swine by genomic fingerprinting. J. Clin. Microbiol. 35: 1595-1596 Amass, S. F., Wu, C. C., und Clark, L. K. (1996) Evaluation of antibiotics for the elimination of the tonsillar carrier state of Streptococcus suis in pigs. J. Vet. Diagn. Invest. 8: 64-67 Amato, S. M., Orman, M. A., und Brynildsen, M. P. (2013) Metabolic control of persister formation in Escherichia coli. Mol. Cell. 50: 475-487 Anderl, J. N., Zahller, J., Roe, F., und Stewart, P. S. (2003) Role of nutrient limitation and stationary-phase existence in Klebsiella pneumoniae biofilm resistance to ampicillin and ciprofloxacin. Antimicrob. Agents. Chemother. 47: 1251-1256 Arends, J. P. und Zanen, H. C. (1988) Meningitis caused by Streptococcus suis in humans. Rev. Infect. Dis. 10: 131-137 Atalla, H., Gyles, C., und Mallard, B. (2011) Staphylococcus aureus small colony variants (SCVs) and their role in disease. Anim. Health. Res. Rev. 12: 33-45 Atalla, H., Gyles C., Jacob C. L., Moisan H., Malouin F., und Mallard B. (2008) Characterization of a Staphylococcus aureus small colony variant (SCV) associated with persistant bovine mastistis. Foodborne Pathog. Dis. 5: 785-799 182 Literaturverzeichnis Balaban, N. Q., Merrin, J., Chait, R., Kowalik, L., und Leibler, S. (2004) Bacterial persistence as a phenotypic switch. Science 305: 1622-1625 Balwit, J. M., van Langefelde, P., Vann, J. M., und Proctor, R. A. (1994) Gentamicin-resistant menadione and hemin auxotrophic Staphylococcus aureus persist within cultured endothelial cells. J. Infect. Dis. 170: 1033-1037 Barry, C. E. 3rd, Boshoff, H. I., Dartois, V., Dick, T., Ehrt, S., Flynn, J., Schnappinger, D., Wilkinson, R. J., Young, D. (2009) The spectrum of latent tuberculosis: rethinking the biology and intervention strategies. Nat. Rev. Microbiol. 7: 845-855 Basta, S., Knoetig, S. M., Spagnuolo-Weaver, M., Allan, G., und McCullough, K. C. (1999) Modulation of monocytic cell activity and virus susceptibility during differentiation into macrophages. J. Immunol. 162: 3961-3969 Baums, C. G. und Valentin-Weigand, P. (2009) Surface-associated and secreted factors of Streptococcus suis in epidemiology, pathogenesis and vaccine development. Anim. Health. Res. Rev. 10: 65-83 Baums, C. G., Verkühlen, G. J., Rehm, T., Silva, L. M., Beyerbach, M., Pohlmeyer, K., und Valentin-Weigand, P. (2007) Prevalence of Streptococcus suis genotypes in wild boars of Northwestern Germany. Appl. Environ. Microbiol. 73: 711-717. Beckert, S., Kreikemeyer, B., und Podbielski, A. (2001) Group A streptococcal rofA gene is involved in the control of several virulence genes and eukaryotic cell attachment and internalization. Infect. Immun. 69: 534-537 183 Literaturverzeichnis Beineke, A., Bennecke, K, Neis, C., Schröder, C., Waldmann, K. H., Baumgartner, W., Valentin-Weigand, P., und Baums, C. G. (2008) Comparative evaluation of virulence and pathology of streptococcus suis serotypes 2 and 9 in experimentally infected growers. Vet. Microbiol. 128: 423-430 Benga, L., Friedl, P., und Valentin-Weigand, P. (2005) Adherence of Streptococcus suis to porcine endothelial cells. J. Vet. Med. B. Infect. Dis. Vet. Public. Health. 52: 392-395 Benga, L., Fulde, M., Neis, C., Goethe, R., und Valentin-Weigand, P. (2008) Polysaccharide capsule and suilysin contribute to extracellular survival of Streptococcus suis co-cultivated with primary porcine phagocytes. Vet. Microbiol. 132: 211-219 Benga, L., Goethe, R., Rohde, M., und Valentin-Weigand, P. (2004) Non-encapsulated strains reveal novel insights in invasion and survival of Streptococcus suis in epithelial cells. Cell. Microbiol. 6: 867-881 Bigger, J. W. (1944) Treatment of staphylococcal infections with penicillin. Lancet 244: 497-500 Bizzini, A., Entenza, J. M., und Moreillon, P. (2007) Loss of penicillin tolerance by inactivating the carbon catabolite repression determinant CcpA in Streptococcus gordonii. J. Antimicrob. Chemother. 59: 607-615 Black, D. S., Kelly, A. J., Mardis, M. J., und Moyed, H. S. (1991) Structure and organization of hip, an operon that affects lethality due to inhibition of peptidoglycan or DNA synthesis. J. Bacteriol. 173: 5732-5739 184 Literaturverzeichnis Blecha, F., Kielian, T., McVey, D. S., Lunney, J. K., Walker, K., Stokes, C. R., Stevens K, Kim, Y. B., Chu, R. M., Chen, T.S. et al. (1994) Workshop studies on monoclonal antibodies reactive against porcine myeloid cells. Vet. Immunol. Immunopathol. 43: 269-272 Bonifait, L., Grignon, L., und Grenier, D. (2008) Fibrinogen induces biofilm formation by Streptococcus suis and enhances its antibiotic resistance. Appl. Environ. Microbiol. 74: 4969-4972 Brassard, J., Gottschalk, M., und Quessy, S. (2004) Cloning and purification of the Streptococcus suis serotype 2 glyceraldehyde-3phosphate dehydrogenase and its involvement as an adhesin. Vet. Microbiol. 102: 87-94 Brisebois, L. M., Charlebois, R., Higgins, R., und Nadeau, M. (1990) Prevalence of Streptococcus suis in four to eight week old clinically healthy piglets. Can. J. Vet. Res. 54: 174-177 Brooun, A., Liu, S., und Lewis, K. (2000) A dose-response study of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa biofilms. Antimicrob. Agents Chemother. 44: 640-646 Büttner, N., Beineke, A., de Buhr, N., Lilienthal, S., Merkel, J., Waldmann, K. H., Valentin-Weigand, P., und Baums, C. G. (2012) Streptococcus suis serotype 9 bacterin immunogenicity and protective efficacy. Vet. Immunol. Immunopathol. 146: 191-200 Busque, P., Higgins, R., Sénéchal, S., Marchand, R., und Quessy, S. (1998) Simultaneous flow cytometric measurement of Streptococcus suis by polymorphnuclear and mononuclear blood leukocytes. Vet. Microbiol. 63: 229-238 185 Literaturverzeichnis Casiano-Colón, A. und Marquis, R. E. (1988) Role of the arginine deiminase system in protecting oral bacteria and an enzymatic basis for acid tolerance. Appl. Environ. Microbiol. 54: 1318-1324 Chabot-Roy, G., Willson, P., Segura, M., Lacouture, S., und Gottschalk, M. (2006) Phagocytosis and killing of Streptococcus suis by porcine neutrophils. Microb. Pathog. 41: 21-32 Chamorro, S., Revilla, R., Alvarez, B., López-Fuertes, L., Ezquerra, A., und Domínguez, J. (2000) Phenotypic characterization of monocyte subpopulations in the pig. Immunobiology 202: 82-93 Chamorro, S., Revilla, C., Alvarez, B., Alonso, F., Ezquerra, A., und Domínguez, J. (2005) Phenotypic and functional heterogeneity of porcine blood monocytes and its relation with maturation. Immunology 114: 63-71 Charland, N., Harel, J., Kobisch, M., Lacasse, S., und Gottschalk, M. (1998) Streptococcus suis serotype 2 deficient in capsular expression. Microbiology 144: 325-332 Charland, N., Kellens, J. T., Caya, F., und Gottschalk, M. (1995) Agglutination of Streptococcus suis by sialic acid-binding lectins. J. Clin. Microbiol. 33: 2220-2221 Charland, N., Kobisch, M., Martineau-Doizé, B., Jacques, M., und Gottschalk, M. (1996) Role of capsular sialic acid in virulence and resistance to phagocytosis of Streptococcus suis capsular type 2. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 14: 195-203 Charland, N., Nizet, V., Rubens, C. E., Kim, K. S., Lacouture, S., und Gottschalk, M. (2000) Streptococcus suis serotype 2 interactions with human brain microvascular endothelial cells. Infect. Immun. 68: 637-643 186 Literaturverzeichnis Chaussee, M. S., Phillips, E. R., und Ferretti, J. J. (1997) Temporal production of streptococcal erythrogenic toxin B (streptococcal cysteine proteinase) in response to nutrient depletion. Infect. Immun. 65: 1956-1959 Chaussee, M. S., Sylva, G. L., Sturdevant, D. E., Smoot, L. M., Graham, M. R., Watson, R. O., und Musser, J. M. (2002) Rgg influences the expression of multiple regulatory loci to coregulate virulence factor expression in Streptococcus pyogenes. Infect. Immun. 70: 762-770 Chaussee, M. S., Watson, R. O., Smoot, J. C., und Musser, J. M. (2001) Identification of Rgg-regulated exoproteins of Streptococcus pyogenes. Infect. Immun. 69: 822-831 Chen, C., Tang, J., Dong, W., Wang, C., Feng, Y., Wang, J., Zheng, F., Pan, X., Liu, D., Li, M., Song, Y., Zhu, X., Sun, H, Feng, T., Guo, Z., Ju, A., Ge, J., Dong, Y., Sun, W., Jiang, Y., Wang J., Yan, J., Yang, H., Wang, X., Gao, G. F., Yang, R., Wang, J., und Yu, J. (2007) A glimpse of streptococcal toxic shock syndrome from comparative genomics of S. suis 2 Chinese isolates. PLoSONE 2: e315 Chu, Y. W., Cheung, T. K. M., Chu, M. Y., Tsang, V. Y. M., Fung, J. T. L., Kam, K. M., und Lo, J. Y. C. (2009) Resistance to tetracycline, erythromycin and clindamycin in Streptococcus suis serotype 2 in Hong Kong. Int. J. Antimicrob. Agents 34: 181-182 Cieslewicz, M. J., Kasper, D. L., Wang, Y., und Wessels, M. R. (2001) Functional analysis in type Ia group B Streptococcus of a cluster of genes involved in extracellular polysaccharide production by diverse species of streptococci. J. Biol. Chem. 276: 139-146 187 Literaturverzeichnis Clifton-Hadley, F. A. und Alexander, T. J. (1980). The carrier site and carrier rate of Streptococcus suis type II in pigs. Vet. Rec. 107: 40-41 Cunin, R., Glansdorff, N., Piérard, A., und Stalon, V. (1986) Biosynthesis and metabolism of arginine in bacteria. Microbiol. Rev. 50: 314-352 Dato, M. E., Wierda, W. G., und Kim, Y. B. (1992) A triggering structure recognized by G7 monoclonal antibody on porcine lymphocytes and granulocytes. Cell. Immunol. 140: 468-477 de Greeff, A., Buys, H., Verhaar, R., Dijkstra, J., Van Alphen, L., und Smith, H. E. (2002) Contribution of fibronectin-binding protein to pathogenesis of Streptococcus suis serotype 2. Infect. Immun. 70: 1319-1325 Dhar, N. und McKinney, J. D. (2007) Microbial phenotypic heterogeneity and antibiotic tolerance. Curr. Opin. Microbiol. 10: 30-38 Dörr, T., Lewis, K., und Vulić, M. (2009) SOS response induces persistence to fluoroquinolones in Escherichia coli. PLoS Genet. 5: e1000760 Dörr, T., Vulić, M., und Lewis, K. (2010) Ciprofloxacin causes persister formation by inducing the TisB toxin in Escherichia coli. Plos. Biol. 8(2): e1000317 Domínguez, J., Ezquerra, A., Alonso, F., McCullough, K., Summerfield, A., Bianchi, A., Zwart, R. J., Kim, Y. B., Blecha, F., Eicher, S., Murtaugh, M., Pampusch, M., und Burger, K. (1998) Porcine myelomonocytic markers: summary of the Second International Swine CD Workshop. Vet. Immunol. Immunopathol. 60: 329-341 188 Literaturverzeichnis Eisenstark, A., Calcutt, M. J., Becker-Hapak, M., und Ivanova, A. (1996) Role of Escherichia coli rpoS and associated genes in defense against oxidative damage. Free Radic. Biol. Med. 21: 975-993 Engelberg-Kulka, H., Amitai, S., Kolodkin-Gal, I., und Hazan, R. (2006) Bacterial programmed cell death and multicellular behavior in bacteria. PLoS Genet. 2: e135 Escudero, J. A., San Millan, A., Catalan, A., de la Campa, A. G., Rivero, E., Lopez, G., Domínguez, L., Moreno, M. A., und Gonzalez-Zorn, B. (2007) First characterization of fluoroquinolone resistance in Streptococcus suis. Antimicrob. Agents Chemother. 51: 777-782 Escudero, J. A., San Millan, A., Gutierrez, B., Hidalgo, L., La Ragione, R. M., Abuoun, M., Galimand, M., Ferrandiz, M. J., Domínguez, L., De La Campa, A. G., und Gonzalez-Zorn, B. (2011) Fluoroquinolone efflux in Streptococcus suis is mediated by SatAB and not by SmrA. Antimicrob. Agents Chemother. 55: 5850-5860 Esgleas, M., Lacouture, S., und Gottschalk, M. (2005) Streptococcus suis serotype 2 binding to extracellular matrix proteins. FEMS Microbiol. Lett. 244: 33-40 Esgleas, M., Li, Y., Hancock, M. A., Harel, J., Dubreuil, J. D., und Gottschalk, M. (2008) Isolation and characterization of α-enolase, a novel fibronectin-binding protein from Streptococcus suis. Microbiol. 154: 2668-2679 Ezquerra, A., Revilla, C., Alvarez, B., Pérez, C., Alonso, F., und Domínguez, J. (2009) Porcine myelomonocytic markers and cell populations. Dev. Comp. Immunol. 33: 284-298 189 Literaturverzeichnis Ferrando, M. L., Fuentes, S., de Greeff, A., Smith, H., und Wells, J. M. (2010) ApuA, a multifunctional alpha-glucan-degrading enzyme of Streptococcus suis, mediates adhesion to porcine epithelium and mucus. Microbiology 156: 2818-2828 Fittipaldi, N., Segura, M., Grenier, D., und Gottschalk, M. (2012) Virulence factors involved in the pathogenesis of the infection caused by the swine pathogen and zoonotic agent Streptococcus suis. Future Microbiol. 7: 259-279 Foster, J. W. (1995) Low pH adaptation and the acid tolerance response of Salmonella typhimurium. Crit. Rev. Microbiol. 21: 215-237 Francois, B., Gissot, V., Ploy, M. C., und Vignon, P. (1998) Recurrent septic shock due to Streptococcus suis. J. Clin. Microbiol. 36: 2395 Fulde, M. (2007) Regulation und Funktion des Arginin Deiminase Systems von Streptococcus suis. Dissertationsarbeit, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover Fulde, M., Willenborg, J., de Greeff, A., Benga, L., Smith, H. E., Valentin-Weigand, P., und Goethe, R. (2011) ArgR is an essential local transcriptional regulator of the arcABC operon in Streptococcus suis and is crucial for biological fitness in an acidic environment. Microbiology 157: 572-582 Gamper, M., Zimmermann, A., und Haas, D. (1991) Anaerobic regulation of transcription initiation in the arcDABC operon of Pseudomonas aeruginosa. J. Bacteriol. 173: 4742-4750 190 Literaturverzeichnis Gefen, O., Gabay, C., Mumcuoglu, M., Engel, G., und Balaban, N. Q. (2008) Single-cell protein induction dynamics reveals a period of vulnerability to antibiotics in persister bacteria. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A 105: 6145-6149 Gefen, O. und Balaban, N. Q. (2009) The importance of being persistent: heterogeneity of bacterial populations under antibiotic stress. FEMS Microbiol. Rev. 33: 704-717 Gerdes, K., Rasmussen, P. B., und Molin, S. (1986) Unique type of plasmidmaintenance function: postsegregational killing of plasmidfree cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83: 3116-3120 Giammarinaro, P. und Paton, J. C. (2002) Role of RegM, a homologue of the catabolite repressor protein CcpA, in the virulence of Streptococcus pneumoniae. Infect. Immun. 70: 5454-5461 Gilligan, P. H., Gage, P. A., Welch, D. F., Muszynski, M. J., und Wait, K. R. (1987) Prevalence of thymidine-dependent Staphylococcus aureus in patients with cystic fibrosis. J. Clin. Microbiol. 25: 1258-1261 Gordon, S., Keshav, S., und Chung, L. P. (1988) Mononuclear phagocytes: tissue distribution and functional heterogeneity. Curr. Opin. Immunol. 1: 26-35 Gottschalk, M., Petitbois, S., Higgins, R., und Jacques, M. (1991) Adherence of Streptococcus suis capsular type 2 to porcine lung sections. Can. J. Vet. Res. 55: 302-304 Gottschalk, M. und Segura, M. (2000) The pathogenesis of the meningitis caused by Streptococcus suis: the unresolved questions. Vet. Microbiol. 76: 259-272 191 Literaturverzeichnis Gottschalk, M., Xu, J., Calzas, C., und Segura, M. (2010) Streptococcus suis: a new emerging or an old neglected zoonotic pathogen? Future Microbiol. 5: 371-391 Gregory, C. D. (2000a) CD14-dependent clearance of apoptotic cells: relevance to the immune system. Curr. Opin. Immunol.12: 27-34 Gregory, C. D. (2000b) Non-inflammatory/anti-inflammatory CD14 responses: CD14 in apoptosis. Chem. Immunol. 74: 122-140 Gruening, P. (2004) Molekularbiologische Charakterisierung des Arginin Deiminase Systems von Streptococcus suis. Dissertationsarbeit, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover VVB Laufersweiler Verlag, Wettenberg Gruening, P., Fulde, M., Valentin-Weigand, P., und Goethe, R. (2006) Structure, regulation, and putative function of the arginine deiminase system of streptococcus suis. J. Bacteriol., 188: 361-369 Guo, Q., Ahn, S. J., Kaspar, J., Zhou, X., und Burne, R. A. (2014) Growth Phase and pH Influence Peptide Signaling for Competence Development in Streptococcus mutans. J. Bacteriol. 196: 227-236 Hall-Stoodley, L., Costerton, J. W., und Stoodley, P. (2004) Bacterial biofilms: from the natural environment to infectious diseases. Nat. Rev. Microbiol. 2: 95-108 192 Literaturverzeichnis Hammerschmidt, S., Wolff, S., Hocke, A., Rosseau, S., Müller, E., und Rohde, M. (2005) Illustration of pneumococcal polysaccharide capsule during adherence and invasion of epithelial cells. Infect. Immun. 73: 4653-4667 Hansen, S., Lewis, K., und Vulić, M. (2008) Role of global regulators and nucleotide metabolism in antibiotic tolerance in Escherichia coli. Antimicrob. Agents. Chemother. 52: 2718–2726 Harrison, J. J., Turner, R. J., und Ceri, H. (2005) Persister cells, the biofilm matrix and tolerance to metal cations in biofilm and planktonic Pseudomonas aeruginosa. Environ. Microbiol. 7: 981-994 Hassett, D. J. und Cohen, M. S. (1989) Bacterial adaptation to oxidative stress: implications for pathogenesis and interaction with phagocytic cells. FASEB J. 3: 2574-2582 Haverson, K., Bailey, M., Higgins, V. R., Bland, P. W., und Stokes, C. R. (1994) Characterization of monoclonal antibodies specific for monocytes, macrophages and granulocytes from porcine peripheral blood and mucosal tissues. J. Immunol. Methods. 170: 233-245 Hayes, F. (2003) Toxins-antitoxins: plasmid maintenance, programmed cell death, and cell cycle arrest. Science 301: 1496-1499 Helaine, S., Cheverton, A. M., Watson, K. G., Faure, L. M., Matthews, S. A., and Holden, D. W. (2014) Internalization of Salmonella by macrophages induces formation of nonreplicating persisters. Science 343: 204-208 193 Literaturverzeichnis Hendriksen, R. S., Mevius, D. J., Schroeter, A., Teale, C., Jouy, E., Butaye, P., Franco, A., Utinane, A., Amado, A., Moreno, M., Greko, C., Stärk, K. D., Berghold, C., Myllyniemi, A. L., Hoszowski, A., Sunde, M., und Aarestrup, F. M. (2008) Occurrence of antimicrobial resistance among bacterial pathogens and indicator bacteria in pigs in different European countries from year 2002 - 2004: the ARBAO-II study. Acta. Vet. Scand. 50:19 Hengge-Aronis, R. (1996) Back to log phase: sigma S as a global regulator in the osmotic control of gene expression in Escherichia coli. Mol. Microbiol.21: 887-893 Higgins, R., Gottschalk, M., Beaudoin M., und Rawluk, S. A. (1992) Distribution of Streptococcus suis capsular types in Quebec and western Canada. Can. Vet. J. 33: 27-30 Higgins R., Gottschalk M., Mittal K. R., und Beaudoin, M. (1990) Streptococcus suis infection in swine. A sixteen month study. Can. J. Vet. Res. 54: 170-173 Higgins, R. und Gottschalk, M. (2005) Streptococcal diseases. In: Diseases of Swine; Straw, B. E., D’Allaire, S., Mengeling, W. L., und Taylor D. J., eds; Ames, Iowa State University Press: 769-783 Hoa, N. T., Chieu, T. T., Nghia, H. D., Mai, N. T., Anh, P. H., Wolbers, M., Baker, S., Campbell, J. I., Chau, N. V., Hien, T. T., Farrar, J., und Schultsz, C. (2011) The antimicrobial resistance patterns and associated determinants in Streptococcus suis isolated from humans in southern Vietnam, 1997-2008. BMC Infect. Dis. 6: 11-16 Hondorp, E. R. und McIver, K. S. (2007) The Mga virulence regulon: infection where the grass is greener. Mol. Microbiol. 66: 1056-1065 194 Literaturverzeichnis Hu, P., Yang, M., Zhang, A., Wu, J., Chen, B., Hua, Y., Yu, J., Xiao, J., und Jin, M. (2011) Comparative genomics study of multi-drug-resistance mechanisms in the antibioticresistant Streptococcus suis R61 strain. PLoS ONE 6: e24988 Huang, Y. T., Teng, L. J., Ho, S. W., und Hsueh, P. R. (2005) Streptococcus suis infection. J. Microbiol. Immunol. Infect. 38: 306-313 Hui, A. C., Ng, K. C, Tong, P. Y., Mok, V., Chow, K. M, Wu, A., und Wong, L. K. (2005) Bacterial meningitis in Hong Kong: 10-years' experience. Clin. Neurol. Neurosurg. 107: 366-370 Jacobs, A. A. C., Loeffen, P. L. W., vandenBerg, A. J. G., und Storm, P. K. (1994) Identification, Purification, and Characterization of A Thiol-Activated Hemolysin (Suilysin) of Streptococcus suis. Infect. Immun. 62: 1742-1748 Jobin, M. C., Brassard, J., Quessy, S., Gottschalk, M., und Grenier, D. (2004) Acquisition of host plasmin activity by the swine pathogen Streptococcus suis serotype 2. Infect. Immun. 72: 606–610 Johnson, P. J. und Levin, B. R. (2013) Pharmacodynamics, population dynamics, and the evolution of persistence in Staphylococcus aureus. PLoS Genet. 9: e1003123 Kadioglu, A., Weiser, J. N., Paton, J. C., und Andrew, P. W. (2008) The role of Streptococcus pneumoniae virulence factors in host respiratory colonization and disease. Nat. Rev. Microbiol. 6: 288-301 195 Literaturverzeichnis Keller, L. und Surette, M. G. (2006) Communication in bacteria: an ecological and evolutionary perspective. Nat. Rev. Microbiol 4: 249-258 Keren, I., Kaldalu, N., Spoering, A., Wang, Y., und Lewis, K. (2004a) Persister cells and tolerance to antimicrobials. FEMS Microbiol. Lett. 230: 13-18 Keren, I., Minami, S., Rubin, E., und Lewis, K. (2011) Characterization and transcriptome analysis of Mycobacterium tuberculosis persisters. mBio 2: e00100-e00111 Keren, I., Shah, D., Spoering, A., Kaldalu, N., und Lewis, K. (2004b) Specialized persister cells and the mechanism of multidrug tolerance in Escherichia coli. J. Bacteriol. 186: 8172-8180 Kielian, T., McVey, D. S., Davis, W. C., Kim, Y. B., und Blecha, F. (1994) Competitive binding analysis of monoclonal antibodies reactive with porcine alveolar macrophages using anti-CD14 and anti-CD18. Vet. Immunol. Immunopathol. 43: 273-278 Kietzman, C. C. und Caparon, M. G. (2010) CcpA and LacD.1 affect temporal regulation of Streptococcus pyogenes virulence genes. Infect. Immun. 78: 241-252 Kolter, R., Siegele, D. A., und Tormo, A. (1993) The stationary phase of the bacterial life cycle. Annu. Rev. Microbiol. 47: 855-874 Kreikemeyer, B., Beckert, S., Braun-Kiewnick, A., und Podbielski, A. (2002) Group A streptococcal RofA-type global regulators exhibit a strain-specific genomic presence and regulation pattern. Microbiology 148: 1501-1511 196 Literaturverzeichnis Kreikemeyer, B., McIver, K. S., und Podbielski, A. (2003) Virulence factor regulation and regulatory networks in Streptococcus pyogenes and their impact on pathogen-host interactions. Trends Microbiol. 11: 224-232 Kristiansen, M., Graversen, J. H., Jacobsen, C., Sonne, O., Hoffman, H. J., Law, S. K., und Moestrup, S. K. (2001) Identification of the haemoglobin scavenger receptor. Nature 409: 198-201 Kussell, E., Kishony, R., Balaban, N. Q., und Leibler, S. (2005) Bacterial persistence: a model of survival in changing environments. Genetics. 169: 1807-1814 Lalonde, M., Segura, M., Lacouture, S., und Gottschalk, M. (2000) Interactions between Streptococcus suis serotype 2 and different epithelial cell lines. Microbiology 146 (Pt 8): 1913-1921 Lazazzera, B. A. (2000) Quorum sensing and starvation: signals for entry into stationary phase. Curr. Opin. Microbiol. 3: 177-182 Lechner, S., Lewis, K., und Bertram, R. (2012) Staphylococcus aureus persisters tolerant to bactericidal antibiotics. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 22: 235-244 Lecours, M. P., Fittipaldi, N., Takamatsu, D., Okura, M., Segura, M., GoyetteDesjardins, G., Van Calsteren, M. R., und Gottschalk, M. (2012) Sialylation of Streptococcus suis serotype 2 is essential for capsule expression but is not responsible for the main capsular epitope. Microbes Infect. 14: 941-950 Leung, V. und Lévesque, C. M. (2012) A stress-inducible quorum-sensing peptide mediates the formation of persister cells with noninherited multidrug tolerance. J. Bacteriol. 194: 2265-2274 197 Literaturverzeichnis Levin, B. R. und Rozen, D. E. (2006) Non-inherited antibiotic resistance. Nat. Rev. Microbiol. 4: 556-562 Lewis, K. (2001) Riddle of biofilm resistance. Antimicrob. Agents Chemother. 45: 999–1007 Lewis, K. (2007) Persister cells, dormancy and infectious disease. Nat. Rev. Microbiol. 2007 5: 48-56 Lewis, K. (2010a) Persister cells. Annu. Rev. Microbiol. 64: 357-372 Lewis, K. (2010b) Persister cells and the paradox of chronic infections. Microbe 5: 429-437. Liu, M., Tan, C., Fang, L., Xiao, S., und Chen, H. (2011) Microarray analyses of THP-1 cells infected with Streptococcus suis serotype 2. Vet. Microbiol. 150: 126-131 Lleo Mdel, M., Benedetti, D., Tafi, M. C., Signoretto, C., und Canepari, P. (2007) Inhibition of the resuscitation from the viable but nonculturable state in Enterococcus faecalis. Environ. Microbiol. 9: 2313-2320 Loewen, P. C. und Hengge-Aronis, R. (1994) The role of the sigma factor sigma S (KatF) in bacterial global regulation. Annu. Rev. Microbiol.48: 53-80 Lun, S., Perez-Casal, J., Connor, W., und Willson, P. J. (2003) Role of suilysin in pathogenesis of Streptococcus suis capsular serotype 2. Microb. Pathog. 34: 27-37 198 Literaturverzeichnis Lun, S. und Willson, P. J. (2004) Expression of green fluorescent protein and its application in pathogenesis studies of serotype 2 Streptococcus suis. J. Microbiol. Methods. 56: 401-412 MacInnes, J. I., Gottschalk, M., Lone, A. G., Metcalf, D. S., Ojha, S., Rosendal, T., und Watson, S. B. (2008) Friendship RM: Prevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus suis, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida, and Streptococcus suis in representative Ontario swine herds. Can. J. Vet. Res. 72: 242-248 Maghnouj, A., Abu-Bakr, A. A., Baumberg, S., Stalon, V., Vander Wauven, C. (2000) Regulation of anaerobic arginine catabolism in Bacillus licheniformis by a protein of the Crp/Fnr family. FEMS Microbiol. Lett. 191: 227-234 Mai, N. T., Hoa, N. T., Nga, T. V., Linh, le D., Chau, T. T., Sinh, D. X., Phu, N. H., Chuong, L. V., Diep, T. S., Campbell, J., Nghia, H. D., Minh, T. N., Chau, N. V., de Jong, M. D., Chinh, N. T., Hien, T. T., Farrar, J., und Schultsz, C. (2008) Streptococcus suis meningitis in adults in Vietnam. Clin. Infect. Dis. 46: 659-667 Marie, J., Morvan, H., Berthelot-Hérault, F., Sanders, P., Kempf, I., GautierBouchardon, A. V., Jouy, E., und Kobisch, M. (2002) Antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from swine in France and from humans indifferent countries between 1996 and 2000. J. Antimicrob. Chemother. 50: 201-209 Massey, R. C., Buckling, A., und Peacock, S. J. (2001) Phenotypic switching of antibiotic resistance circumvents permanent costs in Staphylococcus aureus. Curr. Biol. 11: 1810-1814 199 Literaturverzeichnis McCullough, K. C., Basta, S., Knötig, S., Gerber, H., Schaffner, R., Kim, Y. B, Saalmüller, A., und Summerfield, A. (1999) Intermediate stages in monocyte-macrophage differentiation modulate phenotype and susceptibility to virus infection. Immunology 98: 203-212 McCullough, K. C., Schaffner, R., Natale, V., Kim, Y. B., und Summerfield, A. (1997) Phenotype of porcine monocytic cells: modulation of surface molecule expression upon monocyte differentiation into macrophages. Vet. Immunol. Immunopathol. 58: 265-275 McIver, K. S. und Scott, J. R. (1997) Role of mga in growth phase regulation of virulence genes of the group A streptococcus. J. Bacteriol. 179: 5178-5187 McNamara, P. J. und Proctor, R. A. (2000) Staphylococcus aureus small colony variants, electron transport and persistent infections. Int. J. Antimicrob. Agents 14: 117-122 Miller, M. H., Edberg, S. C., Mandel, L. J., Behar, C. F., und Steigbigel, N. H. (1980) Gentamicin uptake in wild-type and aminoglycoside-resistant small-colony mutants of Staphylococcus aureus. Antimicrob. Agents Chemother. 18: 722-729 Mitchell, P. (2011) Chemiosmotic coupling in oxidative and photosynthetic phosphorylation. 1966. Biochim. Biophys. Acta. 1807: 1507-1538 Möker, N., Dean, C. R., und Tao, J. (2010) Pseudomonas aeruginosa increases formation of multidrug-tolerant persister cells in response to quorumsensing signaling molecules. J. Bacteriol. 192: 1946-1955 200 Literaturverzeichnis Molinari, G., Talay, S. R., Valentin-Weigand, P., Rohde, M., und Chhatwal, G. S. (1997) The fibronectin-binding protein of Streptococcus pyogenes, SfbI, is involved in the internalization of group A streptococci by epithelial cells. Infect. Immun. 4: 1357-1363 Molinari, G., Rohde, M., Talay, S. R., Chhatwal, G. S., Beckert, S., und Podbielski, A. (2001) The role played by the group A streptococcal negative regulator Nra on bacterial interactions with epithelial cells. Mol. Microbiol. 40: 99-114 Mollerach, M., López, R., und García, E. (1998) Characterization of the galU gene of Streptococcus pneumoniae encoding a uridine diphosphoglucose pyrophosphorylase: a gene essential for capsular polysaccharide biosynthesis. J. Exp. Med. 188: 2047-2056 Moyed, H. S. und Bertrand, K. P. (1983) hipA, a newly recognized gene of Escherichia coli K-12 that effects frequency of persistence after inhibition of murein synthesis. J. Bacteriol. 155: 768-775 Moyed, H. S. und Broderick, S. H. (1986) Molecular cloning and expression of hipA, a gene of Escherichia coli K-12 that affects frequency of persistence after inhibition of murein synthesis. J. Bacteriol. 166: 399-403 Musher, D. M., Baughn, R. E., Templeton, G. B., und Minuth, J. N. (1977) Emergence of variant forms of Staphylococcus aureus after exposure to gentamicin and infectivity of the variants in experimental animals. J. Infect. Dis. 136: 360-369 Na, S. H., Miyanaga, K., Unno, H., und Tanji, Y. (2006) The survival response of Escherichia coli K12 in a natural environment. Appl. Microbiol. Biot. 72: 386-392 201 Literaturverzeichnis Navarro Llorens, J. M., Tormo, A., und Martínez-García, E. (2010) Stationary phase in gram-negative bacteria FEMS Microbiol. Rev. 34: 476-495 Norton, P. M., Rolph, C., Ward, P. N., Bentley, R. W., und Leigh, J. A. (1999) Epithelial invasion and cell lysis by virulent strains of Streptococcus suis is enhanced by the presence of suilysin. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 26: 25-35 Nystrom, T. (2004) Stationary-phase physiology. Annu. Rev. Microbiol. 58: 161-181 Okwumabua, O., Abdelmagid, O., und Chengappa, M. M. (1999) Hybridization analysis of the gene encoding a hemolysin (suilysin) of Streptococcus suis type 2: evidence for the absence of the gene in some isolates. FEMS Microbiol. Lett. 181: 113-121 Oliver, J. D. (2005) The viable but nonculturable state in bacteria. J. Microbiol. 43 (Special No.): 93-100 Olson, M. E., Ceri, H., Morck, D. W., und Buret, A. G. (2002) Read RR: Biofilm bacteria: formation and comparative susceptibility to antibiotics. Can. J. Vet. Res. 66: 86-92 Palmieri, C., Varaldo, P. E., und Facinelli, B. (2011) Streptococcus suis, an emerging drug-resistant animal and human pathogen. Frontiers in Microbiology 2: 235 Pancholi, V. (2001) Multifunctional α-enolase: its role in diseases. Cell. Mol. Life Sci. 58: 902-920 202 Literaturverzeichnis Passlick, B., Flieger, D., Ziegler-Heitbrock, H. W. (1989) Identification and characterization of a novel monocyte subpopulation in human peripheral blood. Blood 74: 2527-2534 Perry, J. A., Jones, M. B., Peterson, S. N., Cvitkovitch, D. G., und Lévesque, C. M. (2009) Peptide alarmone signaling triggers an auto-active bacteriocin necessary for genetic competence. Mol. Microbiol. 72: 905-917 Petersen, C. B., Nygard, A. B., Viuff, B., Fredholm, M., Aasted, B., Salomonsen, J. (2007) Porcine ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 (NPP1/CD203a): cloning, transcription, expression, mapping, and identification of an NPP1/CD203a epitope for swine workshop cluster 9 (SWC9) monoclonal antibodies. Dev. Comp. Immunol. 31: 618-631 Philippidis, P., Mason, J. C., Evans, B. J., Nadra, I., Taylor, K. M., Haskard, D. O., Landis, R. C. (2004) Hemoglobin scavenger receptor CD163 mediates interleukin-10 release and heme oxygenase-1 synthesis: antiinflammatory monocyte-macrophage responses in vitro, in resolving skin blisters in vivo, and after cardiopulmonary bypass surgery. Circ. Res. 94: 119-126 Phillips, I., Culebras, E., Moreno, F., und Baquero, F. (1987) Induction of the SOS response by new 4-quinolones. J. Antimicrob. Chemother. 20: 631-638 Princivalli, M. S., Palmieri, C., Magi, G., Vignaroli, C., Manzin, A., Camporese, A., Barocci, S., Magistrali, C., und Facinelli, B. (2009) Genetic diversity of Streptococcus suis clinical isolates from pigs and humans in Italy (2003–2007). Euro Surveill. 14 pii, 19310. 203 Literaturverzeichnis Proctor, R. A., von Eiff, C., Kahl, B. C., Becker, K., McNamara, P., Herrmann, M., und Peters, G. (2006) Small colony variants: a pathogenic form of bacteria that facilitates persistent and recurrent infections. Nat. Rev. Microbiol. 4: 295-305 Quessy, S., Busque, P., Higgins, R., Jacques, M., und Dubreuil, J. D. (1997) Description of an albumin binding activity for Streptococcus suis serotype 2. FEMS Microbiol. Lett. 147: 245-50 Reid, S. D., Green, N. M., Buss, J. K., Lei, B., und Musser, J. M. (2001) Multilocus analysis of extracellular putative virulence proteins made by group A Streptococcus: population genetics, human serologic response, and gene transcription. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A 98: 7552-7557 Robertson, I. D. und Blackmore, D. K. (1989) Prevalence of Streptococcus suis types 1 and 2 in domestic pigs in Australia and New Zealand. Vet. Rec. 124: 391-394 Rohde, M., Müller, E., Chhatwal, G. S., und Talay, S. R. (2003) Host cell caveolae act as an entry-port for group A streptococci. Cell. Microbiol. 5: 323-342 Rosenkranz, M., Elsner, H. A., Stürenburg, H. J., Weiller, C., Röther, J., und Sobottka, I. (2003) Streptococcus suis meningitis and septicemia contracted from a wild boar in Germany. J. Neurol. 250: 869-870 Ruepp, A. und Soppa, J. (1996) Fermentative arginine degradation in Halobacterium salinarium (formerly Halobacterium halobium): genes, gene products, and transcripts of the arcRACB gene cluster. J. Bacteriol. 178: 4942-4947 204 Literaturverzeichnis Saalmüller, A., Jonjic, S., Buhring, H. J., Reddehase, M. J., und Koszinowski, U. H. (1987) Monoclonal antibodies reactive with swine lymphocytes. II. Detection of an antigen on resting T cells down-regulated after activation. J. Immunol. 138: 1852-1857 Sadowska, B., Bonar, A., von Eiff, C., Proctor, R. A., Chmiela, M., Rudnicka, W., und Róźalska, B. (2002) Characteristics of Staphylococcus aureus, isolated from airways of cystic fibrosis patients, and their small colony variants. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 32: 191-197 Sahl, H.-G. (1994) Wachstum von Bakterien. In: Lehrbuch der Medizinischen Mikrobiologie; Brandis, H., Köhler, W., Eggers, H. J., und Pulverer, G., eds; 7. Auflage, Gustav Fischer-Verlag, Stuttgart: 79-82 Sánchez, C., Domenech, N., Vazquez, J., Alonso, F., Ezquerra, A., und Domínguez, J. (1999) The porcine 2A10 antigen is homologous to human CD163 and related to macrophage differentiation. J. Immunol. 162: 5230-5237 Schaaff, F., Bierbaum, G., Baumert, N., Bartmann, P., und Sahl, H. G. (2003) Mutations are involved in emergence of aminoglycoside-induced small colony variants of Staphylococcus aureus. Int. J. Med. Microbiol. 293: 427-435 Schubert, A., Zakikhany, K., Schreiner, M., Frank, R., Spellerberg, B., Eikmanns, B. J., und Reinscheid, D. J. (2002) A fibrinogen receptor from group B Streptococcus interacts with fibrinogen by repetitive units with novel ligand binding sites. Mol. Microbiol. 46: 557-569 Schumacher, M. A., Piro, K. M., Xu, W., Hansen, S., Lewis, K., und Brennan, R. G. (2009) Molecular mechanisms of HipA-mediated multidrug tolerance and its neutralization by HipB. Science 323: 396-401 205 Literaturverzeichnis Schuster, M., Hawkins, A. C., Harwood, C. S., und Greenberg, E. P. (2004) The Pseudomonas aeruginosa RpoS regulon and its relationship to quorum sensing. Mol. Microbiol. 51: 973-985 Segers, R. P. A. M., Kenter, T., De Hahn, L. A. M., und Jacobs, A. A. C. (1998) Characterization of the gene encoding suilysin from Streptococcus suis and expression in field strains. FEMS Microbiol. Lett. 167: 255-261 Segura, M. (2012) Fisher scientific award lecture - the capsular polysaccharides of Group B Streptococcus and Streptococcus suis differently modulate bacterial interactions with dendritic cells. Can. J. Microbiol. 58: 249-260 Segura, M. A, Cléroux, P., und Gottschalk, M. (1998) Streptococcus suis and group B Streptococcus differ in their interactions with murine macrophages. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 21: 189-95 Segura, M. und Gottschalk, M. (2002) Streptococcus suis interactions with the murine macrophage cell line J774: adhesion and cytotoxicity. Infect. Immun. 70: 4312-4322 Segura M., Vadeboncoeur N., und Gottschalk M. (2002) CD14-dependent and -independent cytokine and chemokine production by human THP-1 monocytes stimulated by Streptococcus suis capsular type 2. Clin. Exp. Immunol. 127: 243-54. Seitz, M., Baums, C. G., Neis, C., Benga, L., Fulde, M., Rohde, M., Goethe, R., und Valentin-Weigand, P. (2013) Subcytolytic effects of suilysin on interaction of Streptococcus suis with epithelial cells. Vet. Microbiol. 167: 584-591 206 Literaturverzeichnis Seitz, M., Beineke, A., Seele, J., Fulde, M., Valentin-Weigand, P., und Baums, C. G. (2012) A novel intranasal mouse model for mucosal colonization by Streptococcus suis serotype 2. J. Med. Microbiol. 61:1311-1318 Shah, D., Zhang, Z., Khodursky, A., Kaldalu, N., Kurg, K., und Lewis, K. (2006) Persisters: a distinct physiological state of E. coli. BMC Microbiol. 6: 53 Shneerson, J. M., Chattopadhyay, B., Murphy, M. F., und Fawcett, I. W. (1980) Permanent perceptive deafness due to Streptococcus suis type II infection. J. Laryngol. Otol. 94: 425-427 Si, Y., Yuan, F., Chang, H., Liu, X., Li, H., Cai, K., Xu, Z., Huang, Q., Bei, W., und Chen, H. (2009) Contribution of glutamine synthetase to the virulence of Streptococcus suis serotype 2. Vet. Microbiol. 139: 80-88 Singh, R., Ray, P., Das, A., und Sharma, M. (2009) Role of persisters and small-colony variants in antibiotic resistance of planktonic and biofilm-associated Staphylococcus aureus: an in vitro study. J. Med. Microbiol. 58: 1067-1073 Sitkiewicz, I. und Musser, J. M. (2009) Analysis of growth-phase regulated genes in Streptococcus agalactiae by global transcript profiling. BMC Microbiol. 9: 32 Smith, H. E., Buijs, H., De Vries, R. R., Wisselink, H. J., N. Stockhofe-Zurwieden, N., und Smits, M. A. (2001) Environmentally regulated genes of Streptococcus suis: identification by the use of ironrestricted conditions in vitro and by experimental infection of piglets. Microbiology 147: 271-280 207 Literaturverzeichnis Smith, H. E., Damman, M., van der Velde, J., Wagenaar, F., Wisselink, H. J., Stockhoffe-Zurwieden, N., und Smits, M. A. (1999) Identification and characterization of the cps locus of Streptococcus suis serotype 2: the capsule protects against phagocytosis and is an important virulence factor. Infect. Immun. 67: 1750-1756 Smith, H. E., de Vries, R., van’t Slot, R., und Smits, M. A. (2000) The cps locus of Streptococcus suis serotype 2: genetic determinant for the synthesis of sialic acid. Microb. Pathog. 29: 127-134. Smith, H. E., Vecht, U., Gielkens, A. L., und Smits, M. A. (1992) Cloning and nucleotide sequence of the gene encoding the 136-kilodalton surface protein (muramidase-released protein) of Streptococcus suis type 2. Infect. Immun. 60: 2361-2367 Smith, H. E., Vecht, U., Wisselink, H. J., Stockhofe-Zurwieden, N., Biermann, Y., und Smits, M. A. (1996) Mutants of Streptococcus suis types 1 and 2 impaired in expression of muramidasereleased protein and extracellular protein induce disease in newborn germfree pigs. Infect. Immun. 64: 4409-4412 Spiro, S. (1994) The FNR family of transcriptional regulators. Antonie Van Leeuwenhoek 66: 23-36 Spoering, A. L. und Lewis, K. (2001) Biofilms and planktonic cells of Pseudomonas aeruginosa have similar resistance to killing by antimicrobials. J. Bacteriol. 183: 6746-6751 Sriskandan, S. und Slater, J. D. (2006) Invasive disease and toxic shock due to zoonotic Streptococcus suis: an emerging infection in the East? PLoS Med 3(e187): 0595-0597 208 Literaturverzeichnis Staats, J. J., Feder, .I, Okwumabua, O., und Chengappa, M. M. (1997) Streptococcus suis: past and present. Vet. Res. Commun. 21: 381-407 Summerfield, A. und McCullough, K. C. (1997) Porcine bone marrow myeloid cells: phenotype and adhesion molecule expression. J. Leukoc. Biol. 62: 176-185. Swildens, B., Stockhofe-Zurwieden, N., van der Meulen, J., Wisselink, H. J., Nielen, M., und Niewold, T. A. (2004) Intestinal translocation of Streptococcus suis type 2 EF+ in pigs. Vet. Microbiol. 103: 29-33 Taber, H. W., Mueller, J. P., Miller, P. F., und Arrow, A. S. (1987) Bacterial uptake of aminoglycoside antibiotics. Microbiol. Rev. 51: 439-457 Takamatsu, D., Osaki, M., und Sekizaki, T. (2003) Chloramphenicol resistance transposable element TnSs1 of Streptococcus suis, a transposon flanked by IS6-family elements. Plasmid 49: 143-151 Tan, C., Fu, S., Liu, M., Jin, M., Liu, J., Bei, W., und Chen, H. (2008) Cloning, expression and characterization of a cell wall surface protein, 6phosphogluconate-dehydrogenase, of Streptococcus suis serotype 2. Vet. Microbiol. 130: 363-370 Tanabe, S., Bonifait, L., Fittipaldi, N., Grignon, L., Gottschalk, M., und Grenier, D. (2010) Pleiotropic effects of polysaccharide capsule loss on selected biological properties of Streptococcus suis. Can. J. Vet. Res. 74: 65-70 209 Literaturverzeichnis Tang, J., Wang, C., Feng, Y., Yang, W., Song, H., Chen, Z., Yu, H., Pan, X., Zhou, X., Wang, H., Wu, B., Wang, H., Zhao, H., Lin, Y., Yue, J., Wu, Z., He, X., Gao, F., Khan, A. H., Wang, J., Zhao, G. P., Wang, Y., Wang, X., Chen, Z., und Gao, G. F. (2006) Streptococcal toxic shock syndrome caused by Streptococcus suis serotype 2. PLoS Med 3(e151): 0668-0676. Tenenbaum, T., Adam, R., Eggelnpöhler, I., Matalon, D., Seibt, A. K., Novotny, G. E., Galla, H. J., und Schroten, H. (2005) Strain-dependent disruption of blood-cerebrospinal fluid barrier by Streptoccocus suis in vitro. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 44: 25-34 Tenenbaum, T., Essmann, F., Adam, R., Seibt, A., Jänicke, R. U., Novotny, G. E., Galla, H. J., und Schroten, H. (2006) Cell death, caspase activation, and HMGB1 release of porcine choroid plexus epithelial cells during Streptococcus suis infection in vitro. Brain Res. 1100: 1-12 Tenenbaum, T., Papandreou, T., Gellrich, D., Friedrichs, U., Seibt, A., Adam, R., Wewer, C., Galla, H. J., Schwerk, C., und Schroten, H. (2009) Polar bacterial invasion and translocation of Streptococcus suis across the bloodcerebrospinal fluid barrier in vitro. Cell. Microbiol. 11: 323-336 Thacker, E., Summerfield, A., McCullough, K., Ezquerra, A., Domínguez, J., Alonso, F., Lunney, J., Sinkora, J., und Haverson, K. (2001) Summary of workshop findings for porcine myelomonocytic markers. Vet. Immunol. Immunopathol. 80: 93-109 Thorn, C. E. (2010) Hematology of the Pig. In: Schalm’s Veterinary Hematology; Weiss, D. J. und Wardrop, K. J., eds; 6th edition, Wiley-Blackwell, USA: 843-845 210 Literaturverzeichnis Tian, Y., Aarestrup, F. M., und Lu, C. P. (2004) Characterization of Streptococcus suis serotype 7 isolates from diseased pigs in Denmark. Vet. Microbiol. 103: 55-62 Titgemeyer, F. und Hillen, W. (2002) Global control of sugar metabolism: a gram-positive solution. Antonie Van Leeuwenhoek 82: 59-71 Touil, F., Higgins, R., und Nadeau, M. (1988) Isolationof Streptococcus suis from diseased pigs inCanada. Vet. Microbiol. 17: 171-177 Triantafilou, M. und Triantafilou, K. (2002) Lipopolysaccharide recognition: CD14, TLRs and the LPS-activation cluster. Trends Immunol. 23: 301-304 Unoson, C. und Wagner, E. (2008) A small SOS-induced toxin is targeted against the inner membrane in Escherichia coli. Mol. Microbiol. 70: 258-270 van den Heuvel, M. M., Tensen, C. P., van As, J. H., van den Berg, T. K., Fluitsma, D. M., Dijkstra, C. D., Döpp, E. A., Droste, A., van Gaalen, F. A., Sorg, C., Högger, P., und Beelen, R. H. (1999) Regulation of CD 163 on human macrophages: cross-linking of CD163 induces signaling and activation. J. Leukoc. Biol. 66: 858-866 van Furth, A. M., Roord, J. J., und van Furth, R. (1996) Roles of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in pathophysiology of bacterial meningitis and effect of adjunctive therapy. Infect. Immun. 64: 4883-4890 211 Literaturverzeichnis van Furth, R., Cohn, Z. A., Hirsch, J. G., Humphrey, J. H., Spector, W. G., und Langevoort, H. L. (1972) The mononuclear phagocyte system: a new classification of macrophages, monocytes, and their precursor cells. Bull World Health Organ 46: 845-852 Vanier, G., Segura, M., Friedl, P., Lacouture, S., und Gottschalk, M. (2004) Invasion of porcine brain microvascular endothelial cells by Streptococcus suis serotype 2. Infect. Immun. 72: 1441-1449 Varela, N. P., Gadbois, P., Thibault, C., Gottschalk, M., Dick, P., und Wilson, J. (2013) Antimicrobial resistance and prudent drug use for Streptococcus suis. Anim. Health. Res. Rev. 14: 68-77 Vazquez-Laslop, N., Lee, H., und Neyfakh, A. A. (2006) Increased persistence in Escherichia coli caused by controlled expression of toxins or other unrelated proteins. J. Bacteriol. 188: 3494-3497 Vecht, U., Wisselink, H. J., Jellema, M. L., und Smith, H. E. (1991) Identification of two proteins associated with virulence of Streptococcus suis type 2. Infect. Immun. 59: 3156-3162 von Eiff, C. (2008) Staphylococcus aureus small colony variants: a challenge to microbiologists and clinicians. Int. J. Antimicrob. Agents 31: 507-510. von Eiff, C., Peters, G., und Becker, K. (2006) The small colony variant (SCV) concept -- the role of staphylococcal SCVs in persistent infections. Injury 37 (Suppl 2): S26-33. 212 Literaturverzeichnis Wang, K. und Lu C. (2007) Adhesion activity of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in a Chinese Streptococcus suis Type 2 strain. Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr. 120: 207-209 Wangkaew, S., Chaiwarith, R., Tharavichitkul, P., und Supparatpinyo, K. (2006) Streptococcus suis infection: a series of 41 cases from Chiang Mai University Hospital. J. Infect. 52: 455-460 Wasteson, Y., Høie, S., und Roberts, M. C. (1994) Characterization of antibiotic resistance in Streptococcus suis. Vet. Microbiol. 41: 41-49 Willenborg, J., de Greeff, A., Jarek, M., Valentin-Weigand, P., und Goethe, R. (2014) The CcpA regulon of Streptococcus suis reveals novel insights into the regulation of the streptococcal central carbon metabolism by binding of CcpA to two distinct binding motifs. Mol. Microbiol. 92: 61-83 Willenborg, J., Fulde, M., de Greeff, A., Rohde, M., Smith, H. E., Valentin-Weigand, P., und Goethe, R. (2011) Role of glucose and CcpA in capsule expression and virulence of Streptococcus suis. Microbiology 157: 1823-1833 Williams, A. E. und Blakemore, W. F. (1990) Pathogenesis of meningitis caused by Streptococcus suis type 2. J Inf Dis 162: 474-481 Winterhoff, N., Goethe, R., Gruening, P., Rohde, M., Kalisz, H., Smith, H. E., und Valentin-Weigand, P. (2002) Identification and characterization of two temperature-induced surface-associated proteins of Streptococcus suis with high homologies to members of the Arginine Deiminase system of Streptococcus pyogenes. J. Bacteriol. 184: 6768-6776 213 Literaturverzeichnis Wise, R. I. und Spink, W. W. (1954) The influence of antibiotics on the origin of small colonies (G variants) of Micrococcus pyogenes var. aureus. J. Clin. Invest. 33: 1611-1622 Wisselink, H. J., Smith H. E., Stockhofe-Zurwieden, N., Peperkamp, K., und Vecht, U. (2000) Distribution of capsular types and production of muramidase-released protein (MRP) and extracrellular factor (EF) of Streptococcus suis strains isolated from diseased pigs in seven European countries. Vet. Microbiol. 74: 237-248 Wisselink, H. J., Vecht, U., Stockhofe-Zurwieden, N., und Smith, H. E. (2001) Protection of pigs against challenge with virulent Streptococcus suis serotype 2 strains by a muramidase-released protein and extracellular factor vaccine. Vet. Rec. 148: 473-477 Wisselink, H. J., Veldman, K. T., Van den Eede, C., Salmon, S. A., und Mevius, D. J. (2006) Quantitative susceptibility of Streptococcus suis strains isolated from diseased pigs in seven European countries to antimicrobial agents licensed in veterinary medicine. Vet. Microbiol. 113: 73-82 Wiuff, C., Zappala, R. M., Regoes, R. R., Garner, K.N., Baquero, F., und Levin, B. R. (2005) Phenotypic tolerance: antibiotic enrichment of noninherited resistance in bacterial populations. Antimicrob. Agents Chemother. 49: 1483-1494 Ye, C., Bai, X., Zhang, J., Jing, H., Zheng, H., Du, H., Cui, Z., Zhang, S., Jin, D., Xu, Y., Xiong, Y., Zhao, A., Luo, X., Sun, Q., Gottschalk, M., und Xu, J. (2008) Spread of Streptococcus suis sequence type 7, China. Emerging Infect. Dis. 14: 787-791 214 Literaturverzeichnis Yu, H., Jing, H., Chen, Z., Zheng, H., Zhu, X., Wang, H., Wang, S., Liu, L., Zu, R., Luo, L., Xiang, N., Liu, H., Liu, X., Shu, Y., Lee, S. S., Chuang, S. K., Wang, Y., Xu, J., und Yang, W. (2006) Human Streptococcus suis outbreak, Sichuan, China. Emerg. Infect. Dis. 12: 914-920. Zeng, L., Dong, Y., und Burne, R. A. (2006) Characterization of cis-acting sites controlling arginine deiminase gene expression in Streptococcus gordonii. J. Bacteriol. 188, 941-949 Zhang, A., Chen, B., Mu, X., Li, R., Zheng, P., Zhao, Y., Chen, H., und Jin, M. (2009) Identification and characterization of a novel protective antigen, Enolase of Streptococcus suis serotype 2. Vaccine 27: 1348-1353 Zhang, A., Xie, C., Chen, H., und Jin, M. (2008a) Identification of immunogenic cell wall-associated proteins of Streptococcus suis serotype 2. Proteomics 8: 3506-3515 Zhang, C., Ning, Y., Zhang, Z., Song, L., Qiu, H., und Gao, H. (2008b) In vitro antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis strains isolated from clinically healthy sows in China. Vet. Microbiol. 131: 386-392 Ziegler-Heitbrock, H. W., Fingerle, G., Ströbel, M., Schraut, W., Stelter, F., Schütt, C., Passlick, B., und Pforte, A. (1993) The novel subset of CD14+/CD16+ blood monocytes exhibits features of tissue macrophages. Eur. J. Immunol. 23: 2053-2058 Zomer, A. L., Buist, G., Larsen, R., Kok, J., und Kuipers, O. P. (2007) Time-resolved determination of the CcpA regulon of Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363. J. Bacteriol. 189: 1366-1381 215 Literaturverzeichnis Zúñiga, M., Champomier-Verges, M., Zagorec, M., und Pérez-Martínez, G. (1998) Structural and functional analysis of the gene cluster encoding the enzymes of the arginine deiminase pathway of Lactobacillus sake. J. Bacteriol. 180: 4154-4159 216 Anhang 9 Anhang 9.1 Ergebnisse 9.1.1 Kapseldicke der S. suis Serotypen 2 (10) und 9 (A3286/94) während des Wachstumsphasenverlaufs A B *** 10 *** C *** A3286/94 Abbildung 23: Messung der Polysaccharidkapseldicke von S. suis-Stamm 10 (Serotyp 2) und S. suisStamm A3286/94 (Serotyp 9) während des Wachstums. A: Kapseldicke von S. suis-Stamm 10 und A3286/94 in der exponentiellen, stationären und späten stationären (nach 24 h) Wachstumsphase. Dargestellt sind die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen von mindestens 28 Kapseldickemessungen an mehreren einzelnen Bakterien. Die Signifikanz ist angegeben mit *** (t-Test; p-Wert < 0,001). B: Repräsentative TEM-Aufnahme von S.suis-Stamm 10 in der stationären Wachstumsphase nach Lysin-/Ruthenium Rot-Färbung. C: Repräsentative TEM-Aufnahme von S. suis-Stamm A3286/94 in der stationären Wachstumsphase nach Lysin-/Ruthenium Rot-Färbung. 217 Anhang 9.1.2 Überleben von S. suis in PBS exp stat Abbildung 24: Überlebenskinetik der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase in PBS bei 37°C. Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. 9.1.3 Vermehrungsfaktor von S. suis in RPMI-Medium Abbildung 25: Vermehrungsfaktor der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase in RPMI-Medium nach 1 h. Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. 218 Anhang 9.1.4 S. suis (10): Vergleich der Überlebensfähigkeit von kryokonservierten und frisch kultivierten Bakterien nach Gentamicinbehandlung exp stat Abbildung 26: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von kryokonservierten und frisch kultivierten Bakterien (S. suis-Stamm 10) gegenüber der 4-fachen MHK von Gentamicin. Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. 9.1.5 Vergleich der Überlebensfähigkeit von S. suis-Stamm 10 in verschiedenen Medien nach Gentamicinbehandlung exp stat Abbildung 27: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 in RPMI-Medium, RPMIMedium mit 20 % Serumzusatz und THB-Medium gegenüber der 4-fachen MHK von Gentamicin. Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. 219 Anhang 9.1.6 Auswirkungen der MHK von Gentamicin auf die Ausprägung der Antibiotikumtoleranz von S. suis-Stamm 10 im Heritabilitätstest A B C D E F Abbildung 28: Test auf die Vererblichkeit der Gentamicintoleranz in S. suis-Stamm 10 (Heritabilitätstest) in Anwesenheit unterschiedlicher Gentamicin-Konzentrationen. A, C, E: S. suis (10), exponentielle Wachstumsphase. B, D, F: S. suis (10), stationäre Wachstumsphase. A, B: 67-fache MHK von Gentamicin. C, D: 13-fache MHK von Gentamicin. E, F: 4-fache MHK von Gentamicin. A: Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus drei unabhängigen Experimenten. B, C: Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. D, E, F: Dargestellt sind die Ergebnisse aus einem repräsentativen Experiment. 220 Anhang 9.1.7 Überlebenskinetik der erythromycinresistenten Mutante 10∆ccpA und von S. suis-Stamm 10 in Anwesenheit von Erythromycin. Abbildung 29: Überlebenskinetik der erythromycinresistenten Mutante 10∆ccpA und von S. suis-Stamm 10 in Anwesenheit der 100-fachen MHK von Erythromycin. Dargestellt sind jeweils die arithmetischen Mittelwerte und die Standardabweichungen aus zwei unabhängigen Experimenten. 9.1.8 Charakterisierung porziner MNCs anhand der Verteilung von CD-Markern Tabelle 5: Prozentuale Verteilung des CD-Markers CD172a auf porzinen MNCs und die prozentuale high low low high Verteilung der Zellpopulationen CD14 CD163 und CD14 CD163 innerhalb der high low low CD172a-positiven MNCs mit Angabe des Verhältnisses der CD14 CD163 - zur CD14 high CD163 - Population in drei unabhängigen Experimenten. Porzine MNCs high Experiment-Nr. CD172a-pos. (%) CD14 low CD163 (%) low CD14 high CD163 (%) (innerhalb CD172apositiver Zellen) (innerhalb CD172apositiver Zellen) Ratio CD14high CD163low CD14low CD163high 1 2,2 34,6 57,9 0,6 2 2,8 18,9 74,1 0,26 3 5,6 10,7 75,6 0,14 Arithm. Mittel 3,53 21,4 69,2 0,32 221 Anhang 9.1.9 CFSE-Markierung von S. suis A B C D E F G H I J K L M N O 222 Anhang P Q R Abbildung 30: Durchflusszytometrische Darstellung der CFSE-Markierung von kryokonservierten Bakterien der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase. Dargestellt sind repräsentative FACS-Bilder. A-F: S. suis-Stamm 10 aus der exponentiellen (A-C) und stationären Wachstumsphase (D-F). G-L: S. suis-Stamm 10∆cps aus der exponentiellen (G-I) und stationären Wachstumsphase (J-L). M-R: S. suis-Stamm A3286/94 aus der exponentiellen (M-O) und stationären Wachstumsphase (P-R). A, D, G, J, M, P: Darstellung der Morphologie von S. suis als Dichteplot im FSC-/SSC-Kanal. Aufgetragen ist die Größe der Bakterien (FSC/x-Achse) gegen die Granularität (SSC/y-Achse). Die eingegrenzte Region umfasst die S. suis-Populationen, die in B, E, H, K, N und Q bzw. in C, F, I, L, O und R dargestellt sind. B, E, H, K, N, Q: Erfassung des prozentualen Anteils fluoreszierender Bakterien von unmarkierten Bakterien im FL1-/SSC-Kanal. C, F, I, L, O, R: Erfassung des prozentualen Anteils fluoreszierender Bakterien von CFSE-markierten Bakterien im FL1-/SSC-Kanal. 9.1.10 ROS-Produktion verschiedener Zellpopulationen Tabelle 6: ROS-Produktion von MNCs, CD14-positiven Monozyten, CD14-negativen MNCs (Lymphozyten) und Granulozyten ohne Stimulation und nach Stimulation mit S. suisStamm 10 und 10∆cps mit Angabe des Verhältnisses der ROS-Produktion stimulierter Zellen zur ROS-Produktion unstimulierter Zellen in drei unabhängigen Experimenten. Zellpopulationen: Fluoreszenzintensität (Ratio stimuliert/unstimuliert) Stimulation und Experiment-Nr. MNCs CD14-positive Monozyten CD14-negative MNCs (Lymphozyten) Granulozyten unstimuliert (ohne Bakterien) 1 2 3 7.273 6.525 3.856 32.385 17.746 19.644 8.130 6.623 3.890 16.166 12.408 10.593 stimuliert mit 10 (WT) 1 2 3 7.306 (1,00) 28.661 (0,89) 4.302 (0,66) 4.498 (1,17) 16.395 (0,92) 18.125 (0,92) 8.666 (1,07) 5.199 (0,78) 3.849 (0,98) 32.493 (2,01) 16.156 (1,30) 19.384 (1,83) stimuliert mit 10∆cps 1 2 3 9.496 (1,31) 3.932 (0,60) 5.206 (1,35) 120.172 (3,71) 42.941 (2,42) 204.393 (10,40) 7.848 (0,97) 5.075 (0,77) 4.098 (1,05) 1.377.803 (85,23) 76.869 (6,19) 298.191 (28,15) 223 Anhang 9.2 Reagenzien, Materialien, Geräte und Software 9.2.1 Reagenzien und Chemikalien Aceton Roth, Karlsruhe Acrylamid Roth, Karlsruhe Ammoniumpersulfat (APS) Roth, Karlsruhe AP-Juice p. j. k., Kleinbittersdorf Biocoll Biochrom, Darmstadt Bovines Serum Albumin (BSA) Serva, Heidelberg BSA-Standard Thermo Fisher Scientific, Schwerte Cacodylat Merck, Darmstadt Carbonyl cyanide m-chlorphenyl hydrazone (CCCP) Merck, Darmstadt Colostrum deprived serum (CDS) eigene Gewinnung Columbia Blutagar Basis Oxoid, Wesel Columbia Agarplatten mit 7% Schafblut Oxoid, Wesel Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat Roth, Karlsruhe (Na2HPO4 * 2H2O) Dihydrorhodamin (DHR) 123 Sigma, Taufkirchen Dimethylsulfoxid (DMSO) Sigma, Taufkirchen Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) Roth, Karlsruhe Ethanol Roth, Karlsruhe Fetal calf serum (FCS) Biochrom, Darmstadt Formaldehyd Roth, Karlsruhe Formaldehyd, methanolfrei Polyscience, Eppelheim Glycin Roth, Karlsruhe Glyzerol Roth, Karlsruhe Kaliumchlorid (KCl) Merck, Darmstadt Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4) Merck, Darmstadt L-Lysinacetat Sigma, Taufkirchen 224 Anhang Latexbeads Sigma, Taufkirchen (sulfatmodifiziert, Durchmesser 1 µm, orangefarbene Fluoreszenz) LR White resin London resin company, Reading (England) Methanol Roth, Karlsruhe Milchpulver Sucofin, Edeka, Hannover Natrium-EDTA (Na-EDTA) Roth, Karlsruhe Natriumcarbonat (Na2CO3) Roth, Karlsruhe Natriumchlorid (NaCl) Roth, Karlsruhe Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) Roth, Karlsruhe Natriumazid Sigma, Taufkirchen Noble Agar Difco, Heidelberg Osmiumtetroxid Roth, Karlsruhe PageRuler™ Prestained Protein Ladder #26619 Fermentas, St. Leon-Rot Paraformaldehyd Roth, Karlsruhe Phosphate buffered saline (PBS) + Ca 2+ Gibco, Darmstadt Prolong® Gold mit Dapi Invitrogen, Darmstadt Propidiumjodid (PJ) Sigma, Taufkirchen Roti Load (4 x) Roth, Karlsruhe RPMI-Medium 1640 Gibco, Darmstadt Ruthenium Rot Sigma, Taufkirchen Salzsäure (HCl) Roth, Karlsruhe Saponin Roth, Karlsruhe Sodium dodecyl sulphate (SDS) Roth, Karlsruhe TEMED Roth, Karlsruhe Todd Hewitt broth (THB) Difco, Heidelberg Tris-(hydroxymethyl-)aminomethan (Tris) Roth, Karlsruhe Tween 20 Roth, Karlsruhe Uranylacetat Science Services, München 225 Anhang 9.2.2 Kits Bio-Rad-DC-Protein-Assay Bio-Rad, München CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit Invitrogen, Darmstadt 9.2.3 Verbrauchsmaterialien 96-well-Mikrotiterplatte (Rundboden) Sarstedt, Nümbrecht Aluminiumfolie Roth, Karlruhe Breathe Easy®-Folie Sigma, Taufkirchen Dauermagnet (MiniMACS™ Separator) Miltenyi, Bergisch Gladbach Deckgläser IDL, Nidderau Kryoröhrchen, 2 ml Roth, Karlsruhe Mikroliterküvetten Sarstedt, Nümbrecht MS-Säule (MS Column) Miltenyi, Bergisch Gladbach Neubauer-Zählkammer Brand, Wertheim Objektträger Roth, Karlsruhe Pipettenspitzen, 200 µl (gelb) Starlab, Hamburg Pipettenspitzen, 1000 µl (blau) Starlab, Hamburg PVDF-Membran Millipore, Darmstadt Reaktionsgefäße, 1,5 ml Sarstedt, Nümbrecht Reaktionsgefäße, 2,0 ml Sarstedt, Nümbrecht Röhrchen, 12 ml Greiner, Frickenhausen Röhrchen, 14 ml Roth, Karlsruhe Röhrchen, 50 ml Sarstedt, Nümbrecht Sterilfilter Steritop™ Express Plus Millipore, Darmstadt Whatman® Filterpapier, 3 mm Hartenstein, Würzburg 9.2.4 Geräteverzeichnis Analysenwaage (80-400 g), Sartorius über Landgraf, Hannover Analysenwaage BA61 (0-60 g), Sartorius über Landgraf, Hannover Blockthermostat BT 100, Kleinfeld-Labortechnik, Hannover 226 Anhang Blottingapparatur Trans-Blot™ Semi Dry, Bio-Rad, München Durchflusszytometer BD accuri™ C6, BD, Heidelberg Durchflusszytometer FACscan®, BD, Heidelberg Eismaschine Manitowoc über Landgraf, Hannover Fluoreszenzmikroskop Nikon Eclipse Ti-S, Nikon, Düsseldorf Fluoreszenzmikroskop (konfokal) TCS SP5, Leica, Wetzlar Gefrier-/Kühlkombination Comfort, NoFrost, Liebherr, Ochsenhausen Gefrierschrank (-80°C) HeraFreeze, HFU-T series, Thermo Scientific, Schwerte Geldokumentationsgerät Chemo Cam Imager 3.2, Intas, Göttingen Kühlzentrifuge 5810R, Eppendorf, Hamburg Kühlzentrifuge Hereaus™ Multifuge™ 1S-R, Thermo Scientific, Schwerte (Zentrifugation von Volumina bis 2 ml) Kühlzentrifuge Heraeus™ Megafuge™ 1.0R, Thermo Scientific, Schwerte (Zentrifugation von Volumina bis 50 ml) Kühlzentrifuge Z 400 K, Hermle, Wehingen (Zentrifugation von eukaryotischen Zellen) Laufkammer für SDS-PAGE, Sigma, Taufkirchen Multifunktionsmessgerät GENios Pro, Tecan, Crailsheim pH-Meter pH 197, WTW, Weilheim Photometer BioPhotometer, Eppendorf, Hamburg Photometer Ultrospec® 2000, Pharmacia, Freiburg Pipettboy, Tecnomara, Fernwald Pipetten, Gilson, Frankreich Rotator, Fröbel Labortechnik über Landgraf, Hannover Scanner perfection V700, Epson, Meerbusch Schütteltisch AM Microshaker, Dynex Dynatech, Langenau Schwenktisch Rotamax 120, Heidolph über Landgraf, Hannover Spannungsgerät PowerPac 200, Bio-Rad, München Tischzentrifuge Hereaus™ Biofuge™ pico, Thermo Scientific, Schwerte (Zentrifugationen von Volumina bis 2 ml bei RT) Transmissionselektronenmikroskop TEM 910, Zeiss, Jena 227 Anhang Vortex, Heidolph über Landgraf, Hannover Vortex Genie-2, Roth, Karlsruhe 9.2.5 Software Durchflusszytometerie: BD accuri™ C6 Software (BD), winMDI-Software Version 2.9 Fluoreszenzmikroskopie: NIS Elements software BR 3.2 (Nikon) Geldokumentation: Chemostar Aufnahmesoftware (Intas) Graphenerstellung: GraphPad Prism 5 Konfokale Fluoreszenzmikroskopie: LAS-Auswertesoftware (Leica) Transmissionselektronenmikroskopie: ITEM-Software 5.0 (Olympus Soft Imaging Solutions) 228 Anhang 9.3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Wachstumskinetiken ausgewählter S. suis-Stämme und isogener Mutanten (A) sowie weiterer Streptokokken-Spezies (B) in THBMedium. 87 Abbildung 2: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber der 100-fachen MHK verschiedener Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen über die Zeit. ........................................... 92 Abbildung 3: Test auf die Vererblichkeit der Gentamicintoleranz in S. suisStamm 10 (Heritabilitätstest). ......................................................................... 95 Abbildung 4: Test auf Eliminierung von S. suis-Persisterzellen. ............................... 97 Abbildung 5: Koloniemorphologie von S. suis-Stamm 10 nach Antibiotikumbehandlung. ................................................................................ 98 Abbildung 6: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 gegenüber der Kombination eines Aminoglykosid- und eines β-LaktamAntibiotikums................................................................................................ 102 Abbildung 7: Einfluss der PMF-Hemmung auf die Gentamicintoleranz von S. suis-Stamm 10. ........................................................................................ 104 Abbildung 8: Wachstumsphasenabhängige Gentamicintoleranz von S. suis- Stamm 10 und der Stoffwechselmutanten 10∆ccpA, 10∆flpS, 10∆arcD und 10∆AD................................................................................................... 107 Abbildung 9: Wachstumsphasenabhängige Gentamicintoleranz der S. suis- Stämme 10 (Serotyp 2), A3286/94 (Serotyp 9) und 05ZYH33 (Serotyp 2). .................................................................................................. 110 Abbildung 10: Antibiotikatoleranz ausgewählter Vertreter der Gattung Streptococcus. ............................................................................................. 113 Abbildung 11: Präparation porziner MNCs und deren Charakterisierung anhand spezifischer Oberflächenmoleküle (CD-Marker).............................. 119 Abbildung 12: Anreicherung porziner CD14-positiver MNCs (Monozyten) und deren Charakterisierung anhand spezifischer Oberflächenmoleküle (CDMarker)......................................................................................................... 122 229 Anhang Abbildung 13: Assoziation von fluoreszierenden unbehandelten bzw. IgG- beladenen Latexbeads mit porzinen CD14-positiven Monozyten. ............... 125 Abbildung 14: Überlebensfaktor der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in Anwesenheit porziner CD14-positiver Monozyten nach 3 h. .... 127 Abbildung 15: Assoziation der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 mit porzinen CD14-positiven Monozyten nach 1 h............................................. 129 Abbildung 16: Wachstumsphasenabhängige Assoziation CFSE-markierter S. suis-Stämme mit porzinen CD14-positiven Monozyten. .......................... 132 Abbildung 17: Darstellung der Assoziation von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 mit porzinen CD14-positiven Monozyten. .................................... 134 Abbildung 18: Internalisation von S. suis-Stamm 10, 10∆cps und A3286/94 durch porzine CD14-positive Monozyten. .................................................... 136 Abbildung 19: TEM-Aufnahmen von porzinen CD14-positiven Monozyten mit adhärenten und intrazellulären Streptokokken. ............................................ 139 Abbildung 20: Auswirkung der S. suis-Stämme 10, 10∆cps, 10∆sly und A3286/94 auf die Morphologie und Vitalität porziner CD14-positiver Monozyten nach 3 h Ko-Inkubation. ............................................................. 141 Abbildung 21: Immunoblot zur Detektion sezernierten Suilysins im Überstand nach 3 h Infektion porziner CD14-positiver Monozyten mit S. suis-Stamm 10, A3286/94, 10∆sly und 10∆cps. .............................................................. 143 Abbildung 22: ROS-Produktion porziner MNCs und CD14-positiver Monozyten ohne Stimulation und nach Stimulation mit S. suis-Stamm 10 und 10∆cps. ................................................................................................. 146 Abbildung 23: Messung der Polysaccharidkapseldicke von S. suis-Stamm 10 (Serotyp 2) und S. suis-Stamm A3286/94 (Serotyp 9) während des Wachstums. ................................................................................................. 217 Abbildung 24: Überlebenskinetik der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase in PBS bei 37°C. .............................................................................................. 218 230 Anhang Abbildung 25: Vermehrungsfaktor der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase in RPMI-Medium nach 1 h. .............................................................................. 218 Abbildung 26: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von kryokonservierten und frisch kultivierten Bakterien (S. suis-Stamm 10) gegenüber der 4fachen MHK von Gentamicin. ...................................................................... 219 Abbildung 27: Wachstumsphasenabhängige Toleranz von S. suis-Stamm 10 in RPMI-Medium, RPMI- Medium mit 20 % Serumzusatz und THBMedium gegenüber der 4-fachen MHK von Gentamicin. ............................. 219 Abbildung 28: Test auf die Vererblichkeit der Gentamicintoleranz in S. suis- Stamm 10 (Heritabilitätstest) in Anwesenheit unterschiedlicher Gentamicin-Konzentrationen........................................................................ 220 Abbildung 29: Überlebenskinetik der erythromycinresistenten Mutante 10∆ccpA und von S. suis-Stamm 10 in Anwesenheit der 100-fachen MHK von Erythromycin. ............................................................................................... 221 Abbildung 30: Durchflusszytometrische Darstellung der CFSE-Markierung von kryokonservierten Bakterien der S. suis-Stämme 10, 10∆cps und A3286/94 in der exponentiellen und stationären Wachstumsphase............. 223 231 Anhang 9.4 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Expressionsmuster von CD172a, CD163, CD14 und SLA-II innerhalb Subsets porziner Monozyten und deren Reifegrad (modifiziert nach Chamorro et al., 2005) .......................................................................... 37 Tabelle 2: Zusammenfassung der MHK-Bestimmungen für die entsprechenden S. suis-Stämme und Spezies. ............................................. 59 Tabelle 3: Behandlung und eingesetzte Zellzahl der porzinen MNCs und CD14-positiven Monozyten in den Experimenten (Zusammenfassung) ....... 65 Tabelle 4: Bestimmung der MHK ausgewählter Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen für S. suis- Stamm 10.......................................................... 90 Tabelle 5: Prozentuale Verteilung des CD-Markers CD172a auf porzinen MNCs und die prozentuale Verteilung der Zellpopulationen CD14high CD163low und CD14low CD163high innerhalb der CD172a-positiven MNCs mit Angabe des Verhältnisses der CD14high CD163low- zur CD14low CD163high- Population in drei unabhängigen Experimenten. ........................ 221 Tabelle 6: ROS-Produktion von MNCs, CD14-positiven Monozyten, CD14- negativen MNCs (Lymphozyten) und Granulozyten ohne Stimulation und nach Stimulation mit S. suis-Stamm 10 und 10∆cps mit Angabe des Verhältnisses der ROS-Produktion stimulierter Zellen zur ROSProduktion unstimulierter Zellen in drei unabhängigen Experimenten. ....... 223 232 Danksagung Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Peter Valentin-Weigand für das Ermöglichen dieser Dissertation und für seine gute Betreuung und Unterstützung bei Problemen jeglicher Art bedanken. Ein sehr großer Dank gilt Herrn Dr. Jörg Willenborg, der mich lange begleitet und sehr gut fachlich betreut hat. Danke für dein stets offenes Ohr – sei es für fachliche oder zwischenmenschliche Belange –, deine Geduld und Anregungen. Bei Herrn Prof. Dr. Ralph Goethe bedanke ich mich für sein Interesse am Thema und seine hilfreichen Ratschläge und bei Herrn PD Dr. Ralph Bertram für seine fachkompetente Beratung und für die Tipps bei der Versuchsplanung. Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Manfred Rohde für das Erstellen der TEM-Aufnahmen. Den Mitarbeitern der Klinik für kleine Klauentiere danke ich für das Bereitstellen von Blutproben und den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe Immunologie für die Unterstützung bei den FACS-Analysen. Bei Herrn Prof. Dr. Christoph Georg Baums bedanke ich mich für seine Ideen, die auch maßgeblich zum Zustandekommen dieser Dissertation beigetragen haben, und für die tolle Zeit in San Francisco. Vielen Dank an Herrn Jörg Merkel für die geduldige Hilfe bei allen Computer-, Statistik- und Formatierungsproblemen, sowie für die kulinarische Versorgung. Frau Sabine Baumert danke ich für die große Unterstützung hinsichtlich jeglicher organisatorischer Belange. Der DFG danke ich für die finanzielle Förderung im Rahmen des SFB 587. Dankeschön an alle Kollegen und Ex-Kollegen, mit denen ich in der Mibi zusammenarbeiten durfte, für die Unterstützung und die tolle Arbeitsatmosphäre. Ganz herzlich bedanke ich mich bei Tina Basler, Sabine Baumert, Christoph Baums, Nadine Büttner, Nicole de Buhr, Sabrina Diehl, Anna Drees, Elke Eckelt, Antonio Eramo, Marcus Fulde, Sabine Göbel, Lena Hillermann, Nina Janze, Anna Koczula, Jochen Meens, Jörg Merkel, Kristin Laarmann, Thorsten Meißner, Andreas Nerlich, Nantaporn Ruangkiattikul, Silke Schiewe, Anja Schulze, Jana Seele, Maren Seitz, Matthias Stehr, Mathias Weigoldt, Yenehiwot Berhanu Weldearegay und Jörg Willenborg für das phantastische kollegiale Verhältnis, die schöne Zeit und den Spaß, den wir zusammen hatten. Insbesondere möchte ich mich bei der “Streptoconga-Büro & Co GmbH“ für die allerbesten Kommunikationen, Ideen und Aktionen bedanken. Es war toll mit Euch und ich danke für Eure Freundschaft! Ganz besonders bedanke ich bei meinen Mädels Anja, Anne, Athena, Bianca, Birte, Donata, Eva, Kathrin, Kris, Maren, Melanie, Sarah, Ulla, Wiebke und Yvonne. Danke für Eure Unterstützung, Geduld, Gespräche, und dass ihr immer für mich da seid. Ihr seid die besten Freundinnen, die ich mir vorstellen kann. Stephan, Dir danke ich von Herzen für Deine Motivation, Dein Vertrauen und Deinen Rückhalt. Außerdem ein riesengroßes Dankeschön für das Notebook, das die Vervollständigung der Dissertation um einiges erleichtert hat. Mein größter Dank gilt meinem Vater Wilfried. Durch Deine Geduld und Unterstützung in jeglicher Hinsicht war mein Werdegang bis hierher erst möglich.