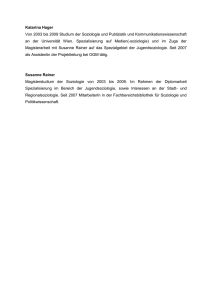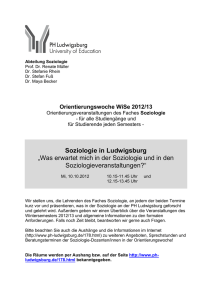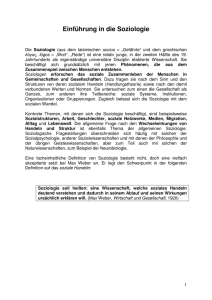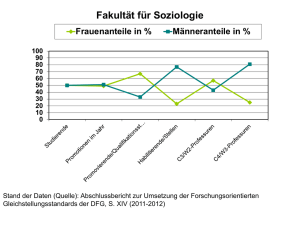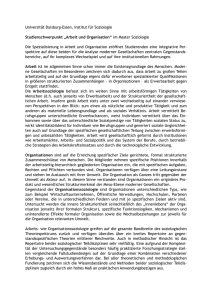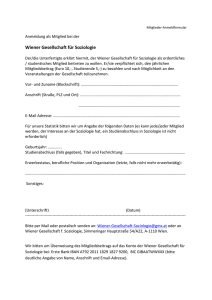`Einheit` der Soziologie unmöglich ist
Werbung

1 [Zitierhinweis: In eckigen Klammern jeweils die Seitenzahlen der Druckfassung] In: Uwe Schimank/ Rainer Greshoff (Hg.): Was erklärt die Soziologie? Methodologien, Modelle, Perspektiven, Münster, S. 65- 77. Warum die 'Einheit' der Soziologie unmöglich ist: Die Dynamik theoretischer Differenzproduktion und die Selbsttransformation der Moderne Andreas Reckwitz [Druckfassung: 65] 1. Ist es möglich, dass die Soziologie über alle konzeptuellen Differenzen hinweg eine theoretische Einheit entwickelt? Ist es denkbar, dass sie eine einzige 'grand theory' produziert, die einen universalen Rahmen für materiale Analysen absteckt und diesen universalen Status auch in der historischen Entwicklung des Faches zu stabilisieren vermag? Und ist die solche Entwicklung eines universalen Theorierahmens wünschenswert oder eher als Fortschrittshemmnis zu vermeiden? Diese Fragen sind in der Geschichte der Soziologie alles andere als neu. Die bisherige Erfahrung mit einhundertfünfzig Jahren Wissenschaftsgeschichte der Disziplin, mit der generellen kulturellen Logik der Entwicklung jener symbolischen Codes, die wir 'Theorien' nennen, legt für mich eine eindeutig negative Antwort nahe: Die Soziologie - und darin unterscheidet sie sich nicht von anderen humanwissenschaftliche Disziplinen - vermag keine theoretische Einheit einer 'grand theory' zu entwickeln, die von allen anerkannt ist, und dieses Denkexperiment weist auch nicht in eine erstrebenswerte Richtung. Ich möchte zur Begründung dieser These zwei miteinander verknüpfte Argumente zu bedenken geben: das erste ist ein wissenschafts- und kultursoziologisches Argument, das darauf hinweist, dass die Theorieentwicklung in der Soziologie die eigentümliche Form einer Generierung neuer theoretischer Differenzen gerade durch die fortwährende Formulierung von Synthesevokabularen genommen hat. Theoriesynthesen wollen das Theoriefeld 'schließen', tatsächlich und unintendiert aber öffnen sie dieses Feld für die Produktion von Gegenvokabularen. Die Idee einer letzten vereinheitlichenden Synthese, einer 'theory to end all theories' muss dann fiktiv erscheinen und berücksichtigt nicht ihre eigenen Folgen im sozialen Feld Wissenschaft, die paradoxerweise das Gegenteil dessen befördern, was sie beabsichtigen. Das zweite Argument lautet: die Soziologie ist in ihrem Grundverständnis um die Frage zentriert, was das Moderne der modernen Gesellschaft ausmacht. Die Antwort auf diese Frage verändert sich jedoch mit dem 2 Strukturwandel der modernern Gesellschaft und Kultur selbst - in einem spezifischen Sinne muss die Soziologie dann in ihrem Kern eine ideographische Wissenschaft sein. Diese permanente Selbsttransformation des Gegenstandes jedoch verunmöglicht dauerhafte, quasi zeitlose Großtheorien - und gleichzeitig verschiebt der realkulturelle Wandel auch [Druckfassung: 66] die soziologischen Vokabulare des Sozialen. Im Verhältnis zum Vortrag von Gesa Lindemann möchte ich daher in zweifacher Hinsicht eine anders akzentuierte Position vertreten. Ich möchte nahe legen, die Entwicklung der Soziologie nicht allein aus der Lakatos'schen Teilnehmerperspektive, sondern auch aus der kultursoziologischen Beobachterperspektive zu betrachten. Das Ergebnis einer solchen Blickverschiebung lautet, gegen ein 'modernisierungstheoretisches' Verständnis der Wissenschaftsentwicklung die agonale Dynamik der Theorieentwicklung freizulegen, die sich als eine Sequenz von Kulturkonflikten und Differenzproduktionen darstellt. Gleichzeitig möchte ich gegen die im Kern Parsonsianische Festlegung der Soziologie auf eine 'Wissenschaft des Sozialen' und der sozialen Ordnung ein Verständnis der Soziologie als Wissenschaft der Moderne in Stellung bringen, welche die Frage nach der möglichen Konsensualiät einer soziologischen 'grand theory' zusätzlich verkompliziert. 2. Wie lässt sich das Verhältnis zwischen unterschiedlichen soziologischen Theorievokabularen seinerseits 'metatheoretisch' modellieren? Welche Form sollte ein 'Vergleich' von Sozialtheorien annehmen? Um dieses Problem anzugehen, kann man sich sicherlich nicht darauf beschränken, statisch diverse Theorien einander gegenüberzustellen. Vielmehr ist eine diachrone Analyse der historischen Entwicklung von Theorien nötig - hierin stimme ich mit Gesa Lindemann und mit der wissenschaftstheoretischen und -historischen Diskussion der letzten Jahrzehnte seit Kuhn (1962) und Foucault (1966), Popper (1972) und Toulmin (1972) überein. Eine Rekonstruktion der Wissenschafts- und Theorieentwicklung kann allerdings aus zwei ganz unterschiedlichen, nicht aufeinander reduzierbaren Blickwinkeln betrieben werden: aus einer Teilnehmer- und aus einer Beobachterperspektive. Mit der 'Teilnehmerperspektive' ist hier keine Analyse der subjektiven Sinnhorizonte einzelner Wissenschaftler gemeint, vielmehr eine Binnenperspektive auf die Wissenschaftsentwicklung, die sich aus einem Interesse an der rationalen Weiterentwicklung der Disziplin speist: Die Teilnehmerperspektive heftet sich an die immanenten Geltungsansprüche auf Wahrheit und Plausibilität, welche die Theorien erheben. Die 'Beobachterperspektive' ist demgegenüber eine kultursoziologische Perspektive, die Wissenschaft analog anderen sozialkulturellen Praxisformaten betrachtet und an einem Verstehen ihrer realen kulturellen Funktionsweise interessiert ist. Damit werden die Rationalitätsansprüche der Theorien einklammert: sie werden 3 jenseits aller wissenschaftlichen Wahrheitsansprüche als kulturelle Codes, als Vokabulare interpretiert, die [Druckfassung: 67] sich in bestimmten Praktiken des sozialen Feldes 'Wissenschaft' ausbilden. Imre Lakatos' (1978) Version des Kritischen Rationalismus, sein Projekt der Analyse der Genese von Forschungsprogrammen und ihrer Überprüfung argumentiert aus der Teilnehmerperspektive, sie speist sich aus dem Interesse eines 'Vergleichs' der Reichweite und Fruchtbarkeit von Theorien. Um den Zweck einer 'rationalitätstheoretisch' imprägnierten Wissenschaftsgeschichte zu verfolgen, liefert Lakatos das avancierteste Instrumentarium.1 Eine kultursoziologische Perspektive auf die Theorieentwicklung, ihre Analyse der theoretischen Vokabulare aus der Beobachterperspektive, die für das Feld der Naturwissenschaften Thomas S. Kuhn und die französischen Wissenschaftshistoriographie um Bachelard und Canguilhem auf den Weg gebracht haben, liefert ein notwendiges Korrektiv zur rationalistischen Teilnehmerperspektive: Die Soziologie kann sich hier selbst zum Gegenstand nehmen. Nun erscheint sie als ein sozial-kulturelles Konfliktfeld, dessen tatsächliche Entwicklung normativen Erwartungen und Intentionen bezüglich progressiver Forschungsprogramme nicht entsprechen muss. Eine solche wissenschafts- und kultursoziologische Perspektive auf die Theorieentwicklung macht einen auf den ersten Blick möglicherweise verblüffenden Sachverhalt deutlich: die Formulierung von soziologischen Synthesevokabularen produziert keine theoretische Einheit, sondern wirkt genau umgekehrt als Differenzgenerator. Der Versuch, ein bestimmtes Theorievokabular als universal, als Synthese zu präsentieren, damit das theoretische Feld zu schließen, provoziert regelmäßig die Reaktion, diesen Allgemeinheitsanspruch in Frage zu stellen, die Selektivität des Theorievokabulars zu demonstrieren, es mit Alternativen zu konfrontieren und damit das theoretische Feld erneut zu öffnen. Dieser paradoxe Zusammenhang von Differenzgenerierung qua Einheitsanspruch wird in bezug auf die kulturelle Dynamik von sozialen Diskursen insgesamt in instruktiver Weise von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (1985, vgl. auch Torfing 1999) thematisiert und lässt sich - während er bei Mouffe/ Laclau in erster Linie auf politische Diskurse bezogen wird - auf die dynamische Entwicklung wissenschaftlicher Vokabulare anwenden. Nach Laclau/ Mouffe ist für gesellschaftliche Diskurse (die hier generell als Sinngeneratoren verstanden werden) insbesondere unter Verhältnissen der Moderne der Versuch der Installierung von 'Hegemonien' kennzeichnend: Diskurse versuchen sich als alternativenlos zu präsentieren, ihre eigene Kontingenz als Sinnsystem zu invisibilisieren, sich als die 'natürliche Sicht der Dinge' darzustellen, kurz: sie versuchen sich als 'universalen Horizont' zu installieren. Diese kulturellen Hegemonien [Druckfassung: 68] untermininieren sich jedoch aufgrund der Logik des 1Vgl. hierzu auch Reckwitz (2000), S. 194ff. 4 Kulturellen langfristig selbst, sie produzieren ebenso systematisch wie unintendiert ihre eigene Opposition, welche die Hegemonie umstürzt. Zentral für diese Logik des Kulturellen ist die Konstitution von Identität über Differenz, über ein 'konstitutives Außen' und die immanente Heterogenität von hegemonialen Diskursen (die Mouffe/ Laclau ein wenig missverständlich mit Althussers und Freuds Begriff der 'Überdetermination' umschreiben). Hegemoniale Diskurse enthalten keine vorgängige semiotische Einheit, ihre zentralen Signifkaten/ Signifikate werden bedeutungsvoll nur in Abgrenzung zu dem, was sie nicht bezeichnen, was sie verwerfen: Differenz geht der Identität voraus, eine Differenz zu einem abgelehnten 'konstitutiven Außen'. Diese Differenzmarkierung gegenüber einem kulturellen Anderen setzt jedoch notwendig voraus, dass dieses 'Andere' nicht ignoriert, sondern beständig thematisiert wird, es im Diskurs präsent ist. An das zugleich abwesende wie anwesende kulturell Andere kann sich damit positives Interesse und Faszination knüpfen. Das kulturelle Andere wird vom herrschenden Diskurs als ein bloßes, ergänzendes 'Supplement' (Derrida) behandelt, aber gerade dieses Supplement kann in einer quasi-dialektischen Umkehrung des Blicks im Laufe der Zeit als das 'eigentliche Fundament' entdeckt werden; das bisherige 'Fundament' erscheint dann als bloße Ableitung (vgl. etwa die Differenz Mann/ Frau, Produktion/ Konsumtion, Individualität/ Sozialität etc.) Diese Unterminierung dominanter Diskurse wird dadurch erleichtert, dass sich diese zwar regelmäßig als homogen und eindeutig präsentieren, sie tatsächlich jedoch von Heterogenitäten und Polysemien, von immanenten Fissuren durchzogen sind, die jede 'fixity of meaning' destabilisieren: Dominante Diskurse sind regelmäßig 'überdeterminiert' (und damit paradoxerweise unterdeterminiert) in jenem Sinne, dass sie kontingente Produkte verschiedenster signifikativer Einflusslinien darstellen; diese laden die Diskurse mit verschiedenen Bedeutungsebenen auf und implantieren in ihnen Mehrdeutigkeiten, die der Dekonstruktion leichtes Spiel bereiten.2 Die Präsenz der Abgrenzung von einem konstitutiven Außen und die polysemische Überdetermination des Diskurses höhlen damit jeden hegemonialen Horizont von innen aus: Die immanenten Fissuren locken Alternativdiskurse hervor, die 'den Spieß umdrehen', das diskriminierte Außen stark machen und die Mehrdeutigkeiten innerhalb des dominanten Diskurses [Druckfassung: 69] gegeneinander ausspielen. Der Universalitätsanspruch eines Diskurses wirkt damit paradoxerweise als Differenzgenerator. Man kann sicherlich bezweifeln, ob es zumindest in der Soziologie 'hegemoniale Diskurse' - die Kuhns Paradigmen ähneln - in einem strikten Sinne je gegeben hat. In jedem Fall jedoch haben sich in der Theoriegeschichte immer wieder Versuche ergeben, über theoretische Synthesen 'Supertheorien' zu formulieren, die mit einem universalen 2Freud 5 Anspruch auftreten. Sobald man diese Vokabulare jedoch nicht mit Lakatos als progressive Sequenz sich steigernder Problemlösungsfähigkeit, sondern mit Laclau/ Mouffe als fragile Universalisierungsversuche modelliert, wird man ihrer Bedeutung als unintendierte Differenzgeneratoren gewahr. Die Theoriegeschichte stellt sich dann nicht mehr modernisierungstheoretisch als eine lineare Entwicklung zunehmender Problembearbeitungskompetenz (oder gar mit Popper: der 'Wahrheitsannäherung') dar, sondern kulturtheoretisch als ein ständiger agonaler Konflikt differenter, aber selbst ex negativo voneinander abhängiger Vokabulare, als ein - wenn man es mit Max Webers Pathos formulieren mag - ein konzeptueller 'Kampf der Götter'. Die Ansätze von Talcott Parsons und Pierre Bourdieu liefern gute Beispiele für diese agonale Dynamik der Theorieentwicklung, die durch Supertheorien angetrieben wird. Parsons' normorientierte Handlungserklärung in "The Structure of Social Action" (1937) liefert den Prototyp für ein soziologisches Synthesevokabular, das sich zudem der Rhetorik einer Konvergenz bedient: Hier erscheinen die jeweils zur Hälfte gelungenen theoretischen Problemlösungsversuche der positivistischen und der idealistischen Handlungstheorien in der eigenen normorientierten Handlungstheorie rational aufgehoben. Parsons bedient sich der Strategie einer konzeptuellen Universalisierung, er versucht tatsächlich eine kulturelle Hegemonie zu errichten. Dabei muss er jedoch sowohl ein 'konstitutives Außen' präsent halten als auch sich durch verschiedene Theorietraditionen 'überdeterminieren' lassen, die nicht vollständig zusammenpassen. Parsons' beständige Abgrenzung gilt einem 'individualistischen' oder 'subjektivistischen' Vokabular, das von der Figur eines eigeninteressierten oder interpretierenden Subjekts ausgeht. In der Abgrenzung hält er dieses Vokabular damit gleichzeitig als Alternative präsent. Gleichzeitig ist sein eigenes Vokabular weder homogen noch eindeutig, sondern infolge der synthetisierenden Rezeption verschiedener Vorgängertheorien, der 'Überdetermination' durch diese voll von Polysemien: es ist sowohl handlungstheoretisch als auch funktionalistisch ausgerichtet; es ist am Modell eines normorientierten homo sociologicus orientiert, aber enthält auch Momente eines kulturtheoretischen 'animal symbolicum'. [Druckfassung: 70] Parsons' soziologische Supertheorie par excellence hat als ein theoretischer Differenzgenerator ohne historischen Vergleich in der Soziologiegeschichte wirken können. Die Opponenten konnten an Parsons' ausgeschlossenen und zugleich repräsentierten 'Gegner', den Subjektivismus, anschließen und das, was Parsons als bloß residuales 'Supplement' einführt, als 'tatsächliche Grundlage' des Sozialen präsentieren; sie konnten schließlich die heterogenen Elemente innerhalb Parsons' Theoriesystem dekonstruieren und sie gegeneinander ausspielen. Parsons Strukturfunktionalismus hat so eine Fülle von Gegenvokabularen produziert, die alle den Allgemeinheitsanspruch 6 angezweifelt haben (aber ex negativo auf ihn bezogen bleiben): George Caspar Homans Verhaltenstheorie, Erving Goffmans, Aaron Cicourels und Harold Garfinkels interpretativer Ansatz, der bis hin zu Anthony Giddens' Strukturierungstheorie reicht, aber auch die Neuprofilierung der Rational Choice Theorie bei James Coleman und Raymond Boudon und die Konflikttheorie bei Dahrendorf und Randall Collins. Eine ähnliche dialektische Bewegung von Schließung und Öffnung lässt sich in Reaktion auf Pierre Bourdieus groß angelegtes Unternehmen einer neostrukturalistischen Kulturtheorie beobachten. Ironischerweise liefert Bourdieu selbst einen dezidiert post-parsonsianischen Ansatz, der seinerseits jene 'Öffnung' des Theoriefeldes betrieben hat, die auf Parsons' orthodoxen Konsensus folgte (vgl. Bourdieu 1972, 1979): Bourdieus Öffnung wird unweigerlich selbst zur Schließung, indem sie in eine neue, mit universalem Anspruch auftretende Sozialtheorie mündet. Auch diese Universalisierung prozessiert über den Weg einer 'Synthese': was hier zu synthetisieren und in ihren Defiziten zu überwinden ist, ist der Strukturalismus und der interpretative Ansatz, ist gleichzeitig der Kulturalismus und der Materialismus. Gleichzeitig bleibt Bourdieus Ansatz von Heterogenitäten durchzogen: dem Anspruch einer 'Theorie der Praxis' und Tendenzen zum Strukturdeterminismus, einem dezidierten Kulturalismus symbolischer Formen und einem Materialismus determinierender Kapitalformen. Zumindest auf Frankreich bezogen hat gerade Bourdieus universalisierender Anspruch alles andere als eine faktische Vereinheitlichung der Soziologie, sondern wiederum mannigfache theoretische Differenzen hervorgebracht, die Bourdieus Ansatz von seinen Rändern her dekonstruieren: von Luc Boltanskis und Laurent Thévenots ethnomethodologischer "De la justification" bis Bruno Latours Theorie der Artefakte und Bernard Lahirs Konzeption eines nicht-homogenen Subjekts. Aus dem eigentümlichen kulturellen Mechanismus der Schließung und Öffnung von Theorievokabularen, von dominanten Theorien und Gegentheorien, die sich bei Parsons und Bourdieu exemplifizieren lässt, könnte man halbironisch die Schussfolgerung ziehen: die beste Garantie, eine [Druckfassung: 71] weitere Multiplikation theoretischer Ansätze zu bewirken, scheint es, ein Synthesevokabular mit Universalitätsanspruch zu formulieren. 3. Wenn man die soziologische Theorieentwicklung damit nicht anhand des Lakatos'schen Modells der Steigerung von Problemlösungsfähigkeit, sondern vor dem Hintergrund einer kulturtheoretischen Folie als agonalen Dynamik der Schließung und Öffnung von Vokabularen dechiffriert, schält sich auch eine andere Narration bezüglich der soziologischen Entwicklung des Begriffs des Sozialen heraus. Gesa Lindemann vertritt in ihrem Beitrag die These, dass alle bisherige Sozialtheorie zumindest implizit das Soziale mit normativen Erwartungserwartungen identifiziere, dass mithin vom Ende 7 des 19. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart hinein ein Konsens bezüglich einer Konzeptualisierung des Sozialen bestanden habe. Dieser Konsens werde in der aktuellen Debatte möglicherweise von einem neuen Sozialitätsverständnis durch materialitätsorientierte Ansätze aufgebrochen. Ich würde zustimmen, dass die neuen Ansätze etwa im Umkreis der science studies - beispielsweise bei B. Latour und der Actor-Network-Theory - in ihrer Neubeschreibung von Körpern und Artefakten bisherige sozialtheoretische Basisvokabulare aufbrechen und eine Alternative gegenüber einer Dominanz des 'Sinns' und des 'Sinnhaften' in vorangegangenen Ansätzen zu bieten versuchen. Mir scheint jedoch, dass dieser aktuelle Versuch einer 'Öffnung' gegenüber vorangegangenen 'Schließungen' sich weniger spektakulär darstellt. Statt von einem übergreifenden, an dem Konzept normativer Erwartungen orientierten soziologischen Konsens von Weber bis Luhmann auszugehen - ein Befund, der von der Suche nach einen übergreifenden 'rationalen Kern' soziologischer Theoriekontroversen motiviert zu sein scheint - würde ich die Hypothese vertreten, dass die theoretische Modellierung des Sozialen im gesamten 19. und 20. Jahrhundert dem konflikthaften Muster von Öffnung und Schließung folgt und hier mehrere, letztlich nicht aufeinander reduzierbare Modelle des Sozialen miteinander konkurrieren. Vor allem vier Vokabulare scheinen hier in Konkurrenz zueinander zu stehen: ein individualistisches, ein materialistisches, ein normativistisches und ein kulturalistisches.3 Die sozialtheoretischen Reflexionen des bürgerlichen 19. Jahrhunderts bieten mit dem individualistischen und dem materialistischen Vokabular zwei alternative Modellierungen des Sozialen: In der Tradition der Schottischen [Druckfassung: 72] Moralphilosophie wird das Soziale als emergentes, intendiertes oder unintendiertes 'Resultat' individueller Handlungen modelliert. Marktpreise und Ressourcenverteilungsmuster als Ergebnis von 'matching situations' (Coleman) und Normen als Ergebnis von Vertragsschlüssen liefern verschiedene Exemplare dieser Emergenzebene des Sozialen, welche auch im Individualismus kategorial nicht kurzerhand auf Individuen reduziert, allerdings in ihrer Entstehung auf individuelles Verhalten vieler zurückgeführt werden kann. Dem steht eine materialistische Modellierung des Sozialen entgegen, wie sie sich bei Marx und in Durkheims "Über soziale Arbeitsteilung" findet: Hier wird das Soziale auf der Ebene eines vor-sinnhaften Substrats, der Konstellation von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen oder der Bevölkerungsgröße und - struktur, im Rahmen der 'formalen Soziologie' Simmels etwa auch auf der Ebene der quantitativen Größe von sozialen Gruppen festgemacht. Gegenüber diesen beiden immanent alles andere als homogenen, individualistischen 3Zum Folgenden vgl. auch Reckwitz (1997), (2000), (2002), (2004). 8 und materialistischen Vokabularen positioniert sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert die bekannte 'normativistische' Definition des Sozialen, welche das Soziale als Regeln des Sollens versteht, die sich als intersubjektive normative Erwartungen darstellen und in 'Rollen' konkretisieren, ein Vokabular, das paradigmatisch bei Parsons, in anderer Weise auch bei Mead formuliert wird. Der Versuch einer Hegemonisierung des Sozialen über das Konzept der normativen Regeln ist jedoch seit den 1960er Jahren aufgebrochen worden: Der 'lingustic turn' in den Sozialwissenschaften, vor allem vom Strukturalismus und der Semiotik, aber auch der Phänomenologie, Hermeneutik und Sprachphilosophie beeinflusst, bringt kulturtheoretische und (sozial-)konstruktivistische Ansätze hervor. Diese machen die 'Ordnungsleistung' des Sozialen in symbolischen Ordnungen nach dem Vorbild der Sprache aus, in jenen kulturellen Codes, jenen Signifikationssystemen, die eine 'Ordnung des Sagbaren' implizit definieren. Für Autoren wie Foucault oder Bourdieu etwa findet sich das Soziale in erster Linie nicht mehr auf der Ebene intersubjektiver Erwartungen, sondern auf der Ebene jener symbolisch-kognitiven Strukturierungen von 'Welt', wie sie sich in 'Diskursen' und ihren Codes oder in den Differenzensystemen der Habitusformationen finden. Grundlegender als das 'normative Problem der Ordnung', das Problem der Koordination von Handlungen, das von normativistischer Seite mit dem Verweis auf einen Konsens von Sollen-Regeln beantwortet wird, erscheint hier das 'kognitive Problem der Ordnung', das Problem, wie eine sinnhafte Klassifikation von Welt (und damit auch regelmäßiges Handeln) möglich wird, welches von kulturalistischer Seite mit dem Verweis auf 'Codes' (Typisierungen, Semantiken,, Diskursformationen, Differenzsystemen etc.) beantwortet wird. Auch die Kulturtheorien sind in sich nicht homogen, [Druckfassung: 73] auch sie tendieren zu Universalisierungen, und jene neuen post-kulturalistischen Ansätze, welche die konstitutive Rolle von Artefakten und von Körpern für das Soziale betonen, stellen eine Herausforderung für den Sozialkonstruktivismus dar, die entweder die Kulturtheorien immanent 'materialisieren' oder tatsächlich darüber hinausführen wird. In jedem Fall scheint einiges dafür zu sprechen, hier weder mehr noch weniger als eine weitere Runde der fortdauernden Kulturkonflikte zwischen verschiedenen Sozialitätsvokabularen auszumachen, welche die Sozialwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert strukturieren und die mit dem individualistischen, dem materialistischen, dem normativistischen und dem kulturalistischen Vokabular bisher mindestens vier miteinander konkurrierende Definitionen des Sozialen hervorgebracht haben. 4. Es gibt keine übereinstimmende Definition des Sozialen - aber ist die Frage nach dem Sozialen überhaupt die Kernfrage der Soziologie? Damit erreiche ich den zweiten Punkt, den ich zu bedenken geben möchte. In der Tradition von Talcott Parsons scheint 9 regelmäßig vorausgesetzt, dass das zentrale Theorieproblem der Soziologie die Frage nach dem 'Sozialen' ist. In diesem Sinne müssten sich Theoriediskussion und Theorievergleich der Diszipin primär immer auf die Modellierung dieses Sozialen oder noch allgemeiner einer Ebene übersubjektiver, nicht auf Individuen reduzierbarer, kollektiver Strukturen beziehen. Dass die Frage nach der grundbegrifflichen Modellierung von Sozialität für die Soziologie elementar ist, möchte ich nicht bezweifeln. Die Annahme, dass damit der primäre Fragehorizont abgesteckt wäre, scheint jedoch nicht alternativenlos. Es spricht vielmehr aus der Geschichte und Gegenwart der Disziplin einiges dafür, eine andere Frage als mindestens ebenso elementar, letztlich aber als die für die Soziologie eigentlich disziplinenkonstitutive zu verstehen: die Frage nach der Form der Moderne, der modernen Gesellschaft.4 Nimmt man sich die Klassiker der Theorie vor - Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Tönnies u.a. -, dann kann man den Schluss ziehen, dass die genuin soziologische Perspektive in ihrer Frage nach den besonderen Strukturmerkmalen der modernen Gesellschaft im Vergleich zu nicht-modernen Gesellschaften zu suchen ist. Der Leitdualismus der Soziologie ist von Anfang an jener zwischen traditionaler und moderner Gesellschaft gewesen. Das, was dem intellektuellen Unternehmen der Soziologie seinen Antrieb gab, ist von Marx und We- [Druckfassung: 74] ber über die Frankfurter Schule bis Luhmann, Bourdieu und Foucault das Problem, was das spezifisch Moderne der Moderne ausmacht. Die sozialtheoretische Grundbegrifflichkeit, die Konzepte des Handelns und der Struktur, des Diskurses und der Macht, des Konflikts und des Systems hat demgegenüber regelmäßig zwar eine bedeutsame, aber letztlich eine sekundäre, dienende Rolle eingenommen: sie ist nicht letzter Zweck, sondern Mittel zum Zweck, sie soll das begriffliche Rüstzeug für eine solche Gesellschaftstheorie zur Verfügung stellen, welche noch einmal ganz begriffliche Probleme ganz anderer Art aufwirft. Es scheint, dass die Frage nach dem Modernen jenen Fragehorizont ausmacht, der die Soziologie eigentlich von anderen humanwissenschaftlichen Disziplinen unterscheidet, insbesondere wenn man die weitere Wissenschaftsentwicklung im 20. Jahrhundert im Blick hat. Dass die Humanwelt sich aus übersubjektiven, kollektiven Formen zusammensetzt, stellt sich mittlerweile als alles andere denn eine exklusive Hintergrundannahme von Soziologen dar: Ethnologen, Anthropologen und viele Historiker, Linguisten und kulturwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaftler teilen mittlerweile nicht zuletzt unter dem Einfluss des 'cultural turn' (vgl. Jaeger/ Rüsen 2004) ähnliche begriffliche Voraussetzungen und betreiben - teilweise bereits mit mehr Ambition und Enthusiasmus als die Soziologen - eine entsprechende Theoriearbeit. 4Eine ähnliche Position findet sich bei Wagner (2001). 10 Aber was die Soziologie von diesen Disziplinen weiterhin unterscheidet, ist ihr dezidiertes, eindeutiges Interesse an einer Theoretisierung der Strukturmerkmale der Moderne im Unterschied zu nicht-modernen Formen menschlichen Zusammenlebens, ihr Gegenwartsinteresse an den Bedingungen der 'Modernität'. Die Detailanalysen der soziologischen Empirie - von der Wirtschafts- bis zur Familiensoziologie, von der Religions- zur Mediensoziologie - lassen sich in diesem Sinne kaum als Arbeit an einem Verständnis des Sozialen im allgemeinen, sondern als Arbeit an einem Verständnis der modernen Vergesellschaftung in ihrer Besonderheit verstehen; diese Perspektive unterscheidet die Soziologie grundsätzlich von den Historikern wie von den Anthropologen und Ethnologen, von den Literaturwissenschaftlern wie den Ökonomen. Man müsste - parallel zu der von Lindemann vorgeschlagenen - eine zweite Genealogie versuchen, in der es darum geht, die Einheit oder die Veränderbarkeit der soziologischen Theorien der Moderne zu rekonstruieren. Theorievergleiche müssten sich dann auf einen Vergleich eben dieser Theorien der Moderne beziehen. Dies kann an dieser Stelle nicht geleistet werden und wäre ein komplexes Unterfangen: Hier konkurrieren Kapitalismustheorien mit Theorien formaler Rationalisierung und den Theorien funktionaler Differenzierung, hier positionieren sich Theorien, die grundsätzliche Brüche und Konflikte innerhalb der Moderne annehmen - etwa die Theorien der Postmoderne - mit jenen, die [Druckfassung: 75] von linearen Modernisierungsprozessen ausgehen. Welche Konsequenzen für die Frage nach der 'Einheit' der Soziologie hätte nun aber die Annahme, dass die soziologische Grundfrage gar nicht die nach der Struktur des Sozialen, sondern die nach der Struktur der Moderne ist? Einerseits kann diese Verschiebung des Problemhaushalts die Identität der Soziologie stabilisieren: sie schafft ihr jene besondere Perspektive auf die Humanwelt, die sie von anderen Disziplinen unterscheidet. Die 'Einheit' der Soziologie bestünde dann nicht in einer spezifischen Theorie, sondern in einem spezifischen Fragehorizont, dem nach den besonderen Bedingungen von 'Modernität'. Gleichzeitig muss die Frage nach der möglichen Einheit der Disziplin auf der Ebene eines theoretischen Antwortmusters, einem übergreifenden Vokabular nun vollends negativ beantwortet werden: Als Wissenschaft der Moderne kann die Soziologie - um die Begrifflichkeit aus dem Kontext des Neukantianismus zu übernehmen - in einem spezifischen Sinne keine nomothetische, sondern muss eine ideographische Disziplin sein, die Wissenschaft eines - mit Max Weber (1904) gesprochen - 'historischen Individuums', der modernen Gesellschaft. Moderne Gesellschaftlichkeit fällt nicht zusammen mit Gesellschaftlichkeit schlechthin (dies wäre eher das Thema der Philosophischen Anthropologie), insofern stellt die Soziologie unweigerlich eine historische 11 Wissenschaft dar, deren Aussagen mit einem zeitlichen (und räumlichen) Index versehen sind. Mehr noch: diese besondere gesellschaftliche Formation 'der Moderne' verändert sich selbst weiterhin in unberechenbarer Weise, möglicherweise auch in ihren Strukturmerkmalen - die gesellschaftliche Selbsttransformation scheint geradezu ein Strukturprinzip der Moderne darzustellen. Daraus, dass der Gegenstand, der sich aus der soziologischen Perspektive ergibt, kein allgemeingültiger, sondern ein besonderer ist und dadurch dass dieser sich selbst möglicherweise transformiert, folgt jedoch, dass auch die Theorien der Moderne nicht überzeitlich konstant gehalten werden können. Eine überzeitliche Einheit der theoretischen Grundlagen der Soziologie wäre damit nicht nur nicht wünschenswert, sondern fortschrittshemmend. Die Gefahr besteht darin, Aussagen, die für eine bestimmte historische Phase der Moderne gelten - etwa Aussagen über die ökonomischen und politischen Strukturen, der Lebensstile und Subjektformen dessen, was Peter Wagner (1994) als organisierte Moderne umschreibt und was die von der Soziologie fokussierte 'Industriegesellschaft' ausmacht kurzerhand als grundlegend für 'die Moderne' insgesamt anzunehmen, damit Strukturveränderungen der Gegenwart zu marginalisieren und als Variationen des Immergleichen zu deklarieren. Mit der Veränderung der Problemlage in der unmittelbaren Gegenwart modifiziert sich darüber hinaus das Probleminteresse bezüglich bereits vergange[Druckfassung: 76] ner Phasen moderner Gesellschaft. Auch unser Wissen über die früheren Formen der Moderne des 19. oder 20. Jahrhunderts ist damit nicht konstant zu halten, sondern - Max Weber hat es bereits klassisch auf den Begriff gebracht - im Lichte der neuen Probleminteressen der Gegenwart immer wieder neu umzuschreiben: Wenn durch die feministischen Theorien seit den 1970er Jahren die Frage nach der geschlechtlichen Verfasstheit der Gegenwart relevant wird, avanciert mit einen Mal auch die Geschlechterordnung der früheren Phasen der Moderne (und der Vormoderne) zu einem Gesichtspunkt, der für die Theorie der Moderne zentral wird. Wenn die Medientheorien seit Marshall MacLuhan ein Interesse an der massenmedialen Verfasstheit der Gegenwartgesellschaft wecken, dann wird auch deutlich, wie die Moderne von Anfang auf medialen Strukturen - etwa Schriftlichkeit und Buchdruck aufbaute. Die Theorie der Moderne muss daher für die Gegenwart wie für die Vergangenheit ständig umgeschrieben werden - und auch hier sind wiederum Konflikte um hegemoniale Definitionen von Modernität zu beobachten. Um den Zirkel komplett zu machen: Die Abhängigkeit der Fragerichtung vom kulturellen Horizont der Gegenwart gilt auch für die nur scheinbar rein formale Definition des Sozialen. Diese ist auch dadurch kaum überzeitlich konstant zu halten, dass die wissenschaftlichen Plausibilitätsgründe selber von der Transformation der 12 modernen Kultur und ihrer Probleminteressen abhängen: So liefert eine bürgerliche Kultur den Plausibilitätshintergrund für individualistisch-kontraktualistische Definitionen des Sozialen, die sich industrialisierende Gesellschaft des 19. Jahrhunderts stützt materialistische Vokabulare, die 'kollektivistischen' Gesellschaften der organisierten Moderne betreiben eine Identifizierung des Sozialen mit normativen Erwartungen und die postindustriellen, lebensstilorientierten und kulturell globalisierten Gesellschaften seit den 1970er Jahren favorisieren kulturtheoretische Definitionen des Sozialen; das besondere Interesse an einer neuen 'Materialisierung' von Sozialität in der Gegenwart, die Gesa Lindemann hervorhebt, ist hier sicherlich auch durch die neue Stufe technologischer Entwicklung in der Mikroelektronik und Biotechnologie zu erklären, die ein entsprechendes verschobenes Probleminteresse hervorbringt. Die Abhängigkeit der Definitionen des Sozialen von historisch-kulturell spezifischen Plausibilitätsannahmen liefert damit nur den letzten Baustein, der die Einheitsvision der Soziologie unterminiert. Zum Schaden der Disziplin wäre dies sicherlich nicht. [Druckfassung: 77] Literatur Bourdieu, Pierre (1972): Entwurf einer Theorie der Praxis (auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft), Frankfurt/ Main 1979 (frz.: Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études d'éthnologie kabyle) Bourdieu, Pierre (1979): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/ Main 1989 (frz.: La distinction. Critique sociale du jugement) Foucault, Michel (1966): Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt/ Main 1990, 9. Aufl. (frz.: Les mots et les choses) Jaeger, Friedrich/ Jörn Rüsen (Hg.) (2004): Handbuch der Kulturwissenschaften, 3 Bände, Stuttgart/ Weimar Kuhn, Thomas S. (1962): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/ Main 1989, 10. Aufl. (engl.: The Structure of Scientific Revolutions) Laclau, Ernesto/ Chantal Mouffe (1985): Hegemony and Socialist Strategy. Towards a radical democratic politics, London/ New York 2001, 2. Aufl. Lakatos, Imre (1978): The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers Volume 1, Cambridge 1995 Parsons, Talcott (1937): The Structure of Social Action, New York/ London 1968 Popper, Karl R. (1972): Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf, Hamburg 1984, 4., verbess. und ergänzte Aufl. (engl.: Objective Knowledge) 13 Reckwitz, Andreas (1997): Struktur. Zur sozialwissenschaftlichen Analyse von Regeln und Regelmäßigkeiten, Opladen Reckwitz, Andreas (2000): Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Weilerswist Reckwitz, Andreas (2002): The status of the 'material' in theories of culture: From 'social structure' to 'artefacts', in: Journal for the Theory of Social Behaviour, H. 2, S. 195- 217 Reckwitz, Andreas (2004): Die Kontingenzperspektive der 'Kultur'. Kulturbegriffe, Kulturtheorien und das kulturwissenschaftliche Forschungsprogramm, in: Friedrich Jaeger/ Jörn Rüsen (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Band 3: Themen und Tendenzen, Stuttgart/ Weimar, S. 1- 20 Torfing, Jacob (1999): New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek, Oxford Toulmin, Stephen (1972): Kritik der kollektiven Vernunft. Menschliches Erkennen, Band 1, Frankfurt/ Main 1978 (engl.: Human Understandning, Volume I: The Collective Use and Evolution of Concepts) Wagner, Peter (1994): A Sociology of Modernity. Liberty and discipline, London Wagner, Peter (2001): Theorizing Modernity. Inescapability and attainability in social theory, London Weber, Max (1904): Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: ders. (1922): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1988, 7. Aufl., S. 146- 214