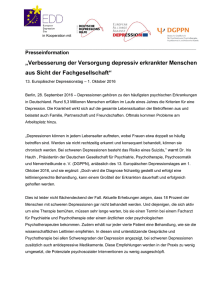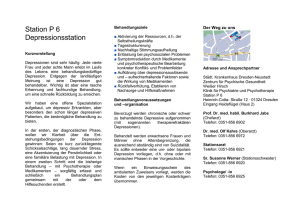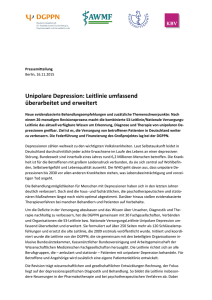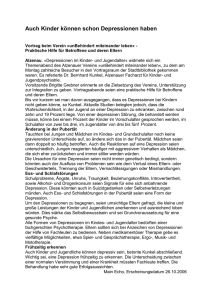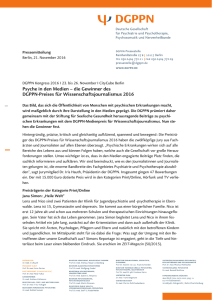PRESSE-INFO
Werbung

PRESSE-INFO Juli 2002 Psychiatrie und Psychotherapie DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE UND NERVENHEILKUNDE (DGPPN) n i u R e l l e u x e Der s Über Sexsucht kursieren wilde Vorstellungen – Therapie durch Enthaltsamkeit Am Ende steht meist der seelische Zusammenbruch. Sexsucht ist für die Erkrankten ähnlich qualvoll wie etwa Spiel- oder Kaufsucht. Sie zerstört Existenzen, zerrüttet Familien und führt zu Straftaten. Nach US-Schätzungen könnten bis zu sechs Prozent der Bevölkerung betroffen sein. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) macht darauf aufmerksam, dass Sexsucht eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung ist. Über ihr Problem zu sprechen, fällt den Betroffenen häufig sehr schwer. Denn noch mehr als andere Süchte ist Sexsucht tabuisiert und schambesetzt. „Sexsucht ist oft gekoppelt mit Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit, Essstörungen oder Depressionen", er- läutert Prof. Wolfgang Berner von der Abteilung für Sexualforschung am Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg. „Sie wird oft von solchen anderen Abhängigkeiten überdeckt und ist daher zunächst schwer zu erkennen, wenn der Patient nicht von sich aus darüber spricht." Die „Suchtkarriere” beginnt, wie bei anderen Abhängigkeiten auch, damit, dass die Betroffenen immer mehr Zeit und Energie für die Suchtbefriedigung aufwenden, die sie doch nicht wirklich erreichen. Die Erkrankten verlieren die Kontrolle über ihr Verhalten, immer mehr Geld geht für Telefonsex, Pornographie, Bordell- und Klubbesuche verloren; mitunter verlieren Betroffene aufgrund sexueller Belästigung oder Internet-Surfens ihren Arbeitsplatz, werden straffällig wegen Exhibitionismus oder sexuellen Missbrauchs. Auch körperliche Auswirkungen sind möglich – durch sexuelles Risikoverhaltens, unnötige chirurgische Eingriffe, Verletzungen an Geschlechtsteilen oder eine schädlichen Einnahme von Aphrodisiaka. Einige amerikanische Autoren sprechen von drei bis sechs Prozent der Bevölkerung, die sexsüchtig sind, wobei der Begriff weit gefasst ist und damit die Häufigkeit eher zu überschätzen scheint: Darunter fallen zwanghaftes Masturbieren ebenso wie etwa Promiskuität, Exhibitionismus, Sado-Masochismus, Telefonsex, obszöne Anrufe, Prostitution und Sex mit Kindern oder Schutzbefohlenen. Drei Viertel der Erkrankten sind Männer. weiter auf Seite 3 SCHLAFSTÖRUNGEN – SIEBZIG PROZENT BLEIBEN UNBEHANDELT Gravierende Folgen: Erhöhtes Unfallrisiko, Depressionen und Infektionskrankheiten Fünf Prozent der Deutschen leiden an krankhaften Ein- und Durchschlafstörungen. Über Monate oder Jahre kämpfen sie mit Tagesmüdigkeit, sind abgespannt und unkonzentriert. Die Folgen sind fatal: Die Unfallhäufigkeit in Verkehr, Beruf oder Haushalt steigt um das Fünffache. Und die Gefahr, an einer Depression zu erkranken, liegt bei Schlafgestörten viermal höher als bei Gesunden. „Schlafstörungen sind keine Bagatelle“, so Prof. Dr. Max Schmauß, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), „zu oft bleiben diese Erkrankungen noch unbehandelt.“ „Wer mehr als dreimal pro Woche über mindestens einen Monat hinweg an Ein- und Durchschlafstörungen mit Tagesmüdigkeit leidet, sollte zum Arzt gehen“, rät Prof. Dr. Göran Hajak (DGPPN) von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Regensburg. Eine Hauptursache für Ein- und Durchschlafstörungen ist chronischer Stress. Auch organische oder psychische Erkrankungen können schuld sein. Nicht selten haben sich die Schlafstörungen so verselbstständigt, dass sie fortbestehen, auch wenn die Ursachen beseitigt sind. Zwar liegen die Hausärzte in Deutschland bei der weiter auf Seite 2 1 AUS DEM INHALT 2 Depressionen machen doppelt krank Herzerkrankungen, Osteoporose, Diabetes häufige Folgeerkrankungen 3 Augen-Blicke: Neue Therapie hilft Trauma-Opfern Schnelle Augenbewegungen unterstützen das Gehirn bei der AngstBewältigung 4 Parkinson-Patienten: Jeder Zweite leidet unter Depressionen Depression ist oft ein Vorbote von Parkinson PRESSE-INFO PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE JULI 2002 DEPRESSIONEN MACHEN DOPPELT KRANK DGPPN: Herzerkrankungen, Osteoporose, Diabetes häufige Folgeerkrankungen Wer an Depressionen erkrankt ist, leidet oft doppelt. Denn er trägt ein deutlich höheres Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Auch das Risiko für Diabetes und Osteoporose steigt. Auf den engen Zusammenhang zwischen Depressionen und körperlichen Folgeerkrankungen weist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) hin. Zahlreiche internationale Studien belegen einen engen Zusammenhang zwischen Herzerkrankungen und Depressionen. „Eine depressive Störung erhöht deutlich das Risiko von HerzKreislauf-Erkrankungen“, stellt Prof. Hans-Peter Kapfhammer (DGPPN) von der Psychiatrischen Klinik der LudwigMaximilian-Universität München fest. „Vermutlich ist eine Herzerkrankung – nach dem Suizid – die zweithäufigste Todesursache bei depressiven Patienten.“ Den Hauptgrund sieht der Mediziner in der permanenten Aktivierung der körpereigenen Stress-Systeme in den depressiven Phasen. Ein an Depressionen erkrankter Mensch fühlt sich gewissermaßen unter Dauerstress. Die psycho-biologischen Mechanismen geraten außer Kontrolle und beeinträchti- gen wichtige Herz-Kreislauf-Faktoren wie Blutdruck, Herzfrequenz und Blutgerinnung. Hinzu kommt, dass depressive Menschen überdurchschnittlich stark rauchen und sich häufig wenig bewegen. Störungen des Hormonstoffwechsels verursachen auch eine weitere häufige Folgeerkrankung von Depressionen: Diabetes mellitus. Personen, die an einer Depression erkrankt waren, hatten nach einer amerikanischen Studie ein im Vergleich zur gesunden Bevölkerung doppelt so hohes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Auch Osteoporose ist eine typische Begleiterkrankung. So wurde in einer Lübecker Studie eine um ca. 15 Prozent geringere Knochendichte bei depressiv erkrankten Patienten festgestellt. Altersbedingte Knochenerkrankungen traten im Schnitt fünf bis acht Jahre früher auf als in vergleichbaren Altersgruppen. Auch dies liegt vermutlich an Störungen in der Hormonausschüttung, die zunächst die Depression und später die Osteoporose auslösen. Herzinfarkt und Diabetes sind aber nicht nur typische Folgeerkrankungen einer Depression, sie lösen auch selbst Depressionen aus. So wird oft beob- Fortsetzung von Seite 1 Schlafstörungen… Diagnose von Schlafstörungen europaweit an der Spitze. Aber auch hierzulande bleiben noch vierzig Prozent dieser Erkrankungen unerkannt. „Das liegt oft auch an den Patienten“ so Prof. Göran Hajak, „die die Ärzte nicht über ihre Schlafprobleme informieren. Hinzu kommt: Von den Patienten mit Schlafproblemen erhält nur die Hälfte eine gezielte ärztliche Behandlung.“ Das bedeutet: Insgesamt 70 Prozent aller Schlafstörungen werden nicht oder nur unzureichend therapiert. Viele Patienten nehmen verschriebene Schlafmittel nicht ein, aus Angst, abhängig zu werden. Auch psychologische Entspannungstrainings werden häufig abgebrochen, weil sie nach Ansicht vieler Patienten nicht richtig helfen, was aber oft an mangelhafter Schulung liegt. „Wer seine Schlafstörungen nicht konsequent behandeln lässt, setzt Körper und Psyche einer schweren Dauerbelastung aus“, so Prof. Max Schmauß (DGPPN). Das Risiko eines Unfalls, einer Infektionskrankheit, einer Depression steigt enorm. Optimal für die Behandlung von schweren Ein- und Durchschlafstörungen ist eine Kombination aus Verhaltenstherapie und Medikamenten. Bei vielen Patienten hat das Bett im Unter- 2 achtet, dass gesunde Patienten unmittelbar nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt eine depressive Symptomatik entwickeln. Ein Viertel der Patienten ist davon betroffen, ein weiteres Viertel zeigt leichte, noch nicht behandlungsbedürftige depressive Symptome. Frauen erkranken doppelt so häufig wie Männer an der „Depression nach Herzinfarkt“ Die Wechselwirkungen zwischen Depressionen und körperlichen Erkrankungen werden von Fachärzten wie Psychiatern, Kardiologen, Internisten usw. bisher zu wenig beachtet. Prof. Dr. Jürgen Fritze, Geschäftsführer der DGPPN, fordert daher: „Bei depressiven Patienten sollten die Risikofaktoren für HerzKreislauf-Erkrankungen routinemäßig untersucht und mitbehandelt werden, bei Herzpatienten die therapiebedürftigen depressiven Syndrome.“ Für die Therapie setzen sich neuartige Psychopharmaka – Serotonin-Wiederaufnahmehemmer – immer mehr durch. Sie eignen sich aufgrund ihrer Nebenwirkungsarmut gut für die Behandlung von Depressionen und scheinen auch mögliche Begleiterkrankungen wie HerzKreislauf-Erkrankungen und Diabetes nicht ungünstig zu beeinflussen. bewusstsein seine Rolle als Schlafplatz verloren. Auch wenn sie vorher müde waren – sobald sie in die Kissen sinken, sind sie wieder hellwach. Hier setzt die Stimulus-Kontrolltherapie an: Wer länger als eine Viertelstunde wach liegt, soll das Bett verlassen. Auch Fernsehen oder Essen im Bett sind tabu. Die Patienten bekommen pro Woche drei bis vier Tabletten, die sie einnehmen, wann sie es für nötig halten. Es sind Schlafmittel einer neuen Generation, sogenannte Benzodiazepin-Rezeptor-Agonisten. Sie wirken ähnlich wie die bekannten Benzodiazepine, aber mit geringerer Suchtgefahr. Eventuell kommen auch niedrig dosierte Antidepressiva in Frage. Auch sie wirken schlaffördernd und weisen kein Abhängigkeitspotenzial auf. Die Kombinationstherapie zeigt gute Erfolge: Bereits nach kurzer Zeit reduzieren die Patienten von sich aus Schritt für Schritt die Tablettendosis. PRESSE-INFO PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE Opfer von Gewalt, sexuellem Missbrauch oder schweren Verkehrsunfällen leiden oft jahrelang unter Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Eine neue Psychotherapie, abgekürzt EMDR, hilft ihnen, die schrecklichen Erinnerungen nach kurzer Zeit in den Griff zu bekommen. Das Prinzip: Schnelle Augenbewegungen während des Erinnerungsprozesses unterstützen das Gehirn bei der Verarbeitung des Erlebten. „Aktuelle Studien zeigen die Wirksamkeit von EMDR“, so Prof. Peter Falkai, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN). „Für viele PTBS-Patienten bringt diese Methode eine nachhaltige Besserung.“ JULI 2002 rapie lässt der Patient die Horrorerlebnisse in seinem Inneren erneut ablaufen, durchlebt wieder die Emotionen und Gedanken, die er dabei hatte. Zugleich folgt er mit den Augen der sich hin- und herbewegenden Hand des Therapeuten. matik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. „Menschen, die über längere Zeit traumatisiert wurden, z.B. durch sexuellen Missbrauch in der Kindheit, brauchen unter Umständen bis zu zwanzig Sitzungen oder mehr.“ Dass die Besserung durch EMDR dauerhaft ist, zeigen verschiedene Studien. Hinzu kommt die Akzeptanz bei den Patienten: Nur wenige brechen eine EMDR-Therapie ab. „Es ist zu begrüßen, dass EMDR nun auch in Deutschland Fuß fasst“, so Prof. Peter Falkai (DGPPN), „es handelt sich um eine sinnvolle Erweiterung des Therapieangebotes für PTBS.“ AUGEN-BLICKE: NEUE THERAPIE HILFT TRAUMA-OPFERN Schnelle Augenbewegungen unterstützen das Gehirn bei der Angst-Bewältigung Katastrophen wie der Amoklauf in Erfurt hinterlassen bei den Beteiligten oft schwere seelische Verletzungen. Die schrecklichen Erinnerungen führen zu Alpträumen, dauernder Unruhe, Zittern und Schweißausbrüchen. Schätzungsweise vier Prozent der Deutschen leiden unter einer solchen Posttraumatischen Belastungsstörung. Die EMDR-Therapie (Eye movement desensitization and reprocessing / Augenbewegungs-Desensibilisierung und Neuverarbeitung) wurde in den USA entwickelt: Während der The- Fortsetzung von Seite 1 Der sexuelle Ruin In den USA gibt es rund fünf vollstationäre und 50 Tagesklinikeinrichtungen für Sexsüchtige. Die Ursachen einer Sexsucht sind vielfältig. Prof. Berner (DGPPN): „Häufig ist eigener sexueller Missbrauch in der Kindheit oder Jugendzeit im Spiel oder zumindest ein gestörter Umgang mit Intimität in der Familie.“ Betroffene berichten auch über sehr frühe sexuelle Erfahrungen, die sie als „überwältigend" erlebten, ähnlich Drogenabhängigen bei ihrem ersten „Kick”. Diese Erfahrung wird immer wieder gesucht, um Stress, Angst, Einsamkeit und Depressionen zu betäuben. Oft ist die Sucht gekoppelt mit einem schwachen Selbstwertgefühl, Persönlichkeits- Die Augenbewegungen beschleunigen den Verarbeitungsprozess im Gehirn. Allmählich verblassen die Bilder, verlieren ihre Macht über die Psyche, positivere Gedanken stellen sich ein. HOHE AKZEPTANZ Ein wesentlicher Vorteil von EMDR ist die oft kurze Behandlungsdauer. „Bei Patienten mit einer leichteren PTBS reichen oft schon eine oder zwei Therapie-Sitzungen“, so Dr. Martin Sack von der Abteilung für Psychoso- störungen oder geringer Intelligenz. Auch neurobiologische Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen. Das körpereigene Belohnungssystem über Hormone und Botenstoffe kann verändert sein, oder bestimmte Bereiche des Gehirns sind gestört. Nach amerikanischem Vorbild gibt es inzwischen auch in Deutschland mehrere Selbsthilfegruppen für Sexsüchtige und ihre Angehörigen. In psychiatrischen Kliniken mit Schwerpunkt Sexualforschung wird Beratung und Therapie angeboten. Je nach Art der Störung kann am Anfang eine mehrmonatige völlige sexuelle Abstinenz empfehlenswert sein. Das „Zölibat“ ist für die Betroffenen mit massiven psychischen Entzugserscheinungen wie Angstzuständen, Weinkrämpfen oder Wutausbrüchen verbunden. 3 Welche Rolle dabei die Augenbewegungen spielen, wird zur Zeit erforscht. Wahrscheinlich lösen sie Blockaden auf, die die Informationsverarbeitung im Gehirn behindern. Erlebnisse, die mit starkem Stress verbunden sind, werden in tieferen Hirnregionen als gefühlsbeladene Bilder gespeichert. Bei PTBS-Patienten bleiben sie dort „eingesperrt“ und können nicht in der Großhirnrinde, wo Sprache und Bewusstsein ihren Sitz haben, rational verarbeitet werden. „Möglicherweise spielen sich bei EMDR ähnliche psychische Prozesse ab wie beim Träumen, das auch von schnellen Augenbewegungen begleitet wird“, so Dr. Martin Sack. Prof. Peter Falkai, Sprecher der DGPPN: „Der Patient soll so wieder lernen, Intimität ohne Sexualität zu erleben, unterdrückte Schmerz-, Scham- und Schuldgefühle zuzulassen und sie nicht durch zwanghaften Sex zu überdecken.” Eine meist noch jahrelange Psychotherapie schließt sich an. Auch Medikamente werden eingesetzt, besonders wenn begleitend andere psychische Störungen wie Depressivität, erhöhte Impulsivität oder Zwanghaftigkeit vorliegen; dazu gehören u.a. neuartige Psychopharmaka, die so genannten Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die wenig belastende Nebenwirkungen zeigen. Wichtig ist es, andere Süchte wie Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch gleichzeitig zu behandeln. Eine große Rolle spielt die Angehörigenarbeit, die Bestandteil der Therapie sein muss. PRESSE-INFO PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE JULI 2002 PARKINSON-PATIENTEN: JEDER ZWEITE LEIDET UNTER DEPRESSIONEN Depression ist oft ein Vorbote von Parkinson Fast die Hälfte aller Parkinson-Patienten leidet gleichzeitig unter Depressionen. Viele Ärzte glauben, dass die Patienten nur wegen ihrer körperlichen Beschwerden depressiv werden. Doch neue Forschungen zeigen: Auch wenn die Parkinson-Symptome sich bessern, bleibt die Depression häufig bestehen. Der Grund: Beide Krankheiten haben eigene neurobiologische Ursachen – oft setzt die Depression sogar schon vor dem Parkinson ein. „Eine Depression kann eine Frühwarnung vor einer beginnenden Parkinson-Erkrankung sein“, so Prof. Dr. Max Schmauß, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN). Bewegungstherapien und Psychotherapien. Sie sollten vor allem Probleme in der Partnerschaft und im Rollenverhalten thematisieren, mit denen depressive Parkinson-Patienten besonders häufig zu kämpfen haben. Tauchen Parkinson-Patienten erst einmal aus ihrem seelischen Tief auf, können sie auch ihre motorischen Störungen psychisch viel besser verkraften. In Deutschland leiden etwa 100.000 Parkinson-Patienten zusätzlich an einer Depression. Sie sind permanent niedergeschlagen und ängstlich, reagieren oft gereizt, fühlen sich ungeliebt und alleingelassen. Im Unterschied zu anderen Depressionspatienten spielen Selbstvorwürfe, Schuld- und Versagensgefühle bei ihnen kaum eine Rolle. Stattdessen erleben sie durch die dunkle Brille ihrer Depression die Behinderungen der Parkinson-Krankheit als besonders niederdrückend. Ihre Lebensfreude ist deshalb viel stärker getrübt als bei psychisch gesunden ParkinsonPatienten. „Manche Patienten erkranken an einer Depression, schon etliche Jahre bevor sich die Parkinson-Symptome zeigen“, so Dr. Matthias Lemke. Seine Forschungen belegen: Wer an einer Depression erkrankt, trägt auch ein erhöhtes Parkinson-Risiko. Oft zeigen depressive Patienten schon frühe Vorboten des Parkinson, die im Alltag noch gar nicht auffallen: Die Mimik wirkt leicht erstarrt, die Feinmotorik funktioniert nicht mehr so gut, die Schritte sind kleiner als normal. „Wenn Ärzte bei der Behandlung von Depressionen auch auf solche Anzeichen achten, kann eine Parkinson-Krankheit schon im Frühstadium erkannt werden“, so Dr. Matthias DEPRESSIONEN OFT VERNACHLÄSSIGT Bislang bleiben Depressionen bei Parkinson-Patienten allerdings zu oft unentdeckt, meist wird nur die neurologische Erkrankung behandelt. „Hier müssten Psychiater und Neurologen noch besser zusammenarbeiten“, so PD Dr. Matthias Lemke (DGPPN), Leitender Arzt an den Rheinischen Kliniken Bonn. Eine gezielte Behandlung mit Antidepressiva, die auf die Parkinson-Medikamente abgestimmt sind, kann die Lebensqualität beträchtlich steigern. Gute Wirkungen zeigen auch Lemke. Je eher dann eine neurologische Behandlung eingeleitet wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten. WECHSELWIRKUNGEN IM GEHIRN Bis jetzt weiß man noch nicht im Einzelnen, wie Parkinson und Depression zusammenhängen. Doch dass es neurobiologische Wechselwirkungen gibt, ist klar. Ein Bindeglied ist der Botenstoff Dopamin. In Phasen starken Dopaminmangels leiden Parkinson-Patienten nicht nur unter motorischen Störungen, sondern sind oft auch besonders depressiv. Hier setzt die Behandlung mit Dopaminagonisten an: Diese Medikamente wirken im vorderen Stirnhirn und bessern die Symptome beider Krankheiten. Ohne Medikamente arbeitet die Tiefenhirnstimulation: Dabei werden Nervenzellen im Zwischenhirn mit Hilfe von Elektroden stimuliert. Die leichten Stromimpulse bringen den Stoffwechsel in Schwung und bewirken die Ausschüttung von Botenstoffen. Auch diese Behandlung wirkt sowohl gegen die Depression als auch gegen die Bewegungsstörungen. „Die Forschungen zu Parkinson und Depression sind vielversprechend. Es zeichnen sich wirkungsvolle Medikamente und Behandlungsmethoden ab, mit denen sich beide Krankheiten zugleich behandeln lassen“, so Prof. Dr. Max Schmauß (DGPPN). Impressum Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) Dr.-Mack-Straße 1, 86156 Augsburg Tel.: 08 21 / 4 80 31 82 Fax: 08 21 / 4 80 31 32 Verantwortlich für den Inhalt: Prof. Dr. med. Peter Falkai Die Texte und Grafiken stehen zum Download im Internet: www.dgppn.de Abdruck der Texte honorarfrei bei Angabe der Quelle DGPPN. Konzept und Produktion: impressum Publikation und PR, Hamburg Die Presse-Info Psychiatrie und Psychotherapie erscheint mit Unterstützung der folgenden Firmen: Astra Zeneca, Aventis Pharma Deutschland GmbH, Lilly, Novartis Pharma, Organon 4