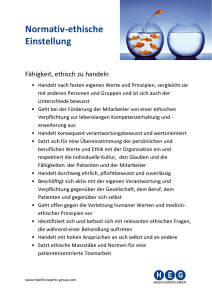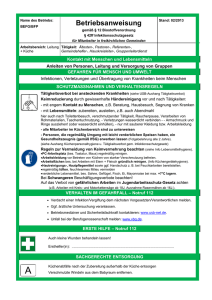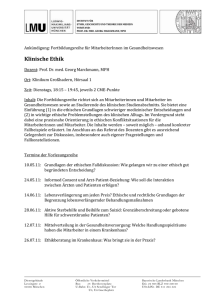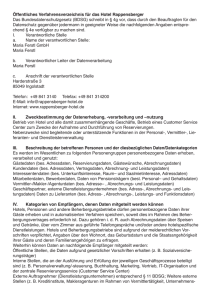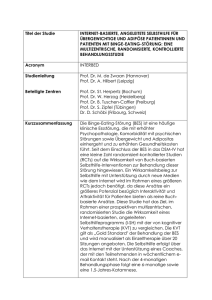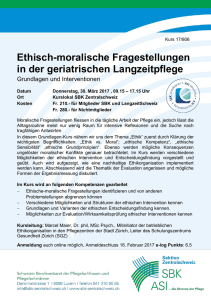dtv-Lexikon (1988) Ethik [grch. ethos „Sitte“, „Brauch“] die, die
Werbung
![dtv-Lexikon (1988) Ethik [grch. ethos „Sitte“, „Brauch“] die, die](http://s1.studylibde.com/store/data/011357095_1-8283903a075ada30e158285f71baab69-768x994.png)
dtv-Lexikon (1988) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Ethik [grch. ethos „Sitte“, „Brauch“] die, die philosoph. Wissenschaft vom Sittlichen, die krit. Untersuchung seiner Ausprägungen, Voraussetzungen und Prinzipien, in der aristotel. Tradition mit der Rechts-, Sozial-und Staatsphilosophie Teil der Praktischen Philosophie. Als Hauptgegenstand ihrer Betrachtung gelten meist die menschl. Handlungen und bes. die Gesinnung, aus der diese hervorgehen (Gesinnungsethik) oder die von ihnen erzeugte Wirkung (Erfolgsethik) . Von dieser Individualethik wird eine Sozialethik unterschieden. Ein besonderer Ausgangspunkt des ethischen Denkens ist die Frage, ob die sittl. Willensantriebe und Wertschätzungen angeboren, also in gewissem Ausmaß allen Menschen gemeinsam sind, oder ob sie aus der Erfahrung gewonnen oder durch Erziehung vermittelt werden, daher nach Völkern und Zeitaltern wechseln. Richtungsunterschiede ergeben sich auch aus der Frage nach dem Wesen des Sittlichen. Dieses kann in einer Form gefunden werden, die allen sittl. Handlungen gemeinsam ist, so bes. die Vernünftigkeit der Intention (formale E.), aber auch in best. Wertgesetzlichkeiten und Wertinhalten, in die sich die Welt der sittl. Erscheinungen gliedert (materiale E.). Einige in der Geschichte hervortretende Richtungen der E. ergeben sich aus dem Versuch, die sittl. Erscheinungen auf einen einheitlichen, an sich außersittl. Wert zurückzuführen, etwa die Glückseligkeit (Eudämonismus), die Lust (Hedonismus), den eigenen oder allgern. Nutzen (Utilitarismus). S. Moralphilosophie. Gesetzmäßigkeit der Handlungen ohne Rücksicht auf ihre Intention. Ausgangspunkt der ethischen 65 Betrachtung war für Kant allein die Gesinnung (als „guter Wille“) der von der „Vernunft“ in einem kategorischen Imperativ geforderten Achtung vor dem Gesetz. Einen anderen Weg schlug im 19. Jh. die E. in England aus utilitarist., in Frankreich aus positivist. 70 Ansatz ein. Im Rahmen der linken Hegel-Schule suchten dann seit der Mitte des Jh. bes. entschieden L. Feuerbach und M. Stirner aus einem materialist. und solipsist. Ansatz die klassisch-metaphys. E. aufzuheben. Diese wird dann später von der E. des Marxismus als 75 Ausdruck der gesellschaftl. Verhältnisse, also der „bürgerl. Moral“, verstanden, an deren Stelle ein neues gesellschaftl. Bewußtsein zu treten habe. In Abkehr von Kant entstand in Dtl. im 20. Jh. eine neue, phänomenologisch beschreibende E:, die als 80 „materiale Wert-E.“ bald die Vorherrschaft gewann (M. Scheler, N. Hartmann u.a.). Ihr urspr. betont aprior. Ansatz wurde später durch Hervorkehren der Erfahrung (O. Bollnow, H. Reiner) der empirischen Richtung angenähert. Im kath. Bereich wurde die thomist. E. 85 fortgeführt (J. Pieper, M. Reding u.a.). In neuerer Zeit entwickelt die „Erlanger Schule“ (P. Lorenzen, O. Schwemmer) in Anlehnung an Kant als Modell zur Überprüfung und Rechtfertigung von Handlungen eine normativ-kritische Theorie der E. 90 In Frankreich deckte die existentialist. E. der Nachkriegszeit (J.-P. Sartre, A. Camus) bes. die anthropolog. Voraussetzungen der E. auf, ließ allerdings die ethische Sinnfrage zurücktreten. Verwandt der dt. phänomenolog. E. sind hingegen hier V. Jankelevitch, 95 R. Le Senne; bedeutend ist wie in Spanien und Belgien die thomist. E. (J. Maritain, J. Leclercq). Geschichte. Als Wissenschaft ist die E. zuerst von Aristoteles entwickelt worden. Sie fragte nach dem „Gut(en)“ als dem, was einem Streben Erfüllung bietet; insbes. nach dem höchsten Gut als der „Verwirklichung der Seele gemäß der Tugend“. Damit wird die In England hat zu Beginn des 20. Jh. die der dt. Tugendlehre zum wesentl. Teil der E. Nicht gefragt phänomenolog. E. verwandte intuitionist. E. von G. E. wurde noch nach der sittl. Forderung; diese wurde erst Moore nachhaltigen Einfluß ausgeübt, der jedoch hier in der Stoa beachtet, teils durch den Begriff des 100 wie in den USA unter dem Einfluß L. Wittgensteins von kathekon (grch. das „Geziemende“), teils durch den der empiristisch-sprachanalyt. Meta-Ethik verdrängt Gedanken eines sittl. Gesetzes, das von der Natur wurde. gegeben sei (lat. „lex naturae“) und ein Leben in Übereinstimmung mit diesem erfordere. Im Christentum verband sich der Gedanke des „Naturgesetzes“ mit dem geoffenbarten Gesetz Gottes. Erst bei Thomas von Aquino entstand daraus eine umfassende philosophischtheolog. Synthese, deren Grundbegriffe in verschiedenen Abwandlungen und unter allmähl. Ausscheidung des theolog. Elements bis in die Aufklärung erhalten blieben. In dieser Zeit erst setzt bes. Th. Hobbes die Wende zu einem rein rationalist. Ansatz, der die prakt. Philosophie auf die mechanisch bestimmbare Natur des Menschen, die sittl. Normen auf die Vernunft zurückführte. Ihm entgegen stand im engl. Sprachraum eine Gefühls- und Gewissensethik (A. Shaftesbury, J. Butler, F. Hutcheson, A. Smith); zugleich wandelte sich bei D. Hume der Güter-Gedanke in den der Nützlichkeit. Eine epochale Wendung brachte I. Kant, der die 60 „Sittenlehre“ in eine Tugend- und eine Rechtslehre aufgliederte. Jene betrachtete nur die „inneren“ Pflichten gegen sich und andere, diese die „äußere“ dtv-Lexikon (2006) Ethik [grch. ethika, „das die Sittlichkeit betreffende“, 105 „Sittenlehre“], 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 1. Philosophie: E. als philosoph. Disziplin befasst sich mit den sittl. Normen, Werten u. Anschauungen, insbes. im Hinblick auf ihre Begründbarkeit. Als solche zumeist gleichbedeutend mit Moralphilosophie u. schon in der Antike ganz oder z. T. mit praktischer Philosophie zusammenfallend, wozu nach Aristoteles, dem Begründer der E. als Disziplin, aber noch Politik u. Ökonomie gehören. Die E. selbst umfasst die Beschreibung der herrschenden Vorstellungen von Sittlichkeit, der Tugenden sowie die Bestimmung der sittl. Klugheit oder der ethischen Wahl, der später so genannten Moralität, u. schließlich die Angabe des Ziels des ethischen Handelns, in der Antike als Glück verstanden, in der christlich geprägten Zeit als Liebe zu Gott u. von der Aufklärung an (bes. Kant) als Freiheit. Je nachdem, ob mehr die Vorstellungen von Sittlichkeit im Vordergrund stehen oder das Kriterium der ethischen Entscheidung, trennt man eine materiale von einer formalen Ethik, außerdem eine Wertethik (bei welcher der moral. Wert der Handlungsresultate im Vordergrund steht) von einer Pflichtethik (bei der es auf den sittl. Charakter der Handlungsweise ankommt). 2. Theologie: im Bereich der kath. Kirche „Moraltheologie“ genannt, die Wissenschaft, die das sittl. Wollen u. Handeln des Menschen auf die christl. Offenbarung als letzte Begründungsinstanz zurückführt. Ursprünglich nur als philosoph. Disziplin selbständig, ist die E. seit dem 17. Jh. auch eine selbständige Disziplin der systemat. Theologie. Der Sache nach ist aber theolog. E. so alt wie das Christentum. Ihre Anfänge sind dadurch gekennzeichnet, dass an die Stelle einer alles regelnden Gesetzesethik ein im Glauben ermöglichtes Sein in der Liebe tritt, das freisetzt zu eigener Entscheidung. Hier änderte sich jedoch schon früh wieder Entscheidendes: An die Stelle des nach dem Willen Gottes suchenden Glaubens traten wieder Gebot u. Gesetz, Lohn-u. Verdienstdenken. Aufs Ganze gesehen lassen sich vier Typen christl. Gesetzesethik unterscheiden: Die Pflichtethik des Tertullian; die Güterethik Augustins, die nach dem höchsten Gut (latein. Summum Bonum) streben lässt; die Gesetzesethik der Scholastik mit einer breit ausgeführten Kasuistik; die Nachfolgeethik der Franziskaner, die eine Angleichung des Menschen an den erniedrigten Jesus anstreben. – Luther sah die E. wieder in engem Zusammenhang mit dem die Liebe ermöglichenden Glauben. Die neuere Geschichte der theolog. E. ist durch ein Nebeneinander, Miteinander u. Gegeneinander von Individualethik, Sozialethik u. Situationsethik gekennzeichnet.
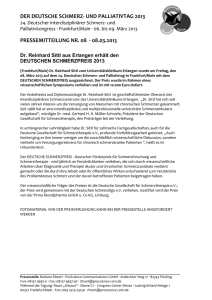
![Moral [lat. moralis „die Sitten betreffend“ von mores „Sitten“]](http://s1.studylibde.com/store/data/007809495_1-8aeb9eb339f9725b7ab189a9219ca5f8-300x300.png)