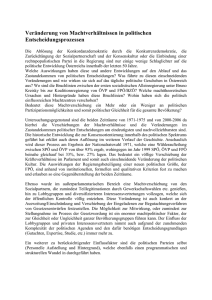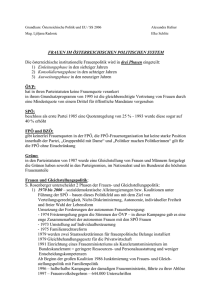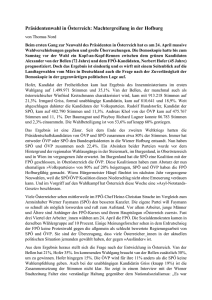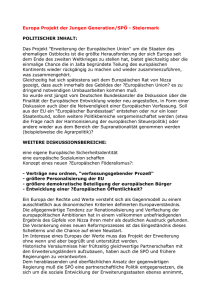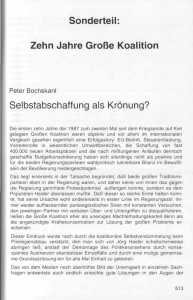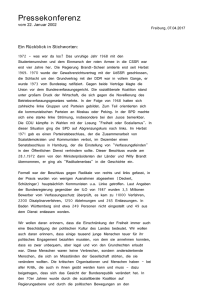Beitrag als PDF öffnen
Werbung
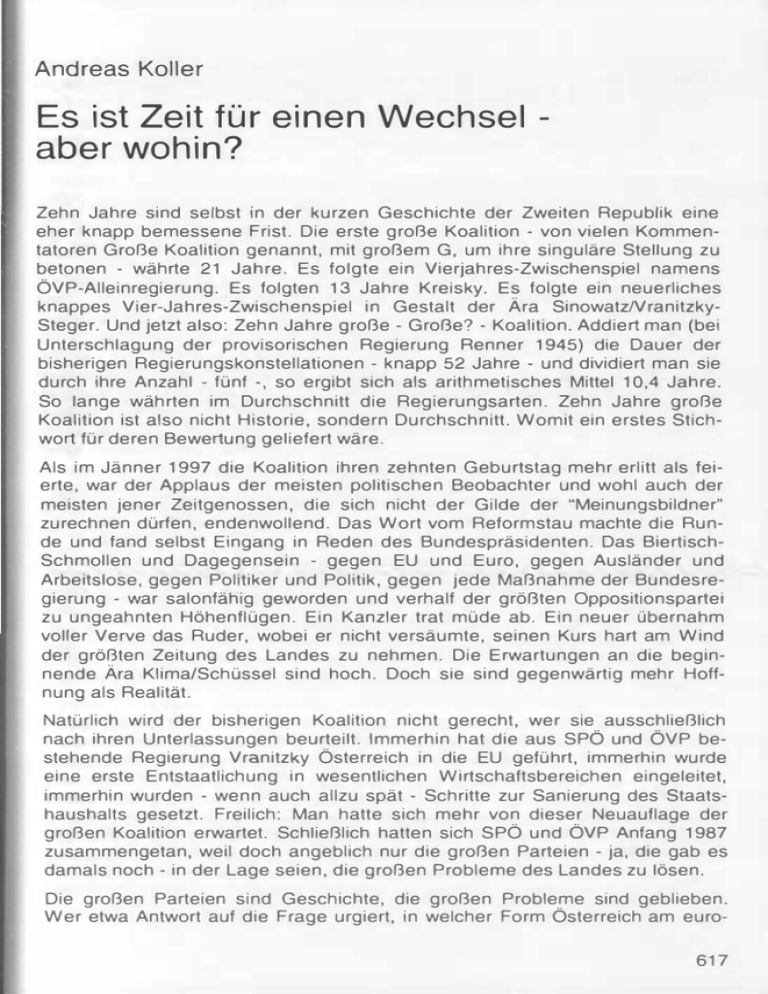
Andreas Koller Es ist Zeit für einen Wechsel aber wohin? Zehn Jahre sind selbst in der kurzen Geschichte der Zweiten Republik eine eher knapp bemessene Frist. Die erste große Koalition - von vielen Kommen­ tatoren Große Koalition genannt, mit großem G, um ihre singuläre Stellung zu betonen - währte 21 Jahre. Es folgte ein Vierjahres-Zwischenspiel namens ÖVP-Alleinregierung. Es folgten 13 Jahre Kreisky. Es folgte ein neuerliches knappes Vier-Jahres-Zwischenspiel in Gestalt der Ära SinowatzlVranitzky­ Steger. Und jetzt also: Zehn Jahre große - Große? - Koalition. Addiert man (bei Unterschlagung der provisorischen Regierung Renner 1945) die Dauer der bisherigen Regierungskonstellationen - knapp 52 Jahre - und dividiert man sie durch ihre Anzahl - fünf -, so ergibt sich als arithmetisches Mittel 10,4 Jahre. So lange währten im Durchschnitt die Regierungsarten. Zehn Jahre große Koalition ist also nicht Historie, sondern Durchschnitt. Womit ein erstes Stich­ wort für deren Bewertung geliefert wäre. Als im Jänner 1997 die Koalition ihren zehnten Geburtstag mehr erlitt als fei­ erte, war der Applaus der meisten politischen Beobachter und wohl auch der meisten jener Zeitgenossen, die sich nicht der Gilde der "Meinungsbildner" zurechnen dürfen, endenwollend. Das Wort vom Reformstau machte die Run­ de und fand selbst Eingang in Reden des Bundespräsidenten. Das Biertisch­ Schmollen und Dagegensein - gegen EU und Euro, gegen Ausländer und Arbeitslose, gegen Politiker und Politik, gegen jede Maßnahme der Bundesre­ gierung - war salonfähig geworden und verhalf der größten Oppositionspartei zu ungeahnten Höhenflügen. Ein Kanzler trat müde ab. Ein neuer übernahm voller Verve das Ruder, wobei er nicht versäumte, seinen Kurs hart am Wind der größten Zeitung des Landes zu nehmen. Die Erwartungen an die begin­ nende Ära Klima/Schüssel sind hoch. Doch sie sind gegenwärtig mehr Hoff­ nung als Realität. Natürlich wird der bisherigen Koalition nicht gerecht, wer sie ausschließlich nach ihren Unterlassungen beurteilt. Immerhin hat die aus SPÖ und ÖVP be­ stehende Regierung Vranitzky Österreich in die EU geführt, immerhin wurde eine erste Entstaatlichung in wesentlichen Wirtschaftsbereichen eingeleitet, immerhin wurden - wenn auch allzu spät - Schritte zur Sanierung des Staats­ haushalts gesetzt. Freilich: Man hatte sich mehr von dieser Neuauflage der großen Koalition erwartet. Schließlich hatten sich SPÖ und ÖVP Anfang 1987 zusammengetan, weil doch angeblich nur die großen Parteien - ja, die gab es damals noch - in der Lage seien, die großen Probleme des Landes zu lösen. Die großen Parteien sind Geschichte, die großen Probleme sind geblieben. Wer etwa Antwort auf die Frage urgiert, in welcher Form Österreich am euro617 päischen Sicherheitssystem teilzunehmen gedenke, erntet verlegenes Schwei­ gen oder billige, auf seiten der SPÖ mit überkommenem Kaltem-Kriegs­ Vokabular bestrittene Ausflüchte. Und selbst die vergleichsweise kleinen Pro­ bleme, wie etwa die Medienliberalisierung oder die Arbeitszeitflexibilisierung, brachten die Koalition an den Rande des Ruins und bedurften, bevor endlich erste bescheidene Lösungen in Sicht waren, jahrelangen Tauziehens. Die Koalition bot politischen Durchschnitt. Und dennoch: Das naheliegende, von Bill Clintons 1992er-Wahlstrategen ent­ liehene Schlagwort: "Ws time for a change" bleibt dem Zwischenrufer der Ta­ gespolitik hierzulande im Halse stecken. A change - wohin? Ebenso alt wie die gegenwärtige Koalition ist nämlich die Parteiführerschaft Jörg Haiders. Der FPÖ-Obmann hat sich durch seine Worten und Taten aus allen ernsthaften Koalitionsüberlegungen ausgegrenzt. Gerade in den Wochen, in denen sich das Entstehen der Koalition zum zehnen Mal jährte, zeigten die Freiheilichen ihr Gesicht. Haiders Kärntner Statthalter wurde bei einer rechtswidrigen Wei­ sung ertappt. Haiders Tiroler Vertrauensmann erhielt eine Anklage wegen eines mutmaßlichen Steuerdelikts zugestellt. Und der Südtiroler Chefideologe wurde unter Mordverdacht verhaftet. Die FPÖ befindet sich, wie man sieht, in ihrer eigenen Gefangenschaft. Das Problem ist, daß sie rund eine Million Österreicher, nämlich ihre Wähler, als Geiseln hält und durch ihre Selbstaus­ grenzung die möglichen Koalitionsvarianten - sieht man von diversen erfri­ schenden Ampelvarianten ab - auf ein Minimum einschränkt. Die somit vollzogene Zementierung der großen Koalition kommt jener Geistes­ haltung entgegen, die davon ausgeht, daß diese Regierungsform in Österreich sozusagen eine Volkskrankheit sei. In der Tat: Die - trotz allem - immer noch machtvolle Polarität der Sozialpartner verlangt nahezu nach einer großkoalitio­ nären Ergänzung auf der Regierungsbank. Denn auch in jenen Zwischenzei­ ten, in denen SPÖ oder ÖVP in die Opposition verbannt waren, waren diese beiden Staatsparteien nie tatsächlich in Opposition. Sie regierten in Gestalt von Wirtschaftskammer und GewerkschafVArbeiterkammer mit. Was liegt also näher, als die - fast hätten wir geschrieben: ständestaatliche rotschwarz-Struktur des Landes auch bei der Bildung der Bundesregierung nachzuvollziehen? So könnte man fragen. Man könnte freilich ebensogut die de-facto-Pragmatisierung der großen Koali­ tion für ein großes demokratiepolitisches Minus halten. Eine Demokratie zeich­ net sich unter anderem dadurch aus, daß der Wähler die Regierenden bei Mißfallen nach Hause schicken und durch neue ersetzen kann. In Österreich kann er das nicht, weder auf Bundesebene noch in den Ländern (hier schon gar nicht). In Österreich kann der Wähler wählen, wie er will, es kommt immer die gleiche Koalition zustande. Als die Wiener SPÖ bei den Gemeinderats­ wahlen 1996 unter die absolute Mehrheit rutschte, stieg die ÖVP in die Stadt­ regierung ein und legitimierte damit die wilde Ehe, die schon zuvor zwischen roter Stadtverwaltung und schwarzer Wirtschaftskammer geherrscht hatte; dies, obwohl sich SPÖ und FPÖ in zentralen inhaltlichen Fragen (Stichwort: 618 Ausländer im Gemeindebau) näher gestanden hatten als SPÖ und ÖVP, die nichts weiter verband als der Wille zum Machterhalt. In den übrigen Bundes­ ländern sind Koalitionswechsel unbekannt - man regiert im Proporz. Jede Partei halbwegs wahrnehmbarer Größe hat Anspruch auf Vertretung in der Landesregierung. Um demokratische Kinkerlitzchen wie Oppositionsparteien und parlamentarische Kontrolle braucht sich kein Mensch zu scheren. Und auf Bundesebene reagiert zwar nicht der Allparteien-, aber ohne jede Beirrung der rotschwarze Proporz. Die Welt mag aus den Fugen geraten, der Eiserne Vor­ hang fallen, Österreich ins Zentrum Europas rücken - in den historischen Wie­ ner Gemäuern einer bedeutenderen Vergangenheit sitzt die große Koalition und verwaltet, durchaus durchschnittlich, vor sich hin. Um in diesem Land einen neuen Aufbruch einzuleiten, genügt es nicht, nach neuen Koalitionsvarianten zu schielen. Selbst der Wiedereintritt einer erneu­ erten, demokratischen FPÖ ins Lager der regierungsfähigen Parteien würde die Starre nicht notwendigerweise lösen. Denn das Vorhandensein extremisti­ scher, sich selbst ausgrenzender Parteien ist eher die Regel als die Ausnah­ me, wie nicht nur der Blick auf jüngste Wahlergebnisse in Europa lehrt, son­ dern auch die Geschichte dieses Jahrhunderts. Dies bedeutet, daß mit selbst­ isolierten Parlamentsfraktionen und dadurch eingeschränkten Koalitions­ Optionen immer gerechnet werden muß, heißen die Selbstausgrenzer nun FPÖ oder sonstwie. Jörg Haider ist kein singuläres Phänomen, er ist vielmehr eine Funktion von Kräften, die in jeder Gesellschaft vorhanden sind. Das be­ deutet: Wenn ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel des Parlaments für eine Zu­ sammenarbeit nicht in Frage kommt, reduzieren sich die demokratischen Mög­ lichkeiten der Regierungsbildung ganz eklatant. Es ist also keineswegs FPÖ-Anlaßaktionismus, wenn seit einiger Zeit eine ernsthafte Debatte über die mögliche Einführung eines Mehrheitswahlrechts geführt wird. Dieser Gedanke wurde auf politischer Ebene vor allem von Hein­ rich Neisser und Josef Cap artikuliert. Franz Vranitzky setzte in den letzten Wochen seiner Kanzlerschaft eine diesbezügliche Arbeitsgruppe ein. Ein Mehrheitswahlrecht würde nicht nur - dank damit verbundener eindeutiger Parlamentsmehrheiten - für eine stabilere(Allein)-Regierung ohne Koalitions­ krämpfe sorgen, es hätte auch Ventilcharakter. Derzeit fliegen die Stimmen der frustrierten Protestwähler fast automatisch Jörg Haider zu, da ja SPÖ und ÖVP in der Regierung sind. Beim Mehrheitswahlrecht könnte stets jene der beiden Parteien, die gerade in Opposition ist, stimmenmäßig punkten. Die Protest­ stimmen gingen also nicht an die Extremisten, sondern blieben in der sozial­ partnerschaftlichen Familie. Nachteil: Auch die konstruktive Opposition, also Grüne und Liberale, blieben auf der Strecke. Auch aus inhaltlich-politischer Sicht wäre ein Mehheitswahlrecht bestechend. Der Wähler hätte tatsächlich die Wahl. Am Beispiel Sicherheitspolitik: Stattet er die ÖVP mit absoluter Mehrheit aus, so kann sie Österreich in die NATO führen. Macht er die SPÖ zur Regierungspartei, bleiben wir eine neutrale Rest- 619 Enklave. Und so weiter, wobei die Zahl der Beispiele, aber auch der möglichen Regierungsparteien der Phantasie des Lesers überlassen bleibt. Freilich, all das ist Zukunftsmusik. Ein erster Schritt Richtung Mehrheitswahl­ recht wäre es, den Proporzzwang in den Landesregierungen zu beseitigen; auf daß also zumindest die Landesregierungen - wenn schon nicht die Landtage nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt werden und nicht jede Mehrheitspartei nach mißgünstigen Koalitionspartnern suchen muß. Was den Vorteil hätte, daß es auch auf Länderebene plötzlich Oppositionsparteien gäbe. Und eine neue politische Kultur, die nicht nur den Ländern, sondern dem ganzen Land gut anstünde. 620