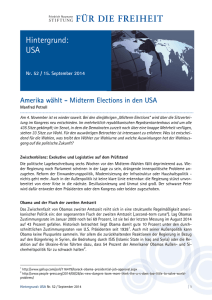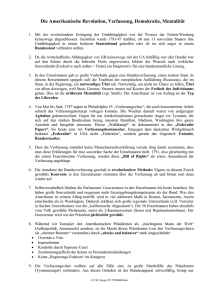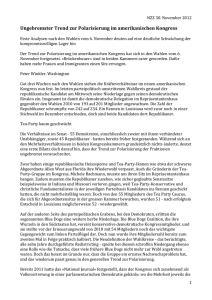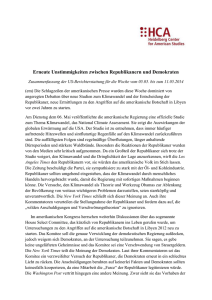Informationen zur politischen Bildung 320 – IzpB
Werbung
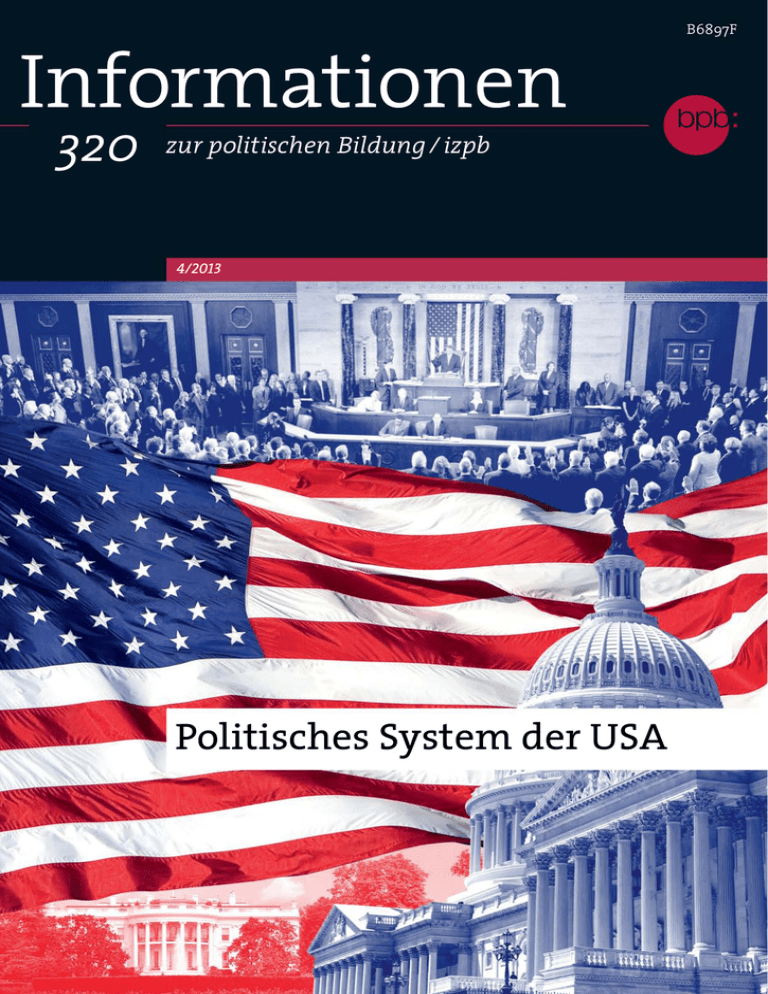
Informationen 320 zur politischen Bildung / izpb 4/2013 Politisches System der USA 2 Politisches System der USA Inhalt Die USA – eine europäische Idee mit welthistorischer Bedeutung .....................................................4 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances .........................................................................8 Horizontale Gewaltenteilung .............................................................. 8 Vertikale Gewaltenteilung: Föderalismus ...................................... 27 Temporale Kontrolle: Macht auf Zeit durch Wahlen ................. 30 Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker ......................................................................44 Schwache Parteien ..................................................................................44 Starke Interessengruppen ...................................................................46 Think Tanks als Ideen- und Personalagenturen ......................... 47 Medien als vierte Gewalt? ................................................................... 50 Aktuelle Probleme: Politikblockade ................................ 54 Der Schuldenberg .................................................................................... 54 Blockierte Wirtschaftspolitik .............................................................. 56 Freie Hand für freien Handel? ............................................................ 57 Volle Kraft zurück: Energie- und Umweltpolitik ........................ 58 Abwälzen außenpolitischer Lasten ................................................ 60 Literaturhinweise und Internetadressen .................. 64 Schlagwörterverzeichnis ......................................................... 66 Der Autor ............................................................................................... 67 Impressum ........................................................................................... 67 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 3 Editorial „E in Land im Würgegriff“, „Unvereinigte Staaten“, „Eines langen Tages Reise in die Unregierbarkeit“ – so lauteten Schlagzeilen der deutschen Presse im Oktober 2013. Anlass für diese Zuschreibungen waren die haushaltspolitischen Auseinandersetzungen zwischen der Republikanischen Mehrheit im Kongress und dem Demokratischen Präsidenten Obama. Es drohte – wieder einmal – die Zahlungsunfähigkeit der USA, 16 Tage lang waren Bundesbehörden geschlossen und wurden Regierungsangestellte in Zwangsurlaub geschickt. Erst Ende Dezember konnten sich Demokraten und Republikaner mühsam auf einen Minimalkompromiss einigen. Aufmerksame Beobachter sprechen von einer Tendenz zur Polarisierung der USGesellschaft, die sich in den vergangenen Jahren verschärft hat – und das sowohl auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem wie auf kulturellem Gebiet. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass eine Schließung von Bundesbehörden erfolgt ist oder dass um die Schuldengrenze gestritten wird, aber die Bereitschaft, tragfähige Kompromisse herbeizuführen, scheint in den vergangenen Jahren zunehmend verloren gegangen zu sein. Was spricht für die Richtigkeit dieser Beobachtungen, und welche Entwicklungen liegen der konstatierten Polarisierung zugrunde? Wie ist das politische System der USA angelegt, das aufgrund seiner Prinzipien und seiner elastischen Konstruktion zum Vorbild für viele Demokratien weltweit wurde, und wie kann es unter den aktuellen Voraussetzungen seine Funktionsfähigkeit bewahren? Der Autor dieses Heftes, der Politikwissenschaftler Josef Braml, erklärt die Grundprinzipien, nach denen das politische System der USA aufgebaut ist, stellt seine wichtigsten zentralen Akteure vor, beschreibt ihr Zusammenwirken auf den verschiedenen Politikfeldern und erläutert die Spielregeln und den Rahmen, in dem die politischen Auseinandersetzungen stattfinden. Dabei geht er auch auf die historischen Hintergründe und die Ideengeschichte ein, weil ohne sie die politischen Strukturen der USA, ihre aktuellen Probleme und die künftige Entwicklung nicht zu verstehen sind. Jutta Klaeren Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 4 Politisches System der USA Josef Braml Die USA – eine europäische Idee mit welthistorischer Bedeutung akg / De Agostini Pict. Lib. Die Verfassung von 1787 ist bis heute Grundlage politischen Handelns in den USA. Sie genießt nicht nur bei der eigenen Bevölkerung Anerkennung, auch international haben ihre Prinzipien und ihr freiheitliches Gesellschaftsmodell Vorbildcharakter. Seit 2001 ist es schwieriger geworden, diesen hohen Anspruch zu erfüllen. Am 17. September 1787 unterzeichnen die Abgesandten der Einzelstaaten in Philadelphia unter Vorsitz des späteren Präsidenten George Washington die Verfassungsurkunde für ihr neues Staatswesen. (Bildausschnitt) D ie Architekten der US-amerikanischen Verfassung, die sogenannten Gründerväter, darunter Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson und George Washington, genießen bis heute in den USA für ihr Werk große Wertschätzung. Dass die älteste bis heute gültige republikanische Staatsverfassung auch im 21. Jahrhundert mehr oder weniger unverändert besteht, liegt an ihrer elastischen Konstruktion. Die miteinander verbundenen Prinzipien der Volkssouveränität, der individuellen Menschenrechte und der Repräsentation gewährleisten immer noch die Statik des Verfassungsgerüsts von 1787. Die antike Vorstellung vom Volk als Quelle von Regierungsmacht wurde mit dem neuzeitlichen Konzept individueller Menschenrechte verschränkt: In einer liberalen Demokratie stößt der Mehrheitswille des Volkes dort an Grenzen, wo er die Rechte von Minderheiten beschneidet – eine „Tyrannei der Mehrheit“ soll verhindert werden. Das Misstrauen gegenüber der breiten Masse wird in einem weiteren Konstruktionselement deutlich, der repräsentativen Demokratie: Insbesondere auf der Ebene des Bundesstaates sollte nicht das Volk selbst im Sinne einer direkten Demokratie entscheiden, sondern seine Repräsentanten. Dahinter steht die Erwartung, dass vom Volk gewählte Vertreterinnen und Vertreter in ihrem Handeln weniger durch Leidenschaften und Affekte geleitet sind, sondern eher rationale und weitsichtige Entscheidungen treffen als eine direkte Volksregierung. Die „Erfindung“ der amerikanischen Nation, so der USamerikanische Politikwissenschaftler Benedict Anderson in seinem 1988 auf Deutsch erschienenen gleichnamigen Buch, gründet denn auch wesentlich auf der Emanzipation vom „Alten Kontinent“ Europa mit seinen Staatskirchen und Herrschern von Gottes Gnaden. Gleichzeitig waren die Siedler in der „Neuen Welt“ von Beginn an von dem Bewusstsein erfüllt, eine von Gott auserwählte Nation zu sein: „God’s own country“. Diese Abkehr vom Staatskirchentum, verbunden mit dem Bewusstsein des Auserwähltseins, kommt auch im ersten Verfassungszusatz zum Ausdruck: Die Einrichtung einer staatstragenden Amtskirche wird untersagt und Religions- und Meinungsfreiheit gewährleistet. Diese verfassungsrechtlich gewährte Freiheit schafft bis heute Raum für Pluralismus und ein ständiges Ringen um die legitime Position von Religion im Spannungsfeld zwischen privater und öffentlich-politischer Sphäre. So steht etwa das Schulgebet bis heute im Zentrum politischer Auseinandersetzungen, insbesondere seit das Oberste Gericht, der Supreme Court, 1985 im Fall Wallace v. (v. = versus, lat. für gegen) Jaffree entschied, dass in staatlichen Schulen sogar eine Minute der Stille zum freiwilligen Beten oder Meditieren gegen die „establishment clause“ verstoße, die vor der Etablierung einer Staatsreligion schützen soll. Geprägt von den Erfahrungen absolutistischer Herrschaft, insbesondere von den Praktiken der damaligen Kolonialmacht Großbritannien, und inspiriert durch aufklärerische Ideen der Philosophen John Locke und Montesquieu, wollten die Exilanten fernab ihrer Heimat eine „Neue Welt“ schaffen. In ihr sollte Herrschaft nicht wie auf dem „Alten Kontinent“ von oben, von Gottes Gnaden, legitimiert sein, sondern jegliche Macht von unten, vom Volke, auf Zeit verliehen werden. Der Einzelne – wobei damals indes nur an den wohlhabenden Mann mit weißer Hautfarbe gedacht war – galt als Quelle der Volkssouveränität. Darüber hinaus sollte im Sinne einer Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Die USA – eine europäische Idee mit welthistorischer Bedeutung 5 Pledge of Allegiance: William Thomas Cain / Getty Images I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Treueschwur: Ich schwöre Treue auf die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden. http://usa.usembassy.de/regierung-treueschwur.htm Ausdruck der Verehrung gegenüber der Republik und der Fahne, die sie symbolisiert, ist der Fahneneid, den hier 2004 eine Schulklasse in Pennsylvania leistet. Die Formulierung „under God“ verweist auf das nationale Selbstverständnis, ist in einem Land mit Religionsfreiheit aber auch immer wieder umstritten. liberalen Verfassung durch Prinzipien der Gewaltenkontrolle Missbrauch verhindert werden, um individuelle Grundrechte vor staatlicher Willkür zu schützen. Die wichtigsten, im Weiteren als individuelle oder persönliche Freiheitsrechte bezeichneten civil liberties werden durch die ersten zehn Verfassungszusätze (amendments) garantiert. Diese auch unter dem Begriff der Bill of Rights zusammengefassten Grundsätze wurden am 15. Dezember 1791 als Ganzes in die US-Verfassung aufgenommen. Nach dem Bürgerkrieg (1861-1865) kamen weitere Verfassungszusätze dazu, wobei der 14. besonders bedeutsam für den Schutz der individuellen Freiheitsrechte jeder Person – ungeachtet der Staatsbürgerschaft – ist. Allerdings hat die verfassungsrechtliche Auslegung des Supreme Court gezeigt, dass einige der individuellen Freiheitsrechte ausschließlich US-Amerikanerinnen und -Amerikanern vorbehalten sind. Die Verfassungsväter haben der Gewaltenkontrolle besondere Aufmerksamkeit gewidmet, denn das Grundprinzip der konkurrierenden, sich gegenseitig kontrollierenden Staatsgewalten (checks and balances) hat eine grundlegende Bedeutung für die Sicherung individueller Freiheitsrechte. Neben der horizontalen Gewaltenteilung in die gesetzgebende (Legislative), die ausführende (Exekutive) und die richterliche Gewalt (Judikative) wurde in der amerikanischen Verfassung auch eine vertikale Gewaltenkontrolle angelegt: Die Befugnisse zwischen den Einzelstaaten und dem Bundesstaat wurden aufgeteilt. Mit horizontaler und vertikaler Gewaltenteilung sollte verhindert werden, dass die Rechte und Freiheiten des Einzelnen und jene der Einzelstaaten über Gebühr eingeschränkt werden. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Gleichwohl wurden die Rechte der Einzelstaaten, die states‘ rights, mit Billigung des Supreme Court auch dazu missbraucht, um bis ins 20. Jahrhundert in den Südstaaten der USA die Rassendiskriminierung aufrechtzuerhalten. Erst in den 1950erund 1960er-Jahren gelang es der Bürgerrechtsbewegung, dem civil rights movement, die Rassentrennung und -diskriminierung mehr oder weniger zu überwinden. So erklärte der Supreme Court 1954 im Fall Brown v. Board of Education die Rassentrennung an staatlich finanzierten Schulen für unzulässig. Der Voting Rights Act von 1965 ermöglichte schließlich auch der afroamerikanischen Bevölkerung verbesserte Rechte zur politischen Teilhabe. Rassendiskriminierung ist jedoch bis heute ein politisch brisantes Thema geblieben. Ungeachtet solcher Unzulänglichkeiten sollte schon nach dem Ansinnen der frühen Siedler der Neuen Welt das „amerikanische Experiment“ die Welt verbessern. Das Leitbild US-amerikanischer Außenpolitik bewegte sich im Laufe ihrer Geschichte kontinuierlich zwischen Absonderung von der Welt und missionarischem Drang zur Weltverbesserung. Der selbstverstandene Ausnahmecharakter der USA, der sogenannte Exzeptionalismus, manifestierte sich dementsprechend in unterschiedlicher Weise: zum einen, indem die „beinahe auserwählte“ Nation („almost chosen“, so Abraham Lincoln), die „city upon a hill“ (so der puritanische Pionier John Winthrop 1630 in Anspielung auf das biblische Jerusalem, das einen engen Bund mit Gott hatte) selbstgenügsam der Welt als leuchtendes Vorbild diente, oder zum anderen, indem sie die Welt aktiv verändern wollte, sei es mit diplomatischen oder militärischen Mitteln, sei es durch Vorgehen im Alleingang oder mit Unterstützung anderer Staaten. 6 Politisches System der USA „All men are created equal“ – ein Verfassungsgebot und seine Auslegung an US-amerikanischen Schulen aufgehoben werden. Am 2. Juli 1964 unterzeichnete Präsident Lyndon B. Johnson in Anwesenheit des Bürgerrechtlers Martin Luther King den Civil Rights Act, mit dem die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung bei Wahlen und in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Hotels oder Bussen abgeschafft werden sollte. Bereits sein Vorgänger John F. Kennedy hatte auf die immer heftiger werdenden öffentlichen Proteste der Afroamerikaner reagiert. In seiner Ansprache vom 11. Juni 1963 hatte er seine Landsleute und die Gesetzgeber aufgefordert, der Diskriminierung ein Ende zu bereiten. Es war dann aber die Regierungsmannschaft seines Nachfolgers Johnson, der es gelang, das heftig umstrittene Gesetz durch den Kongress zu manövrieren. Gleich in seiner ersten Ansprache an die versammelten Abgeordneten und Senatoren am 27. November 1963 äußerte Präsident Johnson, dass kein noch so eloquenter Nachruf den wenige Tage zuvor, am 22. November 1963, ermordeten Präsidenten gleichermaßen ehren könne wie die schnellstmögliche Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes, für das Kennedy so lange gekämpft habe. Mit dem Civil Rights Act konnte zwar die Zweiklassengesellschaft in öffentlichen Räumen mehr oder weniger beseitigt werden, aber nicht die Diskrimi- nierung der Afroamerikaner bei den Wahlen. Mit dem von Präsident Johnson am 6. August 1965 unterzeichneten Voting Rights Act sollte einmal mehr sichergestellt werden, dass der afroamerikanischen Minderheit gleiche Voraussetzungen gegeben werden, um sich an den Wahlen zu beteiligen. Dazu wurden diskriminierende Praktiken wie Analphabetismus-Tests als Voraussetzung zur Wählerregistrierung verboten und die verantwortlichen Einzelstaaten unter Aufsicht des Bundesjustizministeriums gestellt. Am 25. Juni 2013 urteilte das Oberste Gericht im Fall Shelby County v. Holder mit einer denkbar knappen Mehrheit von fünf gegen vier Stimmen, dass im „Lichte gegenwärtiger Bedingungen“, insbesondere aufgrund der verbesserten politischen Beteiligung von Minderheiten, eine elementare Bestimmung (Sektion 4) des Voting Rights Act überholt und damit verfassungswidrig sei. Bisher unterstanden die bei Wahlen mit Diskriminierungspraktiken historisch vorbelasteten Südstaaten der Bundesaufsicht. Die Gesetzgeber sind nun aufgefordert, neue, an die heutige Zeit angepasste Kriterien zu finden, die weiterhin eine bundesstaatliche Aufsicht der von den Einzelstaaten organisierten Wahlen rechtfertigen würden. AP Photo Am 17. Mai 1954 entschied das Oberste Gericht im Fall Brown v. Board of Education, dass nach Hautfarbe getrennte Schulen „von Natur aus ungleich“ sind und dem Gleichheitsgrundsatz des 14. Zusatzartikels der Verfassung widersprechen. Mit diesem wegweisenden Urteil revidierten die Obersten Richter auch die bislang vorherrschende Rechtsauslegung gemäß der „separate but equal“-Doktrin. Sie war 1896 im Fall Plessy v. Ferguson etabliert worden, um Rassentrennung zu rechtfertigen, solange es „getrennte, aber gleichwertige“ Einrichtungen für afroamerikanische und weiße Schüler gab. Landesweit, vor allem in den Südstaaten, waren jedoch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die nach Hautfarbe getrennten Schulen alles andere als gleichwertig eingerichtet. Die ursprüngliche Klägerin, Esther Brown, kritisierte die schlimmen Zustände, mit denen afroamerikanische Kinder in ihrer Heimatstadt South Park im Bundesstaat Kansas alltäglich zu kämpfen hatten. Ihre auf die Städte Wichita und Topeka ausgeweitete Klage wurde unterstützt von der bereits 1909 gegründeten National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Mit der erfolgreichen Sammelklage, der sich weitere Familien anschlossen (unter anderem Oliver Brown, nach dem der Fall benannt wurde), konnte schließlich die Rassentrennung Der Civil Rights Act von 1964 ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung. Nach der Unterzeichnung wendet sich Präsident Johnson (sitzend) dem hinter ihm stehenden Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King zu. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Burkhard Mohr / Baaske Cartoons Die USA – eine europäische Idee mit welthistorischer Bedeutung Nach den für die USA traumatischen islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington haben die Bemühungen von US-Präsident George W. Bush (2001-2009), mehr Sicherheit auf Kosten der Freiheit zu erlangen und die Ohne Religion geht es nicht Frau Professor Bungert, Präsident Obama wird in diesem Jahr [2013] zweimal vereidigt. Was hat es damit auf sich? Es wäre in den USA undenkbar, dass der offizielle Festakt zur Inauguration an einem Sonntag stattfindet. Damit nun das Land nicht ohne vereidigten Präsidenten ist, wenn der verfassungsmäßig festgesetzte Termin des Amtswechsels am 20. Januar auf einen Sonntag fällt, gibt es seit dem 20. Jahrhundert an diesem Tag eine Vereidigung im Weißen Haus im kleinen Kreis, am Montag wiederholt der Präsident seinen Schwur in aller Öffentlichkeit. Im 19. Jahrhundert hatte man den Amtseid auf Samstag vorverlegt – mit der seltsamen Folge, dass es einen Tag lang zwei vereidigte Präsidenten gab. So viel Umstand mit Rücksicht auf den christlichen Ruhetag? Offiziell sind Religion und Staat in den USA strikt getrennt. Aber die puritanische Tradition ist bis heute lebendig. Der Sonntag gehört dem Gottesdienst. Festivitäten sind verpönt, ebenso wie Alkoholgenuss. […] Das sind natürlich Anachronismen, deren Logik auch nicht durchgehalten ist. Der Superbowl, eines der größten Sportereignisse in den USA, darf zum Beispiel sehr wohl sonntags stattfinden. Welt mit militärischen Mitteln zu demokratisieren, jedoch zu einem merklichen Qualitätsverlust der eigenen, US-amerikanischen Demokratie geführt. Barack Obamas Wahl zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gab Anlass zur Hoffnung auf einen Kurswechsel. „Change we can believe in“ hatte sein Wahlkampfmotto gelautet, und in seiner Amtsantrittsrede verurteilte er die Politik seines Vorgängers: „Wir verweigern uns gegen die irreführende Wahlmöglichkeit zwischen unserer Sicherheit und unseren Idealen.“ Er bekundete dagegen die Absicht, unter seiner Führung der von den Gründervätern verfassten Charta zur Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten wieder neuen Glanz zu verleihen. „Diese Ideale erleuchten immer noch die Welt, und wir geben sie nicht preis, nur weil es zweckdienlich erscheint“, so Obama in seiner Ansprache. (www.whitehouse. gov/blog/inaugural-address/) Ob es Präsident Obama gelingen wird, die inneren Kollateralschäden des „Globalen Krieges gegen den Terror“ (Global War on Terror) und den internationalen Ansehensverlust der einstigen liberalen Vorbilddemokratie zu reparieren, bleibt abzuwarten. Dies wäre nicht ohne Belang, denn der Qualitätszustand der freiheitlich verfassten offenen US-Gesellschaft beeinflusst aufgrund ihres Vorbildcharakters die weltweite Wahrnehmung demokratischer Rechtsstaatlichkeit und internationaler Rechts- und Ordnungsvorstellungen. Sind die USA also doch eine Art Gottesstaat? Mit dem Begriff wäre ich vorsichtig, aber klar, es gibt eine Vermischung von Religion und Politik, was in der Wissenschaft oft „Zivilreligion“ genannt wird. Sie wird nirgends deutlicher als in der Inaugurationsfeier mit Gebeten zu Beginn und einem Schluss-Segen – Ritualen, die nicht zu einer säkularen staatlichen Zeremonie zu passen scheinen. Offiziell wird dann gern gesagt, es werde nicht der Gott einer bestimmten Religion adressiert. [...] Welchen Sinn hat die religiöse Aufladung der ganzen Feier? Sie drückt das Selbstverständnis der USAmerikaner als „Gottes auserwähltes Volk“ aus. Auch das ist puritanisches Erbe und Teil der Zivilreligion. Europäern ist dieser Erwählungsgedanke oft fremd. Für US-Amerikaner hingegen verbindet sich damit die Selbstverpflichtung, sich der göttlichen Erwählung und des Erbes der Vorväter würdig zu erweisen. Jede Generation von Amerikanern wird daraufhin neu geprüft. […] Ohne Bibel geht es nicht? Fast alle Präsidenten haben auf die Bibel geschworen. George Washingtons Vereidigung hätte zwar beinahe ohne Bibel stattgefunden. Doch im letzten Augenblick wurde ein Exemplar herbeigeschafft, Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 7 ausgerechnet aus einem Freimaurertempel. Seitdem hat nur John Quincy Adams, Präsident von 1825 bis 1829, stattdessen auf ein Gesetzesbuch geschworen. Nach Kennedys Ermordung 1963 wurde sein Vize Lyndon B. Johnson an Bord der Air Force One vereidigt. Dort fand sich zwar keine Bibel, wohl aber ein katholisches Messbuch. Das musste als Ersatz herhalten. Also: Bibel muss sein. Neuerdings eben sogar zwei [Am Montag, 21. Januar 2013, dem Tag der öffentlichen Vereidigung Präsident Obamas, wurde auch offiziell der Gedenktag für den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King begangen. Deshalb leistete der Präsident an diesem Tag seinen Amtseid nicht nur auf die Bibel des ehemaligen Präsidenten Abraham Lincoln, sondern auch auf eine Bibel Martin Luther Kings. – Anm. d. Red.]. Bei seiner „kleinen Vereidigung“ am Sonntag wird Obama noch eine dritte benutzen, eine Bibel aus Familienbesitz. Wie funktioniert denn der Schwur auf zwei Bibeln gleichzeitig? Indem man sie übereinanderlegt. Jedes Exemplar ist an einer bestimmten Textstelle geöffnet. […] Heike Bungert, geb. 1967, ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. „Religiös getränkt“. Joachim Frank im Gespräch mit der Historikerin Heike Bungert über das Zeremoniell zur Vereidigung Barack Obamas, in: Frankfurter Rundschau vom 16. Januar 2013 8 Politisches System der USA Josef Braml picture alliance / dpa / Shawn Thew Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Legislative, Exekutive und die Bundesstaaten haben jeweils eigene Interessen und Befugnisse. Sie kontrollieren sich gegenseitig und werden von der Wählerschaft, von Interessengruppen und ggf. vom Supreme Court kontrolliert. Eine wachsende gesellschaftliche Polarisierung erschwert Kompromisse. Strikte Trennung: Nur für besondere Anlässe, etwa für seine Rede zur Lage der Nation – hier 2012 –, darf der Präsident den Kongress betreten. U m Machtmissbrauch zu verhindern, haben die Architekten der US-amerikanischen Verfassung mehrere Kontrolldimensionen verankert: Erstens verleiht der Souverän, das heißt der wahlberechtigte Bürger, die Macht an seine Repräsentanten nur auf Zeit (temporale Machtkontrolle), damit diese ihm Rechenschaft schuldig bleiben. Zweitens verlangt die föderale Struktur, die Machtbefugnisse der den Bürgern näher stehenden Einzelstaaten mit jenen des Gesamtstaates in Einklang zu bringen (vertikale Machtkontrolle). Dies musste nicht zuletzt auf den Schlachtfeldern des Bürgerkrieges und in bis heute andauernden höchstrichterlichen Auseinandersetzungen ausgefochten werden. Drittens gibt es sowohl auf einzelstaatlicher Ebene als auch auf der Ebene des Gesamtstaates eine Teilung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative (horizontale Machtkontrolle). Strukturmerkmale parlamentarischer und präsidentieller Regierungssysteme Merkmal parlamentarisch (z. B. BRD) präsidentiell (z. B. USA) Legitimation nur Parlament direkt gewählt Präsident und Parlament mit jeweils eigener Legitimation Organisation der Gewaltenkontrolle Gewaltenverschränkung Trennung von Regierung und Parlament politische Abberufbarkeit der Regierung ja nein (nur verfassungsrechtlich, impeachment) Parlamentsauflösungsrecht der Exekutive ja nein Regierungsamt und Parlamentsmandat vereinbar unvereinbar Partei- und Fraktionsdisziplin stark schwach Walter Bagehot, The English Constitution, Ithaca (1867) 1966; Ernst Fraenkel, Das amerikanische Regierungssystem, Köln/Opladen 1960; Winfried Steffani, Parlamentarische und präsidentielle Demokratie: Strukturelle Aspekte westlicher Demokratien, Opladen 1979, S. 39-104 Horizontale Gewaltenteilung Der zentrale Unterschied zwischen dem US-amerikanischen (präsidentiellen) checks and balances-System und parlamentarischen Regierungssystemen wie dem der Bundesrepublik Deutschland liegt in der unterschiedlichen Beziehung zwischen der Legislative und der Exekutive begründet. Anders als der USPräsident, der durch einen landesweiten Wahlakt persönlich gewählt wird und damit eigene Legitimation beanspruchen kann, wird die deutsche Kanzlerin mittelbar von der Mehrheit im Parlament gewählt. Auch in der politischen Auseinandersetzung muss die Spitze der deutschen Exekutive darauf vertrauen können, dass ihre politischen Initiativen von ihrer Fraktion bzw. Koalition im Bundestag mitgetragen werden. Die Stabilität sowohl Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances der Regierung/der Exekutive als auch jene der Parlamentsmehrheit hängt von einer engen und vertrauensvollen Kommunikationsbeziehung zwischen beiden ab. Diese „Gewaltenverschränkung“ charakterisiert parlamentarische Regierungssysteme. Legislative und Exekutive sind im politischen System der USA nicht nur durch verschiedene Wahlakte stärker voneinander „getrennt“. Das System der checks and balances ist darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass die politischen Gewalten miteinander konkurrieren und sich gegenseitig kontrollieren. Der US-amerikanische Kongress übernimmt somit nicht automatisch die politische Agenda der Exekutive/des Präsidenten, selbst wenn im Fall des unified government das Weiße Haus (Sitz des Präsidenten) und Capitol Hill (Sitz des Kongresses) von der gleichen Partei „regiert“ werden. Noch weniger ist dies der Fall, wenn bei einem divided government Präsident und Kongress von unterschiedlichen Parteien „kontrolliert“ werden, was mit dem Wahlergebnis 2012 erneut eintrat. Während im US-System die Legislative als Ganzes mit der Exekutive um Machtbefugnisse konkurriert, ist „Opposition“ im parlamentarischen System auf die Minderheit im Parlament beschränkt, die nicht die Regierung trägt. Insbesondere für die Regierungspartei/-koalition sind Partei- bzw. Fraktionsdisziplin grundlegend erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der eigenen Regierung, ja des parlamentarischen Regierungssystems insgesamt zu gewährleisten. Da Exekutive und Parlamentsmehrheit in einer politischen Schicksalsgemeinschaft verbunden sind, haben einzelne Abgeordnete ein © Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild 854 511 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 9 Eigeninteresse, bei wichtigen Abstimmungen nicht von der Parteilinie abzuweichen und sich der Fraktionsdisziplin zu fügen. Wahlverfahren, Parteienfinanzierung, Kandidatenrekrutierung und die hohe Arbeitsteilung im Parlament geben weitere Anreize für parteidiszipliniertes Verhalten. Dagegen ist in den USA die politische Zukunft einzelner Abgeordneter und Senatoren weitgehend unabhängig von der des Präsidenten; ihre (Wieder-)Wahlchancen hängen vorrangig vom Rückhalt im eigenen Wahlkreis bzw. Einzelstaat ab. Aufgrund des Wahlsystems und der Politikfinanzierung sind sie als „politische Einzelunternehmer“ (political entrepreneurs) in den USA primär selbst für ihre Wiederwahl verantwortlich und haften gegebenenfalls auch persönlich für ihr Abstimmungsverhalten im Kongress, weil sie sich gegenüber Interessengruppen und Wählerschaft nicht hinter einer Parteidisziplin verstecken können. Den US-Parteien fehlen in der legislativen Auseinandersetzung Ressourcen und Sanktionsmechanismen, um den Gesetzgebungsprozess im Sinne einer Parteidisziplin zu gestalten (siehe S. 44 f.). Power of the purse: die Legislative Die Legislative und ihre Befugnisse sind in der US-Verfassung – noch vor dem Präsidenten und dessen Aufgaben – an erster Stelle angeführt. Artikel I, Absatz 1 bestimmt: „Die gesetzgebende Gewalt ruht im Kongress der Vereinigten Staaten, der aus einem Politisches System der USA Doug Armand / Getty Images 10 Stephen Crowley / The New York Times / laif Die US-Legislative, der Kongress, residiert mit beiden Kammern im Kapitol. Senat und Repräsentantenhaus sind aber räumlich getrennt, und es besteht zudem ein machthemmendes Konkurrenzverhältnis. wikimedia.org Am 13. Januar 2013 leisten die Mitglieder des neu formierten 113. Kongresses den Treueeid im Plenarsaal des Repräsentantenhauses. Vollversammlung des Senats, des kleinen, aber einflussreichen „Oberhauses“ Senat und einem Abgeordnetenhaus besteht.“ Im Sinne der Verfassungsväter, dargelegt von James Madison in den Federalist Papers, Nr. 63, galt die Senatskammer seinerzeit schon als „gemäßigte und angesehene Körperschaft von Bürgern“ (temperate and respectable body of citizens), die nötig war, um die „regelwidrigen Leidenschaften“ (irregular passions) der Abgeordneten der zweiten Kammer zu zügeln. Ihre unterschiedlichen konstitutionellen Eigenschaften begünstigen die Konkurrenz zwischen den beiden Kammern und bedingen damit eine weitere Form der Gewaltenkontrolle. Ein langjähriger Insider bringt die Rivalität zwischen House of Representatives und Senate auf den Punkt: Für Christopher Matthews, den ehemaligen Stabschef des legendären Sprechers des Abgeordnetenhauses, Tip O’Neill, existiert eine Art unsichtbare Trennwand zwischen beiden Kammern. Senatoren könnten Jahre auf dem Kapitol-Hügel zubringen, ohne je die andere Seite des Kapitols betreten zu haben – wenn es nicht die Reden des Präsidenten zur Lage der Nation (State of the Union) gäbe, zu der sich Senatoren und Abgeordnete im Plenum des größeren Abgeordnetenhauses versammeln. Es gäbe keinen anderen wirklich wichtigen Grund, um in Ungnade zu fallen, als als Senator hinüber zum Abgeordnetenhaus zu gehen. Andererseits würde es ein Abgeordneter aus Angst vor einer Demütigung nie wagen, die ehrwürdigen Hallen des Senats zu betreten (zitiert in: Ross Baker, House and Senate, New York / London 1995, S. 14 f.). Der Statusunterschied zwischen beiden ist enorm: Ein Senator vertritt einen ganzen Bundesstaat, sein Bekanntheitsgrad ist dementsprechend viel größer. Seine längere Amtszeit von sechs Jahren und Exklusivrechte in der Gesetzgebung (zum Beispiel die Blockademöglichkeit des filibuster (siehe S. 13), mithilfe derer er den ganzen Gesetzgebungsprozess aufhalten kann, verleihen ihm mehr Machtpotenzial. Dagegen repräsentiert ein Abgeordneter nur eine sehr viel kleinere Teileinheit eines Bundesstaates; er muss sich alle zwei Jahre zur Wahl stellen und ist über seinen Wahlkreis hinaus nur wenigen bekannt, es sei denn, er hat eine Führungsposition inne. Mehr noch als im Abgeordnetenhaus in der Hierarchie aufzusteigen, träumen die meisten Abgeordneten insgeheim davon, irgendwann auch einmal Senator zu werden. Hingegen gab es in der Parlamentsgeschichte der USA noch keinen Senator, der nach seinem Ausscheiden aus dem „Oberhaus“ (Senat) für das „Unterhaus“ (Repräsentanten-/Abgeordnetenhaus) kandidierte. Doch die Verfassung zwingt beide zur Zusammenarbeit. Damit eine Gesetzesvorlage (bill) dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt werden kann, muss sie in beiden Kammern in identischer Form verabschiedet werden. Der dafür notwendige intensive Austausch findet häufig über den Mitarbeiterstab (congressional staff) der Senatoren und Abgeordneten statt; in vielen Fällen auch erst später, in einem ad hoc für eine bestimmte Gesetzesvorlage einberufenen Gremium: Im Vermittlungsausschuss (conference committee) verhandeln dann die von den Parteiführungen beider Kammern bestimmten Vertreterinnen und Vertreter in kleinerer Runde, um einen Kompromiss zu finden. Der Kongress ist das zentrale Verfassungsorgan bei der Gesetzgebung – auch wenn die beiden anderen politischen Gewalten mitwirken: der Supreme Court durch die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und der Präsident durch sein Vetorecht. Der Präsident hat zwar selbst kein Initiativrecht und kann nur mittelbar über gleichgesinnte Abgeordnete und Senatoren Gesetzesvorlagen auf den Weg bringen. Er hat jedoch das „letzte“ Wort: Damit eine Vorlage (bill) zum Gesetz (law) wird, ist diese von ihm zu unterzeichnen. Er kann auch auf den laufenden Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen, indem er sein suspensives (aufschiebendes) Veto ausspricht oder damit Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Die permanenten Hauptausschüsse im Kongress, 113. Legislaturperiode 2013-2014 Ausschüsse und ihre Vorsitzenden (chairmen) spielen eine wichtige Rolle in der Gesetzgebung der USA. Ausschüsse (committees) und deren Unterausschüsse (subcommittees) entlasten die Plenararbeit: Die meisten Gesetzesinitiativen bleiben bereits in einem der zahlreichen committees oder subcommittees hängen. Nur wenige Vorlagen schaffen es – meist nachdem sie durch Änderungsanträge (amendments) maßgeblich verändert wurden – ins Plenum der jeweiligen Kammer, das heißt auf den House Floor oder den Senate Floor zur Abstimmung. Senate House of Representatives Agriculture, Nutrition, and Forestry (http://www.agriculture.senate.gov/) Appropriations (http://www.appropriations.senate.gov/) Armed Services (http://www.armed-services.senate.gov/) Banking, Housing, and Urban Affairs (http://www.banking.senate.gov/public/) Budget (http://www.budget.senate.gov/) Commerce, Science, and Transportation (http://commerce.senate.gov/public/) Energy and Natural Resources (http://www.energy.senate.gov/public/) Environment and Public Works (http://epw.senate.gov/public/) Finance (http://www.finance.senate.gov/) Foreign Relations (http://www.foreign.senate.gov/) Health, Education, Labor, and Pensions (http://www.help.senate.gov/) Homeland Security and Governmental Affairs (http://www.hsgac.senate.gov/) Judiciary (http://www.judiciary.senate.gov/) Rules and Administration (http://www.rules.senate.gov/public/) Small Business and Entrepreneurship (http://www.sbc.senate.gov/public/) Veterans’ Affairs (http://www.veterans.senate.gov/) Agriculture (http://agriculture.house.gov/) Appropriations (http://appropriations.house.gov/) Armed Services (http://armedservices.house.gov/) Budget (http://budget.house.gov/) Education and the Workforce (http://edworkforce.house.gov/) Energy and Commerce (http://energycommerce.house.gov/) Ethics (http://ethics.house.gov/) Financial Services (http://financialservices.house.gov/) Foreign Affairs (http://foreignaffairs.house.gov/) Homeland Security (http://homeland.house.gov/) House Administration (http://cha.house.gov/) Judiciary (http://judiciary.house.gov/) Natural Resources (http://naturalresources.house.gov/) Oversight and Government Reform (http://oversight.house.gov/) Rules (http://www.rules.house.gov/) Science, Space, and Technology (http://science.house.gov/) Small Business (http://smallbusiness.house.gov/) Transportation and Infrastructure (http://transportation.house.gov/) Veterans’ Affairs (http://veterans.house.gov/) Ways and Means (http://waysandmeans.house.gov/) picture-alliance /abaca / Olivier Douliery United States Congress, Website: http://beta.congress.gov/ committees Parlamentsausschüsse sind ein gefürchtetes Kontrollinstrument. Im September 2013 versuchen Außenminister John Kerry (Mi.), Verteidigungsminister Chuck Hagel (re.) und General Martin Dempsey den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen vergeblich für einen US-Militäreinsatz im Bürgerkriegsland Syrien zu gewinnen. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 11 12 Politisches System der USA * OMB = Office of Management and Budget ** Gesetzesentwürfe werden entweder in beiden Kammern gleichzeitig eingebracht oder nach Verabschiedung im Plenum der einen Kammer in die andere verwiesen. Christoph M. Haas, Winfried Steffani und Wolfgang Welz, Der Gesetzgebungsprozess, in: Wolfgang Jäger, Christoph M. Haas und Wolfgang Welz (Hg.), Regierungssystem der USA, 3. Aufl., München/Wien: Oldenbourg-Verlag 2007, S. 185-204, hier S. 188 Kongressmitarbeiter und externe Expertise Die Arbeit der Abgeordneten und Senatoren wäre ohne das Zutun ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (congressional staff) nicht denkbar. Für einen Abgeordneten arbeiten im Schnitt 15 bis 20 Mitarbeiter; manche Senatoren haben gar einen Stab von über 100 Fachkräften. Insbesondere die staffer im Senat verfügen über enorme informelle Machtbefugnisse. Sie wurden von dem Politikwissenschaftler Michael J. Malbin 1980 deshalb auch schon als „Volksvertreter ohne Mandat“ (unelected representatives) bezeichnet. Abgeordnete und Senatoren beschäftigen Personal in ihrem Wahlkreis und in Washington. Doch selbst in ihren Parlamentsbüros sind neben der legislativen Arbeit viele Helferinnen und Helfer in der Wahlkreisarbeit (case work) tätig. Case Worker: Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihrem Senator oder Abgeordneten, dass er sich auch um ihre persönlichen Anliegen kümmert. Die für die case work eingeteilten Mitarbeiter helfen etwa bei Problemen mit Rentenbescheiden, Krankenversicherungen, Studienplätzen oder Steuerangelegenheiten. © Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild 854 525 Legislative Staff: Die legislativen Mitarbeiter bereiten ihren Abgeordneten oder Senator inhaltlich auf Ausschussoder Plenumssitzungen vor, schreiben Reden und Pressemitteilungen, verfassen Vorlagen und Änderungsanträge im Gesetzgebungsprozess, bereiten Statements und Fragen für öffentliche Anhörungen vor. Um die Interessenlage vor wichtigen Abstimmungen einschätzen zu können, treffen sie sich mit Regierungsvertretern, Unternehmern, Lobbyisten und Repräsentanten zivilgesellschaftlicher Organisationen. Professional Staff: Die Vorsitzenden der Ausschüsse und Unterausschüsse, die von der Regierungspartei bestimmt werden, sowie deren Stellvertreter (ranking members) von der Minderheitspartei verfügen darüber hinaus über erfahrene, meist ältere Fachleute, die sogenannten professional staffer, die die inhaltliche Arbeit in den Ausschüssen koordinieren sowie externe Sachverständige, Interessengruppen und Regierungsvertreter zu den öffentlichen Anhörungen (hearings) einladen. Wissenschaftliche Dienste: Um sich gegen die umfangreiche Expertise des Weißen Hauses und der Regierungsbü- rokratie zu rüsten, können Senatoren, Abgeordnete und deren Mitarbeiterstab auf sehr professionelle wissenschaftliche Hilfsdienste wie den Congressional Research Service (CRS), das Government Accountability Office (GAO), eine Art Rechnungshof des Kongresses, oder in Haushaltsfragen auf das Congressional Budget Office (CBO) zugreifen. Externe Ideen- und Personalagenturen: Schließlich leisten auch Expertinnen und Experten politikorientierter Forschungsinstitute, sogenannter Think Tanks, und Professoren an Universitäten Politikberatung. Insbesondere die vom amerikanischen Politikwissenschaftler Kent Weaver so genannten advokatischen Think Tanks (advocacy tanks), die Partei für bestimmte Partikularinteressen oder ein politisches Lager ergreifen, kultivieren seit den 1980er-Jahren intensive Personalkontakte mit Kongressmitgliedern, pflegen gar eine Personaldatenbank und leisten tatkräftige Unterstützung bei der Rekrutierung. Viele Think Tanker haben praktische Erfahrung im Kongress gesammelt; umgekehrt arbeiten auf dem Capitol Hill zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zuvor in einem Think Tank beschäftigt waren. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances droht. Denn sein Einspruch kann nur von jeweils einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses überstimmt werden – was sehr selten möglich ist. Hingegen hat auch die Legislative Möglichkeiten, die ausführende Gewalt zu kontrollieren, sprich oversight auszuüben: Bei schweren Verfehlungen, sogenannten high crimes and misdemeanors, kann der Senat (nach Aufnahme eines Verfahrens durch das Abgeordnetenhaus) sogar den Präsidenten seines Amtes entheben (impeachment). Völkerrechtlich bindende Vertragsunterzeichnungen des Präsidenten gelten erst, wenn sie vom Senat ratifiziert worden sind. Der Senat muss ferner präsidentiellen Personalernennungen für höhere Ämter wie Richter, Botschafter, Minister und weitere Spitzenbeamte zustimmen. Zwar kann der Präsident den Rat und die Zustimmung (advice and consent) des Senats umgehen, indem er Kandidaten außerhalb der Sitzungsperiode, das heißt über ein recess appointment, ernennt. Doch deren Amtszeiten enden dann mit der jeweiligen Legislaturperiode, und sie bekommen bei ihrer Amtsausübung den Unmut der Senatoren zu spüren. Denn das wirksamste politische Kontrollmittel ist die Macht der Geldbörse (power of the purse), das heißt, der Kongress muss bzw. darf die Haushaltsmittel insbesondere auch jene für Exekutivorgane bewilligen. Die unterschiedlichen Wahlzyklen des Präsidenten und des Kongresses ermöglichen eine weitere Facette der Machtkontrolle, nämlich eine „geteilte Regierung“. Mit den Wahlen 2012 wurde einmal mehr eine Regierungskonstellation des divided government etabliert, das heißt, dass die Partei, die den Amtsinhaber im Weißen Haus stellt, nicht über Mehrheiten im Kongress verfügt. Während der Präsident im Falle eines unified government im Sprecher des Abgeordnetenhauses (speaker of the house) einen Verbündeten hat, der ihm hilft, Mehrheiten für seine politischen Initiativen zu organisieren, ist dieser im Falle des divided government sein schärfster Widersacher. Zwar verfügt der Sprecher des Abgeordnetenhauses wegen der fehlenden Partei- und Fraktionsdisziplin nicht über die enormen Sanktionsmittel, die ein Fraktionschef in einem parlamentarischen Regierungssystem wie in Deutschland hat. Der US-Präsident kann sich mit entsprechenden Hilfen für die Wahlkreise oder Einzelstaaten der umworbenen Abgeordneten und Senatoren sogar Kongressmitglieder der anderen Partei „kaufen“. Doch hat auch der speaker Mittel zur Verfügung, um die Mehrheit seiner Parteifreunde auf Linie zu halten: Er kann die für Interessengruppen und deren Zuwendungen besonders attraktiven Vorsitzenden von Ausschüssen und Unterausschüssen 13 bestimmen, über einen Verfahrensausschuss, das rules committee, regeln, ob und in welchen Ausschüssen bzw. Unterausschüssen ein Gesetz behandelt wird, und festlegen, inwieweit Änderungsanträge (amendments) zulässig sind und welche Prozeduren zu erfolgen haben. Die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses gibt dem Sprecher also wirksame Machtinstrumente an die Hand. Erheblich schwieriger ist es, den Senat zu führen. In dieser Kammer kann ein einziger Senator mit Dauerreden, einem sogenannten filibuster, den Geschäftsbetrieb aufhalten – solange ihm nicht eine qualifizierte Dreifünftelmehrheit von 60 Senatoren den Mund verbietet. „To invoke cloture“ lautet das Manöver, um ein filibuster abzuwenden. Seitdem die Demokraten im November 2013 mit ihrer einfachen Mehrheit kurzerhand die Geschäftsordnung des Senats veränderten – sich für die von den Republikanern so genannte „nukleare Option“ entschieden –, können Blockademanöver bei Personalbenennungen nunmehr mit einer einfachen Mehrheit aufgehoben werden. Ausgenommen bleiben jedoch Nominierungen für das Oberste Gericht sowie das normale Gesetzgebungsverfahren. Hier sind weiterhin 60 Stimmen nötig, um eine Blockade aufzuheben. Filibuster light […] In einem historischen Schritt hat der demokratisch beherrschte Senat im US-Kongress ein seit 1806 praktiziertes Instrument teilweise aus dem Verkehr gezogen, mit dem die zahlenmäßig kleinere Fraktion Entscheidungen der tonangebenden Partei nach eigenem Gusto blockieren kann – den sogenannten Filibuster, eine potenziell endlose Ermüdungsrede. […] Bisher konnte jedes Mitglied im Senat ohne zeitliche Begrenzung reden und Personalentscheidungen so auf Eis legen. Das amerikanische Parlamentssystem wollte so Minderheitenschutz gewährleisten. Um die Debatte abzukürzen und eine Abstimmung zu erzwingen, war bisher das Ja von 60 der insgesamt 100 Senatoren nötig. Weil die Demokraten nur über 55 Sitze verfügen, konnten die Republikaner im Prinzip jede Personalie blockieren. Sie machen davon seit Amtsantritt von Obama überproportional Gebrauch. Vor Kurzem sprach der konservative Senator Ted Cruz aus Texas, Wortführer der Fundamental-Opposition, 21 Stunden am Stück gegen Obamas umstrittene Gesundheitsreform. Dabei trug er unter anderem aus Kinderbüchern vor. Den Filibuster-Rekord hält mit 24 Stunden und 18 Minuten nach wie vor Strom Thurmond. Der als Demokrat gestartete Senator, der später die Seiten wechselte, wollte so 1957 das Ende der Rassentrennung verhindern. Unter Zuhilfenahme der sogenannten „nuklearen Option“ brachte der demokratische Mehrheitsführer in Washington, Harry Reid, das seit über 200 Jahren praktizierte Modell jetzt [November 2013] zu Fall. Die entscheidende Abstimmung verlief mit 52:48 Stimmen. […] AP Photo / Carolyn Kaster Dirk Hautkapp, „Ende der Ermüdungsrede mit Filibuster light?“, in: General-Anzeiger Bonn vom 23. November 2013 Der Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner (li.), ist als Vertreter der Republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus politischer Gegner des Demokratischen Präsidenten Obama. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Deshalb gilt es im Senat, Anreize zu geben, um möglichst alle 100 Senatorinnen und Senatoren zufriedenzustellen. Mit Druck würde man hingegen wenig bewirken. Nach der „Macht“ des Mehrheitsführers im Senat gefragt, erwiderte der ehemalige Demokratische Senator und majority leader George J. Mitchell: „Man hat die Macht, 99 Hintern zu küssen.“ (zitiert nach Ross Baker, House and Senate, New York / London 1995, S. 91). Noch weniger Macht kann der Präsident auf die Senatoren ausüben, von denen nicht wenige eine Kandidatur für das Präsidentenamt erwägen. Der amtierende Präsident Barack Obama war selbst Senator, bevor er erfolgreich für die Präsident- 14 Politisches System der USA schaft kandidierte. Der Kongress hat im politischen System der Vereinigten Staaten, anders als die Legislative in parlamentarischen Regierungssystemen, allgemein eine sehr starke, institutionell fundierte Machtstellung gegenüber der Exekutive – insbesondere auch durch seine Aufsicht (oversight) und Organisationsgewalt gegenüber der Administration, dem Verwaltungsapparat des Präsidenten. Zwischen Legislative und Exekutive: die Verwaltung Im Kontrast zur überschaubaren und hierarchisch organisierten deutschen Ministerialbürokratie erscheint die USBehördenstruktur als unübersichtlicher Wildwuchs von Organisationseinheiten. Während die deutsche Kanzlerin an der Spitze des Kabinetts steht, ihr damit auch die Ministerien und deren Bürokratie untergeordnet sind, hat der USPräsident viel größere Schwierigkeiten, seine Exekutive zu leiten. Enorme Anstrengungen, um die eigene Linie in einem Interessengeflecht rivalisierender Ministerien und Regierungsstellen durchzusetzen, gehören zum mühsamen Tagesgeschäft des sogenannten Chefs der Bundesverwaltung. Die einzelnen Behörden wurden oftmals ad hoc, aus politischen Anlässen oder wegen Krisen gegründet und nicht etwa in das bestehende Organigramm eingegliedert, sondern hinzugefügt. Die daraus entstandene fragmentierte Struktur ist gewollt, denn sie bietet Außenstehenden vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme. Die US-Verwaltung ist geprägt durch intensives Kompetenzgerangel zwischen Exekutive und Legislative, wenn es darum geht, wichtige Positionen zu besetzen, die Behörden finanziell auszustatten sowie deren Aufgaben vorzugeben bzw. zu kontrollieren. Zwar liegt die exekutive Gewalt beim Präsidenten. Laut Verfassung (Artikel III, Absatz 1) muss er dafür sorgen, dass die Gesetze „gewissenhaft“ vollzogen werden. Er kann dazu unter anderem auch die Führungsspitzen der Ministerien (departments) und Bundesbehörden (federal agencies) nominieren. Doch müssen diese von der Legislative, namentlich vom Senat, gebilligt werden. Dem Kongress obliegt auch die Organisationsgewalt, sprich die Befugnis, die Bundesbehörden zu errichten und zu finanzieren. Die power of the purse führt seit jeher zu (informellen) Absprachen zwischen den Geldgebern im Kongress und den Empfängern in der Verwaltung. Insbesondere die für die Finanzierung verantwortlich zeichnenden Abgeordneten und Senatoren zuständiger Kongressausschüsse bewachen mit Argusaugen ihre Pfründen, die auch ihre Wiederwahl sichern helfen. Denn ihr politisches Schicksal hängt letztlich davon ab, wie sehr sie die Partikularinteressen in ihren Wahlkreisen bzw. Einzelstaaten bedienen können, und insbesondere jene von ihnen nahestehenden Interessengruppen, die ihre immer teurer werdenden Wahlkämpfe finanzieren. Meistens sind denn auch Vorhaben misslungen, den Verwaltungsapparat wieder zu verkleinern. So scheiterte Anfang der 1970er-Jahre Präsident Richard Nixon (1969-1974) mit seinem Versuch, durch einen radikalen Umbau „anti-präsidiale Nischen“ in der Exekutive zu eliminieren. Mit seinem Dezentralisierungsprogramm des „New Federalism“ wollte eine Dekade später Präsident Ronald Reagan (1981-1989) das „big government“ in Washington verkleinern – ohne nachhaltigen Erfolg. Der amtierende Präsident Barack Obama ist ebenso bemüht, den Regierungsapparat schlanker und effizienter zu machen. Bereits im Januar 2012 hat der Präsident den Kongress um die Kompetenz ersucht, die handelspolitischen Aufgaben von sechs Regierungseinheiten, darunter das Handelsministerium und das Büro des Handelsbeauftragten, in einer neuen Behörde zusammenzufassen. Wer die symbiotischen Dreiecksbeziehungen, das „eiserne Dreieck“ (iron triangle) zwischen den betroffenen Einheiten der Exekutive, der Wirtschafts- und Handelslobby und den federführenden Ausschüssen im Kongress kennt, muss aber skeptisch sein, ob dem Präsidenten die ehrgeizige Neuorganisation der Handelsbehörden gelingen wird. Mittlerweile haben sich zu den Vertretern von Partikularinteressen, Kongressausschüssen und der Exekutive auch noch Experten von Think Tanks, Universitäten und Journalisten gesellt. Ihre etwas lockeren themenspezifischen Verbindungen wurden 1978 vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Hugh Heclo „issue networks“ genannt: Mittels dieser „Themennetzwerke“ versuchen sie mit vereinten Kräften bestimmte Interessen und politische Ideen durchzusetzen, weshalb sie vom US-Politikwissenschaftler Paul Sabatier 1993 als „Tendenzkoalitionen“ (advocacy coalitions) bezeichnet wurden. Jeder Präsident ist deshalb gut beraten, einen eigenen, nur ihm gegenüber loyalen Beraterstab um sich zu scharen, um in diesem Interessengeflecht seine politische Linie durchzusetzen – nicht zuletzt auch gegenüber der Verwaltung „seiner“ Exekutive. Denn die Auseinandersetzungen in den Reihen der Exekutive sind nicht minder heftig. Auf der einen Seite versuchen die „Männer und Frauen des Präsidenten“, das presidential government, die Politikinitiativen des Weißen Hauses voranzutreiben. Auf der anderen Seite bremst Simon Koschut Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 AP Photo / Carolyn Kaster Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances AP Photo / The White House, Pete Souza Konsultationen gehören zum Regierungsalltag. Präsident Obama in einer Kabinettssitzung (September 2013), ... 15 sie das permanent government immer wieder aus. Die relativ autonomen Ministerien und Behörden versuchen unabhängig vom jeweiligen Präsidenten und von der jeweiligen parteipolitischen Konstellation ihre eigenen institutionellen Besitzstände zu wahren. Dabei berücksichtigen sie die Absichten der ihnen nahestehenden Kongressausschüsse und die Anliegen der von ihnen repräsentierten Interessengruppen. Hinzu kommen noch jene unabhängigen Behörden (independent agencies), deren Leiter bzw. Leiterinnen der Präsident zwar nominieren kann, wofür er aber wiederum die Zustimmung des Senats benötigt. Die independent regulatory agencies, die häufig auch als independent regulatory commissions bezeichnet werden, sind überdies ausschließlich dem Kongress verantwortlich. Die meisten von ihnen werden massiv von Interessengruppen beeinflusst. Die von Regulierungen Betroffenen regulieren sich mehr oder weniger selbst. Regulation by the regulated lautet das Prinzip, das dem Präsidenten kaum Einwirkungsmöglichkeiten lässt. Die persönlichen Mitarbeiter des Präsidenten – die er ohne Zustimmung des Senats frei auswählen kann – sind seine engsten Vertrauten in den Machtkämpfen, die mit dem Begriff bureaucratic politics verharmlosend umschrieben werden. Die Getreuen und einflussreichsten Berater des Präsidenten sind im White House Office zu finden. Sie genießen auch ein „exekutives Privileg“ (executive privilege), das heißt, sie sind der Legislative nicht Rechenschaft schuldig und dürfen vor Kongressausschüssen nicht verhört werden. Die anderen, dem Präsidenten ebenso nahestehenden Leiterinnen und Leiter der Einheiten (federal agencies) des Executive Office of the President müssen jedoch vom Senat abgesegnet werden und auch nach ihrer Bestätigung der Legislative laufend Rede und Antwort stehen. The President’s Team: 11 federal agencies des Executive Office of the President (Stand: Juli 2013): White House Office (Persönlicher Stab des Präsidenten) ... in einer Besprechung mit seinen Beratern (Oktober 2009) ... Office of the Vice President (Beraterstab des Vizepräsidenten) Executive Residence (Wohnung/Personal des Präsidenten und seiner Familie) Council of Economic Advisers (Wirtschaftspolitik) Council on Environmental Quality (Umweltschutzmaßnahmen) National Security Council (Außen- und Sicherheitspolitik) Office of Administration (Verwaltungsfragen) Office of Management and Budget (Haushaltsaufstellung und Kontrolle) Office of National Drug Control Policy (Drogenkontrollpolitik) AP Photo / Pablo Martinez / Monsivais Office of Science and Technology Policy (Wissenschafts- und Technologiepolitik) Office of the United States Trade Representative (Handelspolitik) www.whitehouse.gov/administration/eop … und in einer Haushaltsdiskussion mit führenden Mitgliedern der Demokratischen Partei (Oktober 2013) Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Ebenso wie bei diesen Personalentscheidungen muss der Präsident auch bei der Besetzung der Ministerämter die Machtkalküle der „anderen politischen Gewalt“, sprich die Interessen des Kongresses, berücksichtigen. 16 Politisches System der USA 15 Ministerien (executive departments; Stand: Juli 2013) Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland spielt im politischen System der USA das Kabinett keine wichtige Rolle. Die Minister heißen in den USA bezeichnenderweise „Sekretäre“ (Secretaries) des Präsidenten, etwa der Außenminister Secretary of State. So gilt auch bei diesem prominenten Amt als grundlegendes Prinzip: Der Präsident ist der „Koch“, der Außenminister der „Kellner“. Die engsten persönlichen Berater des Präsidenten sind einflussreicher als seine Minister, die er oftmals auch aus wahltaktischen und politischen Erwägungen ernennen muss. In der Regel vertreten Minister auch die Interessen ihrer Häuser (departments), die wiederum von einflussreichen Senatoren oder Abgeordneten finanziell abhängig sind. Department of Agriculture (Landwirtschaftsministerium): www.usda.gov Department of Commerce (Handelsministerium): www.commerce.gov Department of Defense (Verteidigungsministerium): www.defense.gov Department of Education (Bildungsministerium): www.ed.gov Department of Energy (Energieministerium): www.energy.gov Department of Health and Human Services (Gesundheitsministerium): www.hhs.gov Department of Homeland Security (Heimatschutzministerium): www.dhs.gov Department of Housing and Urban Development (Bauministerium): www.hud.gov Department of Justice (Justizministerium): www.usdoj.gov Department of Labor (Arbeitsministerium): www.dol.gov Department of State (Außenministerium): www.state.gov Department of the Interior (Innenministerium): www.doi.gov Department of the Treasury (Finanzministerium): www.treasury.gov Department of Transportation (Verkehrsministerium): www.dot.gov Department of Veterans Affairs (Kriegsveteranenministerium): www.va.gov www.whitehouse.gov/administration/cabinet/ Die große Fülle politischer Berufungen in die Ministerien und Behörden geht nicht nur auf Kosten des öffentlichen Dienstes (civil service); sie ist zeitraubend und erschwert nach Wahlen den Übergang von einer Regierungsmannschaft zur nächsten. Mit jedem neuen Präsidenten wechseln in den USA etwa 7000 Fachleute ihre Position: entweder von außen nach innen oder, im Falle der ausscheidenden Administration, von innen nach außen. In diesem Drehtürsystem der revolving doors, des ständigen inand-out, spielen neben Interessengruppen auch Think Tanks, das heißt politikorientierte Forschungsinstitute, eine wichtige Rolle als „Ideenagenturen“, so der Politologe Winand Gellner 1995. Dementsprechend politisch ist das Selbstverständnis im Verwaltungsapparat. Während die meisten auf Lebenszeit dienenden deutschen Beamten sich für ihr Fortkommen nicht politisch engagieren müssen und sich auf ihre Aufgabenbereiche und nächste „Verwendung“ konzentrieren können, arbeitet die USamerikanische Bürokratie im Zentrum der Auseinandersetzung um den politischen Machterhalt. Das Gros der oft nur für eine Amtszeit beschäftigten Verwaltungseliten beteiligt sich mehr oder weniger sichtbar an der politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Diese policy maker sind indes keine inkompetenten Parteigänger, sondern ausgewiesene Experten mit politischer Orientierung. Ihre Fachkenntnisse haben sie zumeist über mehrere Jahre in verschiedenen Arbeitsbereichen erworben, sei es in der Exekutive, der Legislative, einem Think Tank, einer Universität oder einem Privatunternehmen. Sie wechseln häufig ihre Arbeitgeber, bleiben aber ihrem Themenschwerpunkt (issue) treu. Damit sind sie auch in ihrem issue network gut vernetzt, was wiederum ihren nächsten Arbeitsplatz sichern hilft. Diese „Wanderarbeiter“ haben mittlerweile die auf Lebenszeit Beschäftigten des civil service verdrängt. Zwar genießen auch einige US-amerikanische Staatsbedienstete noch Privilegien wie eine mehr oder weniger sichere Anstellung. Schlechte Bezahlung und mangelnde Aufstiegschancen haben aber zur Demoralisierung und permanenten Krise des civil service geführt. Nicht zuletzt spiegelt das geringe Ansehen des Staatsdienstes auch die historisch begründete, institutionell begünstigte und politisch verstärkte Skepsis großer Teile der US-Bevölkerung gegenüber dem Staat wider. Obschon der Begriff „government“ über Jahrzehnte in den Köpfen der meisten US-Amerikaner negative Vorstellungen hervorgerufen hatte, wurde die Regierung von ihren Bürgern zwischenzeitlich merklich positiver wahrgenommen. Eine seit den 1960er-Jahren nicht mehr registrierte Vertrauensmarke von knapp 60 Prozent brach mit dem bis dahin vorherrschenden Muster einer „Vertrauenslücke“ (confidence gap), so das Ergebnis einer Gallup-Umfrage, die von den AEI Studies in Public Opinion 2003 zitiert wurde. Ein genauer Blick der Politikwissenschaftler Calvin Mackenzie und Judith Labiner von der renommierten Brookings Institution zeigte jedoch, dass dieses überschwängliche Vertrauen in die eigene Regierung in erster Linie als unmittelbare emotionale Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 zu interpretieren ist: Ausgehend von 29 Prozent im Juli 2001 schlug das Vertrauensbarometer kurz nach den Terrorangriffen auf eine Höhe von 57 Prozent aus und pendelte sich im Mai 2002 wieder auf 40 Prozent ein. Gemessen an den Umfrageergebnissen vor den Terrorangriffen wurde der Regierung in Washington jedoch immer noch ein deutlich höheres Vertrauen entgegengebracht. Das Gefühl von Verwundbarkeit und nationaler Bedrohung bewirkte ein gesteigertes Bedürfnis nach Schutz, dessen Gewährleistung die meisten US-Amerikaner ihrer Regierung, vor allem ihrem Präsidenten als Oberstem Befehlshaber zutrauten. Neben ihm konnte nur seine unmittelbare Umgebung von Amtsträgern der Exekutive auch nach einem zeitlichen Abstand zu den Anschlägen diesen immensen Vertrauensbonus noch auf sich konzentrieren, während die übrigen Volksvertreterinnen und -vertreter sowie Staatsangestellten in der Gunst der Bevölkerung nach einem kurzen Ausschlag wieder auf ihr vormaliges Niveau absanken. Macht und Ohnmacht der Exekutive Geprägt durch die historische Erfahrung mit den Monarchien der „Alten Welt“ wollten die Verfassungsväter die Machtbefugnisse des Präsidenten beschneiden. Doch die Bedrohung durch das Königreich Großbritannien und die Persönlichkeit des ersten amerikanischen Präsidenten George Washington (1789-1797) sorgten dafür, dass das Amt mit mehr Handlungsspielraum, also zusätzlichen Machtbefugnissen gegenüber dem Kongress und gegenüber den Einzelstaaten, ausgestattet wurde. Washington, Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances © Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild 854 545 Gerald Ford 1974-1977 picture-alliance / Everett Collection picture-alliance / dpa Bill Clinton 1993-2001 George W. Bush 2001-2009 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 picture-alliance / Everett Collection John F. Kennedy 1961-1963 Barack Obama seit 2009 Lyndon B. Johnson 1963-1969 picture-alliance / akg-images picture-alliance / Everett Collection Jimmy Carter 1977-1981 picture-alliance / dpa / epa Michael Reynolds picture-alliance /dpa Richard Nixon 1969-1974 Dwight D. Eisenhower 1953-1961 picture-alliance / Everett Collection Harry S. Truman 1945-1953 picture-alliance / dpa / Mathieson Franklin D. Roosevelt 1933-1945 picture-alliance / dpa / epa Cecil Stoughton picture-alliance / Everett Collection picture-alliance / dpa picture-alliance / Everett Collection US-Präsidenten der vergangenen 80 Jahre Ronald Reagan 1981-1989 George Bush 1989-1993 17 18 Politisches System der USA ehemaliger Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee der 13 nordamerikanischen Kolonien im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) gegen die britische Kolonialmacht, beanspruchte als Präsident und Hüter der neu gewonnenen „independence“ vom Mutterland ebenso im Inneren größere Gestaltungsmacht. Auch im Laufe der weiteren Geschichte wurden als Reaktion auf nationale Krisen, etwa auf die Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, den Zweiten Weltkrieg und die Anschläge vom 11. September 2001, die Bundeskompetenzen, vor allem jene des Präsidenten, erheblich erweitert. Als Staatsoberhaupt, Regierungschef, Chef der Bundesverwaltung, höchster Diplomat, militärischer Oberbefehlshaber und Parteiführer kann der Präsident heute umfangreiche, in der Verfassung garantierte Aufgaben und Funktionen beanspruchen. Dennoch ist im politischen System der checks and balances seine Macht beschränkt. Je nach Politikbereich verfügt der Präsident über unterschiedliche Machtbefugnisse: Während in der Sicherheitspolitik selbst das Oberste Gericht die mangelnde Gewaltenkontrolle seitens der Legislative beklagt, sind dem Präsidenten in allen anderen Politikfeldern, etwa in der Wirtschafts-, Handels-, Umwelt- und Energiepolitik, durch den Kongress oftmals die Hände gebunden. Der US-Präsident, der selbst keine Gesetzesvorlagen einbringen kann und bei Initiativen gleichgesinnte Abgeordnete und Senatoren benötigt, ist im Gesetzgebungsprozess laufend gefordert (und gelegentlich überfordert), im Kongress für die Zustimmung zu seiner Politik zu werben, das heißt je nach Politikinitiative unterschiedliche und zumeist parteiübergreifende Adhoc-Koalitionen zu schmieden. Das ist für den seit Januar 2009 amtierenden Präsidenten sehr mühsam geworden. Präsident Obama konnte nur in den ersten zwei Jahren seiner ersten Amtszeit auf die Mehrheit seiner Parteifreunde im Kongress (sprich im Abgeordnetenhaus und Senat) zählen und diese Zeit für umfangreiche Maßnahmen wie die Gesundheitsreform oder die Reform der Finanzmärkte nutzen. Seit Februar 2010, als die Demokraten mit der Nachwahl des durch den Tod von Edward Kennedy freigewordenen Sitzes ihre Dreifünftelmehrheit (60 Stimmen) im Senat verloren, und insbesondere seit die Republikaner bei den Zwischenwahlen vom November 2010 die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zurückerlangten, ist es für ihn noch viel schwieriger geworden, Kompromisse mit der Legislative zu finden. Daran änderte auch seine Wiederwahl 2012 nichts. Mit der Bestätigung der Mehrheit der Republikaner im Abgeordnetenhaus kann bis zu den nächsten Zwischenwahlen im November 2014 mindestens eine Kammer der Legislative, entweder der Senat oder insbesondere das von den Republikanern kontrollierte Abgeordnetenhaus, die Initiativen des Demokratischen Amtsinhabers im Oval Office blockieren. Das ist umso problematischer, als der Amtsinhaber ja gewählt und wiedergewählt wurde, um den enormen wirtschaftlichen und sozialen Problemen des Landes abzuhelfen. Für Kompromisse bleibt ohnehin wenig Zeit, weil schon 2014 wieder Kongresswahlen anstehen und der Präsident spätestens dann als „lahme Ente“ (lame duck) gilt. Denn er kann nach seiner zweiten Amtszeit nicht mehr wiedergewählt werden und verfügt deshalb in der legislativen Auseinandersetzung über weniger „politisches Kapital“ (political capital): Beim politischen Kuhhandel – im Englischen als „Pferdehandel“ (horse trading) bezeichnet – sichert sich der Präsident die Unterstützung des einen oder anderen Gesetzgebers, indem er im Gegenzug versichert, künftig die eine oder andere wählerwirksame finanzielle Unterstützung in den Wahlkreis bzw. Einzelstaat des umworbenen Ab- geordneten oder Senatoren fließen zu lassen. Diese Versprechungen verlieren jedoch gegen Ende der Präsidentschaft an Zugkraft. Der Präsident muss nunmehr politische Führung (leadership) demonstrieren. Wenn er nicht mehr mit Angeboten locken kann, dann muss er umso mehr öffentlichen Druck ausüben. Präsident Theodore Roosevelt (1901-1909) prägte den Begriff der „bully pulpit“, das Bild der „hervorragenden“ (bully) Redeplattform einer Kanzel (pulpit), welche die Präsidentschaft seiner Ansicht nach bot, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Seine exponierte Stellung als einziger landesweit gewählter Politiker kann der Präsident dazu nutzen, um über die Massenmedien auch die Wählerbasis der Kongressmitglieder für seine Agenda zu mobilisieren, damit die (qualifizierte) Mehrheit der Abgeordneten und Senatoren seiner Politik folgen. Das ist dennoch nicht einfach, da diese eine institutionelle Identität als Mitglieder des Kongresses haben, sich der „anderen Staatsgewalt“ (the other branch of government) zugehörig fühlen und mit der Exekutive um Macht konkurrieren. Die Sorge der Legislative um die institutionelle Machtbalance tritt jedoch in den Hintergrund, wenn Gefahr in Verzug ist. In Krisen- und Kriegszeiten steht der Präsident als Oberster Befehlshaber im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihm kommt die Rolle des Schutzpatrons zu. Der patriotische Sammlungseffekt des rally around the flag bedeutet einen immensen Machtgewinn und Vertrauensvorsprung für den Präsidenten und die Exekutive. Nicht zuletzt symbolisiert das Präsidentenamt die nationale Einheit, gilt das Weiße Haus als Ort der Orientierung, an dem in Krisenzeiten die Standarte hochgehalten wird. Präsidenten konnten immer wieder nationale Krisen dazu nutzen, die Struktur des Regierungsapparats und der Verwaltung grundlegend zu verändern, indem sie exekutive Kompetenzbereiche auf nationaler Ebene gebündelt und oftmals auch erweitert haben. So mündete die „Große Depression“ der 1930er-Jahre in den Sozialstaat, der von Präsident Franklin D. Roosevelt (1933-1945) geprägt wurde. Im Zuge der militärischen und sicherheitsdienstlichen Aufrüstung im Zweiten Weltkrieg erhielt die Bundesregierung umfangreiche Sicherheitsaufgaben. Im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion etablierte sich eine Interessenverbindung zwischen Militär, Rüstungsindustrie und politischen Eliten. In seiner Abschiedsrede warnte Präsident Dwight D. Eisenhower (19531961), der einst selbst Generalstabschef der Armee war, im Januar 1961 vor diesem „militärisch-industriellen Komplex“. Der Kalte Krieg und seine Nebenkriegsschauplätze, etwa in Vietnam, gingen auch im Inneren einher mit einer „imperialen Präsidentschaft“, so der Buchtitel des US-Historikers und Beraters zweier US-Präsidenten, Arthur Schlesinger Jr., 1973: Das Regierungshandeln der Kriegspräsidenten Lyndon B. Johnson (19631969) und Richard Nixon (1969-1974) war wenig transparent und im Falle Nixons höchst kriminell. Ihm drohte ein Amtsenthebungsverfahren (impeachment) wegen „schwerster Verbrechen und Amtsvergehen“ (high crimes and misdemeanors). Denn seine Machenschaften hatten das System der checks and balances aus dem Gleichgewicht gebracht. Um in der Watergate-Affäre einer formalen Amtsenthebung zu entgehen, trat Nixon schließlich am 9. August 1974 zurück. Danach schlug das Pendel wieder in die andere Richtung: In Reaktion auf die Grenzüberschreitungen der Exekutive beanspruchte der Kongress wieder mehr Machtbefugnisse. Die Verunsicherung nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der von der Regierung George W. Bush so genannte Globale Krieg gegen den Terror eröffneten einmal mehr Möglichkeiten, die Gestaltungsmacht des Präsidenten und der unter seiner Führung handelnden Exekutive auszuweiten. Schon Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances unmittelbar nach Amtsantritt hatten Präsident George W. Bush, Vizepräsident Richard (Dick) Cheney und ihre Gefolgsleute keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass sie die Position der Exekutive auf Kosten der Machtbefugnisse der Legislative zu stärken beabsichtigten. Diese offensive Strategie des Weißen Hauses, den vor allem in der Amtszeit des Vorgängers Bill Clinton (1993-2001) erstarkten Kongress wieder in eine untergeordnete Rolle zu drängen, erhielt mit den Terroranschlägen von New York und Washington ihre Legitimation – und zwar durch die in der US-amerikanischen Bevölkerung gemeinhin gehegte Überzeugung, dass dies angesichts der nationalen Bedrohung rechtens, ja notwendig sei. Im Globalen Krieg gegen den Terror konnte der Präsident nunmehr die dominante Rolle des Oberbefehlshabers der Streitkräfte spielen. Aber auch in der nationalen Diskussion gelang es George W. Bush, seine Diskurshoheit zu etablieren und sich als Schutzpatron zu geben, der die traumatisierte Nation vor weiteren Angriffen bewahrt. Unter dem Primat der Sicherheit konnte Präsident Bush auch innerhalb der Exekutive Organisationsstrukturen aufbrechen und Kompetenzen neu verteilen. Zahlreichen Ministerien wurden Ressourcen und Aufgabenbereiche entzogen und dem 2002 neu geschaffenen Heimatschutzministerium, dem Department of Homeland Security (DHS), zugewiesen. Eine Vielzahl von Einheiten aus anderen Ministerien wurde in dieses neue Heimatschutzministerium integriert, zwei Dutzend Bundesbehörden mit etwa 180 000 Bediensteten und einem jährlichen Budget von 40 Milliarden Dollar darin zusammengefasst. In Fragen der inneren Sicherheit ist das Department of Homeland Security auf horizontaler Regierungsebene federführend bei der Zusammenarbeit mit anderen Ministerien. Es ist zudem bei der vertikalen Koordination die zen- © Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild 854 529 Die Watergate-Affäre Am frühen Morgen des 17. Juni 1972 verhaftete die Polizei fünf Männer, die offenkundig versucht hatten, in die Büros der nationalen Parteizentrale der Demokraten im Washingtoner Watergate Hotel einzubrechen. Was der Pressesprecher des republikanischen Präsidenten Nixon auf Anfrage als „drittklassigen Einbruch“ bezeichnete, führte zwei Jahre später – und erstmals in der amerikanischen Geschichte – zum Rücktritt eines amerikanischen Präsidenten. Dass die politischen Hintergründe des Watergate-Einbruchs ans Tageslicht kamen, ist in erster Linie zwei Journalisten der Washington Post, Bob Woodward und Carl Bernstein, zu verdanken. Sie enthüllten – mit Hilfe eines Informanten namens „Deep Throat“, der sich erst 2005 zu erkennen gab (es handelte sich um den Stellvertretenden Direktor des FBI, W. Mark Felt) – nach und nach, dass der Präsident selbst von dem Einbruch wusste und dessen Vertuschung befohlen hatte. Angesichts der Kritik seiner politischen Gegner hatte Nixon, der von Natur 19 aus ein unsicherer und misstrauischer Mensch war, einen geheimniskrämerischen Führungsstil entwickelt und einen autoritären Apparat aufgebaut, der die Macht des vermeintlich von der Presse und den Demokraten „belagerten“ Weißen Hauses konsequent ausbaute. Die Paranoia des Präsidenten reichte so weit, dass er eine geheime Spezialeinheit aufbaute, die sogenannten „Klempner“, die Feindlisten erstellten, subversive Gerüchte in die Welt setzten und politische Gegner – wie die Demokraten im Watergate Hotel – ausspionierten und abhörten. Als die illegalen Aktivitäten im Prozess gegen die Watergate-Einbrecher an die Öffentlichkeit drangen, profilierte sich der Präsident zunächst als Saubermann, während er einen seiner Vasallen nach dem anderen „opferte“. Die Situation spitzte sich zu, als Nixons ehrgeiziger Mitarbeiter John Dean, der anfangs loyal hinter dem Präsidenten gestanden hatte, öffentlich erklärte, Nixon habe die Vertuschung selbst initiiert. Anfangs dementierte der Präsident die Behauptung Deans. Zum wahren Unglückstag für den Präsidenten wurde dann freilich jener Freitag, der 13. Juli 1973, an dem Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 öffentlich bekannt wurde, dass es Tonbandaufzeichnungen aller Gespräche gab, die im Weißen Haus geführt wurden. Zwar konnte Nixon die von einem Sonderermittler geforderte Freigabe der Tonbänder über ein Jahr lang hinauszögern. Seine Glaubwürdigkeit hatte der Präsident jedoch bereits verloren, als er im sogenannten Samstagabend-Massaker vom Oktober 1973 den Justizminister und dessen Stellvertreter entließ, weil diese sich geweigert hatten, den für Nixon so unbequemen Sonderermittler seines Amtes zu entheben. Selbst als im Sommer 1974 mit der Herausgabe der Tonbänder der endgültige Beweis für seine Verwicklung in die WatergateAffäre vorlag, zog Nixon die politischen Konsequenzen nur zögerlich. Um einer formalen Amtsenthebung zu entgehen, trat der Präsident am 9. August 1974 schließlich zurück. Damit hatte das Watergate-Spektakel, das für viele Amerikaner zur Unterhaltungsserie mit Shakespeare’scher Dramatik geworden war, ein Ende gefunden. Christof Mauch, Die 101 wichtigsten Fragen – Amerikanische Geschichte, München: C.H.Beck Verlag 2008, S. 116 f. 20 Politisches System der USA trale Ansprechstelle für Behörden auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene. Seine Schaffung ist Teil des umfangreichsten Umbaus, dem die Regierungsorganisation der Vereinigten Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unterzogen worden ist. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 führten den USA auch vor Augen, dass ihre Geheimdienste versagt hatten. Dieser nationale Schock erleichterte es dem Kriegspräsidenten Bush, die Struktur der Nachrichtendienste zu verändern, um den Informationsfluss innerhalb der sogenannten intelligence community zu bündeln. Vor den Anschlägen waren die diversen Einheiten für ihre Geheimniskrämerei bekannt: Sie taten sich schwer damit, Informationen auszutauschen, auch weil sie miteinander um die knappen finanziellen Ressourcen konkurrierten. Doch auch die Geldknappheit veränderte sich mit einem Schlag: Nach den Terroranschlägen wurden die Mittelzuweisungen für die neu aufgestellten Teileinheiten massiv aufgestockt. Den über die Medien verbreiteten Informationen des ehemaligen technischen Mitarbeiters der US-amerikanischen Geheimdienste Edward Snowden ist es zu verdanken, dass auch die Öffentlichkeit einen Einblick in die neue Struktur, die Aufgabenund Finanzzuweisungen der einzelnen Einheiten bekam. Von den 52,6 Milliarden Dollar, die im Haushaltsjahr 2013 für die intelligence community veranschlagt wurden, erhalten die Central Intelligence Agency (CIA), die National Security Agency (NSA) und das National Reconnaissance Office (NRO) mit mehr als zwei Dritteln des Gesamtbudgets den Löwenanteil. Von den über 107 000 Mitarbeitern des insgesamt 16 Bundesbehörden (agencies) umfassenden Gesamtapparats sind etwa 20 Prozent in militärischen Funktionen tätig (etwa zwei Drittel davon bei der NSA), der Großteil ist jedoch mit „zivilen“ Aufgaben betraut. Der Patriot Act – Lizenz zum Kampf gegen das Böse Das Gesetzespaket „Patriot Act“ zur Bekämpfung des globalen Terrorismus, das kaum sechs Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vom Kongress mit großer, überparteilicher Mehrheit angenommen wurde, hat die Tore zum Aufbau eines Überwachungsstaates weit aufgestoßen. Bis heute ist der „Patriot Act“ die gesetzliche Grundlage für die umfangreichen Überwachungsmaßnahmen der 16 staatlichen Geheim- und Abwehrdienste sowie der vielen privaten Sicherheitsunternehmen, die im Auftrag der Dienste Informationen sammeln und auswerten. Der „Patriot Act“, verabschiedet am 25. Oktober 2001, ist gleichsam das zivile Pendant zur gemeinsamen Resolution beider Kammern des Kongresses vom 14. September 2001, mit welcher das Parlament den Präsidenten zur Anwendung von militärischer Gewalt ermächtigte: Beide Bestimmungen sind faktisch unbefristet und greifen äußerst weit. Am meisten Ausrüstung und Personal haben seit 2001 der Auslandsgeheim- Washington Post, Website: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/ black-budget/?wpisrc=nl_pmpol dienst „Central Intelligence Agency“ (CIA) und der militärische Geheimdienst „National Security Agency“ (NSA) erhalten. So verfügt die CIA – wie das Pentagon – über eine umfangreiche und stetig wachsende Flotte von Kampfdrohnen; auch die Zahl der Analytiker im Hauptquartier in Langley nahe Washington, der Auslandsstationen und der Agenten wurde deutlich erhöht. Aufgabe der NSA im Konzert der Dienste ist die Überwachung des globalen Telefon- und Datenverkehrs. Der Sitz der NSA, die dem Pentagon untersteht, befindet sich im Heeres-Stützpunkt Fort Meade in Maryland nahe Washington. Derzeit wird in Bluffdale in Utah für geschätzte zwei Milliarden Dollar das neue Datenzentrum der NSA errichtet; es soll bis September [2013] fertiggestellt und dann das größte Computerzentrum der Welt sein. Nach umfangreichen Recherchen der Tageszeitung „Washington Post“ sind mehr als 850 000 Personen für die staatlichen Dienste und für die vom Staat beauftragten Sicherheitsunternehmen tätig. Die Zahl der Angestellten der NSA wird auf 55 000 geschätzt. Die meisten von ihnen sind Programmierer, Techni- ker oder Computerfachleute, deren Gehälter mit den gängigen Vergütungen im Silicon Valley Schritt halten müssen. Maßgebliche technologische Neuerungen bei der Erfassung und Bearbeitung von riesigen Datenmengen werden bei der NSA sofort angewendet. […] Zu den größten Privatunternehmen [„Contractors“], die nicht nur in der Datenbearbeitung, sondern auch in der aktiven Informationsbeschaffung für die staatlichen Dienste und verschiedene Ministerien tätig sind, gehört Booz Allen Hamilton. Das Unternehmen mit Sitz in Virginia nahe Washington hat weltweit mehr als 25 000 Angestellte; Edward Snowden war in den letzten drei Monaten bis zu seiner Flucht nach Hongkong Ende Mai einer von ihnen. […] Den allergrößten Teil seines Jahresumsatzes von zuletzt 5,76 Milliarden Dollar erwirtschaftet das Unternehmen Booz Allen Hamilton, das zu den zehn größten in der Landesverteidigung und in der nationalen Sicherheit tätigen Privatfirmen gehört, durch Regierungsaufträge. […] rüb (Matthias Rüb), „Amerikas Geheimdienste und ihre Helfer: Eine Truppe von mehr als 850 000 Mann“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. Juni 2013 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Die Nachrichtendienste wurden von der Regierung George W. Bush nicht nur finanziell aufgerüstet, sondern auch ermutigt, ihre Arbeit mit mehr Nachdruck zu verrichten. Nach Medienberichten haben in der Amtszeit George W. Bushs Mitarbeiter der CIA im Globalen Krieg gegen den Terror unter anderem die Foltermethode des simulierten Ertränkens, das sogenannte waterboarding, praktiziert oder mutmaßliche Terroristen festgenommen bzw. entführt und in befreundete autoritäre Staaten geflogen, wo noch weit robustere Verhörmethoden angewendet werden. Damit verstießen die USA unter anderem gegen die Folterkonvention der Vereinten Nationen. Im Rahmen des Globalen Krieges gegen den Terror wurde Recht neu interpretiert – im nationalen wie internationalen Rahmen. Mit dem Angriffskrieg gegen den Irak und den auch von der nachfolgenden Obama-Regierung als Folter eingestuften Praktiken bei Verhören wurde Völkerrecht gebrochen. Um den inneren politischen Frieden zu wahren, scheute Präsident Obama jedoch davor zurück, die federführenden Mitarbeiter der Bush-Administration juristisch zur Verantwortung zu zie- Drohnen – die neuen Waffen Herr Mazzetti, […] Sie nennen die USKriegsführung einen Schattenkrieg, in dem mit unbemannten Drohnen gezielt Jagd auf Terrorverdächtige gemacht wird. Wie kam es dazu? In den USA hat sich nach den katastrophalen Anschlägen vom 11. September 2001 nach und nach ein neues militärisches Denken durchgesetzt. Die gezielte Tötung von Terrorverdächtigen wurde wieder als möglich erachtet. Bis kurz vor den Anschlägen war das unvorstellbar. [...] Im Jahr 2001 hieß der US-Präsident George W. Bush. Warum hat sein Nachfolger Barack Obama, der vielen als das komplette Gegenmodell zu Bush schien, den Drohnenkrieg fortgesetzt? […] Obama hat nie versprochen, den Drohnenkrieg zu beenden. Es ist nach seinem Amtsantritt sogar das Gegenteil geschehen: Der Präsident hat den Drohnenkrieg erheblich ausgeweitet. […] Hat es Sie überrascht, dass der Präsident [...] einmal sinngemäß gesagt hat: „Was immer die CIA haben will, das bekommt sie.“? [...] Das hat mich nicht überrascht. Der Satz zeigt nur, dass Obama diese Art der geheimen Kriegsführung als sehr effektiv wahrnimmt. [...] Er hat [...] nie gesagt, dass er als Präsident überhaupt keinen Krieg führen wird. Ist der Schattenkrieg ein sauberer Krieg? Nein. Krieg ist Krieg. Was den Einsatz von Drohnen in Obamas Augen offenbar hen. In Obamas bisheriger Amtszeit sind auch viele von der Vorgängerregierung eingeleitete Strategieänderungen weitergeführt, ja forciert worden. Die Obama-Regierung hat letztlich den Globalen Krieg gegen den Terror rhetorisch geschickter vermittelt und mit weniger militärischem Aufwand und geringeren politischen wie ökonomischen Kosten, dafür aber mit größerem geheimdienstlichem Einsatz weitergeführt. In diesem Zusammenhang wirkt es stimmig, dass der von Präsident Obama Anfang Januar 2009 als Direktor der CIA nominierte Leon Panetta von Juli 2011 bis Februar 2013 das Amt des Verteidigungsministers innehatte. Sein Nachfolger bei der CIA wurde General David Petraeus, den bereits Präsident Bush zum Befehlshaber des den amerikanischen Streitkräften im Irak und Afghanistan übergeordneten regionalen Kommandobereichs (US Central Command) berufen hatte. Als Chef der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF) war er für die von der NATO geführte Sicherheits- und Aufbaumission in Afghanistan verantwortlich. Bereits George W. Bush hatte im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan den Einsatz von Drohnen befohlen. Das so attraktiv macht, ist die Tatsache, dass es sich dabei nicht um einen teuren Besatzungskrieg wie in Afghanistan oder im Irak handelt. Kein einziger US-Soldat läuft Gefahr, sein Leben zu verlieren. Drohnen kann man – im Gegensatz zu Bodentruppen – tatsächlich begrenzt und sehr gezielt einsetzen. Das klingt so, als wären Drohnen die erste Waffe, die nicht außer Kontrolle geraten kann. Das ist falsch. Ein Krieg ist in letzter Konsequenz nicht kontrollierbar, ob man ihn nun konventionell führt oder per Fernsteuerung. Die USA führen seit mehr als zehn Jahren diesen Drohnenkrieg. Inzwischen sind die Grenzen zwischen den Geheimdiensten und dem Militär praktisch verschwunden. [...] Warum hat es so lange gedauert, bis darüber eine öffentliche Debatte begonnen hat? Niemand in der US-Politik hat prinzipiell etwas gegen diese Art der Kriegsführung. Über alle Parteigrenzen hinweg wird der Einsatz von Drohnen als richtig angesehen. Die Kongressabgeordneten haben sich erst in diesem Jahr [2013] etwas kritisch geäußert, weil sie mehr eingebunden sein wollten. [...] [W]arum wird über die Rechtmäßigkeit solcher Drohneneinsätze nicht mehr gestritten? Das ist ganz einfach: Die Rechtsanwälte von zwei aufeinander folgenden Regierungen, einer republikanischen und einer demokratischen, haben immer Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 21 wieder deutlich gemacht: Wir dürfen das machen. Das ist alles in den Kompetenzen enthalten, die der Kongress der Regierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegeben hat. [...] Niemand in den USA spricht von den zivilen Opfern des Drohnenkriegs. Seit die Drohnen-Operateure nicht einmal mehr die Identität ihrer Zielpersonen kennen müssen, muss doch auch logischerweise die Zahl der Opfer unter den Zivilisten gestiegen sein. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Drohnen die ultimativen Waffen in einem geheimen Krieg sind. Es herrscht ein Informationsvakuum. Alles wird geheim gehalten, und die Einsätze geschehen in unzugänglichen Gegenden der Welt, in denen nicht so ohne Weiteres Journalisten ihrer Arbeit nachgehen können. Ist der Drohnenkrieg der Krieg der Zukunft? Es gibt Leute, die sagen: So etwas wie Afghanistan oder Irak machen wir nie wieder. Mit Vorhersagen dieser Art wäre ich vorsichtig. Ich glaube eher, dass der Krieg per Fernsteuerung die Art der Kriegsführung verändern wird – so wie es Panzer getan haben oder Flugzeuge. Auf Bodentruppen wurde trotzdem nicht verzichtet. Mark Mazzetti, 39, arbeitet im Washingtoner Büro der „New York Times“. Der Journalist ist Träger des Pulitzer-Preises. „Neues militärisches Denken“. Interview von Damir Fras mit Mark Mazzetti, in: Frankfurter Rundschau vom 21./22. September 2013 22 Politisches System der USA sind unbemannte Luftfahrzeuge (unmanned aerial vehicles, UAV) zur Aufklärung und Überwachung. Mit Raketen bestückt können diese – dann als unmanned combat air vehicles (UCAV) bezeichneten – Luftfahrzeuge bei Bedarf auch in Kampfeinsätzen Verwendung finden. Nach der Amtsübernahme Obamas wurden diese Einsätze, die sowohl von der CIA als auch vom Pentagon gesteuert werden können – insbesondere auch über dem Staatsgebiet Pakistans –, forciert. Darüber hinaus wurden die Überwachungs- und Kampfeinsätze im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus auf andere Gebiete ausgeweitet, etwa auf den Jemen und Somalia. Es vergeht kein Monat, in dem nicht mindestens ein Anführer der Taliban oder Al-Qaidas auf diese Weise getötet wird. Doch Washington riskiert damit, die Bevölkerungen dieser Länder gegen sich aufzubringen, Terrorgruppen die Rekrutierung zu erleichtern und diplomatische Verstimmungen zu verursachen. Am Ende könnte es mit diesem Vorgehen gerade jene Alliierten verprellen, mit denen es die Last der globalen Verantwortung teilen möchte, so die eindringliche Warnung eines langjährigen Si- Der Preis der Kriege Viele Veteranen der jüngsten Feldzüge Amerikas leiden [...] unter PTBS, posttraumatischen Belastungsstörungen, die ihnen ihr Leben in der Heimat zur Hölle machen. Einschlägigen Studien zufolge haben bis zu 20 Prozent aller Kriegsheimkehrer PTBS-Symptome – was eine eher vorsichtige Schätzung sein dürfte. Man könnte auch einfach sagen: Alle diese meist jungen Menschen stehen unter dem Schock dessen, was sie erlebt oder gar selbst angerichtet haben. Niemand von ihnen wird diesen Krieg je wieder los. Fast eine Volkskrankheit dürfte es werden, angesichts der weit mehr als zwei Millionen Soldaten, welche die USA inzwischen in den Irak und nach Afghanistan geschickt haben: eine neue Generation der Gezeichneten in Amerika, die Generation 9/11. Die Zahl der Selbstmorde in ihren Reihen ist alarmierend hoch: Nicht weniger als achtzehn Kriegsheimkehrer nehmen sich Tag für Tag in den USA das Leben, so die offiziellen Statistiken. Das sind innerhalb eines Jahres mehr als alle bisherigen US-Kriegstoten in Afghanistan und Irak zusammen. Einer von fünf Selbstmördern in Amerika ist ein Veteran. Dabei ist die nach oben geschnellte Suizidrate tatsächlich nur einer von vielen bedrückenden Indikatoren, die dokumentieren, wie sehr die Kriege an den Vereinigten Staaten zehren – menschlich, sozial, finanziell. Sie zerreißen das Gewebe der Gesellschaft. Die Kosten sind exorbitant und drohen die Ressourcen selbst dieses so reichen Landes zu erschöpfen. [...] Seit mehr als cherheitsberaters des amerikanischen Außenministeriums: John B. Bellinger III stellte in einem Meinungsbeitrag in der Washington Post vom 3. Oktober 2011 die rhetorische Frage: „Will Drone Strikes Become Obama’s Guantánamo?“ Umso mehr wurde die Zusammenarbeit mit den Alliierten belastet, als durch die Enthüllungen Snowdens bekannt wurde, dass die amerikanischen Nachrichtendienste im großen Umfang auch Verbündete der Europäischen Union abhören. Der Globale Krieg gegen den Terror verursachte vor allem innenpolitische „Kollateralschäden“. Aus Sicht der Bush-Regierung hatte die Präventionsfunktion Vorrang vor der Rechtsfindungsund Rechtsstaatsfunktion. Diese Umgewichtung blieb nicht ohne Wirkung auf das Verhältnis zwischen persönlichen Freiheitsrechten und Sicherheit: Die Prävention künftiger Terroranschläge ging oft auf Kosten individueller Freiheit. Mehr noch: Die sogenannte Ashcroft-Doktrin der Prävention (benannt nach dem federführenden Justizminister John Ashcroft) drohte die grundlegende Sicherung persönlicher Freiheitsrechte durch das System sich gegenseitig kontrollierender Gewalten auszuhebeln. einem Jahrzehnt, seit dem 11. September 2001, befinden sich die USA in permanentem Kriegszustand. [...] Die Kriege sind nicht präsent, und doch bedrücken sie die Nation ungemein. […] Mehr als 6300 tote Soldaten hat Amerika in den vergangenen zehn Jahren zu beklagen, fast 4500 von ihnen im Irak. [...] Die Bürde ist ungleich verteilt. Gemessen an der Bevölkerungszahl, wird ein übergroßer Teil der Kondolenzbriefe aus dem Weißen Haus an Adressen in ländlichen Regionen Amerikas gegangen sein. Das hat das Online-Magazin The Daily Yonder ermittelt, das sich als Sprachrohr des ländlichen Amerikas jenseits der großen Ballungszentren im Osten und Westen der USA sieht. Die Redaktion hatte im Jahr 2007 die Toten der Kriege in Afghanistan und Irak gezählt und festgestellt, dass, bezogen auf die Zahl der Männer im wehrfähigen Alter, doppelt so viele Gefallene aus ländlichen Gemeinden oder Kleinstädten stammten wie aus den Metropolen. […] Das war 2007, aber das Verhältnis dürfte sich seither nicht wesentlich verschoben haben. […] Auch bei den Versehrten der Kriege ist dieses Ungleichgewicht zu beobachten. Mehr als 47 000 Soldaten wurden in dem Jahrzehnt seit 9/11 verwundet. Dank eines ausgeklügelten Rettungssystems können inzwischen viele Schwerstverletzte gerettet werden, die früher auf dem Schlachtfeld verblutet wären. Doch beinahe die Hälfte der Verwundeten wird für den Rest ihres Lebens medizinische Betreuung benötigen. [...] In jedem Fall ist die VA, die Veteranenverwaltung, heillos überfordert mit der Betreuung Zehntausender körperlich und Hunderttausender seelisch Versehrter. Gründe für dieses Versagen gibt es viele: Gleichgültigkeit, bürokratische Desorganisation oder schlicht die Tatsache, dass zu Beginn von Amerikas „Global War on Terror“ niemand ahnte, wie viele Schwerstverwundete von den Fronten der Welt nach Hause zurückkehren würden. [...] Diese menschlichen „Kosten“, so bitter sie auch sind, machen tatsächlich jedoch nur einen Teil der Bürde aus, die Amerika seit dem 11. September zu schultern hat. Auch finanziell sind die Kriege für das Land ein Desaster. Der Congressional Research Service, der unabhängige wissenschaftliche Dienst des US-Parlaments, bezifferte die direkten Ausgaben für das Militär im ersten Jahrzehnt nach 9/11 auf nicht weniger als 1,3 Billionen Dollar. 800 Milliarden davon wurden in den Irakkrieg gesteckt, gut 440 Milliarden in Operationen in Afghanistan, der Rest in den Ausbau von Stützpunkten rund um den Globus und in Hilfsprogramme in Afghanistan und Irak. Das war im Frühjahr 2011. [...] Die wahren Kosten des militärischen Engagements seit dem 11. September dürften indes noch weitaus höher liegen. Der linke Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz taxiert sie auf mittlerweile über drei Billionen Dollar. Und laut Forschern von der Brown University, einer der US-Elitehochschulen, werden die Kriegskosten sich am Ende auf 3,7 Billionen Dollar belaufen – Zinszahlungen noch nicht miteinbezogen. [...] Mit freundlicher Genehmigung des Berlin Verlages in der Piper Verlag GmbH. Reymer Klüver / Christian Wernicke, Amerikas letzte Chance, © 2012 Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, S. 159 ff. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Die Bush/Ashcroft-Doktrin … Justizminister John Ashcroft brachte das Rechtsverständnis der Bush-Regierung im Dezember 2001 vor dem Justizausschuss des Senats deutlich zum Ausdruck: „Herr Vorsitzender, Mitglieder des Ausschusses, wir befinden uns im Krieg gegen einen Feind, der individuelle Rechte ebenso missbraucht wie Passagierflugzeuge: als Waffen zum Töten von Amerikanern. Wir haben darauf reagiert, indem wir den Auftrag des Justizministeriums neu definiert haben. Unsere Nation und ihre Bürger gegen terroristische Angriffe zu verteidigen, ist nunmehr unsere erste und vorrangige Aufgabe.“ … und ihre Probleme An den einzelnen Bereichen, in denen die Problematik der Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte vor allem auch internationale Aufmerksamkeit erregte, lässt sich erkennen, dass die Verantwortlichen zwischen zwei Klassen von Rechtsträgern unterschieden: zwischen amerikanischen Bürgern und „Nicht-Amerikanern“. Ungeachtet der verfassungsrechtlichen „due process“– bzw. „equal protection“-Bestimmungen, in denen vom Schutz der individuellen Freiheitsrechte „jeder Person“ (any person) die Rede ist, genossen die sich in den USA aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländer nach Auffassung der Bush-Administration grundsätzlich nicht den gleichen Rechtsschutz wie die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Vereinigten Staaten. Wenn sie als mutmaßliche Terroristen eingestuft wurden, hatten sie zudem auch noch diesen „minderen Anspruch“ verwirkt. Sie wurden gar als Outlaws (Gesetzlose) behandelt, wenn sie sich nicht auf dem souveränen Staatsgebiet der Vereinigten Staaten befanden – wie die gefangenen Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer auf dem US-Marinestützpunkt in Guantánamo Bay, Kuba. Unter den jahrelang Inhaftierten befanden sich auch viele, die irrtümlich festgenommen wurden. Die Entscheidung, wer welche Rechte „verdiente“, wurde a priori von der Exekutive getroffen. Die Bush-Administration versuchte dabei auch, sich der Kontrolle juristischer und parlamentarischer Instanzen zu entziehen. Lauschen erlaubt […] Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 meint die Mehrheit der Amerikaner, dass bei Terrorgefahr die Privatsphäre zurückstehen müsse. 56 Prozent geben laut einer Langzeitstudie des renommierten Pew Research Center der Sicherheit den Vorrang und finden es „akzeptabel“, dass Telefon- und Internetdaten gespeichert werden. [...] Das heißt nicht, dass die Überwachung in den USA keine Regeln und Grenzen hätte. Bevor die National Security Agency (NSA) massenhaft Daten sammeln darf und die Geheimdienste abhören dürfen, müssen sie nicht nur den Justizminister um Erlaubnis bitten, sondern auch ein Geheimgericht, den Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA-Gericht). Jedenfalls, wenn im Laufe der Überwachung Amerikaner betroffen sein könnten. Die bloße Kontrolle der Nachrichtendienste durch einen parlamentarischen Ausschuss, wie in Deutschland, reicht nicht. Das letzte Wort hat die dritte Gewalt – auch wenn das FISA-Gericht ein seltsames Tribunal ist, weil es nicht öffentlich operiert und die möglichen Opfer nicht anhört. Befürworter dieses Vorgehens sehen die außerordentlichen Machtbefugnisse der Exekutive durch die alles überragende Schutzrolle des Obersten Befehlshabers legitimiert. Aus dieser Sicht erscheint es vertretbar, dass in Kriegszeiten das zivile Recht, das stärker den Anspruch auf individuelle Freiheitsrechte betont, zum Kriegsrecht mutiert, in dem der kollektive Sicherheitsaspekt alle anderen überragt. In den verschiedenen Problembereichen lässt sich entsprechend ein gemeinsamer Nenner ausmachen: Es geht weniger um die strafrechtliche Verantwortung einzelner Täter und deren Verfolgung wegen begangener Taten, sondern vielmehr um die allgemeine Verhinderung künftiger Attentate. Denn wie Justizminister Ashcroft in seiner Ansprache bei der U.S. Attorneys Conference in New York am 1. Oktober 2002 erklärte, war die „Kultur der Hemmung“ (culture of inhibition) vor dem 11. September „so stark auf die Strafverfolgung begangener Straftaten fokussiert, dass sie die Prävention künftiger Terroranschläge einschränkte.“ (Auszüge in Siobhan Gorman, There Are No Second Chances, in: National Journal vom 21.12.2002) Nicht wenige Beobachter sahen in dieser Praxis aus verfassungsrechtlicher Warte hingegen ein gefährliches Wagnis, bei dem die im politischen System der USA fest verankerten Prinzipien der checks and balances ausgehebelt zu werden drohten. Kenntnisse der amerikanischen Geschichte begründen diese Befürchtungen: In einer eingehenden Analyse mit dem Titel „All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime“ warnte William Rehnquist, bis zu seinem Tode Anfang September 2005 Chief Justice (Oberster Richter) des Supreme Court, bereits 1998 vor der Gefahr, dass der Oberste Befehlshaber in Kriegszeiten durch zusätzliche Machtbefugnisse dazu verleitet wird, den konstitutionellen Rahmen zu überdehnen. Im Keller eines klotzigen Justizgebäudes, auf halber Wegstrecke zwischen Weißem Haus und Kapitol, entscheiden elf Bundesrichter in einem fensterlosen, abhörsicheren Raum über die Anträge der Nachrichtendienste. Kein Wort dringt aus den Sitzungen, die Urteile bleiben unter Verschluss. [...] Die Richter genehmigen nicht nur das Ausspähen im konkreten Einzelfall. Seit den Anschlägen vom 11. September sind sie überdies eine Art verfassungsrechtliches Gutachtergremium und prüfen, ob auch die im Rahmen des Antiterrorkampfs beantragten unspezifischen flächendeckenden Überwachungsmaßnahmen rechtmäßig sind. Dazu zählt die massenhafte Speicherung von Verbindungs- und Inhaltsdaten mithilfe von Google, Yahoo oder Facebook sowie der Telefonfirma Verizon. 1978 wurde das FISA-Gericht ins Leben gerufen. Es war die Antwort auf den Watergate-Skandal und das hemmungslose Aushorchen angeblicher Staatsfeinde. Unter dem Vorwand des Spionageverdachts und der Gefährdung der nationalen Sicherheit hatten Amerikas Präsidenten Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 23 reihenweise Vietnamkriegsgegner, Bürgerrechtler und politische Konkurrenten ausleuchten lassen. Der Kongress stoppte diese Willkür. Seither liegt der Schutz der Privatsphäre maßgeblich in den Händen dieser elf Richter. Ihre Rechtsphilosophie kennt man nicht, sie lässt sich allerdings erahnen: Zehntausende von Überwachungsanträgen wurden in 35 Jahren genehmigt und nur fünf oder sechs abgelehnt. Auch die massenhafte Speicherung von Vorratsdaten ließen die Richter jedes Mal anstandslos passieren. […] Allerdings ist dies […] weder Pflichtvergessenheit noch Zufall. „Verfassungen“, sagt Jeffrey Rosen, Datenschutzexperte, Juraprofessor an der George-WashingtonUniversität und einer der besten Kenner der transatlantischen rechtspolitischen Mentalitätsdifferenzen, „sind immer auch ein Spiegel der nationalen Geschichte, der Kultur und Psychologie.“ Wenn Amerikaner an die Terrorgefahr denken, erinnern sich Deutsche an die Überwachungsapparate der Gestapo und der Stasi. [...] Martin Klingst, „Lauschen? Wir sind so frei“, in: DIE ZEIT Nr. 30 vom 18. Juli 2013 24 Politisches System der USA Zwar hat Bushs Nachfolger, der seit dem 20. Januar 2009 amtierende Präsident Barack Obama, sich gleich in seiner Ansprache zur Amtseinführung von der Politik seines Vorgängers distanziert. Doch sind seinen Worten bislang wenige Taten gefolgt. Mittlerweile ist über die Medien ans Tageslicht gekommen, dass viele Sicherheits- und Geheimdienstpraktiken der Bush-Administration von der Obama-Regierung im Dunkeln weitergeführt bzw. in vielen Bereichen sogar noch forciert wurden. Sitz des Supreme Court, der höchsten richterlichen Instanz, in Washington, D.C. … picture alliance / landov Auch die Frage, ob die Rechtsprechung der Exekutive ihre Grenzen aufzeigen könnte, beurteilte der Oberste Richter skeptisch: „Wenn die (höchstrichterliche) Entscheidung getroffen wird, nachdem die Kriegshandlungen beendet sind, ist es wahrscheinlicher, dass die persönlichen Freiheitsrechte favorisiert werden, als wenn sie getroffen wird, während der Krieg noch andauert“, so William Rehnquist 1998 im oben erwähnten Buch. Obschon zivilgesellschaftliche Interessengruppen vereinzelt einige Teilerfolge vor Gericht erzielen und einschlägige Urteile erwirken konnten, wurden diese in der Regel nach Gegenhalten der Exekutive von höheren Instanzen wieder zurückgewiesen oder für nicht rechtskräftig erklärt. Letztendlich sind solche Fälle dann von der höchsten richterlichen Instanz, dem Supreme Court, zu entscheiden. Die Urteile der neun Richterinnen und Richter beeinflussen unter anderem auch die Kräfteverhältnisse der politischen Gewalten im US-System der checks and balances. So wurden die Versuche der Regierung George W. Bushs, die eigenen Machtbefugnisse auf Kosten der Legislative und Judikative auszuweiten, vom Supreme Court verurteilt – unter anderem mit der Rechtsprechung vom Juni 2008 (Boumediene et al v. Bush et al). Die Richter entschieden, dass die „Habeas Corpus“-Bestimmung auch für Guantánamo Geltung habe, woraufhin fünf der sechs klagenden Guantánamo-Häftlinge im November 2008 entlassen wurden. Dieses Urteil erging allerdings mit einer knappen Mehrheit von fünf gegen vier Stimmen. Dabei haben die beiden von Präsident Bush ernannten Richter Samuel A. Alito und Chief Justice John G. Roberts, Jr. in ihrer Minderheitsmeinung den Machtanspruch und die Vorgehensweise des Präsidenten im Globalen Krieg gegen den Terror gebilligt. Mit jeder Neubesetzung von Richterämtern am Supreme Court stehen mit einer möglichen Veränderung der Mehrheitsverhältnisse auch grundlegende, für die Qualität der amerikanischen Demokratie ausschlaggebende Entscheidungen auf dem Spiel. So konnten die Obersten Richter auch eine der größten Verfassungskrisen der jüngsten US-amerikanischen Geschichte entschärfen, indem sie im Fall Bush v. Gore am 12. Dezember 2000 den Ausgang der heftig umstrittenen Präsidentschaftswahl zugunsten des Republikaners George W. Bush entschieden. Trotz dieser fundamentalen Kontroversen genießt der Supreme Court in der US-Bevölkerung höchste Autorität. Seine Zustimmungsraten übertreffen bei Weitem die Werte der anderen politischen Gewalten, namentlich des Kongresses und des Präsidenten. Doch sind auch die Rechtsprechungen des Obersten Gerichts nicht in Stein gemeißelt. Im Laufe der Entwicklung der USA von einer Agrar- über eine Industrie- hin zu einer Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft mussten die Richter immer wieder neue Realitäten mit den (interpre- picture alliance / landov / Dennis Brack Sicherungsinstanz Judikative ... und seine neun derzeitigen Mitglieder: (v. li. n. re.) Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Antonin Scalia, Stephen Breyer, Chief Justice John Roberts, Samuel Alito, Anthony Kennedy, Elena Kagan und Ruth Bader Ginsburg Das Gerichtssystem der USA In der Justiz der USA herrscht ebenso das Prinzip der Gewaltenteilung – zwischen der Bundesgerichtsbarkeit und der Jurisdiktion der Einzelstaaten, die parallel existieren. Daneben gibt es auch noch die außerhalb der Judikative urteilenden Militärgerichte (Military Courts). Die Bundesgerichtsbarkeit besteht aus drei Instanzen: Auf der untersten Ebene richten 94 District (Trial) Courts, darüber stehen 13 Berufungsgerichte (Appellate Courts), deren Urteile wiederum vom Obersten Gericht (Supreme Court) revidiert werden können. Der Supreme Court besteht aus neun Richterinnen und Richtern, die auf Lebenszeit berufen werden. Sie werden vom Präsidenten ernannt und müssen von der Legislative, namentlich vom Senat, gebilligt werden. Die Gerichte der Einzelstaaten sind hauptsächlich für Zivil- und Strafsachen zuständig. Jeder Einzelstaat hat sein eigenes, mehrstufig aufgebautes Gerichtssystem und seine eigenen Strafzumessungen. So gilt in einigen Staaten noch die Todesstrafe, während sie in anderen bereits abgeschafft wurde. Auch die Berufung der Richter ist unterschiedlich: Je nach Bundesstaat werden Richter entweder direkt vom Volk gewählt oder politisch, das heißt von der jeweiligen Exekutive und Legislative ernannt. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances tierbaren) Verfassungsgrundsätzen in Einklang bringen. Doch die Interpretationsfähigkeit des Verfassungstextes ist bis heute umstritten. Während die einen den Text der Verfassung nur gemäß der „ursprünglichen Absicht“ (original intent) ihrer Väter auslegen wollen, sehen die anderen im Verfassungstext ein „lebendes Dokument“ (living document). Dementsprechend fordern erstere juristische Zurückhaltung (judicial restraint) und verurteilen den Standpunkt der anderen Gruppe, die weite rechtliche Auslegung, als Aktionismus (judicial activism). Die amerikanischen Rechtsquellen Häufig werden nur das geschriebene Recht und das Richterrecht als Quellen des amerikanischen Rechts unterschieden. […] Das sog. „constitutional law“ umfasst […] nach amerikanischem Verständnis nicht nur die in der Verfassung niedergelegten Normen, sondern auch deren jeweilige Interpretation durch den Supreme Court. Unterhalb des „constitutional law“ ist das sog. „statutory law“ anzusiedeln, das die durch die gesetzgebenden Körperschaften beschlossenen Normen inkl. ihrer Auslegung durch die Gerichte umfasst. Nominierungen für den Supreme Court Für Nominierungen an den Supreme Court kann der Justizausschuss im Senat die schriftliche Stellungnahme der beiden Senatoren aus dem Staat einholen, aus dem auch der Kandidat stammt. Wegen der blauen Briefbögen, auf denen die Gutachten geschrieben werden, ist dieses Verfahren auch unter der Bezeichnung blue slip bekannt. Faktisch liegt damit das Schicksal eines Kandidaten in der Hand zweier Senatoren, die eine Anhörung von vornherein verhindern können. In diesem Netzwerk von politischen Abhängigkeiten offenbart sich das Potenzial für politisch motivierte Ernennungen. Kein Präsident kann es sich leisten, politisches Personal ohne eine Abstimmung mit Kongressabgeordneten zu bestimmen, das gilt umso mehr, wenn der Abgeordnete oder Senator eine für den Präsidenten wichtige Rolle im Kongress einnimmt. Die Personalauswahl für die Bundesgerichte trägt deshalb durchaus Züge einer Patronagepolitik. Die typische Strategie für die Personalauswahl, insbesondere für ein Amt am Supreme Court, zielt nicht darauf ab, einzelne Entscheidungen zu beeinflussen, sondern 25 Bei einigen Urteilen geht es im wahrsten Sinne um Leben und Tod. Mit der Entscheidung des Obersten Gerichts zur Abtreibung (Roe v. Wade, 1973) wurden viele Gläubige politisiert. Die Liberalisierung des Abtreibungsrechts bedeutete die Geburtsstunde der politischen Bewegung der Christlich Rechten, konservativer evangelikaler und katholischer Interessengruppen und ihrer Wählerschaft, die sich seither im Sinne einer „moralischen Mehrheit“ verstärkt für die Republikaner engagieren. Sogenannte moralische Themen (moral issues) wie Abtreibung spalten nicht nur die Bevölkerung in Befürworter und Gegner, Nochmals eine Stufe niedriger steht das sog. „administrative law“, das weder dem „constitutional“ noch dem „statutory law“ entgegenlaufen darf und das als Ausfüllung der Lücken des „statutory law“ durch administrative Organe umschrieben werden kann. Letztlich ist das aus England importierte „common law“ zu nennen. Das „common law“ ist durch Gerichte gesetztes Recht, das in Streitfällen bei einem Fehlen gesetzlicher Normen entwickelt wird und das die spätere Rechtsprechung bei gleichgelagerten Fällen präjudiziert. Da das „common law“ in seinem Rang hinter das geschriebene Recht zurücktritt, ist es leicht einsichtig, dass die- ses Recht durch die vermehrten Aktivitäten der Legislativorgane im modernen Staate allmählich seine frühere Bedeutung verliert. Hierüber darf allerdings nicht vergessen werden, dass entscheidende Grundsätze des amerikanischen Rechts auf das englische „common law“ zurückgehen, […] z. B. die berühmte „due process of law“-Klausel, die die wichtigsten Verfahrensgrundsätze festschreibt und die – abgesichert im V. und XIV. Amendment der US-Verfassung – u. a. Eingriffe in Leben, Freiheit und Eigentum „without due process of law“ verbietet. den Grundstein für eine langfristig angelegte Doktrin zu legen. Die Auswahl von Richtern wird häufig als die am stärksten politisierte Dimension innerhalb der Judikative wahrgenommen. […] Über 90 % der Nominierungen stammen in der Tat aus dem Umfeld der Partei des Präsidenten. Zum Verdruss der Präsidenten […][ist d]ie Geschichte des Supreme Court […] [jedoch] reich an Beispielen, die eine Kluft zwischen den Erwartungen der Präsidenten und den Urteilen der Richter belegen. Präsident Eisenhower nominierte beispielsweise den Richter Earl Warren zum Chief Justice, der in der Folge mit seiner unerwartet liberalen Rechtsprechung maßgeblich an der amerikanischen Sozialpolitik der 1950/60erJahre beteiligt war, sehr zum Missfallen Eisenhowers. Ähnlich frustriert [waren zu Beginn der 2000er-Jahre] die Republikaner, deren Präsident George H.W. Bush in den 80er-Jahren Richter Souter im Glauben nominiert hatte, dass er ein zuverlässiger Konservativer sei. Judge Souter [vertrat] seit seiner Ernennung indes mit hoher Zuverlässigkeit Demokratische Positionen. Laut Verfassung muss der Senat jedem Kandidaten zustimmen, bevor dessen Berufung rechtskräftig wird. Dafür befasst sich zunächst der Justizausschuss mit Anhörungen der Kandidaten. […] Nach den Anhörungen im Ausschuss findet eine Abstimmung im Plenum statt. Eine einfache Mehrheit reicht aus, um einen Kandidaten zu bestätigen. Eine seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges fest verankerte Praxis im Ernennungsprozess ist die Empfehlung der American Bar Association […]. Sie gibt Empfehlungen als „very qualified“, „qualified“ und „not qualified“ heraus. In der Regel ist es für einen Kandidaten mit der Bewertung „not qualified“ aussichtslos, für ein hohes Richteramt ernannt zu werden. Die Qualifikation eines Richters wird vor allem dann zum entscheidenden Kriterium, wenn der Kandidat politisch vergleichsweise gemäßigt ist. In diesem Fall wird es für die opponierende Partei sehr schwierig, gegen einen moderaten, hoch qualifizierten Richter anzugehen, weil sie sich damit selbst dem Vorwurf parteipolitischer Stellungnahme aussetzt. Der Präsident kann natürlich auch, im Gegenzug für die Unterstützung eines wichtigen Gesetzesvorhabens, einen Kandidaten der anderen Partei vorschlagen, wenn er glaubt, er oder sie teile im Allgemeinen seine politischen Ansichten. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Emil Hübner / Ursula Münch, Das politische System der USA. Eine Einführung, 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage, © Verlag C. H. Beck, München 2013, S. 158 Winand Gellner / Martin Kleiber, Das Regierungssystem der USA, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2007, S. 120 ff. 26 Politisches System der USA sondern beschäftigen seit Jahrzehnten die Politik und die diversen Instanzen im US-amerikanischen Justizsystem. Auch in der Jurisprudenz herrscht das Prinzip der vertikalen Gewaltenteilung – zwischen der Gerichtsbarkeit des Bundes und der Einzelstaaten, die parallel existieren. Ohnehin konkur- […] Vorige Woche veröffentlichte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten binnen zwei Tagen vier Urteile, die enorme Folgen für Millionen Amerikaner haben werden. […] Zwei der […] Urteile waren besonders spektakulär. Im Fall Shelby County v. Holder verwarf das Verfassungsgericht mit fünf zu vier Stimmen einen der wichtigsten Paragrafen des Voting Rights Act, ein hart erkämpftes Gesetz von 1965, das den Schwarzen im amerikanischen Süden das volle Wahlrecht garantiert. Die Folge ist, dass die US-Regierung künftig nicht mehr darüber wachen darf, dass Minderheiten bei Wahlen in einzelnen Bundesstaaten nicht diskriminiert werden. Im Fall United States v. Windsor erklärte das Gericht, ebenfalls mit fünf zu vier Stimmen, den Defense of Marriage Act für nichtig. Dieses Gesetz von 1996 definierte „Ehe“ für verwaltungsrechtliche Zwecke als Gemeinschaft von Mann und Frau. Es verwehrte damit gleichgeschlechtlichen Paaren Steuerprivilegien, die heterosexuellen Ehepaaren zustehen. Nach dem Urteil müssen alle US-Bundesbehörden nun homosexuelle Paare, die rechtmäßig verheiratet sind – derzeit ist das in etwa einem Dutzend Bundesstaaten möglich –, künftig wie heterosexuelle Paare behandeln. Auf den ersten Blick passen die beiden Urteile nicht zusammen. An einem Tag kastrierte der Supreme Court eines der wichtigsten Bürgerrechtsgesetze der Vereinigten Staaten – ein historischer Sieg für Amerikas Konservative. Doch nur 24 Stunden später jubelte das linksliberale Amerika über die Gleichstellung von homound heterosexuellen Ehepaaren. Dasselbe Gericht, das per Federstrich die Rechte der schwarzen Minderheit massiv beschnitten hatte, erweiterte im Gegenzug die Rechte der homosexuellen Minderheit erheblich. So jedenfalls erschien es. Auf den zweiten Blick ist das Hin und Her weniger erstaunlich. Der Unterschied zwischen den Urteilen besteht im Votum eines einzelnen Mannes: des Richters Anthony Kennedy. Er schlug sich im Wahlrechtsfall auf die Seite der vier konservativen Richter am Supreme Court (John Roberts, Clarence Thomas, Antonin Scalia sowie Samuel Alito). Im Fall der Homo-Ehe stimmte der 77-Jährige dann mit den vier liberalen Richtern (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor und Elena Kagan). […] Es war insofern nicht „das Gericht“, das die Urteile fällte. Sondern es standen sich bei beiden Urteilen wieder einmal die beiden altbekannten Vierergruppen gegenüber: Die vier liberalen Richter wollten den Minderheiten helfen. Sie stimmten für den Erhalt des Voting Rights Act und gegen das Ehegesetz. Die vier Konservativen […] dagegen […] stimmten gegen das Wahlgesetz und für die traditionelle Ehe. Es war Kennedy, der als Mehrheitsbeschaffer hin- und herpendelte. […] Amerikas Oberstes Gericht tut gern so, als stünde es, allein der Verfassung verpflichtet, hoch über dem politischen Alltagsgezänk. Aber das ist ein Trugbild. Die neun Richter sind Juristen. Doch sie machen mit ihren Urteilen pure Politik. [Chief Justice John] Roberts’ Urteilsbegründung im Wahlrechtsfall war in dieser Hinsicht eindeutig: Sein Argument gegen den Voting Rights Act – immerhin ein Gesetz, das der Kongress erst 2006 für weitere 25 Jahre bestätigt hatte – war, dass es keinen staatlich organisierten Rassismus im Süden mehr gebe. „Die Dinge haben sich dramatisch verändert“, so sein Kernsatz – eine politische Feststellung, wohl kaum eine juristische Analyse. Im Fall der Homo-Ehe zogen sich Roberts und seine konserva- tiven Kollegen, die tags zuvor dem Parlament noch so beherzt ins Steuer gegriffen hatten, dann wieder auf ihr Lieblingsargument zurück: Das Gericht solle nicht Gesetzgeber spielen und dem Kongress nicht dreinpfuschen. […] Wie politisch das Gericht inzwischen ist, zeigen einige Zahlen: Während es im Jahr 2005 nur elf Fünf-zu-vier-Entscheidungen gab, waren es in der abgelaufenen Sitzungszeit 24. Das waren knapp 30 Prozent aller Urteile. Bei 70 Prozent dieser Urteile standen sich jeweils die beiden ideologisch geprägten Vierergruppen gegenüber. Und in 63 Prozent dieser Fälle gewann die konservative Seite. Daran ändert auch nichts, dass es just Roberts war, der voriges Jahr mit seinem Votum die bei den Republikanern so verhasste Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama rettete: Der Wutschrei der Rechten damals war ein Wutschrei über einen Abtrünnigen, auf den man sich bis dahin verlassen konnte. Der Rechtsdrall des Gerichts wäre verkraftbar, wenn es sich nicht zunehmend – und zunehmend parteiisch – genau in die politischen Fragen einmischen würde, die das Land so tief spalten. Die Klage gegen den Voting Rights Act zum Beispiel hätte der Supreme Court nicht annehmen müssen. Chief Justice Roberts tat es trotzdem. Und zwar, wie die Gerichtskorrespondentin der New York Times fast ungläubig feststellte, aus dem „blanken Willen, festgefügtes Recht zu verändern“. […] Hubert Wetzel, „Die zerfallenden Staaten von Amerika“, in: Süddeutsche Zeitung vom 6. Juli 2013 Roll Call / Getty Images / Douglas Graham Gespalten wie die Gesellschaft – der Supreme Court rieren die Staaten mit dem Bund um Kompetenzen – das sind historisch angelegte, permanente Auseinandersetzungen, die im Laufe der US-amerikanischen Verfassungsgeschichte auch den Supreme Court immer wieder zu Grundsatzentscheidungen genötigt haben. Die 9. Stimme zählt: Im Juni 2013 erfreut eine Entscheidung des Supreme Court Demonstranten für die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen. Kurz zuvor hatte er mit ebenso knappem Mehrheitsvotum den Voting Rights Act, ein wichtiges Antidiskriminierungsgesetz, beschnitten. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 27 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Daten zu den Einzelstaaten der USA Bundesstaat Wie ein roter Faden durchziehen die Konflikte zwischen den Einzelstaaten und der Bundesregierung die oftmals blutige Geschichte der USA. Als sich 1776 die dreizehn britischen Kolonien für unabhängig von ihrem Mutterland erklärten, schlossen sie sich zunächst 1781 mit den Articles of Confederation zu einem Bund souveräner Staaten zusammen. Die massiven innen- und außenpolitischen Probleme infolge des Unabhängigkeitskrieges (1775-1783) nötigten sie jedoch, eine handlungsfähigere Einheit zu bilden. Sie gaben sich 1787 eine neue bundesstaatliche Verfassung. Dabei gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen den Wegbereitern einer starken Zentralregierung, den sogenannten Federalists, und den auf Eigenständigkeit der Einzelstaaten pochenden Anti-Federalists. Während die einen den Bundesstaat befürworteten, wollten die anderen nur einen losen Staatenbund, eine Konföderation, die die Souveränität und Befugnisse bei den Einzelstaaten belassen hätte. Die Föderalisten behielten in der Verfassungsdebatte die Oberhand, und die Federalist Papers, die von Alexander Hamilton, James Madison und John Jay unter dem Pseudonym „Publius“ verfassten Artikel, wurden aufgrund ihrer großen publizistischen Wirkung identitätsstiftend für die junge Nation. Es galt aber auch vorzubeugen, dass die neu geschaffene Regierung nicht in eine Tyrannei abglitt. Neben der horizontalen Aufteilung in gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalten sollte auch eine vertikale Gewaltenkontrolle ausgeübt werden, indem die Befugnisse zwischen der Bundesregierung und den Einzelstaaten aufgeteilt wurden. Gemäß dem Konzept des dual federalism verfügten Bund und Einzelstaaten jeweils über eigene, voneinander abgegrenzte Aufgabenbereiche. Die Verfassung regelt, so der Kompromiss von 1787, dass die Bundesregierung nur die in Artikel I aufgeführten Vorrechte, die enumerated powers, ausüben darf, um die Rechte der Einzelstaaten zu wahren. Der 1791 hinzugefügte zehnte Verfassungszusatz spezifiziert denn auch, dass alle Kompetenzen, die nicht explizit dem Zentralstaat zugesprochen bzw. den Pro-Kopf-Einkommen in US-Dollar*** (2010) 14.12.1819 135 293 4780 (23) 33 945 03.01.1959 1 593 444 710 (47) 44 174 (8) Arizona 14.02.1912 295 276 6392 (16) 34 999 (40) (42) (46) Arkansas 15.06.1836 137 742 2916 (32) 33 150 California 09.09.1850 411 470 37 254 (1) 43 104 (12) Colorado 01.08.1876 269 618 5029 (22) 42 802 (14) Connecticut* 09.01.1788 14 358 3574 (29) 56 001 (1) 07.12.1787 6208 898 (45) 39 962 (20) – 177 602 (–) 71 044 (–) Delaware* District of Columbia**** Florida 03.03.1845 155 214 18 801 (4) 39 272 (24) Georgia* 02.01.1788 152 750 9688 (9) 35 490 (37) Hawaii 21.08.1959 16 729 1360 (40) 41 021 (17) Idaho 03.07.1890 216 456 1568 (39) 32 257 (49) Illinois 03.12.1818 150 007 12 831 (5) 43 159 (11) Indiana 11.12.1816 94 328 6484 (15) 34 943 (41) (28) Iowa 28.12.1846 145 754 3046 (30) 38 281 Kansas 29.01.1861 213 110 2853 (33) 39 737 (21) Kentucky 01.06.1792 104 665 4339 (26) 33 348 (44) Louisiana 30.04.1812 134 275 4533 (25) 38 446 (26) Maine 15.03.1820 87 388 1328 (41) 37 300 (29) Maryland* 28.04.1788 31 849 5774 (19) 49 025 (4) Massachusetts* 06.02.1788 23 934 6548 (14) 51 552 (2) (36) Michigan 26.01.1837 250 465 9884 (8) 35 597 Minnesota 11.05.1858 225 182 5304 (21) 42 843 (13) Mississippi 10.12.1817 125 060 2967 (31) 31 186 (50) Missouri 10.08.1821 180 546 5989 (18) 36 979 (32) Montana 08.11.1889 380 849 989 (44) 35 317 (38) Nebraska 01.03.1867 200 358 1826 (38) 39 557 (22) Nevada 31.10.1864 286 367 2701 (35) 36 997 (31) New Hampshire* 21.06.1788 24 044 1316 (42) 44 084 (9) New Jersey* 18.12.1787 21 277 8792 (11) 50 781 (3) New Mexico 06.01.1912 314 939 2059 (36) 33 837 (43) New York* 26.07.1788 139 833 19 378 (3) 48 821 (5) 21.11.1789 136 421 9535 (10) 35 638 (35) North Dakota 02.11.1889 183 123 673 (48) 40 596 (18) Ohio 01.03.1803 116 103 11 537 (7) 36 395 (34) Oklahoma 16.11.1907 181 048 3751 (28) 36 421 (33) Oregon 14.02.1859 251 571 3831 (27) 37 095 (30) 12.12.1787 119 291 12 702 (6) 41 152 (16) North Carolina* Pennsylvania* Rhode Island* 29.05.1790 3189 1053 (43) 42 579 (15) South Carolina* 23.05.1788 80 779 4625 (24) 33 163 (45) South Dakota 02.11.1889 199 744 814 (46) 38 865 (25) Tennessee 01.06.1796 109 158 6346 (17) 35 307 (39) Texas 29.12.1845 692 248 25 146 (2) 39 493 (23) Utah 04.01.1896 219 902 2764 (34) 32 595 (48) (19) Vermont 04.03.1791 24 903 626 (49) 40 283 Virginia* 25.06.1788 109 625 8001 (12) 44 762 (7) Washington 11.11.1889 182 949 6725 (13) 43 564 (10) West Virginia 19.06.1863 62 759 1853 (37) 32 641 (47) Wisconsin 29.05.1848 169 643 5687 (20) 38 432 (27) Wyoming 10.07.1890 253 349 564 (50) 47 851 (6) 9 629 091 310 955 USA insgesamt** Reinhard Eisele / project photos Einwohner (in 1000) (2010)*** Alaska Alabama Vertikale Gewaltenteilung: Föderalismus Aufnahme in Größe in die Union* km² 40 584 * Bei den dreizehn Gründerstaaten ist das jeweilige Datum der Ratifizierung der Verfassung angegeben. ** Die Differenzen zwischen Einzelsummen und Gesamtsumme ergeben sich aus den nicht aufgeführten Außengebieten (z. B. Puerto Rico). *** Die Ziffern in den Klammern geben die Reihenfolge der Bundesstaaten an. **** (Bundesdistrikt mit der Hauptstadt Washington, der als neutrales Territorium zu keinem Bundesstaat gehört und dem Kongress der USA unmittelbar untersteht – Anm. d. Red.) Symbol für die föderale Staatsordnung ist das „Star-Spangled Banner“, die Flagge der USA. 13 Streifen stehen für die 13 Gründerstaaten, 50 Sterne für die heutigen 50 Bundesstaaten. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Quellen: Angaben für die Eintrittsdaten: Udo Sautter, Die Vereinigten Staaten. Daten, Fakten, Dokumente, Tübingen 2000, S. 619 (Florida und West Virginia wurden geringfügig korrigiert); für die Einwohnerzahlen 2010: US Census Bureau: Census 2010 resident people of states and D.C.; für Einkommen 2010: Statistical abstract of the United States of America. Hg. vom US-Department of Commerce, Washington 2012, S. 269 Emil Hübner / Ursula Münch, Das politische System der USA. Eine Einführung, 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage, © Verlag C. H. Beck, München 2013, S. 20 f. (Quellennachweis auf S. 176 unter 4) 28 Politisches System der USA Kompetenzverteilung im föderalen System der USA Bundeskompetenzen Konkurrierende Kompetenzen Kompetenzen der Einzelstaaten ¬ Währungsangelegenheiten ¬ Steuererhebung ¬ Organisation von Wahlen ¬ Regulierung des Handels mit anderen Nationen und zwischen den Einzelstaaten (interstate commerce) ¬ Erhebung von Importzöllen ¬ Pflege der auswärtigen Beziehungen und Abschluss von Verträgen ¬ Verabschiedung von „notwendigen und geeigneten“ Gesetzen ¬ Erklärung und Führung von Kriegen ¬ Regulierung des Postwesens ¬ Enteignung zum öffentlichen Nutzen gegen entsprechende Entschädigung ¬ Recht zur Kreditaufnahme ¬ Gründung von Banken und Unternehmen ¬ Verabschiedung und Durchsetzung von Gesetzen ¬ Finanzierung der allgemeinen Wohlfahrt ¬ Einrichtung von Gerichtshöfen ¬ Regulierung des Handels innerhalb des Einzelstaates (intrastate commerce) ¬ Schutz der öffentlichen Wohlfahrt, Sicherheit und Sitten ¬ Etablierung einer republikanischen Regierungsform auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene ¬ alle Kompetenzen, die nicht explizit dem Bund zugewiesen bzw. den Einzelstaaten vorenthalten sind Quelle: Lee Epstein / Thomas G. Walker, Constitutional Law for a Changing America. A Short Course, 3. Aufl., Washington D.C. 2005, S. 176; zitiert nach Wolfgang Welz, „Die bundeseinheitliche Struktur“, in: Wolfgang Jäger u. a. (Hg.), Regierungssystem der USA, 3. Aufl., München / Wien: Oldenbourg-Verlag 2007, S. 69-98, hier S. 73 Einzelstaaten entzogen werden, bei den Einzelstaaten liegen. Weniger eindeutig sind jedoch jene Befugnisse, die aus den enumerated powers abgeleitet werden können: namentlich die impliziten, implied powers. Das sind insbesondere Kompetenzen, die Washington entsprechend der necessary and proper clause in Form von „notwendigen und angemessenen“ Gesetzen für sich beansprucht, um seine verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten zu erfüllen. Auch die general welfare clause, gemäß der die Zentralregierung für das Gemeinwohl zu sorgen hat, ist vielfältig interpretierbar. Bei Streitigkeiten zwischen Bundesstaat und Einzelstaaten entscheidet der Supreme Court. Historische Grundsatzentscheidungen der Obersten Richter haben die Ausgestaltung des Föderalismus maßgeblich bestimmt. Insbesondere nutzte der Oberste Richter und überzeugte Federalist John Marshall seine Amtszeit (1801-1835) dazu, die Generalklauseln (necessary and proper clause, general welfare clause, commerce clause) zugunsten erweiterter Bundesvollmachten auszulegen. In ihrer Urteilsfindung waren die Richter jedoch meistens von sozioökonomischen Entwicklungen und politischen Entscheidungen beeinflusst oder haben diese sogar nachvollzogen bzw. legitimiert (so Michael Bothe 1982, S. 144). Als Reaktion auf nationale Krisen, etwa auf die Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, wurden die Bundeskompetenzen erweitert. So bereitete die „Große Depression“ den Weg für den Sozialstaat. Um dem Marktversagen zu begegnen, regulierte die Bundesregierung unter der Führung von Präsident Franklin D. Roosevelt in einem „New Deal“ neue Bereiche (etwa die Finanzmärkte), kümmerte sich auch um die Fürsorge für arme, kranke und alte Menschen und übernahm Kompetenzen, die vorher den Einzelstaaten oblagen, zum Beispiel Straßenbau, Ausbau der Energie- und Kommunikationsnetze und andere Infrastrukturleistungen. Der Bund unterstützt seitdem die zunehmend überforderten Einzelstaaten in ihren Aufgaben mit üppigen Geldzuweisungen (federal grants-in-aid). In den knapp vier Jahrzehnten Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2013, Historical Tables, Washington 2013, S. 251-252, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ omb/budget/fy2013/assets/hist.pdf von 1930 bis 1968 stiegen die Bundeszuweisungen von 120 Millionen auf 19 Milliarden Dollar, wie Stephen J. Wayne u. a. in „Conflict and Consensus in American Politics“, Belmont 2007, S. 75 f. nachweisen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit, des sogenannten cooperative federalism, wurde der von den Gründervätern angelegte Dualismus (dual federalism) überlagert. Spätestens in den 1980er-Jahren fühlten sich jedoch viele Einzelstaaten durch die „goldenen Zügel“ Washingtons gegängelt. Denn mit Hilfe des sogenannten Regulierungsföderalismus konnte der Bund in die Einzelstaaten „hineinregieren“, etwa indem er die Sozial- und Infrastrukturhilfen nicht nur mit Regulierungsauflagen verband, sondern die Mittel auch nach parteipolitischen und wahltaktischen Erwägungen vergab. Da außer Vermont alle Einzelstaaten zu ausgeglichenen Haushalten verpflichtet sind, das heißt keine Schulden machen dürfen, sind sie umso mehr vom Bund abhängig. Mit seinem Dezentralisierungsprogramm des „New Federalism“ wollte Präsident Ronald Reagan dem „big government“, das mit dem „New Deal“ Roosevelts geschaffen und von den Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson ausgebaut worden war, zu Leibe rücken. Die sogenannte devolution, das heißt die Übertragung administrativer Verantwortung an die Einzelstaaten, hat indes nicht viel bewirkt – im Gegenteil: Die Bundeszuweisungen sind im Laufe der folgenden Jahrzehnte weiter gestiegen, und sie sind restriktiver geworden: Ende der 1970er-Jahre machten die für spezifische Zwecke gebundenen categorial grants drei Viertel und die allgemeinen, mit weitem Verwendungsspielraum versehenen block grants ein Viertel aus. In den 1990er-Jahren ist deren Anteil nach Berechnungen von Wolfang Welz (2007) gar auf ein Zehntel geschmolzen. Der Bund hat offensichtlich die „goldenen Zügel“ weiter gestrafft. Denn zweckgebundene Zuwendungen helfen auch den Regierungsvertretern in Washington bei ihrer Wiederwahl: Die Wohltaten für die Einzelstaaten bzw. Wahlkreise können damit von den Wählern besser den federführenden Senatoren und Abgeordneten zugerechnet werden. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances 29 Schulden und Lasten – Herausforderungen für die Bundesstaaten […] Zu den Schulden, die Amerika zu überrollen drohen, gehören die Lasten der social security. Die staatliche Rentenpflichtversicherung für Angestellte bildet die Grundabsicherung für viele Amerikaner – für neun von zehn Rentnern ist es die Haupteinnahmequelle. Derzeit erhalten 58 Millionen eine social security-Rente. Diese Zahl wird sich deutlich erhöhen, weil sich die geburtenstarken Jahrgänge aufs Altenteil zurückziehen. Doch die Beiträge der Versicherten reichen bereits heute nicht mehr zur Finanzierung aus. Seit Kurzem hat die Rentenversicherung damit begonnen, die Rentenauszahlungen aus ihrem Treuhandfonds zu bezuschussen, der als Sicherheit hinterlegt worden war. Wenn es keine Reform gibt, wird nach den Prognosen der social security-Behörde der Fonds bis 2033 ausgeschöpft sein und eine Deckungslücke von 633 Milliarden Dollar klaffen. Bis 2045 wird diese Lücke auf über eine Billion Dollar angestiegen sein. Doch social security gilt in der amerikanischen Politik als third rail – das ist die Strom führende Schiene der Washingtoner U-Bahn: Wer sie anfasst, ist sofort tot. Denn social security ist eines der beliebtesten staatlichen Programme – selbst die junge Generation plädiert bei Umfragen für eine Beibehaltung des Systems. Obwohl die unumgängliche Reform der Altersvorsorgesysteme sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern immer wieder beschworen wird, liegen bisher keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch. […] Das Problem einfach wegzudrücken können sich die Bundesstaaten nicht mehr leisten. Je nach Hochrechnungen liegen die Pensionszusagen von Bundesstaaten und Kommunen bei drei Billionen Dollar, manche Experten halten eher vier Billionen für realistisch. […] Es gibt über 3000 Fonds in den USA, aus denen Pensionen und Gesundheitsvorsorge für öffentlich Bedienstete – vom Polizisten bis zum Universitätsprofessor – bezahlt werden. Doch was die Altersversorgung der 27 Millionen Amerikaner im öffentlichen Dienst sichern sollte, hat sich als Zeitbombe herausgestellt, die die öffentlichen Kassen sprengt. Denn wenn die Fonds schlecht wirtschaften, muss der Steuerzahler die Lücken schließen. Bei den Pensionsfonds der Bundesstaaten klafft laut der jüngsten Untersuchung des Washingtoner Forschungsinstituts Pew Center on the States zwischen Leistungszusagen und dem Fondsvermögen eine Lücke von knapp 1,4 Billionen Dollar. Städte und Gemeinden haben zusätzlich eine Deckungslücke von 217 Milliarden Dollar. Noch alarmierender: Bei 34 der 50 Staatsfonds ist die Deckung unter 80 Prozent gerutscht, ein Wert, der als kritisch für die langfristige Finanzierbarkeit gilt. […] Wie sind die Fonds in diese Schieflage geraten? Es war die Finanzkrise und die anschließende Rezession. Doch die Katastrophe hat sich lange angebahnt. Attraktive öffentliche Altersbezüge halfen öffentlichen Verwaltungen, im Wettbewerb mit privaten Arbeitgebern mitzuhalten, die mit höheren Gehältern und besseren Aufstiegschancen lockten. Bald erkannten auch Kommunalpolitiker, dass sich Pensionsversprechen im Wahlkampf einsetzen ließen. Vor allem Demokraten, die den öffentlichen Gewerkschaften nahestehen, erwiesen sich als großzügig. […] „Das System ist voller Interessenkonflikte“, sagt Kritiker Joe Nation. „Der Steuerzahler kommt dabei regelmäßig unter die Räder.“ Es half, dass die Erhöhungen scheinbar kostenlos zu haben waren. Die zusätzlichen Ausgaben würden einfach durch höhere Anlagegewinne finanziert werden, erklärten die Pensionsverwalter. Die Pensionsfonds verabschiedeten sich von der konservativen Anlagestrategie ihrer Anfangszeiten, als sie fast ausschließlich auf US-Staatsanleihen setzten. Tatsächlich sind die Fonds heute mit die einflussreichsten Investoren der Wall Street, sie kaufen Aktien, Immobilien und stecken Milliarden in Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften. Doch die Renditekalkulationen stellten sich als übertrieben optimistisch heraus. Immer wieder erlitten die Fonds schwere Verluste. Die verheerende Finanzkrise von 2008 riss Deckungslücken von historischen Ausmaßen auf, die nun die Tragfähigkeit der Fonds selbst infrage stellen. Um die Verluste einigermaßen wettzumachen, müssen die öffentlichen Kassen weit mehr als zuvor in die Pensionsfonds abführen – während die Kommunen und Bundesstaaten selbst noch immer unter den Folgen der Wirtschaftskrise leiden. […] „Je höher die Beiträge, desto weniger Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 bleibt für Schulen, Hospitäler, Straßen, Bibliotheken“, sagt Steven Malanga vom konservativen New Yorker Thinktank Manhattan Institute. Seit sich die Folgen des Pensionsfiaskos bei den Wählern so direkt bemerkbar machen, reagieren auch die Politiker. Es ist mächtig Bewegung in die Reformen gekommen. Fast alle Fonds haben begonnen, Leistungen zu reduzieren. Einige […] haben ihr System grundlegend geändert und zahlen künftig Altersvorsorgezuschüsse, statt eine feste Pension zuzusichern. Noch ist unsicher, ob der große Pensionsschock so verhindert werden kann. […] Heike Buchter, „Amerika auf der Klippe“, in: DIE ZEIT Nr. 10 vom 28. Februar 2013 Amerikanische Altlasten Regierung, Bundesstaaten, Städte und Firmen in den USA ächzen unter hohen Verpflichtungen: ¬ 633 Milliarden Dollar werden der staatlichen Pflichtversicherung Social Security bis 2033 fehlen. 327 Milliarden Dollar groß ist die Lücke bei den 100 US-Unternehmen mit Betriebspensionskassen. 1,4 Billionen Dollar beträgt die Unterdeckung bei den Pensionsfonds der Bundesstaaten. 217 Milliarden Dollar fehlen den 61 US-Metropolen, um ihre Pensionen zu finanzieren. 630 Milliarden Dollar weitere Rückstellungen sind für die Pensionen von Bundesbeamten erforderlich. Quellen: CBO-Rechnungshof, FERS, Pew Center on the States, Milliman 30 Politisches System der USA Wettbewerbsverzerrungen bei Kongresswahlen Temporale Kontrolle: Macht auf Zeit durch Wahlen Alle Macht geht vom Volke aus. Indem Macht nur für eine bestimmte Zeit gewährt wird, soll sie vom Volkssouverän unmittelbar kontrolliert werden können. So wird der US-Präsident für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt; seit dem 22. Verfassungszusatz von 1951 ist die maximale Amtszeit auf zwei Perioden – also acht Jahre – begrenzt. Die Amtszeit der 435 Repräsentanten des Abgeordnetenhauses beträgt zwei Jahre, jene der 100 Senatoren sechs Jahre. Alle zwei Jahre steht ein Drittel der Senatssitze zur Wiederwahl an. Während bei den Kongresswahlen in den jeweiligen Wahlkreisen und Einzelstaaten wenig Wettbewerb zwischen den Parteien herrscht und die Amtsinhaber hohe Wiederwahlchancen haben, ist die Nation bei Präsidentschaftswahlen mittlerweile in zwei etwa gleich große Lager gespalten. Aktives Wahlrecht: Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht wurde mit dem 1971 erlassenen 26. Verfassungszusatz von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Wahlberechtigt sind alle Männer und, seit dem 19. Verfassungszusatz von 1920, auch Frauen. Wahlberechtigte müssen sich in Wahlregister ihres Bundesstaates bzw. Wahlkreises eintragen lassen. Dabei muss man sich als potenzieller Wähler/ potenzielle Wählerin der Demokraten, Republikaner oder als Unabhängiger identifizieren. Die Registrierung und Angabe der Parteipräferenz ist nötig, um sich an den Vorwahlen beteiligen zu können, in denen die Kandidaten der Parteien gekürt werden. Bei geschlossenen Vorwahlen (closed primaries) dürfen nur Wählerinnen und Wähler teilnehmen, die sich als Anhängerinnen bzw. Anhänger der jeweiligen Partei registriert haben. Bei offenen Vorwahlen (open primaries) hingegen darf jeder registrierte Wähler teilnehmen. Da die Organisation der Wahlen – auch von denen der nationalen Ebene – im Kompetenzbereich der Einzelstaaten liegt (siehe S. 27 f.), gibt es kein einheitliches, bundesweites Wahlverfahren. In der heutigen Praxis gelten vielfältige Einzelbestimmungen, etwa bei der Registrierung und technischen Durchführung von Wahlen. Die mancherorts für US-amerikanische Verhältnisse hohen Auflagen (etwa die Pflicht, einen gültigen Ausweis oder Urkunden vorzulegen) hemmen die Wahlbeteiligung, insbesondere jene sozial schwacher Schichten. Mit dem Urteil des Supreme Court im Juni 2013 im Fall Shelby County v. Holder (siehe S. 6 u. 26) ist diese Problematik erneut zum Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen geworden, nicht zuletzt zwischen dem Bund und den Einzelstaaten. Passives Wahlrecht: Die Auflagen für das Recht, gewählt zu werden, sind je nach Amt verschieden: Das Mindestalter, um Präsident zu werden, beträgt 35 Jahre, Senatoren müssen 30, Abgeordnete mindestens 25 Jahre alt sein. Um sich für das höchste Amt im Staate, die Präsidentschaft, zu bewerben, muss der Kandidat oder die Kandidatin die US-amerikanische Staatsangehörigkeit von Geburt an besitzen und in den zurückliegenden 14 Jahren in den USA gelebt haben. AP Photo / The Herald-Palladium, Don Campbell Aktives und passives Wahlrecht Kritische Beobachter fordern seit längerem ein sogenanntes term limit, sprich eine maximale Amtsdauer von Mitgliedern des Kongresses, um mehr Wettbewerb bei den Wahlen zu ermöglichen. Denn nur Sitze, die frei werden (open seats) – wenn ein Abgeordneter oder Senator etwa aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl antritt –, sind wirklich umstritten. Die Amtsinhaber (incumbents) genießen einen Amtsbonus aufgrund ihres Bekanntheitsgrades, ihrer Erfahrung sowie ihrer Wohltaten in ihren Wahlkreisen bzw. Einzelstaaten während ihrer bisherigen Mandatstätigkeit. Zudem gehen die üppigen Wahlkampfzuwendungen von Interessengruppen ungeachtet der Parteizugehörigkeit fast ausschließlich an die incumbents, Herausforderer haben somit nur Außenseiterchancen. Die Wiederwahlquote von Amtsinhabern im Abgeordnetenhaus liegt seit vier Jahrzehnten über 90 Prozent (mit einer Ausnahme, 2010: 85 Prozent); sie lag in vielen Wahlzyklen sogar bei 98 Prozent. Auch im Senat ist seit Anfang der 1980er-Jahre die Tendenz steigend; 2012 konnten nach Angaben des Center for Responsive Politics (2013) 91 Prozent der Amtsinhaber ihre Herausforderer abwehren (www.opensecrets.org/bigpicture/reelect.php). Der Wettbewerb bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus wird zudem durch das Zuschneiden der Wahlkreise einge- In einem College im US-Bundesstaat Michigan helfen Freiwillige im September 2012 beim Eintrag in das Wahlregister. Die Registrierung (zum Teil zuzüglich der Angabe von Parteipräferenzen) berechtigt zur Teilnahme an den Vorwahlen, deren Organisation in die Kompetenz der Einzelstaaten fällt. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 schränkt. Nach jeder alle zehn Jahre stattfindenden Volkszählung sind die Parlamente und/oder Regierungen der Einzelstaaten angehalten, die Wahlkreisgrenzen für die Wahl ihrer Repräsentanten in Washington den demografischen Entwicklungen anzupassen. Dabei versuchen diese seit jeher, Vorteile für die eigene Partei herauszuschlagen. Seitdem der Gouverneur von Massachusetts, Elbridge Gerry, Anfang des 19. Jahrhunderts einen Wahlkreis derart zuschnitt, dass er – wie ein zeitgenössischer Zeitungskarikaturist ironisch bemerkte – wie ein Salamander aussah, wird diese Manipulation als „gerrymandering“ bezeichnet (eine Kombination aus „Gerry“ und dem Wortende von „Salamander“). Mittlerweile ist die Technik des Zuschneidens derart verfeinert worden, dass in vielen Wahlkreisen der eigentliche Wettbewerb nicht mehr zwischen den Parteien, sondern innerhalb des jeweiligen Lagers ausgetragen wird. Zudem grenzen sich die Lebensräume der beiden politischen Lager immer stärker voneinander ab. Viele US-Amerikaner wählen ihren Wohnort nach sozialen, ethnischen, religiö- Getrennte Welten [...] In Chelsea, wo der Hilfspolizist Robert Burnett lebt, wählt fast jeder die Republikaner. [...] Im Süden der Bronx, wo Michael Gonzalez lebt, wählen fast alle die Demokraten. [...] Die Nation sortiert sich. Amerikaner sind beweglich, und wann immer sie umziehen, streben sie wenn möglich dorthin, wo Menschen denken und fühlen wie sie. Republikaner, so haben Sozialforscher ermittelt, wünschen große Vorgärten, Steakhäuser, Golfplätze und einen evangelikalen Pastor. Demokraten bevorzugen städtische Biotope, Supermärkte mit Ökokost, Yoga-Kurse und sozial engagierte Kirchengemeinden – oder auch gar keine Kirchengemeinden. Das Land hat die Rassentrennung überwunden, stattdessen grassiert nun die politische Segregation von Roten (Republikanern) und Blauen (Demokraten). Die Gesellschaft verklumpt zu Haufen von Gleichgesinnten. 1976 lebte nur ein gutes Viertel aller Amerikaner in sogenannten Landslide Countys, also in Landkreisen, in denen stets dieselbe Partei mit mindestens 20 Prozentpunkten Vorsprung gewinnt. Inzwischen wohnt fast die Hälfte aller Amerikaner in solchen Gegenden. Wer anders denkt, lebt woanders. Es ist dies der Nährboden, auf dem die Großparteien gedeihen; sie ähneln mehr und mehr reinrassigen Stämmen. Wer von der politischen Lehre abweicht, wer zum Kompromiss mit dem Gegner mahnt, gilt als unzuverlässig. Wer zum anderen Lager gehört, der lebt in Feindesland, im anderen Amerika. Hilfspolizist Robert Burnett stammt aus Birmingham, Alabama, der verkommenen Stahlstadt mit der landesweit siebthöchsten Mordrate. „Als wir dann die Häuser hier draußen in Chelsea gesehen haben, haben wir uns in die Gegend verliebt“, erinnert er sich, „hier können die Kinder unbeschwert auf der Straße spielen. Wie früher.“ Vor 15 Jahren war Chelsea noch ein Weiler mit 900 Einwohnern. An die alte Zeit erinnert heute eine weiß getünchte Holzbaracke, deren windschiefe Front „Gottes Segen für Amerika“ erbittet. Einst war dies der einzige Laden weit und breit. Inzwischen hat sich die Anzahl der Einwohner verzwanzigfacht. Die Menschen finden hier: ein preiswertes Haus, einen gepflegten Rasen, kaum Kriminalität, den Walmart am Highway 280. Eine kleinbürgerliche Idylle, erschaffen am Reißbrett. „Dies ist das rote Amerika“, sagt Burnett. Republikanisches Gebiet. Konservativ zu fühlen ist hier draußen so selbstverständlich wie Fan der „Crimson Tide“ zu sein, des Football-Teams der Universität von Alabama. Die Weißen hier haben die Stahlstadt Birmingham hinter sich gelassen, auch die Schwarzen, die dort leben mit ihren Problemen und die, natürlich in ihrem eigenen Wahlkreis, stramm demokratisch wählen. „White Flight“, heißt das. Die weiße Flucht. In der Bronx ist es Mitte des vergangenen Jahrhunderts geschehen. Die Weißen zogen weg, es blieben fast nur Schwarze und Latinos. Die Familie von Michael Gonzalez stammt aus Puerto Rico, er ist im Sozialbauviertel Hunts Point aufgewachsen, im Süden der Bronx. „Die schlimmste Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 31 Elkanah Tisdale, publiziert am 26. März 1812 in der Boston Gazette (Quelle: wikimedia) Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances aller schlimmen Gegenden Amerikas“, sagt er. Vor allem in den 1980er-Jahren. Nutten, Drogen, Gewalt. Wer hier groß wird, „lernt die Straße“, wie er sagt. Als er 15 war, ging Gonzalez in einen Blumenladen und bat um eine Putzstelle. Er blieb sechs Jahre, und am Ende verstand er das Geschäft besser als die Inhaber. Dann führte er einen Laden im Süden Manhattans, und als er auch dort nichts mehr lernen konnte, machte er sich selbstständig. Er belieferte die Premierenfeiern des Bezahlsenders HBO. „Sex and the City“, „The Sopranos“. [...] Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte aus der South Bronx, in der noch immer 40 Prozent der Menschen in Armut leben, wo fast jeder Zweite es nicht auf die High School geschafft hat, wo fast jeder Zweite Angst hat davor, die Miete nicht mehr bezahlen zu können und auf der Straße zu landen. [...] [S]eit der Wirtschaftskrise leben die Gebeutelten nicht mehr nur in den blauen Wahlkreisen, sondern auch in den roten. [...] „Wer in der Bronx aufwächst“, sagt Gonzalez, „der lernt schon in der Schule, dass die Demokraten für die Armen kämpfen und die Republikaner für die Reichen.“ Es ist ein Naturgesetz, es wird weitergegeben von einer Generation an die nächste, und Gonzalez wird es auch an seinen Sohn weitergeben. Demokrat oder Republikaner, das ist mehr als Parteizugehörigkeit, es ist Identität und Lebensgefühl. […] Nicolas Richter / Christian Wernicke „Du bist hier in meinem Land“, in: Süddeutsche Zeitung vom 5. November 2012 Politisches System der USA sen und politischen Kriterien, sie lassen sich dort nieder, wo sie Gleichgesinnte vermuten. Damit werden die Wahlkreise homogener. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Demokratischen oder Republikanischen „Inseln“ haben so noch weniger Möglichkeiten, sich im Alltag mit der Meinung anders Denkender auseinanderzusetzen, zumal viele auch aufgrund ihrer Berufswahl und ihres Medienkonsums in verschiedenen Welten leben. Diese beiden Entwicklungen, das politische gerrymandering und die gesellschaftliche Abgrenzung, haben dazu beigetragen, dass sich in den Vorwahlen immer mehr Kandidaten mit extremen Positionen durchgesetzt haben, weil sie nunmehr alles daran setzen mussten, den harten Kern der homogeneren eigenen Wählerschaft, die sogenannte Basis (base), anzusprechen und sich weniger um heterogenere und gemäßigtere Wählerschaften der Mitte bemühen müssen. Die so gewählten Repräsentanten sind bei ihrer Tätigkeit im Parlament dann auch gut beraten, extreme Positionen zu vertreten. Sie haben keine Anreize, in der Gesetzgebung die nötigen Kompromisse mit dem anderen Lager einzugehen, weil sie damit Gefahr laufen, bei der nächsten Vorwahl von einem parteiinternen Herausforderer angegriffen zu werden, der vorgibt, die Interessen des Wahlkreises kompromissloser zu vertreten. Die sogenannte Polarisierung, das Auseinanderdriften der Positionen in der politischen Auseinandersetzung im Abgeordnetenhaus, hat demnach auch strukturelle, im Wahlsystem und in der Gesellschaft angelegte Gründe. Präsidentschaftswahlen: die 50-50-Nation Hingegen ist bei den Präsidentschaftswahlen der Wettbewerb zwischen den beiden Parteilagern sehr viel härter. Die USA scheinen sich zu einer „50-50-Nation“ entwickelt zu haben. Seit den Wahlen von 1984, bei denen der Republikaner Ronald Reagan seinen Demokratischen Herausforderer Walter Mondale deklassierte, gab es keinen Sieger mehr, der viel mehr als 53 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Einige haben sogar mit weniger als der Hälfte der abgegebenen Stimmen (popular vote) gewonnen, so zwei Mal Bill Clinton (1992 und 1996) sowie George W. Bush (2000). Wenn man bedenkt, dass die Wahlbeteiligung in Gerhard Mester / Baaske Cartoons 32 Kongress: Konfrontation statt Kooperation Viele Europäer glauben an den Niedergang der Vereinigten Staaten – sie denken dabei an verrottete Infrastruktur, sozialen Zerfall und den am Ende unvermeidlichen Kollaps einer überanstrengten Militärmacht. Das ist eine irreführende Fantasie. Amerika kann immer noch viele Ressourcen für seine Zukunft mobilisieren – eine Spitzenforschung ohnegleichen, seine Attraktivität für Einwanderer aus aller Welt, eine dynamische Wirtschaft mit den führenden Konzernen der digitalen Ökonomie. Als Land sind die USA ziemlich stark. Aber auch als Staat? Die wirklichen amerikanischen Schwächen sind die zerrüttete politische Kultur und das funktionsschwache politische System, bis hin zur Gefahr der Regierungsunfähigkeit. Das Washingtoner Drama dieser Tage [im Januar 2013] um die „Fiskalklippe“ hat die Risiken gezeigt. […] Die Unversöhnlichkeit, die das Regieren in den USA inzwischen so schwer macht, ein Klima, in dem der Kompromiss als Verrat und die Halsstarrigkeit als prinzipienfeste Tugend gilt – von außen wirkt das wie der Gipfel der Irrationalität. Die Feindseligkeit folgt aber ihrer eigenen zerstörerischen Logik. Diese Logik hat eine ideologische Seite: die immer stärkere Polarisierung der amerikanischen Politik. Vor allem die Republikaner sind nicht mehr die breit aufgestellte Mitte-rechts-Partei, die sie lange waren. Die Republikaner von heute sind eine überzeugungsstarke, hochdisziplinierte Kampftruppe, die mit echter Inbrunst an ihren Doktrinen (von der Schrumpfung des Wohlfahrtsstaats bis zum Verbot der Schwulenehe) festhält. Bei den Demokraten ist die Ideologisierung weniger schrill, die parteiliche Sturheit aber ebenfalls beträchtlich; Zweifel am Segen des öffentlichen Dienstes oder an großzügigen Konjunkturprogrammen sind unter Linksliberalen weithin unerwünscht. Ihre eigentliche Brisanz bekommt die Polarisierung jedoch erst dadurch, dass sie sich auch machtpolitisch auszahlt. Mehr und mehr Abgeordnete stammen aus gleichsam einfarbigen Wahlkreisen, überwältigend republikanisch oder vorherrschend demokratisch; sie haben weniger den hoffnungslos unterlegenen Gegenkandidaten der anderen Partei zu fürchten als mögliche Herausforderer im eigenen Lager. Sie müssen nicht durch Kompromissfähigkeit um die po- litische Mitte werben, sondern durch Linientreue die Rechtgläubigen bei der Stange halten – eine Prämie auf Dogmatismus und Extremismus. […] Gehässige Polarisierung ist immer unschön. In den Vereinigten Staaten aber ist sie gefährlich. Denn stärker als die meisten politischen Systeme ist das amerikanische auf Kooperation und Überparteilichkeit ausgerichtet. Hier lässt sich nicht „durchregieren“: Der direkt gewählte Präsident und die ebenso direkt gewählten Abgeordneten bilden fast automatisch unabhängige, selbstständige Machtzentren; eine clubartig verfasste Parlamentskammer wie der Senat kann überhaupt nur funktionieren, wenn ihre Mitglieder miteinander auskommen und geschäftsfähig sind. Dass der Kongress im Angesicht der „Fiskalklippe“ immerhin einen Minimalkompromiss zustande gebracht hat, zeigt hoffentlich, dass die Vorräte an Staatsbürgersinn noch nicht ganz aufgebraucht sind. Aber die USA werden mehr, viel mehr davon brauchen. Und das selbst krisenbedrohte Europa muss zuschauen und die Daumen drücken. Jan Ross, „Unter Feinden“, in: DIE ZEIT Nr. 2 vom 3. Januar 2013 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances © picture-alliance / dpa-infografik, Globus 1904 den USA seit den 1970er-Jahren meistens unter 60 Prozent lag, häufig sogar nur etwa 50 Prozent betrug, kann sich jeder neu gewählte Präsident jeweils nur auf ein begrenztes Wählermandat von etwa einem Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung berufen. Es war also doch etwas befremdlich, als nach der knappen Wiederwahl Obamas, die aufgrund von Feinheiten des Wahlsystems deutlicher ausfiel als erwartet, in den Medien ein „erdrutschartiger Sieg“ (landslide victory) gefeiert wurde. Auf den Amtsinhaber Barack Obama fielen bei seiner Wiederwahl 2012 gut 51 Prozent der abgegebenen Stimmen, sein Herausforderer Mitt Romney erhielt etwas mehr als 47 Prozent. Die popular vote ist jedoch nicht wahlentscheidend. Denn sonst hätte bei der Wahl 2000 Al Gore gewonnen, als er insgesamt etwa 544 000 Stimmen mehr für sich verbuchen konnte als George W. Bush. Ausschlaggebend ist die Mehrheit im Wahlmänner- und Wahlfrauenkollegium (electoral college). Mit zwei Ausnahmen – Maine und Nebraska, die ihre Stimmen entsprechend den Mehrheiten in kleineren Einheiten (Wahlkreisen) auf beide Kandidaten verteilen – erhält der Gewinner eines Einzelstaates alle Wahlmännerstimmen, die dieser zu vergeben hat: „The winner takes it all“ lautet das Prinzip. Gewählt ist schließlich derjenige, der mindestens 270 Stimmen, also mehr als die Hälfte der zu vergebenden 538 Wahlmännerstimmen, erzielt. Bevölkerungsreiche Staaten zählen mehr als spärlich besiedelte: So entsendet Kalifornien 55, Montana dagegen nur drei Wahlmänner ins Kollegium. Letzten Endes ist jedoch weniger die Größe der Einzelstaaten als vielmehr ein anderes Kriterium von Bedeutung: Da aufgrund des bisherigen Wählerverhaltens viele Staaten ohnehin als vergeben anzusehen sind (zum Beispiel gehen die Wahlmännerstimmen Kaliforniens Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 33 * U.S. Electoral College, http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/historical.html und New Yorks regelmäßig an die Demokraten, die Stimmen von Texas an die Republikaner), sind nur einige hart umkämpfte Einzelstaaten (battleground states) wirklich wahlentscheidend. Das sind vor allem solche, die in der Vergangenheit zwischen den beiden Parteien hin- und hergependelt sind und deshalb auch als swing states bezeichnet werden. Während die meisten Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika von den Wahlkampagnen mehr oder weniger unbehelligt bleiben, konzentriert sich die Aufmerksamkeit und geballte Finanzkraft der Präsidentschaftskandidaten und der sie unterstützenden sogenannten externen Organisationen auf ein Dutzend hart umkämpfter Staaten: Florida (mit 29 Wahlmännerstimmen), Pennsylvania (20), Ohio (18), Michigan (16), North Carolina (15), Virginia (13), Wisconsin (10), Iowa (6), Colorado (9) Nevada (6), New Mexico (5) und New Hampshire (4). Um aussagekräftige Prognosen zu gewinnen, sollte man sich daher weniger – wie in Deutschland üblich – auf nationale Umfragen stützen, sondern auf jene Einzelstaaten konzentrieren, die letzten Endes ausschlaggebend sind. Geteilte Regierung Was viele auch nicht auf dem (Fernseh-)Schirm haben, die nur alle vier Jahre das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Präsidentschaftskandidaten verfolgen: Mindestens genauso wichtig wie der Wettkampf um das Weiße Haus sind die Kongresswahlen. 435 Sitze im Abgeordnetenhaus und ein Drittel des 100-köpfigen Senats stehen alle zwei Jahre zur Wiederwahl. Mit den Zwischenwahlen, das heißt den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Senat, die nicht mit den Präsidentschafts- Politisches System der USA wahlen zusammenfallen und somit zwei Jahre nach Beginn der Amtszeit des Präsidenten stattfinden, können die Wählerinnen und Wähler den Spielraum der Exekutive einmal mehr in ihrem Sinne beeinflussen: indem sie dem Präsidenten zu Mehrheiten seiner Partei in beiden Kammern des Kongresses, also zu einem unified government, verhelfen, oder aber ihn durch ein divided government hemmen. Bei dieser Konstellation wird mindestens eine Kammer des Kongresses von der anderen Partei kontrolliert. Ob die Wählerinnen und Wähler bei ihrer Entscheidung wirklich die Gewaltenkontrolle im Sinn haben, ist jedoch fraglich. Vielmehr dürften sie ihre Abgeordneten und Senatoren nach ihren Fähigkeiten und Leistungen beurteilen, um so die wirtschaftliche und soziale Lage in ihrem Wahlkreis bzw. Einzelstaat zu verbessern – nach Kriterien also, die die Wählerschaft unmittelbar persönlich betreffen. Die Wahlen 2008, 2010, 2012: It’s the Economy, Stupid! Barack Obama wurde 2008 nicht zum Präsidenten gewählt, weil er als der stärkere Oberbefehlshaber galt, sondern weil man ihm eher als seinem Herausforderer (und Irakkiegsbefürworter) Senator John McCain zutraute, das Land aus der größten Wirtschafts- und Finanzkrise seit den 1930er-Jahren zu führen. Mit der kritischen Wirtschaftslage rückten die Kriegsschauplätze im Globalen Krieg gegen den Terror, insbesondere im Irak und in Afghanistan, in der Wahrnehmung der meisten US-Amerikaner in weite Ferne. Anders als noch bei der vom Sicherheitsthema dominierten Wiederwahl George W. Bushs trieben im Wahlkampf 2008 nunmehr die Sorgen um die hohen Energiepreise und die prekäre wirtschaftliche Situation die USWählerinnen und -Wähler um. Weitaus häufiger als außenpolitische Themen wie Irak oder Terrorismus wurden in Meinungsumfragen innenpolitische Belange wie Wirtschaft, Ausbildung, Arbeitsplätze, Gesundheitsfürsorge, Energie und soziale Sicherung als ausschlaggebend für das Abstimmungsverhalten im November 2008 genannt, wie eine Umfrage des Pew Research Center, zitiert in: CQ Weekly vom 9. Juni 2008 (S. 1512), ergab. Differenzierte Analysen im Vorfeld der Wahlen zeigten, dass jene Wähler, denen Wirtschaftsthemen am wichtigsten waren, den designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Senator Barack Obama, klar dem Bewerber der Republikaner, Senator John McCain, vorzogen (Friedl und Gilbert 2008). Angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage und der akuten oder drohenden Arbeitslosigkeit fühlten sich Angehörige der amerikanischen Mittelschicht besonders verunsichert. Wie 1992 Bill Clinton konnte 2008 Barack Obama die prekäre soziale und wirtschaftliche Lage bei den Präsidentschaftswahlen in einen politischen Vorteil ummünzen. Obama sensibilisierte die mittleren und unteren Einkommensschichten für wirtschaftspolitische Themen und mobilisierte nicht zuletzt auch Minderheiten, sprich afroamerikanische und hispanische Wähler, für seine wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele. Aus gutem Grund: Laut den offiziellen Statistiken des U.S. Department of Commerce (zitiert in: U.S. Census Bureau 2011, S. 14 f.) lebt ein Drittel der Afroamerikaner und Latinos unterhalb der Armutsgrenze. Sie sind von „Nahrungsmittelunsicherheit“ betroffen, wie es im sozialstatistischen Sprachgebrauch beschönigend heißt. Mit anderen Worten: Sie leiden Hunger, ja sie können sogar ihre Kinder nicht mehr richtig ernähren. Vonseiten der afroamerikanischen Bevölkerung hat Obama laut der Zeitschrift The Economist vom 6. November 2008 denn auch 95 Prozent der Stimmen erhalten. Ebenso konnte er bei der mittlerweile größten Minderheit, den Latinos, den Wähleranteil der Demokraten merklich erhöhen. Obama gewann über zwei Drittel der Stimmen hispanischer Wähler, die in vielen battleground states wie Florida, New Mexico und Colorado den Ausschlag gaben. Das Erfolgsrezept war einfach: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!“, könnte man es mit Bertolt Brechts Worten auf den Punkt bringen. Die Demokraten verstanden, dass in prekären Zeiten moralische Themen zweitrangig sind und es zunächst um das nackte wirtschaftliche Überleben, um Arbeitsplätze oder soziale Leistungen geht. Dabei gelang es Obamas Wahlkämpfern, den auf sexualmoralische Themen wie Abtreibung und Homoehe fixierten Christlich Rechten und Republikanern eine alternative Deutung von „moral issues“ entgegenzuhalten: Neue Graswurzelorganisationen der religiösen Linken haben im Sinne der katholischen Soziallehre auch Armutsbekämpfung, Bildung, Krankenversicherung und Alterssicherung als moralische Themen definiert. Seit seiner Amtsübernahme im Januar 2009 steht Präsident Obama nunmehr in der Pflicht, zu handeln und seine Thomas Plaßmann / Baaske Cartoons 34 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances 35 © Bergmoser + Höller Verlag AG, Zahlenbild 855 214 wirtschafts- und sozialpolitischen Versprechen einzulösen. Teilweise bereits mit Erfolg: Anders als sein Demokratischer Vorgänger Bill Clinton (1993-2001) und die damals in diesem Politikfeld federführende First Lady Hillary Clinton, die an einer umfassenden Gesundheitsreform scheiterten, gelang es Präsident Obama, dem Kongress eine Jahrhundertreform abzuringen. Unter anderem konnte er durchsetzen, dass den 45 Millionen bis dato nicht bzw. den 16 Millionen unterversicherten (Klein 2007) US-Amerikanern eine Krankengrundversicherung gewährt wird. Seit den Kongresswahlen 2010 ist jedoch seine Handlungsfähigkeit enorm eingeschränkt. Auch bei den Zwischenwahlen im November 2010 – bei denen nicht der Präsident, sondern der Kongress, sprich alle 435 Repräsentanten des Abgeordnetenhauses und ein „Drittel“ (37) der Senatoren zur Wahl standen – gab die prekäre wirtschaftliche Lage den Ausschlag. Sechs von zehn Wählern (62 Prozent) erklärten in den Umfragen unmittelbar nach dem Wahlgang laut den exit polls des Nachrichtensenders CNN vom 3. November 2010, dass wirtschaftliche Probleme ihre Hauptmotivation waren, gefolgt von der umstrittenen Gesundheitsreform (18 Prozent) und der illegalen Einwanderung (8 Prozent). Außenpolitik blieb außen vor: Nur acht Prozent der US-Bevölkerung hat der Krieg in Afghanistan umgetrieben. Da eine schnelle Besserung der US-Wirtschaft in den vergangenen Jahren ausgeblieben war, verloren die Demokraten das Abgeordnetenhaus an die Republikaner und sechs Sitze im Senat. Damit hatten sie zwar noch die einfache Mehrheit in dieser zweiten Kammer des Kongresses verteidigt, aber die qualifizierte Mehrheit (von 60 Stimmen) verfehlt, die nötig ist, um Blockademanöver (filibuster) abzuwenden. Im Präsidentschaftswahlkampf 2012 waren wirtschaftliche und soziale Themen einmal mehr wahlentscheidend. Selbst in der für außenpolitische Themen angesetzten dritten Fernsehdebatte kamen Amtsinhaber Obama und sein Herausforderer Mitt Romney sehr schnell auf die inneren, sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der Weltmacht zu sprechen. Beide wollten sich dafür einsetzen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Doch während Obama in Aussicht stellte, mehr Geld für Bildung und Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Sozialausgaben in die Hand zu nehmen und dafür den Verteidigungsetat zu kürzen, versprach Romney, die Gesundheitsreform Obamas rückgängig zu machen, Sozialleistungen zu kürzen und die enormen Militärausgaben beizubehalten. Als Amtsinhaber, dem in den zurückliegenden vier Jahren keine Verbesserung der nach wie vor prekären wirtschaftlichen Entwicklung gelungen war, war Präsident Obama bestrebt zu verhindern, dass sein Gegner aus der Wahl ein Referendum über die wirtschaftliche Situation machte. Denn kein Präsident seit Franklin D. Roosevelt war (bisher) wiedergewählt worden, wenn er eine derartig schlechte wirtschaftliche Lage zu verantworten hatte. Deshalb schärfte Obama sein Profil als ehemaliger Sozialarbeiter, der sich auch als Politiker um jene kümmert, die durch die anhaltende Wirtschafts- und Finanzkrise sozial umso mehr beeinträchtigt wurden. Mit einer heftigen Negativkampagne, die mit großem Risiko und hohen Kosten verbunden war, wurde der Herausforderer Romney sehr früh attackiert, als er, vom Vorwahlkampf noch geschwächt und finanziell fast ausgebrannt, versuchte, zu Beginn des Hauptwahlkampfes gegen Obama inhaltlich wieder in die politische Mitte zu rücken. Romney wurde als eiskalter Wirtschaftsmanager stigmatisiert, der, abgehoben von den Sorgen und Bedürfnissen der einfachen Wählerinnen und Wähler, nur das große Geld im Sinn habe. Die Obama-Strategen widerstanden dabei der Versuchung, Romney – so wie zuvor seine parteiinternen Widersacher im Vorwahlkampf – als Wendehals (flip flopper), der häufig seine politischen Überzeugungen wechselt, zu brandmarken. Schließlich hatte Romney als Gouverneur des liberalen Einzelstaates Massachusetts durchaus sozialverträglich regiert und hätte das auch als Präsident weiterführen können. Das Stigma des abgehobenen Finanzhais blieb an Romney haften, zumal dieser den Demokraten auch noch den Gefallen tat, in einer heimlich vom Obama-Team mitgeschnittenen Rede für Finanziers seines Wahlkampfes „47 Prozent“ der Wählerinnen und Wähler als Sozialschmarotzer abzuschreiben, um die er sich als Kandidat ohnehin nicht zu bemühen brauche. 36 Politisches System der USA Wahlentscheidende Faktoren bei den Präsidentschaftswahlen 2012 Anteil (in %) der Wähler ObamaWähler Anteil der Gesamtstimmen RomneyWähler Die Ergebnisse der Wahlen, insbesondere ihre differenzierte Analyse, sprachen für den Erfolg der Obama-Strategie. Wähler mit niedrigerem Einkommen, die das bestehende Wirtschaftssystem als ungerecht empfanden, stimmten mehrheitlich für Obama. Er verdankte seine Wiederwahl insbesondere den sozial benachteiligten Hispanics (die auch als Latinos bezeichnet werden) und den afroamerikanischen Wählerinnen und Wählern. Die Minderheiten machen mittlerweile knapp ein Viertel der Wählerschaft aus und bildeten einmal mehr einen geschlossenen Wählerblock für Obama. Ob Obama die prekäre soziale Lage in seiner zweiten Amtszeit verbessern kann, bleibt jedoch fraglich. Bereits vor der Wahl im November 2012 war abzusehen, dass auch der nächste Präsident wieder mindestens von einer Kammer des Kongresses blockiert werden würde: entweder Romney durch den Senat oder Obama weiterhin von der Republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die Ergebnisse der Kongresswahlen bestätigten die Prognosen mehr oder weniger unveränderter Mehrheitsverhältnisse und zementierten damit den bestehenden Politikstau (gridlock). Künftig werden die Grabenkämpfe zwischen Präsident und Kongress wohl noch heftiger, weil sich beide, der Demokrat Obama und die Republikaner im Kongress, durch ihr neues Wählermandat in ihrer bisherigen politischen Konfrontationshaltung bestätigt fühlen. Nicht einmal beim Thema Einwanderungsreform konnte bislang eine Einigung erzielt werden, obwohl es unter den Konservativen bereits einige Vordenker wie den Kolumnisten David Brooks gibt, der die Blockadehaltung der Republikaner bei der Einwanderungsreform im Hinblick auf künftige Wahlen als „politischen Selbstmord“ bezeichnet. 50 48 47 53 45 55 52 44 Ethnische Zugehörigkeit Weiße Afroamerikaner Hispanics Asiaten 72 13 10 3 39 93 71 73 59 6 27 26 Alter 18-29 Jahre alt 30-44 45-64 65 und älter 19 27 38 16 60 52 47 44 37 45 51 56 Parteiidentifikation Republikaner Demokrat Unabhängige 32 38 29 6 92 45 93 7 50 Familieneinkommen (2011) Weniger als 50 000 Dollar 50 000 bis 99 999 100 000 und mehr 41 31 28 60 46 44 38 52 54 Finanzielle Lage der Familie im Vergleich zu vor vier Jahren Besser Schlechter Gleich 25 33 41 84 18 58 15 80 40 Wichtigstes Thema/Problemfeld Außenpolitik Haushaltsdefizit Wirtschaft Gesundheitsversorgung 5 15 59 18 56 32 47 75 33 66 51 24 Größtes, einen persönlich betreffendes Wirtschaftsproblem Immobilienmarkt Arbeitslosigkeit Steuern Steigende Preise 8 38 14 37 63 54 32 49 32 44 66 49 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Exzellent oder gut Nicht so gut oder schlecht 23 77 90 38 9 60 Ausblick: Die Weißen in der Minderheit Erwartung der wirtschaftlichen Entwicklung Wird besser Wird schlechter Bleibt gleich 39 30 29 88 9 40 9 90 57 Hat mehr Wirtschaftskompetenz Barack Obama Mitt Romney 48 49 98 4 1 94 Wirtschaftssystem Begünstigt die Wohlhabenden Ist gerecht 55 39 71 22 26 77 Steuererhöhungen, um Haushaltsdefizit zu reduzieren Ja Nein 33 63 73 37 24 61 Bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen 2016 werden die nächsten Demokratischen und Republikanischen Spitzenkandidaten ihre persönliche Partei-Plattform festlegen. Schon lange Zeit vor dem eigentlichen Wahlkampf gilt es für die Aspiranten, Spenden zu sammeln und ein Netzwerk von Unterstützern zu knüpfen. Dabei wären auch die Wahlkämpfer der Republikaner gut beraten, bereits im Vorwahlkampf endlich die Latinos als wichtige Wählergruppe zu berücksichtigen. Der vorläufig letzte Republikanische Präsident, George W. Bush, erzielte ein überdurchschnittlich gutes Wahlergebnis bei der hispanischen Bevölkerung, weil er diese in religiöser Hinsicht und in ihrer Muttersprache anzusprechen wusste. Die (vorläufig) letzten beiden Verlierer, John McCain und Mitt Romney, waren in ihrer vorherigen politischen Karriere als Senator bzw. Gouverneur zwar durchaus liberal eingestellt, insbesondere in der Einwanderungsfrage. Um sich jedoch im Vorwahlkampf gegen ihre teilweise chauvinistisch argumentierenden Herausforderer durchsetzen zu können, mussten sie ihrerseits extremere Positionen einnehmen und schmälerten damit im Hauptwahlkampf ihre Siegeschancen. Die hispanischen Wähler werden demografisch bedingt immer wichtiger, zumal sie auch in hoher Konzentration in den für Wahlsiege ausschlaggebenden Einzelstaaten leben. Bereits bei der Wahl 2012 haben Romneys enorme 20 Prozentpunkte Vorsprung vor Obama bei weißen Wählern nicht genügt, um die Hausmacht des amtierenden Präsidenten bei den Wählerinnen und Wählern aus den ethnischen Minderheiten, der Geschlecht Männer Frauen Weniger als 100 = keine oder andere Angabe. Exit Polls des National Election Pool 2012 Sitzverteilung im US-Kongress, 113. Legislaturperiode, seit 3.1.2013; Stand: Dezember 2013 Abgeordnetenhaus Senat Republikaner 232 45 Demokraten 201 53 – 2 (beide stimmen regelmäßig mit den Demokraten ab) Unabhängige Vakante Sitze* Gesamt 2 – 435 100 * Vorzeitig ausgeschiedene Abgeordnete werden noch durch Nachwahlen besetzt. United States Congress Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 AP Photo / The Mountain Press, Curt Habraken Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances AP Photo / Julie Fletcher Wahllokal in Sevierville, Tennessee, 2012. Der Anteil der älteren weißen Wähler, die traditionell eher den Republikanern ihre Stimme geben, sinkt, … … während die hispanische Minderheit, die bisher eher die Demokratischen Präsidentschaftsbewerber unterstützt hat, weiter wächst. Wahlplakat im Lechonera El Barrio Restaurant in Orlando, Florida, 2012 hispanischen und afroamerikanischen Bevölkerung, auszugleichen. Ein Blick auf die demografische Entwicklung in den USA könnte die Wahlstrategen der Republikaner wachrütteln. Demnach werden die weißen Wähler, die 1960 noch 85 Prozent der Bevölkerung ausmachten, voraussichtlich schon 2050 in der Minderheit sein. Die bislang als „ethnische Minderheiten“ (ethnic minorities) bezeichneten Afroamerikaner, Asiaten und Latinos werden die Mehrheit bilden, den größten Teil davon, etwa ein Drittel, werden die Latinos stellen, so Paul Taylor und D’Vera Cohn vom Pew Research Center 2012. Während die afroamerikanischen Wählerinnen und Wähler auf absehbare Zeit in der Wählerkoalition der Demokraten bleiben dürften, haben die Republikaner künftig durchaus Chancen, den Demokraten ihre Dominanz bei der hispanischen Wählerschaft streitig zu machen. Bislang standen sie aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen den Demokraten näher, doch mithilfe religiöser Faktoren könnten die Republikaner künftig an Boden gewinnen. Latinos sind die am schnellsten wachsende Minderheit in den USA und haben bereits die Afroamerikaner als größte ethnische Minderheit in den Vereinigten Staaten abgelöst. Laut Angaben des Pew Hispanic Center vom 14. November 2012 machen die 53 Millionen Menschen lateinamerikanischer Herkunft derzeit rund 17 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, Tendenz steiInformationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 37 gend. Viele von ihnen dürfen, unter anderem aus Altersgründen, noch nicht wählen. Zudem beteiligen sich aus den Reihen der wahlberechtigten Latinos prozentual weniger Menschen an den Wahlen als aufseiten der afroamerikanischen und der weißen Bevölkerung. Doch der „schlafende Riese“ ist erwacht; der Anteil der Hispanics an der Wählerschaft dürfte sich laut den Berechnungen der Forscher des Pew Hispanic Center schon im Jahr 2030 von zehn (2012) auf 20 Prozent verdoppeln. (An Awakened Gigant: The Hispanic Electorate is Likely to Double by 2030) Aufgrund ihrer zunehmenden Beteiligung am politischen Geschehen können sie auch heute schon beachtlichen politischen Einfluss ausüben. Zwar ist ihr Anteil an der Gesamtwählerschaft verhältnismäßig klein, doch das US-Wahlsystem ermöglicht ihnen eine politische Hebelwirkung: In einigen hart umkämpften Bundesstaaten, die den Ausschlag für Sieg oder Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen geben können, ist der Anteil hispanischer Wähler relativ groß: in New Mexiko waren es 2012 37 Prozent, in Arizona und Nevada jeweils 18, in Florida 17 und in Colorado 14 Prozent. Und sie haben jeweils mit überwältigender Mehrheit für Obama gestimmt. (http://www.pewhispanic.org/2012/11/07/latino-voters-in-the2012-election/) Zwar ist der Großteil der Latino-Wählerschaft schon längere Zeit den Demokraten zugeneigt, doch während der letzten Dekade hat sich die traditionelle Verbundenheit etwas gelöst. 2000 gelang es dem Republikaner George W. Bush, 35 Prozent der hispanischen Wählerinnen und Wähler zu gewinnen; bei seiner Wiederwahl 2004 konnte er den Anteil sogar auf die Rekordmarke von 40 Prozent steigern. Doch bereits bei den Zwischenwahlen (nur Kongresswahlen) 2006 verringerte sich das Ergebnis wieder auf 28 Prozent, weil die Republikaner einen Drahtseilakt zu meistern hatten. Einerseits versuchten sie, hispanische Wähler mit einer liberalen Einwanderungspolitik anzusprechen und Wirtschaftsliberalen entgegenzukommen, die an billigen Arbeitskräften (vor allem in der Gastronomie, Baubranche und Landwirtschaft) interessiert sind. Aber andererseits riskierten sie damit, sicherheitsorientierte und teilweise auch chauvinistische Gruppen der konservativen Parteibasis zu verprellen. Der von Bush mit Nachdruck unterstützte Reformvorschlag sah vor, zum einen die Grenzen besser zu sichern und zum anderen den Arbeitsmigranten ohne gültige Aufenthaltserlaubnis Legalisierungsoptionen anzubieten. Doch Bush scheiterte mit seiner parteiübergreifenden Initiative – nicht nur an gewerkschaftsnahen Abgeordneten der Demokraten, sondern auch am harten konservativen Kern seiner eigenen Partei. Widerstand gegen die sogenannte Amnestie wurde nicht zuletzt von konservativen Graswurzelorganisationen mobilisiert. Für die republikanischen Bewerber um Bushs Nachfolge war es demnach schwierig, das Vertrauen der Latino-Wählerschaft zurückzugewinnen. Zwar hatte sich John McCain – mit Blick auf das Wählerpotenzial der Latinos – in seiner Funktion als Senator für ein liberales Einwanderungsrecht stark gemacht. Doch nach heftigem Widerstand seiner Parteibasis versicherte McCain reumütig, dass er der Einwanderungsreform nur dann zustimmen werde, wenn die Grenzen gesichert seien. Ebenso musste sich Mitt Romney vier Jahre später im Vorwahlkampf auf einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik festlegen, der ihn dann im Hauptwahlkampf bei hispanischen Wählern merklich Punkte kostete. Von dieser Situation konnte der Demokrat Barack Obama bei beiden Wahlen profitieren. Langfristig machen sich die Wahlstrategen der Republikaner aber durchaus berechtigte Hoffnungen, mehr hispani- Politisches System der USA Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images 38 Bei Wahlen gilt die Faustregel: Je häufiger die Gläubigen einen Gottesdienst besuchen, desto eher wählen sie Republikanische Kandidaten. Studierende eines auf Theologie spezialisierten Colleges in Haverhill, Massachusetts, 2012 beim Gebet sche Wählerinnen und Wähler gewinnen zu können, zumal diese sehr religiös sind. Zwar haben bislang soziale und wirtschaftliche Gründe den Ausschlag für deren Hinwendung zu den Demokraten gegeben. Aber eine günstigere allgemeine Wirtschaftslage und ein verbesserter sozioökonomischer Status von Latinos könnte künftig die Grundlage dafür bilden, dass hispanische Wähler – wie die meisten US-Amerikaner – ihre Wahlentscheidung aufgrund ihrer religiösen Einstellung treffen. Mittlerweile gilt die Faustregel: Je häufiger US-Amerikaner den Gottesdienst besuchen, desto eher wählen sie einen Kandidaten der Republikaner. Evangelikale Latinos sind dafür aufgeschlossener als katholische. Während erstere es als gottgegeben hinnehmen, dass jeder selbst „schuld“ an seiner Armut ist, halten es die zweiten eher mit der katholischen Soziallehre, wonach mit sozialer Hilfestellung die Menschen zum Besseren bekehrt werden sollen. Während sich in der politischen Debatte katholische Bischöfe schon seit längerem für die Einwanderer aus Lateinamerika stark gemacht haben, werden die sozialen Belange von Einwanderungsfamilien nunmehr auch von evangelikaler Seite professionell vertreten, etwa durch die National Hispanic Christian Leadership Conference, einem organisatorischen Ableger der einflussreichen National Association of Evangelicals. Der evangelikale Einfluss nimmt zu, weil auch immer mehr katholische Latinos sogenannte Erweckungserlebnisse haben und ins Lager der „wiedergeborenen“ Glaubensgemeinde konvertieren. Bereits 2007 bezeichneten sich vier von zehn Latino-Christen als „born again“ oder „evangelikal“ (Pew 2007, S. 8). Die Demokraten haben ihr strukturelles Defizit bei der religiösen Wählerschaft erkannt und versuchen ihrerseits, „moralische Werte“ im Wahlkampf stärker zur Geltung zu bringen, indem sie, über sexualmoralische Themen hinausgehend, „moral values“ breiter interpretieren und neben Umweltschutz auch Armutsbekämpfung als moralisches Thema deuten. So wollen sie in der Umweltpolitik „Gottes Schöpfung bewahren“, und der ehemalige „Sozialhelfer“ (community organizer) Barack Obama hat auch die von George W. Bush initiierte „faith based initiative“ befürwortet, in deren Rahmen Kirchen mit staatlichen Mitteln soziale Dienstleistungen erbringen. Innen- und machtpolitisch bleibt demnach höchst relevant, wer letztendlich die Deutungshoheit über „moralische Werte“ gewinnt. Wahlkämpfe: Finanzierung und Mobilisierung Nach der Wahl ist vor der Wahl. Im sogenannten permanenten Wahlkampf müssen 435 Abgeordnete und ein Drittel der 100 Senatoren einmal mehr schier unvorstellbare Geldsummen einwerben, um ihre Wiederwahl im November 2014 zu sichern. Ebenso sind die Bewerber um die Präsidentschaft immer wieder angehalten, neue Rekorde bei der Einwerbung von Spenden zu brechen. Damit sind Politiker in den USA sehr offen für die „Kommunikation“ der Interessengruppen geworden, zumal die Obersten Richter finanzielle Zuwendungen im Wahlkampf wiederholt als Ausdruck der Meinungsfreiheit (freedom of speech) interpretiert haben, die nicht gesetzlich reglementiert werden dürfe. Als der Supreme Court 1976 im Fall Buckley v. Valeo die gesetzliche Regelung der Politikfinanzierung (die Wahlkampfspenden und die Ausgaben der Kandidaten begrenzt hätte) wegen Einschränkung der persönlichen Meinungsfreiheit für verfassungswidrig erklärte, wurde die rechtliche und institutionelle Position von Partikularinteressen entscheidend aufgewertet. Die spezifische US-amerikanische Interpretation der freedom of speech bedeutet zum einen, dass Meinungen und Interessen bestimmter Gruppen mehr Gehör finden als die anderer. Es wird zum anderen auch zunehmend schwierig, in dem immer größer werdenden Chor von political action committees (PACs), Super PACs, Wirtschaftsvertretern, Interessengruppen und betuchten Privatleuten die Stimme der politischen Parteien herauszuhören. Seitdem der Supreme Court am 21. Januar 2010 im Fall Citizens United v. Federal Election Commission einmal mehr den ersten Verfassungszusatz der Meinungsfreiheit hochhielt, sind alle Dämme gebrochen. Der infolge des Skandals um die Bilanzfälschungen und politischen Verbindungen des Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Ausgaben im Präsidentschaftswahlkampf 2012 Ausgaben (in US-Dollar) Blue Team Demokraten Red Team Republikaner Kandidaten (Obama / Romney) 683 546 548 433 281 516 Nationale Parteiorganisationen 292 264 802 386 180 565 131 269 587 418 610 490 1 107 080 937 1 238 072 571 Externe Gruppierungen Gesamtausgaben www.opensecrets.org/pres12/ Wahlen als big business Paul Wilson [...] ist ein Campaign Consultant, einer jener Berater und Helfer im Hintergrund, die Politikern zum Wahlerfolg verhelfen. […] Wahlen in den USA sind Big Business. [...] Der Kampf um die Präsidentschaft erhält dabei die meiste Aufmerksamkeit, aber er stellt nur die Spitze des Eisbergs dar. Alle zwei Jahre wird über die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses und des Senats abgestimmt, Hunderte von Volksvertretern werden dann gewählt [...]. Zudem wählt jeder Bundesstaat sein Repräsentantenhaus sowie Senatoren, dazu einen Gouverneur. Viele Ämter und Positionen, die in Deutschland von Beamten besetzt werden, sind in Amerika Wahlämter – vom Sheriff über den Richter und Staatsanwalt bis hin zum Vorsitzenden des Schulbezirksvorstands. Mehr als eine Million Abstimmungen finden über eine Legislaturperiode von vier Jahren in den USA im Schnitt statt. Lokale Kandidaten setzen nach wie vor auf bewährte Mittel: Sie organisieren Bürgertreffen, knabbern gegrillte Maiskolben auf der Kirmes der County Fair und schütteln Hände in Seniorenheimen. Ihre Kampagnen leben vom Einsatz von Freiwilligen, die meisten Mittel kommen von Familie und Freunden. Doch wer höhere Ambitionen hat – egal, ob für ein Amt im Bundesstaat oder in Washington –, der kommt um Profis wie Wilson nicht mehr herum. [...] texanischen Energiehandelsunternehmens Enron im März 2002 verabschiedete Bipartisan Campaign Reform Act wurde in seinen wesentlichen Bestimmungen wieder aufgeweicht. Die gesetzliche Regulierung, die sogenannte unabhängige Ausgaben (independent expenditures) sowie Themen- und Anzeigenkampagnen (electioneering communication) von Unternehmen, Gewerkschaften und auch gemeinnützigen Organisationen einschränkte, wurde für verfassungswidrig erklärt. Das Center for Responsive Politics schätzt die Ausgaben der „non-party outside groups“ im Wahlkampf 2012 auf über eine Milliarde Dollar. Freilich dürfen diese sogenannten externen Organisationen ihre Aktivitäten nicht mit den Kandidaten koordinieren, wenn sie etwa in Schlammschlachten deren Gegner mit Negativ-Anzeigenkampagnen (negative ads) überziehen. Doch wer will das kontrollieren, bei der Vielzahl interessierter Akteure, die electioneering communication betreiben? Selbst die nachprüfbaren Zuwendungen – sowohl für die Präsidentschaftswahlkämpfe als auch für die Kongresswahlen – haben mittlerweile astronomische Höhen erreicht. Barack Obama hat im Präsidentschaftswahl- Schon ein Bewerber für den US-Senat muss mit Ausgaben von mindestens acht Millionen Dollar rechnen, um Aussichten auf Erfolg zu haben. Dafür heuert er eine ganze Reihe von Experten an. Ein Manager, der die Organisation führt, gehört genauso dazu wie ein Medienstratege, ein Marktforscher und ein Fachmann für Briefwurfsendungen. Spezialisten kümmern sich ums Redenschreiben, um den Internetauftritt und die Konkurrenzbeobachtung – etwa wenn es gilt, belastende Informationen über den Gegner zu finden. Der Kandidat braucht Fernsehproduzenten, Redakteure, Buchhalter und Anwälte. Ein solches Team ist nicht billig: Die Mehrheit der Politikberater verdient mehr als 100 000 Dollar im Jahr, so die Studie eines Instituts der American University in Washington. Wer in der Top-Liga spielt, kann bis zu 500 000 Dollar und mehr verlangen. [...] Mit den Super Pacs [das sind Spendenpools, die unabhängig von Partei oder Kandidaten eine Kampagne organisieren – Anm. d. Red.] ist eine neue Ära der amerikanischen Demokratie angebrochen. Entstanden sind sie infolge des Urteils im Fall Citizens United, einer der umstrittensten Entscheidungen des US Supreme Court, des obersten USGerichts. Die Richter hoben Anfang 2010 ein Verbot auf, das Unternehmen und Gewerkschaften bis dahin direkte politische Spenden untersagt hatte. Zuvor konnten lediglich einzelne Mitarbeiter und Mitglieder spenden. Ein Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 39 weiteres Gerichtsurteil hob Beschränkungen der Spendensummen auf, solange sie nicht direkt in die Kasse der Partei oder des Kandidaten fließen. [...] Die neuen Super Pacs dürfen, im Ge gensatz zu den Kandidaten selbst, Geld in unbegrenzter Höhe einsammeln – etwa von Superreichen und Großkonzernen. Einzige Bedingung: Die SuperPac-Strategen dürfen sich nicht direkt mit dem Kandidaten abstimmen. [...] Prinzipiell können Super Pacs für oder gegen alles Stimmung machen, ob für Umweltschutz oder gegen Schusswaffen. [...] „Die Super Pacs sind fast ausschließlich negativ, sie richten sich in der Regel gegen den Rivalen“, gesteht Wilson. Das habe zum Teil auch praktische Gründe. Weil sein Team keinen direkten Zugang zum Kandidaten hat, gibt es wenig positives Material. „Wir dürfen kein Video mit unserem Kandidaten drehen – das wäre Absprache.“ [...] Vor allem verfügen viele Super Pacs über enorme Summen. [...] Viele Kritiker fürchteten nach der Gerichtsentscheidung, dass vor allem große Unternehmen die Super Pacs sponsern würden. Doch bisher waren es vor allem private Spender [...], die ihre Privatschatullen öffneten. [...] Heike Buchter, „Die Dreckschleuder AG“, in: DIE ZEIT Nr. 27 vom 28. Juni 2012 40 Politisches System der USA Die Veränderungen der Kommunikationsbeziehungen gingen einher mit dem Wandel der USA von einer Agrar- über eine Industrie- hin zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Neue Verkehrs- und Kommunikationswege erhöhten nicht nur die physische, sondern auch die soziale Mobilität der Menschen und damit auch die Dynamik in der politischen Parteienlandschaft. Eine der Hauptursachen für die Verluste der Demokratischen Partei ist die Auflösung von Roosevelts „New Deal“Koalition. Sie hatte bis in die 1960er-Jahre Bestand und umfasste neben Katholiken, Juden, afroamerikanischen und (liberalen) Mainline-Protestanten auch (konservative) Evangelikale, insbesondere in den Südstaaten. Ausschlaggebend war vor allem die Umorientierung evangelikalprotestantischer, teilweise auch katholischer Wählerinnen und Wähler von der Demokratischen zur Republikanischen Partei. Diese Umorientierung bei zentralen Wählergruppen, das sogenannte dealignment, war in den Südstaaten sehr ausgeprägt. Die Umorientierung hatte mehrere Beweggründe: Zum einen setzte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Binnenmigration ein. Teile der afroamerikanischen Landbevölkerung des Südens suchten Arbeit im industrialisierten Nordosten des Landes. Umgekehrt kamen viele Weiße im Zuge der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung in den Süden. Aus Protest gegen den Civil Rights Act von 1964 wechselten zahlreiche „Dixiecrats“, konservative Südstaaten-Demokraten, die sich für Rassentrennung stark machten, ins Lager der Republikaner. Das Abtreibungsurteil des Obersten Gerichts im Fall Roe v. Wade (1973), die Infragestellung der Steuerbegünstigung christlicher Schulen (1978) sowie das politische Engagement der Feministinnen und der Schwulenbewegung brachte all jene Christlich Rechten auf den Plan, die die traditionellen Werte (family/moral values) gefährdet sahen. Die Republikanische Partei konnte in den letzten Jahrzehnten starke Zugewinne im „Bible Belt“ (Region im Süden der USA, in der der evangelikale Protestantismus am stärksten verbreitet ist) verzeichnen. Die Hochburgen der Evangelikalen befinden sich heute in ländlichen Gegenden des Südens und Teilen des Mittleren Westens. „Wenn die Republikanische Partei konservative religiöse Wähler benötigt, so gilt auch umgekehrt: Evangelikale, Sozial-/Moralkonservative T.J. Kirkpatrick / Bloomberg via Getty Images T.J. Kirkpatrick / Bloomberg via Getty Images kampf 2012 erneut alle Rekorde gebrochen. Der Amtsinhaber, der ebenso wie sein Herausforderer Mitt Romney im Hauptwahlkampf auf staatliche Gelder (matching funds) verzichtete, musste sich nicht an Obergrenzen halten, die ihm sonst gesetzt gewesen wären. (Obergrenzen für Kandidaten sind in den USA nur dann mit dem Recht auf Meinungsfreiheit vereinbar, wenn sie aufgrund von Anreizen wie staatlichen matching funds freiwillig akzeptiert, sprich erkauft werden.) Obama konnte somit im Vor- und Hauptwahlkampf insgesamt mit etwa 700 Millionen Dollar wuchern. Rechnet man noch die Ausgaben von externen Gruppierungen hinzu, dann wurden in dieser Wahlperiode allein für den Präsidentschaftswahlkampf über zwei Milliarden Dollar ausgegeben. Kandidaten, die bei den vergangenen Kongresswahlen 2012 einen Sitz im Senat gewannen, setzten durchschnittlich 9,5 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden ein. Die Wahlkämpfe für weniger prestigeträchtige und einflussreiche Sitze im Abgeordnetenhaus erforderten entsprechend niedrigeren Einsatz: Siegreiche Kandidaten investierten im Schnitt „nur“ 1,2 Millionen Dollar. Geld alleine bietet zwar keine Sicherheit dafür, einen Sitz im Kongress zu gewinnen, doch es erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Aus 94 Prozent der Rennen im Abgeordnetenhaus gingen diejenigen als Sieger hervor, die das meiste Geld ausgeben konnten. Im Senat liegt die Erfolgsquote der „top spender“ bei 80 Prozent, so das Center for Responsive Politics 2012. Es gibt noch andere Machtwährungen. Wer über ein politisches Netzwerk von Basisorganisationen verfügt, kann über eine Vielzahl Gleichgesinnter, die von Haus zu Haus gehen, potenzielle Wählerinnen und Wähler direkt ansprechen und ist nicht auf die diffuse und teure Massenkommunikation der Fernsehsender angewiesen. Bereits in den 1970er-Jahren kommunizierten die Pioniere der Christlich Rechten mit Gleichgesinnten unmittelbar über sogenannte Direct-Mail-Kanäle. Zielgruppenspezifische Kommunikationsformen mit geringen Streuverlusten wie Briefappelle, die mittlerweile durch E-Mail-Kommunikation und soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter ersetzt wurden, sind besonders gut geeignet, kostengünstig den harten Kern der Stammwählerschaft zu mobilisieren und Wahlkampfgeld zu akquirieren. Direkte Wähleransprache: Beim Canvassing gehen freiwillige Helfer, hier in Steubenville, Ohio, in einem vom Kampagnenteam festgelegten Gebiet von Haus zu Haus, um für ihren Kandidaten zu werben, … … oder sie rufen bei potenziellen Wählerinnen und Wählern an, um sie für die anstehende Wahl zu mobilisieren. Gezielt geschieht dies besonders in Gebieten, in denen der Anteil der Wechselwähler groß ist. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 41 VOA / UIG via Getty Images Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Nur registrierte Wählerinnen und Wähler können in den USA ihre Stimme abgeben, wie hier bei der Präsidentenwahl am 6. November 2012 in einem Wahllokal in Ventura County, Kalifornien. #usa – Einfluss sozialer Netzwerke [...] Zweifellos ermöglichen es soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook, dass sich mehr Menschen leichter und unmittelbarer an Politik beteiligen denn je. Führt das aber auch dazu, dass die wichtigen Themen erkannt, Lügen der Politik entdeckt, andere Meinungen eher nachvollzogen werden? Ist der Twitter-Facebook-Google-Wähler also aufgeklärter als jener, der sich bloß von Wahlwerbespots berieseln lässt? Twitter wirbt damit, dass es den Bürger mit ganz neuer Macht ausstattet, aber diese Verheißung ist umstritten. Politiker wissen aus dem Internet inzwischen deutlich mehr über ihre Wähler als umgekehrt. Der Internetnutzer, der kaum noch Geheimnisse hat, könnte damit stärker beeinflussbar sein als früher, von Kampagnen, die ihre Botschaften genau auf ihn zuschneiden und noch stärker in jenen Vorurteilen bestätigen, die er eh schon immer hatte. [...] [F]ür viele Menschen in Amerika wäre ein Politikereignis (oder überhaupt ein Ereignis) ohne Twitter so hinnehmbar wie ein Fußballspiel ohne Ton. Ist man an der Ostküste zu Hause, kann man die Kommentare des Cousins in Kalifornien mitlesen. „Es ist wie früher, als man solche Ereignisse auf der Couch mit Familie und Freunden verfolgte, nur dass die Couch nun eben global ist“, sagt Adam Sharp, 34, „Head of government, news and social innovation“ bei Twitter und als solcher verantwortlich für die Politik. Ob man tatsächlich auf einer globalen Couch sitzt, hängt jedoch davon ab, wem man auf Twitter folgt. Die Neutralen finden unter dem Stichwort #debates einen Überblick, oder sie folgen jenen Freunden oder Journalisten oder Experten, denen sie immer folgen, oder sie suchen sich ein spezielles Sachthema wie #Libya. Die Parteiischen hingegen können all jene ausblenden, die nicht ihrer Meinung sind. Ein Tea-Party-Republikaner kann statt der globalen die patriotische Couch wählen, indem er bei Twitter nur jenen folgt, die er von seinem rechten Haussender Fox News kennt. […] Twitter-Mann Adam Sharp und seine Kollegen von Facebook und Google zählen die Vorteile ihrer Produkte auf: Erstens hätten die Leute das Gefühl, am politischen Prozess teilzunehmen. Zweitens sei Politik messbar [...] Drittens sei Politik viel schneller. „Der 24-Stunden-Nachrichtenzyklus ist durch einen 140-Zeichen-Zyklus ersetzt worden“, sagt Sharp. Das klingt so größenwahnsinnig, wie Sharp es vermutlich meint, und ist insoweit wahr, als sich Politik enorm beschleunigt. Oft müssen die Kampagnen binnen Minuten auf einen Vorwurf reagieren. […] Mit großen Rechnern und raffinierter Software suchen die Strategen [der Kandidaten] in den Wählerlisten nach Wechselwählern oder jenen, die sich öfters mal enthalten, und legen Profile dieser Zielpersonen an. Sie kaufen bei Datenhändlern ein, schlachten Facebook-Profile oder TwitterMeldungen aus, verfolgen Internetspuren über Einkaufsverhalten und andere Vorlieben. Alles kann etwas bedeuten: Ob ein Wähler eine Zeitschrift abonniert hat, ob Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 er raucht oder Ski fährt, ob er Haustiere hat oder einen Pool. […] Wähler sollen sich eingebunden, mitgenommen fühlen. Adam Sharp sagt, das sei die moderne Version der altmodischen Kampagne, als der Kandidat noch von Tür zu Tür ging und Hände schüttelte. Für die neuen Formen gezielter Internetwerbung geben die Kampagnen inzwischen sechsmal mehr Geld aus als vor vier Jahren. Zwar zahlen sie immer noch den Großteil ihres Werbebudgets von insgesamt drei Milliarden Dollar ans Fernsehen, aber die Streuverluste dort sind enorm. Ein Drittel der Wähler hat es aufgegeben, in Echtzeit fernzusehen, die Zuschauer zeichnen die Sendungen lieber auf und überspielen dann die Werbepausen. Sie sind für Politiker nur noch online zu erreichen. In Zukunft werden sich die Kampagnen also immer stärker auf jene wenigen konzentrieren, die sie brauchen. Das ist zwar nicht im Sinne der Demokratie, aber es geht ja nicht um Ideale, Privatsphäre oder Transparenz, sondern um den Sieg. Nicolas Richter, „#usa – Die Welt in 140 Zeichen“, in: Süddeutsche Zeitung vom 24. Oktober 2012 42 Politisches System der USA for Tax Reform und Stratege der libertären Bewegung. Norquist hat die große Mehrheit der Republikaner im Abgeordnetenhaus und im Senat dazu gebracht, einen öffentlichen Eid (pledge) zu leisten, dass sie keiner Steuererhöhung zustimmen werden. Von den derzeit 232 Republikanern im Abgeordnetenhaus haben 219 diesen „pledge“ unterschrieben; im Senat gibt es auch nur noch einige „Abtrünnige“ vom „wahren libertären Glauben“: Von den 45 Republikanischen Senatoren haben sich immerhin sechs dem Ansinnen Norquists verwehrt und ihren politischen Bewegungsspielraum bewahrt, der nötig ist, um Kompromisse in der Gesetzgebung zu finden. Anders als in der Sexualmoral stimmen die Vorstellungen der rechten Christen bei wirtschaftspolitischen Themen durchaus mit dem Denken libertärer Republikaner überein. Sie sind sich einig in der Zielsetzung, den Einfluss des Staates auf die Wirtschaft zu reduzieren. Doch während wirtschaftslibertär überzeugte Republikaner an die unsichtbare Hand des Marktes glauben, sind für überzeugte Evangelikale persönliche Verfehlungen und unmoralisches Handeln die Ursache für wirtschaftliches Versagen: „Schwarze sind meist selbst verantwortlich für ihre Lage“, meinen zum Beispiel rund zwei Drittel der engagierten Evangelikalen laut den Umfragedaten des Pew Research Center, die von den US-Politikwissenschaftlern Andrew Kohut u. a. (2000, S. 131) zitiert wurden. Staatliche Sozialleistungen und Wohlfahrt haben in diesem Denken keinen Platz. „Defunding the government“, lautet ihr Slogan, und das bedeutet, dem Staat keine Mittel zur Verfügung zu stellen, es sei denn, die Finanzierung betrifft militärische oder sicherheitspolitische Belange. „Weniger Sozialstaat“ und „weniger Steuern“ sind Glaubenssätze konservativen Wirtschaftsdenkens in den Vereinigten Staaten. Wirtschaftssubjekte gelten als Individuen in freier Verantwortung. Staatliche Interventionen durch Wirtschafts- oder gar Sozialpolitik sind demzufolge überflüssig, ja kontraproduktiv. Dieses staatskritische Gedankengut wurde gemäß dem Slogan „Ideen haben Konsequenzen“ über Think Tanks in praktische Politik übersetzt. Das Wirken von Politunternehmern wie Norquist und auch von Milliardären wie den Brüdern Charles und David Koch, die neben libertären Think AP Photo / The News & Observer, Corey Lowenstein und vor allem die Christlich Rechte benötigen die Republikaner. Religiöse Konservative sind am einflussreichsten, wenn sie Teil einer größeren konservativen Koalition sind, und die Republikanische Partei ist dafür die zugänglichste Institution.“ (Green 1994, S. 64). Dieses pragmatische Verständnis bildet die Grundlage für die Machtsymbiose zwischen der Republikanischen Partei und dem Organisationsgeflecht der Christlich Rechten. Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines langwierigen Lernprozesses sowohl der Republikanischen Parteistrategen als auch der Christlich Rechten, der sie von den Anfängen fundamentalistischen Sektierertums in ein Stadium des politischen Pragmatismus führte. Politische Unternehmer, die religiöse Autorität sowie Hochachtung unter evangelikalen Christen genießen, gaben der abstrakten Idee der „Christian Right“ Gestalt und inneren Zusammenhalt, indem sie ein Organisationsgeflecht an der politischen Basis schufen. Unter ihnen sind Persönlichkeiten wie der Fernsehprediger Pat Robertson, James Dobson, der Think Tanks wie Focus on the Family oder den Family Research Council gründete, sowie der politische Netzwerker Gary Bauer – um einige der prominentesten zu nennen, die gleichwohl der allgemeinen Bevölkerung wenig bekannt sind. „Betrachtet man die Gesamtheit der Organisationen auf der Neuen Rechten, so übernehmen diese Aufgaben, die in westeuropäischen parlamentarischen Regierungssystemen überwiegend oder ausschließlich von Parteien wahrgenommen werden“, brachte es der Parteienforscher und Kenner US-amerikanischer Politik Peter Lösche 1982 (S. 41) auf den Punkt. „In ihnen sind häufig junge, hochintelligente, eiskalte Politmanager tätig, die nicht nur wissen, wie man organisiert, mobilisiert, manipuliert und Wahlkämpfe führt, sondern dabei auch die neuen Technologien einsetzen.“ Mittlerweile hat sich zur Christlich Rechten auch das sogenannte Tea Party Movement gesellt. Die Übergänge beider Gruppierungen sind fließend. Während Christlich Rechte sich vor allem gegen Abtreibung und Homoehe einsetzen, sind die Tea Party-Aktivisten bestrebt, den Staat so klein wie möglich zu machen, damit man ihn „wie ein Baby im Bade ertränken“ könne, so Grover Norquist, Chef der Vereinigung Americans Einflussreicher Aktivist: Grover Norquist (re.), Präsident der Interessenvertretung Americans for Tax Reform, hat viele Republikanische Abgeordnete und Senatoren per öffentlichen Eid verpflichtet, gegen jedwede Steuererhöhung zu stimmen. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 SAUL LOEB / AFP / Getty Images Konkurrenz und Kontrolle der Machthaber: checks and balances Joe Raedle / Getty Images Anhänger der Tea Party, einer Gruppierung innerhalb der Republikanischen Partei, wollen den Staat so klein wie möglich halten und lehnen staatliche Hilfen und Steuern ab. Kundgebung in Washington 2013 Justin Sullivan / Getty Images Der Konflikt im Kongress um eine Lösung des Haushaltsproblems durch höhere Steuern führte 2013 zur Haushaltssperre. Staatliche Angestellte wurden ohne Lohn freigestellt. Protest in Doral, Florida Neben den Zuwendungen einflussreicher Lobbyisten gewinnen in den USWahlkämpfen Kleinspenden an Bedeutung. In Townsend, Montana, sammelt der Senatskandidat Jon Tester 2006 Geld ein. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 43 Tanks wie Cato auch die Tea Party finanziell unterstützen, verdeutlicht, dass sich der politische Prozess nicht, wie es die politikromantische Bezeichnung „Graswurzelbewegung“ suggeriert, von der Basis her wildwüchsig formiert hat, sondern „von oben“ gesteuert wird. Das mittlerweile bestehende Netzwerk vieler Kleinspender an der Basis musste mit Startkapital finanzkräftiger Unternehmen, das im Englischen bezeichnenderweise „seed money“ (Saatgeld) genannt wird, kultiviert und zur Blüte gebracht werden. Gleichwohl begrüßen Experten wie Anthony Corrado (zitiert in: Feldmann 2004) diese Entwicklung als Demokratisierung der Wahlkampffinanzierung: Die Macht der Kleinspender habe zugenommen. So machten erstmals auch viele Anhänger der Demokratischen Partei ihrem Unmut über die Politik des Republikaners George W. Bush Luft, indem sie via Internet den Demokraten Geld spendeten. Durch den Einsatz solch moderner Kommunikationsmittel gelang es dem Herausforderer John Kerry im Präsidentschaftswahlkampf 2004, den traditionellen Vorsprung der Republikaner beim Eintreiben von Wahlkampfspenden wettzumachen. Dabei waren Einzelspenden über das Internet Kerrys am üppigsten sprudelnde Finanzierungsquelle, wie in der Washington Post am 17. Juni und 21. Juli 2004 nachzulesen war. Doch die Republikaner unter der Führung von Karl Rove, dem „Architekten“ des Wahlsiegs von George W. Bush, waren noch effektiver, ihre vor allem religiös-rechte Basis an Kleinspendern zu erweitern und mit Hilfe des Internets zu mobilisieren. Als großer Vorteil erweist sich dabei, dass bei der persönlichen Ansprache der religiösen Kernklientel über die neuen Medien die moderate Wählerschaft nicht verprellt oder weitere politische Gegner aktiviert werden, was bei diffus gestreuten Fernsehkampagnen häufig der Fall ist. Ralph Reed, ein führender Kopf der Christlich Rechten und ehedem im Team von Bushs Wahlkampfberatern, erklärte die Neuausrichtung der Wahlkampfstrategie vom „Luft- hin zum Bodenkrieg“, sprich der Abwendung von der Fernsehwerbung über die „air waves“ hin zur Mobilisierung der politischen Graswurzeln (grassroots): „Das ist meines Wissens das erste Mal, dass ein amtierender Präsident derartige Anstrengungen unternimmt, eine regelrechte Basiskampagne zu organisieren, die sich auf Wahlbezirke und Wohngegenden konzentriert, anstelle bisheriger Strategien, die ausschließlich auf Fernsehbilder und die Medien setzten“, zitierten ihn Richard Stevenson und Adam Nagourney in der New York Times am 29. September 2003. Die Wahlkämpfer von Barack Obama perfektionierten diese Strategie. In den Präsidentschaftswahlkämpfen 2008 und 2012 gelang es ihnen, jeweils sowohl im Vor- als auch später im Hauptwahlkampf gegen John McCain bzw. Mitt Romney ein Drittel ihrer Wahlkampfgelder in kleineren Beträgen von bis zu 200 Dollar einzuwerben, so Michael J. Malbin und das Center for Responsive Politics 2012. Das Organisationsgeflecht Gleichgesinnter auf der Ebene der Basisorganisationen ist also in mehrfacher Hinsicht nützlich und vorteilhaft: zum einen bei der Wahlkampffinanzierung, zum anderen bei der direkten permanenten Wählermobilisierung. Doch häufig werden Politiker die vielen gleichgesinnten Geister, die sie vor der Wahl gerufen haben, danach nicht mehr los. Diese Organisationen können nämlich ebenso wie andere wirtschaftliche Interessengruppen massiven Druck auf die Politik ausüben, nicht zuletzt indem sie damit drohen, ihre Unterstützung bei den nächsten Wahlen wieder zu entziehen. 44 Politisches System der USA Josef Braml Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker AP Photo / Jim Cole Schwachen Parteien stehen in den USA starke Interessengruppen gegenüber. Deren Vertreter können durch einen regen Personalaustausch ihre Ideen bisweilen in die Praxis umsetzen. Die Medien kontrollieren das politische Geschehen, sind aber selbst zunehmend einem politischen Lagerdenken verhaftet. US-Parteien sind auf einzelstaatlicher Ebene einflussreicher als auf nationaler. Pressekonferenz von Maggie Hassan, Gouverneurin von New Hampshire 2013 P olitik wird in den USA nicht – wie in parlamentarischen Regierungssystemen üblich – von den Parteien formuliert und gesteuert, sondern über „Themennetzwerke“ und „Tendenzkoalitionen“ ausgehandelt, in denen gleichgesinnte Politikberater, Wahlkampfmanager, Lobbyisten, Politiker, Verwaltungseliten und Journalisten gemeinsam versuchen, ihre Ideen und Interessen durchzusetzen. Anders als Parteien in parlamentarischen Regierungssystemen, die in elementaren Bereichen umfassend funktionieren, sind US-Parteien aufgrund ihrer von den Verfassungsvätern institutionell angelegten Schwäche und ihrer weiteren Beschneidung im Laufe der Geschichte nicht in der Lage, gesellschaftliche Interessengegensätze auszutarieren und Politik zu gestalten. Die Parteien in den USA haben wenige Mittel, Abgeordnete und Senatoren zu sanktionieren und disziplinierend einzugreifen, um politische Inhalte durchzusetzen. Im Gegensatz zu deutschen haben US-Parteien keine Gestaltungsmacht im Gesetzgebungsprozess. Parteien spielen in den USA – mit Ausnahme ihrer Funktion bei den Wahlen – eine untergeordnete Rolle. Doch selbst bei ihrer Wahlfunktion sind sie eingeschränkt: In Deutschland wird der Wahlkampf fast ausschließlich über Parteien finanziert, und die Kandidatinnen und Kandidaten müssen für höhere Ämter nach wie vor die „Ochsentour“ durchlaufen, indem sie im Wahlkampf oder in diversen Vorstufen auf Gemeindeebene, im Landtag oder Bundestag der Partei dienen, um einen begehrten Platz auf der Parteiliste oder ein Ministeramt zu er- AP Photo / Tamir Kalifa Schwache Parteien Bei besonders umkämpften Themen ergibt sich eine enge Wechselbeziehung zwischen Interessengruppen und Politikern, die ihre Anschichten vertreten sollen. Kampf um eine Verschärfung des Abtreibungsrechts in Texas im Juli 2013 halten. In den USA dagegen sind Quereinsteiger ohne „Stallgeruch“ Gang und Gäbe. Durch das progressive movement während der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden die Parteien noch weiter geschwächt, indem ihnen durch die Einführung der Vorwahlen (primaries) die Allmacht bei der Kandidatenaufstellung entzogen wurde. Hatten früher die „Parteibosse“ in rauchgeschwängerten Hinterzimmern die Entscheidungen getroffen, so werden die Parteien bei der Kandidatenauswahl und der Wahlkampffinanzierung mittlerweile von InteInformationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker Warum sind die nationalen Parteien so schwach? Einer […] Stärkung [nationaler Parteiorganisationen] stehen […] erhebliche Probleme entgegen: Zunächst die […] Dezentralisierung der amerikanischen Parteien selbst. Die einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Parteiorganisationen sind nur bedingt bereit, auf bisherige Kompetenzen zugunsten einer Stärkung der nationalen Parteiorganisationen zu verzichten. Watergate und Vietnam haben in den 1970er-Jahren zu einem deutlichen Vertrauensverlust der amerikanischen Parteien geführt. Die Anzahl der Bürger, die sich zu keiner Partei bekennen wollten, stieg damals beträchtlich; eine Tendenz, die sich seither verstetigt hat. Man orientiert sich bei der Wahlentscheidung an bestimmten Sachthemen oder an den zur Wahl stehenden Kandidaten. […] Weiterhin ist die Institution der Vorwahlen zu nennen, die die Parteien Tea Party – Sinnbild für die Polarisierung Die amerikanischen Parteien stellen für gewöhnlich alles andere als geschlossene Einheiten dar: Es gibt konservative Politiker bei den Demokraten und liberale […] Politiker bei den Republikanern. Und dennoch bestehen deutliche Kontraste, wenn man die Mehrheitsmeinungen der beiden Parteien einander gegenüberstellt. In der Wirtschaftspolitik haben die Demokraten die „New Deal“-Linie des in der Wirtschaft relativ stark engagierten Staates bis heute nicht gänzlich aufgegeben, die Republikaner hingegen plädieren hier für eine deutlich größere Zurückhaltung des Staates. Auch in der Sozial- und Bildungspolitik lassen sich Divergenzen nachweisen: Die Demokraten treten eher für die Benachteiligten ein, während die Republikaner stärker geneigt sind, diese ihrem Schicksal zu überlassen. Exemplarisch hierfür ist die […] Debatte um die Gesundheitsreform der Regierung Obama, die dem Präsidenten von republikanischer Seite aus den Vorwurf einbrachte, Staatssozialismus zu betreiben. Dieses Beispiel deutet zugleich an, dass die programmatische Kluft, aber auch die Schärfe der politischen Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Republikanern in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Das hängt in gehörigem Maße mit dem zwischenzeitlichen Erstarken der „Tea Party“ zusammen, einer 45 zumindest teilweise einer ihrer zentralen Aufgaben – der Kandidatenaufstellung nämlich – berauben und sie Parteianhängern – und damit de facto ihren Wählern – überantworten. Auch wirkt der zunehmende Einfluss der Medien im amerikanischen Wahlkampf – anders als vorerst in Europa – eher zugunsten der einzelnen Kandidaten als zugunsten der Parteiorganisationen. Paradoxerweise muss das amerikanische Zweiparteisystem in diesem Zusammenhang selbst erwähnt werden. Das relative Mehrheitswahlsystem hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Vereinigten Staaten von ihren Anfängen bis heute im Wesentlichen mit nur zwei Parteien – wenn auch mit wechselnden Benennungen und Zielsetzungen – ausgekommen sind. In dieser religiös und ethnisch heterogenen Gesellschaft hätte sich jedoch auch unter dem bestehenden Wahlsystem das Zweiparteiensystem auflösen müssen, wenn sich nicht – durch eine erzwungene innerparteiliche Toleranz – ein „inner- parteiliches Mehrparteiensystem“ hätte herausbilden können. Dieses gerät jedoch […] heute immer mehr in Gefahr. Letztlich entscheidend für die Schwäche der nationalen amerikanischen Parteien ist jedoch […] das präsidentielle Regierungssystem. Der Präsident der USA bedarf – im Gegensatz zu einem Regierungschef in einem parlamentarischen Regierungssystem – nicht der dauerhaften Unterstützung seiner Partei im Kongress: Sie hat ihn nicht gewählt, sie kann ihn nicht entlassen. Geschlossene Parteifronten könnten im Gegenteil zu einer Gefahr für das präsidentielle Regierungssystem werden, wenn der Präsident einerseits und die Mehrheit eines oder beider Häuser des Kongresses andererseits von verschiedenen Parteien gestellt würden. Starre Parteifronten und mangelnde Kompromissbereitschaft führen dann – wie momentan zu beobachten – […] zu einem Stillstand und zur Unregierbarkeit des Systems. außerordentlich wertkonservativen Gruppierung – wohlgemerkt keine Partei –, die den Republikanern nahesteht. In der Folge kann man von einer deutlichen Polarisierung des parteipolitischen Wettbewerbs bzw. einer „conflict extension“ sprechen, überspitzt formuliert vielleicht sogar von den „Divided States of America“. […] Für die jüngste ideologische Polarisierung gibt es indes kein singuläres, allumfassendes Erklärungsmuster. Vielmehr treffen hier eine ganze Reihe politischer und gesellschaftlicher Faktoren aufeinander. So scheint sich innerhalb der amerikanischen Gesellschaft der Dissens über die als richtig empfundenen politischen und „social values“ zu verstärken. Die Frage nach der richtigen Arbeitsmarkt-, Steuer- und Sozialpolitik wird völlig konträr beantwortet. Ethische und wertorientierte Debatten wie die um die rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder die Zulässigkeit von Abtreibung werden als Glaubenskriege geführt – meist ohne Aussicht auf einen Kompromiss. Hinzu kommt vor allem auf Seiten derjenigen, die dem republikanischen Lager nahestehen, eine Angst vor dem Verlust von Privilegien: Die „old white men“ fürchten um ihren wirtschaftlichen Wohlstand und um die moralische Deutungshoheit. Diese Ängste wiederum bilden einen wichtigen Nährboden für den Aufstieg der Tea Party, dem Sinnbild für die derzeitige Ära der „polarized politics“ in den USA. Die Tea Party – der Name ist sowohl eine Reminiszenz an die Boston Tea Party, die den Widerstand gegen die britischen Kolonialherren im Jahre 1773 bezeichnete, als auch die Abkürzung für den zentralen Leitspruch „taxed enough already“ – entstand Anfang 2009 als Reaktion auf die Wirtschaftspolitik der Regierung Obama. Die Bewegung sieht sich selbst als „grassroot movement“ – was sie allerdings nur zum Teil ist, da sie nicht nur auf der Aktivität engagierter Bürger vor Ort fußt, sondern auch einflussreiche Medien wie „Fox News“ und finanzkräftige Interessengruppen hinter sich weiß. Ideologisch steht sie den Republikanern nahe, ist aber in vielerlei Hinsicht noch deutlich konservativer und staatsskeptischer. Zwei Beispiele: 82 % der Tea-Party-Anhänger halten Einwanderung für ein „sehr ernstes Problem“ – gegenüber 72 % der Republikaner und 60 % der Gesamtbevölkerung. 66 % sind der Ansicht, die globale Erwärmung werde „keine Auswirkungen“ haben – bei den Republikanern sind es 51 %, in der gesamten Bevölkerung 29 %. Die Anhängerschaft der Tea Party speist sich vor allem aus den eben erwähnten „old white men“, die sich selbst als „workers“ einstufen und sich durch die steigende Zahl „bunter“ Bevölkerungsgruppen […] ökonomisch und kulturell bedroht sehen. […] Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Beide Texte: Emil Hübner / Ursula Münch, Das politische System der USA. Eine Einführung, 7., überarb. u. aktual. Auflage, © Verlag C. H. Beck, München 2013, S. 80 f. (oben) u. S. 70 ff. 46 Politisches System der USA ressengruppen und deren Wahlkampfkomitees überboten. Dazu haben auch die Entscheidungen des Obersten Gerichts (grundlegend 1976 im Fall Buckley v. Valeo und zuletzt, am 21. Januar 2010, im Fall Citizens United v. Federal Election Commission) beigetragen; die Interpretationen der Obersten Richter haben dem Einfluss von Interessengruppen, Think Tanks und Politikunternehmern (policy entrepreneurs) Tür und Tor geöffnet (siehe auch S. 38 f.). Starke Interessengruppen Anders als in den korporatistischen Strukturen Westeuropas sind Interessengruppen in den USA dezentral strukturiert, ja „anarchisch aufgesplittert“, so der Politikwissenschaftler Peter Lösche 2008 (S. 274). Dementsprechend viele gibt es; ihre Zahl wurde vom Verbandsforscher Martin Sebaldt in seinem 2001 erschienenen Buch „Transformation der Verbändedemokratie“ (S. 14, 20) auf über 200 000 geschätzt. Mittlerweile beteiligen sie sich auch verstärkt an der außenpolitischen Debatte. Seit den 1960er- und 1970er-Jahren hat der Einfluss von Interessengruppen und Wirtschaftsvertretern auf das politische System deutlich zugenommen. „Wirtschaftsunternehmen haben eine Vielzahl von Lobbyisten und Anwälten beschäftigt, Büros in Washington eröffnet, political action committees (PACs) gegründet und finanziert, die Mitarbeiterstäbe ihrer government relations-Büros vergrößert, ausgefeilte Strategien entworfen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und gelernt, wie man Graswurzelbewegun- gen organisiert“, erläutert der amerikanische Interessengruppenforscher David Vogel (1996, S. 5 f.; 1989) ihr umfassendes Wirken. Viele Interessengruppen und Verbände haben PACs etabliert, um direkt in die Wahlkämpfe einzugreifen. Diese Wahlkampfkomitees werden nicht nur von Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden genutzt, sondern auch von religiösen oder ethnischen Interessengruppen in Stellung gebracht, um mit Anzeigenkampagnen (issue ads) die Wählerinnen und Wähler über die Kandidaten zu „informieren“. Betrachtet man das Wirken der PACs in ihrer Gesamtheit, „so übernehmen sie Aufgaben, die in westeuropäischen parlamentarischen Regierungssystemen von Parteien wahrgenommen werden: Sie sammeln und verteilen Wahlkampfspenden, sie bilden Wahlkampfmanager und Wahlhelfer aus; sie stellen den Kandidaten Dienstleistungen aller Art zur Verfügung (von Meinungsumfragen bis zur Produktion von Fernseh-Werbespots)“, so Peter Lösche 2008 (S. 296). Außenpolitisch orientierte Interessengruppen in den USA (Beispiele) Organisation Kategorie in USA Interessenträger bzw. -orientierung American Bankers Association (ABA) http://www.aba.com/ Business Banken American Civil Liberties Union (ACLU) http://www.aclu.org/ Human Rights Menschen- und Bürgerrechte American Farm Bureau Federation (AFBF) http://www.fb.org/ Agribusiness Landwirtschaft American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) http://www.aflcio.org/ Unions Gewerkschaften American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) http://www.aipac.org/ Ethnic Pro Israel Boeing Co. http://www.boeing.com/ Defense Industry Rüstungsunternehmen Business Roundtable http://businessroundtable.org/ Business Unternehmen Christian Coalition http://www.cc.org/ Ethnic/Religious Christlich Rechte, pro Israel Common Cause http://www.commoncause.org/ Public Interest Gemeinwohl Exxon Mobil http://www.exxonmobil.com/ Energy Energieunternehmen Human Rights Campaign http://www.hrc.org/ Human Rights Menschenrechte Independent Petroleum Association of America (IPAA) http://www.ipaa.org/ Oil & Gas Energiewirtschaft League of Conservation Voters (LCV) http://www.lcv.org/ Environment Umweltschutz Lockheed Martin http://www.lockheedmartin.com/ Defense Industry Rüstungsunternehmen National Association of Manufacturers (NAM) http://www.nam.org/ Business Unternehmen National Federation of Independent Business (NFIB) http://www.nfib.com/ Business Unternehmen Sierra Club http://www.sierraclub.org/ Environment Umweltschutz U.S. Chamber of Commerce http://www.uschamber.com/ Business Unternehmen U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) http://www.uscirf.gov/ Ethnic/Religious Internationale Religionsfreiheit und Menschenrechte Cuban American National Foundation (CANF) http://www.canf.org/ Ethnic/Single Issue Exil-Kubaner Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker 47 © Federal Election Commission (FEC), Pressemitteilungen Bis zur Jahrtausendwende stiegen sowohl die Anzahl als auch die Zuwendungen von PACs enorm an. Die Zuwendungen an Kandidaten für Wahlkämpfe auf nationaler Ebene verzeichneten einen Anstieg (inflationsbereinigt) von zwölf (1974) auf knapp 70 Millionen Dollar (1998) – das entspricht einer Erhöhung der „Kaufkraft“ amerikanischer PACs um knapp 500 Prozent (Braml 2004, S. 129 ff.), die innerhalb dieses Vierteljahrhunderts in das politische System der USA eingeflossen ist. Wie die obige Abbildung verdeutlicht, wurden insbesondere wirtschafts- und industrienahe Organisationen in Stellung gebracht. Das politische System der USA bietet diesen Politunternehmern ein optimales Betätigungsfeld: Ihr Spielraum ist in den USA weniger durch die potenzielle Machtrolle politischer Parteien – der traditionellen Türsteher (gatekeepers) – eingeschränkt, und sie haben leichteren Zugang zu einer größeren Zahl mitentscheidender Akteure. Neben der persönlichen Ansprache von Entscheidungsträgern in der Exekutive/Administration, Judikative und im Parlament in Washington bearbeiten Interessenvertreter insbesondere die 435 Abgeordneten und 100 Senatoren über ihre Wahlkreise bzw. Einzelstaaten. Sie zielen mit ihrem Graswurzel-Lobbying direkt auf die Basis, die Wähleranbindung. Ein besonders wirksames Mittel für Interessengruppen, um Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess und die Wiederwahl zu nehmen, sind „Wählerprüfsteine“ (scorecards oder voter guides). Interessengruppen der Christlich Rechten machen zum Beispiel kritische Abstimmungen publik, damit Abgeordnete und Senatoren wissen, dass ihre Bevölkerung im Wahlkreis genau erfahren wird, wie sie abgestimmt haben (Braml 2005, S. 79 ff.). Dieser externe Einfluss einer Vielzahl unterschiedlicher und oft widerstreitender Interessen ist als erheblich einzuschätzen, vor allem bei den Kongresswahlen. Da US-amerikanische Abgeordnete und Senatoren keiner Parteidisziplin unterworfen sind, können sie sich auch nicht hinter ihr verstecken. Einzelne Politiker laufen ständig Gefahr, im Rahmen einflussreicher Kampagnen an den Pranger gestellt und gegebenenfalls bei der Kandidatur um eine Wiederwahl persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie wägen deshalb bei jeder einzelnen Abstimmung gründlich ab, wie diese sich bei den nächsten Wahlen für sie persönlich auswirken könnte. Think Tanks als Ideen- und Personalagenturen Das checks and balances-System der Vereinigten Staaten eröffnet auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Think Tanks vielfältige Einwirkungsmöglichkeiten, insbesondere aufgrund seiner Durchlässigkeit: Sie bedingt eine hohe Rotation und erleichtert Karrierewechsel. In diesem System der revolving doors, des fortwährenden inand-out, werden Personen und mit ihnen auch Ideen und Interessen ständig ausgetauscht. In keinem anderen Land als den USA wird ein derart breiter und offener (außen) politischer Diskurs gepflegt, an dem sich unzählige Interessengruppen und Think Tanks maßgeblich beteiligen und Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 in dem sie ihre verschiedenen Kommunikationsrollen ausüben können. Während in einem parlamentarischen Regierungssystem wie der Bundesrepublik Deutschland die politischen Parteien bei der Rekrutierung des Spitzenpersonals von zentraler Bedeutung sind und ohnehin ein großer Berufsbeamtenapparat von politischen Veränderungen unberührt bleibt, übernehmen in den USA Think Tanks die Rolle des Personaltransfers und damit auch der Ideengebung. Anders als in Deutschland, wo nur eine Handvoll Fachleute je die Seiten gewechselt haben, kommentieren US-amerikanische Exper- 48 Politisches System der USA Think-Tank-Typen und -Familien Familien Politisch/ideologisch identifizierbar (id) Politisch/ideologisch nicht identifizierbar (nicht-id) Typen advokatisch parteiisch akademisch auf Vertragsbasis forschend Prototypen Heritage Foundation Nicht in USA (parteinahe Stiftungen in Deutschland) Brookings Institution RAND Corporation Zur Typologie von Think Tanks siehe Winand Gellner, Ideenagenturen für Politik und Öffentlichkeit. Think Tanks in den USA und in Deutschland, Opladen 1995 und Kent R. Weaver, The Changing World of Think Tanks, in: Political Science and Politics 22 / 1989, S. 563-579 Prominente außenpolitisch orientierte Think Tanks in den USA Organisation Typ Politische Orientierung American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) http://www.aei.org/ advokatisch (neo-)konservativ Brookings Institution http://brook.edu/ akademisch zentristisch (middle of the road) Carnegie Endowment for International Peace http://carnegieendowment.org/ akademisch zentristisch Cato Institute http://www.cato.org/ advokatisch libertär Center for American Progress http://www.americanprogress.org/ advokatisch progressiv (Neue Demokraten) Center for Strategic and International Studies (CSIS) http://www.csis.org/ akademisch zentristisch Council on Foreign Relations (CFR) http://www.cfr.org/ akademisch zentristisch Democratic Leadership Council (DLC) / Progressive Policy Institute (PPI) http://www.dlc.org/ advokatisch progressiv (Neue Demokraten Economic Policy Institute (EPI) http://epi.org/ advokatisch sozial-liberal/ gewerkschaftsnah Economic Strategy Institute (ESI) (http://www.econstrat.org/) akademisch zentristisch Heritage Foundation http://www.heritage.org/ advokatisch konservativ Hoover Institution http://www.hoover.org/ akademisch konservativ Hudson Institute http://www.hudson.org/ advokatisch konservativ New America Foundation (NAF) http://www.newamerica.net/ akademisch zentristisch Peterson Institute for International Economics (PIIE) http://www.piie.com/ akademisch zentristisch RAND Corporation http://www.rand.org/ auf Vertragsbasis forschend zentristisch Resources for the Future http://www.rff.org/ advokatisch liberal/umweltorientiert Stimson Center http://www.stimson.org/ akademisch zentristisch Woodrow Wilson International Center for Scholars http://www.wilsoncenter.org/ akademisch zentristisch World Resources Institute (WRI) http://www.wri.org/ advokatisch liberal/umweltorientiert ten nicht nur am Seitenrand, sondern erhalten hin und wieder die Chance, sich selbst im Zentrum der Macht am politischen Spiel zu beteiligen. Indem sie eine politische Aufgabe übernehmen, können sie, selbstredend, auch ihre vorher im Think Tank erdachten Ideen in die Tat umzusetzen versuchen. Dieser ständige Austausch von Personal und Ideen hat Vorund Nachteile. So sind US-Sozialwissenschaftler, die häufig auch direkt von Elite-Universitäten rekrutiert werden, eher als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern geübt, praxisorientiert ein komplexes Problem zu analysieren und Lösungsansätze vorzuschlagen. Davon profitieren gleichermaßen Politik und Wissenschaft, insbesondere Universitäten, die die nächste Generation pragmatischer Fachleute ausbilden. Doch auf dem „Marktplatz der Ideen“ werden mittlerweile nicht nur Ideen gehandelt, die auf empirisch überprüfbaren Aussagen fußen, sondern auch solche, die ideologischer bzw. religiöser Natur und daher nicht falsifizierbar sind. In der Beratungslandschaft wuchern, dank üppiger finanzieller Zuwendungen der Privatwirtschaft, mittlerweile ideologische Think Tanks, die im „Krieg der Ideen“ ihre Interessen vertreten. Die Heritage Foundation, sicherlich das prominenteste Beispiel, beabsichtigte in den 1990er-Jahren gar, als Avantgarde der „Konservativen Revolution“ in die Weltgeschichte einzugehen. Auch wenn die konservative Bewegung merklich an Boden und Einfluss gewonnen hat, bleibt doch festzuhalten, dass die zunehmende Politisierung nicht allein von der politischen Rechten ausgeht. Advokatische Think Tanks wie die Heritage Foundation perfektionieren ähnlich wie Interessengruppen unter anderem auch Lobbying- und Graswurzelstrategien. Think Tanks – die in der US-amerikanischen Steuergesetzgebung als sogenannte 501(c)(3)-Organisationen firmieren – dürfen zwar kein Lobbying betreiben (das einen „substanziellen Anteil“ ihrer Aktivitäten ausmacht), um nicht ihren steuerlich vorteilhaften Status zu verlieren. Doch mittlerweile gibt es zahlreiche „zivilgesellschaftliche Vereinigungen oder Organisationen, die nicht nach Gewinn, sondern ausschließlich nach Förderung sozialer Wohlfahrt streben.“ Das sind Organisationen, die unter Paragraph 501(c)(4) der US-amerikanischen Steuergesetzgebung subsummiert werden – und deren Lobbying keine steuerlichen Konsequenzen nach sich zieht. Die Vertreter zentristisch orientierter, das heißt politisch/ ideologisch nicht identifizierbarer akademischer Think Tanks sehen sich zunehmend mit ideologischen Think Tanks konfrontiert, die im „Krieg der Ideen“ ihre Interessen vertreten. Das bedeutet indes nicht, dass diese Institute auch entsprechend an Einfluss gewonnen haben. Vielmehr vermuten Kenner der Szene, dass das Wuchern advokatischer Think Tanks einen Vertrauensverlust bei politischen Entscheidungsträgern und Geldgebern nach sich ziehen könnte: „Ich bin erstaunt, wie sich die Wertschätzung von Think Tanks entwickelt und frage mich, ob sie den Wert des Papiergeldes der Weimarer Republik annimmt – und so aufgrund der Proliferation (Wucherung – Anm. d. Red.) und der offenen Parteilichkeit einiger Institute an Wert verliert,“ urteilte etwa die Meinungsforscherin Karlyn Bowman (zitiert in: Andrew Rich / Kent R. Weaver, Advocats and Analysts, 1998, S. 250) vom konservativen American Enterprise Institute. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 49 AP Photo / The Tampa Bay Times, Eve Edelheit Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker Ideologisch geprägte Interessenvertretungen spielen eine einflussreiche Rolle in der US-Politik. Prominentestes Beispiel für einen konservativen Think Tank ist die Heritage Foundation, an deren Spitze der ehemalige Republikanische Senator Jim DeMint steht. Heritage Foundation – eine Stiftung mit Einfluss Kleine Sünden wider die reine Lehre bestraft das konservative Amerika heute schnell. Richard Burr, republikanischer Senator aus North Carolina, hatte es gewagt, an der Strategie einiger seiner Parteifreunde zu zweifeln. Der Versuch, die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama im letzten Augenblick auf dem Umweg über das Haushaltsrecht zu zerstören und dabei notfalls auch die Schließung der Regierung in Kauf zu nehmen, sei „die dümmste Idee, von der er je gehört habe“, sagte Blurr einem Journalisten. Die Antwort auf die offenherzige Bemerkung kam umgehend: ein Shitstorm. Internetforen diskutierten die Frage: „Ist Richard Burr noch konservativ?“ In seinem Heimatstaat North Carolina liefen überall Fernsehspots mit einer klaren Aussage: Dumm sei nicht die Konfliktstrategie der konservativen Republikaner, sondern im Gegenteil die Kompromissbereitschaft der Moderaten: „Es ist höchste Zeit, dass Richard Burr auf uns hört und nicht auf seine Freunde in Washington.“ Finanziert wurden die Werbespots von einer Organisation namens Senate Conservatives Fund. Deren Ziel ist es, wahre Konservative unter den Republikanern zu stützen und Abweichler zu bestrafen. Gegründet hat den Fonds James Warren DeMint, den in Washington alle „Jim“ DeMint nennen. Er […] gehört zu einer zunehmend einflussreichen Gruppe von Politikern, die die Republikanische Partei „reinigen“ wollen – in ihrem Sinne: keine Kompromisse mit linken Demokra- ten mehr, weniger Staat, Marktwirtschaft ohne Einschränkungen, kompromisslos gegenüber illegalen Einwanderern, „nein“ zur Schwulenehe und zu Abtreibungen, selbst nach Vergewaltigung und Inzest. Die Reinheit der Partei ist ihnen dabei wichtiger als Wahlsiege. […] Im Januar [2013] zog sich DeMint aus dem Senat zurück, um Präsident der Heritage Foundation zu werden. […] Ihr offizielles Ziel ist es, „konservative Politikentwürfe zu liefern, die auf den Prinzipien von freiem Unternehmertum, Begrenzung des Staates, individueller Freiheit, traditionellen amerikanischen Werten und einer starken nationalen Verteidigung beruhen“. Gegründet wurde Heritage 1973 von konservativen Republikanern, denen ihr damaliger Präsident Richard Nixon zu weit links war. Der Mitgründer und langjährige Präsident der Stiftung, Ed Feulner, schreibt im Rückblick: „Als wir 1973 anfingen, kontrollierten die Linken den Kongress und alle sozio-kulturellen Institutionen. Im Weißen Haus hatten wir einen Präsidenten, der durch Skandale geschwächt war und Preis- und Lohnkontrollen verordnete, den Sozialstaat ausbaute und nach Beijing fuhr, um Mao zu treffen. Wir hatten kaum Verbündete in Machtpositionen, wenn es überhaupt welche gab.“ Verbündete hatte die junge Stiftung allerdings in der amerikanischen Wirtschaft. Zu den ersten Spendern für die Stiftung gehörten reiche Unternehmer wie der Bierkönig Joseph Coors. [...] Vor drei Jahren [...] gründete Heritage eine Organisation namens „Heritage Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Action for America“. Heritage Action greift als Lobby-Gruppe direkt in den Prozess der Gesetzgebung ein, was Heritage als gemeinnützige Stiftung nicht darf. Schon das zeigt, dass der Ehrgeiz von Heritage heute weit über das hinausgeht, was die Gründer 1973 sich vorstellen konnten. Und der Wechsel vom langjährigen Präsidenten Ed Feulner, einem Ökonomen, zum Politiker Jim DeMint ist Programm. DeMint und Michael Needham, der Chef von Heritage Action, haben jedenfalls nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie die Spielregeln ändern und auch Republikaner bekämpfen würden, die ihnen nicht konservativ genug sind. Es ist ein Tabubruch, dessen Bedeutung man kaum überschätzen kann. Es ist ungefähr so, als würde die Friedrich-Ebert-Stiftung WahlkampfSpots gegen Andrea Nahles schalten. […] Jim DeMint dürfte das wenig stören. Er hat seine eigenen Methoden, um das Establishment der Partei zu ärgern. Zum Beispiel mit der Institution der „Wächter“ („Sentinels“). Wächter sind Politiker und Aktivisten, die ihre konservative Gesinnung bewiesen haben, etwa dadurch, dass sie nach den Kriterien von Heritage korrekt stimmten. Unter den republikanischen Abgeordneten und Senatoren erreichten nur 29 den Status. [...] Nikolaus Piper, „Ohne Rücksicht auf Verluste“, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. Oktober 2013 50 Politisches System der USA Andrew Rich / R. Kent Weaver, Advocats and Analysts: Think Tanks and the Politicization of Expertise, in: Allan J. Cigler / Burdett A. Loomis (Hg.), Interest Group Politics, Washington D.C. 1998, S. 235-254 Experten stimmen darin überein, dass es sehr schwierig ist, den wirklichen Einfluss von Interessengruppen und Think Tanks zu ermessen. Die meisten Politikwissenschaftler halten es für „zwecklos“, nach direkten Auswirkungen von Think-Tank-Aktivitäten zu fragen: „Solche Fragen könne nur stellen, wer die Komplexität des politischen Prozesses nicht in Rechnung stelle. In einzelnen Fallstudien seien Nachweise durchaus möglich, systematisch überzeugende Erklärungen (aber) wohl eine Illusion“, so der mittlerweile verstorbene Nestor der US-amerikanischen Politikwissenschaft Nelson Polsby im Gespräch mit Winand Gellner (1995, S. 22). Gleichwohl ist es offensichtlich, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die Eigenschaften und Arbeitsweisen von Think Tanks grundlegend verändert haben, was sich in einer Politisierung der Beratung US-amerikanischer Politik widerspiegelt: „In den ersten Jahrzehnten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Think Tanks allgemein als objektive und sehr glaubwürdige Produzenten von Expertisen für politische Akteure angesehen. In der heutigen, viel dichter besiedelten Think-Tank-Landschaft werden sie zunehmend zu streitsüchtigen Advokaten in balkanisierten Debatten über politische Richtungsentscheidungen, oder werden zumindest so wahrgenommen.“ (Rich/Weaver 1998, S. 250). Das ist genau das Ziel advokatischer Institute: Ihre klare politische Positionierung beschert ihnen bessere Sichtbarkeit in den Medien. Damit haben sie auch bessere Karten beim Fundraising. Denn die Geldgeber nehmen an, dass Think Tanks nicht nur direkt, sondern vor allem auch über die Medien indirekt Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen können. Medien als vierte Gewalt? Nicht erst seit Orson Welles‘ 1938 ausgestrahlter Radiosendung „Invasion from Mars“, nach der viele Hörer voller Angst auf die Straßen liefen, weil sie das, was ihnen vermittelt wurde, für real hielten, existiert der Mythos von den übermächtigen Medien. Er wurde bereits zuvor mit der Erforschung der Wirkung von Werbung und Propaganda verfestigt. Die Annahme omnipotenter Medien beherrschte auch lange Zeit die Medienwirkungsforschung. Mittlerweile wird der Medieneinfluss differenzierter gesehen: Zum einen bemühen sich die Medien selbst – oder werden von anderen als Medium bemüht –, um auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Zum anderen können sie aber auch mitentscheiden, worüber entschieden wird: indem sie ein Thema problematisieren oder ein zu lösendes Problem auf die politische Tagesordnung bringen. Neben dieser Agenda-SettingFunktion, wie sie 1972 die US-Forscher Maxwell E. McCombs und Donald L. Shaw beschrieben, können die Medien auch noch den Rahmen des Vorstellbaren abstecken: sprich mit Begriffen oder Metaphern das Problem und dessen Lösung begreifbar machen und dabei Einfluss nehmen oder manipulieren. In seiner analytischen Betrachtung der menschlichen Kommunikation unterschied der Journalist Walter Lippmann bereits 1922 zwischen der „Außenwelt“ und den „Bildern in unseren Köpfen“. Die Realität ist laut Lippmann zu groß, zu komplex und zu vergänglich, als dass sie von uns direkt wahrgenommen werden könnte. Da wir jedoch in ihr handeln müssen, behelfen wir uns damit, sie durch ein einfacheres Modell zu rekonstruieren, damit sie uns vertraut und umgänglicher wird. Diese Modelle, sprich (Sprach-)Bilder, liefern uns die Medien und die Medienmacher. Politik liegt für die meisten Menschen außerhalb ihres Erfahrungshorizonts, sodass sie von anderen erforscht und beInformationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 51 Yoon S. Byun / The Boston Globe via Getty Images Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker US-Politiker müssen den Bürgerinnen und Bürgern stets Rede und Antwort stehen. Ed Markey, 2013 Bewerber der Demokraten für einen Senatssitz in Massachusetts, beantwortet nach dem ersten Fernsehduell mit seinem Republikanischen Gegenkandidaten, Gabriel E. Gomez, Fragen der Presse. richtet werden muss. Auch die meisten US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner sind auf die Medien angewiesen, weil die wenigsten von ihnen sich ein eigenes Bild von dem machen können, was in ihrer Hauptstadt oftmals auch hinter den Kulissen politisch geschieht. Gleichwohl sind sie alle zwei bzw. vier Jahre aufgerufen, ihren politischen Willen in der Wahlkabine kundzutun. Zudem werden sie laufend von Demoskopen gebeten, zu allen möglichen Themen und Problemen ihre Meinung abzugeben. Die Medien, die Meinungsumfragen zum Teil auch selbst in Auftrag geben, konfrontieren Politiker dann gerne mit dieser „öffentlichen Meinung“. US-Politiker sind damit verpflichtet, ganz im Sinne der Gründerväter, stets ihren Bürgern Rede und Antwort zu stehen. In der heutigen Mediendemokratie sind sie aber ebenso gezwungen, sich an den täglich von Demoskopen ermittelten und oft widersprüchlichen Befindlichkeiten ihrer Wählerschaft zu orientieren. Die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung, sprich die Meinungsmacher in den Medien, gewinnen dadurch immer mehr Einfluss auf die Politik. Auch im (permanenten) Wahlkampf spielen Medien eine wichtige Rolle. Politiker versuchen ständig, durch Pressemitteilungen und indem sie „Ereignisse“ inszenieren, in die Nachrichten zu kommen. Das kostet wenig und erhöht den Bekanntheitsgrad. Umso schwieriger und teurer wird es für die Kandidaten, im Wahlkampf sichtbar zu bleiben. Die Werbespots in Radio und Fernsehen verschlingen das meiste der für den Normalbürger unvorstellbaren Summen an Wahlkampfgeldern, die die Kandidierenden – auch auf Kosten ihrer Regierungsarbeit – ständig einwerben müssen. Die Medien, die von diesem Geldsegen profitieren, sind verständlicherweise die verlässlichsten Anwälte der Redefreiheit (freedom of speech) und politisieren gegen jegliche Beschränkung von Wahlkampfspenden. Nach wiederholten Auslegungen des Obersten Gerichts der USA würde mit der Begrenzung von Wahlkampfspenden der erste Verfassungszusatz, das Grundrecht auf Redefreiheit, beschnitten. Indem Interessengruppen und deren political action committees den Kandidaten direkt Geld geben oder als sogenannInformationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 te unabhängige externe Organisationen die Qualitäten des einen preisen oder die Unfähigkeit des anderen anprangern, üben sie, selbstredend, ihr verfassungsmäßiges Recht auf Redefreiheit aus. „Money talks“, das trifft oft im wahrsten Sinne des Wortes zu. Geld kann dafür sorgen, dass in der politischen Auseinandersetzung einigen Interessen mehr Gehör verschafft wird als anderen. So werden mit Wahlkampfgeldern teure Werbespots finanziert und über eine Vielzahl privater Fernsehsender verbreitet. Seit den 1960er-Jahren hat das Fernsehen die Zeitungen in puncto Glaubwürdigkeit abgelöst. Laut Angaben der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch (Emil Hübner / Ursula Münch, Das politische System der USA, 2013, S. 107) bezogen 2010 knapp 60 Prozent der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner ihre Informationen aus dem Fernsehen; nur noch ein Drittel informiert sich über die Tageszeitungen, genauso viele nutzen Radio und Internet. Angesichts des Kommunikationsverhaltens von Jugendlichen, die auch ihre politisch relevanten Informationen immer häufiger im Internet und dabei vor allem über soziale Netzwerke beziehen, laufen die etablierten Medien, insbesondere das Fernsehen und die Tageszeitungen, Gefahr, künftig nur noch die Altersgruppe der Rentnerinnen und Rentner zu bedienen. Da die in hart umkämpften Einzelstaaten lebenden Zuschauer in Wahlkampfzeiten mit politischer Werbung überhäuft und abgestumpft werden, ist auch die persönliche Ansprache der Wähler wieder „modern“ geworden: zum einen durch freiwillige Wahlkampfhelfer, die von Haus zu Haus gehen (canvassing), zum anderen durch direct mail, ehedem über Datenbanken generierte und per Post versendete „persönliche Massenbriefe“, die nunmehr in Form von E-Mail-Kampagnen und über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook an den Mann oder die Frau gebracht werden. Mit den neuen zielgruppenspezifisch einsetzbaren Medien und Kampagnen über das Internet können sich Politiker immer mehr von den klassischen Massenmedien unabhängig machen, und ihre Wahlkampfhelfer, Finanziers und potenziellen Wähler direkt und permanent ansprechen. 52 Politisches System der USA Kommerzialisierung und Konzentration haben ihren Preis: weniger Auswahl und noch weniger Qualität: Nach Einschätzung von Emil Hübner und Ursula Münch (2013, S. 102) ist in den USA Qualitätsjournalismus zur Ausnahme geworden; der Großteil des Landes gleiche einer „Informationswüste“, in der es keine Vielfalt, sondern „nur die Vervielfältigung weitgehend gleicher, häufig sehr seichter Inhalte“ gebe. Die Medienlandschaft in den USA hat sich in den letzten Jahren merklich politisiert. Weit entfernt vom Ideal unabhängiger Berichterstattung verhalten sich viele US-Journalisten wie Matadore im politischen Zweikampf. Viele sind Teil von Koalitionen, die bestimmte Themen oder politische Tendenzen befördern (issue networks; advocacy coalitions). Die Grenzen zwischen Journalismus und politischem Aktionismus sind häufig nicht mehr erkennbar. Die offensichtlichsten Beispiele sind die TV-Sender Fox und MSNBC (ein Gemeinschaftsunternehmen von NBC Universal und Microsoft). Die Einseitigkeit der Medienangebote führt dazu, dass auch die Rezipienten in jeweils eigenen Welten leben. Die Zuschauer werden mit anderslautenden Meinungen nicht mehr behelligt. Die Republikaner informieren sich über Fox News; MSNBC dient den Demokraten als Informationsquelle. Beide Lager können sich mittlerweile auch im Alltag nicht mehr über die gleiche Realität unterhalten, weil die Wahrnehmungsunterschiede zu groß geworden sind. Ebenso wenig werden Kompromisse in der politischen Praxis belohnt, im Gegenteil: So wurde der Republikaner John Boehner, als er zur Behebung des Schuldenproblems im Sommer 2011 eine Einigung mit dem Demokratischen Präsidenten Obama ausgehandelt hatte, von Fox News, dem Sprachrohr der staatskritischen, von Milliardären wie den Brüdern Charles und David Koch finanzierten Tea Party-Bewegung, umgehend publizistisch in die Mangel genommen. Der Kompromiss ist bekanntlich gescheitert. Der Sprecher des Abgeordnetenhauses gilt seitdem als schwer angeschlagen. Boehner hat nunmehr große Schwierigkeiten, die eigenen Reihen zusammenzuhalten, um mit Präsident Obama politische Lösungen für drängende Probleme zu finden. Damit tragen auch die Medien zur Polarisierung bei, die mittlerweile das politische System der USA lähmt. Tom Pennington / Getty Images Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images Zwar wird von Vertretern etablierter Medien gerne eingewendet, dass mit der Beliebigkeit der Angebote im Internet die Qualität verloren gehe. Doch die Qualitätsberichterstattung wurde aufgrund der Kommerzialisierung und Konzentration der Medienwelt ohnehin schon längst ausgedünnt. Der US-amerikanische Medienmarkt wird (laut Hübner/ Münch 2013, S. 101) von fünf Medienimperien (Time Warner, Disney, Murdoch’s News Corporation, General Electric/NBC und CBS Corp.) mit 90 Prozent der Marktanteile beherrscht. Die Lockerung gesetzlicher Regulierungen, etwa 1996 mit dem Telecommunications Act, habe es den Megakonzernen erleichtert, auch ihre vertikalen Integrationsstrategien durchzusetzen, das heißt Produktion und Verteilung von Medieninhalten unter ein Firmendach zu bekommen. Der politisch interessierte Fernsehzuschauer hat die Wahl zwischen wenigen kommerziellen Stationen: der ABC (American Broadcasting Company), dem CBS (Columbia Broadcasting System) und der NBC (National Broadcasting Company), dem vom Medienmogul Ted Turner geschaffenen Nachrichtensender CNN (Cable News Network) sowie dem vom australischen Geschäftsmann Rupert Murdoch finanzierten Fox TV. Staatlich geförderte Qualitätssender wie PBS (Public Broadcasting System), C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network) oder NPR (National Public Radio) sind vom Aussterben bedroht, da sie laufend Schwierigkeiten mit ihrer Finanzierung haben. Auch der Zeitungsmarkt konzentriert sich auf immer weniger Anbieter. Vier von fünf Tageszeitungen in den USA befinden sich in der Hand von Konzernen; dem größten, der Thompson-Gruppe, gehören mittlerweile über 100 Tageszeitungen. Die Kommerzialisierung hat zur Konzentration und Ausdünnung der Medienvielfalt geführt. Es gibt in den USA heute nur noch wenige Städte, in denen die Bewohner mehr als eine Tageszeitung zu lesen bekommen. Auch die überregionalen, landesweit verbreiteten Blätter wie das Wall Street Journal, USA Today, die New York Times, die Los Angeles Times und die Washington Post kann man an einer Hand abzählen. Hinzu kommen die Wochenmagazine Time, Newsweek und US News and World Report. Noch informieren sich die meisten US-Amerikaner über das Fernsehen. Junge Leute nutzen aber zunehmend digitale Medien, um mehr über Politik zu erfahren. „Zuschauer“ in Fred’s Texas Café in Fort Worth 2013 Insbesondere die Printmedien leiden unter der veränderten Mediennutzung. In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Tageszeitungen drastisch reduziert. Zeitungskiosk auf Manhattans Upper West Side 2012 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 53 Michael Loccisano / Getty Images Chip East / Bloomberg via Getty Images Mittler zwischen Zivilgesellschaft und Politik: Themennetzwerker In den USA sind auch die Medien zunehmend polarisiert. Wer möchte, informiert sich in der jeweils eigenen Welt. Demokraten schauen TV mit MSNBC, … … während Anhänger der Republikaner ihre Informationen lieber beim konservativen Fernsehsender FOX beziehen. Eine Ära neigt sich dem Ende zu neue Eigentümer passiert.“ Diese Sätze lassen die Progressiven träumen: Wer, wenn nicht einer der größten Digitalstrategen der Gegenwart könnte neue Herangehensweisen jenseits aller Verleger-Denkweisen finden und ein Produkt entwickeln, das die Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt stellt? Wer, wenn nicht der Herrscher über schmalste Gewinnmargen könnte dem Journalismus beibringen, wieder Geld zu verdienen? Wer, wenn nicht der Erfinder einer digitalen Amazon-Verkaufsmaschine in Tablet-Form (Kindle Fire) könnte verstehen, wie ein Medienkonzern das Flachcomputer-Zeitalter angehen muss? Und welches Medienunternehmen hätte nicht Interesse an der Infrastruktur, die Amazon bietet – von den Nutzervorlieben bis zu den Lesegeräten? Doch auch die Skeptiker finden in Bezos die Projektionsfläche für die Angst vor einem Medienwandel, der in die falsche Richtung geht: Was ist mit dem Interessenkonflikt, den die Washington Post künftig in der Berichterstattung über Amazon, den Einzelhandel oder die Techbranche eingeht? Wer verhindert, dass die Zeitung zum Washingtoner Lobbyorgan für die Vorstellungen des Eigentümers wird? Genügt die Zusage, dass Bezos sich aus dem aktuellen Geschäft heraushält? […] Dass Geschäftsmänner in den USA zu Verlegern werden, ist kein Novum, sondern hatte im 20. Jahrhundert Tradition: John Whitney verdiente sein Geld mit Schwefelminen und Filmrollen, bevor er […] Jeff Bezos kauft die Washington Post. Der Mann, der aus dem Online-Buchversand Amazon mit viel Geduld und noch mehr Geschick die auf absehbare Zeit wichtigste Verkaufsplattform der Welt gemacht hat. […] Das Geschäft ist ein gewaltiger Einschnitt für die traditionelle amerikanische Medienbranche. „Der Eisberg hat gerade die Titanic gerettet“, titelte das Portal Salon. com. Für 250 Millionen Dollar übernimmt mit Bezos erstmals ein Internet-Unternehmer eine bedeutende Printmarke. Der Preis sei „für die moderne Zeit großzügig“, merkt New-Yorker-Chef David Remnick an und ergänzt nüchtern: Vor zehn Jahren hätten die Eigentümer allerdings ein Vielfaches erhalten. […] Amazon, so betonen die Beteiligten, ist an dem Deal nicht beteiligt. Damit sinkt die Gefahr, dass ungeduldige Aktionäre Bezos dazu drängen, das Traditionsunternehmen möglichst schnell auf Profitabilität zu trimmen und möglicherweise bald wieder abzustoßen. Und genau das ist es, was die Hoffnung in Belegschaft und Branche nährt. […] „Die Werte der Post müssen sich nicht verändern“, kündigte [Bezos] bereits in einem Brief an die Belegschaft an. Soweit die Aspekte, die jene erfreuen dürften, denen Berechenbarkeit wichtig ist. Doch schreibt Bezos auch: „Es wird in den nächsten Jahren Änderungen bei der Post geben. Das ist essentiell und wäre mit oder ohne Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 die New York Herald Tribune kaufte. Ohne den Finanzinvestor Raoul Fleischmann hätte es den New Yorker nie gegeben. William Randolph Hearst profitierte beim Aufbau seines Medienimperiums von den Bergbau-Millionen seines Vaters. Ist nun also die Zeit gekommen, in der Medienunternehmen wieder das Hobby von Milliardären werden? Immerhin ist es bereits der zweite Deal dieser Art in wenigen Tagen: Erst am Wochenende [2./3. August 2013] kaufte der Milliardär John Henry den Boston Globe. Bereits seit 2007 fördern die kalifornischen Immobilien-Milliardäre Herbert und Marion Sandler investigativen Journalismus mit der nichtkommerziellen Plattform ProPublica. Und selbst Facebook-Mitgründer Chris Hughes leistet sich im Alter von 29 Jahren mit dem Traditionsmagazin New Republic ein teures Hobby. Mit dem Verkauf der Washington Post scheint zumindest die Ära der Familienverleger in den USA zu Ende zu gehen: Vor den Grahams verabschiedeten sich bereits renommierte Eigentümer wie die Chandlers (Los Angeles Times) oder die Bancrofts (Wall Street Journal) aus dem Geschäft. Einziges Überbleibsel dieser Ära ist die Sulzberger-Familie, der die New York Times gehört. Wenn man so möchte, ist das Duell der beiden bekanntesten Tageszeitungen künftig auch das des Verleger-Establishments gegen die SiliconValley-Generation. Johannes Kuhn, „Jeff Bezos kauft der Branche Hoffnung“, in: sueddeutsche.de vom 6. August 2013 54 Politisches System der USA Josef Braml Aktuelle Probleme: Politikblockade D ie politische Ohnmacht Barack Obamas wird von vielen Beobachtern an seiner Person und Biographie festgemacht. Erinnert der amtierende Präsident doch ein wenig an Jimmy Carter, der vor seiner Amtsübernahme noch weniger politische Erfahrung hatte als Obama. Anders als etwa Lyndon B. Johnson, der in der Auseinandersetzung mit dem Kongress seine langjährige Erfahrung und persönlichen Kontakte als Abgeordneter, Senator und Vizepräsident in die Waagschale werfen konnte, sind beide mehr oder weniger als politische Novizen ins höchste Amt der USA gelangt. Diese vor allem von Historikern auf den Personenkult Mächtiger fixierte Sichtweise blendet jedoch aus, dass US-Präsidenten nicht alleine im politischen Vakuum regieren und einen gestandenen Beraterstab um sich scharen. Ausschlaggebend für den Politikstau (gridlock) in Washington sind in erster Linie die enormen sozialen und wirtschaftlichen Strukturprobleme, die auch Obamas „große Vorgänger“ ihm hinterlassen haben, sowie die grundlegenden Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen, die das Regieren beinahe unmöglich gemacht haben. In der derzeitigen Machtkonstellation sind Präsident und Kongress kaum in der Lage, wenigstens die akuten Probleme zu lösen – sei es die tickende Schuldenbombe zu entschärfen, die Wirtschaft wieder zu beleben, den Freihandel zu fördern, nachhaltig die Umwelt- und Energieprobleme zu lindern oder in der Außenpolitik eine liberale Weltordnung aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil: Die wirtschaftliche Schwäche vertieft die ideologischen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern. Das verstärkt die Dysfunktionalität und untergräbt die Legitimation des Regierungssystems und die Handlungsfähigkeit der Regierung. Demokraten und Republikaner konnten sich seit den Zwischenwahlen 2010 bei den wichtigen Fragen nicht mehr auf Kompromisse verständigen. Viele Republikaner stehen der Tea Party-Bewegung nahe und benötigen deren Unterstützung, um wiedergewählt zu werden. Die Anhänger der Tea Party betreiben jedoch Fundamentalopposition, sodass unter anderem auch bei der Anhebung der Schuldenober- Klaus Stuttmann Innen- und außenpolitische Herausforderungen setzen die Supermacht USA unter Handlungsdruck. Der Erfolg ihres Handelns wird davon abhängen, ob die politische Blockade überwunden werden kann. grenze im Sommer 2011 der Kongress und das Weiße Haus, namentlich Verhandlungsführer John Boehner und Barack Obama, sich nicht auf einen Kompromiss einigen konnten. Die Unfähigkeit der Politik hat schließlich die amerikanischen Ratingagenturen genötigt, die Kreditwürdigkeit der USA herabzustufen. Wie sehr das Grundvertrauen der US-Bevölkerung in ihre Regierung inzwischen erschüttert ist, offenbarte eine repräsentative Umfrage der Washington Post vom 9. August 2011, wonach acht von zehn Befragten unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie das politische System funktioniert bzw. nicht mehr funktioniert. Sieben von zehn Befragten stimmten der Begründung der Ratingagentur Standard & Poor’s zu, dass ihr Regierungssystem „weniger stabil, ineffektiver und weniger berechenbar“ geworden sei. Genauso viele potenzielle Wählerinnen und Wähler haben wenig oder keine Hoffnung, dass die Regierung in Washington die wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen kann. (www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/postpoll_080911.html) Diese Herkulesaufgabe wird umso schwieriger, als zudem der Handlungsspielraum des Präsidenten durch die Blockademacht des Kongresses – insbesondere durch dessen Haushaltsbewilligungsrecht, die power of the purse – massiv eingeschränkt ist. Insgesamt wird die Bewältigung der Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturprobleme viel Geld kosten, das den USA aufgrund der desolaten Haushaltslage fehlt. Der Schuldenberg Barack Obama hat ein schweres Erbe übernommen: eine ausgesprochen schlechte Wirtschaftslage und leere Haushaltskassen. George W. Bushs Butter-und-Kanonen-Politik, also Steuersenkungen trotz immenser Kriegsausgaben, hatte den Staatshaushalt stark belastet. Hinzu kamen dann Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Aktuelle Probleme: Politikblockade Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 © Congressional Budget Office (CBO) 2012, eigene Darstellung Schuldenstand 30.9.2013 © picture-alliance / dpa-infografik, Globus 17 973; Quelle: Office of Management and Budget, White House Gerhard Mester / Baaske Cartoons auch unter Obamas Führung milliardenschwere Rettungsund Förderprogramme, um die größte Wirtschafts- und Finanzkrise seit den 1930er-Jahren zu beheben. Bereits das Haushaltsjahr 2008 markierte mit 459 Milliarden Dollar ein Rekorddefizit. 2009 war der Fehlbetrag mehr als dreimal so hoch: 1413 Milliarden Dollar. In den beiden Folgejahren wurde der Staatshaushalt erneut um jeweils etwa 1300 Milliarden Dollar überzogen. Auch im Haushaltsjahr 2012, das am 30. September 2012 endete, bezifferte sich das Haushaltsdefizit auf über 1100 Milliarden Dollar. Da sich Jahr für Jahr weitere hohe Milliarden-Defizite anhäuften, musste die Gesamtschuldenobergrenze, die vom Kongress bereits im Februar 2010 auf 14 Billionen Dollar erhöht worden war, im Jahr 2011 erneut angehoben werden. Doch spätestens im Sommer 2011, im Zuge der Auseinandersetzungen um die Anhebung der Schuldenobergrenze, wurde deutlich, dass das politische System blockiert ist. Dass eine solche in der Vergangenheit routinemäßig abgewickelte Aktion dieses Mal zum heftigen politischen Streit wurde, verdeutlicht den Ernst der Lage. Selbst die Drohungen der Ratingagenturen, die Kreditwürdigkeit der USA herabzustufen, brachten die politischen Kontrahenten nicht zur Raison. So machte im August 2011 Standard and Poor`s seine Ankündigung wahr und stufte die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herab. Nach monatelangem ergebnislosem Tauziehen, das die Finanzmärkte in beständiger Unruhe hielt, konnte Präsident Obama Anfang August 2011 zwar dann doch noch den Budget Control Act unterzeichnen. Wie der Name des Gesetzes suggeriert, sind mit der Anhebung der Schuldenobergrenze um zunächst 900 Milliarden Dollar auch Ausgabenkürzungen verbunden: In den nächsten zehn Jahren sollen insgesamt 2400 Milliarden Dollar eingespart werden. Doch die zur Ermittlung der ersten Sparziele im Umfang von zunächst 1500 Milliarden Dollar eingesetzte überparteiliche Gruppe von Abgeordneten und Senatoren konnte sich bis zum vereinbarten Stichtag, dem 23. November 2011, nicht auf konkrete Vorschläge einigen. Deshalb ist seit März 2013 ein automatischer Mechanismus in Kraft getreten, der über alle Haushaltstitel verteilt, im sozialen wie im militärischen Bereich, Kürzungen nach dem Rasenmäherprinzip (sequestiation) durchführt. Die drastischen Ausgabenkürzungen und die Unsicherheit, wie lange diese Kürzungen dauern, drohen, den Konsumenten Kaufkraft und Kauflaune zu nehmen und die Konjunktur zu bremsen. Hinzu kam, dass staatliche Angestellte von ihren Arbeitgebern in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden mussten, weil sich die Kontrahenten gegen Ende des Haushaltsjahres (zum 30. September) nicht einmal auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Die meisten Regierungsgeschäfte wurden für 16 Tage stillgelegt, was das Land laut Berechnungen überparteilicher Forschungsinstitute auf das Gesamtjahr gerechnet rund 24 Milliarden Dollar Wirtschaftsleistung und über 120 000 Arbeitsplätze gekostet haben dürfte. (White House / Office of Management and Budget (OMB), Impacts and Costs of the October 2013 Federal Government Shutdown, Washington, D.C., November 2013, S. 2 ff.; http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/reports/impacts-and-costs-of-october-2013-federal-govern ment-shutdown-report.pdf) Nachdem im Herbst 2013 der Sturz in den sogenannten finanziellen Abgrund (fiscal cliff) in letzter Minute abgewendet werden konnte, ist Anfang 2014 der nächste Showdown zwischen Präsident und Kongress vorprogrammiert. Einmal mehr 55 56 Politisches System der USA muss die Gesamtschuldenobergrenze angehoben werden. Auf lange Sicht führt jedoch kein Weg daran vorbei, die drückende Staatsschuldenlast abzubauen. Um eine Einigung mit Präsident Obama zu finden, der beflügelt durch seine Wiederwahl nunmehr noch weniger als bisher bereit ist, seinen Parteigenossen im Kongress Ausgabenkürzungen zuzumuten, müsste John Boehner, der angeschlagene Parteichef der Republikaner im Abgeordnetenhaus, den Seinen mehr Einnahmen, also Steuererhöhungen abringen. Doch insbesondere die libertären, der Tea Party nahestehenden Republikaner wollen das Schuldenproblem lösen, indem nur die Ausgaben gekürzt werden. Die von den Granden der Tea Party-Bewegung patronierten und finanzierten Republikaner würden insbesondere mit höheren Steuersätzen einen „politischen Selbstmord“ begehen, zumal viele von ihnen auch öffentlich einen Eid gegen Steuererhöhungen geschworen haben. US-Abgeordnete sind entsprechend der Funktionslogik des politischen (Wahl-)Systems und der Politikfinanzierung politische Einzelunternehmer, keine Parteisoldaten. Bedroht durch mögliche – von anti-staatlichen political action committees und Partikularinteressen finanzierte – Gegenkandidaten bei den Vorwahlen für die im November 2014 anstehenden Kongresswahlen, werden viele dieser Abgeordneten zunächst an ihr eigenes Überleben denken und weniger an die öffentliche Wahrnehmung ihrer Partei, die laut Umfragen mehrheitlich für ein Scheitern der Haushaltspolitik verantwortlich gemacht wird. Spätestens seit den Zwischenwahlen 2010 ist die Schuldenlast politisch brisant geworden. Damals wurden auch republikanische Mandatsträger, die für Bushs 700-MilliardenRettungsplan gestimmt hatten, bereits von den libertären Anhängern und Herausforderern der Tea Party-Bewegung an den Pranger gestellt. In größerem Ausmaß wurden jedoch am Wahltag jene fiskalkonservativen Demokraten, die sogenannten Blue Dogs abgestraft, die in Wahlkreisen mit eher fiskalkonservativer Wählerklientel zur Wiederwahl anzutreten hatten. Selbst langjährige Abgeordnete wie der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Ike Skelton, und der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, John Spratt, mussten das jähe Ende ihrer 34- bzw. 28-jährigen Amtszeiten hinnehmen. Blockierte Wirtschaftspolitik Obama hat auch in seiner zweiten Amtszeit sehr wenig fiskal- und wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum, um die lahmende Wirtschaft wiederzubeleben. Sollte der Präsident versuchen, die Wirtschaft mit kreditfinanzierten Ausgaben anzukurbeln, wird er am Kongress scheitern, denn dort verhindern die libertären, staatskritischen Repräsentanten der republikanischen Tea Party-Bewegung die Kreditaufnahme, unterstützt von den fiskalkonservativen Demokraten. Auch sein Amtsvorgänger, Präsident George W. Bush, hatte bereits ähnliche Schwierigkeiten gehabt. Bushs Gesetzesinitiative für ein 700-Milliarden-Dollar-Stabilisierungsprogramm Reparaturbedürftig: die Infrastruktur Die Infrastruktur in den USA ist in einem Maße vernachlässigt und reparaturbedürftig, dass sie auch schon bei geringeren Einwirkungen als einem Hurrikan zusammenbricht. Schlaglochpisten, gekappte Stromleitungen, einsturzgefährdete Brücken oder löchrige Wasserleitungen, es besteht Reparaturbedarf. Doch für den öffentlichen Sektor wird immer weniger Geld zur Verfügung gestellt. Stromnetze: Die oberirdisch verlegten Kabel sind extrem anfällig. Jeder herabfallende Ast kann eine Leitung zerreißen und so mitunter ein ganzes Viertel von der Elektrizitätsversorgung abschneiden. Weil dies bei fast jedem stärkeren Sturm (Troubled Asset Relief Program, TARP) scheiterte beim ersten Versuch an der Blockadehaltung „seiner“ republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Erst als die Märkte panisch reagierten – der Dow-Jones-Index fiel nach der Abstimmungsniederlage vom 29. September 2008, laut einer Meldung der Zeitung The Economist vom gleichen Tag, innerhalb eines Handelstages um die Rekordmarke von über 700 Punkten –, gelang es Präsident Bush im zweiten Anlauf, die erforderlichen Stimmen seiner Parteifreunde zu gewinnen. Nach dieser Stimmabgabe, die für viele staatskritische Republikaner politisch riskant war, konnte sein Nachfolger Obama bei der nächsten Intervention – mit seinem 787 Milliarden Dol- passiert, raten Elektrizitätswerke den Bürgern zum Kauf von Generatoren. Trinkwasser: Viele veraltete Wasserwerke warten auf eine Sanierung. Die meisten Rohrleitungen sind mehr als 60 Jahre alt, viele mehr als 100. Jeden Tag versickern durch Lecks knapp 30 Millionen Liter Trinkwasser im Erdreich. Schule: Eine landesweite Übersicht über den Bauzustand öffentlicher Schulen in den USA fehlt. Ende der 1990erJahre sei bereits bei einem Drittel der Gebäude eine umfangreiche Sanierung erforderlich gewesen, sagt der Ingenieursverband ASCE. 2005 nutzten 37 Prozent aller Schulen improvisierte Klassenräume aus Fertigbauteilen. Flughäfen sind oft überaltert und überlastet, Verspätungen an der Tages- ordnung. Das aus den 1950er-Jahren stammende Flugleitsystem sollte nach Expertenansicht durch effizientere Modelle ersetzt werden. Brücken: Mehr als ein Viertel der rund 600 000 Brücken entsprechen nicht mehr optimalen Sicherheitsstandards, über 160 000 sind einsturzgefährdet. 2007 starben 13 Menschen beim Einsturz einer Autobahnbrücke. Staudämme: Das Durchschnittsalter der mehr als 85 000 Dämme liegt bei 51 Jahren. Viele weisen gravierende Sicherheitsmängel auf. „Marode und überaltert“, im Artikel: Damir Fras, „Anerkennung für den Staat“, in: Frankfürter Rundschau vom 1. November 2012 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Gerhard Mester / Baaske Cartoons Aktuelle Probleme: Politikblockade lar schweren American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) – dann nicht mehr mit parteiübergreifender Unterstützung rechnen und musste sich auf seine Parteifreunde im Kongress verlassen. Viele von ihnen, insbesondere fiskalkonservative Blue Dog-Demokraten, folgten ihm widerwillig oder widersetzten sich mit Verweis auf das aus dem Ruder laufende Haushaltsdefizit. Es ist bezeichnend, dass Präsident Obama seinen letzten großen Deal noch in der alten Legislaturperiode einfädelte – bevor die durch die Zwischenwahlen etablierten neuen Machtverhältnisse im Januar 2011 greifen konnten. Gegen Jahresende 2010 erwirkte er noch einen 800 Milliarden teuren Kompromiss mit der Legislative, indem er die Steuererleichterungen seines Vorgängers um zwei weitere Jahre fortschrieb und diese mit einer Verlängerung der maximalen Bezugsdauer der Arbeitslosenhilfe für weitere 13 Monate verband. Die neu in den Kongress gewählten republikanischen Mandatsträger (über 60 Abgeordnete und sechs Senatoren), von denen viele über die Tea Party-Bewegung in den Kongress gelangt waren, ebenso wie die seit den Wahlen verstärkt verunsicherten (fiskalkonservativen) Demokraten, haben es Präsident Obama seitdem verwehrt, weitere nennenswerte Wirtschaftsförderprogramme auf den Weg zu bringen. Auch seine Wiederwahl 2012 konnte diese Pattsituation nicht aufheben, weil mit der Mehrheit der Republikaner im Abgeordnetenhaus deren Blockademacht erhalten blieb. Freie Hand für freien Handel? Die Exekutive wird demnach weiterhin in der Exportförderung ihr Heil für mehr Wirtschaftswachstum suchen müssen. Bereits im März 2010 hat Präsident Obama per Exekutiverlass (executive order), das heißt ohne Mitwirken des Kongresses, die National Export Initiative (NEI) initiiert. Demnach sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre die US-amerikanischen Exporte verdoppelt werden. Auf die Unterstützung des Kongresses wird die Regierung nicht zählen können. Denn mit den Kongresswahlen vom November 2010 wurde auf der einen Seite des politischen Spektrums die freihandelsorientierte Fraktion der Blue Dog-Demokraten dezimiert. Ebenso wird auf der politischen Gegenseite der bei Handelsfragen wortführende Republikaner Kevin Brady große Schwierigkeiten haben, viele der eher protektionistisch gesinnten AbgeordneInformationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 57 ten, die über die libertäre Tea Party-Bewegung in den Kongress gelangt sind, auf Freihandelslinie zu bringen. Die Handelspolitik ist ein Beispiel par excellence für die Stärke des Kongresses – und damit auch für die vielfältigen Einwirkungsmöglichkeiten von Interessengruppen und Think Tanks – im politischen Entscheidungsprozess, denn internationale Handelsabkommen müssen vom Kongress ratifiziert werden. Bereits während der Amtszeit George W. Bushs, im Juli 2007, endete die vom Kongress befristet gewährte Trade Promotion Authority (TPA), wonach die Legislative die vom US-Präsidenten vorgelegten internationalen Handelsabkommen nur noch als Ganzes, das heißt ohne Änderungsanträge, annehmen oder ablehnen kann. Damit wird auch die Verhandlungsmacht des Präsidenten auf internationaler Ebene berührt: seine Kompetenz, Vereinbarungen ohne Wenn und Aber auch im eigenen Land politisch durchsetzen zu können. Die TPA, die damals noch unter der Bezeichnung „fast track“ firmierte, blieb schon dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton vom demokratisch kontrollierten Kongress versagt. Obama wird – auch aufgrund der Erfahrungen Bill Clintons und um seine Erfolgsaussichten zu erhöhen – in der künftigen Auseinandersetzung mit dem Kongress sicherlich mit Augenmaß handeln. Die Legislative hat zwar im Oktober 2011 noch jene drei bilateralen Freihandelsabkommen (mit Südkorea, Kolumbien und Panama) gebilligt, die bereits Bush im „Schnellverfahren“ durchboxen wollte. Sogar das Freihandelsabkommen mit Südkorea, das nach Aussagen des damaligen US-Handelsbeauftragten Ron Kirk das bedeutendste Abkommen der USA seit 15 Jahren darstellt und nach Einschätzung der U.S. International Trade Commission (2007) die US-amerikanischen Exporte um jährlich elf Milliarden Dollar steigern werde, konnte trotz massiver Intervention des Weißen Hauses – Obama hatte den G20-Gipfel in Südkorea im November 2010 als Stichtag genommen – erst nach dem Gipfel in Nachverhandlungen abgeschlossen werden. Die innenpolitischen Schwierigkeiten des Präsidenten, die TPA zu erwirken, beeinträchtigen auch die Verhandlungsmacht des Präsidenten im Rahmen der Doha-Runde der Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation. Ohne diese Handelsautorität ist auch nicht an umfangreiche Freihandelsinitiativen wie die Transpazifische Partnerschaft (TPP) zu denken – ganz zu schweigen von der in Washington weniger populären deutschen Initiative des Transatlantischen Handels- und Investitionsabkommens (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Zwar werden die aktuellen Verhandlungen auch von europäischer Seite belastet, indem etwa die französische Regierung entsprechend ihrer Praxis der „exception culturelle“ Kulturgüter vom Verhandlungstisch nehmen will und die US-amerikanische Seite darin bestärkt, ihrerseits Ausnahmen durchzusetzen. Doch problematischer sind die innenpolitischen Beschränkungen, die den Handlungsspielraum des US-Präsidenten schwächen. Denn viele der auf dem Capitol Hill tonangebenden Demokraten, nicht zuletzt auch einige (stellvertretende) Vorsitzende federführender Ausschüsse, sind protektionistisch eingestellt. Um ihre Wiederwahl nicht zu gefährden, nehmen sie insbesondere Rücksicht auf die spezifischen Interessen der Wähler bzw. Wahlkampffinanziers in ihren Wahlkreisen und Bundesstaaten. Die Stimmen der Freihandelskritiker finden durch die Organisation verschiedener Interessengruppen politisches Gehör. An vorderster Front kämpfen die Gewerkschaften: Sie wollen sicherstellen, dass die Lebensgrundlage US-amerikanischer Arbeitnehmer nicht durch die Niedriglohnkonkurrenz anderer Länder bedroht wird. Indem sie sich gegen die „Ausbeutung“ in anderen Ländern und für internationale Arbeitnehmerrechte als „Men- 58 Politisches System der USA Zeit-Grafik: „Lass uns tauschen“, in: DIE ZEIT vom 13. Juni 2013 schenrechte“ einsetzen, ziehen sie an einem Strang mit der Menschenrechtslobby. Ebenso kritisieren Umweltverbände Schädigungen der Umwelt in anderen Ländern und fordern internationale Standards in Handelsvereinbarungen. Die Agrarlobby ist zwar der natürliche politische Gegner der Ökobewegung, wenn es um wirtschaftliche Interessen auf Kosten des Umweltschutzes geht. Anders als die exportorientierte Agrarindustrie sieht der importbedrohte Teil der US-amerikanischen Landwirte jedoch im Freihandel eine Herausforderung anderer Natur: die Konkurrenz der Entwicklungsländer, die vor allem über die Doha-Runde zum Beispiel mit Baumwolle, Zucker oder Textilien auf den Weltmarkt drängen. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, so verfolgt diese häufig auch als „sonderbare Bettgenossen“ (strange bedfellows) bezeichnete Tendenzkoalition verschiedenster Interessengruppen, advokatischer Think Tanks sowie Abgeordneter und Senatoren ein gemeinsames Ziel: die Vereitelung der Freihandelspolitik. Volle Kraft zurück: Energie- und Umweltpolitik In der Energie- und Umweltpolitik hat Präsident Obama einmal mehr große Probleme, seine Versprechungen in die Tat umzusetzen. Bis auf Weiteres ist nicht daran zu denken, dass die multilateralen Post-Kyoto-Verhandlungen von den Vereinigten Staaten mitgetragen oder gar gefördert werden könnten. Auch in diesem Politikfeld machen viele Akteure im politischen System der USA ihren Einfluss geltend und bremsen die nötige Kurskorrektur. Gleichwohl sehen Experten zahlreicher Think Tanks und Politiker beider Parteien in der Entwicklung erneuerbarer Energien einen für die USA gangbaren Weg, sich aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus problematischen Weltregionen zu befreien. Angesichts der Verwundbarkeit der US-amerikanischen Wirtschaft und des Transportsektors sei es dringend erforderlich, energiesparende Technologien sowie Biokraftstoffe und andere Alternativen für die auf fossile Brennstoffe angewiesenen Wirtschaftszweige zu entwickeln. Auch Präsident Obama sah in der Umstellung auf erneuerbare Energien einen Ausweg aus der übermäßigen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und prophezeite eine Reindustrialisierung dank umweltsparender Technologien. Dass die Debatte in den USA nunmehr wieder rückwärtsgewandt ist und auf die von Präsident Obama ehedem so genannten „Energieträger der Vergangenheit“ abzielt, wurde bewirkt durch das Zusammenspiel einer Koalition von Ölindustrie, Private Equity-Firmen, die Milliarden in die die Shale-Gas-Förderung gepumpt haben, und gleichgesinnten Journalisten. Wer den überschwänglichen Meldungen der Medien Glauben schenkt, wähnt Amerika vor einem „goldenen Zeitalter“: Dank neuer Bohrtechniken zur Gewinnung von Gas und Öl aus Schiefergestein, dem sogenannten fracking, seien die USA auf dem Weg zur „Energieunabhängigkeit“, sie betrieben einen „finanziellen und politischen Kraftakt", um zur „Ölmacht“ zu werden. Ehedem vom Aussterben bedrohte Prärieregionen erlebten nunmehr einen wahren „Ölrausch“ und „Wirtschaftsboom“. Nüchtern betrachtet ergibt die Analyse der Fakten ein anderes Bild: Wirtschaft und Transportsektor in den USA sind massiv vom Erdöl abhängig, das auf absehbare Zeit zu einem Gutteil aus instabilen Weltregionen wie dem Mittleren Osten und Afrika importiert werden muss. Eine umfassende Analyse der Sicherheits-, Wirtschafts- und Umweltaspekte der gegenwärtigen Energieaußenpolitik der USA würde ein anderes „nationales Interesse“ nahelegen, nämlich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Doch entscheidend für das Ergebnis der politischen Auseinandersetzung sind auch in diesem Politikfeld Partikularinteressen. Mehr noch als nationale Ziele sind lokale, regionale, institutionelle und persönliche Ambitionen ausschlaggebend für die politischen Streitigkeiten; sie verlangsamen den in Gang gesetzten energiepolitischen Kurswechsel der USA. Indem Interessenvertreter ihre Partikularinteressen und Ideologien einbringen, ergibt der politische Entscheidungsprozess häufig ein suboptimales „Gemeinwohl“. Aber das ist der Preis einer pluralistischen Demokratie, in der das sogenannte nationale Interesse das jeweilige Ergebnis eines ständigen Aushandlungsprozesses ist – in dem manche Interessen und Ideen stärker als andere vertreten oder vertretbar sind. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Aktuelle Probleme: Politikblockade Seit 2007 erlebt das Land [die USA] einen Gasboom. Eine eigentlich alte, aber erneuerte Fördermethode – das sogenannte Fracking – erlaubt es seither, zuvor unerreichbares Gas aus dem Untergrund herauszuholen. Die Mengen scheinen so gewaltig, dass Vertreter von Industrie und Politik, Wissenschaft und Wall Street das neue Gas als den Stoff bezeichnen, der die USA von Grund auf verändert. Hunderttausende Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, billiges Erdgas soll Amerikas Industrie revitalisieren und die USA aus ihrer Finanz- und Wirtschaftskrise führen. Nordamerika sei „der neue Mittlere Osten“, jubelt die Großbank Citigroup in einer Analyse. […] Vordergründig sprechen die Fakten eine klare Sprache. Seit 2006 ist die Gasproduktion in den USA um 24 Prozent gestiegen. Ein knappes Viertel der Förderung entfällt inzwischen auf das, was durch Fracking ans Tageslicht kommt, das sogenannte Schiefergas. In einem weiten Bogen vom tiefen Süden bis zum Nordosten Amerikas wurden Tausende Bohrungen in das Erdreich getrieben. Aus rund einer halben Million Quellen wird Gas an die Oberfläche gebracht, in über 30 Bundesstaaten wird heute gefrackt – vor allem Gas, aber auch Öl. […] Geld fließt auf die Konten von Grundeigentümern, die Bohrrechte verkaufen, es beschert Städten und Staaten steigende Einnahmen und lässt Zulieferer an lukrativen Geschäften mit Dieselgeneratoren, Bohrgestänge oder Fracking-Chemikalien verdienen. Entsprechend euphorisch reagiert auch die Politik. Anfang 2012 schwärmte der sonst so kühle US-Präsident Barack Obama davon, dass Amerika „Gas für fast hundert Jahre“ habe. 600 000 Arbeitsplätze könnten durch die neue Bonanza geschaffen werden. Zugleich drückte der neue Überfluss den Gaspreis auf ein Zehnjahrestief. Der flüchtige Stoff kostet in den USA inzwischen rund dreieinhalb Mal weniger als in Europa und ist fünfmal billiger als in Asien. Deshalb wird in den Stromfabriken des Landes die besonders klimaschädliche Kohle zunehmend durch Gas ersetzt. Düngemittelfirmen, Chemieproduzenten oder Aluminiumschmelzen planen wegen der niedrigen Energiepreise angeblich schon jetzt, hundert neue Anlagen im Wert von etwa 80 Milliarden Dollar zu errichten. Selbst Amerikas Helden der Landstraße sollen umdenken: Bis 2019 dürften rund eine Million Lastwagen verkauft werden, die mit kostengünstigem Gas fahren, schätzt das Forschungsinstitut Pike Research. Skeptiker haben es angesichts all dieser Zahlen schwer. Am lautstärksten äußern sich die Umweltschützer. Sie warnen vor einer Verseuchung der Grundwässer durch Chemikalien, Metalle und radioaktive Stoffe, vor hohem Wasser- und Landverbrauch und sogar vor Erdbeben. Beim Fracking wird nämlich unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Sand und bis zu 700 teilweise giftigen Stoffen durch das Bohrloch in den Untergrund gejagt, um dort den in winzigen Gesteinsporen eingeschlossenen Rohstoff freizusprengen. Bislang haben Umweltbedenken die Entwicklung allerdings nicht aufhalten können. […] Aber möglicherweise sind es weniger die Umweltschützer, die Amerikas Gasboom gefährden, als vielmehr Geologie und Ökonomie. Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, korrigierte die amerikanische Energieagentur EIA schon im Januar 2012 ihre Zahlen über den Gasschatz radikal nach unten. […] Der Grund: Mit den zahllosen neuen Bohrungen gab es genauere Daten über die mehrere Bundesstaaten querende Marcellus-Formation. Deren förderbare Gasvorkommen sollen nun fast 70 Prozent kleiner sein als zuvor angenommen. Der staatliche U.S. Geological Survey prognostizierte gar, dass aus dem Marcellus-Feld im Extremfall nur etwa ein Zehntel des Gases herauszuholen sei, das ursprünglich einmal als förderbar galt. […] Die Skepsis mancher Geologen rührt auch daher, dass sich Schiefergasquellen womöglich schneller als erhofft erschöpfen. Sowohl die Prognosen über das tatsächliche Potenzial einzelner Vorkommen wie auch Angaben über deren Lebensdauer seien womöglich stark übertrieben, fand der Erdölgeologe und Energiefachmann Arthur Berman bei der Auswertung der Produktionsdaten einiger Tausend Quellen heraus. Weil deshalb aber ständig alte durch neue Förderstellen ersetzt werden müssen und jede Bohrung bis zu elf Millionen Dollar kostet, stellt sich die Frage nach der Ökonomie: ob sich mit Schiefergas überhaupt Geld verdienen lässt. […] Ist Amerikas Gasboom am Ende also eine riesige Blase, die ungeachtet der Umweltfragen aus geologischen wie aus wirtschaftlichen Gründen zu platzen droht? Mit einem eindeutigen Ja kann das gegenwärtig niemand beantworten – aber ebenso wenig mit einem klaren Nein. [...] Anders sieht es beim Schieferöl aus. Da weiß man: Die Fördermengen in den USA werden schon vom Jahr 2020 an wieder sinken. Deshalb werden auch die Energiestrategen der USA ihr Interesse an den bisher dominanten Ölregionen der Welt nicht verlieren. [...] Christian Tenbrock / Fritz Vorholz, „Amerika im Gasrausch“, in: DIE ZEIT Nr. 7 vom 7. Februar 2013 Mitarbeit: Heike Buchter, Johannes Voswinkel AP Photo / Detroit News, Dale Young Schiefergas – ein Glücksfall? 59 Fracking, die Gewinnung von Erdgas aus Schiefergestein durch Einleitung von Wasser und einem chemischen Gemisch, wird in den USA an vielen Stellen betrieben. Es hält die Energiepreise niedrig, blockiert dadurch aber die Entwicklung erneuerbarer Energien. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 60 Politisches System der USA Abwälzen außenpolitischer Lasten In der außenpolitischen Debatte wird gerne das „nationale Interesse“ bemüht. Die Protagonisten im politischen Diskurs versuchen, ihre Vorstellungen durchzusetzen, sprich die Worthülse „nationales Interesse“ mit ihren spezifischen Inhalten zu füllen, um ihre partikularen Interessen zu wahren. Im pluralistischen politischen System der USA gibt es seit jeher heftige Auseinandersetzungen zwischen Individuen, Organisationen und Institutionen, die je nach Politikfeld in unterschiedlichen Machtkonstellationen ausgefochten und entschieden werden. Den Ton angebenden außenpolitischen Mainstream einigt nach wie vor ein liberal-hegemoniales Weltbild, wonach die USA die Welt nach ihren Wertvorstellungen und Interessen ordnen. Gleichwohl argumentieren an den beiden Rändern des politischen Spektrums einerseits libertäre Republikaner und andererseits gewerkschaftsnahe Demokraten – aus unterschiedlichen Gründen – gegen das internationale Engagement der USA: Die einen, die libertär gesinnten Republikaner, sind besorgt um die „innere kapitalistische Ordnung“ und das wachsende Haushaltsdefizit und stellen sich gegen kostspieliges militärisches Engagement und zunehmend auch gegen Freihandel. Die anderen, die traditionellen, den Gewerkschaften nahen Demokraten (Old Liberals), verteidigen die „so- zialen Interessen Amerikas“ und positionieren sich gegen Freihandel und kostspielige Interventionen. Sie befürchten insbesondere, dass Mittel für internationale bzw. militärische Zwecke verbraucht werden und somit für innere soziale Belange fehlen. Der innen- und fiskalpolitische Druck in den USA wird eine kontroverse transatlantische Lastenteilungsdebatte forcieren. Die sich zuspitzende Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise verschaffte dem Demokraten Obama einen großen Vorteil bei den Präsidentschaftswahlen 2008 – aber auch ein umso größeres Problem als Präsident: Einem demokratischen Präsidenten fällt es in der Auseinandersetzung – selbst mit einem ebenso demokratisch kontrollierten Kongress – um einiges schwerer, die eigene Wählerbasis und seine Landsleute vom nachhaltigen außenpolitischen Engagement der USA zu überzeugen. Denn Barack Obamas Wahlerfolge 2008 und 2012 sind in erster Linie der erfolgreichen Mobilisierung der hispanischen und afroamerikanischen Minderheiten gutzuschreiben. Diese sind weniger daran interessiert, dass Amerika nation building betreibt, sprich weltweit Demokratien errichtet, sondern wollen vielmehr die knappen Ressourcen dafür einsetzen, die sozioökonomische Lage im eigenen Land zu verbessern. Ideelle Grundorientierungen US-amerikanischer Außenpolitik Idealtypische Grundhaltungen internationalistisch orientiert nach innen gerichtet Spielarten konservativ liberal konservativ liberal Hauptmotivation / zentrales Interesse Machtpolitisch garantierter zwischenstaatlicher Frieden; angesichts der Gefahr der Überdehnung eigener (politischer) Ressourcen jedoch Engagement mit Augenmaß (nur bei Bedrohung des „vitalen“ Sicherheitsinteresses, wenn Gefahr in Verzug ist) Schaffen einer Weltordnung demokratischer Staaten; Förderung von Freihandel; auch Intervention aus „humanitärem“ bzw. „moralischem“ Interesse, wenn „Wertinteressen“ oder „moralische Werte“ wie Menschenrechte oder „Religionsfreiheit“ auf dem Spiel stehen Verteidigung „grundlegender amerikanischer Interessen“, Handlungsfreiheit und strategische Unabhängigkeit; Sorge um die innere kapitalistische Ordnung und das Haushaltsdefizit; zwar für Freihandel, aber gegen kostspieliges militärisches Engagement Verteidigung „sozialer Interessen Amerikas“, Befürchtung, dass Mittel für int. / militärische Zwecke verbraucht werden und für innere soziale Belange fehlen; gegen kostspielige Interventionen und Freihandel Idealtypische Vertreter Pragmatische Realisten Idealisten, darunter 1. Progressive / „New Liberals“ (multilaterales Engagement) 2. Neo-Konservative und Christlich Rechte (unilaterales Vorgehen) Libertäre Traditionelle Liberale / „Old Liberals“ Protagonisten im politischen Diskurs Brent Scowcroft, Henry Kissinger, Verteidigungsminister Chuck Hagel zu 1.: Vizepräsident Joseph Biden zu 2.: Richard Perle bzw. Mike Huckabee Republican Study Committee (RSC) im Kongress & Tea Party-Bewegung Gewerkschaftsflügel der Demokraten Cato Institute Institute for Policy Studies Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Aktuelle Probleme: Politikblockade Sollten die europäischen Regierungen nicht bereit oder fähig sein, die ihnen zugedachten Lasten zu schultern, hätten sie weniger stichhaltige Argumente gegen eine Globalisierung der NATO, sprich die partnerschaftliche Anbindung pazifischer Staaten an die Allianz. Aber auch ohne das Instrument der NATO werden die USA versuchen, neue Mittel und Wege zu finden, um neben den transatlantischen Verbündeten auch Demokratien in Asien stärker in die Pflicht zu nehmen. Der auf Hawaii geborene US-Präsident Barack Obama stellte sich im November 2009 in Tokio als „erster pazifischer Präsident“ der USA vor. Ebenso machte die damalige Außenministerin Hillary Clinton mit ihrem Ausspruch „Amerika ist zurück!“ bereits im Juli 2009 in Bangkok deutlich, dass die USA die Zukunft der asiatischen Region mitgestalten wollen. Mit der Hinwendung nach Asien tragen die USA nicht nur ihrer neuen sicherheitspolitischen Bedrohungswahrnehmung und wirtschaftlichen Abhängigkeit gegenüber China Rechnung, sondern wollen auch ihre „Lasten weltweiter Verantwortung“ neu verteilen. Die Vereinigten Staaten wollen Institutionen in Asien, etwa das Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsforum (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) oder den Verband Südostasiatischer Staaten (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) für die eigenen Ordnungsvorstellungen in der Region nutzbar machen. Um die USA als pazifische Macht zu stärken, nahm US-Präsident Obama während seines Asienbesuches im November 2009 am APEC-Gipfeltreffen teil, wo er auch Gelegenheit hatte, sich mit den zehn Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Staaten zu beraten. Neben der künftigen, von Washington dominierten APEC-Agenda wurde dabei auch die Intensivierung der Beziehungen zwischen den USA und der ASEAN diskutiert. Für die USA ist die ASEAN-Integration höchst interessant: Bis 2015 sollen eine gemeinsame Freihandelszone und eine Sicherheits-, Wirtschafts- und soziokulturelle Gemeinschaft etabliert werden. Seit Obamas Amtsantritt erhöhten die USA ihre diplomatischen Anstrengungen, um schließlich am 22. Juli 2009 mit Hillary Clintons Unterzeichnung dem Vertrag für Freundschaft und Zusammenarbeit (Treaty of Amity and Cooperation, TAC), einem der Hauptdokumente der ASEAN, beizutreten. Damit wurde auch der Grundstein für den Beitritt der USA zum Ostasiengipfel (East Asia Summit, EAS) gelegt: Im November 2011 Oliver Schopf Washington hat bisher auf die kostspielige Strategie massiver Militärpräsenz gesetzt, um seine Energieressourcen und Handelswege zu sichern. Diese Strategie lässt sich wegen der schlechten sozioökonomischen Verfassung der USA und wegen des schwindenden innenpolitischen Rückhalts nicht länger aufrechterhalten. Der Einsatz unbemannter Flugkörper (Drohnen) zur Überwachung, Unterstützung und Bekämpfung feindlicher Ziele, aber auch zur Spionage und Aufklärung hat enorm zugenommen. Die Verlagerung der Kampf- und Aufklärungsarbeit auf Drohnen führt dazu, dass die klassische Luftwaffe an Bedeutung verliert und in diesem Bereich wie auch im Bereich konventioneller Truppen Investitionen massiv zurückgefahren werden. Dabei werden auch die ehedem in Deutschland stationierten Soldatinnen und Soldaten nach ihrem Afghanistan-Einsatz heimgeholt. Nach der in den USA parteiübergreifend gefeierten Tötung Osama bin Ladens und trotz der allgemeinen Einschätzung, dass damit die Terrorgefahr keineswegs beseitigt worden sei, erklärte laut einem Bericht der Washington Post vom 3. Mai 2011 die Hälfte der US-Bevölkerung, Amerika solle seine Truppen „so schnell wie möglich“ aus Afghanistan zurückziehen. Nach Auffassung des scheidenden US-Verteidigungsministers Robert Gates (zitiert in: Broder 2011) seien die US-Bürger, und nicht zuletzt auch die für die Finanzierung von Auslandseinsätzen ausschlaggebenden Abgeordneten und Senatoren im Kongress, müde, amerikanische Steuergelder zu verwenden, um über die NATO die Sicherheit trittbrettfahrender europäischer Länder zu gewährleisten. Experten der Heritage Foundation haben die Europäer seit Längerem schon als „Wohlfahrtspenner“ (welfare bums) kritisiert, die ihr Geld für Sozialleistungen ausgeben, aber wenig für ihre Sicherheit investieren und die Sicherung den USA überlassen. Den europäischen Alliierten werden weiterhin Gelegenheiten geboten, ihr „effektives multilaterales“ Engagement unter Beweis zu stellen, sei es mit einem verlängerten Mandat zur Polizeiausbildung in Afghanistan, mit einem stärkeren finanziellen Engagement beim Wiederaufbau im Irak, Afghanistan und Libyen oder bei Wirtschaftshilfen für Pakistan. Die US-Regierung unter Obama wird ihre diplomatische Arbeit intensivieren, um aus George W. Bushs viel gescholtener „coalition of the willing“ eine Koalition der Zahlungswilligen zu schmieden. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 61 Politisches System der USA AP Photo / Susan Walsh 62 Außenpolitisch richten die USA ihren Blick stärker nach Asien. Ausdruck dessen ist auch die Teilnahme von Präsident Barack Obama beim Gipfel der ASEAN-Staaten. „Familienfoto“ der Staats- und Regierungschefs 2011 in Nusa Dua auf Bali nahm Barack Obama als erster US-amerikanischer Präsident am Gipfel teil. Das Engagement der USA in der Region wird von den ASEAN-Staaten begrüßt, weil Amerikas Interessen auch ihre Handlungsspielräume, nicht zuletzt gegenüber China, erweitern. Um die pazifischen Länder wirtschafts- und handelspolitisch stärker an sich zu binden, versuchen die USA im Rahmen der Trans-Pacific Partnership (TPP) die Liberalisierung und Marktintegration in der transpazifischen Region voranzutreiben. Fraglich bleibt indes, ob der US-Präsident das dafür nötige innenpolitische Kapital aufbringen kann, um dem protektionistisch eingestellten Kongress dieses umfangreiche Freihandelsabkommen abzuringen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass auch die umworbenen Handelspartner Interessenkonflikte plagen, vor allem wenn diese Initiative gegen China gerichtet sein sollte. Denn Japan und andere Länder der Region genießen zwar einerseits den militärischen Schutz der USA, vor allem auch gegenüber China, doch teilen sie andererseits mit dem Reich der Mitte wichtige Handels- und Währungsinteressen. Peking und Tokio wollen ihre Währungsreserven peu à peu aus der „Dollar-Falle“ ziehen. Um den Dollar zu umgehen, hat China unter anderem schon zwei Vereinbarungen zur gegenseitigen Anerkennung von Währungen mit Japan und Südkorea geschlossen. Neben zahlreichen asiatischen Ländern hat China auch mit Brasilien, Indien und Russland vereinbart, den Handel untereinander in nationalen Währungen abzuwickeln. China arbeitet daran, eine multipolare Ordnung mit mehreren Leitwährungen zu etablieren. Früher oder später werden die Währungsmärkte die Kräfteverhältnisse im internationalen Handel abbilden – nämlich eine multipolare Ordnung mit drei Kraftzentren: Der Dollar wird auf absehbare Zeit seine Leitfunktion mit dem Euro und dem chinesischen Renminbi teilen müssen. Damit werden die USA aber künftig nicht mehr wie bisher den Gutteil der Währungsreserven anderer Länder zum Nulltarif erhalten und über ihre Verhältnisse, das heißt kreditfinanziert, wirtschaften können. Die USA versuchen derweil, sich aus der Schuldenfalle zu befreien, indem sie durch ihre Notenbank jene Staatsanleihen aufkaufen lassen, die über den Markt von ausländischen Investoren nicht mehr bedient werden. Dieses Vorgehen wird beschönigend als „quantitative Lockerung“ bezeichnet. In Wahrheit druckt man neues Geld. Die internationale Leitwährung Dollar gerät dadurch unter Druck, wird also abgewertet. Das hat zwei Nebeneffekte, die aus US-amerikanischer Sicht durchaus willkommen sind: Die Vereinigten Staaten können sich einerseits eines Großteils ihrer Schulden entledigen, andererseits verbilligen sich ihre Exportwaren und sind damit wieder mehr gefragt. Selbst wenn die Strategie, den Dollar zu schwächen, kurzfristig erfolgreich sein sollte, bleiben die langfristig grundlegenden Strukturprobleme der US-Wirtschaft bestehen: marode Infrastruktur, unzureichendes Bildungssystem, Vernachlässigung des Produktionssektors. Die Unausgewogenheit der Außenhandelsbilanz ist neben der hohen Staatsverschuldung ein weiteres strukturelles Problem der US-Wirtschaft (twin deficit). Das in den letzten Jahren angestiegene Handelsdefizit stellte die USA zunächst vor keine größeren Schwierigkeiten, solange die Lieferanten ihre Erlöse in den USA reinvestierten. Sollten Investoren jedoch Zweifel an der Produktivität, Wirtschaftskraft und Geldwertstabilität der USA hegen und ihre Erlöse für Waren und Dienstleistungen in anderen Ländern und Währungen sichern, etwa in Europa oder in Asien, würden der Dollar und die US-Wirtschaft noch massiver unter Druck geraten. Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme verstärken die von den Gründervätern angelegte Konkurrenz der politischen Gewalten so sehr, dass sie sich immer häufiger blockieren und die politische Handlungsfähigkeit im Innern wie nach außen lähmen. Zwar erheben die Vereinigten Staaten nach wie vor den Anspruch, eine liberale Weltordnung amerikanischer Prägung aufrechtzuerhalten, doch die wirtschaftliche Schwäche und die Einschränkungen der politischen Führung hindern sie zunehmend daran, ihre globale Ordnungsfunktion wahrzunehmen, indem sie sogenannte öffentliche Güter wie Sicherheit, freien Handel und eine stabile Leitwährung bereitstellen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass andere Länder die Vormachtstellung der USA, des sogenannten liberalen Hegemons, akzeptieren und seiner Führung folgen. Doch Washington wird in Zukunft voraussichtlich mehr Gewicht darauf legen, seine vitalen Eigeninteressen rücksichtsloser durchzusetzen und versuchen, Lasten abzuwälzen: sei es über die gezielte Schwächung der US-amerikanischen Leitwährung, über Protektionismus in der Handelspolitik oder über Lastenteilung in der Sicherheitspolitik. Dies wird Konkurrenten wie Verbündete in Asien und Europa vor neue Herausforderungen stellen. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Aktuelle Probleme: Politikblockade „Unser Schicksal liegt in unseren eigenen Händen“ [Robert] Kagan, leben wir noch in einer amerikanischen Welt? Ja. Das liberale internationale System und vor allem dessen Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vereinigten Staaten geschaffen wurden, sind immer noch da. Bislang hat noch keine Macht oder Gruppe von Mächten die Vereinigten Staaten überflügelt. Natürlich hat Amerika in den letzten Jahren etwas von seinem Glanz verloren. Aber die Vereinigten Staaten haben auch früher schon Turbulenzen erlebt, und, wichtiger noch, dank des Systems, für das sie sich seit dem Krieg einsetzen, geht es der Welt besser als jemals zuvor. Die Demokratie hat sich in alle Winkel der Erde ausgebreitet. 1939 gab es nur zehn demokratische Staaten. Von 1945 bis 2012 ist die Weltwirtschaft jährlich im Durchschnitt um vier Prozent gewachsen, und zum ersten Mal beschränkt sich das Wachstum nicht nur auf eine kleine Gruppe hochentwickelter Länder. Und schließlich hat es seit 1945 keine direkte Auseinandersetzung zwischen den Großmächten gegeben. Sie beschreiben hier eine unipolare Welt. Aber leben wir nicht inzwischen, wie viele in Europa dies gern sehen möchten, in einer multipolaren Welt? Das glaube ich nicht. […] In Wirklichkeit leben wir in einer unipolar-multipolaren Welt. Die Vereinigten Staaten dominieren die internationale Arena, und den zweiten Rang nehmen mehrere bedeutendere Mächte ein. Aber die Mächte, die das internationale System bilden, sind einander nicht ebenbürtig. […] Und das ist gar nicht schlecht. Eine multipolare Welt ist weder stabil noch friedlich und wäre letztlich eine Gefahr für den Frieden zwischen den Großmächten. Solch eine Konstellation spielt in der Regel den Autokratien in die Hände, da es keinen Polizisten gibt, der sie davon abhält, ihren Einflussbereich auszudehnen. Das entspricht nicht der gegenwärtigen Lage. Die Vereinigten Staaten sind immer noch in einer Hegemonialposition. Sie produzieren, wie schon zu Beginn der 1970erJahre, ein Viertel des weltweiten Reichtums. Ihre Militärmacht ist immer noch erdrückend. Der Bedeutungszuwachs Indiens, Brasiliens, der Türkei oder Südafrikas stellt keine Bedrohung für Amerika dar. Ich würde sogar sagen, er stärkt die Vereinigten Staaten, wie sie nach dem Krieg vom Aufstieg Westdeutschlands und Japans profitiert haben. Unterschätzen Sie da nicht den Aufstieg Chinas? Die Vereinigten Staaten besitzen eine außergewöhnliche geographische Lage. Sie sind von allen anderen Großmächten weit entfernt. Für China gilt das nicht. China ist zwar eine wirtschaftliche Supermacht, aber das Land ist eingekreist von Japan, Indien und Russland – sämtlich Großmächte, die sich einer geostrategischen Hegemonie Chinas widersetzen. Wenn die Welt wieder bipolar werden sollte, müsste China ganz Asien beherrschen. Die Vereinigten Staaten haben jedoch ihre Beziehungen zu Indien, Japan, Südkorea, den Asean-Ländern und auch Australien auf deren Wunsch hin intensiviert. Den Chinesen mangelt es einfach an Verbündeten, um den Vereinigten Staaten ihre Stellung im Pazifischen und Indischen Ozean streitig zu machen. Sie haben von „Turbulenzen“ gesprochen. Amerika erlebt also keinen wirklichen Niedergang? Seit mehr als vier Jahren leidet Amerika, das ist unbestreitbar. Aber Supermächte erleben ihren Niedergang nicht in so kurzer Zeit. […] Es ist nicht das erste Mal, dass Amerika sich in einer ernsthaften Krise befindet. In den 1930er-Jahren, in den 1970er-Jahren … Immer wieder wird unsere Dekadenz überschätzt. Man stellt sich vor, die Russen oder die Japaner oder die Chinesen würden Amerika bald verschlingen. Dennoch halte ich das für eine sinnvolle Mahnung. So sind wir gezwungen, uns immer wieder neu zu erfinden. Und auch diesmal, davon bin ich überzeugt, wird Amerika sich auf die neue internationale Lage einstellen. Ich habe den Eindruck, die Krise ist diesmal ernster als die früheren. Abgesehen von den aktuellen wirtschaftlichen Problemen, scheint Amerika noch nie so gespalten, das politische System so blockiert und die Ungleichheit so gewaltig gewesen zu sein. Werden diese Probleme nicht die internationale Macht der Vereinigten Staaten beeinträchtigen? Da bin ich weniger pessimistisch als Sie, weil ich nicht glaube, dass die amerikanische Nation ernstlich geschwächt wäre. Ist sie politisch gespalten? Ja, aber die Amerikaner teilen dieselbe Ideologie und dieselben Grundsätze, die der Unabhängigkeitserklärung, des Individualismus oder der Chancengleichheit. Nur herrscht heute keine Einigkeit über die Interpretation dieser großen Ideen. Aber – und das ist schon seit dem Unabhängigkeitskrieg so – die Verfassungsordnung wird nicht in Frage gestellt. Auch im Blick auf die Blockierung der Institutionen haben Sie recht. Aber in Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 63 der amerikanischen Geschichte standen die Parteien immer in heftigem Widerstreit zueinander. In der Wiederaufbauphase Ende des 19. Jahrhunderts waren Demokraten und Republikaner tief gespalten. Die Medien waren stets ein Abbild dieser Gegensätze. Der Fernsehsender Fox knüpft an diese Tradition an. Tatsächlich bildete die Zeit des Kalten Krieges, in der die Parteien enger miteinander kooperierten, eine Ausnahme, das vergisst man allzu oft. Was die Ungleichheit betrifft, so ist sie nicht erst in den letzten zehn Jahren entstanden. Sie hat sich seit mindestens drei Jahrzehnten entwickelt und hat im Übrigen keinen Einfluss auf die Außenpolitik. Dagegen gibt es eine psychologische Gefahr, die Amerika bedroht: Wenn die Amerikaner glauben, der Niedergang ihres Landes sei unabwendbar, könnten sie gerade dadurch den Sturz des Landes herbeiführen. Aber noch liegt unser Schicksal in unseren eigenen Händen. Sie sind also nicht beunruhigt? Ich bin relativ optimistisch, solange sich keine größeren strukturellen Veränderungen der internationalen Ordnung am Horizont abzeichnen. Wie jede politische Ordnung wird auch die amerikanische zusammenbrechen, aber nicht in den nächsten Jahrzehnten. […] Gibt es in der Außenpolitik eine ObamaDoktrin? Ich glaube, es ist falsch, die Diplomatie der amerikanischen Präsidenten allzu sehr zu personalisieren. Die Außenpolitik hängt zunächst einmal von den Umständen ab. Die der Vereinigten Staaten folgt seit dem Ersten Weltkrieg gewissen Zyklen. Auf interventionistische Phasen folgen stärker isolationistische: amerikanische Intervention im Ersten Weltkrieg, dann Rückzug in den 1920er- und 1930er-Jahren; der Zweite Weltkrieg und der Korea-Krieg, dann Beruhigung unter Eisenhower; der VietnamKonflikt, Rückzug unter Carter, große Aktivitäten unter Reagan, Zurückhaltung unter Clinton … Nach den Interventionen in Afghanistan und im Irak unter Bush war es ganz folgerichtig, dass Obamas Außenpolitik weniger intensiv ausfiel. […] Interview von Olivier Guez mit dem neo-konservativen Historiker und Republikanischen Politberater Robert Kagan Olivier Guez (Übersetzung Michael Bischoff), „Wir herrschen auch morgen noch“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. November 2012 64 Politisches System der USA Feldmann, Linda: In Politics, the Rise of Small Donors, in: Christian Science Monitor vom 28.6.2004 Fraenkel, Ernst: Das amerikanische Regierungssystem. Eine politologische Analyse, Köln/Opladen 1960, 399 S. Literaturhinweise AEI Studies in Public Opinion: American Public Opinion on the War on Terrorism, Washington, D.C., American Enterprise Institute, 10.1.2003 Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt am Main / New York 1988, 216 S. Ashcroft, John: Ansprache des Justizministers an die U.S. Attorneys Conference in New York vom 1.10.2002; Exzerpte in: Gorman, Siobhan: There Are No Second Chances, in: National Journal vom 21.12.2002 Ders.: Testimony of Attorney General John Ashcroft, Senate Committee on the Judiciary, vom 6.12.2001, http://www.justice.gov/ag/testimony/2 001/1206transcriptsenatejudiciarycommittee.htm Associated Press (AP): Clinton Declares U.S. ‘is Back’ in Asia, in: AP, 22.7.2009 Bagehot, Walter: The English Constitution, Ithaca (1867) 1966, 320 S. Baker, Ross K.: House and Senate, New York / London 1995, 272 S. Bellinger III, John B.: Will Drone Strikes Become Obama’s Guantanamo?, in: Washington Post vom 3.10.2011 Blumenthal, Sidney: The Rise of the Counter-establishment. From Conservative Ideology to Political Power, New York 1986, 345 S. Bothe, Michael: Die Entwicklung des Föderalismus in den angelsächsischen Staaten, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue Folge 31, (1982); S. 109-167 Braml, Josef: Der Amerikanische Patient, München 2012, 224 S. Ders.: Amerika, Gott und die Welt. George W. Bushs Außenpolitik auf christlich-rechter Basis, Berlin 2005, 159 S. Ders: Think Tanks versus „Denkfabriken“? U.S. and German Policy Research Institutes’ Coping with and Influencing Their Environments; Strategien, Management und Organisation politikorientierter Forschungsinstitute (dt. Zusammenfassung), Aktuelle Materialien zur Internationalen Politik 68, Stiftung Wissenschaft und Politik, BadenBaden 2004, 622 S. Broder, Jonathan: Bearing the Burden of NATO, in: Congressional Quarterly (CQ) Weekly vom 18.6.2011, http://public.cq.com/docs/weeklyreport/weeklyreport-000003891515.html#src=db Center for Responsive Politics: Reelection Rates Over the Years, Washington, D.C. 2013, http://www.opensecrets.org/bigpicture/reelect.php Dass: Blue Team Aided by Small Donors, Big Bundlers; Huge Outside Spending Still Comes Up Short, Washington, D.C., 7.11.2012 Cohen, Jon / Craighill, Peyton M.: More See Success in Afghanistan; Half Still Want U.S. Troops Home, in: Washington Post vom 3.5.2011 Congressional Budget Office: Haushaltsdaten vom 22.8.2012 Critchlow, Donald T.: The Brookings Institution, 1916-1952. Expertise and the Public Interest in a Democratic Society, DeKalb, IL 1985, 247 S. Economist: Presidential Election Results. How the Race Was Won, 6.11.2008 Ders.: The Bail-out Plan: A Shock from the House, 29.9.2008 Edsall, Thomas: Kerry Breaks Bush Record For Pace of Fundraising, in: Washington Post vom 17.6.2004, S. A1 Epstein, Lee / Walker, Thomas G.: Constitutional Law for a Changing America. A Short Course, 3. Aufl., Washington, D.C. 2005, 4. Aufl. 2008, 803 S. Friedl, Kevin / Gilbert, Mary: To Withdraw, Or Not To Withdraw?, in: National Journal Poll Track vom 15.7.2008 Gellner, Winand: Ideenagenturen für Politik und Öffentlichkeit. Think Tanks in den USA und in Deutschland, Opladen 1995, 276 S. Ders. / Kleiber, Martin: Das Regierungssystem der USA. Eine Einführung, 2., überarb. u. aktual. Aufl., Baden-Baden 2012, 300 S. Green, John / et al: Murphy Brown Revisited. The Social Issues in the 1992 Election, in: Cromartie, Michael (Hg.): Disciples and Democracy. Religious Conservatives and the Future of American Politics, Washington, D.C./Grand Rapids, MI 1994, S. 51 Hamilton, Alexander / Madison, James / Jay, John: Die Federalist Papers, Darmstadt 1993 (deutsche Ausgabe, hg. von Barbara Zehnpfennig), 583 S. Heclo, Hugh: Issue Networks and the Executive Establishment, in: Beer, Samuel / King, Anthony (Hg.): The New American Political System, Washington, D.C. 1978, 407 S. Hübner, Emil / Münch, Ursula: Das politische System der USA. Eine Einführung, 7., überarb. u. aktual. Aufl., München 2013, 207 S. Jäger, Wolfgang / Haas, Christoph M. / Welz, Wolfgang (Hg.): Regierungssystem der USA, 3. Aufl., München/Wien 2007, 563 S. Jann, Werner: Politik als Aufgabe der Bürokratie: Die Ministerialbürokratie im politischen System der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Demokratien, in: Politische Bildung 21 (1988) 2, S. 39-56 Klein, Ezra: The Health of Nations, in: The American Prospect vom 7.5.2007, http://prospect.org/article/health-nations Kohut, Andrew / Green, John C. / Keeter, Scott / Toth, Robert C.: The Diminishing Divide. Religion’s Changing Role in American Politics, Washington, D.C. 2000, 196 S. Koschut, Simon / Kutz, Magnus (Hg.): Die Außenpolitik der USA. Theorie – Prozess – Politikfelder – Regionen, Opladen 2012, 297 S. Lammert, Christian / Siewert, Markus / Vormann, Boris (Hg.): Handbuch Politik der USA, Wiesbaden 2014 (im Erscheinen) Lippmann, Walter: The World Outside and the Pictures in Our Heads, 1922, neu abgedruckt in: Wilbur Schramm (Hg.): Mass Communications, Urbana/Chicago/London, S. 468-486 Lösche, Peter (Hg.): Die Ära Obama: Erste Amtszeit (bpb-Schriftenreihe Bd. 1290), Bonn 2012, 224 S. Ders., (Hg.): Länderbericht USA (bpb-Schriftenreihe Bd.1690), 5., aktual. u. neu bearb. Aufl., Bonn 2008, 839 S. Ders.: Verbände, Gewerkschaften und das System der Arbeitsbeziehungen, in: ders. (Hg.): Länderbericht USA, Bonn 2008, S. 274-314 Ders.: Thesen zum amerikanischen Konservatismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft B49, Dezember 1982, S. 37-45 Mackenzie, Calvin / Labiner, Judith: Opportunity Lost: The Rise and Fall of Trust and Confidence in Government After September 11, Washington, D.C., Center for Public Policy Service at the Brookings Institution, 30.5.2002 Malbin, Michael J.: All CFI Funding Statistics Revised and Updated for the 2008 Presidential Primary and General Election Candidates, Campaign Finance Institute, Washington, D.C., 8.1.2010 Ders.: Unelected Representatives: Congressional Staff and the Future of Representative Government, New York 1980, 320 S. Mauch, Christoph: Die 101 wichtigsten Fragen – Amerikanische Geschichte, München 2008, 176 S. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 65 Ders. / Wersich, Rüdiger (Hg.): USA-Lexikon, 2., völlig neu bearb. u. erw. Aufl., Berlin 2013, 1334 S. Washington Post: Umfrage vom 9.8.2011, abrufbar unter http://www. washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/postpoll_080911.htm McCombs, Maxwell E. / Shaw, Donald L.: The Agenda-Setting Function of Mass Media, in: The Public Opinion Quarterly, 36 (1972) 1, S. 176-187 Dies.: Website: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/black-budget/?wpisrc=nl_pmpol McGann, James G.: Academics to Ideologues. A Brief History of the Public Policy Research Industry, in: PS: Political Science & Politics 25 (1992) 4, S. 733-740 Wayne, Stephen J. / Mackenzie, G. Calvin / Cole, Richard L.: Conflict and Consensus in American Politics, Belmont 2007, 704 S. National Election Pool: Exit Polls 2012 Obama, Barack Hussein: Remarks by President Barack Obama at Suntory Hall, Tokyo, Japan, 14.11.2009, http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/remarks-president-barack-obama-suntory-hall Ders.: Inaugural Address, 20.1.2009, http://www.whitehouse.gov/blog/ inaugural-address/ Office of Management and Budget (OMB): Budget of the United States Government, Fiscal Year 2013, Historical Tables, Washington, D.C. 2013, S. 251-252, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/ fy2013/assets/hist.pdf Pew Research Center for the People and the Press, Umfrage vom 21.25.5.2008, zitiert in: Congressional Quarterly (CQ) Weekly vom 9.6.2008, S. 1512 Weaver, R. Kent: The Changing World of Think Tanks, in: Political Science and Politics 22 (1989) 3, S. 563-579 Ders.: Think Tanks, in: Bacon, Donald C. / Davidson, Roger H. / Keller, Morton (Hg.): The Encyclopedia of the United States Congress, Vol. 4., 19571959, New York 1995, 2359 S. Welz, Wolfgang: Die bundesstaatliche Struktur, in: Jäger, Wolfgang / Haas, Christoph / Welz, Wolfgang (Hg.): Regierungssystem der USA, 3. Aufl., München/Wien 2007, S. 69-98 White House / Office of Management and Budget (OMB): Impacts and Costs of the October 2013 Federal Government Shutdown, Washington, D.C., November 2013, S. 2ff.; http://www.whitehouse.gov/sites/default/ files/omb/reports/impacts-and-costs-of-october-2013-federal-government-shutdown-report.pdf Zogby, John: Political Polls: Why We Just Can’t Live Without Them, eJournal USA, Vol. 12, Nr. 10, Oktober 2007, 5 S. (pdf) Pew Forum on Religion & Public Life / Pew Hispanic Center: Changing Faiths. Latinos and the Transformation of American Religion, Washington, D.C., Mai 2007, 154 S. (PDF) Pew Hispanic Center: An Awakened Giant: The Hispanic Electorate is Likely to Double by 2030, Washington, D.C., 14.11.2012 Rehnquist, William H.: All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime, New York / Toronto 1998, 253 S. (Reprint 2000, 288 S.) Rich, Andrew / Weaver, R. Kent: Advocates and Analysts: Think Tanks and the Politicization of Expertise, in: Cigler, Allan J. / Loomis, Burdett A. (Hg.): Interest Group Politics, Washington, D.C. 1998, S. 235-254 Internetadressen Atlantik-Brücke: www.atlantik-bruecke.org/ Deutsch-amerikanische Kultur-Institute in Deutschland: http://german.germany.usembassy.gov/germany-ger/dais.html Sabatier, Paul (1993): Advocacy-Koalitionen, Policy-Wandel und PolicyLernen: Eine Alternative zur Phasenheuristic. In: PVS-Sonderheft 24, S. 116-148 Deutsche Botschaft in Washington, D.C .: www.germany.info/Vertretung/usa/de/01__Botschaft/Washington/ 00/__Start.html Schlesinger, Arthur Jr.: The Imperial Presidency, Boston 1973, 505 S. Deutsches Historisches Institut in Washington, D.C.: www.ghi-dc.org/ Sebaldt, Martin: Transformation der Verbändedemokratie. Die Modernisierung des Systems organisierter Interessen in den USA, Wiesbaden 2001, 410 S. Library of Congress: www.loc.gov/index.html Steffani, Winfried: Parlamentarische und präsidentielle Demokratie: Strukturelle Aspekte westlicher Demokratien, Opladen 1979, 354 S. Nationale Vereinigung der Gouverneure (National Governors Association): www.nga.org/cms/home.html Stevenson, Richard / Nagourney, Adam: Bush’04 Readying for One Democrat, Not 10, in: New York Times vom 29.9.2003 Nationales Archiv der USA (National Archives): www.archives.gov/ Taylor, Paul / Cohn, D’Vera: A Milestone En Route to a Majority Minority Nation, Washington, D.C. 2012, http://www.pewsocialtrends. org/2012/11/07/a-milestone-en-route-to-a-majority-minority-nation/ U.S. Department of Commerce (U.S. Census Bureau): Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010, Washington, D.C., September 2011, 95 S. (PDF) U.S. International Trade Commission: US Korea Free Trade Agreement, Potential Economy Wide and Selected Sectoral Effects, 2007, http:// www.usitc.gov/publications/pub3949.pdf VandeHei, Jim / Edsall, Thomas: Democrats Outraising the GOP This Year. But Republicans Still Have Financial Lead, in: Washington Post vom 21.7.2004, S. A1 Vogel, David: Fluctuating Fortunes. The Political Power of Business in America, New York 1989, 337 S. Ders.: Kindred Strangers. The Uneasy Relationship between Politics and Business in America, Princeton 1996, 350 S. Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Oberstes Gericht der USA (US Supreme Court): www.supremecourt.gov/ US-Botschaft in Deutschland: german.germany.usembassy.gov/ US-Repräsentantenhaus: www.house.gov/ US-Senat: http://www.senate.gov/ Weißes Haus: www.whitehouse.gov/ 66 Politisches System der USA Schlagwörterverzeichnis Ad-hoc-Koalition................................................................ S. 18 Administration = Exekutive, Verwaltungsapparat ........................ S. 14 ff., 47 advocacy coalition = Tendenzkoalition ........................................S. 14, 44 ff., 52, 58 advocacy tank = advokatischer Think Tank .... S. 48, 58 agencies, federal agencies = Bundesbehörden ........................................................... S. 14 ff. agenda setting ................................................................... S. 50 amendment = Verfassungszusatz. S. 5 = Änderungsantrag (in der Gesetzgebung) ............. S. 11 Asien, APEC, ASEAN, TAC, EAS, TP .......................... S. 61 ff. Außenpolitik ................................................................. S. 60 ff. base = Wählerbasis, Kernwähler................................. S. 32 battleground states. S. 33 f. Bible Belt. S. 40 big government ........................................................... S. 14, 28 bill = Gesetzesvorlage.S. 10 Bill of Rights = erste zehn Verfassungszusätze ....... S. 5 Blue Dogs = fiskalkonservative Demokraten ...... S. 56 f. bully pulpit ...........................................................................S. 18 Bundesstaaten / Einzelstaaten . S. 27, 29 burden sharing = Lastenteilung(-sdebatte) ...... S. 60 ff. bureaucratic politics = Machtkämpfe innerhalb der Exekutive ............................................................................... S. 15 Bush-/Ashcroft-Doktrin.............................................. S. 22 f. campaign consultant = Wahlkampfberater/-experte ........................................ S. 39 canvassing ..................................................................... S. 40, 51 Capitol Hill = Sitz des Kongresses ............................. S. 9 f. case work = Bearbeitung von Bürgeranliegen ....... S. 12 categorial / block grants ................................................. S. 28 chairman = Ausschussvorsitzender ........................... S. 11 checks and balances .................................................. S. 5, 8 ff. Chief Justice = Oberster Richter (des Supreme Court) ..................S. 24 ff. Christian Right = Christlich Rechte; vgl. Evangelicals .... S. 31, 38 ff., 47, 60 civil liberties = persönliche Freiheitsrechte......................... S. 5 f., 23 f., 46 Civil Rights Act. S. 6, 40 Civil Rights Movement = Bürgerrechtsbewegung ..................................................... S. 5 civil service = Staatsdienst, Öffentlicher Dienst .......................... S. 16, 47 Commander in Chief = Oberbefehlshaber (Präsident) ............................ S. 17 ff., 34 committee / subcommittee = Ausschuss / Unterausschuss .......................................... S. 11 conference committee = Vermittlungsausschuss....................................................S. 10 Congress, U.S. Congress = Kongress (Parlament/Legislative)............................. S. 9 ff. Constitution = Verfassung .......................................... S. 4 ff. dealignment ....................................................................... S. 40 Defense of Marriage Act ................................................ S. 26 departments, executive departments = Ministerien ...........................................................................S. 16 devolution ............................................................................ S. 28 direct mail. S. 40, 51 divided / unified government............................ S. 9, 13, 34 Dixiecrats ............................................................................. S. 40 Dollar-Falle ......................................................................S. 62 ff. Drohnen ...........................................................................S. 21, 61 dual / cooperative federalism ................................... S. 27 f. due process ...................................................................... S. 23 ff. electoral college = Wahlmänner/-frauen-Gremium . S. 32 f. Energiepolitik. S. 58 f. enumerated / implied powers .................................. S. 27 f. Ethnische Gruppierungen ....................................... S. 36 ff. Evangelicals = Evangelikale ..............................S. 31, 38 ff. equal protection ................................................................ S. 23 Executive Office of the President (EOP) ................S. 15 ff. executive order = Exekutiverlass ................................. S. 57 executive privilege ............................................................ S. 15 Exekutive .......................................................................... S. 16 ff. Exzeptionalismus ................................................................ S. 5 federal grants-in-aid = Bundeszuweisungen an Einzelstaaten .................... S. 28 Federalists / Anti-Federalists, Federalist Papers .S. 27 Fernsehen.S. 51 ff. filibuster = Blockademanöver....................................... S. 13 fiscal cliff = Fiskalklippe ........................................ S. 32, 55 f. floor, House floor, Senate floor = Plenum (der jew. Kammer) .......................................... S. 11 f. Föderalismus .................................................................. S. 27 ff. Folter ....................................................................................... S. 21 Foreign Intelligence Surveillance Court = FISA-Gericht. S. 23 founding fathers = Gründerväter ............................. S. 4 f. fracking / shale gas = Schiefergasförderung. S. 58 f. freedom of speech = Meinungsfreiheit ......... S. 4, 38, 51 Freihandelsabkommen . S. 57 ff., 60 Generalklauseln (necessary and proper / general welfare / commerce clause) ........................................... S. 28 Gerichtssystem .................................................................. S. 24 gerrymandering. S. 31 f. Gesetzgebungsprozess (Grafik) .................................... S. 12 Gesundheitsreform / „Obamacare“........ S. 18, 26, 35, 49 Gewaltenkontrolle/-teilung .............................. S. 5 f., 8 ff. Gewerkschaften ......................................S. 29, 39, 46, 57, 60 Global War on Terror = Globaler Krieg gegen den Terror ..........................S. 7, 18 ff. God’s own country / Sendungs-, Nationalbewusstsein. S. 4 f., 7 grassroots movement = pol. Graswurzel-/ Basis-Bewegung...................................S. 34, 37, 40, 43, 45 ff. gridlock = Politikstau/-blockade / Regierungsunfähigkeit ..................... S. 10, 32, 36, 45, 54 ff. Guantánamo, US-Marinestützpunkt in Kuba .... S. 23 f. Handelspolitik .................................................................S. 57 f. Haushalt ............................................................................ S. 54 f. Hegemonie, hegemoniales Weltbild / Weltordnung. S. 60 ff. high crimes and misdemeanors = schwerste Verbrechen und Amtsvergehen ..............................................S. 18 f. horse trading = pol. Pferde-/Kuh-Handel ................. S. 18 immigration / Einwanderungspolitik .......... S. 35 ff., 45 impeachment = Amtsenthebungsverfahren .........S. 19 imperial presidency = imperiale Präsidentschaft .............................................. S. 18 inauguration = Amtseinführung .................................. S. 7 incumbent = Amtsinhaber ........................................... S. 30 independent (regulatory) agencies/commissions .... S. 15 Infrastruktur. S. 56 intelligence community = Nachrichten-/Sicherheits-/Geheimdienste ................................................ S. 20 ff. interest groups = Interessengruppen .................. S. 46 ff. internationales Engagement / Auslandseinsätze ........................................................ S. 60 ff. iron triangle = eisernes Dreieck. S. 14 Isolationismus .........................................................S. 60 f., 63 issue advertisements (ads) = Themenanzeigenkampagnen. S. 39, 46 issue network = Themennetzwerk ...... S. 14, 16, 44 ff., 52 Judikative .........................................................................S. 24 ff. Kabinett ............................................................................ S. 14 ff. lame duck = lahme Ente. S. 18 Latinos = Hispanics ..................................S. 31, 34, 36 ff., 60 law, public law (P.L.) = Gesetz .................................. S. 10 ff. leadership, political leadership = politische Führung............................................................. S. 18 Legislative .......................................................................... S. 9 ff. Legitimation ................................................................... S. 8, 54 liberale Demokratie. S. 4 f. Libertarians = Libertäre, libertäre Bewegung ......................... S. 42 ff., 60 Lobbying .................................................................... S. 47 ff., 58 majority leader = Mehrheitsführer (im Senat) ...... S. 13 matching funds = staatliche Wahlkampfgelder .... S. 40 Medien, Medieneinfluss.S. 50 ff. Medienunternehmen ......................................................S. 52 Menschenrechte. S. 4 f. midterm elections = Zwischenwahlen ............................. S. 18, 33, 35, 37, 54, 56 f. militärisch-industrieller Komplex. S. 18 minorities, ethnic minorities = ethnische Minderheiten. S. 6, 26, 34, 36 ff., 60 moral majority = moralische Mehrheit, moral / social issues ......................................S. 25 f., 34 ff., 45 multipolare Währungsordnung ............................S. 62 ff. national interest = nationales Interesse ........ S. 58, 60 f. nation building..................................................................S. 60 negative advertisements (ads) = Negativ-Wahlkampagne .......................................... S. 35, 39 neo-conservatives = Neo-Konservative ...................S. 60 Netzwerker, Themennetzwerker .................... S. 42, 44 ff. New Deal ................................................................. S. 28, 40, 45 New Federalism. S. 14, 28 New Liberals, Progressives = progressive Demokraten ................................................S. 60 non-party outside groups = unabhängige externe Organisationen ............... S. 39, 51 öffentliche Güter. S. 62 öffentliche Meinung / veröffentlichte Meinung .. S. 51 Old Liberals = gewerkschaftsnahe Demokraten ....S. 60 open seat .............................................................................. S. 30 Opposition .......................................................................... S. 8 f. outlaws = Gesetzlose ....................................................... S. 23 Oval Office = Büro des Präsidenten.............................S. 18 Parteien, (mangelnde) Partei-/ Fraktionsdisziplin .S. 9, 44 f. Parlamentarisches Regierungssystem................... S. 8 f. Patriot Act ............................................................................ S. 20 permanent government .............................................. S. 15 f. Personalernennungen. S. 14 ff. Pledge of Allegiance = Treueschwur ........................... S. 5 Pluralismus............................................................... S. 4, 58, 60 Polarisierung ..................................................... S. 8, 32, 45, 52 political action committees (PACs) / Super Pacs .................................................. S. 38 f., 46 f., 51, 56 political / policy entrepreneur = politischer Einzelunternehmer. S. 9, 46 f. popular vote = Wählerstimmen .............................. S. 32 f. posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) . S. 22 power of the purse = Haushaltsbewilligungsrecht ............................... S. 13 f., 54 Präsidentielles Regierungssystem. S. 8 ff. presidential government ............................................S. 14 f. primaries = Vorwahlen. S. 30, 44 f. progressive movement. S. 44 Protektionismus. S. 57 f., 60, 62 quantitative easing (QE) = quantitative Lockerung = Gelddrucken ....................................................................S. 62 ff. rally around the flag = patriotischer Sammlungseffekt ................................... S. 18 ranking member = stellvertretender Ausschussvorsitzender. S. 11 f. recess appointment = Ernennung außerhalb der Sitzungsperiode. S. 13 Rechtssystem, Rechtsquellen ..................................S. 24 ff. Religion, Religionsfreiheit, Zivilreligion ........ S. 4, 7, 38 Repräsentantenhaus / Abgeordnetenhaus. S. 10 ff. Repräsentation, repräsentative Demokratie ....... S. 4 f. revolving doors / in-and-out = Drehtürsystem (Personalrekrutierung) .......... S. 16, 47 f. rules committee = Verfahrensausschuss ................. S. 13 Schulden, Kreditwürdigkeit.S. 52, 54 ff. scorecards, voter guides = Wählerprüfsteine ....... S. 47 Senate = Senat ................................................................ S. 10 ff. sequestration = Haushaltskürzung nach dem Rasenmäherprinzip ........................................................... S. 55 shale gas = Schiefergas ................................................ S. 58 f. Sicherheitspolitik, NATO .......................................... S. 60 ff. Social Security .................................................................... S. 29 Soziale Netzwerke ................................................... S. 40 f., 51 speaker of the house = Sprecher des Repräsentantenhauses ........................................................................S. 13, 52 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 67 staff, congressional staff = Kongressmitarbeiter/ -innen .................................. S. 10, 12 State of the Union = Rede des Präsidenten zur Lage der Nation.S. 10 Supreme Court = Oberstes Gericht ............S. 4 f., 6, 24 ff. swing states .......................................................................... S. 33 Tea Party, Tea Party Movement ..... S. 42 ff., 45, 52, 54, 56 f. term limit ............................................................................. S. 30 Terroranschläge vom 11. September 2001 (9/11) . S. 7, 18 ff. Think Tanks = politikorientierte Forschungsinstitute .................................................... S. 12, 14, 16, 42, 47 ff. Trade Promotion Authority (TPA); früher: fast track .................................................................S. 57 twin deficit = Staatsschulden plus Außenhandelsdefizit...................................................................................... S. 62 Umweltpolitik ................................................................. S. 58 f. unified / divided government............................ S. 9, 13, 34 US-Präsident / Aufgaben und Funktionen (Grafik). S. 17 Verfassungssystem (Grafik) ........................................... S. 9 Verwaltung, Behörden................................................ S. 14 ff. Veto, suspensives = aufschiebendes ................... S. 9 f., 12 f. Volkssouveränität............................................................ S. 4 f. Voting Rights Act ....................................................... S. 5 f., 26 Wahlen/Wahlrecht ..................................................... S. 30 ff. Wahlkampf/Wählermobilisierung ................ S. 34 ff., 51 Wahlspenden/Wahlkampffinanzierung .... S. 38 ff., 43 waterboarding = Foltermethode des simulierten Ertränkens ............................................................................. S. 21 Watergate-Affäre .................................................. S. 19, 23, 45 White House = Sitz des Präsidenten........................ S. 9 ff. Wirtschafts-/Finanzkrise ..... S. 18, 28 f., 31, 34 f., 55, 59 f. Wirtschaftspolitik ............................................................ S. 56 wissenschaftliche Dienste des Kongresses ............ S. 12 Zeitungsmarkt ................................................................ S. 52 f. Der Autor Dr. Josef Braml ist seit Oktober 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Programms USA/Transatlantische Beziehungen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er leitet außerdem die Redaktion „Jahrbuch Internationale Politik“. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik (2002-2006), Projektleiter des Aspen Institute Berlin (2001), Visiting Scholar am German-American Center (2000), Consultant der Weltbank (1999), Guest Scholar der Brookings Institution (1998-1999), Congressional Fellow der American Political Science Association (APSA) und legislativer Berater im US-Abgeordnetenhaus (1997-1998). Ausbildungsstationen: Berufsausbildung zum Bankkaufmann; Wehrdienst Pionierbataillon 240; Abitur über den Zweiten Bildungsweg; Auslandssemester an der Université de Nice – Sophia Antipolis; Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien (Diplom) an der Universität Passau (1997); Promotion im Hauptfach Politikwissenschaft und in den Nebenfächern Soziologie und Französische Kulturwissenschaft an der Universität Passau (2001). Seine Fachgebiete: Amerikanische Weltordnungsvorstellungen und transatlantische Beziehungen; Sicherheits-, Energie- und Handelspolitik der USA; Wirtschaftliche und innenpolitische Rahmenbedingungen amerikanischer Außenpolitik; Vergleichende Governance-Analyse, u. a. deutsches und US-Regierungssystem; Religion und Politik in den USA Kontakt: [email protected]; https://dgap.org/de/think-tank/experten/203 Impressum Herausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Fax-Nr.: 02 28/99 515-309, Internetadresse: www.bpb.de/izpb, E-Mail: [email protected] Redaktion: Christine Hesse (verantwortlich/bpb), Jutta Klaeren, Magdalena Langholz (Volontärin) Gutachten und redaktionelle Mitarbeit: Ines Jurkeit, Alicante, Spanien; Dr. Simon Koschut, Akademischer Rat am Lehrstuhl für Auslandswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg; Prof. Dr. Peter Lösche, Kassel (bis 2007 Lehrtätigkeit am Institut für Politikwissenschaft der Georg-August-Universität Göttingen); Martin Neibig, Darmstadt; Jenny Rademann, Eisenhüttenstadt; Verena Waeger, Köln Titelbild: KonzeptQuartier® GmbH, Fürth; unter Verwendung von fotolia (NIcholas B, Andrea Izzotti, SergiyN); Stephen Crowley / The New York Times / laif Umschlag-Rückseite: KonzeptQuartier® GmbH, Fürth Gesamtgestaltung: KonzeptQuartier® GmbH, Art Direktion: Linda Spokojny, Schwabacher Straße 261, 90763 Fürth Druck: STARK Druck GmbH + Co. KG, 75181 Pforzheim Vertrieb: IBRo, Verbindungsstraße 1, 18184 Roggentin Erscheinungsweise: vierteljährlich. ISSN 0046-9408. Auflage dieser Ausgabe: 500 000 Informationen zur politischen Bildung Nr. 320/2013 Redaktionsschluss dieser Ausgabe: Dezember 2013 Text und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Der Text kann in Schulen zu Unterrichtszwecken vergütungsfrei vervielfältigt werden. Anforderungen bitte schriftlich an Publikationsversand der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb Postfach 501055, 18155 Rostock Fax: 03 82 04/66-273 oder E-Mail: [email protected] Absenderanschrift bitte in Druckschrift. Abonnement-Anmeldungen oder Änderungen der Abonnementmodalitäten bitte melden an [email protected] Informationen über das weitere Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb erhalten Sie unter der o. g. bpb-Adresse. Für telefonische Auskünfte (bitte keine Bestellungen) steht das Infotelefon der bpb unter Tel.: 02 28/99 515-115 von Montag bis Donnerstag zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr und freitags zwischen 8.00 Uhr und 15.00 Uhr zur Verfügung.