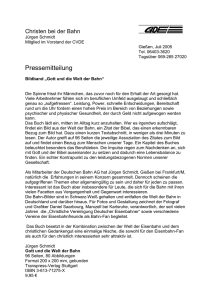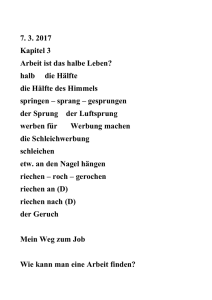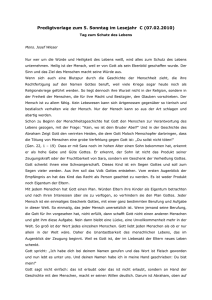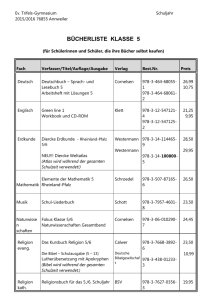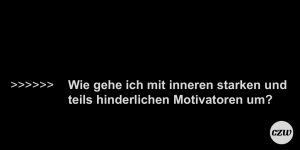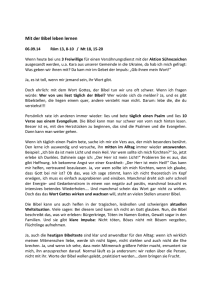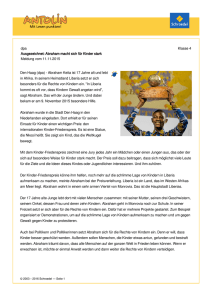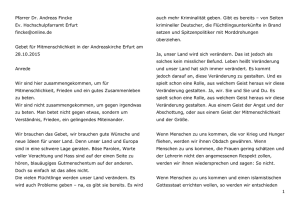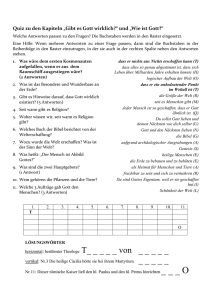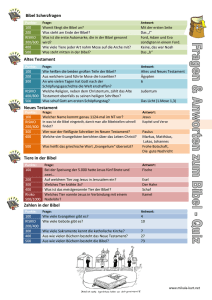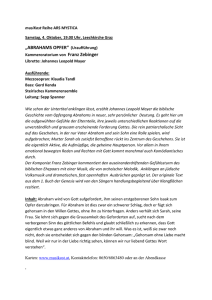Nach Gott fragen – Gottesvorstellungen und biblische - ISB
Werbung

Religionspädagogisches Zentrum in Bayern Jahrgangsstufe 1/2 Theologische Grundlegung zum Lernbereich 3 Nach Gott fragen – Gottesvorstellungen und biblische Glaubenszeugnisse Das Verb „fragen“ im Titel dieses Lernbereichs weist darauf hin, dass hier die sprachlichen und kognitiven Kompetenzen angesprochen sind, zu denen der gesamte Such- und Erkenntnisprozess gehört: zum Ausdruck bringen, sich austauschen, deuten. Wenn es um die Gottesfrage geht, haben wir es nicht mit etwas fertig Gegebenem zu tun, das wir in Sätzen und Bildern festschreiben könnten. Die Suche nach Gott ist die Suche nach Sinn. Sie bleibt immer unabgeschlossen. Sinn eröffnet sich, wenn etwas zur Sprache kommt. Zwar haben Menschen sich stets auch Bilder von Gott gemacht und solche hergestellt. Das alles hat seine Berechtigung. Doch muss jedes Bild immer wieder hinterfragt werden, so wie es auch die Bibel selbst tut, dieses ausdrückliche „Wort Gottes“. Die Bibel bietet an manchen Stellen bildhafte Vorstellungen von Gott, an anderen wiederum kritisiert sie diese, etwa, wenn Jesaja über die von Menschen gemachten Götterbilder spottet (Jes 44,9-20). Wenn der Mensch Sinn verstehen will, bleibt ihm kein anderes Mittel als die Sprache. Trefflich hat das der Philosoph HANS-GEORG GADAMER ausgedrückt: „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache.“ Deswegen sollte bei diesem Lernbereich nicht voreilig zu Buntstiften gegriffen werden, um Gott zu „malen“, sondern die Chance genutzt werden, das Gottesthema ins Wort zu bringen, gerade hinsichtlich dessen, dass in unserer Gesellschaft diesbezüglich eine verbreitete Sprachlosigkeit herrscht – selbst unter Christen. Der Religionsunterricht hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler auskunftsfähig zu machen über ihren Glauben. Das beginnt bei der Gottesfrage. Das Malen behält dann immer noch seine Berechtigung als Möglichkeit, sich der Gottesfrage auch meditativ und kreativ zu nähern. Aber dem sollte ein Sprachgeschehen vorausgehen. Die Rede von Gott nimmt ihren Anfang in der sprachlichen Kommunikation. Erst im Miteinander-Reden formt sich die eigene Gottesvorstellung. Aus vielfältigen Kommunikationsereignissen ist schließlich in einem langen, Jahrhunderte andauernden Prozess die Bibel hervorgegangen. An ihrem Ursprung stehen nicht historische Tatsachen, sondern die gelebte Gegenwart einer Gruppe, Gemeinde, eines Volkes, das sein Schicksal im Angesicht Gottes deutet und sich betend an ihn wendet. Immer ist dabei die Gottesfrage identisch mit der Sinnfrage. Um sie zu beantworten, werden frühere, mehr oder weniger historisch belegbare Traditionen in Form von Erzählungen oder Liedern herangezogen und immer wieder neu interpretiert. Deswegen ist es angemessen, wenn der 3. Lernbereich die Gottesfrage mit ältesten biblischen Überlieferungen wie der Abrahamserzählung verbindet. Damit wird ausgedrückt: Gottesvorstellungen kommen in einer Erzählgemeinschaft zur Sprache und über diesen Weg ins Bewusstsein des Einzelnen. Wenn man mit Kindern über Gott spricht, könnte etwa folgendes Gedankenspiel hilfreich sein: Gott ist unsichtbar und mit unseren Sinnen nicht zu fassen. Man kann hierbei ggf. einen Vergleich aus der Empirie heranziehen: Es gibt in unserer Welt mit Sicherheit Dinge und Sachverhalte, die man nicht sehen, hören, riechen, oder in die Hand nehmen kann, weil unser Körper dafür kein Werkzeug (wie Augen, Ohren, Nase, Hände) besitzt. Trotzdem gibt es sie. Elektrischer Strom etwa hat keine Farbe, keinen Geruch und ein stromführendes Kabel sieht nicht anders aus als ein neutrales Kabel. Wir können allenfalls die Wirkungen spüren. Oder wie kommt die Stimme des Sprechers aus der Rundfunkanstalt in unser Radiogerät? Durch elektromagnetische Wellen in der Atmosphäre. Wir sehen, hören, riechen sie nicht, noch können wir sie anfassen. Nur wer das passende Empfangsgerät hat, kann sie wahrnehmen und messen. Auch in uns selbst gibt es etwas, das die anderen weder sehen, hören, riechen noch anfassen können und man kann es auch nicht wiegen oder messen: unsere Gedanken. Wenn wir nicht mit unserer Stimme davon sprechen, bekommt niemand etwas davon mit. Trotzdem wird niemand ernsthaft bezweifeln, dass es sie gibt. Auch von der Musik, die sich ein Komponist in seinem Kopf ausdenkt, wissen wir nichts, erst wenn er sie aufschreibt. Hören wird man sie erst, wenn Musiker sie auf ihren Instrumenten zum Klingen bringen. Trotzdem gibt es diese Musik nicht erst, wenn sie erklingt, sondern schon im Kopf des Komponisten. Fazit: man braucht das richtige „Werkzeug“, damit Unsichtbares, Ungehörtes usw. sichtbar und hörbar wird. Ebenso ist es mit der Gotteserfahrung. Die körperlichen Augen und Ohren taugen nicht dazu, ihn wahrzunehmen. Wir nennen all das, was wir nicht mit unseren körperlichen Organen wahrnehmen und auch nicht mit empirischen Mitteln nachweisen können, Geist. Dazu gehören auch die Gedanken in meinem Kopf oder die Musik im Kopf des Komponisten und ebenso Gott. Nur wer das richtige „Werkzeug“, „Empfangsgerät“, bzw. die richtige „Antenne“ dafür hat, kann etwas von Gott erfahren oder erahnen. Das Herz des Menschen ist das Empfangsgerät für Gott schlechthin, wobei das Wort „Herz“ hier eine Metapher für eine innere Offenheit auf Gott hin ist. Genau so könnte man auch die Metapher „inneres Ohr“ verwenden. Von diesem Ohr ist in der Bibel oft die Rede. Unsere Gottesahnungen sind so gut wie unser „Empfangsgerät“. Der Philosoph JÜRGEN HABERMAS hat einmal zugegeben, er sei unmusikalisch für Gott. Damit wollte er nicht sagen, dass es keinen Gott gäbe, sondern nur, dass ihm selbst das Empfangsgerät dafür fehlt. So wie wir den elektrischen Strom nicht sehen können, aber seine Wirkung erfahren, können wir auch erfahren, dass Gott etwas bewirkt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Von solchen Wirkungen erzählt die Bibel, indem sie alte Überlieferungen so formt, dass darin ein herausrufender, mitgehender und beschützender Gott erfahrbar wird, wie dies beispielsweise in den Abrahamserzählungen, in einem alttestamentlichen Lied oder in der Erzählung Jesu vom guten Hirten geschieht. Dazu einige historisch-kritische Anmerkungen zur besseren Einordnung von Abraham: Seine Gestalt ist historisch nicht nachweisbar. Die Erzelternerzählungen lassen sich keinem zeitgeschichtlichen Horizont zuordnen. Die Exegeten sagen, dass sie auch nicht mit Völkerwanderungsvorstellungen in Verbindung gebracht werden können, sondern nur mit einem allgemeinen altorientalischen Milieu. Es handelt sich bei den Erzeltern um Idealpersonen, deren Handlungen typologisch aufzufassen sind, d. h., sie stellen einen überzeitlichen Typus für Menschen dar, die den Anruf Gottes verspüren und aus ihrer gewohnten Umgebung aufbrechen. Schon die Aussage des biblischen Textes (Gen 11,31), dass Abraham aus Ur in Chaldäa stammen soll, zeigt an, dass Abraham als Typus zu verstehen ist, denn Chaldäa hat es vor dem 8./7. Jh. v. Chr. noch gar nicht gegeben. Dieser Name kommt von den Neubabyloniern, auch Chaldäer genannt, die unter Nebukadnezar mit der Eroberung des Südreiches Juda 598/586 das Ende seiner Eigenstaatlichkeit besiegelt haben. Zuvor schon (722 v. Chr.) war das Nordreich Israel an die Assyrer gefallen. Auf die Abrahamserzählungen treffen wir erstmals in der bereits theologisch verarbeiteten Form der Tora und können sie nicht davon ablösen. Ihr plausibler Entstehungsgrund liegt in den Erfahrungen nach 722. In einer Zeit großer Umsiedelungsaktionen, zuerst durch die Assyrer, dann durch die Babylonier, wird hier die Führung und Berufung durch Jahwe betont: Unter Zuhilfenahme alter nomadischer Familiengeschichten wird verdeutlicht, dass Abraham nicht ein Spielball der Geschichte ist, sondern der von Gott Gesegnete. Die Abrahamserzählungen sind im Kern Vertrauensgeschichten für die Exilierten. Von daher besteht ein innerer Zusammenhang zu Ps 23, aber auch zu neutestamentlichen Texten wie dem Gleichnis vom guten Hirten (Lk 15,3-6), zur Rede von der falschen Sorge in der Bergpredigt (Mt 6,25) sowie zur vertrauensvollen Anrede Gottes als Abba/Papa (Mt 6,9), die allesamt im Lehrplan genannt werden. Das kann freilich nicht bedeuten, dass diese Texte ausführlich im Unterricht thematisiert werden sollen. Sie bilden gleichsam flankierende Sprachbilder für das Thema Hoffnung und Vertrauen als Ziel- und Angelpunkt jüdischchrist-licher Gottesvorstellungen. Aus: Reil, Elisabeth: Theologischer Leitfaden zum Fachlehrplan Katholische Religionslehre Grundschule. In: Katholisches Schulkommissariat in Bayern (Hg.): Handreichung zum LehrplanPLUS, Katholische Religionslehre in der Grundschule, München 2015, S. 33-55. www.rpz-bayern.de/handreichung_zum_lehrplan_plus.html