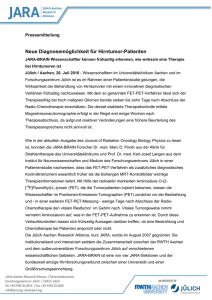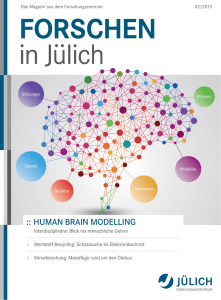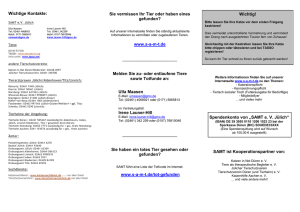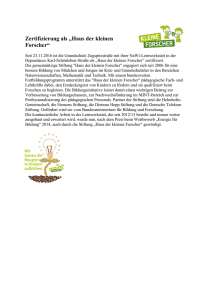(PDF / 4 MB) - Forschungszentrum Jülich GmbH
Werbung

Das Magazin aus dem Forschungszentrum :: WARUM DAS DENKEN STIRBT Jülicher Forscher verfolgen neue Spuren im Fall Alzheimer :: Schwarzer Kohlenstoff: Der unterschätzte Klimafaktor :: Fußgängersimulation: Probanden drängeln für die Wissenschaft 03|2013 :: IM BILDE Eine Erdkugel, der gerade die Luft ausgeht? Mitnichten. Die blau eingefärbte Kugel misst etwa einen zwanzigstel Millimeter und besteht aus reinem Wolfram. Entstanden ist sie in der Elektronenstrahltestanlage JUDITH. Jülicher Forscher setzen darin Werkstoffe hoher thermischer Belastung aus. Dabei kann sogar Wolfram – das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt aller Elemente – in Bruchteilen einer Millisekunde schmelzen und dann in bizarren Formen wieder erstarren. Die unter dem Rasterelektronenmikroskop erkennbaren „Kontinente“ zeigen, dass dabei offenbar kein einheitliches Kristallgerüst entsteht. Wolfram ist derzeit erste Wahl für einen Extremeinsatz: Es soll an besonders heiklen Stellen die Wand des künftigen Fusionsreaktors ITER auskleiden – und wird damit ein bis zu 100 Millionen Grad Celsius heißes Plasma ummanteln. 6 16 22 INHALT :: NACHRICHTEN 4 :: TITELTHEMA 6 6 Neue Verdächtige im Fall Alzheimer Heiße Spur bei der Fahndung nach den Ursachen 11 Was bringt eine Diagnose ohne Therapie? Interview mit Prof. Dieter Sturma :: FORSCHUNG IM ZENTRUM 12 12 Fernlaster: Motor aus – Brennstoffzelle ein Die saubere Energiequelle in der Fahrerkabine 14 Der unterschätzte Klimafaktor Rußpartikel gefährden Klima und Gesundheit 15 Auf dem Weg der Besserung Die arktische Ozonschicht erholt sich 16 MenschenmENGE Probanden drängeln für die Wissenschaft 18 Reifen, Reibung und schlaue Rechnungen Computer berechnen die perfekte Mischung 20 Die Stimme als Türöffner Wo das Gehirn unser Gegenüber beurteilt :: SCHLUSSPUNKT 22 22 Forschen im Forst Wissenschaftler begleiten Renaturierung in der Eifel 23 Impressum 3 | 2013 Forschen in Jülich 3 :: EDITORIAL „Die demografische Chance“ ist Thema des Wissenschaftsjahrs 2013. Ein Aspekt davon: Wir werden älter. Jedes Jahr steigt die Lebenserwartung eines Menschen in Deutschland um etwa drei Monate. Dieses Geschenk bringt neue Herausforderungen für die Forschung. Eine, der wir uns in Jülich stellen, ist die Grundlagenforschung zu Alzheimer. Wissenschaftler berichten in diesem Heft über neue Erkenntnisse zur Ursache der Krankheit, aber auch über mögliche Frühdiagnosen und Therapien, die sich daraus ergeben könnten. Lesen Sie außerdem den neuesten Stand zum Thema Ozonloch, warum Brennstoffzellen für Lkw-Fahrer attraktiv werden könnten und wie Drängeln im Namen der Wissenschaft sogar erbeten ist. Brennstoffzelle mit Erfolg im Dauereinsatz Institut für Energie- und Klimaforschung | Mit über 20.000 Stunden Dauereinsatz erreicht die Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC) eine neue Bestmarke und zeigt ihre Praxistauglichkeit. Die DMFC arbeitet mit flüssigem Methanol und nicht mit gasförmigem Wasserstoff wie die klassische Brennstoffzelle. Methanol hat Vorteile, da es auf kleinem Volumen viel Energie speichert und in kurzer Zeit getankt werden kann. Die Haltbarkeit der DMFC konnte durch systematische Entwicklungsarbeiten von wenigen Stunden auf die nun erreichten 20.000 Stunden gesteigert werden. Jülicher Forscher testen sie speziell als Batterieersatz in elektrischen Hubwagen für große Warenbestandslager. Weitere Anwendung findet sie in Hilfsstromaggregaten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung, etwa für Mobilfunkstationen und Rechenzentren. :: Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, Ihr Prof. Achim Bachem Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich Horizontalkommissionierer mit Direktmethanol-Brennstoffzelle Ultraschnelle Pulse für Rechner der Zukunft Daten zur Bodenfeuchte verbessern Wettervorhersage Institut für Bio- und Geowissenschaften | Vom Flugzeug aus haben Jülicher Forscher mit Partnern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Frühjahr die Bodenfeuchte im Rureinzugsgebiet gemessen. Diese beeinflusst den Austausch von Energie und Wasser zwischen Boden und Atmosphäre und ist ein Parameter, mit dem sich Wetter- und Flutvorhersagen verbessern lassen. Bei den Messungen testeten die Forscher die Kombination zweier verschiedener Typen von Mikrowellensensoren. Sie werden derzeit als Kombipack für eine NASA-Satellitenmission im Jahr 2015 optimiert. :: Messung der Bodenfeuchte beim Überflug über den Blausteinsee bei Eschweiler 4 Peter Grünberg Institut/Institute for Advanced Simulation | Jülicher Forschern ist es mit internationalen Kollegen gelungen, extrem kurze und schnelle Pulse aus Spinströmen kontrolliert zu erzeugen. Mit solchen Pulsen im Terahertz-Frequenzbereich könnten künftige Computer Daten schneller und energieeffizienter verarbeiten als heutige Rechner. Für die ultraschnellen Pulse nutzten die Forscher die Eigenrotation der Elektronen (den „Spin“). Dieser kann zusätzlich zur Ladung der Elektronen zur Informationsverarbeitung dienen. Das genaue experimentelle Vorgehen beschreibt das Forscherteam in „Nature Nanotechnology“. :: Forschen in Jülich 3 | 2013 NACHRICHTEN Tauziehen bei der Wundheilung Institute of Complex Systems/Institute for Advanced Simulation | Wunden heilen, indem sich Zellen immer wieder teilen und schließlich die offene Stelle mit neuem Gewebe überdecken. Überraschend ist: Neue Zellen drücken benachbarte nicht zur Seite, sondern ziehen einander – ähnlich wie beim Tauziehen – in eine Richtung. Dabei machen alle Zellen mit, auch weit von der Wunde entfernte. Simulationen bieten nun eine Erklärung für dieses koordinierte Vorgehen: Die Zellen ziehen in eine zufällige Richtung, kommen sie dort nicht voran, wählen sie eine neue. In dem neuen Gewebe baut sich dadurch eine Spannung auf, die möglicherweise die Heilung beschleunigt und die Wunde zusammenhält. Die Ergebnisse stellt ein internationales Forscherteam mit Jülicher Beteiligung in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) vor. :: Pflaster nicht nötig! Beim Verschluss einer Wunde entstehen neue Zellen, die darunter liegendes Gewebe offenbar wie ein Heftpflaster zusammenhalten. „La Ola“ treibt Einzeller an Institute of Complex Systems/Institute for Advanced Simulation | Flimmerhärchen (Zilien) bewegen Einzeller wie Pantoffeltierchen durchs Wasser oder transportieren Schleim und Schmutz aus den Atemwegen des Menschen. Dabei zeigen die bis zu 10 Mikrometer langen Miniwimpern Bewegungsmuster ähnlich wie eine „La-Ola-Welle“. Bisher war unklar, ob sie eine Funktion erfüllen und wie die Muster entstehen. Die Simulationen mehrerer Tausend Zilien in Flüssigkeit hat nun gezeigt, dass die Bewegung der umgebenden Flüssigkeit die entscheidende Rolle spielt. Sie sorgt für eine synchronisierte, selbstorganisierte Wellenbewegung. Verglichen mit einer „Ruderbewegung“ im Gleichtakt, treibt die wellenförmige Bewegung der Zilien Zellen auch doppelt so schnell und zehnmal so effizient an, wie Jülicher Forscher herausfanden. Ihre Ergebnisse sind im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) veröffentlicht. Die Erkenntnisse könnten helfen, Krankheiten mit Beteiligung der Flimmerhärchen besser zu verstehen oder künstliche Schwimmer zu konstruieren. :: 3 | 2013 Forschen in Jülich Mikroskopische „La Ola“: Flimmerhärchen in Flüssigkeit bewegen Zellen durch geordnete Wellenbewegung. 5 Neue Verdächtige im Fall Alzheimer 6 Forschen in Jülich 3 | 2013 TITELTHEMA | Alzheimer In der Alzheimerforschung verdichten sich die Hinweise, dass nicht Ablagerungen im Gehirn, sondern kleine lösliche Aggregate des Amyloid-beta-Peptids Nervenzellen und Synapsen zerstören – und damit die eigentlichen Auslöser für die Krankheit sind. Jülicher Forscher arbeiten daran, diese Aggregate unschädlich zu machen. Und es ist ihnen gelungen, sie als Biomarker für den Nachweis von Alzheimer zu nutzen. F ür Betroffene und Angehörige scheint es, als ob die Alzheimerforschung seit Jahren auf der Stelle tritt. Vielversprechende Medikamente, die im Tierversuch gute Erfolge erzielten, versagen in klinischen Tests reihenweise. „Es ist natürlich höchst ärgerlich, dass keiner der bisherigen Wirkstoffe hilft“, gibt Prof. Dieter Willbold zu. Er ist Direktor des Institute of Complex Systems (ICS) und in Jülich für den Bereich Strukturbiochemie zuständig. „Aber in der Grundlagenforschung ist von Stillstand nichts zu spüren“, betont er, „dort gibt es so viel zu tun, dass eher die Fördermittel und die Zahl der Forscherhände und -köpfe die limitierenden Faktoren sind.“ Da kommt es gelegen, dass sein Team für die beiden wichtigsten Arbeitspakete frische Fördermittel einwerben konnte. Zwei Millionen Euro fließen für die kommenden zwei Jahre aus dem Helmholtz-Validierungsfonds in die Jülicher Alzheimerforschung. „Damit versuchen wir unseren potenziellen Alzheimer-Wirkstoff durch die klinische Phase I zu bringen“, sagt Willbold zuversichtlich. Zehn Jahre intensiver Forschungsarbeit stecken in der Vorläufersubstanz D3 und weitere drei Jahre in dem nochmals verbesserten Derivat davon. Hierbei handelt es sich um ein Peptid, das aus einer relativ kurzen Kette von Aminosäuren aufgebaut ist. Es ist in der Lage, insbesondere die Amyloid-betaOligomere, die aus wenigen Dutzend Amyloid-beta-Molekülen bestehen, zu zerstören. Genau diese Amyloid-beta-Oligomere haben eine besonders fatale Eigenschaft: Sie sind im Gegensatz zu den sehr großen, aber viel bekannteren Fibrillen wasserlöslich – und können sich so über Körperflüssigkeiten im gesam- 3 | 2013 Forschen in Jülich 7 Heiße Spur bei der Fahndung nach den Ursachen Synapsen 4b 4a Kalzium-Ionen Ca 2+ 4 A lösliche Amyloid-beta-Oligomere unlösliche Protofibrillen Nervenzelle Protein-Rest 1 β-Sekretase 3 Amyloid-beta-Moleküle 2 APP γ-Sekretase Zellmembran 8 Forschen in Jülich 3 | 2013 TITELTHEMA | Alzheimer Einfache („monomere“) Amyloid-beta-Moleküle entstehen zeitlebens aus dem zelleigenen Amyloid-Vorläuferprotein (APP). Dazu wird das große Eiweiß in zwei Schritten von Enzymen, sogenannten Sekretasen, gekürzt: 1 Die Beta-Sekretase schneidet ein großes Stück außerhalb der Zellmembran ab. 2 Die Gamma-Sekretase kürzt weiter in der Membran zum Amyloid-beta. 3 Es entstehen Amyloid-beta-Moleküle. In ihrer monomeren Form scheinen sie unschädlich zu sein. Ihnen wird sogar eine schützende Funktion im Nervensystem zugesprochen. Mit fortschreitendem Lebensalter steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehrere Amyloid-beta-Moleküle zu größeren Molekülverbänden zusammenschließen. 4 Kleinere Aggregate, die aus zwei bis wenigen Dutzend Amyloid-beta-Molekülen bestehen, sind in Körperflüssigkeiten löslich. Diese sogenannten Amyloidbeta-Oligomere stehen im Verdacht, Nervenzellen und die Verbindungen zwischen ihnen zu schädigen und damit letztlich die Alzheimer'sche Demenz auszulösen. Zwei mögliche Mechanismen werden dabei diskutiert: 4a Die Oligomere lagern sich in die Membran von Nervenzellen ein und bilden Poren. Dadurch strömen Kalzium-Ionen unkontrolliert in die Zellen ein, sodass diese absterben. 4b Die Amyloid-beta-Oligomere binden an zelleigene Rezeptoren und lösen dadurch möglicherweise ein zellschädigendes Signal aus. A Gleichzeitig bilden sich die bekannten Amyloid-beta-Plaques, die aus unlöslichen Protofibrillen bestehen. B Neuere Forschungsergebnisse lassen darauf schließen, dass sie deutlich weniger zellschädigend als die Oligomere sind, jedoch ein Reservoir für die toxischen Amyloid-beta-Oligomere bilden. Mit mathematischen Modellen unterstützt Prof. Birgit Strodel die Suche nach einem Wirkstoff. ten System verbreiten. Sie stehen im Verdacht, die eigentlichen „Bösewichte“ zu sein, indem sie Synapsen und ganze Neuronen schädigen. Plaques Plaques B Amyloid-beta-Oligomere 3 | 2013 Forschen in Jülich KANÄLE DES VERGESSENS Wie sie das tun, erforscht Juniorprofessorin Dr. Birgit Strodel vom Institute of Complex Systems mithilfe von Computermodellen. Sie fand heraus, dass Aggregate aus vier oder sechs Amyloid-beta-Molekülen in der Lage sind, stabile Kanäle in Zellmembranen zu formen. „Durch diese Kanäle könnten KalziumIonen unkontrolliert in die Zelle strömen und sie zum Absterben bringen“, erläutert die Forscherin. Unterstützt werden ihre Ergebnisse durch elektronenmikroskopische Aufnahmen von Synapsen aus von Alzheimer geschädigten Hirnschnitten. Hier finden sich Poren, die im gesunden Gehirn so nicht vorkommen. Birgit Strodel hat mit ihrem Team zudem die mögliche Wirkungsweise von D3 in Computermodellen untersucht. „Wir konnten zeigen, wo D3 an das Amyloidbeta bindet und wie es binden muss, um die toxischen Amyloid-Aggregate aufzulösen“, erklärt Strodel. Die Angriffspunkte sind eine Reihe von negativen Ladungen an einem Ende der Amyloid-beta-Mole- 9 Prof. Dieter Willbold entwickelt mit seinem Team neue Therapie- und Diagnoseverfahren für Alzheimerpatienten. küle. Hier binden die Moleküle im Krankheitsfall andere Amyloid-beta-Moleküle und ordnen sich wie ein Faltblatt zu größeren Aggregaten an. D3 wiederum besitzt entsprechende positive Ladungen, die genau an dieser Stelle – der Bindungsstelle und dem Knick im Faltblatt – andocken, diese somit abschirmen und das Aggregat zerstören. Strodels Computermodelle sollen in Zukunft dabei helfen, D3 noch weiter zu optimieren. Um zu verstehen, wieso die Tage in den Labors von Willbold und Strodel mehr als 24 Stunden haben sollten, muss man wissen, welche Wirkung D3 bisher im Tierversuch gezeigt hat. Getestet wurden sogenannte Alzheimer-Mäuse, die das menschliche Amyloid-beta produzieren, typische Plaques im Gehirn bilden und später durch eine verminderte Lernfähigkeit auffallen. So vergessen diese Mäuse beispielsweise, wo unter einer trüben Wasseroberfläche eine Plattform versteckt ist, auf der sie stehen und sich vom Schwimmen ausruhen können. Wurde diesen Mäusen D3 im Trinkwasser oder per Infusion verabreicht, passieren drei Dinge: Die Amyloid-Plaques und typischen Entzündungsprozesse im Gehirn nehmen ab und gleichzeitig steigt das Lernvermögen. Dieter Willbold bittet um Geduld: „Die klinische Studie der Phase I, die jetzt beginnt, wird lediglich zeigen, ob die Substanz im Menschen sicher anwendbar ist. Ob es dort genau wie im Tierversuch wirkt, das wird erst in Phase II und III geklärt.“ 10 TEST SOLL KLARHEIT BRINGEN Entscheidend für diese klinischen Studien ist es unter anderem, die richtigen Patienten auszuwählen. Denn bisherige Testverfahren sind ungenau: Bei etwa 30 Prozent der Demenzkranken liegt eine andere Form der Demenz vor. „Zur besseren Diagnose und Verlaufskontrolle stehen zwar seit diesem Jahr mehrere Radiopharmaka zur Verfügung“, sagt Willbold (siehe auch „Was bringt eine Diagnose ohne Therapie?“, Seite 11), „andererseits sind diese Untersuchungen recht teuer“, gibt er zu bedenken. „Zudem interessieren uns die Amyloid-Plaques im Gehirn weniger als die Amyloid-OligomerLast in den Körperflüssigkeiten.“ In einer kürzlich veröffentlichten Studie stellt sein Team daher einen neuen Test vor, der Amyloid-Oligomere in der Rückenmarksflüssigkeit extrem empfindlich nachweist. Bei Gesunden ließen sich so gut wie keine Oligomere aufspüren. Bei Alzheimerpatienten und sogar schon bei Patienten mit ersten kognitiven Einschränkungen fanden sich dagegen sehr viele der toxischen Aggregate. Die Schwere der Demenz war dabei eindeutig an der Oligomer-Belastung im Liquor ablesbar. Nur ein mit Alzheimer diagnostizierter und schwer demenzkranker Patient gab den Forschern Rätsel auf. Bei ihm fand sich kein erhöhter Oligomer-Wert. „Es gibt zwar noch ein paar andere Erklärungsmöglichkeiten, aber ich gehe davon aus, dass der Betroffene falsch diagnostiziert war. Da die bisher verwendete Diagnostik nicht 100-prozentig richtig liegt, muss eine verbesserte, auf Biomarkern basierende Diagnosemethode zwangsläufig Unterschiede zur bisher verwendeten Diagnostik aufweisen“, meint Prof. Willbold. „Leider konnten wir den Patienten aus verschiedenen Gründen nicht nachuntersuchen, um dies zu klären“, bedauert er. Um den Test zu standardisieren und in Richtung klinische Anwendung weiter voranzubringen, stellt das Bundesforschungsministerium im Rahmen des sogenannten V.I.P.-Programms Fördermittel bereit. Willbold ist überzeugt: „Ein solcher Test wird viele klinische Studien beschleunigen und zuverlässiger machen und damit schneller zu einem wirksamen Alzheimer-Medikament führen.“ :: Brigitte Stahl-Busse Forschen in Jülich 3 | 2013 TITELTHEMA | Alzheimer Was bringt eine Diagnose ohne Therapie? Die Alzheimerdiagnostik steht vor einem Umbruch: Neue Marker zeigen AmyloidPlaques schon zehn bis zwanzig Jahre vor den ersten Anzeichen der Krankheit. Aber diese Diagnose stellt Ärzte und Patienten vor enorme Konflikte. Denn: Eine Therapie ist kurzfristig nicht in Sicht und die Rolle der Plaques noch nicht eindeutig geklärt. Prof. Dieter Sturma vom Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin, Bereich Ethik in den Neurowissenschaften (INM-8), nimmt hierzu in einem Interview Stellung. Frage: Was bringt eine Frühdiagnose der Alzheimerdemenz? Prof. Sturma: Erhebliche Probleme, aber auch sehr viele Optionen. Langfristige Perspektiven, die sich zum Beispiel in Patientenverfügungen ausdrücken, und Gegenwartsinteressen, die sich in einem ganz bestimmten Erlebniszustand ergeben, können in einen dramatischen Konflikt miteinander geraten. Das zeigt das Beispiel des kürzlich verstorbenen Schriftstellers und Rhetorikprofessors Walter Jens. Er hat sich vor seiner Demenzerkrankung gegen lebensverlängernde Maßnahmen ausgesprochen, falls er seine geistigen Fähigkeiten verlieren sollte. Dann aber hat er – mit seinen letzten Möglichkeiten der Bekundung, schon im fortgeschrittenen Alzheimerstadium – deutlich gemacht: Ich möchte nicht sterben. Im Fall von Walter Jens waren es die Worte: „Nicht totmachen, bitte nicht totmachen.“ Kein Arzt oder Angehöriger würde sich in dieser Situation zumuten, das Leben hier enden zu lassen. Frage: Gibt es ein Recht auf Wissen? Prof. Sturma: Sicher, es gibt eine Reihe von Menschen, die sagen, ich möchte das wissen. Zum Beispiel, um Vorkehrungen zu treffen und das Leben zu ordnen. Auf der anderen Seite gibt es auch das Recht auf Nichtwissen. Wenn jemand die Diagnose ein Dutzend oder sogar 15 Jahre vorher bekommt, dann wird er diese 15 Jahre nicht mehr in der Weise leben können, wie unter den Bedingungen von Nichtwissen. Gleichzeitig entwickeln etli- 3 | 2013 Forschen in Jülich che der Patienten mit Amyloid-Plaques im Gehirn gar keine Demenz. Diese Menschen leben dann viele Jahre unter einem Damoklesschwert. Das beeinflusst die Möglichkeiten, ihr Leben selbst zu bestimmen, grundlegend. Es ändert sich natürlich alles, wenn es plausible Erwartungen auf eine Therapie gibt. Frage: Sind Mediziner auf diese ethischen Konflikte gut vorbereitet? Prof. Sturma: Nein, in der Regel nicht. Ein mehrsemestriges ethisches Begleitstudium gehört meiner Meinung nach unbedingt zur medizinischen Ausbildung. Denn Entscheidungen über Leben und Tod stellen sich heute in allen Lebensphasen: vom Embryo bis zu lebensverlängernden Maßnahmen bei komatösen Patienten. Es gibt eine zu geringe professionelle Auseinandersetzung mit diesen Prof. Dieter Sturma, Leiter des Bereichs Ethik in den Neurowissenschaften vielschichtigen Situationen. Dazu gehört auch, Regelungen zu finden, wie Patienten im Fall von demenziellen Erkrankungen Risiken und Diagnosen mitgeteilt werden sollten. :: Das Gespräch führte Brigitte Stahl-Busse. Neue Diagnoseverfahren unterstützen die Forschung Die neuen Radiopharmaka, die Amyloidbeta-Plaques per Positronenemissionstomografie (PET) im lebenden Gehirn aufspüren, heißen: Florbetapir, Florbetaben und Flutemetamol. Für die Forschung steht zudem eine Substanz zur Verfügung, die PiB (Pittsburgh compound B) genannt wird. Damit können potenzielle Medikamente nun viel früher und an der richtigen Patientengruppe getestet werden. Denn bisherige Tests, ob eine Alzheimerkrankheit vorliegt, sind zu 30 Prozent falsch. An der Zulassungsstudie für Florbetaben war das Forschungszentrum Jülich beteiligt. Gleichzeitig ermöglichen die neuen Marker eine Verlaufskontrolle. Florbetaben wird in Zukunft auch dafür eingesetzt, um zu verfolgen, wie das Jülicher Peptid D3 die AmyloidPlaques im Gehirn lebender AlzheimerMäuse reduziert. 11 Herkömmliche Motoren sind umweltbelastende Verschwender, wenn sie laufen, um Strom für Klimaanlage und andere elektrische Geräte im Lastwagen zu erzeugen. Ein motorunabhängiges Brennstoffzellenaggregat, das Jülicher Wissenschaftler entwickelt haben, nutzt Diesel besser aus. F ür Fernfahrer ist ihr Lkw häufig nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Schlafkabine und Wohnraum. Gerade in den Ruhepausen wollen sie auf Klimatisierung, Kommunikationstechnik und Kochplatte nicht verzichten. Um den Strombedarf zu decken, gibt es eine einfache Möglichkeit: Man lässt den Motor im Leerlauf an. Nach einer Untersuchung von 2007 summieren sich die Leerlaufzeiten eines einzigen durchschnittlichen US-Trucks jährlich auf gigantische 1.700 Stunden, also auf rund 70 Tage. Dabei verbraucht der Lkw im Mittel 11.000 Liter Diesel und produziert Lärm, Ruß und klimaschädliche Abgase. Inzwischen machen das einige USStaaten nicht mehr mit: Sie haben AntiLeerlauf-Gesetze erlassen. Dies auch in dem Wissen, dass der Motor im Leerlauf Diesel nur äußerst unzulänglich in Strom umwandelt: Die Energieausbeute, von Fachleuten Wirkungsgrad genannt, liegt Kerosin oder Diesel Reformer Shiftreaktor Wasserstoff Dampf HT-PEFC Luft Wasser Luft Katalytbrenner 12 M Kühlmedium Abgas SAUBERE LEISTUNG Das Aggregat ist etwa 1,10 Meter breit, einen Meter hoch und 70 Zentimeter tief. Es besteht aus mehreren Komponenten (siehe Grafik): Der sogenannte Reformer wandelt Diesel mit Wasserdampf und Luft in ein Gas um, das reich an Wasserstoff ist. Daneben enthält es aber rund 10 Prozent Kohlenmonoxid, Strom an Bord Reformat Luft lediglich bei rund 10 Prozent. In Europa ist das Problem der Bordstromversorgung dank kürzerer Strecken, einem dichten Netz von Autohöfen und eher gemäßigtem Klima nicht so bedeutsam. Trotzdem gibt es auch hierzulande Bedarf an umweltfreundlichen und energieeffizienten Hilfssystemen. Ein solches Aggregat, basierend auf Brennstoffzellen, haben Jülicher Wissenschaftler entwickelt. Es liefert eine elektrische Leistung von 5 Kilowatt, die für die meisten Lastwagen ausreichend ist. Im Testbetrieb hat es bewiesen, dass es Diesel umsetzen kann und komplett eigenständig arbeitet. Anodenabgas Kathodenabluft Ein Reformer und ein Shiftreaktor erzeugen aus Diesel wasserstoffreiches Gas für die Brennstoffzelle. Dort reagiert der Wasserstoff mit Luftsauerstoff zu Wasser und erzeugt dabei elektrischen Strom. Verbleibende Abgase werden in dem folgenden Katalytbrenner verbrannt. Dadurch entsteht Abwärme, die wiederum Dampf für den Reformer erzeugt. Der dargestellte Brennstoffzellentyp ist eine sogenannte Hochtemperatur-Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (HT-PEFC) mit einer dünnen phosphorsäuregetränkten Polymermembran als Elektrolyt, der Anode und Kathode trennt. Forschen in Jülich 3 | 2013 FORSCHUNG IM ZENTRUM | Brennstoffzellen Prof. Werner Lehnert und Prof. Ralf Peters planen schon die nächste, kompaktere Bordstromversorgung mit Brennstoffzellen. das die Brennstoffzelle lahmlegen – „vergiften“ – würde. Der nachgeschaltete Shiftreaktor (Fachsprache) hat daher die Aufgabe, diesen Kohlenmonoxidanteil auf unter ein Prozent zu verringern. Dabei produziert er zusätzlichen Wasserstoff, den Brennstoffzellen als Brenngas verwerten können. „Die Hochtemperatur-Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (HT-PEFC), die wir im Aggregat verwenden, toleriert diesen Kohlenmonoxid-Gehalt von rund einem Prozent ohne größere Leistungseinbußen“, sagt Prof. Ralf Peters aus dem Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung, Bereich Elektrochemische Verfahrenstechnik (IEK-3). Dadurch kommt das Aggregat ohne zusätzliche Komponenten aus, mit denen ansonsten das Gas nach der Shiftreaktion noch weiter gereinigt werden müsste – Komponenten, die vor allem Platz und Gewicht kosten würden. In jede Komponente des Aggregats sind viel Jülicher Entwicklungsarbeit und Know-how geflossen: Der Reformer bei- spielsweise ist ein Jülicher Gerät der neunten Generation, in dem der Diesel besonders gut mit Luft und Wasserdampf durchmischt wird. „Bei der Brennstoffzelleneinheit standen wir vor allem vor zwei Herausforderungen, um die für ein Lkw-Aggregat erforderliche Leistung zu erreichen: Erstens mussten wir Zellen mit einer großen Fläche – 320 Quadratzentimeter – bauen, und zweitens mussten wir 70 dieser Zellen zu einem zuverlässig arbeitenden Stapel verbinden“, sagt Prof. Werner Lehnert, ebenfalls vom IEK-3. WETTLAUF DER SYSTEME Die vorteilhafte geringe Empfindlichkeit der HT-PEFC gegenüber Kohlenmonoxid ist eine Folge der Betriebstemperatur von 160 bis 180 Grad Celsius, bei der dieser Brennstoffzellentyp arbeitet. Ihr verdankt er auch den Zusatz „Hochtemperatur“, denn herkömmliche PEFC haben eine Betriebstemperatur von lediglich 60 bis 80 Grad. Andererseits ist die Bezeichnung „Hochtemperatur“ insofern irreführend, weil es andere Brennstoffzellentypen gibt, die bei weit höheren Temperaturen arbeiten. Einer davon ist die Festoxid- brennstoffzelle (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) mit Betriebstemperaturen von 700 Grad. Auch diese Technologie ist als Lkw-Hilfsstromaggregat im Rennen: So sind Jülicher Wissenschaftler an einem Projekt beteiligt, in dem Unternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam entsprechende Systeme bis zur Marktreife entwickeln. Ob HT-PEFC oder SOFC am Ende die Nase vorn haben werden, ist ungewiss. „Für die HT-PEFC spricht jedenfalls, dass sie nur zehn Minuten lang aufgewärmt werden muss, während die SOFC deutlich länger braucht“, so Lehnert. Die Forscher streben an, möglichst mit Industriepartnern ein HT-PEFC-Demonstrationssystem aufzubauen, das kleiner und kompakter ist als das jetzige Aggregat. In beiden Varianten sollen die Brennstoffzellenaggregate künftig Wirkungsgrade von 35 bis 40 Prozent erreichen. Sie sind damit effizienter und klimafreundlicher als Dieselaggregate und laufen zudem nahezu geräuschlos. :: Dr. Frank Frick Rückzugsort Fahrerkabine: In Ruhepausen unterwegs ist sie für Fernfahrer Küche, Büro und auch Schlafzimmer. 3 | 2013 Forschen in Jülich 13 Der unterschätzte Klimafaktor Im Fokus der Forscher: Emissionen von Dieselfahrzeugen sowie primitiven Kochstellen und Heizöfen Schwarzer Kohlenstoff beeinflusst die globale Erwärmung deutlich stärker als bislang angenommen – im Vergleich zu bisherigen Schätzungen wärmen Rußpartikel die Luft ungefähr doppelt so stark. Daraus ergeben sich aber auch neue Chancen, den Klimawandel zu bremsen. Zu diesen Ergebnissen ist eine internationale Forschergruppe gekommen, zu der auch Jülicher Wissenschaftler gehören. Ihre Erkenntnisse sind in den Klimabericht der Vereinten Nationen eingeflossen, den IPCC-Report 2013. R uß wird fast überall auf der Welt in die Luft gepustet. Er entsteht, wenn fossile Brennstoffe nicht vollständig verbrannt werden, etwa Holz und Kohle. In Industrieländern produzieren insbesondere Dieselmotoren Rußemissionen. Auch Heizöfen sowie einfache Herdstellen in ländlichen Gebieten Asiens und Afrikas tragen zu den Emissionen bei. Als Brennmaterial wird dort nicht nur Holz eingesetzt, sondern auch Pflanzenreste oder Kuhdung. „Tatsächlich sind es neben Wald- und Savannenfeuern die traditionellen primitiven Öfen, die den Hauptteil der Emissionen ausmachen“, erklärt Dr. Martin Schultz vom Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-8). Er hat sich im Rahmen dieser Studie insbesondere mit den Emissionen aus der Verbrennung von Biomasse beschäftigt. Vier Jahre lang haben sich die Wissenschaftler mit der komplexen Rolle des schwarzen Kohlenstoffs im Klimasystem auseinandergesetzt, Klimamodelle wei- 14 terentwickelt und diese mit verschiedenen Messergebnissen verglichen. Die Schwierigkeit: Rußpartikel wirken sich ganz unterschiedlich auf das Klima aus. Wenn sie vom Wind in der Atmosphäre verteilt werden, absorbieren und streuen sie zum Beispiel die Sonnenstrahlung und beeinflussen die Bildung von Wolken. Fällt der schwarze Kohlenstoff später etwa auf Eis und Schnee, dann beschleunigt das den Schmelzprozess. Außerdem kann Ruß auch die Klimaauswirkungen von Schadstoffen verändern, die gemeinsam mit ihm entstehen, wie Schwefeldioxid. ERWÄRMUNG KURZFRISTIG BREMSEN Einige dieser Prozesse sorgen für eine Abkühlung, andere wiederum für eine Erwärmung des Klimas. Unter dem Strich kommen die Wissenschaftler aber zu dem Schluss, dass Ruß mehr zu der vom Menschen verursachten Erwärmung beiträgt als Methan oder Lachgas. Lediglich Kohlendioxid rangiert noch vor dem schwarzen Kohlenstoff. „Man muss aber genau abwägen, welche möglichen Maßnahmen dem Klimaschutz helfen und welche nicht“, betont der Jülicher Forscher. Die Wissenschaftler empfehlen daher, nicht alle Rußquellen in Angriff zu nehmen, sondern zunächst einmal den Rußausstoß von Dieselmotoren sowie von häuslichen Holz- und Kohlefeuern zu reduzieren. Das könnte die globale Erwärmung aus ihrer Sicht zumindest kurzfristig bremsen – im günstigsten Fall um bis zu einem halben Grad Celsius. Zum Vergleich: Ziel der internationalen Klimapolitik ist es, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen. Auch die Gesundheit der Menschen würde von weniger Rußemissionen profitieren. So gilt Dieselruß als Erreger von Lungenkrebs. :: Christian Hohlfeld Forschen in Jülich 3 | 2013 FORSCHUNG IM ZENTRUM | Klimaforschung Die Ozonschicht über der Arktis erholt sich. Bis Ende des Jahrhunderts könnte sie komplett wiederhergestellt sein, prognostiziert eine internationale Forschergruppe mit Jülicher Beteiligung. Allerdings droht eine neue Gefahr: der Klimawandel. V ier Jahre lang untersuchten Wissenschaftler aus 14 Ländern im EU-Projekt RECONCILE den chemischen Prozess der Ozonzerstörung. Sie konnten nachweisen, dass tatsächlich Chlorverbindungen dafür verantwortlich sind. Damit wurde eine 2007 erschienene Studie widerlegt, die die Rolle der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) bei der Zerstörung indirekt infrage gestellt hatte. „Das Montrealer Protokoll hat sich bewährt“, betont der Jülicher Umweltchemiker Dr. Marc von Hobe. In dem Protokoll von 1987 haben sich über 190 Staaten verpflichtet, die Emissionen von chlorhaltigen Chemikalien wie FCKW zu reduzieren. Inzwischen hat Chlor in der Stratosphäre sichtbar abgenommen. Das belegen Analysen von Luftproben, die im Rahmen von RECONCILE genommen wurden. Allerdings dauert der Abbauprozess länger, als die Wissenschaftler erwartet haben. Und nun kommt mit dem Klimawandel die nächste Herausforderung auf die Ozonschicht zu. Klimaveränderungen könnten die Temperatur, die Zirkulationsmuster und die Chemie der Stratosphäre verändern. Das beeinflusst auch die Ozonschicht, deren Dicke sich wiederum auf die Temperatur auswirkt. Aus Sicht 3 | 2013 Forschen in Jülich von Marc von Hobe ein Grund mehr, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren und so den Klimawandel zu stoppen. EIN NEUES VERSTÄNDNIS Dank RECONCILE wissen Forscher nun mehr über den Abbau von Ozon und die Entstehung von Ozonlöchern. Beispielsweise haben die Resultate des Projekts das Verständnis von Polaren Stratosphärischen Wolken (PSCs) komplett verändert. Diese Wolken bilden sich unter bestimmten Bedingungen bei Temperaturen unter minus 80 Grad Celsius in der Stratosphäre. An ihren Oberflächen werden die Chlorreaktionen in Gang gesetzt, die das Ozon zersetzen. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich PSCs sehr viel schneller und bei höheren Temperaturen bilden als bislang angenommen. Durch die neuen Erkenntnisse konnten die Wissenschaftler bestehende Klimamodelle verbessern. Damit lässt sich die künftige Entwicklung der Ozonschicht zuverlässiger vorhersagen – und gleichzeitig auch die möglichen Folgen der Klimaveränderungen für die Stratosphäre. RECONCILE Die Europäische Union hat RECONCILE ab 2009 mit 3,5 Millionen Euro aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm gefördert. Die Forscher führten zahlreiche Laborexperimente, Messungen vor Ort und Computersimulationen durch. Wichtige Erkenntnisse beruhen auf Daten und Proben, die die Wissenschaftler mit dem Forschungsflugzeug M55 Geophysica über der Arktis sammelten. 2013 wurde das vom Forschungszentrum Jülich koordinierte Projekt erfolgreich abgeschlossen. Spezialisten unter sich: Marc von Hobe und die M55 Geophysica. Die russische Maschine ist eines von drei Flugzeugen weltweit, das in Höhen von bis zu 21 Kilometern vordringen kann. Christian Hohlfeld 15 MenschenmENGE „Drängeln erlaubt“ war das Motto eines der größten Experimente seiner Art. In der Messe Düsseldorf lotsten Jülicher Forscher an vier Tagen insgesamt 2.000 Fußgänger durch verschiedene Szenarien. Das Ziel: Die Eigendynamik großer Menschenmassen besser zu verstehen und so die Sicherheit von Großveranstaltungen zu erhöhen. Die Experimente waren Teil des BaSiGo-Projektes, kurz für „Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen“. In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt sammeln Jülicher Forscher unter anderem Daten für ein Modell, das durch Computersimulationen Fußgängerströme vorausberechnet. Es soll Teil eines modularen Sicherheitskonzepts sein, das auf jede Großveranstaltung individuell angewendet werden kann und in Zusammenarbeit mit neun Projektpartnern aus Wissenschaft, Feuerwehr, Polizei und Industrie aufgebaut wird. VON EINEM HEBEWAGEN AUS schauen Prof. Armin Seyfried und Stefan Holl zu, wie Hunderte von Fußgängern durch einen Versuchsaufbau gehen. Die beiden Jülicher Wissenschaftler leiten die mehrtägigen BaSiGoExperimente in der Messe Düsseldorf. Diese gehören zu den größten Versuchen mit Menschenmassen überhaupt. Das Ziel ist es, so Holl, „grundsätzliche Werte zur Fußgängerdynamik“ zu messen. 16 Forschen in Jülich 3 | 2013 FORSCHUNG IM ZENTRUM | Simulation BEIM KREUZUNGSEXPERIMENT strömen die Probanden von vier Seiten auf eine Kreuzung und versuchen, sie geradewegs zu passieren. Bei etwa 100 Teilnehmern im Kernbereich der Kreuzung endete dies im Stillstand, woraufhin der Versuch per Trillerpfeife abgebrochen werden musste. AUF NEUN MONITOREN beobachten die Wissenschaftler die Experimente aus allen Perspektiven. Ihre Arbeit ist damit aber noch längst nicht zu Ende: „Wir haben 42 Terabyte Daten gesammelt. Daraus werden einige Dissertationen entstehen“, so der Jülicher Forscher Stefan Holl. Eines der Ziele der Wissenschaftler ist es, ein Modell zu kreieren, mit dem man simulieren kann, wie sich Menschenmassen auf einer Großveranstaltung bewegen. Gefährliche Situationen lassen sich so vorhersehen – und damit auch verhindern. DIE WEISSEN FISCHERMÜTZEN spielen eine wichtige Rolle: Mithilfe des QR-Codes auf ihnen lässt sich jeder Laufweg jeder Person auf den Zentimeter genau nachvollziehen. 24 Kameras an der Decke zeichnen die Versuche auf. EINER VON 30 VERSUCHSAUFBAUTEN: Der Barrier. Auf diesem Bild strömen die Probanden in einen abgesperrten Bereich hinein – um ihn anschließend wieder zu verlassen. Die Forscher messen so, ab welcher Dichte innerhalb der Menschenmenge sich einzelne Fußgänger noch individuell bewegen können. Dabei haben sie die Dichte stufenweise erhöht. Bei sechs Personen je Quadratmeter ist es dann kaum noch möglich, die Menschenmenge zu verlassen. Und dies, obwohl die Experimente unter Idealbedingungen stattfanden. Die Forscher empfehlen Veranstaltern deshalb, solch hohe Dichten zu vermeiden. 3 | 2013 Forschen in Jülich AUFSCHLUSSREICH war auch der Befund des Projektpartners von der Universität Siegen. Gebhard Rusch, Professor für Medienwissenschaften, hat versucht, die Fußgängerströme „durch minimal-invasive Eingriffe zu optimieren“. Ein Display zeigte ein Kreisverkehrsschild vor dem Zugang zur Kreuzung. Zunächst haben die Teilnehmer das Schild zwar ignoriert, doch nach einem Hinweis „waren wir in einer ganz anderen Welt“, so Rusch. Die Fußgänger passierten die Kreuzung, der Fluss blieb auch bei höheren Dichten erhalten. Christoph Mann 17 Reifen, Reibung und schlaue Rechnungen Autofahrer wünschen sich Reifen, die Sprit sparen, bei jedem Wetter sicher sind und möglichst langsam verschleißen. Und Produzenten wünschen sich, solche Reifen zielgerichtet am Computer entwickeln zu können, ohne dafür Abertausende von Gummimischungen und Testreifen herstellen zu müssen. Jülicher Forscher arbeiten daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. N achdem beim Formel-1-Rennen in Silverstone am 30. Juni gleich von vier Wagen spektakulär Reifen zerplatzten, zitierten Nachrichtenagenturen Paul Hembery, den Motorsportdirektor des Reifenherstellers: „Wir haben etwas gesehen, das wir nicht verstehen.“ Tatsächlich ist das Entwickeln von Reifen auf bestimmte Ansprüche hin nicht nur in der Formel 1 immer noch von auf wendigen Versuchsreihen geprägt – und weniger von der Einsicht in die komplizierten Zusammenhänge zwischen Gummimischungen und den Eigenschaften des Reifens. Auf dem besten Wege, dies zu ändern, sind die Jülicher Wissenschaftler Dr. Bo Persson und Dr. Boris Lorenz. Namhafte Reifenhersteller weltweit beachten ihre Arbeit. Befeuert wird das Interesse der Reifenhersteller durch eine EU-Verordnung, die seit November 2012 in Kraft ist: Danach müssen sie ihre Reifen mit einem Etikett versehen, das jeden Verbraucher auf einen Blick erkennen lässt, wie gut der Reifen bei Nässe auf der Straße haftet, wie er sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt und wie laut er rollt. „Selbstverständlich verstärken die Hersteller dadurch noch einmal ihre Anstrengungen, ihre Produkte auf diese Kriterien hin zu optimieren“, sagt Maschinenbauingenieur Lorenz. Und der Schlüssel zu dieser Optimierung ist es, die Haftreibung von Gummi erklären und aus Basisdaten errechnen zu können. Mit diesem Ziel trat Persson vor rund 15 Jahren erstmals an. Damals entwickelte der Physiker eine völlig neuartige Theorie dazu, wie groß die reale Berührungsfläche ist, wenn zwei Körper miteinander in Kontakt kommen. Im speziellen Fall geht es dabei um den Kontakt zwischen Reifen und Straße. Die Frage ist aber unter anderem auch für die Funktionsfähigkeit von technischen Dichtungen bedeutsam. Perssons Credo: Bei der Berechnung der wahren Kontaktfläche zweier Körper Entwickelte eine Apparatur, mit der sich die Reibung von Reifengummi ermitteln lässt: Dr. Boris Lorenz. 18 muss man die Rauigkeit der jeweiligen Flächen auf vielen Längenskalen – vom tausendstel Millimeter bis zum Zentimeter – berücksichtigen. Konkret hat Persson in Analogie zur Mikroskopie einen „Vergrößerungsfaktor“ in seine Theorie eingeführt, um die Rauigkeit in immer kleineren Dimensionen zu betrachten. PROGRAMM BERECHNET REIBUNG Anschließend ließ Persson seine Überlegungen zur Kontaktmechanik in eine ebenfalls neue Theorie der Gummireibung einfließen. Diese überführte er in ein Computermodell. Das Programm läuft auf einem normalen PC, weil es sich um ein analytisches und nicht um ein numerisches Modell handelt, also eines mit Gleichungssystemen, die exakt lösbar sind und keine Näherungen benötigen. Die Wissenschaftler geben dem Computer neben der gut messbaren Rauigkeit der Straße einige wenige Daten zur Elastizität und zum Temperaturverhalten der betrachteten Gummimischung ein. Daraus berechnet das Programm die Haftreibung des Reifens auf der Straße, unter anderem in Abhängigkeit vom sogenannten Schlupf: Beim Bremsen beispielsweise dreht sich der Reifen etwas langsamer, als es der Geschwindigkeit des Fahrzeuges entspricht. Der Reifen gleitet somit über die Fahrbahn, wobei der Anteil dieses Gleitens als Schlupf bezeichnet wird. Eine solche Theorie wie die von Persson steht und fällt damit, ob die berechneten Werte mit den Werten übereinstimmen, die in der Praxis gemessen Forschen in Jülich 3 | 2013 FORSCHUNG IM ZENTRUM | Materialforschung werden. Daher haben die Jülicher Forscher eine Apparatur entwickelt, um die Reibung von Gummireifen auf Straßenasphalt bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu ermitteln. Ihre jüngsten Resultate, die sie zusammen mit Wissenschaftlern des Reifenherstellers Bridgestone erzielten, haben sie kürzlich veröffentlicht. Auch im Motorsport ist die Entwicklung von Reifen mit aufwendigen Versuchen verbunden. Zukünftig könnten Computermodelle die perfekte Gummimischung berechnen. THEORIE BESTÄTIGT Das Ergebnis passt zur Theorie von Persson. Abhängig von der Geschwindigkeit bestimmen unterschiedliche Faktoren die Reibung und damit die Reifenhaftung: „Unterhalb einer Schlupfgeschwindigkeit von rund einem Zentimeter pro Sekunde wird die Reifenhaftung vorrangig durch die wahre Kontaktfläche bestimmt. Bei schnelleren Geschwindigkeiten ist stattdessen vor allem die Viskoelastizität des Gummis wichtig“, fasst Lorenz eine wesentliche Erkenntnis zusammen. Im Alltag auf der Straße sind beide Faktoren bedeutsam: Bei einer ABS-Bremsung beispielsweise bleibt der Reifen bei geringstem Schlupf zunächst kurz auf der Straße haften, bevor er mit Schlupfgeschwindigkeiten bis zu einem Meter pro Sekunde zu rutschen anfängt. Viskoelastische Materialien sind elastisch wie Feststoffe und zeigen zugleich das zähfließende Verhalten von Flüssigkeiten. Warum diese Eigenschaft des Gummis überhaupt die Reifenhaftung beeinflusst, erklären die Forscher so: Der Reifen ist an den kleinen Unebenheiten des Asphalts Stößen ausgesetzt. Diese führen dazu, dass der Reifen nachgibt und sich eindellt, wodurch sich die Moleküle in ihm gegeneinander bewegen. Dabei verbrauchen sie kurzzeitig Energie. Letztlich verlangsamt dieser Energieverlust die Bewegung des Reifens auf der Straße: Er haftet besser. Künftig möchten die Jülicher Wissenschaftler vor allem ihre theoretischen Vorhersagen zur Haftung auf nassen Straßen oder bei hohen Schlupfgeschwindigkeiten anhand verschiedener Gummimischungen überprüfen. Eines Tages wird dann möglicherweise in der Welt der Reifen der Zufallsfaktor keine entscheidende Bedeutung mehr haben – auch nicht bei den Reifen in der Formel 1. :: Dr. Frank Frick 3 | 2013 Forschen in Jülich 19 Die Stimme als Türöffner Es gibt Menschen, denen leiht man spontan den Rasenmäher oder das Auto. Anderen dagegen nicht. Vertrauen entsteht durch blitzschnell verarbeitete Eindrücke in unserem Gehirn. Ein Lächeln oder ein Blick genügen. Aber auch ein Satz, wie Jülicher Neurowissenschaftler bei einem Forschungsprojekt zum Beurteilen von Stimmen unlängst bestätigt fanden. Offenbar gibt es im Gehirn eine Art zentrale Schlüsselregion für soziale Bewertungen, die bei der Beurteilung von Gesichtern, aber auch Stimmen, aktiv wird. B Vertrauenswürdig oder mit Vorsicht zu genießen? Attraktiv oder unsympathisch? Ein Blick oder auch ein gesprochenes Wort genügt uns … 20 arack Obama, Meryl Streep oder Nachrichtensprecher Claus Kleber besitzen sie – Stimmen, die von vielen Menschen als sympathisch wahrgenommen werden. Ein unschätzbarer Vorteil, wie Prof. Simon Eickhoff weiß: „Eine Stimme, die vertrauensvoll und attraktiv klingt, ist ein Türöffner im Beruf und Privatleben“, so der Mediziner, der in Jülich am Institut für Neurowissenschaften und Medizin forscht und parallel eine Professur für Kognitive Neurowissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat. Wissenschaftlich untersucht wurde bisher aber vorwiegend der Einfluss von Gesichtern. Im Rahmen eines Forschungsprojekts ließ der Neurowissenschaftler mit seinem Team daher 44 gesunde Erwachsene verschiedene weibliche und männliche Stimmen beurteilen. Die Probanden bekamen im funktionellen Magnetresonanztomografen (fMRT) einfache Alltagssätze wie „Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist“ zu hören und mussten diese hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit, Fröhlichkeit, Attraktivität und Alter beurteilen. Parallel dazu wurden von ihren Gehirnaktivitäten im Zwei-Sekunden-Takt Aufnahmen gemacht. Interessanterweise war bei den Probanden immer dieselbe Hirnregion, und zwar der sogenannte dorsomediale Präfrontalkortex, aktiv. „In diesem Bereich beurteilen wir Gesichtsausdrücke“, sagt Simon Eickhoff. „Mit der Erkenntnis, dass auch Stimmen hier Forschen in Jülich 3 | 2013 FORSCHUNG IM ZENTRUM | Neurowissenschaften Prof. Simon Eickhoff hat untersucht, welche Hirnareale aktiv sind, wenn Menschen Stimmen beurteilen. eingeschätzt werden, bestätigte sich unsere These, dass dies eine Schlüsselregion für soziale Bewertungen im menschlichen Gehirn sein muss.“ LEBENSNOTWENDIGE STEUERUNG Was im 21. Jahrhundert für private und berufliche Kontakte und Beziehungen wichtig erscheint, ist auch aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive bedeutsam: „Die sozial-kognitiven Urteile etwa über die Vertrauenswürdigkeit einer Person sind als Warnhinweise neben Grundemotionen wie Angst oder Ekel ausschlaggebend dafür, dass der Mensch überlebt“, erläutert Eickhoff. Ob Höhlenmensch oder Firmenchef: Die Wahl der Partner war und ist für die eigene Existenz entscheidend – zur Jäger- und Sammlerzeit wie im 21. Jahrhundert. Den langfristig relevanten Einschätzungen im dorsomedialen Präfrontalkortex stehen die Beurteilungen von spontanen Gefühlsregungen in anderen Hirnregionen gegenüber: „Ob ein Mensch gerade traurig oder fröhlich ist, beurteilen wir unter anderem in der Amygdala“, erläutert Simon Eickhoff. Zur Verarbeitung dieser Grundemotionen gibt es nach Aussagen des Wissenschaftlers bereits zahlreiche Studien. Die Forschung über die sozial-kognitiven Entscheidungsprozesse – etwa ob wir einem Menschen vertrauen oder nicht – hingegen stecke noch in den Anfängen. Das Wissen über die unterschiedlichen Entscheidungsareale hilft unter anderem, psychiatrische Erkrankungen wie 3 | 2013 Forschen in Jülich die Depression oder den Autismus weiter zu erforschen. Beim Autismus, der von der Weltgesundheitsorganisation zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gerechnet wird und bisher unheilbar ist, haben Betroffene Probleme, sich mit anderen auszutauschen. „Autisten haben beispielsweise Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Sie erwidern häufig kein Lächeln oder können Gefühle wie Wut oder Trauer bei anderen schwer einschätzen“, erklärt Eickhoff. Wissenschaftlich bekannt ist, dass das dafür erforderliche Hineinversetzen in ein Gegenüber ebenfalls im dorsomedialen Präfrontalkortex abläuft. Um die neurobiologischen Ursachen dieser und anderer psychiatrischer Erkrankungen besser zu verstehen, hat der Mediziner bereits Folgeprojekte geplant, mit denen die Hirnstruktur und die Vernetzung verschiedener Hirnareale bei Patientinnen und Patienten analysiert werden sollen. „Wir möchten untersuchen, ob die Hirnstruktur als solche gestört ist, die Interaktion des dorsomedialen Präfrontalkortex mit anderen Hirnarealen abweichend verläuft oder auch beides der Fall ist“, so der Neurowissenschaftler. Die Erkenntnisse können dazu beitragen, Behandlungsmöglichkeiten gezielt zu verbessern. :: Ilse Trautwein … um zu einer Einschätzung unseres Gegenübers zu gelangen – als stünden ihm seine Wesenszüge ins Gesicht geschrieben. 21 Forschen im Forst I n einem Wald sollte nur so viel Holz geschlagen werden, wie auch nachwächst. Was wie eine aktuelle Empfehlung von Umweltschutzorganisationen klingt, wurde tatsächlich schon vor 300 Jahren angemahnt. Hans Carl von Carlowitz, ein Oberberghauptmann aus Freiberg in Sachsen, hielt diesen Grundsatz in seiner 1713 erschienenen Schrift „Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht“ fest. Von Carlowitz gilt damit als Begründer des Nachhaltigkeitsprinzips. So mancher Wald fiel bis Ende des 19. Jahrhunderts dem Holzbedarf des Menschen zum Opfer. Die Idee, mit gezielter Waldbewirtschaftung und Aufforstung gegenzusteuern, setzte sich aber im Lauf der Zeit durch – auch in der Region des heutigen Nationalparks Eifel. Allerdings pflanzten die Forstverwaltungen nicht wieder die einheimischen Laubbäume, sondern Fichten, da diese schneller wachsen. Heute weiß man jedoch, dass die Laubbäume heimischen Pflanzen und Tieren günstigere Lebensbedingungen bieten. Der Nationalpark hat daher vor kurzem begonnen, seinen Fichtenbestand wieder in einen Laubmischwald umzuwandeln. Im Gebiet rund um den Wüstebach begleiten Jülicher Forscher und ihre Kollegen die Renaturierung wissenschaftlich. Dabei untersuchen sie erstmals langfristig und kontinuierlich, welche Auswirkungen ein solcher Prozess etwa auf den Wasser-, Kohlenstoff- und Stickstoffhaushalt hat. Dazu haben sie vor Beginn der Forstarbeiten an rund 175 Stellen Bodenproben genommen, die sie mit künftigen Messungen vergleichen werden. Die Ergebnisse sind auch für den Natur- und Klimaschutz in anderen Ländern von Interesse, in denen Nadelwälder abgeholzt werden. Die Untersuchungen sind Teil des Großprojekts TERENO (Terrestrial Environmental Observatories), in dem Jülicher Wissenschaftler vom Institut für Bio- und Geosphäre (Bereich Agrosphäre) mit Kollegen aus Deutschland die regionalen Folgen des Klimawandels erforschen. :: 1 2 3 22 Forschen in Jülich 3 | 2013 SCHLUSSPUNKT IMPRESSUM 4 5 6 7 Forschen in Jülich Magazin des Forschungszentrums Jülich, ISSN 14337371 Herausgeber: Forschungszentrum Jülich GmbH | 52425 Jülich Konzeption und Redaktion: Annette Stettien, Dr. Barbara Schunk, Dr. Anne Rother (V.i.S.d.P.) Autoren: Dr. Frank Frick, Christian Hohlfeld, David Kreienbruch, Christoph Mann, Tobias Schlößer, Dr. Barbara Schunk, Brigitte Stahl-Busse, Ilse Trautwein, Angela Wenzik Grafik und Layout: SeitenPlan GmbH, Corporate Publishing, Dortmund Bildnachweis: CHEN WS/ Shutterstock.com (19), DenisNata/ Shutterstock.com (13 u. Tasse), erichon/Shutterstock.com (14 r.), Forschungszentrum Jülich (2, 3 r., 4, 5 u., 9 r., 10 o., 11 o., 13 o., 15 r., 18, 21 o., 22-23), Forschungszentrum Jülich/Arndt Lorenz (15 Hintergrund), Forschungszentrum Jülich/Marc Strunz-Michels (16 u. r., 17 o. u. m.), Forschungszentrum Jülich/Ralf Eisenbach (3 m., 16 o. u. u. l., 17 u.), illuteam43 (8), imging/Shutterstock. com (20), iStockphoto/Thinkstock (14 l.), Krivosheev Vitaly/Shutterstock. com (12-13 Hintergrund), Lightspring/ Shutterstock.com (1, 3 l., 6-7, 10-11 Hintergrund), Melianiaka Kanstantsin/ Shutterstock.com (5 o.), Oleg Babich/ Shutterstock.com (3 l. Lupe), R Carner/Shutterstock.com (13 u.), Ryan Jorgensen - Jorgo/Shutterstock.com (21 u.) Kontakt: Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation | Tel.: 02461 61-4661 | Fax: 02461 61-4666 | E-Mail: [email protected] Druck: Schloemer Gruppe GmbH Auflage: 6.000. Print kompensiert Id-Nr. 1331722 www.bvdm-online.de Großeinsatz im Wald: Jülicher Wissenschaftler nehmen Bodenproben, bevor die Fichten am Wüstebach im Nationalpark Eifel einheimischen Laubbäumen weichen müssen. 1. Kraftvoll: Alexander Graf (l.) und François Jonard drücken eine Rammsonde in den Boden. | 2. Eingetütet: Alle Proben werden verpackt und beschriftet. | 3. Handarbeit: Lutz Weihermüller befüllt sogenannte Kopecky-Ringe, um bodenphysikalische Parameter zu bestimmen. | 4. Erfasst: Werner Küpper bringt Proben zur Registrierung. | 5. Frisch gezogen: Nina Gottselig mit einem Probenrohr, einem sogenannten Liner. | 6. Tief gebuddelt: Aus bis zu einem Meter Tiefe werden Proben genommen, hier durch Anne Berns (l.) und Lutz Weihermüller. | 7. Suppenküche: Gemeinsam stärken sich die Forscher. Sie haben an rund 175 Stellen Proben aus bis zu einem Meter Tiefe entnommen. 3 | 2013 Forschen in Jülich 23 Holen Sie sich das Magazin aufs Tablet! „Forschen in Jülich“ gibt es auch als App. Einfach mit dem Tablet den QR-Code scannen oder über unsere Internetseite aufrufen: www.fz-juelich.de/app Mitglied der: App Store (iPad/iOS) Google Play (Android)